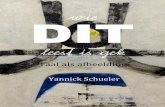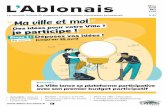Wie digitaal wil zijn, moet leiden - De Vlaamse ScriptieBank
Verwöhnte Gaumen, hungrige Mäuler - wie Konstanz seine Gäste versorgte
Transcript of Verwöhnte Gaumen, hungrige Mäuler - wie Konstanz seine Gäste versorgte
Roman Sigg
Verwöhnte Gaumen, hungrige Mäuler –wie Konstanz seine Gäste versorgte
Nicht im Handel
Beitrag aus:
Silvia Volkart (Hrsg.)
Rom am Bodensee
Die Zeit des Konstanzer Konzils
Zürich, 2014, S. 135−144
Verlag Neue Zürcher Zeitung
˜135
IV • Das Konzil von Konstanz 1414 –1418 – Schlaglichter auf Ereignisse und Alltägliches
VERWÖHNTE GAuMEN, HuNGRIGE MäuLER – WIE KONSTANZ SEINE GäSTE VERSORGTE
Eine Herausforderung für die Konzilsstadt war die Versorgung der vielen Tausend Gäste mit Nah-rungsmitteln. Könige, Kardinäle und Bischöfe wollten mit Luxusprodukten und erstklassigen Weinen verwöhnt werden. Knechte, Liebesdienerinnen und Gaukler, aber auch die vielen Pferde und Maultiere der hohen Herrschaften benötigten täglich Esswaren und Futter. Wie die Stadt und ihr Umland diese Aufgabe meisterten und das Problem der explodierenden Preise für Güter in den Griff bekamen, ist bemerkenswert.
Mit Konrad von Weinsberg auf dem Markt
Im Januar 1418 sah sich Reichserbkämmerer Konrad von Weinsberg, zuständig für die Finan-zen und die Versorgung des römisch-deutschen Königs, wieder einmal vor eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt. Er hatte seinen Herrn, König Sigismund, zu Gast. Konrad machte sich also auf den Weg zum Konstanzer Markt, um die Speisen für den verwöhnten Gaumen des Königs und der übrigen Gäste zu besorgen. Die Überlieferung in der Konzilschronik des Ulrich Richental, ins-besondere die Illustrationen, bieten eine ungefähre Vorstellung des Markttreibens von damals. Konrad konnte Brot und Pasteten bei fahrenden Bäckern kaufen. Er fand ein grosses Angebot an Fisch und Fleisch vor. Auch Exotisches liess sich erwerben. Peter von Dieburg, der Knecht Kon-rads, kaufte in Konstanz für das königliche Abendessen ein. 344 Die nachfolgende Einkaufsliste zeigt eine Mischung aus lokalen und importierten Erzeugnissen: Olivenöl, Hering, Stockfisch, Reis, Gewürze und Wein wurden aus Norden und Süden herangeschafft. Diese Lebensmittel gab es in Konstanz nicht nur zur Konzilszeit zu kaufen. Sie waren auch sonst im Angebot.
• Fische: drei Hechte, drei Karpfen, Grundeln und Krebse, Heringe, Stockfisch und Bratfisch • Geflügel: zwei Truthennen 345 • Gewürze: Macis (Muskatblüte), Gewürznelken, Kümmel, Senf• Olivenöl• Reis• Gemüse: Kohl (Kraut = Sauerkraut?), Zwiebeln• Birnen• Käse• Wein aus dem Elsass, Norditalien und Griechenland• Branntwein• Konfekt (aus Honig oder Zucker, Eiweiss sowie Gewürzen)
Roman Sigg
136˜
77 Ein Fischhändlerstand während des Konstanzer Konzils. Zeichnung koloriert. Konstanzer Handschrift der Richental-chronik, um 1465. Rosgartenmuseum Konstanz, Hs.1, fol. 25l.
˜137
IV • Das Konzil von Konstanz 1414 –1418 – Schlaglichter auf Ereignisse und Alltägliches
Ein Blick in die KücheDoch welche Speisen wurden aus dem Eingekauften zubereitet? Fleisch und Fisch wurden
gebraten und gesotten und mit einer Gewürzsosse serviert. Die übliche Beilage für die gehobe-nen Bevölkerungsschichten bestand aus Weissbrot oder Getreidebrei. In diesem Fall wurde statt-dessen vermutlich gekochter Reis, ein ausgesprochenes Luxusprodukt, serviert. Essen war im Mittelalter auch ein kommunikativer Akt. Man zeigte, was man sich leisten konnte: «Der Mensch ist, was er isst.» 346 Im Rahmen der Ständelehre des Mittelalters wurde definiert, welches Essen für welche Schicht angemessen war. Im Meier Helmbrecht von Werner dem Gärtner, einem Text aus dem Hochmittelalter, zeigt eine illustrative Gegenüberstellung Herren- und Bauernspeisen. Ritter assen Weissbrot, Bauern Roggen- oder Haferbrot; für die Herren gab es gesottenes Huhn, die Bauern nahmen mit Getreidebrei vorlieb.
Welche Gerichte die Menschen im Einzelnen genau gegessen haben, lässt sich kaum eruie-ren, da nur wenige Kochrezepte – vor allem aus Klöstern – überliefert sind. Diese behandeln die eher gehobene Küche und sind bei den Angaben über die Art der Zubereitung und die Menge der
78 Die Verpflegung der Papstwähler während des Konklaves im November 1417. Zeichnung koloriert. Konstanzer Hand-schrift der Richental-chronik, um 1465. Rosgartenmuseum Konstanz, fol. 95r.
Zutaten nur summarisch. Mehl wurde zu Getreidebrei, dem Mus, verarbeitet. Dieser Brei aus Was-ser, Milch, Mehl und Salz war das Grundnahrungsmittel breiter Bevölkerungsschichten. Durch die Verwendung von Eiern und Butter konnte er etwas aufgebessert werden, wie das folgende Re-zept aus Konstanz zeigt, das aus der Zeit zwischen 1450 und 1466 stammt: «Für einen Eierbrei machst du zuerst einen Dinkelbrei und schlägst die Eier darüber. Nimm geklärte Butter, schneid sie klein, gib sie in den Brei und rühr das stark, salze es und richte es an.»347
In der gehobenen Küche wurde aufwendiger gekocht. Ein Rezept für die Zubereitung von «an-gelegten Hühnern» aus dem östlichen Bodenseegebiet lautet: «Zu angelegten Hühnern: Nimm alte Hühner und pflück sie der Länge nach auseinander und schneid das Fleisch davon, so dass die Knochen zusammenbleiben. Und zerhacke das Fleisch und tu Brot dazu und Speck und Gewürz und lege es wieder an die Knochen und koch das, so hast du angelegte Hühner. Und leg die Haut darüber und befestige sie und koch sie dann gut. Auch gib Eier oder Petersilie oder andere Dinge darunter, hierzu wären auch kleine Weinbeeren gut.» 348
Der Thurgau als Kornkammer Die Versorgung der vielen Tausend Konzilsteilnehmer und ihrer Entourage war für Kon-
stanz eine enorme Herausforderung. Wenn man zeitgenössischen Quellen wie der Chronik Ul-rich Richentals Glauben schenkt, dann funktionierte die Versorgung relativ gut. Die Stadt besass durch die Lage am Bodensee eine ausgezeichnete Anbindung an den internationalen Handel. So brachte man viele der Luxuswaren bereits zuvor in die Stadt. Noch wichtiger war der Umstand, dass Stadt und Bischof auf eigene Ländereien zur Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Getreide zurückgreifen konnten. So wurde sehr viel Getreide aus dem Thurgauer Umland und dem schwäbischen Gebiet, das bis ins 19. Jahrhundert als Getreideanbaugebiet für die Schweiz wichtig war, eingeführt. Das Bistum Konstanz verfügte bereits von Anfang an über Herrschafts-besitz im Thurgau: Die Bischofshöri südlich der Stadt (Gottlieben, Tägerwilen, Landschlacht bis auf den Seerücken hinauf), Arbon und Bischofszell samt Umgebung wie auch der Hinterthurgau mit Tannegg und Fischingen bildeten bis zum Konzil die Herrschaftsschwerpunkte im Thurgau, dazu kam weiterer Streubesitz im Klettgau, im Aargau und am Hochrhein sowie am nördlichen Bodenseeufer. Aus all diesen Herrschaften trafen in Konstanz Abgaben in Form von Geld und Na-turalien ein. Das Einkünfteverzeichnis des Bischofs Heinrich von Klingenberg 1302/03 gibt einen Überblick über die Abgaben der einzelnen Herrschaften.349 Die folgende Aufstellung vermittelt einen Eindruck von den Getreideabgaben, daneben wurden auch Bohnen, Tiere (Hühner, Schafe, Schweine, Rinder, Fische), Käse, Eier, Pfeffer,350 Geld, Wachs und Leinwand eingenommen. So war die Gemeinde Gottlieben beispielsweise gemäss dem Urbar zur Abgabe von 13 200 Gangfischen verpflichtet.
138˜
˜139
IV • Das Konzil von Konstanz 1414 –1418 – Schlaglichter auf Ereignisse und Alltägliches
Herrschaft EinkünfteBischofshöri 118 Mütt Dinkel, 96 Mütt HaferTannegg (Hinterthurgau) 106 Mütt Dinkel, 174 Mütt HaferBischofszell 126 Mütt Dinkel, 135 Mütt HaferArbon 508 Mütt Dinkel
Total im Thurgau 858 Mütt Dinkel, 405 Mütt HaferTotale Einkünfte 2600 Mütt Dinkel,351 3060 Mütt Hafer
1 Mütt entspricht 113,2 Liter, 70 Kilogramm Dinkel oder 45 Kilogramm Hafer.
Die Thurgauer Besitzungen des Bistums Konstanz allein warfen gemäss Einkünfteverzeichnis ein Viertel der gesamten Dinkelerträge und etwas mehr als ein Achtel der Hafererträge ab. Ob diese Angaben genau in der im Urbar aufgezeichneten Form eingenommen wurden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Dass die Einnahmen an Getreide bedeutend gewesen sein müssen, lassen Bauten wie das bischöfliche Amtshaus in Schaffhausen erahnen, das unter anderem als Getreidespeicher diente.
Weine in verschiedenen PreislagenAls weiteres «Grundnahrungsmittel» galt der Wein, der im Mittelalter das Standardgetränk
der ganzen Bevölkerung war. Er war Nahrungs-, Stärkungs-, Arznei- und Genussmittel zugleich. Das Angebot an Weinen in Konstanz war gross. Die Reichen konnten sich teure Importweine leisten, während die Mittelschicht in der Regel die lokalen Produkte konsumierte und für die Armen nur noch der billige Nachwein (aus den Pressrückständen unter Zugabe von Wasser hergestellt) übrig
79 Nahrungsmittel für König Sigismund: Anlieferung eines in Salz gepökelten Tieres aus Litauen und von Weinfässern in einem Karren. Zeichnung koloriert. Konstanzer Handschrift der Richental-chronik, um 1465. Rosgartenmuseum Konstanz, Hs.1, fol. 70r.
140˜
80 Gastmahl König Sigismunds in ulm, 13. November 1430. Wie der Einkaufszettel Konrad von Weinsbergs belegt auch diese Darstellung, dass die königliche Tafel stets reich gedeckt war. Auf einem Podest unter einem baldachin sitzend lässt sich der Herrscher durch den Truchsess und den Mundschenk bedienen. Vor der Schranke tafelt die Hofge-sellschaft. Diebold-Schilling-chronik 1513. Eigentum Korporation Luzern, fol. 38r.
˜141
IV • Das Konzil von Konstanz 1414 –1418 – Schlaglichter auf Ereignisse und Alltägliches
blieb. In die Konzilsstadt wurden edle Tropfen aus dem Elsass, aus Oberitalien und sogar aus Grie-chenland angeliefert. Wie gross der Weinkonsum am Konzil war, kann man lediglich erahnen.
Um eine Vorstellung vom Weinkonsum am königlichen Hof zu erhalten, genügt ein Blick in die Buchhaltung des Kämmerers Konrad von Weinsberg. Überliefert sind Rechnungen, die dieser für König Sigismund bezahlt hat: Am 27. Mai 1417 bezahlte er Heinrich Ulmer 1000 fl. rh. (= rheini-sche Gulden) für Wein, dem Lieferanten Hans Schreiber 350 fl. rh.352 Am 20. September 1417 wird bestätigt, dass Heinrich Ulmer dem königlichen Kämmerer das edle Getränk im Wert von 660 fl. rh. geliefert hat, wovon der König noch 360 fl. rh. schuldig ist.353 Geliefert wurden 27 1 ⁄2 Fuder, das entspricht in Konstanzer Mass einer Lieferung von rund 4200 Liter Wein.354
Heu, Stroh und Holz In den Bereich der Versorgung gehörten auch Heu und Stroh für die Tiere in der Stadt. Die
hohen Herren waren in der Regel nicht zu Fuss nach Konstanz gewandert, sondern auf Pferden und Maultieren geritten. Heu wurde aus dem Thurgau, dem Hegau und dem Rheintal per Schiff und Karren nach Konstanz gebracht: «daz uf ainen tag stuond an der bruggen ze Costentz fünf und zwanzig michler schiff mit höw uss dem rintal und vil karren mit höw uss dem Turgöw und Hegöw.»355 Das Stroh und Schilf für die Einstreu kamen aus der näheren Umgebung der Stadt.
Zuletzt waren Holz und andere Brennstoffe zu beschaffen. Richental berichtet, dass das Holz auf Schiffen den Rhein hinauf oder über den See geschafft sowie aus dem Thurgau mit Karren in die Stadt geführt wurde. Die Versorgung mit Holz war gemäss Quellen unproblematisch. 356
Konstanz setzt HöchstpreiseTrotz der guten Versorgungslage in der Konzilsstadt erhoben sich aus den Reihen der Gäste
kritische Stimmen. Bei Ulrich Richental heisst es: «Am zwölften Tag als Hans von Schwarzach zum Bürgermeister ernannt wurde (d. i. der 18. Januar 1415), erschienen vor dem Konstanzer Rat die Botschafter des Papstes, des Königs und anderer Herren und meinten, dass die Unterkünfte zu teuer wären und die Versorgung mit Esswaren mangelhaft.» 357
So sah sich der Konstanzer Rat zeitweise gezwungen, die Lebensmittelversorgung und speziell die Unterbringung der Gesandten zu regeln. Er erliess Regeln über die Höchstpreise (vgl. S. 143). In der Folge kamen neben den einheimischen Händlern auch fremde Händler und Produzenten in die Stadt, die vom sicheren Absatz und den garantierten Preisen profitierten. So berichtet Richen-tal weiter, dass der Kauf von Brot kein Problem darstelle, da «man vil brotts uff karren, wägen und ze schiff bracht». Er erzählt auch von Bäckern mit transportablen Öfen und von Pastetenbäckern: «Die basteten waren ettlich mit hönr und flaisch gemacht und wol gewürtzt. Der fand man gnuog tze kofen [. . .].» 358
142˜
Höchstpreise waren besonders beim Grundnahrungsmittel Getreide nötig, da es die wichtigs-te Kalorienquelle der Bevölkerung war. Besonders Hafer war während des Konstanzer Konzils enorm gefragt. Normalerweise wurde Hafer als einfachstes der Getreide als Brei von der normalen Bevölkerung gegessen. Dass sich die Botschafter während des Konzils wegen der Haferknappheit beklagten,359 lag jedoch weniger an ihrem sozialen Gewissen als vielmehr daran, dass Hafer – wie auch heute noch – als wichtiges Pferdefutter diente. Pferde waren im Mittelalter nur für eine klei-ne Bevölkerungsschicht, beispielsweise die Fernhändler, notwendige Reittiere. Der Besitz von Pferden war ein Statussymbol von Adel und Klerus. Und so viele Pferde wie zur Zeit des Konzils gab es in Konstanz normalerweise nie.
Der Menüplan der Chorherren im Stift Kreuzlingen Vor seinem Einzug in die Konzilsstadt Konstanz übernachtete Papst Johannes XXIII. be-
kanntlich im Augustiner-Chorherrenstift Kreuzlingen. Welches Abendessen ihm damals ser-viert wurde, ist durch zeitgenössische Quellen nicht überliefert. Das Kreuzlinger Küchenbuch, das etwa 300 Jahre nach dem Konzil verfasst wurde, gibt jedoch eine ungefähre Vorstellung von der Speisenfolge.360 Das Buch beschreibt für die verschiedenen Personengruppen aus dem Umfeld des Klosters die aufzutragenden Speisen für Fest-, Fleisch- und Fasttage und legt fest, wer welche Speisen wann und wo konsumieren durfte. Zwar heisst es dort, dass man nicht genau vorschrei-ben könne, was einem besonderen Gast alles geboten werde. Es dürfe aber auf keinen Fall zu we-nig sein. Neben den üblichen Fleischsorten sollten auch Wild, Vögel, Kapaun, Hühner, Hähnchen und Truthennen auf den Teller kommen.
Was assen die Chorherren im Augustiner-Stift Kreuzlingen an gewöhnlichen Wochentagen?
Mittagessen • zwei Portionen Rindfleisch (Tafelstück)• 1 Pfund Rindfleisch pro Person• Kalbs-, Schafs- oder Rindsragout• eine Beilage von Gemüse • gebratenes Fleisch
Abendessen • vom Mittagessen übrig gebliebenes Fleisch, Gerstensuppe oder andere Suppe• Kalbs-, Schafs- oder Rindsragout• gebratenes Fleisch
˜143
IV • Das Konzil von Konstanz 1414 –1418 – Schlaglichter auf Ereignisse und Alltägliches
Höchstpreise für Nahrungsmittel während des Konzils
Der Chronist Ulrich Richental überliefert vom Konstanzer Rat erlassene Höchstpreise. Die folgende Liste präsentiert eine Auswahl der wichtigsten Güter.
• Dinkel beste Qualität 15 ß dn pro Mütt
• Weissbrot 1 dn
• Hafer Höchstpreis 30 ß dn pro Malter Normalpreis 18 ß dn pro Malter bis 1 fl. rh.
• rote Erbsen 4 ß dn pro Viertel
• Rüben 8–10 dn pro Viertel
• grosser Kabiskopf 2 dn
• Wein: Rainfain (aus Istrien oder Verona) 20 dn pro Mass
• Wein: Elsässer 4–6 dn pro Mass
• Wein: guter Landwein 3–4 dn pro Mass
• Wein: Landwein für Knechte 2 dn pro Mass
• Rindfleisch 3 dn pro Pfund
• Schweinefleisch 4 dn pro Pfund
• altes Huhn 2–3 Plappart
• Ei 1 h pro Stück
• Krammetsvogel 5–6 h pro Stück
• Wildschwein 7 dn pro Pfund
• Dachs, Otter, Biber 8 dn pro Pfund
• Hase 6–8 Plappart pro Pfund
• Karpfen 18 dn pro Pfund
• Felchen 1 ß dn pro Pfund
• Grundeln 27 dn pro Mass
• getrockneter und gesalzener Fisch aus der Lombardei 2–3 Plappart pro Pfund
• Tagelohn eines Arbeiters 18 dn
Masse und Geldangaben: 1 Malter = 4 Mütt = 4 Viertel; 1 Mütt KN = 28,3 l; 1 Mass KN = 1,2 l; 1 dn (Denar) = 2 h, 1 lib dn = 20 ß dn = 240 dn, 1 Plappart = 15 dn, 1 fl. rh. = 1 lib. dn.361 Ein rheinischer Gulden (fl. rh.) entspricht etwa 3,4 g Gold. 1000 Gulden sind 3,5 kg Gold oder entsprechen etwa 36 Jahren tägliche Arbeit für einen Tagelöhner oder 40 t Rindfleisch. ß = Schilling; h = Heller oder Haller. Der Haller ist im Mittelalter die kleinste gängige Münze (1/2 Pfennig). Der Schilling war zunächst vor allem eine Recheneinheit, wurde später aber auch ausgeprägt.
Roman Sigg
144˜
Das Mittagessen bestand aus fünf Gängen, das Abendessen aus drei. Zu den Speisen wurden stets Milch, Obst, Brezeln und Brot gereicht. Gemüse kochte man saisonal: Im Sommer kamen Spinat, Bohnen, Erbsen, Rüben, Kohl, Pastinaken, Kohlrabi und Blumenkohl auf den Tisch, im Herbst frisches Obst und Rüben und im Winter eingelegte Rüben, Sauerkraut und getrocknetes Obst. In der Fastenzeit und an den Fasttagen ersetzte man das Fleisch durch Eier, Mehlspeisen, Käse und vor allem Fisch. Abends gab es oftmals nur Suppe und Reste vom Mittagstisch.
Beim Wein wurde unterschieden zwischen Paterwein, Herrenwein und Gesindewein. Es ist davon auszugehen, dass auch hier je nach Stand der Gäste verschiedene Qualitäten ausgeschenkt wurden. Es ist nicht überliefert, wie viel Wein jedem Chorherrn pro Mahlzeit zustand. Der Ober-amtmann erhielt 1,2 Liter Herrenwein pro Essen, das heisst maximal 2,4 Liter pro Tag. Diese Men-ge liegt im zeitüblichen Rahmen für den Weinkonsum der Oberschicht und lässt sich auch durch andere Quellen erhärten.
Papst Johannes XXIII. wurde bei seiner Ankunft in Kreuzlingen im Oktober 1414 sicherlich glanzvoll empfangen und dürfte mit allem bewirtet worden sein, was Keller, Vorräte und Gärten hergaben. Da der Ankunftstermin des Papstes im Voraus bekannt war, konnten die notwendigen Vorbereitungen frühzeitig getroffen werden. Luxusgüter wie edle Weine, Gewürze, Wildbret, Pasteten, Weissbrot und mehr wurden eingekauft. Die festliche Tafel deckte man mit reich ver-zierten Tischtüchern und dem prunkvollsten Geschirr.