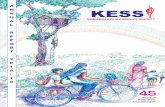Elias KATZ - Ein MINI - SIDUR (Ein Miniaturgebetbuch und seine Miniaturen)
Transcript of Elias KATZ - Ein MINI - SIDUR (Ein Miniaturgebetbuch und seine Miniaturen)
Elias Katz (Oberrabbiner von Beer Schewa)
EIN MINI - SIDUR (Ein Miniaturgebetbuch und seine Miniaturen)
Bei meinem letzten Aufenthalt in London, im Juli 1968, sah und studierte ich einen ganz kleinen (was das Format anbelangt) Sidur. Seine Ausmasse zeigen die beiliegenden Photographien an, die das Originalformat darstellen. Ich muss bekennen, dass mir die Existenz so kleiner mittelalterlicher hebräischer Gebetbücher nicht bekannt war. Es ist deshalb verständlich, dass dieses Gebetbuch mein Interesse erweckte und dies umsomehr, da es auch illustriert ist.
Wenn nun die Handschrift wegen seines Formates ganz unan- sehnlich ist, so stellt dieser Sidur doch eine grosse Kostbarkeit dar und ist ausserordentlich wertvoll.
Dem Inhalte nach ist es ein Gebetbuch des aschkenasischen Ri- tus. Es ist undatiert. Jedoch auf Grund eines paläopgraphischen Vergleiches und nach Beurteilung der Miniaturen glaube ich die Entstehungsgeschichte dieses Gebetbuches gegen das Ende des 14. oder zu Beginn des 15. Jahrhunderts ansetzen zu müssen. Es stammt noch aus der Epoche vor der ruhmreichen Erfindung Gu- tenbergs.
Bei der Datierung gehe ich nicht allein von den Tatsachen aus, dass dieses Gebetbuch eine Handschrift ist. Auch in der Zeit der Wiegendrucke und auch noch später wurden hebräische Gebetbü- eher als Handschriften angefertigt, so dass, wenn nicht andere Merkmale das Gegenteil beweisen würden, diese Sammlung auch gleichgut in das 17., ja sogar in das 18. Jahrhundert passen würde.
Inhaltlich bringt diese Sammlung vor allem die Gebete für die Wochentage und den Sabbat. Wir finden aber auch Gebete für
‘ Feiertage und auch einige Piutim. Aus diesem Grunde könnte man diesen Sidur auch als Miniaturmachsor bezeichnen.
Der Sidur ist auf feinem, dünnem Pergament geschrieben. Die Seiten sind nicht paginiert.
Diese Tatsache erschwert eine Rekonstruktion des ursprüng- lieh Zustandes (der authentischen Anordnung) des Gebetbuches. Die heutige Reihenfolge ist sicher nicht die ursprüngliche. Diese bewei- sen vor allem Zufügungen am Anfang und auch am Ende des Ge- betbuches, die bewiesenermassen späteren Ursprungs sind.
Am Anfang sind auch Hinweise auf einen Besitzer des Sidurs. Jedoch sind diese weder chronologisch noch lückenlos und deshalb nicht entscheidend. Hier will ich sie nicht weiter betrachten.
Der Sidur wurde mehrmals umgebunden. Diese Behauptung be- weisen einleuchtend zwei Tatsachen:
147
1) Die Folios sind stark beschnitten. Davon kann sich auch der Leser dieser Studie leicht überzeugen, wenn er die Miniatur mit dem Schofarstosser betrachtet. Die Gegenseite war mit einer Rand- miniatur verziert, die durch diese Beschneidung soweit unkenntlich wurde, dass wir heute nichteinmal das feststellen können, ob es sich hier um 4 Flügel handelt, oder um 2 Flügel und zwei Hände.
2) Manche Folios sind umgestellt worden, so dass sich heute nicht jeder in diesem Sidur zurechtfinden kann, sondern nur ein Fachmann, der auf diesem Gebiete bewandert ist.
Das Gebetbuch ist wertvoll vor allem für die Erkenntnis der Entwicklung des aschkenasischen Ritus. Es entdeckt unserem Auge wertvolle Eigentümlichkeiten, die in späteren Zeiten nicht mehr gebräuchlich waren und so heute unbekannt sind. Diese Tatsache beweist ebenfalls das hohe Alter dieser Sammlung. Ich kann hier keine ausführliche Aufzählung dieser Eigentümlichkeiten bringen, dazu war die Zeit, die ich einstweilen diesem Sidur widmen konnte, zu kurz. Zwei Wahrnehmungen mögen — pars pro toto — genügen:
a.) das Olenu-Gebet ist hier in seiner unzensurierten Form an- geführt, so wie wir ihn auch im Machsor Lipsia vorfinden;
fo.) beim Morgengebet vermissen wir die Benediktionen auf das Thorastudium und finden diese erst vor dem Bibelzitat über das tägliche Opfer. Auf analoge Fälle machen schon die Tosaffisten auf- merksam (siehe z.B. Traktat Berachot F 11 v im Absatz Schekawar).
Aufschlussreich für die Datierung hebräischer Handschriften ist auch die Schreibweise des Tetragrammes. In diesem Sidur be- nützt der Schreiber die Abbreviatur aus zwei Jodim und einem umgekehrten Nun (Nun inversum). Den Gottesnamen ״El” schreibt er als Ligatur, indem er das Aleph und das Lamed zusammenzieht. Diese Tatsachen sind für die Sphäre und die angenommene Zeit, in der und wo diese Sammlung entstand, charakteristisch. Diese Zeichen allein ermöglichen zwar keine unumstössliche Datierung, dennoch stützen sie diese. Beispiele dieser Schreibweisen findet der Leser auch in den Abbildungen, die diese Studie begleiten.
Für mich am interessantesten — und auch objektiv wahrschein- lieh am wertvollsten — sind in dieser handschriftlichen Sammlung die schon erwähnten Miniaturen, auch wenn diese nur ganz schlichte und nicht kolorierte Federzeichnungen sind.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass im Mittelalter jüdi- sehe Handschriften nur selten illuminiert wurden und so kann man sich nicht wundern, dass uns nur gar wenige erhalten blieben.
Zu diesen kostbaren Schätzen gehört nun auch dieser Sidur. Er enthält zwar nur wenige Zeichnungen, doch diese weisen auf einen begabten Meister hin. Von diesem sind wahrscheinlich auch
148
die Initialen, die m it Blumen- oder Tierornamenten verziert sind. Ich glaube kaum, dass der Schreiber der Handschrift und dessen Illustrator identisch waren. Ein Beweis dafür finde ich auf einer Seite, die m it einem Kustos schliesst, der das folgende W ort der nächsten Seite angibt. Dieses W ort vermissen w ir aber und die Handschrift wird erst m it dem zweitnächsten Wort des Textes fort-
gesetzt. Das dies kein Zufall war, beweist die Tatsache, dass ein grösserer Raum — einige Zeilen breit — fü r das angezeigte Wort, das in Initialen ausgeführt werden sollte — vom Schreiber freige- lassen wurde. Dies konnte nur so geschehen, dass der Sshreiber und der Illuminator nicht identisch waren, sonst hätte der Schreiber die Worte selbst gleich geschrieben.
Die Illuminationen des Sidur haben neben ihrem kunstgeschicht- liehen W ert auch einen allgemein kulturhistorischen Wert, da sie das Zeit kolorit widerspiegeln nnd so unsere Kenntnis über das damalige Leben bereichern und dadurch ein Glied in der Datierung der Handschrift darstellen.
149
Vom Standpunkt der Datierung gesehen, entsprechen die Mi- niaturen der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts. Der Baustil der dargestellten Bauten ist eindeutig gotisch. Die Kostüme sind in die- ser Hinsicht nicht so eindeutig. So z.B. wenn wir die Kopfbedek- kung der Personen betrachten, sehen wir den Judenhut, einen Kegelhut (?) und etwas Turbanähnliches. Wahrscheinlich verfolgte der Illustrator damit eine bestimmte Absicht. Allgemein entsprechen aber auch die Trachten der angegebenen Zeitepoche.
Betrachten wir nun die einzelnen Illuminationen.Ich beginne mit jener Reproduktion, die gleich zwei Illumina-
tionen bringt:Das Bild links widerspiegelt eine halachische Anschauung jener
Zeit. Es stellt einen Mann mit dem typischen Judenhut dar, der sich die Hände wäscht. Den Hintergrund der Darstellung bildet eine gotische Wandnische, an der ein Wasserbehälter mit Zapfen und unten einem Gefäss zum Auf fangen des abf liessenden Wassers zu sehen ist. Rechts hängt auf einer Stange ein Tuch, zum Abtrock- nen. Es könnte aber auch einen Tallith darstellen, der zusammenge- legt ist, denn am unteren Rand sehen wir Fäden, die die Schau- fäden (Zizith) darstellen könnten. Vor dem Behälter ist ein nach vorne geneigter Mann, mit ausgestreckten Händen beim Händewa- sehen zu sehen. Er trägt inen nur kurzen Rock (ober den Knien), der in den Hüften von einem Riemen zusammengehalten ist. Die Gestalt ist Bartlos, mit deutlich erkennbaren Schläfenlöckchen und dem Judenhut. Vom halachischen Standpunkt ist diese Darstellung eine interessante Antwort auf die Frage, ob man bei rituellen Wa- schungen sich die Hände aus einem Zapfen waschen darf, oder ob dazu ein Gefäss notwendig ist, in dem man sich die Hände abspült.
Diese Illumination ist auf der recto Seite des Folios auf der verso Seite folgt dann die Benediktion, die man beim Händewaschen spricht.
Rechts davon sehen wir eine Stadtmauer mit Befestigungen. Uber der Mauer sehen wir zwei Vögel (Gänse?). Dies ist die verso Seite eines Folios. Auf der recto Seite desselben lesen wir das Gebet El melech joschew. Dieses ist die Introduktion zum Gebet über die 13 Gnadeneigenschaften Gottes, das quasi als Refrain in den Selichotgebeten Verwendung findet. Das Gebet beginnt mit den Worten: ״Der Mächtige, G-tt, der König, sitzt auf dem Tron des Erbarmens. .
Die Miniatur ist wahrscheinlich von diesem Gedanken beein- flusst. Im Vordergrund sehen wir ein Stadttor mit Fallbrücke, rechts davon drei Türme (zwei rund, der mittlere eckig. Links oben zwei Vögel im Nest (?). Die Vögel ähneln Gänsen, auch wenn der Schnabel (vorallem des Vogels rechts) zulang geraten ist. Die Iko- nographie dieses Bildes ist mit grossen Schwierigkeiten verbunden.
150
Dem Inhalte nach soll das Bild den Tempel, als Sitz des Allmächti- gen darstellen. F ü r die mittelalterliche Kunst ist es bezeichned, dass sie alles in der damaligen Sprache ausdrückte. Sie zeichnete also auch klassische Bauten in der damals vorherrschenden Gotik. Da nun das Heiligtum in Jerusalem durch seine imposante Grösse
«v«j* y■ ־j a AxzÄ « f e t f *
ז »׳יי̂ג־ T̂ ייו*״י4י ג׳זי i&seיזי£* י**י•13&
*י ׳ יי"־** יי׳ יז־״יד ריןג-ילtv י.-.־.;-
י̂־ 'W י־גי#>6',ך%״*’ »יי מיללי«' ,־»י** ן
%י ״&* «ל &|' רידמימיגיזר י וז«־35די רמי* ־?גי■
einer Festung glich, wäre es möglich, dass der Illuminator sich dieses so vorstellte. Die Gänse wären dann ein Hinweis auf die Römer (Burg Antonie). Diese Allegorie wäre sehr beachtenswert. E r nahm als Symbol der Römer nicht den Adler, da dieser etwas königliches hat. Da aber die Römer das jüdische Reich vernichteten, wollte man ihnen kein so glorreiches Symbol gönnen. Man nahm die Gans, die durch die kapitolinischen Gänse mit den Römern eng zusammenhängt und zwar ebenfalls m it einer Vernichtung und zwar der Vernichtung des römischen Reiches. Diese Symbolik war somit auch m it einer Hoffnung verbunden, sowie G-tt die mächtigen Römer vernichtete, wird er bei der Ankunft des Messias die Macht Israels erneuern.
Es wäre auch möglich, dass der Illuminator dieses Sidur ein Nichtjude war, der sich als Vorbild einfach das Kapitol als Sitz
151
des höchsten G-ttes nahm. Da er allem dem Judentum Fremdem sonst auswich, hatte der Besteller auch bei diesem Bilde kein Be- denken und nahm diese an. Der Kopist sah dabei keinen heidni- sehen Einfluss, da er die Legende von den kapitolinischen Gänsen als Kriegsfabel betrachtete. Dies (ein nichtjüdischer Illustrator) ist aber nicht wahrscheinlich, denn er fertigte auch die Initialen an und dies ist einem Nichtjuden nicht zuzutrauen.
Gänse sind sonst im Judentum oft gezeichnete Tiere. Uber ihre Ikonographie schrieb ich in meiner Studie über ein Mohelbuch aus dem Waagtal, wenn auch in anderem Zusammenhang. Mit Rück- blick auf die obenaufgestellte Hypothese, würde aber dieses Pro- blem ein umfassendes Studium erfordern. Die Gans kommt auch im Talmud vor, z.B. Berachot 20 a und Gitin 73 a. Die Stellen verursa- chen manches Kopfzerbrechen. Sie ist dort das Symbol der Wach- samkeit, wie dies mit der erwähnten römischen Sage zusammen- hängt. Siehe in Lexicons unter Maulins.
Wie dem nun auch sei ist die Miniatur selbst ein bedeutendes Hilfsmittel und Beweis für die Datierung des Sidurs. Der Bestei- ler folgte aber auf keinem Fall einem heidnischen Einfluss.
Als nächstes Bild, will ich die Doppelseite betrachten, auf der wir rechts den Schofarstosser sehen. Wir sehen hier eine bärtige Gestalt (auffallend ist die Tatsache, dass es die einzige bärtige ist), sie ist nach links gerichtet (nach Jerusalem). Den Kopf bedeckt ein Turbanähnliches Gebilde, das mit einem Nackentuch endet. Die Gestalt ist mit einem Obergewand bekleidet, das bis zu den Knieen reicht und dessen Saum unten, bei den Händen und am Kragen durch einen verzierten Saum eingefasst ist. Das Kleid ist gegürtet. Die Gestalt nimmt eine charakteristische und realistische Positur für das Schofarblasen ein. Der linke Fuss ist nach vorne gerichtet und auch die rechte Hand ist weiter nach vorne gestreckt als die linke. Das grosse Schofarhorn hält der Bläser mit beiden Händen. Wie schon gesagt ist es die einzige bärtige Gestalt und wir ver- missen auch den Judenhut. Diese Tatsachen erkläre ich damit, dass das Schofarblasen mit dem Messias verbunden wird und das deshalb der Illustrator alles Beschämende und erniedrigende auslassen wollte. Der Bläser selbst steht auf einem Hügel. Vielleicht auch eine An- spielung auf das Heiligtum, das auf dem Tempelberg stand, oder ein Anklang auf den Isaiasvers 40, 9: ״Auf hohen Berg steig hin- auf, Sion, als Freudenbotin! Erhebe mit Macht deine Stimme..
Links von der Gestalt sehen wir in drei Reihen Buchstaben. Wie die Punkte beweisen, sind es Abbreviaturen. In der oberen Reihe (von links nach rechts) sind es die Buchstaben: K, Sch, R, K in der mittleren: K, Sch, R und in der unteren: K, R, K. Sie bringen in Abbreviatur die Reihenfolge der verschiedenen Schofar- töne.
152
Auf der linken Seite dieser Abbildung sehen wir den schon oben erwähnten beschnittenen Rand des Folios. Die Randiliumina- tion können wir leider nicht mehr agnoszieren.
Aufmerksamkeit verdienen auf dieser Seite auch die Initialen. Sie sind mit stilisierten Hundsköpfen verziert, was darauf hinwei- sen soll, dass auch der Feind, nach Ankunft des Messias, G־tt loben wird. So wie es bei Jeremias 4, 2 heisst: ״ . . . so werden die Heiden sich segnen in Ihm und Seiner sich rühren!”
Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit jener Doppelseite zu auf deren einen Seite die Beschneidung dargestellt ist.
Die Miniatur zeigt fünf Gestalten. Auf einem hohen Stuhl sitzt der Gevatter, der das Kind hält. Der hohe Stuhl soll eine An- spielung auf den Stuhl Elijahus sein. Der hohe Stuhl selbst ent- spricht eher dem sefardischen Ritus und dies ist an dieser Illustra- tion das auffallende. Vielleicht hatte der Illuminator eine marokka- nische Vorlage.
Auffallend ist auch die Kopfbedeckung des Gevatters und auch des Mohels. Er hat nicht die typische Form des Judenhutes, son- dern ähnelt einem Fez. Dies könnte auch mit einer sefardischen Vorlage Zusammenhängen. Es kann aber auch als Anspielung auf Abraham gedeutet werden, der als erster die Beschneidung als Zeichen des Bundes durchführte.
Der Beschneider sitzt unterhalb des Kindes, wie dies dem rituellen Gebrauch entspricht. Die Szene flankieren zwei Gestalten, die wahrscheinlich Hausknechte (wahrscheinlicher jedoch Ehrenge- hilfen) darstellen. Links hält er ein Gefäss mit Räucherwerk, rechts bringt er einen Becher. Rechts unterhalb der Szene sehen wir einen Tisch und unter diesem ein Haustier. Auf dem Tische sind zwei Gefässe.
Das Bild ist auch vom halachischen Gesichtspunkte interessant und aufschlussreich.
Die letzte Abbildung zeigt uns unter reich verzierten Initialen eine Tierszene. Ober den Initialen sehen wir eine stilisierte Tudor- rose, die auch einmal ganzseitig vorkommt. Die Rose als Smybol habe ich umfangreich in meinem Machsor Lipsia bearbeitet. Die Initialen sind mit Blumenornamenten reich verziert.
Wie der Text beweist sind auch hier die Folios versetzt, denn das Wort Baruch, mit dem eine Benediktion beginnt, passt nicht zu dem folgenden Text.
Baruch bedeutet Gebenedeit (sei). Wie hängt dieses Wort mit der Tierszene zusammen?
Im Machsor Lipsia wies ich auf den Zusammenhang von Hirsch Hund und Hasen in der jüdischen Ikonographie hin und habe ihre
153
Symbolik geklärt. Der Hase symbolisiert das verfolgte Judentum, der Hund den Verfolger und der Hirsch (selbstverständlich nicht als Personifikation) den Allmächtigen. Die hier dargestellte Szene ist eine Analogie zum Machsor Lipsia auch wenn auf diesem Folio der Hase fehlt, im Sidur fehlt er jedoch nicht. Wir finden Hasen auf einem anderen Folio, als ob sie sich selbständig gemacht hätten.
Was bedeutet nun das Bild selbst. Es ist gewissermassen wider- sinnig, denn auf den ersten Blick jagt hier der Hirsch einen Hund! Doch dies wirklich nur auf den ersten Blick, denn das Bild soll Jenen symbolisieren, dem jede Benediktion gehört. Den Allmäch- tigen.
Soviel also zu einem unbekannten Sidur aus längst vergangener Zeit. Mögen diese Zeilen dazu beitragen, seine längst verklungene und stumme Sprache wieder zu verstehen können.
Es ist das Recht eines Bearbeiters, einem noch unbenannten Werk einen Namen zu geben. Ich würde diesen Sidur nach seinem jetzigen Besitzer ״Sidur Grausius” benennen, da wir weder seinen Meister noch seinen ersten Besitzer kennen.
SOEBEN ERSCHIENEN
STELLA ROTENBERG (London)
G e d i c h t eDie Dichterin, die aus ihrer Heimat Wien vor den Nazihorden flüchten musste, lebt heute ln England. Besonders reizend und rührend sind die geistvoll herausgearbeiteten Zeilen als Ausdruck eines überladenen Herzens. Das tiefe Weh, das irregeleitete Horden ihr angetan haben, kann und 8011 nicht vergessen werden. Das Leia weitet sich zum Weltschmerz und Auschwitz hinterlässt ein Vermächtnis für ewige Zeiten. . .
112 Seiten * Kartoniert DM 10.—
Edition “OLAMENU”, Tel-Aviv, P.O.B. 3002 (Israel)
154