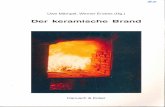Die Sprachsituation der Slovakei: Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Reproduktionsmedizin
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Reproduktionsmedizin
M.S. Kupka: Mitglied des Vorstandes des Deut-schen IVF-Registers seit Mai 2007, Mitglied des Steering Committee, The European IVF Monito-ring Program (EIM), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) seit Juni 2008K. Bühler: Vorstandsvorsitzender des Deutschen IVF-Registers seit Mai 2007R. Felberbaum: Vorstandsvorsitzender des Deutschen IVF-Registers 1995–2007, Ehem. Mitglied des Steering Committee, The European IVF Monitoring Program (EIM), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Mitglied der Zentralen Ethik – Kommission für Stammzellforschung (RKI)
M.S. Kupka1 · K. Bühler2 · R. Felberbaum3
1 Arbeitsgruppe Kinderwunsch - Reproduktionsmedizin & Endokrinologie, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe , Klinikum der Universität München – Innenstadt Ludwig-Maximilians-Universität, München2 Zentrum für Gynäkologische Endokrinologie & Reproduktionsmedizin Langenhagen-Wolfsburg3 Chefarzt der Frauenklinik, Klinikum Kempten-Oberallgäu, Standort Robert-Weixler-Straße, Kempten
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der ReproduktionsmedizinNationale und internationale Einrichtungen
Leitthema
Das Deutsche IVF-Register
Für Deutschland liegen Daten des Deut-schen IVF-Registers (DIR) zu reprodukti-onsmedizinischen Behandlungen seit 1982 vor. Die Tatsache, dass die ersten Arbeits-gruppen, die 1982 noch alle universitäre Einrichtungen waren, die Notwendigkeit einer solchen zentralen Datenerfassung eingesehen haben, kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Da zu diesem Zeit-punkt noch keinerlei rechtliche Regula-torien bestanden, war dies eine aus freien Stücken unternommene Anstrengung.
Von Anfang an war es das Ziel der für dieses Register Verantwortlichen, für die-se in der Öffentlichkeit auch heute noch häufig diskutierten medizinischen Be-handlungsformen eine möglichst hohe Transparenz herzustellen – das ist erreicht worden. Sicherlich hat die zweite Novel-lierung der Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion durch die Bundesärztekammer mit der ausdrückli-chen Einbindung des DIR wesentlich zu diesem Resultat beigetragen [1].
Zur Arbeitsweise des Deutschen IVF-Registers
Das DIR war bisher eine Einrichtung der Deutschen Gesellschaft für Gynä-kologie und Geburtshilfe (DGGG) mit
eigener Geschäftsordnung. Das DIR wurde und wird getragen von der Deut-schen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungs-medizin (DGGEF) und dem Bundes-verband Reproduktionsmedizinischer Zentren (BRZ). Seit November 2008 hat sich das Register in einen eingetragenen Verein mit eigener Satzung umgewan-delt. Zu den tragenden Gesellschaften ist noch die Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin (DGRM) dazu-gekommen. Sitz der Bundesgeschäfts-stelle des DIR ist seit 1996 die Landes-ärztekammer Schleswig-Holstein (Bis-marckallee 8-12, 23795 Bad Segeberg). Die Schirmherrschaft hat die Bundes-ärztekammer übernommen.
Das DIR hat seit 1996 enorme An-strengungen unternommen, um qualita-tiv hochwertige Daten zu generieren. Vor 1997 konnten die Behandlungsdaten und Behandlungsergebnisse nur retrospek-tiv als schriftlicher Fragebogen bzw. mit-tels eines einfachen, zusammenfassenden Computerprogramms zur Verfügung ge-stellt werden. Ab 1995 wurde die compu-tergestützte Datenerfassung weiter voran-getrieben, und seit 1997 werden die Daten bundesweit in allen Zentren mit von der Geschäftsstelle des DIR zertifizierten Er-fassungsprogrammen (DIRpro oder Rec-Date bzw. RecDate-advance) erhoben. Di-
es hat zu einer nachhaltigen Verbesserung der Datenqualität geführt.
Dabei deckt der sehr umfassende Fra-genkatalog alle relevanten Aspekte der Behandlung zur assistierten Reproduk-tion ab. Die elektronische Dateneingabe ermöglicht die nachprüfbare prospektive Datenerhebung und die sofortige Über-prüfung auf Plausibilität. Prospektivität bedeutet in diesem Zusammenhang die Anmeldung der Zyklusdatei im Erfas-sungsprogramm innerhalb von 8 Tagen nach Beginn der Stimulationsbehandlung. Das Register versucht also, Kriterien, wie wir sie aus prospektiven, klinischen Stu-dien her gewohnt sind, auf die bundes-weite Datenerhebung zu übertragen. Di-es allein stellt schon ein wichtiges Quali-tätskriterium dar. Die erzielten Plausibili-täts- und Prospektivitätsraten in den letz-ten Jahren gehen aus . Tab. 1 hervor. Für
RedaktionG. Griesinger, LübeckK. Diedrich, LübeckH. Hepp, Buch am Ammersee
Gynäkologe 2009 DOI 10.1007/s00129-009-2341-y© Springer Medizin Verlag 2009
1Der Gynäkologe 2009 |
das Jahr 2007 konnten so 64.578 Behand-lungen dokumentiert werden.
Die Daten werden in den teilneh-menden Zentren eingegeben und in re-gelmäßigen Abständen an die Bundesge-schäftsstelle des DIR exportiert. Dort wer-den die Datensätze zunächst auf Vollstän-digkeit und Plausibilität geprüft. Sind di-ese Anforderungen erfüllt, gehen die ex-portierten Datensätze in die zentrale Jah-resauswertung ein.
> Mit der Erstellung von Zentrumsprofilen wird Qualitätskontrolle verwirklicht
Darüber hinaus erhält jedes teilnehmende Zentrum eine Auswertung seiner gelie-ferten Daten im Sinne eines eigenen Zen-trumsprofils (. Abb. 1). Somit ist es jedem Zentrum ermöglicht, nicht nur die eigenen Ergebnisse kritisch zu würdigen, sondern auch die eigenen Ergebnisse und Beson-derheiten im Vergleich zu allen anderen Zentren zu sehen. Gerade in der Erstellung dieser Zentrumsprofile, die auch in fast al-len Fällen auf freiwilliger Basis der Zentren den mit der Qualitätssicherung beauftrag-ten Landesärztekammern zur Verfügung gestellt werden, ist die Verwirklichung der Idee der Qualitätskontrolle zu sehen.
Seit dem Jahr 2000 nehmen alle von den Landesärztekammern dem DIR ge-meldeten reproduktionsmedizinischen Einrichtungen in Deutschland an dieser Datenerhebung teil. Dies und die Tatsache, dass seit 1996 die Zentren mehr als 1,3 Mio. EUR für den Betrieb des DIR aus eige-nen Mitteln bezahlt haben (im Gegensatz zu anderen Ländern werden die Kosten in Deutschland weder auf die Patienten noch auf das nationale Gesundheitssystem um-gelegt), zeigten eindrücklich auf, dass wei-testgehend Einvernehmen über diese Art
der Qualitätssicherung besteht. Das DIR stellt neben der Entwicklung der Repro-duktionsmedizin in Deutschland die aktu-elle Situation sehr exakt dar.
> Auch angesichts der Bevölkerungsstruktur wächst die Bedeutung der assistierten Reproduktion
Während 1982 nur 742 Behandlungen in Deutschland durchgeführt worden waren, wurden für das Jahr 2007 11.255 Behand-lungen mit der Technik der In-vitro-Fer-tilisation (IVF), 30.921 Behandlungen mit der Technik der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) und 16.312 Be-handlungen zur Rücksetzung eingefro-rener Eizellen im Vorkernstadium regis-triert. Diese Zahlen belegen, dass die Fort-pflanzungsmedizin in Deutschland trotz der Auswirkungen des Gesundheitsmo-dernisierungsgesetzes von 2004 längst nicht mehr zur Behandlung einer Rand-gruppe unserer Gesellschaft dient. Wenn wir uns vor Augen führen, dass etwa 1,5 Mio. Paare in Deutschland ungewollt kinderlos sind und es sich dabei durchweg um junge Menschen handelt, die sich ei-ne Familie mit Kindern wünschen, dann wächst auch die Bedeutung der extra-korporalen Befruchtung angesichts einer überalterten Bevölkerung.
Behandlungsergebnisse in Deutschland
Im Jahr 2007 betrugen die klinischen Schwangerschaftsraten pro durchgeführ-tem Embryotransfer 30,44% nach IVF und 28,80% nach ICSI. Nach der Rück-setzung kryokonservierter und zu einem späteren Zeitpunkt aufgetauter Eizellen im Vorkernstadium betrug die durch-
schnittliche Schwangerschaftsrate pro durchgeführtem Embryotransfer immer-hin 19,12%. Dabei ist es wichtig darauf hin-zuweisen, dass für diese Berechnungen nur klinisch nachgewiesene Schwanger-schaften herangezogen werden, „bioche-mische Schwangerschaften“ gehen nicht in die Berechnung ein. Die Abortraten nach IVF (20,44%) und nach ICSI sind vergleichbar (19,59%), nach Kryokonser-vierung von Eizellen im Vorkernstadi-um liegt die Rate über all die Jahre 3 bis 5 Prozentpunkte höher. Nach möglichen Ursachen dafür wird im Moment in wei-terführenden wissenschaftlichen Studien gesucht. Die Ergebnisse seit 1997 sind in . Abb. 2 und 3 dargestellt.
Auch bei Verwendung von Spermien aus dem Nebenhoden oder aus Hodenbiopsien und nachfolgender ICSI können Schwan-gerschaftsraten von mehr als 20% pro durch-geführten Embryotransfer erzielt werden. In Anbetracht der Einschränkungen und Auflagen des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) sind das sehr gute Behandlungser-gebnisse, die sich auch mit den Ergebnissen der im europäischen Ausland tätigen Ar-beitsgruppen messen können.
Etwas ernüchternd erscheinen im Vergleich zu den genannten Schwanger-schaftsraten die tatsächlich festzustellen-den Geburtenraten („baby-take-home-rate). Unter Berücksichtigung der Tatsa-che, dass es trotz nachhaltiger Datener-fassung in etwa 13% der Fälle nicht mög-lich war, genaue Angaben zum Schwan-gerschaftsverlauf nach festgestellter kli-nischer Schwangerschaft zu erhalten, be-trugen die Geburtenraten, berechnet als Anzahl der Geburten (auch eine Mehr-lingsgeburt wird dabei nur als eine ein-zige Geburt berechnet) bezogen auf die Anzahl der durchgeführten Behand-lungen 19,87% für die IVF, 19,99% für die ICSI und 12,28% für die Rücksetzung ur-sprünglich kryokonservierter Eizellen im Pronucleusstadium. Diese Zahlen sind natürlich von hoher Relevanz für die Be-ratung der betroffenen Paare
Zur Bedeutung des biologischen Alters der Frau
Die Ergebnisse der in Deutschland durchgeführten reproduktionsmedizi-nischen Behandlungen zeigen ebenso
Tab. 1 DIR-Datenerhebung 2000 bis 2007: Plausibilitäts- und Prospektivitätsraten (%)
Jahr Plausibilität Prospektivität (alle Therapiezyklen)
Prospektivität (Punk-tionszyklen)
2000 99,37 85,90 -
2001 98,31 84,40 -
2002 98,67 80,69 95,23
2003 98,31 81,68 93,54
2004 96,31 79,63 94,92
2005 96,22 84,87 91,56
2006 95,49 85,21 90,70
2007 94,80 87,80 92,16
2 | Der Gynäkologe 2009
Leitthema
wie die international publizierten Da-ten die eminente Bedeutung des Lebens-alters der Frauen für die Wahrschein-lichkeit eines Behandlungserfolges. Lie-gen die Schwangerschaftsraten bis zum 31. Lebensjahr der Frau bei über 36%, so fallen sie nach dem 40. Lebensjahr, un-abhängig von der Anzahl der übertra-genen Embryonen, dramatisch auf 17,85% im Falle der IVF und 13,74% im Falle der ICSI ab (. Abb. 4).
Daher ist es wichtig, bei der Behand-lung steriler Paare nicht unnötig Zeit zu verlieren, etwa durch Anwendung erwie-senermaßen nicht wirksamer konservati-ver Behandlungsformen. Sowohl medi-kamentöse Therapien, wie z. B. mit Padu-tin®, als auch operative Therapien wie die Verödung von Krampfadern im Hoden-bereich (Varikozelen) sind unwirksam zur Behebung einer schweren Einschrän-kung der Samenqualität, von einem völ-ligen Fehlen von Samenzellen im Ejaku-lat ganz zu schweigen. In solchen Fällen ist allein die Methode der intrazytoplas-matischen Spermieninjektion erfolgver-sprechend. Andererseits muss auch bei den Betroffenen das Bewusstsein über die große Bedeutung des Alters, insbe-sondere das der Frau, geschärft werden. Hierzu gibt es noch viel zu viel Irrglau-ben, wie jüngst eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) ergeben hat [16].
Von den 383.953 Eizellen, die zwi-schen dem 01.01. und dem 31.12.2007 ge-wonnen wurden, fanden 96.364 Eizellen für die IVF Verwendung, 228.904 für die ICSI. Die Befruchtungsrate (berechnet als Zahl der normal imprägnierten Ei-zellen mit zwei Vorkernen bezogen auf die Gesamtzahl der gewonnenen Eizel-len) betrug 51,53% nach IVF und 63,48% nach ICSI. Im Durchschnitt wurden 2,07 Embryonen in den IVF-Behandlungen pro Zyklus zurückgesetzt, während 2,09 Embryonen im Durchschnitt nach ICSI-Behandlung pro Zyklus transferiert wur-den.
In Deutschland geborene Kinder nach assistierter Reproduktion 1997–2007
Im Jahre 2008 war das DIR in der Lage, Angaben zum Geburtgewicht und zum
Zusammenfassung · Abstract
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Reprodukti-onsmedizin. Nationale und internationale Einrichtungen
ZusammenfassungFür Deutschland liegen Daten des Deutschen IVF-Registers (DIR) zu reproduktionsmedizi-nischen Behandlungen seit 1982 vor. Über die Jahre hat die Zahl der teilnehmenden Zentren und die der registrierten Behand-lungen deutlich zugenommen. Während 1982 nur 742 Behandlungen in Deutschland durchgeführt worden waren, wurden für das Jahr 2007 11.255 IVF (In-vitro-Fertilisation)-, 30.921 ICSI (intrazytoplasmatische Spermi-eninjektion)-Behandlungen und 16.312 Be-handlungen zur Rücksetzung eingefrore-ner Eizellen im Vorkernstadium registriert. Im Jahr 2007 betrugen die klinischen Schwan-gerschaftsraten pro Embryotransfer 30,44% nach IVF und 28,80% nach ICSI. Im European IVF-Monitoring Consortium (EIM) innerhalb
der European Society of Human Reproduc-tion and Embryology (ESHRE) sind alle euro-päischen Register zur assistierten Reprodukti-on zusammengeschlossen. Ohne Zweifel ge-hört das DIR zu den besten Registern welt-weit, auch wenn Schwachstellen eruiert wer-den können. Als eklatantes Beispiel muss hier die Diskussion um die ungeklärte Zahl der se-lektiven Fetozide in Deutschland genannt werden, die im Jahr 2007 erhebliche Wellen geschlagen hatte. Tatsächlich scheinen nur gesetzlich institutionalisierte Register diese schwierigen Aufgaben erfüllen zu können.
SchlüsselwörterAssistierte Reproduktion · In-vitro-Fertilisati-on · Intrazytoplasmatische Spermieninjektion
Quality assurance and quality control in reproductive medicine. National and international organizations
AbstractThe German IVF Registry (Deutsches IVF-Reg-ister; DIR) has been reporting data on as-sisted reproduction in Germany since 1982. Since then the number of participating cen-tres has increased considerably. While in 1982 only 742 treatments had been performed in Germany, in 2007 11,255 treatments with conventional IVF, 30,921 treatments with IC-SI and 16,312 cryo cycles were reported. In 2007 the clinical pregnancy rate after con-ventional IVF was 30.44% per embryo trans-fer and 28.80% after ICSI. The European IVF Monitoring Consortium (EIM) within the Eu-ropean Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) includes all IVF registries in Europe. The EIM report reflects treatment data from 30 countries: Belgium, Bulgar-
ia, Denmark, England, Finland, France, Ger-many, Greece, Irland, Italy, Lithuania, Latvia, Macedonia, Montenegro, Norway, Nether-lands, Austria, Poland, Portugal, Russia, Swe-den, Switzerland, Serbia, Slowakia, Slowenia, Spain, Czech Republic, Ukraine and Hunga-ry. Without a doubt the German IVF registry is among the best worldwide. However, even there pitfalls can be found. A remarkable ex-ample was the discussion in 2007 on the un-clarified number of selective fetocides taking place in Germany.
KeywordsAssisted reproduction · In vitro fertilization · Intracytoplasmic sperm injection
Gynäkologe 2009 DOI 10.1007/s00129-009-2341-y© Springer Medizin Verlag 2009
M.S. Kupka · K. Bühler · R. Felberbaum
3Der Gynäkologe 2009 |
Gestationsalter von insgesamt 100.159 Kindern zu machen, die zwischen 1997 und 2007 nach assistierter Reproduktion geboren wurden [2].
Dabei konnte gezeigt werden, dass das durchschnittliche Gestationsalter bei 5004 Einlingen, die im Jahr 2007 gebo-ren wurden, zum Zeitpunkt der Geburt
39 Schwangerschaftswochen betrug. Im Durchschnitt wogen diese Einlinge zum Zeitpunkt der Geburt 3360 Gramm. Di-es sind völlig normale Werte. Allerdings wurden 19,76% der Kinder vor der voll-endeten 37. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren. Dieser Wert ist deutlich höher als in der Normalpopulation, bei der eine Frühgeburt in etwa 6% der Fäl-le zu erwarten ist. Dies mag sich durch das im Durchschnitt höhere Lebensalter der Patientinnen im Vergleich zur Popu-lation von Schwangeren nach spontaner Konzeption, und durch das a priori hö-here Abortrisiko einer nach Sterilitäts-therapie eingetretenen Schwangerschaft erklären lassen.
Bei Zwillingen und Drillingen verän-dern sich die Verhältnisse dramatisch. Während die Zwillinge im Durchschnitt in der 36. SSW geboren wurden und zu diesem Zeitpunkt etwa 2510 Gramm wogen, lag der Median des Schwanger-schaftsalters zum Zeitpunkt der Geburt bei den Drillingen bei nur 31 SSW. Die Drillinge wogen zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt nur 1660 Gramm.
Dabei stieg die Rate der Frühgeburten (vor der vollendeten 37. SSW) bei den Zwillingen auf über 80%. Von den Dril-lingen wies keines der geborenen Kinder ein Schwangerschaftsalter jenseits der vollendeten 37. SSW auf.
Es ist als ein Verdienst der uner-müdlichen Aufklärungsarbeit des DIR zu werten, dass in den letzten 10 Jahren die Anzahl der durchschnittlich transfe-rierten Embryonen um 18–19% bei IVF- und ICSI-Behandlungen reduziert wur-de. Dies führte dazu, dass der Anteil der geborenen Drillingskinder an der Ge-samtzahl nach extrakorporaler Fertili-sation geborener Kinder um mehr als 80% verringert werden konnte (8,44% 1997 vs. 1,47% 2007). Auch wenn der An-teil der nach extrakorporaler Fertilisati-on geborenen Mehrlingskinder im Ver-gleich zu allen in Deutschland geborenen Mehrlingskinder, wie die aktuellen Zah-len des Statistischen Bundesamtes erge-ben, nur 15% beträgt, so ist doch festzu-halten, dass nach extrakorporaler Fer-tilisation pro eingetretener Schwanger-schaft zehnmal mehr Mehrlingsschwan-gerschaften entstehen als nach Spontan-konzeption [17].
Zentrumsprofile Deutsches IVF RegisterZentrum xyz
Zeitintervall: 2007 Stand: 11.11.2008Zurückgeführte Embryonen nach IVFBasis: Erfolgreiche TransfersAlle BundesländerGesamt: 1194Anz. d. Zentren: 101
Basismenge: 120Min. Basismenge: 10
Ergebnis: 2,1 MQualität: 97,3 %
p10
p25
p50
p75
p90
3,2 N1,6 2,0 2,4 2,8
min p10 p25 p50 p75 p90 max
1 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2
xyz
Abb. 1 8 Exemplarisches Zentrumsprofil, hier am Beispiel der durchschnittlich übertragenen Embryo-nen nach In-vitro-Fertilisation (IVF). Jedes Zentrum sieht die eigene Position (roter Strich) als Perzenti-lenangabe im Vergleich zu allen anderen in diese Auswertung einbezogenen Zentren (andere Zentren anonymisiert). (Ergebnis: Ergebnis des Zentrums für die in grün aufgeführte Betrachtung im angege-benen Zeitintervall; Qualität: Plausibilitätsrate des Zentrums 97.3%)
4 | Der Gynäkologe 2009
Leitthema
Elektiver Single-Embryo-Transfer – in Deutschland nicht möglich
In Deutschland muss die Entscheidung, welche befruchteten Einzellen sich zu Em-bryonen weiterentwickeln dürfen, in dem frühen Stadium der Vorkernbildung ge-fällt werden. Nach dem ESchG ist die Ei-zelle im Vorkernstadium keine befruchte-te Eizelle und darf sowohl kryokonserviert
als auch verworfen werden. In Ländern, in denen die Embryoselektion gestattet ist, können für den Transfer Embryonen aus-gewählt werden, die nach mikroskopisch-morphologischen Kriterien als diejeni-gen mit der höchsten Implantationswahr-scheinlichkeit gelten. Dieses Verfahren er-höht die Erfolgsaussichten eines Transfers von nur zwei oder auch nur einem Em-bryo. So werden in den skandinavischen
Ländern nur noch höchstens zwei Präim-plantationsembryonen, und in der Regel sogar nur einer zurückgesetzt, ohne dass die Wahrscheinlichkeit gesunken wäre, ei-ne Schwangerschaft zu erzielen.
Auf der anderen Seite konnte die Ra-te höhergradiger Mehrlingsschwanger-schaften deutlich gesenkt werden. An-hand der deutschen Daten kann zumin-dest gezeigt werden, dass bei der Rück-
0,0
5,0
15,0
20,0
25,0
30,0
10,0
1997
IVF ICSI TESE-ICSI Kryo-ET
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Abb. 2 7 Durchschnittliche Schwangerschaftsraten bei
IVF-, ICSI-, TESE-ICSI- und Kryo-ET-Behandlung in den
Jahren 1997 bis 2007
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
IVF ICSI TESE-ICSI Kryo-ET
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Abb. 3 7 Durchschnittliche Abortraten nach IVF-, IC-
SI-, TESE-ICSI- und Kryo-ET-Behandlung in den Jahren
1997 bis 2007. (*Im Jahr-buch 2007 liegt noch eine
dreifach höhere Lost-for-Follow-up-Rate hinsichtlich
des Ausgangs der gemel-deten klinischen Schwan-
gerschaften vor; wahr-scheinlich wird diese bei der Neuberechnung im
Jahr 2008 von etwa 30% auf etwa 12% abfallen)
�Der Gynäkologe 2009 |
setzung von zwei „regulären“ Embryo-nen, also Embryonen von guter Qualität entsprechend mikroskopisch-morpho-logischen Kriterien, untersucht im Sta-dium des Präimplantationsembryos, die durchschnittliche Schwangerschaftsrate pro Embryotransfer 34,84% beträgt. Bei Rücksetzung von zwei Embryonen von schlechter Qualität ergab sich für das Jahr 2007 eine Schwangerschaftsrate von nur noch 15,47%. Noch klarer wird dies bei der Untersuchung eines prognostisch als sehr gut zu bewertenden Patientinnenkollek-tivs wie der Frauen unter 31 Lebensjahren. Hier liegt die durchschnittliche Schwan-gerschaftsrate nach Rücksetzung von zwei „idealen“ Embryonen bei über 39%, nach Rücksetzung zweier „nicht idealer“ Em-bryonen bei nur 20,17%. Diese Unter-schiede sind statistisch hoch signifikant. Die Klassifizierung in „nicht ideal“ und „ideal“ kann aber von den Zentren nur als Beschreibung des eingetretenen Ist-Zustandes durchgeführt werden, nach-dem eben im Pronucleusstadium schon vor Vollzug des Befruchtungs- bzw. Ver-schmelzungsvorgangs der beiden Vor-kerne die Eizelle(n) für die weiterführen-de Kultur festgelegt werden mussten.
Sollte im Zuge eines neuen Fortpflan-zungsmedizingesetzes das ESchG neu ge-regelt werden, so würde eine Zulassung der Embryoselektion vor dem Embryo-
transfer einen wesentlichen Gewinn für die betroffenen Patientinnen darstellen.
Dass einmal Beurteilungskriterien im Vorkernstadium die Selektion im Embry-onalstadium wirklich ersetzen könnten, bleibt weiter zweifelhaft.
Komplikationen der Behandlung
Neben dem erhöhten Vorkommen von Mehrlingsschwangerschaften registriert das DIR Komplikationen bei der Eizellge-winnung sowie Fälle einer schweren Über-reaktion der Eierstöcke auf die Stimula-tionsbehandlung. Dabei kann es in der schweren Form dieses Krankheitsbildes zu Schwellungen der Eierstöcke, zur Bil-dung von Aszites und auch zum Auftre-ten von Thrombosen und Embolien kom-men. Über Komplikationen bei der Ent-nahme von Eizellen kann gesagt werden, dass die Follikelpunktion eine außeror-dentlich sichere Maßnahme darstellt. Bei 40.609 im Jahre 2007 registrierten Folli-kelpunktionen wurden nur 296 Kompli-kationen gemeldet. Von diesen Komplika-tionen wiederum waren 86,49% vaginale Blutungen nach der Punktion. Die ge-fürchtete Peritonitis wurde 2007 von kei-nem Zentrum berichtet. Sie ist jedoch be-schrieben und gehört zu den möglichen Komplikationen dieses Eingriffes. In der Operationsaufklärung sollte daher darauf
hingewiesen werden, ebenso wie auf die Möglichkeit der intraabdominellen Blu-tung oder der Notwendigkeit einer ope-rativen Versorgung (Inzidenz insgesamt: 0,37‰). Die Rate der schweren, hospita-lisationsbedürftigen Überstimulations-syndrome beträgt in Deutschland nur 0,33%. Sie hat sich in den letzten 8 Jahren halbiert!
IVF-Register auf europäischer Ebene
Auf europäischer Ebene wurde bereits 1984 eine Fachgesellschaft (European So-ciety of Human Reproduction and Em-bryology, ESHRE) zu Therapieoptionen der assistierten Reproduktion (ART) ge-gründet. Der erste ESHRE-Kongress fand 1985 in Bonn-Bad Godesberg statt.
Es dauerte noch einige Jahre, bis auf dem 15. Jahrestreffen in Tours (Frank-reich) im Juni 1999 der Grundstein für eine Arbeitsgruppe gelegt wurde, die im weiteren Verlauf als eine der wichtigs-ten Initiativen in der nunmehr 25-jäh-rigen Geschichte der Gesellschaft angese-hen wird [3]. Das wird auch durch die In-tegration innerhalb der ESHRE-Struktur (. Abb. �) deutlich.
Die Anfänge dieses European IVF Mo-nitoring Program (EIM) geht auf die In-itiative von Medizinern aus Schweden
Klin
. SS/
ET% 36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3 transf. Embryonen 2 Transf. Embryonen 1 Transf. Embryo
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44Alter der Frau in Jahren
Abb. 4 8 Klinische Schwangerschaftsraten in Abhängigkeit vom Alter der Frau und der Anzahl der übertragenen Embryonen
� | Der Gynäkologe 2009
Leitthema
und Dänemark zurück. Ziel war es dabei – trotz der großen Heterogenität in Be-zug auf legislative und krankenversiche-rungsbezogene Aspekte – einen Überblick zu Fragen der Struktur-, der Prozess- und der Ergebnissqualität zu geben.
In den skandinavischen Ländern gibt es eine lange Tradition von Datenerhe-
bungen im medizinischen Bereich. Da-bei sind die Größe des Landes, die soziale Ausrichtung des Gesundheitssystems im Allgemeinen und das Registrierungssys-tem (z. B. eine personenbezogene, kons-tante Identifizierungsnummer) entschei-dende Faktoren.
Ziel des EIM war es, ein Instrument der Datenerhebung mit einer jährlichen Zusammenfassung der Ergebnisse in ge-druckter Form zu schaffen. Dabei wurden die klinischen Ergebnisse wie Schwanger-schaft-, Mehrlings- oder Komplikations-rate in den Vordergrund gestellt. Aspekte der Forschung (z. B. Stammzellen), des
General Assembly of Members
Executive Committee Committee of National Representatives
Central O�ce
ESHRE Consortia Other Consortia
EACC
Editorial O�ce
Publisher
Editors-in-Chief
Developing Countries
Fertility Preservation
PGS
Basic Scientists
Cross-border Treatment
Mild IVF
Demography/Epidemiology/Health Economics
Andrology
Early Pregnancy
Endometriosis & Endometrium
Embryology
Ethics & Law
Paramedical group
Psychology & Counselling
Reproductive Endocrinology
Reproductive Genetics
Reproductive Surgery
Safety & Quality in ART
Stem Cells
EIM Consortium
PGD Consortium
Sub-committees
Finance Sub-committee
Communications Sub-committee
Publications Sub-committee
International Scienti�c Committee
SIG Sub-committee
Task Forces
SIG Co-ordinators
Abb. 5 7 Struktur der Euro-pean Society of Human Re-production and Embryolo-
gy (ESHRE)
7Der Gynäkologe 2009 |
Einsatzes neuer Verfahren (z. B. Präim-plantationsdiagnostik) und soziodemo-graphische Zusammenhänge (z. B. der „Reproduktionstourismus“) fanden erst später Beachtung. Kernstück der inzwi-schen 9 Berichte [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] bildet eine Zusammenführung von zy-klusbezogenen (nicht Zentrum-bezoge-nen) Landesstatistiken, die sich mit den gängigen Verfahren – IVF, ICSI und dem intrauterinen Transfer zuvor kryokonser-vierter, fertilisierter Oozyten bzw. Em-bryonen-FER („frozen embryo replace-ment“) – beschäftigen (. Abb. �).
Eine zeitnahe Berichterstattung (. Tab. 2) ist von Anfang an angestrebt worden. Aufgrund der Vielzahl der Län-der, der wechselnden Ansprechpartner und des Erfahrungszugewinns während der Datensammlung hat sich der Fragebo-gen, der an die Register bzw. Verantwort-lichen der inzwischen 30 teilnehmenden Länder versandt wird, deutlich erweitert. Auch deshalb schwankt das Intervall zwi-schen Beobachtungszeit und Report zwi-schen 3 und 4 Jahren. Eine Verkürzung ist jedoch ab 2006 zu erwarten.
Der kürzlich publizierte Bericht von 2005 beinhaltet Daten aus 30 Ländern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Deutschland, Grie-chenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Lettland, Mazedonien, Montenegro, Nor-wegen, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine und Ungarn.
Fe d e r f ü h re nd w are n bi she r K.G. Nygren (Schweden) and A.N. An-dersen (Dänemark).
Die Struktur des EIM besteht aus dem sog. Steering Committee (Lenkungsaus-schuss), dem Koordinator der Daten-sammlung und dem Vorsitzenden. Dieser ist momentan Prof. Anders Nyboe Ander-sen aus Dänemark.
Prof. Karl Gosta Nygren widmet sich momentan der Arbeit des International Committee for Monitoring Assisted Re-productive Technologies (ICMART), ei-ne Einrichtung, die weltweite IVF-Ergeb-nisse zusammenträgt und publiziert.
Im Jahresbericht 2001 des EIM wur-de erstmals auch eine Übersicht über In-seminationsbehandlungen gegeben. Dies ist insofern besonders interessant, da ein entsprechendes Register in Deutschland nicht existiert (. Abb. 7).
Der Fragebogen, den die Verantwort-lichen der 30 teilnehmenden Länder in-zwischen ausfüllen müssen, umfasst 3 Module. Zunächst werden die IVF-Zen-tren nach Zykluszahl pro Jahr katego-risiert (<100, 100–199, 200–499, 500–999, ≥1000). Die Anzahl der Behand-lungen wird unterteilt in initiierte Zy-klen, Follikelpunktionen, Embryotrans-fers, Schwangerschaften und Geburten. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Behandlungen mit Präimplantati-
onsdiagnostik oder Eizellspende einge-schlossen werden. Diese werden separat abgefragt.
Als klinische Schwangerschaft gilt die WHO/ICMART-Definition, die einen so-nographisch oder histologisch gesicher-ten Gestationssack voraussetzt und somit auch Extrauterinschwangerschaften ein-schließt. Mehrere Gestationssäcke bei ei-ner Patientin zählen als eine Schwanger-schaft.
Als eigenständige Therapieentitäten gelten IVF, ICSI, FER, Eizellspende, Prä-implantationsdiagnostik, In-vitro-Matu-ration (IVM), der Transfer aufgetauter Eizellen („frozen oocyte replacements“, FOR), die homologe und die heterologe Insemination.
Behandlungserfolge werden in Ab-hängigkeit zum Alter der Frau (≤34, 35–39, ≥40) angegeben. Bezüglich der Er-gebnissqualität werden auch Komplikati-onen wie Überstimulation, Infektion, Blu-tungen, Todesfälle der Frau und fetale Re-duktionen abgefragt.
Mehrlinge werden als Zwillinge, Dril-linge und noch höhergradige Mehrlinge erfasst.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das EIM innerhalb der ESHRE einen umfassenden Überblick zu Therapieop-tionen im Bereich der humanen Repro-duktionsmedizin aus momentan 30 Län-dern gibt. In unregelmäßigen Abständen werden Workshops in Regionen abgehal-ten, die eigene Register aufbauen möch-ten und partizipieren wollen. Dabei hat das DIR seit Jahren eine aktive Unterstüt-zung geleistet und ist im Lenkungsaus-schuss vertreten.
Was erwarten wir von einem Fortpflanzungsmedizingesetz?
Das Problem der höheren Inzidenz von Mehrlingen nach Maßnahmen der assis-tierten Reproduktion wurde in Deutsch-land lange Zeit als ein typisches Problem der Länder angesehen, die nicht über die entsprechenden gesetzlichen Rege-lungen verfügten. Das deutsche ESchG, 1991 in Kraft getreten, schien mit sei-ner Bestimmung, maximal drei Embryo-nen pro Behandlung und Patientin kulti-vieren zu dürfen als „stabiler Damm vor der Flut von Mehrlingen“ [13]. Das Ma-
Tab. 2 Berichterstattung in den unterschiedlichen Registern
Analysezeit-raum
Berichterstattung EIM SART/CDCa,b DIRa,c
1997 2001 1999 1998
1998 2001 2000 1999
1999 2002 2001 2000
2000 2004 2002 2001
2001 2005 2003 2002
2002 2006 2004 2003
2003 2007 2005 2004
2004 2008 2006 2005
2005 2009 2007 2006
2006 Datenerhebung in den Ländern Oktober 2008
2008 2007
2007 Datenerhebung in den Ländern März 2009
Liegt noch nicht vor
2008
aKeine wissenschaftliche Publikation in einem etablierten Journal, sondern Jahresbericht in Druckform des Registers;bamerikanisches Register SART (Society for Assisted Reproductive Technology) gehört zur ASRM (American Society for Reproductive Medicine), CDC Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services:cDIR Deutsches IVF Register
� | Der Gynäkologe 2009
Leitthema
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Albanien
Bulgarien
Kroatie
n
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griech
enland
UngarnIrla
ndIta
lien
Litauen
Mazedonien
Norwegen
Polen
Portugal
Russland, G
US
Serbien
Slowenien
Spainen
Schweden
Türkei
Ukraine
Großbrit
annien und Nord
irland
Alle
Schwangerschaftsrate homologe Insemination (%) Frau < 40 JahreSchwangerschaftsrate heterologe Insemination (%) Frau < 40 Jahre
%
Abb. 7 7 Behandlungser-gebnisse von Inseminati-onsbehandlungen. (Mod.
nach [12])
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Albanien
Belgien
Bulgarien
Kroatie
n
Tschech
ische Republik
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griech
enland
UngarnIsl
andIrla
ndIta
lien
Litauen
Mazedonien
Montenegro
Norwegen
Polen
Portugal
Russland, G
US
Serbien
Slowenien
Spainen
Schweden
Schweiz
Niederlande
Türkei
Ukraine
Großbrit
annien und Nord
irland
Punktionen
klinische Schwangerschaften
(n)
Abb. 6 7 Behandlungshäu-figkeit (IVF/ICSI) nach Län-
dern. (Mod. nach [12])
9Der Gynäkologe 2009 |
ximum von drei zurückzusetzenden Em-bryonen schien nur Drillinge und Zwil-linge zuzulassen, die billigend in Kauf ge-nommen wurden, da sie im Vergleich zu höhergradigen Mehrlingen als eher un-problematisch angesehen wurden. Die USA mit über 40% an Mehrlingsschwan-gerschaften erschienen als das Schreck-gespenst, Deutschland dagegen als behü-tetes Land. Diese Sicht der Dinge war si-cher falsch.
Von allen Kindern, die in Deutschland nach assistierter Reproduktion bis zum Jahr 2002 geboren wurden, waren 40% Mehrlinge. Dieser Prozentsatz war zwei-fellos zu hoch.
Dabei konnte das DIR für das Jahr 2001 eine klare Beziehung zwischen der Zahl der geborenen Mehrlinge und der Zahl der zurückgesetzten Embryonen nachweisen. Bei der Rücksetzung von nur einem Embryo bei Frauen unter 35 Jahren waren 100% der geborenen Kinder Ein-linge. Wurden zwei Embryonen zurück-gesetzt, so stieg die Rate der Zwillinge auf 23,87% und die der Drillinge auf 0,2%.
Bei der Rücksetzung von drei Embry-onen waren nur noch 66,65% der gebo-renen Kinder Einlinge, während die Ra-
te der Zwillinge 27,99% und die der Dril-linge 5,36% betrug.
Vor dem Hintergrund dieser Zah-len und in Kenntnis der Risiken, die ei-ne Mehrlingsschwangerschaft für Mut-ter und Kinder bedeutet, erfolgte in der fortgeschriebenen Musterberufsordnung die klare Vorgabe, bei Frauen unter 38 Le-bensjahren nicht mehr als 2 Embryonen zurückzusetzen.
Deutsches IVF-Register: Keimzelle eines Bundesamtes für Fortpflanzungsmedizin?
Die Datenqualität der Register auf euro-päischer Ebene variiert erheblich. Oh-ne Zweifel gehört das DIR zu den Bes-ten weltweit [14]. Aber auch hier können Schwachstellen eruiert werden. Als ekla-tantes Beispiel muss hier die Diskussion um die Zahl der selektiven Fetozide ge-nannt werden, die im Jahr 2007 erhebliche Wellen geschlagen hat. Entsprechend den Angaben des DIR für das Jahr 2004 wur-den in Deutschland 222 selektive Fetozide nach IVF vorgenommen. Bei 8500 für das Jahr 2004 dokumentierten IVF-Geburten würde dies eine Inzidenz von 2,6% bedeu-
ten. Diese wäre nicht höher gewesen als im europäischen Durchschnitt. Hier be-trug im Jahre 2003 die durchschnittliche Inzidenz 2,7%, entsprechend 1136 Reduk-tionen bei 41.521 berichteten Geburten nach IVF. Das Problem lag aber darin, dass die Zahl der 222 fetalen Reduktionen in der Zwischenzeit in Frage gestellt wer-den konnte. Fehler, Widersprüche und Unstimmigkeiten in der Dokumentation ließen es unmöglich erscheinen, die ge-naue Zahl zu ermitteln. Und das ist bis heute der Stand der Dinge, ein völlig un-befriedigender, wenn nicht inakzeptab-ler Zustand. Für entsprechende Überprü-fungen vor Ort in den Laboratorien fehlen dem Register aber Geld, personelle Aus-stattung und Legitimation. Hier besteht ohne Zweifel Handlungsbedarf!
Gleiches gilt für die eine Vergleichbar-keit der Ergebnisse in Deutschland völlig unmöglich machenden Verzerrungen, die durch die „liberale Auslegung“ des ESchG hervorgerufen werden. Dazu hat auch der neue Kommentar von Günther, Tau-pitz und Kaiser seinen Teil beigetragen, in dem steht: „Wieviele Eizellen der Gynäko-loge zur Vermeidung überzähliger Embryo-nen... einem Befruchtungsversuch unterzie-
10
15
20
25
30
35
40
45
50
% 55
Albanien
Belgien
Bulgarien
Kroatie
n
Tschech
ische Republik
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griech
enland
UngarnIsl
andIrla
ndIta
lien
Litauen
Mazedonien
Montenegro
Norwegen
Polen
Portugal
Russland, G
US
Serbien
Slowenien
Spainen
Schweden
Schweiz
Niederlande
Türkei
Ukraine
Großbrit
annien und Nord
irland
Alle
Schwangerschaft pro Transfer IVF (%)
Schwangerschaft pro Transfer ICSI (%)
Abb. 8 9 Behandlungser-gebnisse von IVF- und IC-SI-Behandlungen. (Mod. nach [12])
10 | Der Gynäkologe 2009
Leitthema
hen und über das Vorkernstadium hinaus in vitro kultivieren darf, ohne sich dabei strafbar zu machen, kann inzwischen nie-mand mehr zuverlässig beantworten“ [16].
Tatsächlich scheinen nur gesetzlich institutionalisierte Register diese schwie-rigen Aufgaben erfüllen zu können. Ne-ben der verpflichtenden Teilnahme an der Datenerhebung ist eine regelmäßige Kon-trolle der Quelldaten durch regelmäßige Audits vonnöten, um die benötigte Daten-qualität sicherstellen zu können. In die-sem Zusammenhang nimmt das britische IVF-Register der Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) eine Son-der- und Vorbildstellung ein. Dieses Re-gister wird von einer behördlichen Ein-richtung getragen, und die verpflichten-de Datenübermittlung durch die prakti-zierenden Zentren ist mit einer strengen Kontrollfunktion verknüpft.
Es gibt momentan innerhalb der deut-schen Reproduktionsmedizin eine lebhafte Diskussion darüber, ob ein Bundesamt für Fortpflanzungsmedizin, z. B. angesiedelt am Robert-Koch-Institut, sinnvoll wäre. Dieses würde weitgehend autonom agie-ren. Die gesetzlich festzulegenden Aufga-
ben dieser Behörde könnten insbesonde-re folgende Bereiche umfassen:F Lizenzierung und Überwachung von
reproduktionsmedizinischen Zentren und Kliniken,
F Beratung der Regierung in allen Be-reichen der humanen Reproduktions-medizin,
F Entwicklung von Richtlinien undF jährliche Veröffentlichung von Leis-
tungsberichten.
Spätestens wenn es zu der sehnlichst er-warteten Novellierung des ESchG kom-men sollte, die dann einen elektiven Sing-le-Embryo-Transfer ermöglichen würde, wird das Problem der überzähligen „el-ternlosen“ Embryonen virulent. Spätes-tens dann müsste folglich eine neutrale, nicht in der Selbstverwaltung der Ärzte und nicht dem ständestaatlichen Denken verhaftete Institution geschaffen werden, die über das weitere Geschick dieser Em-bryonen wacht und entscheidet.
Wenn deutsche Reproduktionsmedizi-ner den Weg hin zur Embryonenadoption ebnen wollen, dann könnten sie auch eine solche Institution fordern.
Eine gewisse Modellfunktion könnte dabei die Arbeit des RKI im Rahmen der embryonalen Stammzellforschung in Deutschland haben. Hier wurden die Vorgaben des Stammzellgesetzes von 2002 umgesetzt und eine Zentrale Ethik-kommission für Stammzellenforschung (ZES) geschaffen. Die ZES, die mit dem Inkrafttreten des Stammzellgesetzes zum 01.07.2002 erstmalig berufen wurde, prüft und bewertet Anträge auf Import und Verwendung humaner embryonaler Stammzellen (hES-Zellen) und gibt Emp-fehlungen zu den Anträgen gegenüber der zuständigen Behörde, dem RKI, ab.
Die Grundlagen für die Tätigkeit der Kommission sind dabei in dem Ge-setz zur Sicherstellung des Embryonen-schutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryo-naler Stammzellen (Stammzellgesetz, St-ZG) vom 28.06.2002 (BGBl. I S. 2277) und in der Verordnung über die ZES und über die zuständige Behörde nach dem Stamm-zellgesetz (ZES-Verordnung, ZESV) vom 18.07.2002 (BGBl. I S. 2663) festgelegt.
In Analogie zu diesem Vorgehen könnte eine moderne Kontroll- und Rege-linstanz geschaffen werden, die auch wei-
0
6
12
18
24
30
36
Albanien
Belgien
Bulgarien
Kroatie
n
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griech
enland
UngarnIsl
andIrla
ndIta
lien
Litauen
Mazedonien
Montenegro
Norwegen
Polen
Portugal
Russland, G
US
Serbien
Slowenien
Spainen
Schweden
Schweiz
Ukraine
Großbrit
annien und Nord
irland
Alle0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0D
rillinge%Drillinge IVF ICSI (%)Zwillinge IVF ICSI (%)
Zwill
inge
%
Abb. 9 7 Zwillings- und Drillingsraten bei IVF und
ICSI. (Mod. nach [12])
11Der Gynäkologe 2009 |
tere strittige Techniken und Behandlungs-formen, z. B. die Eizellspende bis hin zur Leihmutterschaft ggf. möglich machen könnte.
Die Diskussion darüber ist aber nicht abgeschlossen und wird wohl noch eini-ge Zeit in Anspruch nehmen, zumal es auch Beispiele dafür gibt, dass staatliche Regulierungen Einschränkungen im Be-reich der humanen Reproduktionsmedi-zin und auch Verschlechterungen von Re-gisterqualität mit sich bringen können.
Fazit für die Praxis
Das DIR stellt neben der Entwicklung der Reproduktionsmedizin in Deutsch-land die aktuelle Situation sehr exakt dar. Während 19�2 nur 742 Behandlungen in Deutschland durchgeführt worden wa-ren, wurden für das Jahr 2007 11.2�� Be-handlungen mit der Technik der in-vit-ro-Fertilisation (IVF), 30.921 Behand-lungen mit der Technik der intrazyto-plasmatischen Spermieninjektion (IC-SI) und 1�.312 Behandlungen zur Rück-setzung eingefrorener Eizellen im Vor-kernstadium registriert. Diese Zahlen be-legen, dass die Fortpflanzungsmedizin in Deutschland trotz der Auswirkungen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes von 2004 längst nicht mehr zur Behand-lung einer Randgruppe unserer Gesell-schaft dient. Zu den Entwicklungen in Europa geben die jährlichen Berichte des European IVF-Monitoring Consorti-ums (EIM) der European Society of Hu-man Reproduction and Embryology (ES-HRE) Auskunft.
KorrespondenzadresseProf. Dr. R. FelberbaumChefarzt der Frauenklinik, Klinikum Kempten-Oberallgäu, Standort Robert-Weixler-StraßeRobert-Weixler-Str. 50, 87439 [email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. (1998) Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durchführung der assistierten Reproduktion. Dtsch Arztebl 95(49) Seite A-3166
2. Felberbaum R, Bühler K, van der Ven H (2007) Das Deutsche IVF-Register (1996–2006) 10 Jahre Re-produktionsmedizin in Deutschland. Springer, Ber-lin Heidelberg New York Tokio
3. Brown S (2005) ESHRE – the first 21 years. Publis-hed by ESHRE, http://www.eshre.com
4. Nygren KG, Andersen AN (2001) Assisted repro-ductive technology in Europe, 1997. Results gene-rated from European registers by ESHRE. European IVF-Monitoring Programme (EIM), for the Europe-an Society of Human Reproduction and Embryolo-gy (ESHRE). Hum Reprod 16(2):384–391
5. Nygren KG, Andersen AN (2001) European IVF-monitoring programme (EIM) Assisted reproduc-tive technology in Europe, 1998. Results genera-ted from European registers by ESHRE. European Society of Human Reproduction and Embryology. Hum Reprod 16(11):2459–2471
6. Nygren KG, Andersen AN (2002) Assisted repro-ductive technology in Europe, 1999. Results gene-rated from European registers by ESHRE. Hum Re-prod 17(12):3260–3274
7. Andersen NA, Gianaroli L, Nygren KG (2004) Assis-ted reproductive technology in Europe, 2000. Re-sults generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod 19:490–503
8. Andersen NA, Gianaroli L, Felberbaum R et al (2005) Assisted reproductive technology in Euro-pe, 2001. Results generated from European regis-ters by ESHRE. Hum Reprod 20(5):1158–1176
9. Andersen NA, Gianaroli L, Felberbaum R et al (2006) Assisted reproductive technology in Euro-pe, 2002. Results generated from European regis-ters by ESHRE. Hum Reprod 21(7):1680–1697
10. Andersen NA, Goossens V, Gianaroli L et al (2007) Assisted reproductive technology in Europe, 2003. Results generated from European registers by ES-HRE. Hum Reprod 22(6):1513–1525
11. Andersen NA, Goossens V, Ferraretti AP et al (2008) The European IVF-monitoring (EIM) Consortium. Assisted reproductive technology in Europe, 2004. Results generated from European registers by ES-HRE. Hum Reprod 23(4):756–771
12. Andersen AN, Goossens V, Bhattacharya S et al (2009) Assisted reproductive technology and intra-uterine inseminations in Europe, 2005: results ge-nerated from European registers by ESHRE – The European IVF-monitoring (EIM) Consortium for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Hum Reprod (online first)
13. Gesetz zum Schutz von Embryonen (EschG) BGBl (1991) 1:2746
14. Diedrich K, Felberbaum R, Griesinger G et al (2008) Reproduktionsmedizin im internationalen Ver-gleich. Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung
15. Kaiser P, Günther HL, Taupitz J (2008) Embryonen-schutzgesetz: Juristischer Kommentar mit medi-zinisch-naturwissenschaftlichen Einführungen, 1. Aufl. Kohlhammer, Stuttgart
16. Allensbacher Bericht 2007, Nr. 1117. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1276/
umfrage/anzahl-der-mehrlingskinder-je-1.000-ge-borene/
12 | Der Gynäkologe 2009
Leitthema