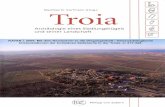Von der Sprache der Götter und Geister: bedeutungsgeschichtliche ...
Die Sprachsituation der Slovakei: Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart
Transcript of Die Sprachsituation der Slovakei: Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart
Leeuwen-Turnovcová, J. van/Richter, N. (Hrsg.) 2006. Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender (Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal).
Beiträge des Kolloquiums an der FSU-Jena, Dezember 2004, S. 91-125.
D I E S P R A C H S I T U A T I O N I N D E R S L O V A K E I : D I G L O S S I E I N D E R V E R G A N G E N H E I T U N D I H R E S P U R E N I N D E R
G E G E N W A R T *
Markus Giger, Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
0. Einleitung Die slovakische Standardsprache gehört bekanntlich zu den ‚jungen‘ slavischen Standardsprachen. Als erste explizite Kodifikation des Slovakischen gilt allgemein die Dissertatio philologico-kritica de litteris Slavorum von Anton Bernolák aus dem Jahre 1787. Stimmt man dieser Ansicht zu, so stellt sich allerdings auch die Frage, wie die vorangegangene Zeit bzw. die in ihr entstandenen Texte interpretiert werden sollen. In der Slovakei wird diesbezüglich allgemein vom predspisovné obdobie, der „vorschriftsprachlichen Zeit“ gesprochen, in der das Tschechische hier eine signifikante Rolle als Schriftsprache spielte (Pauliny 1948, 1983; Kraj�ovi�/Žigo 2002).
Umgekehrt ist bekannt, dass die wichtige Rolle des Tschechischen in der Slovakei weder im Jahre 1787 noch im Jahre 1843, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der letztlich erfolgreichen Kodifikation des Slovakischen durch �udovít Štúr, beendet war, sondern dass sie sich im 19. Jhdt. fortsetzt, zur Zeit der 1. Tschechoslovakischen Republik entscheidend gestärkt wird und nach dem Ende des 2. Weltkriegs in der erneuerten Tschechoslovakei verschiedene Peripetien durchläuft, um schließlich auch nach der Entstehung der eigenständigen Slovakischen Republik unter neuen Vorzeichen weiterzubestehen (Thomas 1992; Marti 1993; Berger 1997, 2000a, b, c; Náb�lková 1999).
Es drängt sich daher die Frage auf, inwiefern die Entwicklung des schriftsprachlichen Slovakischen in seinem Wechselverhältnis zum Tschechischen als kontinuierlich aufzufassen ist und inwiefern die expliziten Kodifikationen, die als entscheidende Wegmarken aufgefasst werden, wirkliche Brüche in der Entwicklung darstellen. In diesem Kontext geht es darum, die Veränderungen der Form und insbesondere der Verwendung des schriftsprachlichen Tschechischen in der Slovakei und seine Ersetzung durch das Slovakische im Rahmen einer allgemeinen Theorie von Standardsprache und Sprachsituation einzufangen (vgl. z.B. Barnet 1977, 1981; Rehder 1995; Scharnhorst 1995; Gladkova/Likomanova 2002), und so sowohl korpus- als auch statusorientiert zu einem komplexen Bild der geschichtlichen Entwicklung der (slavischen) Schrift- und Standardsprache(n) in der Slovakei des 14. bis 20. Jhdt. zu gelangen.1
Angesichts des Umstandes, dass zwei nicht-slovakische Spezialisten für die slovakische Sprachgeschichte (Lifanov 2001; Lauersdorf 2002, 2003) in jüngster Zeit das Konzept der Diglossie auf die frühneuzeitliche slovakische Sprachsituation angewendet haben, bietet es sich an, dieses Konzept mit einzubeziehen.
Die skizzierten Fragestellungen können bestenfalls monographisch, nicht aber in einem einzelnen Aufsatz erschöpfend beantwortet werden. Insbesondere die formalen
* Der vorliegende Text wurde im Rahmen des ‚výzkumný zám�r MSM – 0021620825‘ verfasst. Für einige Literaturhinweise danke ich �ubomír �urovi� (Lund).
1 Ich verwende den Termin ‚Standardsprache‘ erst für die Moderne und spreche davor von ‚Schriftsprache‘. Vgl. auch Berger (2001: 236).
92 Markus Giger
Veränderungen sind bei weitem nicht ausreichend beschrieben. Ich werde mich daher in den folgenden Ausführungen weitgehend auf die existierenden Beschreibungen stützen und nur ausnahmsweise ergänzendes Textmaterial hinzuziehen. Der Hauptakzent wird auf der Interpretation der bislang bekannten Daten und Fakten liegen.
1. Konzeptionen der Geschichte des Slovakischen in der bisherigen Literatur Das Tschechische ist, wie bekannt, die älteste westslavische Schriftsprache. Seine zusammenhängende Überlieferung beginnt Ende des 13. Jhdt., und im 14. Jhdt. weist es bereits eine breite Skala von Textsorten und funktionalen Domänen auf (Havránek 1936: 18-48, Cu�ín 1985: 20-24, Dalewska-Gre� 2002: 563). Das Alttschechische hat erheblichen Einfluss auf die Entstehung der altpolnischen Schriftsprache (Havránek 1936: 44ff., Dalewska-Gre� 2002: 564) und dringt schon in der zweiten Hälfte des 14. Jhdt. in die Slovakei vor, wo es als fertiger Code in seiner prinzipiell mittelböhmischen Form übernommen wird, ohne dass vorerst eine gezielte Veränderung angestrebt wird (Pauliny 1948: 28-30, 1983: 76-78; Doru�a 1977: 34; �urovi� 1980: 212; Berger 1997: 163; Lifanov 2001: 43; Kraj�ovi�/Žigo 2002: 45-48; Lauersdorf 2002: 249, 2003: 50).2
Mit einer stärkeren Slovakisierung wird dann v.a. im 16. Jhdt. gerechnet (Lifanov 2001: 206-209, Kraj�ovi�/Žigo 2002: 78-90, Lauersdorf 2003: 52f.). Ein besonderes Problem stellen dabei die sog. ‚slovakischen Kultursprachen (Kulturdialekte)‘ dar: Ein Teil der slovakischen Sprachhistoriker vertritt die Ansicht, ab dem 16. Jhdt. trete das Slovakische in der Form dreier Schriftdialekte auf (West-, Zentral und Ostslovakisch), welche – unter Beibehaltung der tschechischen Basis – bereits bestehende regionale mündliche Koiné-Formen3 repräsentierten und zum Tschechischen in Konkurrenz traten (vgl. Pauliny 1983: 118-136; zum Begriff vgl. auch Berger 1997: 166f. und ausführlich Lifanov 2001: 9-11). Entsprechend definiert Pauliny:
(1) „Kultúrna sloven�ina je jazykový útvar, relatívne ustálený, ktorý sa používal najprv v administratívno-právnych zápisoch, neskoršie, ale ešte v 16. storo�í, aj v iných žánroch. Spisovným, teda nadnáre�ovým východiskom, resp. kostrou bola v �om spisovná �eština, ale jeho komunikatívnu platnos v hláskosloví, morfológii a v slovníku zabezpe�ovala do zna�nej miery sloven�ina.“ (Pauliny 1983: 119)
Zuerst repräsentiert und am besten beschrieben ist die ‚westslovakische Kultursprache‘ mit Zentrum Trnava (Kraj�ovi�/Žigo 2002: 96-102). An diese Sprachform knüpft letztlich die Kodifikation von Bernolák an (Kraj�ovi�/Žigo 2002: 135). Die Differenzierung der ‚Kultursprachen‘ im Detail ist strittig (vgl. Lifanov 2001: 11). Kraj�ovi�/Žigo (2002: 83-90) scheiden im 16. bis 18. Jhdt. sowohl das ‚normalisierte slovakisierte Tschechische‘ vom ‚nicht-normalisierten‘ als auch die ‚normalisierten slovakischen Kultursprachen‘ von den ‚nicht-normalisierten‘ (a.a.O.: 112-125), wobei ‚Normalisierung‘ eine „relative Einheitlichkeit des graphischen, orthographischen und grammatischen Baus“ bedeutet (a.a.O.: 112).
2 Dies heißt umgekehrt nicht, dass nicht von allem Anfang an phonetisch-phonologische, morphologische und lexikalische Slovakismen in den prinzipiell alttschechischen Texten als Ergebnis von Interferenzerscheinungen zu finden wären, wie alle angeführten Autoren bestätigen.
3 Kraj�ovi� führt diese bis ins 11. Jhdt.(!) zurück (vgl. Lifanov 2001: 11, Kraj�ovi�/Žigo 2002: 49ff.). Zu dieser Richtung der slovakischen Sprachgeschichtsschreibung gehört auch die Einbeziehung des Altkirchenslavischen in die slovakische Sprachgeschichte (vgl. Kraj�ovi�/Žigo 2002: 12-32), wie dies übrigens auch in Darstellungen der tschechischen Sprachgeschichte üblich ist (vgl. Havránek 1936: 3-11, Cu�ín 1985: 13-16). Darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden (vgl. dazu �urovi� 2004a und b sowie Berger 1997: 162f.). Offensichtlich nicht im hier diskutierten terminologischen Sinn der slovakistischen Tradition verwendet den Terminus ‚Kultursprache‘ Dvo�áková (2004: 167), wenn sie schreibt, das Tschechische habe in der Slovakei als kulturní jazyk funktioniert.
Die Sprachsituation in der Slovakei 93
Kaum verwendet wird der Begriff der ‚slovakischen Kultursprachen‘ in den Arbeiten von Doru�a, der sich gegen die Vorstellung von einem auf tschechischer Grundlage entstandenen slovakischen Idiom wendet und die Kontinuität der Differenz zwischen beiden Sprachen betont (Doru�a 1977: 41, 108, Doru�a et al. 1998, Lifanov 2001: 11).
Von der entgegengesetzten Seite her relativiert �urovi� die Vorstellung der ‚slovakischen Kultursprachen‘. Er betont, dass für die Zeit bis Mitte des 18. Jhdt. von einer gemeinsamen Schriftsprache von Tschechen und Slovaken auszugehen ist, die in einigen in der Slovakei entstandenen Grammatiken ihren Niederschlag gefunden hat und sich sowohl vom zeitgenössischen gesprochenen Slovakischen als auch Tschechischen unterschied (�urovi� 2000a: 28, 2000b: 33-35; Lifanov 2001: 11).
Eine weitere alternative Sicht bietet Lifanov (2001) mit seiner Auffassung, dass vom 14. Jhdt. bis in die 30er Jahre des 16. Jhdt. in der Slovakei eine slovakische Redaktion des Alttschechischen entsteht (��������� ������ �� ������� ������ ��� �����), welche ab den 30er Jahren des 16. Jhdt. durch die „altslovakische Schriftsprache“ (��������� ������ �� ���� ������ ����) abgelöst wird, die immer noch auf tschechischer Grundlage beruht, sich jedoch mit der Zeit vom Tschechischen absondert (Lifanov 2001: 218).
Die Unterschiede insbesondere zu den Konzeptionen von Pauliny und Doru�a sind nicht nur terminologischer Natur. Lifanov betont, dass nicht die genetische Zugehörigkeit einzelner, in Texten aus der Slovakei auftretender Elemente entscheidend ist, sondern vielmehr deren Funktion (2001: 13f.). Gelingt es zu zeigen, dass die in der Slovakei des 16. bis 18. Jhdt. verwendete Schriftsprache eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, welche sich von denjenigen der in den Böhmischen Ländern verwendeten Schriftsprache unterscheiden, so kann man diese Sprachform bereits als slovakische Schriftsprache bezeichnen, unabhängig davon, wie viele und welche Bohemismen sie enthält:
(2) „... �� ��� ������ ����������� – �������� ��� ����� �������� ����� ���� ���. ����� – ��������� ����� ���! �������� ���". #�$"���� �� ��� – ��������� %����, ������� �� ���� &�����! �������&�� ����� ��� ��������� ����������� ��� ������ ��� ������"����� ������ ����������� ����! ��� ����& ������������ "������� � ����� ���� ������, ���"�� �������������� � &����������� '�������� ��������� ������ ���&���������.“ (Lifanov 2001: 16)
Die mit den ‚slovakischen Kultursprachen‘ rechnenden Konzeptionen (aber auch diejenige von Doru�a) sind stark vom Bestreben geprägt, die allmähliche ‚Lösung‘ des schriftsprachlichen Slovakischen vom Tschechischen zu unterstreichen. Die Konzeption der ‚slovakischen Kultursprachen‘ an sich und ihrer Differenzierung vom ‚slovaki-sierten Tschechischen‘ (und erst recht die Feindifferenzierung in den normalisierten und nicht-normalisierten Typ beiderseits) wird dabei m.E. nicht ausreichend thematisiert und hinterfragt. Sie wird vielmehr im Sinne eines Fortschreibens der bestehenden Tradition weitergetragen, obwohl sie – wie bei Lifanov (2001: 9-11) geschildert – von Pauliny unter beträchtlicher Abwandlung eines Begriffs von Horálek entwickelt wurde. Zwar führen Kraj�ovi�/Žigo (2002) einige orthographische, phonetisch-phonologische und morphologische Merkmale an, die sie mit den einzelnen Varietäten verbinden (a.a.O.: 85, 113), aber deren Zahl ist relativ gering und sie wirken immer noch recht isoliert (teilweise handelt es sich um rein graphische Normen, welche mit einer Opposition slovakischer vs. tschechischer Elemente nichts zu tun haben, so etwa die Verwendung des Graphems v statt w oder des Graphems i statt y, die Restringierung des Graphems y auf die Position am Wortende u. dgl.; vgl. a.a.O.: 113, Dvo�áková 2004:
94 Markus Giger
169).4 Es wird auch nicht versucht, die Unterschiede insgesamt, systematisch und z.B. unter Anwendung quantifizierender Methoden zu belegen. �urovi�s Konzeption ist stark statusorientiert. Sie geht v.a. von frühneuzeitlichen
Grammatiken aus dem Gebiet der Slovakei aus und ist geprägt von kodifikatorisch intendierten Aussagen der entsprechenden Grammatiker über einzelne Laute, Formen und Paradigmen sowie über die slovakische, tschechische oder „slovako-tschechische“ Sprache überhaupt (eine Ausnahme ist die detaillierte Analyse der Sprache von Hugolín Gavlovi�s „Valaská škola“, �urovi� 1987). Die Beschreibung dieser Tradition und ihres historischen Zusammenhangs mit der Grammatikschreibung in den Böhmischen Ländern ist sehr wertvoll, und es ist gegen sie nichts einzuwenden; man muss sich einfach im klaren darüber sein, dass sie nicht mit der Beschreibung der Sprache von Texten gleichzusetzen ist, die in der entsprechenden Zeit in der Slovakei entstanden sind. Außerdem ist sie rein durch die zur Verfügung stehenden Dokumente (Grammatiken) stark durch das protestantische Milieu geprägt, welches sich vom katholischen in mancherlei Hinsicht unterschied, wie noch ausgeführt werden wird (auch hier bildet bei �urovi� wieder die Analyse der Sprache des Katholiken Gavlovi� den Kontrastpunkt).
In dieser Situation ist die Konzeption von Lifanov mit ihrer entschieden korpusorientierten Ausrichtung und ihrer zumindest teilweisen Quantifizierung der einzelnen in konkreten Texten vorgefundenen Varianten ein wichtiger Schritt weiter. Terminologisch und in ihrem Verständnis des Verhältnisses zwischen zwei Schriftsprachen auf demselben Territorium in vormoderner Zeit ist sie stark durch die russische Tradition der Interpretation des ostslavisch-kirchenslavischen Verhältnisses geprägt (vgl. dazu Abschnitt 4).
2. Einige Gedanken zu Möglichkeiten und Grenzen der Beschreibung der slovakischen Sprachgeschichte An dieser Stelle scheint es lohnend, die Frage zu stellen, mit welcher Ausgangslage und Aufgabe die Beschreibung der slovakischen Sprachgeschichte des 16. bis 18. Jhdt. im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch erfolgen soll. Das Problem beginnt schon beim Material: Zwar ist im 16. Jhdt. die Zahl der erhaltenen Texte bereits beträchtlich und sie nimmt im Verlaufe der Zeit noch zu (vgl. HSSJ I: 43-65), aber es ist nicht a priori klar, welche Texte als Materialgrundlage für eine zu schreibende Geschichte des Slovakischen genommen werden können. Natürlich müsste die Antwort lauten: „die in slovakischer Sprache geschriebenen“. Aber dies würde voraussetzen, dass man Slovakisch und Nicht-Slovakisch in dieser Zeit eindeutig trennen kann, was natürlich, nach dem in Abschnitt 1 Gesagten, nicht der Fall ist. Der HSSJ (I: 14, 17) definiert deshalb seine Materialbasis vorerst geographisch („pamiatky
4 Für die nicht-normalisierten Varietäten sollen auch hybride Elemente wie slibujem (Stamm
phonetisch eindeutig tschechisch, Endung eindeutig slovakisch) stärker charakteristisch sein (Dvo�áková 2004: 169). Häufig wird auch versucht, die absichtliche Slovakisierung von Texten (mit dem Ziel ihrer besseren Verständlichkeit in der Slovakei) zu unterscheiden von der unwillkürlichen, durch mangelnde Beherrschung des Tschechischen verursachten (vgl. Dvo�áková 2004: 168). Als Indiz gilt Dvo�áková (auch unter Berufung auf Doru�a) u.a. das Auftreten hyperkorrekter Formen des Typs młauwenj, po Nemeckau bei Masnicius (für tsch. mluvení, po n�mecku). Giger-Sitárová (2004: 127) zitiert allerdings aus dem noch unveröffentlichten Material des SSN die Formen mlúvit, múvit aus dem Dialekt des Záhorie, so dass zumindest für den ersten Fall die Begründung auch hier gesucht werden kann, zumal dieser Dialekt (bzw. genauer der Grenzdialekt der Stadt Skalica) im 18. Jhdt. eine prestigeträchtige Form des Slovakischen darstellte (�urovi� 2000c: 112f.; vgl. dazu auch Abschnitt 4).
Die Sprachsituation in der Slovakei 95
pochádzajúce zo starého slovenského etnického územia, resp. vztahujúce sa na toto územie“), um dann im Hinblick auf die sprachliche Zugehörigkeit nachzusetzen:
(3) „Slovenskú jazykovú pamiatku predstavuje taký rukopisný alebo tla�ený text, ktorý možno poklada za slovenský nielen pod�a pôvodu autora, miesta vzniku, ur�enia pamiatky ap., ale aj pod�a jazyka pamiatky. Okrem pamiatok, v ktorých sa slovenské jazykové prvky uplat�ujú pravidelnejšie vo všetkých jazykových rovinách, zahrnujú sa do pramennej základne HSSJ aj také pamiatky, v ktorých sa slovenské jazykové prvky vyskytujú jednotlivo a sporadicky. Z pamiatok tohto druhu sa vyberali iba výrazy s hláskoslovnými, gramatickými a najmä lexikálnymi slovakizmami. (...) Okrem stup�a jazykovej slovacity prame�ov, ktorý je základným kritériom výberu, prizeralo sa aj na to, aby boli zastúpené pamiatky z rozli�ných oblastí územia Slovenska a z rozli�ných období (storo�í). Dôležitým kritériom bol aj žánrový a tematický charakter pamiatky.“ (HSSJ I: 17)
Aus dieser Formulierung gehen die Probleme relativ deutlich hervor: Zwar wird das sprachliche Kriterium als das grundlegende bezeichnet, doch es kommt erst nach der Herkunft des Autors (der im übrigen oft unbekannt ist), dem Ort der Entstehung des Textes und seiner Bestimmung. Darüber hinaus wird vom „Grad der Slovacität“ der Texte gesprochen, eine Formulierung, welche auf ein Kontinuum zwischen sprachlich slovakischen und nicht-slovakischen Texten hindeutet. Ein solches Kontinuum kann nur zwischen zwei eng verwandten, d.h. im vorliegenden Fall slavischen Sprachen bestehen. Wenn in einem lateinischen, ungarischen oder deutschen Text slovakische Elemente auftreten, so sind diese fast ausschließlich lexikalischer Natur und lassen sich in den allermeisten Fällen eindeutig bestimmen (vgl. Kraj�ovi�/Žigo 2002: 44f.; dasselbe gilt natürlich auch im umgekehrten Fall des Auftretens von Latinismen, Hungarismen oder Germanismen in einem slovakischen Text, vgl. Doru�a 1977). Zwischen zwei slavischen und erst recht westslavischen Sprachen kann jedoch ein Kontinuum vorliegen, da prinzipiell Elemente verschiedener Sprachebenen aus beiden Sprachen miteinander kombiniert werden können.5 Dies umsomehr zu einer Zeit, in der eine Standardsprache im heutigen Sinne fehlt. Dazu kommt, dass die tschechischen und slovakischen Dialekte bis heute ein ausgeprägtes Kontinuum darstellen, in dem aufgrund rein sprachlicher Merkmale keine deutliche Grenze zu ziehen ist (vgl. B�li� 1972: Karte 2).6 Dies führt dazu, dass zwischen den westslovakischen und den
5 Was für das Verhältnis zwischen Tschechisch und Slovakisch gilt, gilt prinzipiell auch für das
Verhältnis zwischen Slovakisch und Polnisch. Das Polnische spielte in der Slovakei des 16.-18. Jhdt. tatsächlich als Schriftsprache eine gewisse Rolle; im Vergleich zum Tschechischen allerdings stärker beschränkt, sowohl regional (auf die Ostslovakei) als auch funktional (auch in der Ostslovakei konkurrierten das Tschechische bzw. schriftsprachliche Elemente tschechischer Herkunft). Vgl. dazu Doru�a (1977: 47-54).
6 Den kontinuierlichen Übergang zwischen Tschechisch und Slovakisch aus dialektaler Sicht betont auch Berger (1997: 160f.). Er konstatiert dann jedoch: „Trotz des Übergangscharakters der mährischen Dialekte ist die Grenze zwischen Tschechisch und Slowakisch relativ einfach zu ziehen – sie deckt sich im wesentlichen mit der Grenze zwischen r und �.“ Dies ist zwar insofern richtig, als tatsächlich östlich der tschechisch-slovakischen Staatsgrenze der Laut [�] nicht auftritt (bzw. nur in den sog. goralischen Mundarten, welche neben diesem noch eine Reihe weiterer Merkmale zeigen, welche bereits auf das Polnische verweisen; vgl. Štolc 1994: 92, 140-143). Westlich dieser Grenze fehlt [�] nur in solchen Dialekten, welche auf slovakische Kolonisation zurückgehen (so auch Berger; vgl. zur genauen Geographie (JA I: 61, Karte F, Isoglosse 4). Entscheidend ist jedoch, dass dieses lautliche Merkmal in Ostmähren ebensowenig in einer 1:1-Relation mit dem sprachlichen Bewusstsein der Sprecher steht wie alle anderen lautlichen Merkmale: Im Punkt 728 Halenkovice des (JA wissen Sprecher der jüngeren Generation nichts mehr vom einstigen Fehlen des [�] in ihrer Gemeinde, wie ich feststellen konnte, während man im Punkt 737 Hlohovec Formen wie tri oder rekla sem statt t�i bzw. �ekla jsem auf der Straße hören kann (zumal von älteren Sprechern) und die Sprecher angeben, sie würden in benachbarten Gemeinden wegen des fehlenden [�] mit dem Spitznamen Parížané „Pariser“ (statt Pa�ížané) bedacht. Ein Unterschied im (tschechischen) Sprachbewusstsein ist damit zumindest heute nicht verbunden. Dieses macht sich an der historischen Landes- und heutigen Staatsgrenze fest, welche die Amts- und
96 Markus Giger
tschechischen Dialekten eine Reihe von Übereinstimmungen bestehen, welche zwischen der (zentralslovakisch basierten) slovakischen Standardsprache und den verschiedenen Varietäten des Tschechischen nicht bestehen.7 Mit anderen Worten, in vielen Fällen ist nicht ohne weiteres zu entscheiden, ob ein isoliertes Element als tschechisch oder westslovakisch angesehen werden soll, sei es im lautlichen Bereich (z.B. tsch. u. westslk. k(t)erý, pátek gegenüber standardslk. ktorý, piatok), in der Morphologie (tsch./westslk. byl vs. standardslk. bol, tsch./westslk. není/neni vs. standardslk. nie je, tsch./westslk. na ruce, na noze gegenüber standardslk. na ruke, na nohe, tsch./westslk. synové vs. standardslk. synovia, tsch./westslk. o dobrém vs. standardslk. o dobrom) oder im Lexikon8 (tsch./westslk. d�lat/dela� vs. standardslk. robi�, tsch./westslk. jestli vs. standardslk. ak).
Ein weiteres Moment kommt erschwerend hinzu: Ein Teil der lautlichen Prozesse, welche das heutige Standardtschechische vom Standardslovakischen unterscheiden, ist in der uns interessierenden Zeit erst im Gange. So setzt zwar die Diphthongierung des alten ý zu ej im Tschechischen bereits Ende des 13. Jhdt. ein, zeigt sich aber in den erhaltenen Texten erst Ende des 14. Jhdt. in größerem Umfang, die Diphthongierung ú > ou gar erst im 15. Jhdt. Die Veränderung des tautosyllabischen aj zu ej geht im 15.-16. Jhdt. vor sich. Die Monophthongierung ie > í ist erst im 16. Jhdt. stärker in erhaltenen Texten repräsentiert, ebenso die Monophthongierung uo > � [ú]. Die Verengung é > í stabilisiert sich erst im 16.-17. Jhdt.; das prothet. v- vor o- ist zwar bereits im 14. Jhdt. belegt, erreicht aber erst im 16. Jhdt. seine heutige geographische Ausdehnung (vgl. zu diesen tschechischen lautlichen Prozessen Lamprecht/Šlosar/Bauer 1986: 98f., 103-117). In manchen Fällen ist also nicht zu entscheiden, ob eine einzelne Form (z.B. súd) den gemeinsamen Zustand darstellen soll, wie er ursprünglich bestanden hatte, oder den Zustand nach der tschechischen Innovation, d.h. bereits den spezifisch slovakischen. Explizit aussagekräftig ist in solchen Fällen nur die innovierte, spezifisch tschechische Variante (im konkreten Falle soud).
Dialektale und historische Varianz können aufgrund unterschiedlicher phonetischer und morphologischer Entwicklungen auch kombiniert auftreten: vgl. alttsch./westslk. s tú dobrú ženú vs. standardtsch./standardslk. s tou dobrou ženou, tsch.-dialektal /westslk. ženama vs. standardtsch./standardslk. ženami usw. Im Falle der Entwicklung des historischen langen ó zeigen die meisten westslovakischen Dialekte den ältesten Zustand (kó�), das Zentralslovakische mit uo (standardslovakisch graphisch ô) einen mittleren (kô�), während das Tschechische (ohne das durch zentralslovakische Kolonisation entstandene kopani�á�ské ná�e�í in Ostmähren, aber samt dem Dialekt des westslovakischen Záhorie) mit ú (standardtschechisch graphisch �) den jüngsten Stand aufweist (vgl. ASJ 1/1: 91, 1/2: 174ff.). Findet man in einem Text eine Form wie vieme, so kann sie grundsätzlich den älteren gemeinsamen (tschechischen und slovakischen) Zustand darstellen, aber auch den spezifisch zentral- und heute standardslovakischen. Demgegenüber kann die Form víme den jüngeren tschechischen oder aber westslovakischen Stand darstellen.
Dabei muss man sich bewusst sein, dass der heutige Stand der einzelnen Dialekte nicht per se mit einem bestimmten historischen Zustand gleichgesetzt werden darf.
Schulsprache, kurz die die Mundart überdachende Standardsprache, festlegt. Vgl. dazu auch Dolník (1998: 88f.).
7 In manchen Fällen betreffen die Übereinstimmungen natürlich nur einen Teil der westslovakischen bzw. tschechischen Dialekte.
8 Vgl. dazu Giger-Sitárová (2004: 117-131). Allgemein wird die Wortgeographie in Arbeiten zum frühneuzeitlichen Slovakischen relativ wenig eingesetzt. Vgl. jedoch detailliert und quantifiziert �urovi� (1987: 697-707).
Die Sprachsituation in der Slovakei 97
Probleme bringen insbesondere Innovationen der slovakischen Dialekte, wenn das Tschechische den älteren gemeinsamen Zustand beibehält. Giger-Sitárová betont dies für den Bereich der Lexik:
(4) „Ak máme slovo, ktoré je doložené v �eštine, ale nie je doložené v žiadnom slovenskom náre�í, ur�ujeme ho ako �eské. Uvedomujeme si zárove�, že tento prístup nie je úplne spo�ahlivý, pretože dané slovo mohlo existova v slovenskom náre�í a neskôr zaniknú.“ (Giger-Sitárová 2004: 117)
Aber auch wenn eine entsprechende Innovation sich nur in einem Teil der slovakischen Dialekte durchsetzt, ist die genaue Chronologie der Veränderung nicht ohne weiteres klar, denn beweiskräftig ist nur ihr Auftreten, nicht jedoch ihr Fehlen, da dieses auch dem Tschechischen ‚angelastet‘ werden kann. Betroffen sind natürlich auch lautliche und insbesondere morphologische Innovationen (vgl. Abschnitt 3).
Ein weiteres Problem stellt die Graphik der erhaltenen Texte dar, die oft phonetisch und phonologisch relevante Informationen nur ungenügend oder inkonsequent wiedergibt; dies betrifft z.B. die Quantität der Vokale oder manche Konsonanten, und zwar nicht nur in Texten aus der Slovakei (Berger 1997: 164 betont, dass die Anthologie Porák 1979 noch für das 17. Jhdt. Texte enthält, die nur inkonsequent Diakritika benutzen). Von manchen Autoren wird die Aussagekraft einiger Grapheme generell relativiert:
(5) „... najtypickejšie �eské grafémy, ako sú �, au [=ou, MG], �, � sa za�ali na Slovensku používa nefunk�ne, �asto ako pozi�né varianty, alebo plnili aj inú, odlišnú funkciu ako v �eskom prostredí. Tak napr. digrafémou au sa za�alo ozna�ova dlhé ú, napr. maudry, praud, blau�á ap., grafémou � sa okrem mäkkosti predchádzajúcej spoluhlásky (d�ssti�ka, u�it�le ap.) ozna�ovala aj dvojhláska ie, napr. chl�w, kl�tka, l�skowy strom, l�skowy hág ap., grafémou � sa okrem dlhého ú (napr. pr�tik, s�kno, m�tjm, k�sek) ozna�ovala aj dvojhláska uo, napr. l�no, k��, p�rod ap.“ (HSSJ I: 39)
Mit anderen Worten, neben phonetisch-phonologischen, morphologischen und lexikalischen Bohemismen wird auch mit graphischen Bohemismen gerechnet. Diese bieten keine besonderen Probleme, wenn sie in Positionen auftreten, wo das Tschechische das entsprechende Graphem (bzw. das dahinter stehende Phonem) nicht verwendet (vgl. k�sek für alttsch. kúsek, standardtsch. kousek, standardslk. kúsok, westslk. kúsek, p�rod für standardtsch. porod, standardslk. pôrod [puorod]). Steht das Graphem jedoch in seiner angestammten Position (l�no, k��), so ist es kaum möglich zu entscheiden, ob ‚nur‘ von einem graphischen oder ‚auch‘ von einem lautlichen Bohemismus auszugehen ist.9 Dvo�áková (2004: 170, 172f.) weist darauf hin, dass in manchen Fällen in gedruckten Texten die Ersetzung eines Graphems durch ein anderes (z.B. � durch u, � durch R) ganz einfach durch dessen Fehlen in der Druckerei begründet war.
Zu unterscheiden sind also mindestens sieben verschiedene Situationen: a) ein beiden Sprachen (beiden Sprachgebieten, Diasystemen, Dialektkonglo-
meraten) ursprünglich gemeinsames Element wird beibehalten oder die Innovation bei Aufgabe des Elements erfolgt gemeinsam (Kontinuität der Identität),
b) ein beiden Sprachen ursprünglich gemeinsames Element wird in beiden Sprachen aufgegeben, jedoch verschieden innoviert (beidseitige Diskontinuität der Identität),
9 Natürlich wäre überhaupt noch zu bestimmen, was ein lautlicher Bohemismus ist: Von wem wurde
wann und wie die lautlich tschechische Form mündlich benutzt – wenn überhaupt (vgl. auch Berger 1997: 164).
98 Markus Giger
c) ein beiden Sprachen ursprünglich gemeinsames Element unterliegt im Tschechischen (einem Teil der tschechischen Dialekte) einer Innovation (Diskontinuität der Identität auf tschechischer Seite),
d) ein beiden Sprachen ursprünglich gemeinsames Element unterliegt im Slovakischen (einem Teil der slovakischen Dialekte) einer Innovation (Diskontinuität der Identität auf slovakischer Seite),
e) ein in beiden Sprachen ursprünglich verschiedenes Element wird in beiden Sprachen beibehalten oder verschieden innoviert (Kontinuität der Differenz),
f) ein in beiden Sprachen ursprünglich verschiedenes Element wird im Tschechischen (einem Teil der tschechischen Dialekte) durch ein gemeinsames Element ersetzt (Konvergenz auf tschechischer Seite),
g) ein in beiden Sprachen ursprünglich verschiedenes Element wird im Slovakischen (einem Teil der slovakischen Dialekte) durch ein gemeinsames Element ersetzt (Konvergenz auf slovakischer Seite).
Schematisch lassen sich diese Situationen darstellen wie folgt, wenn der ursprüngliche Zustand mit Z1, der spätere mit Z2 bezeichnet wird und die beiden Sprachen (beiden Sprachgebieten, Diasystemen, Dialektkonglomeraten, bezeichnet hier mit S resp. () gemeinsamen Elemente/Zustände grau schattiert hervorgehoben werden:
a) b) c) d) e) f) g) Sit.
Zust. S ( S ( S ( S ( S ( S ( S (
Z1
Z2
Tab. I: Varianten von Sprachsituationen.
Ich bestreite nicht, dass diese Darstellung stark vereinfacht ist, da natürlich mit weiteren möglichen Fällen zu rechnen ist: V.a. können mehr als nur zwei aufeinander folgende Zustände auftreten (vgl. z.B. die oben angedeutete Entwicklung ó > uo > ú) oder der ursprüngliche Zustand ist in einem Teil der Dialekte identisch, in einem Teil verschieden oder es besteht schon in Z1 eine Opposition zwischen mehr als zwei Elementen usw. Dennoch meine ich, dass die sieben angesetzten Situationen für das hier behandelte Problem, nämlich das Verhältnis zwischen der spätmittelalterlichen und der frühneuzeitlichen slovakischen und tschechischen Schriftsprache (oder besser der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriftsprache in der Slovakei und den Böhmischen Ländern) von Relevanz sind:
Die Situation a) (Kontinuität der Identität) ist charakteristisch für den größten Teil des Lexikons, insbesondere im Grundwortschatz (muž, žena, syn, sestra, hora, voda, les...), für einen großen Teil der grammatischen Kategorien resp. Grammeme (Kasus abgesehen vom Vokativ; als gemeinsame Innovation die Aufgabe des Duals und seine Ersetzung durch den Plural oder die Aufgabe der synthetischen Präterita und ihre Ersetzung durch das ursprüngliche Perfekt usw.), aber auch viele lautliche und morphologische Einzelelemente (voda, Gen. vody, Akk. vodu; 1. Sg. vidím, 2. Sg. vidíš, 3. Sg. vidí usw.). Diese Elemente können per definitionem zur Frage der
Die Sprachsituation in der Slovakei 99
Auseinanderentwicklung der Schriftsprache in der Slovakei und den Böhmischen Ländern nichts beitragen.
Die Situation b) (beidseitige Diskontinuität der Identität) ist demgegenüber sehr viel seltener, jedenfalls im hier primär interessierenden Zeitabschnitt.10 Sie kann z.B. zwischen dem größten Teil der slovakischen und tschechischen Dialekte bei der Entwicklung des einstigen langen ý gesehen werden, das beidseits, aber verschieden innoviert wurde: Während es im Slovakischen (und in den südostmährischen Dialekten) mit dem langen í verschmolz, entwickelte es sich in den meisten tschechischen Dialekten zu ej (im Hanakischen später weiter zu é; im heutigen Standardtschechischen ist ej < ý praktisch nicht repräsentiert, im 17. und 18. Jhdt. war es jedoch in schriftlichen tschechischen Texten gut vertreten). Entsprechend ist das Auftreten von ej in der Position des historischen langen ý in Texten slovakischer Provenienz merkmalhaft. Im morphologischen Bereich ist die Situation meist komplexer: Zwar sind der slovakische Lok. Pl. der Maskulina rohoch und die entsprechende umgangssprachliche und dialektale tschechische Form rohách unterschieldiche Neuerungen, aber das Standardtschechische bewahrt die Form rozích; der Instr. Pl. der Maskulina (ursprünglich muži) lautet zwar im heutigen Standardslovakischen mužmi, während er in den allermeisten tschechischen Dialekten mužema oder mužama lautet, aber das Standardtschechische bewahrt die Form muži, ebenso wie manche slovakischen Dialekte (vgl. Štolc 1994: 91, 96; ASJ 1/1: 90-95, 2/2: 130-134). Auch im lexikalischen Bereich ist die Situation b) nicht einfach festzustellen (vgl. jedoch auch Situation e) in der Lexik im Hinblick auf neue außersprachliche Realien).
Die Situation c) ist im lautlichen Bereich relativ häufig (vgl. Berger 1997: 156 zum lautlichen Konservativismus des Slovakischen). Erwähnt seien die aufgeführten Neuerungen ú > ou, aj > ej oder der sog. Umlaut (p�ehláska) in den meisten tschechischen Dialekten.11 In der Morphologie ist die Erhaltung eines älteren Zustands im Slovakischen bei Innovation im Tschechischen (zumal im Standardtschechischen) – sieht man von durch regelmäßige Lautentwicklungen verursachten Innovationen ab – die Ausnahme und mit unregelmäßigen lautlichen Entwicklungen verbunden: Man könnte die Infinitivendung –t statt –� anführen (gemäß Lamprecht/Šlosar/Bauer 1986: 240 entstand die harte Infinitivendung des Tschechischen unter dem Einfluss des Supinums). In einigen Fällen kann man entsprechende Verschiebungen in der Syntax sehen, vgl. den jüngeren Typ Je vid�t Sn�žka im Tschechischen gegenüber dem älteren Je vid�t Sn�žku, der in slk. Vidie� Sn�žku sein Analogon findet (vgl. Giger 1999: 207).
Umgekehrt sieht es bei der Situation d) aus: Hier ist es die Morphologie, in welcher sich das Slovakische vom Tschechischen durch Innovationen abhebt: Z.B. durch den Verlust des Vokativs in den meisten Dialekten, durch die Generalisierung der Endung der 1. Sg. der Verben auf –m, durch den vollständigen Verlust der Kurzformen von Adjektiven und Partizipien oder durch den Abbau vieler Stammalternationen (vgl. �urovi� 2004c). Situation d) kann man im lexikalischen Bereich auch da sehen, wo sich das Slovakische durch einen puristischen Eingriff vom Tschechischen abzuheben versucht (vgl. Jelínek 1998, Lifanov 2005). Dies ist eine Angelegenheit des 20. Jhdt., deren realer Erfolg, d.h. Niederschlag in Texten nicht immer gegeben ist. Vgl. dazu Abschnitt 5, insbes. Anm. 43.
10 Verschiedene späturslavische Entwicklungen dieses Typs – etwa die verschiedenen Reflexe der
reduzierten Vokale oder der Gruppe *dj – sind bei Einsetzen der schriftlichen Überlieferung längst abgeschlossen.
11 Vgl. Lamprecht/Šlosar/Bauer (1986: 63-75), Berger (1999).
100 Markus Giger
Situation e) kann man dort erkennen, wo sich Slovakisch und Tschechisch auseinanderentwickelt haben vor Einsetzen der schriftlichen Überlieferung, wenn man nur diese in Betracht zieht (vgl. Anm. 10); man kann sie jedoch auch dort sehen, wo die beiden Sprachgebiete für neue außersprachliche Realitäten verschiedene Begriffe geschaffen haben, für die vorher keine lexikalische Einheit bestand. In solchen Fällen handelt es sich nicht um die Aufgabe eines früher gemeinsamen Begriffs wie das in Situation b) der Fall wäre, aber doch um neue Differenzen und insofern um eine Diskontinuität. Solche Unterschiede sind seit Anfang der Überlieferung v.a. für die administrative und juristische Terminologie charakteristisch, die in Ungarn und den Böhmischen Ländern differierte (vgl. Doru�a 1977: 35), sie können aber auch spätere Hungarismen im Slovakischen betreffen, welche das Tschechische nicht kennt (vgl. Berger 1997: 158).
Die Situationen f) und g) (Konvergenz) sind bei weitem seltener und weitestgehend auf die Lexik beschränkt. Situation f) (die Übernahme eines Slovakismus im Tschechischen) ist auf das 20. Jhdt. und einige wenige Fälle beschränkt (vgl. Abschnitt 5), Situation g) (die Übernahme eines Bohemismus ins Slovakische) ist dagegen seit einigen Jahrhunderten wichtig (Berger 2000c: 191, Lifanov 2001: 216) und steht in einem logischen Antagonismus mit den unter Konstellation d) erwähnten Bestrebungen, Bohemismen puristisch aus der Kodifikation des Standardslovakischen auszuschließen. Möglicherweise kann man in einigen neueren – bislang nicht kodifizierten – syntaktischen Entwicklungen des umgangssprachlichen Slovakischen ebenfalls Konvergenzerscheinungen mit dem Tschechischen sehen (Giger 1999: 207, 2004).
Angesichts der in diesem Abschnitt gezeigten komplexen Situation ist es verständlich (und richtig), wenn Lifanov die Einteilung in ‚einheimische‘ (slovakische) Elemente und Bohemismen in ihrer Bedeutung für die Geschichte der slovakischen Schriftsprache relativiert und auf die Bedeutung der schriftlichen Tradition auf beiden Seiten verweist, anders gesagt, wenn er fordert, historische Grammatik und Schriftsprachengeschichtsschreibung zu trennen. Nur die Konfrontation der in der Slovakei des 16.-18. Jhdt. verwendeten Schriftsprache mit der zeitgenössischen Schriftsprache aus den Böhmischen Ländern kann letztlich zeigen, ob es sich um dieselbe oder verschiedene Schriftsprachen handelt. Dies bedingt allerdings einen breit angelegten Vergleich konkreter Texte aus verschiedenen Regionen12, und ein solches Unternehmen steht bislang noch aus: Lifanov arbeitet zwar auf der slovakischen Seite mit einem größeren Korpus von Texten, beim Tschechischen begnügt er sich jedoch mit den bestehenden Beschreibungen (2001: 17).13 Diese sind jedoch, gerade wenn es sich um das Tschechische des 17. und 18. Jhdt. – der traditionell als doba temna
12 Dies wäre vonnöten nicht nur bei den aus der Slovakei stammenden Texten, sondern auch bei
denjenigen aus den Böhmischen Ländern: Berger (1997: 164) weist darauf hin, dass auch mährische Texte durch ‚Moravismen‘ gekennzeichnet waren und dass gerade in jüngerer Zeit (d.h. im 17. bis 18. Jhdt.) Regionalismen in der Schriftsprache auch in Böhmen zunehmen. Diese Fragen sind allerdings auch in der Bohemistik bislang völlig unzureichend erforscht. Berger bestreitet auf dieser Grundlage den Sinn des Terminus ‚slovakisiertes Tschechisch‘ generell, da die unterschiedliche Beachtung der schriftsprachlichen Norm sich in der Slovakei innerhalb einer Bandbreite vollzogen habe, wie sie für das Tschechische jener Zeit allgemein charakteristisch gewesen sei und es „im Bewußtsein der Sprachbenutzer keinen größeren Unterschied zwischen dem Tschechischen und seiner in der Slowakei gebräuchlichen Variante gegeben haben dürfte“. Die letzte Aussage dürfte für die spätere Zeit (17./18. Jhdt.) so nicht mehr stimmen, wie verschiedene zeitgenössische Aussagen in Grammatiken zeigen (vgl. dazu �urovi� 2000a, Kraj�ovi�/Žigo 2002: 79-83). Umgekehrt kann aus der älteren Zeit (15./16. Jhdt.) auf bei Lifanov (2001: 206) angeführte Zitate aus der Slovakei vom Tschechischen als der lingua vernacula oder lingua nativa (im Gegensatz zum Latein) verwiesen werden.
13 Obwohl er u.a. dies an Lauersdorf (1996) kritisiert (Lifanov 2001: 15).
Die Sprachsituation in der Slovakei 101
bezeichneten Zeit – handelt (vgl. Havránek 1936: 64-76; Cu�ín 1985: 57-68; Berger 1997: 165f., 2001: 224), nicht genügend ausführlich.
3. Lifanovs Analyse der Genese des schriftsprachlichen Slovakischen Lifanov formuliert das Ziel seiner Untersuchung wie folgt:
(6) „)������! ���"�! ����! ������ (...) �������� ���������� ������� ��! ����� �������� ����� %&�� ������������� � &�����! �������&�� ����� ��� ��������� 16. - 18. ��. *�� �� ������� ��������� ������� : 1) "�� ��+�� � ��� ������: �����"�����! �������&���! ����14, ���������� "�����! �������&���! ���� ��� ����� ��� �������; 2) ������ �&���� �������� ��� �%�"����� ����������� � ��� %�����"����! � ���%�����"����! ���&��&���; 3) � ����� ����������� ��+& ����! �������� ���� ������"����! �������&�� � ���%��� �� ,. -��������; 4) ������ ��� ���� ��� ����� ��� �������� (����������� ����, ���������� ���� � �����"������� ����) � %����������� ����� ������"����! �������&��; 5) �&.����&$� �� ����"�� ����� ��������! �� ����� ���� ����������! ������������ ���������.“ (Lifanov 2001: 42)
Von Bedeutung für das bisher Diskutierte sind insbesondere die Punkte 1) und 4): Festgestellt werden soll, was die sprachliche Basis der in der Slovakei des 16.-18. Jhdt. verfassten Texte bildet, das Tschechische des 14.-16. Jhdt., das „Schrifttschechische an sich“ (mit anderen Worten: das zeitgenössische) oder slovakische Dialekte bzw. welches die Rolle der einzelnen slovakischen Dialektgruppen15 (West-, Zentral- und Ostslovakisch) ist. Dies bedeutet allerdings, dass die Analyse mehr zum Ziel hat als den bloßen Vergleich zwischen der Sprache slovakischer und tschechischer Texte; sie möchte auch feststellen, was der (slovakischen) schriftsprachlichen Tradition zugrunde liegt. Das hat aber zur Folge, dass versucht werden muss, Alttschechisch, zeitgenössisches Tschechisch und Elemente der einzelnen slovakischen Dialekte und Dialektgruppen in den Texten zu unterscheiden. Damit kehrt die historische Grammatik durch die Hintertür in die Analyse zurück und verbindet sich mit der historischen Dialektologie. Beides führt bei der Untersuchung konkreter Erscheinungen zu Problemen.
So untersucht Lifanov z.B. die Verwendung des Vokativs in Texten slovakischer Herkunft (2000: 33-34, 2001: 47-49). Er geht unter Berufung auf Gebauer (1896) und B�li� (1972) davon aus, dass der Vokativ im Tschechischen sowohl in historischer als auch dialektaler Sicht stabil ist, während im Slovakischen (gemäß Pauliny) der Prozess des Verlustes schon im 13. Jhdt.(!) eingesetzt haben soll. Seine Belege (2001: 48) stammen allerdings aus Texten vom Ende des 17. und v.a. aus dem 18. Jhdt., d.h. aus relativ später Zeit, wie Lifanov auch selbst vermerkt. Sie betreffen v.a. Bezeichnungen unbelebter Designate; bei Bezeichnungen belebter Designate und insbesondere von Menschen bleiben die Vokativformen in den Texten erhalten. Das Verhältnis der angeführten Belege zwischen Nominativ und Vokativ ist 10 : 60. Lifanov schließt daraus, dass die Sprache der geistlichen Literatur der slovakischen Katholiken nicht als Tschechisch mit Slovakismen oder als bohemisiertes Slovakisch betrachtet werden darf, sondern als gänzlich eigenständige Sprache, die sich durch eine eigene Struktur und besondere Entwicklungstendenzen unterscheidet, welche mit der Zeit weder in der tschechischen Schriftsprache noch im größten Teil der slovakischen Dialekte eine Parallele finden. Bei der Formierung dieser Sprache spielte der peripher westliche Dialekt des Záhorie eine Rolle (vgl. unten).
14 Darunter versteht Lifanov (a.a.O.) die tschechische Schriftsprache des 14. – 16. Jhdt. 15 Lifanov verwendet den Terminus dialekt hier für eine Dialektgruppe, wie dies in der russischen
Tradition möglich ist (vgl. Meš�erskij 1972: 6).
102 Markus Giger
Versuchen wir die angeführten Fakten zu gruppieren: Im Hinblick auf die in Tabelle I) dargestellten Situationen handelt es sich um den Typ d): Ein ursprünglich gemeinsamer Zustand Z1 (spezielle Vokativformen in den meisten Deklinationsparadigmen) ist durch eine slovakische Innovation (Ersetzung des Vokativs durch den Nominativ) geändert worden. Insofern ist die Verwendung des Nominativs merkmalhaft nicht-tschechisch16, die Verwendung der speziellen Vokativformen entweder archaisch oder tschechisch. Aus der Sicht der slovakischen Dialektologie sind spezielle Vokativformen im 20. Jhdt. v.a. noch im Záhorie (äußerster Westen) und besonders in den ostslovakischen Dialekten, teilweise aber auch in den Regionen Orava und Gemer erhalten (ASJ 2/1: 47-50, 2/2: 52ff.; Kraj�ovi� 1988: 83; Štolc 1994: 48f., 104, 108). Man kann also vermuten, dass es sich beim Verlust des Vokativs um eine zentralslovakische Innovation handelt, die sich allmählich ausgebreitet hat. Solange indessen der Verlauf der Ausbreitung nicht beschrieben ist, können in Texten verwendete Vokativformen weder eindeutig dem Tschechischen noch dem Záhorie-Dialekt zugeschrieben werden, da nicht klar ist, in welcher Region die Vokativformen zu welcher Zeit verschwunden sind. Im Falle der nicht-umgelauteten Vokativformen weicher Stämme des Typs u�ite�u, holubico, die Lifanov als merkmalhaft nicht-tschechisch und charakteristisch für den Záhorie-Dialekt beschreibt, gilt, dass sie für alle slovakischen Dialekte zu postulieren sind, solange in ihnen nicht der Vokativ als morphologische Kategorie ausgestorben ist. Daneben treten sie aber auch in den meisten mährischen Dialekten auf (vgl. (JA 4: 127), und die aus der Sicht der Geschichte der Schriftsprache relevante Frage wäre, ob sie in Texten slovakischer Provenienz deutlich häufiger sind als in hinsichtlich Textsorte und Zeitabschnitt vergleichbaren Texten mährischer Herkunft. Nur im letzteren Fall sprechen sie für die Eigenständigkeit des frühneuzeitlichen slovakischen Schriftidioms. Ein spezielles Problem beim Vokativ stellt außerdem seine ausgeprägte Tendenz zur Lexikalisierung im Slovakischen dar (vgl. MSJ 1966: 85, 152): Formen verschiedener Substantive aus verschiedenen Texten müssen nicht unbedingt vergleichbar sein.
Ähnlich verhält es sich mit anderen (zentral-)slovakischen morphologischen Innovationen wie der Aufgabe der Stammalternation der Velare in der a-stämmigen Deklination der Feminina des Typs na ruce, na noze (Lifanov 2001: 91f., 133f.). Auch hier erhält das Tschechische (alle tschechischen Dialekte) gemeinslavisches Erbe, während im Slovakischen eine Innovation stattgefunden hat, die sich jedoch bis ins 20. Jhdt. nicht auf das ganze Sprachgebiet ausdehnen konnte (ASJ 2/1: 41ff., 2/2: 42f.; Kraj�ovi� 1988: 211, 217, 227, 230, 233f., 241, 243, 252, 282, 285, 291). Es ist richtig, wenn Lifanov (2001: 91) festhält, dass die Alternation sich im 20. Jhdt. nur im Záhorie-Dialekt und „kleineren Enklaven in einigen anderen Regionen hält“. Deren Verteilung vom Westslovakischen über das nördliche Zentralslovakische bis in Teile des Ostslovakischen lässt jedoch vermuten, dass die Ausbreitung der Innovation nur allmählich vor sich gegangen ist bzw. bis heute im Gange ist. Darauf deuten auch Kraj�ovi�s Formulierungen hin: „popri tvaroch ruke, nohe sú aj relikty ruce, noze“ (dolnotren�ianske náre�ie), „reliktné tvary v dat. a lok. sg. typu ruce, noze, macose ustupujú tvarom ruke, nohe, macoche“ (hornotren�ianske náre�ie), ähnlich zum stredooravské náre�ie, zum tur�ianske náre�ie (!) usw. Lifanovs Formulierung (2001: 90), dass manche genetisch tschechischen Elemente sich in den untersuchten Texten
16 Allerdings wäre noch zu prüfen, ob die Verwendung von Nominativformen statt Vokativformen bei
Bezeichungen unbelebter Designate nicht auch in Texten tschechischer Provenienz auftreten kann, da sie ja auch funktional erklärt werden kann: Entsprechende Vokativformen sind kommunikativ ungewöhnlich und deshalb selten.
Die Sprachsituation in der Slovakei 103
deshalb nicht geändert hätten, weil sie durch analoge Erscheinungen in den westslovakischen Dialekten gestützt worden seien, wirft die Frage auf, ob man sie dann überhaupt ohne weiteres als Bohemismus betrachten soll, denn gerade Lifanovs Ergebnisse (die Unifizierung des Stamms schlägt sich in den untersuchten Texten kaum nieder) können darauf hindeuten, dass die Alternation zur Zeit der Entstehung dieser Texte noch stabil war. Erst recht sollte man die Erhaltung der Alternation nicht ohne weiteren Kommentar unter den ustoj�ivye bogemizmy aufführen (Lifanov 2001: 133).17
Etwas komplexer ist die Sachlage im Falle der Generalisierung der Endung –m in der 1. Sg. des Präsens/Futur aller Verben (vgl. dazu Lifanov 2001: 68, 119, 130): Hier ist zunächst zu konstatieren, dass der ältere Zustand (Auftreten der Endung –u in den Verben des Typs nies�, pi�, kupova� sowie bei chcie�) aus der Sicht der heutigen Dialekte nur an der absoluten Peripherie des slovakischen Sprachgebiets erhalten ist, nämlich einerseits in Skalica und Umgebung an der unmittelbaren mährischen Grenze und im šarišské und zemplínske náre�ie im äußersten Osten andererseits (ASJ 2/1: 136, 2/2: 225; Štolc 1994: 105, 118-123). Hinsichtlich der untersuchten Texte stellt Lifanov fest, dass sich die Endung –m im Verlaufe der Zeit durchsetzt, gegen Ende des 18. Jhdt. selbst bei einem Autor aus Skalica, obwohl im Bereich des Gebrauchsschriftums die Kanzlei von Skalica – wie erwartet – eine intensivere Variabilität von –m und –u bewahrt als andere Zentren. Man kann also vermuten, dass sich die Verallgemeinerung der Endung –m früher, rascher und gründlicher durchgesetzt hat als die Unifizierung der velaren Stämme in der Deklination der a-stämmigen Feminina. Die genauen Verhältnisse in einem bestimmten Dialekt zu einem bestimmten Zeitpunkt sind allerdings nur schwer abzuschätzen. Dazu kommt ein weiteres Moment, welches Lifanov nicht thematisiert: Die Endung –u hat im Tschechischen als komplementäre Variante die umgelautete Form –i, deren Ausbreitung (aufgrund des phonetisch-phonologischen Prozesses des Umlauts) und Rückgang (aufgrund morphologischer Vereinheitlichung) im Tschechischen hier nicht diskutiert werden kann.18 Tritt in Texten slovakischer Herkunft –i auf, so handelt es sich stets um einen Bohemismus, der nicht identisch ist mit dem Zustand in der gesprochenen Varietät. Über –u lässt sich dies nicht mit Sicherheit sagen; wenn bei manchen Autoren –m und –u alternieren, so kann dies den Widerstreit zwischen schriftsprachlicher Form tschechischer Herkunft und gesprochener slovakischer Form mit Innovation illustrieren, aber auch einen Übergangszustand in der entsprechenden gesprochenen slovakischen Varietät selbst. Für den slovakisch-tschechischen Vergleich wäre wiederum die Frage relevant, ob sich die Verwendung von –u und –i in Texten slovakischer und ostmährischer Herkunft merklich unterscheidet.
In einzelnen Fällen ist die Situation in den slovakischen Dialekten bei Lifanov zu einfach dargestellt, was dann zu einseitigen Aussagen führt. Dies betrifft die Formen der 1. Sg. und der 1. Pl. des Konditionals (2001: 78f., 116, 134) und den Verlust der historischen Stammalternation im Nom. Pl. m. der Adjektive in Kongruenz mit belebten Substantiven (2001: 90, 116). Zu den Konditionalformen schreibt Lifanov (ibd.: 78), dass der Verlust der 1. Pl. bychom unter gleichzeitiger Bewahrung der 1. Sg. bych zu den Besonderheiten der Sprache der geistlichen Literatur der slovakischen Katholiken
17 Wichtig sind Lifanovs (2001: 133) Anmerkungen zu frühen Belegen für das Fehlen der Alternation
aus der südlichen Zentralslovakei und zu deren Zusammenhang mit der Ersetzung der ‚harten‘ Endungen durch ‚weiche‘ (ruce > ruki). Hier dürfte der Kristallisationspunkt der Entwicklung ruce > ruke zu finden sein, welche das heutige Standardslovakische von allen anderen westslavischen Standardsprachen unterscheidet. Vgl. zu dieser Alternation auch �urovi� (2000c: 113).
18 Vgl. dazu Lamprecht/Šlosar/Bauer (1986: 234).
104 Markus Giger
gehöre, da in den slovakischen Dialekten beide Formen praktisch nicht aufträten.19 Während dies für die 1. Pl. bychom korrekt ist (und für die tschechischen Dialekte genauso gilt, vgl. (JA 4: 601), stimmt es für die 1. Sg. bych nicht. Stanislav (1958 II: 416) konstatiert: „Tvar 1. os. sg. [bych, MG] dodnes existuje v hovorovej sloven�ine, niekedy aj spisovnej, a okrem toho na západe a východe. (...) V spisovnej sloven�ine zaniká a v �udovej stredoslovenskej re�i už zanikol aj tvar 1. os. sg. bych“ (vgl. zur Ausdehnung auch ASJ 2/1: 177, 2/2: 312). Man kann also zusammenfassen, dass es sich beim Typ by som höchstwahrscheinlich wiederum um eine zentralslovakische Innovation handelt, deren endgültige Ausbreitung noch nicht beendet ist, und dass bych in frühneuzeitlichen Texten aus der Westslovakei kaum einen Bohemismus darstellt, der nur „minimale Unterstützung“ (Lifanov 2001: 116) in den westslovakischen Dialekten hatte.20 In der 1. Pl. geht die Innovation im Tschechischen und Slovakischen offenbar parallel (d.h. sie gehört eigtl. zum Typ a in Tabelle I): Die Form bychom wird ersetzt durch die Innovation byjsme, bysme, by sme oder durch reanalysierte Formen des Typs bychme. Der Unterschied liegt darin, dass das moderne Standardtschechische immer noch ausschließlich die Form bychom als korrekt anerkennt; Belege für bysme finden sich jedoch schon im 16. Jhdt. und erst recht im 18. Jhdt. (Gebauer 1909: 429). Vgl. auch die konkurrierenden Formen abychme und abychom in unmittelbarer Nachbarschaft bei Koniáš (1756/1995: 29f.). Es ist also nicht weiter erstaunlich, wenn sich 1. Sg. und 1. Pl. des Konditionals hinsichtlich der Erhaltung der älteren Form verschieden verhalten, wie Lifanov (2001: 134) feststellt. Dies entspricht der Situation in den westslovakischen Dialekten und nicht zuletzt auch in den tschechischen Dialekten und dem schriftsprachlichen Tschechischen vor dem 19. Jhdt.
Im Falle der Aufgabe der Stammalternation im Nom. Pl. m. der Adjektive in Kongruenz mit belebten Substantiven behauptet Lifanov (2001: 90), sie trete in keinem einzigen slovakischen Dialekt auf. Dies ist aber offenbar nicht richtig, denn Štolc (1994: 104) gibt für den Záhorie-Dialekt an: „V nominatíve mn. �ísla muž. rodu živ. sú tvary prídavných mien: muadzí, najedze�í, piek�í xuapci, jednací, druzí“ (vgl. auch ähnlich ASJ 2/1: 104). Dies lässt sich zumindest teilweise auch noch in den populären Kurzwörterbüchern der slovakischen Dialekte feststellen (vgl. die Redensart To sú dva rovnací. Jeden nebojsa, druhí nedajsa bei Palkovi� 1996: 16), auch wenn anderswo die Alternation nicht mehr zu finden ist (Ked byli chuapci už velikí, Morav�ík 1996: 88; vi drahí rodi�ové, Balák 1997: 7). Dies kann jedoch eine jüngere Entwicklung unter dem Einfluss der slovakischen Standardsprache darstellen, und es ist nicht auszuschließen – zumal wenn man dem Záhorie-Dialekt eine besondere Rolle bei der Entwicklung der frühneuzeitlichen slovakischen Schriftsprache zuerkennt (Lifanov 2001: 49, vgl. auch Anm. 4) –, dass er auf die konsequente Erhaltung der diskutierten Alternation in Texten aus der Slovakei (vgl. dazu a.a.O.: 90) gewirkt hat.21 Zu dieser Alternation vgl. auch
19 Einzig im Dialekt der Region Myjava trete, so Lifanov, –ch als verselbständigter Formant auf, der sich mit praktisch jedem Satzglied verbinden könne. Hier handelt es sich indessen um etwas anderes: In diesem Dialekt vertritt ein bewegliches enklitisches Morphem –ch das Auxiliar der 1. Sg. im Präteritum: jách ból, bólch, bolach, videlach für standardslk. ja som bol, bol som, bola som, videla som (Štolc 1994: 98). Dieses Phänomen (das übrigens auch unter allgemeiner Perspektive interessant ist, denn es handelt sich um einen seltenen Fall von Degrammatikalisierung!) ist auch in Teilen der tschechischen Dialekte Schlesiens und des kopani�á�ské ná�e�í Ostmährens bekannt (B�li� 1972: 197).
20 Am Rande sei noch erwähnt, dass v.a. in Zentral- und Südwestböhmen auch eine parallele geneuerte Form by sem auftritt ((JA 4: 599), die allerdings in älteren tschechischen Texten noch keinen Niederschlag findet (vgl. Gebauer 1909: 427f.).
21 Die Frage wäre noch aus einer anderen Perspektive interessant: In den tschechischen Dialekten ist die Konsonantenalternation im Nom. Pl. m. bel. der Adjektive nämlich nur in den mährischen Dialekten erhalten, in Böhmen und entsprechend in der obecná �eština fehlt sie (vgl. (JA 4: 311). Entsprechend erstaunt es nicht, wenn sie auch im schriftsprachlichen Tschechischen des 18. Jhdt. nicht mehr gänzlich
Die Sprachsituation in der Slovakei 105
�urovi� (2000c: 113), der feststellt, dass sie in der Valaská škola von Hugolín Gavlovi�, einem Text katholischer Provenienz aus dem Jahre 1755, zwar konsequent steht, jedoch mit Ausnahme des Konsonanten ch, der nicht alterniert: Nom. Sg. m. tichý, Nom. Pl. m. bel. tichí. Dies deckt sich interessanterweise mit der Beobachtung von Kraj�ovi� (1988: 243, 252), der feststellt, dass im Falle der Alternation der Velare im Dat./Lok. Sg. f. in manchen Dialekten der Konsonant ch zuerst unifiziert wird (macocha – macoche neben ruka – ruce, noha – noze). Gavlovi�s Zustand könnte also durchaus dem realen Übergangszustand eines zeitgenössischen westslovakischen Dialekts entsprechen.
Im Falle der von Lifanov (2001: 66, 135) diskutierten Kurz- und Langformen der Partizipien ist die Situation ähnlich wie bei der oben diskutierten 1. Pl. des Konditionals: Die Entwicklung in den tschechischen und slovakischen Dialekten ist praktisch dieselbe, die Kurzformen gehen verloren22; die tschechische Schriftsprache behält sie jedoch bei, und die moderne tschechische Standardsprache kodifiziert ihren Gebrauch (im Resultativ optional, im aktionalen Passiv obligatorisch, vgl. Giger 2003a: 70-74). Lifanov stellt fest, dass in Texten aus der Slovakei mindestens seit Mitte des 16. Jhdt. Kurz- und Langformen nebeneinander verwendet werden und postuliert deshalb – mit Berufung auf Vážný (1964: 104), der erklärt, im Alttschechischen seien im analytischen Passiv nur Kurzformen verwendet worden – einen Unterschied zwischen schriftsprachlichem Slovakisch und Tschechisch. Hier muss festgehalten werden, dass sich die kollektive historische Grammatik des Tschechischen, zu welcher der zitierte Band von Vážný gehört, primär an der Sprache des 14. Jhdt. orientiert (Komárek 1958: 7). Tatsächlich stimmen die in der Literatur zum alttschechischen Passiv (vgl. Giger 2003a: 355-368) zitierten Beispiele mit Vážnýs Aussage überein. Mit Sicherheit stimmt dies jedoch nicht mehr für das 17. und 18. Jhdt., die für den Vergleich mit dem Slovakischen in Lifanovs Korpus am ehesten relevant sind: Vgl. byl jsem (...) tenkrát napomenutý (1669, MS 1995: 95), na v�ky jest zatracená (1676, MS 1995: 72), jest nová díra od �ert� proklubaná (1689, MS 1995: 78). Besonders auffällig ist dies bei Koniáš (1756/1995): v�cem, které jim byly pravený od paštý�� (ibd.: 25), jen a� Ježíše zbavený nejsem (ibd.: 38), abych jich zprošt�ná býti mohla (ibd.: 128), aby (...) pohanstvo proti nim zbou�ené nebylo (ibd.: 130), duše od tebe požádaná bude (ibd.: 147) vs. budu k soudu p�iveden (ibd.: 18), neopatrný �lov�k snadno od �ábla p�emožen bude (ibd.: 53), božské slávy zbaveni býti m�li (ibd.: 140), slávy v��né zbaven býti mám (ibd.: 152). Vgl. auch Tak jako dobrý vozka chválený bude (...), tak on v nesmrtedlnost oble�en bude (ibd.: 86). Diese Verhältnisse sind von den bei Lifanov (2001: 67f.) in Texten slovakischer Herkunft beschriebenen nicht weit entfernt.
Auch im Falle der spezifischen Endung der Adjektive im Nominativ/Akkusativ Plural Neutrum des Typs nová slova ist die Entwicklung im schriftsprachlichen Tschechischen gegenüber dem Slovakischen nur verzögert, wie Lifanov (2001: 77f.) festhält: Die Variabilität wird in der Slovakei früher aufgegeben, während sie im Tschechischen des 18. Jhdt. fortgesetzt wird (vgl. auch Koniáš 1756/1995, z.B. jaké by ty trápení v��né byly vs. zanechejte tak smutná myšlení). Bemerkenswert ist, dass der
konsequent auftritt (vgl. všeliký d�lnící, Koniáš 1756/1995: 23). Es wäre also noch zu untersuchen, ob sich das frühneuzeitliche Schriftslovakische vom Tschechischen nicht gerade durch die konsequente Erhaltung der Alternation abhebt und ob sich Unterschiede zwischen böhmischen und mährischen Texten feststellen lassen.
22 Nur in den böhmischen Dialekten (mit Ausnahme eines nordböhmischen Streifens) ist die Kurzform Neutrum Sg. auf –o erhalten ((JA 4: 584-590) und dient dem Ausdruck der Kongruenzlosigkeit bei subjektlosen Objektresultativa und objektlosen possessiven Resultativa (Giger 2003: 79-82).
106 Markus Giger
protestantische Autor Tobiáš Masnicius (Masník), der ansonsten relativ strikt an der zeitgenössischen Norm des Tschechischen festhält, in diesem Falle böhmische (tato dobrá vína, tichá zví�ata), mährische (tato / tyto zví�ata) und slovakische Form (tyto zví�ata) einander ohne weiteren Kommentar gegenüberstellt (Dvo�áková 2004: 175f.). Vgl. zu dieser Stelle bei Masnicius auch �urovi� (2000b: 34).
Eine eigene Studie habe ich der Frage der Verwendung des Auxiliarverbs in der 3. Sg. und der 3. Pl. des Präteritums gewidmet (Giger im Druck), da ihr Lifanov (2001: 134f., 207) große Bedeutung zumisst und da ein ähnliches Problem entsteht wie bei der eben beschriebenen Frage der Kurzformen des Partizips: Ausgehend von Passagen aus der bohemistischen Literatur behauptet Lifanov, das Auxiliar werde in der 3. Sg. und Pl. des Präteritums im Tschechischen ab Beginn des 17. Jhdt. kaum mehr verwendet, dies im Gegensatz zu Texten aus der Slovakei. Hierin sieht er eine Fortsetzung eines alttschechischen Elements im Slovakischen, das im Tschechischen selbst bereits obsolet geworden sei, und damit den eigentlichen Ansatzpunkt zur Lösung der slovakischen Schriftsprache von der tschechischen Tradition.23 Ich habe gezeigt, dass Formen des Typs je(st) �ekl, jsou �ekli in der tschechischen schriftsprachlichen Tradition des 17. und 18. Jhdt. nicht weniger häufig sind als in der slovakischen, dass aber abgesehen davon die Beibehaltung oder Aufgabe des Auxiliars in der 3. Person des Präteritums sehr stark textabhängig ist und kaum geeignet ist, als Kriterium zur Periodisierung der Geschichte der einen oder anderen Sprache zu dienen.
Der vorangegangene Abschnitt soll weder die Leistung Lifanovs bestreiten noch seine Ergebnisse insgesamt in Zweifel ziehen. Es bestehen diverse weitere Kriterien (v.a. phonetisch-phonologischer Natur), die ich nicht behandelt habe. Sie gehören, wie gesagt, häufig dem Typ c) aus Tabelle I) an, d.h. auf tschechischer Seite ist eine Innovation erfolgt, welche das Slovakische nicht (oder kaum) mitgemacht hat. Neben den bereits früh erfolgten Neuerungen wie Umlaut oder Monophthongierung gilt es auch an die Diphthongierung zu erinnern (ú > ou, ý > ej) und an die Entwicklung é > í oder an das prothetische v- vor o am Wortanfang. Beides tritt in Texten slovakischer Herkunft kaum auf (Lifanov 2001: 140). In den von Giger (im Druck) und in der vorliegenden Arbeit verwendeten tschechischen Texten findet sich alles relativ häufig, wenn auch mit merklichen Unterschieden: ý > ej und prothetisches v- vor o stechen am stärksten in den KS hervor: mlejn, žádnej, kterej, bejvá, �ákej, pravej, Šimkovejmi, Vo�ko Starej, vostrov, vokolo, vostatek, vobehrával (1538-1541; KS 1969: 11-20). Auch in den KS finden sich aber zahlreiche Belege für ý und o-: svatých, �eských, který, o, od, odolal, osoba (ibd.). Gerade im Bereich des prothetischen v- scheint die Verteilung oft lexikalisiert (on, od); ein Eindruck, der sich auch bei Koniáš (1756/1995) wiederholt: vgl. vorá�, vorba, vorati, Vold�ichovi, aber o, od, on, odpus�, osv��, oslavil (ibd.: 79-83, 105). Der Diphthong ej < ý tritt v.a. in Stämmen auf (dobejvati, vymejšlejí, smejšleti, vejš, zejskal, pejcha) und im Präfix vej- (vejmínka, vejstraha, vejmluva); vgl. aber demgegenüber hýbati, býti, p�ebývati, výborn� und insbesondere die Adjektivendungen des Typs nový, nových, novými, in denen der Diphthong ej bei Koniáš praktisch nicht
23 Wörtlich schreibt Lifanov (2001: 207): „-���� ��"�� ����� �������� ����� ����� ��! ��� �������� �� �����"������� �������&����� ����� �������$� �������� ��������� %���� 3 �� � ������.��� [sic!] �������, ����+�.�� � ����� ������� ����������� ��! ������. /������������ � ����� ��� ���������� ��� �������� ��� � XVIII � �+� ��"��� XIX �., '�� %���� �� ���&� ��� �������� �� � "������& �������&����& ����& [dieser Zeit, MG], �� � ����� ��� �������� '���� ������. 0���������� ��1�������� �� ����"�� � ���� ������ ������� ��+�� ��� ��������� �����! (�.�. �����"�����!) ��� �����! ���� ��. 2 �����"������ +� �������&���� ����� ������� %���� ���� ������ &+� � XVI �., � � ����� ��"��� XVII �. ��� ����.� ��"���$�. 3���� �������, ����������� ����� ����� ��! ��� �������� ��������� � ��"��& XVII �.“
Die Sprachsituation in der Slovakei 107
auftritt. In manchen Fällen ist in Bibelzitaten die ältere Form erhalten, während in Koniášs eigenem Text die jüngere auftritt; oft wechseln ältere und jüngere Form auf eine Art ab, die keinen ohne weiteres erkennbaren Regularitäten unterliegt und manchmal an das heutige sog. code-switching zwischen tschechischer Standardsprache und obecná �eština erinnert (vgl. Giger 2003b: 95). Demgegenüber sind diese Elemente in den aus Trnava stammenden Texten aus Giger-Sitárová (2004: 285-357)24 tatsächlich – wie in Lifanovs Texten – selten: Die Belege für das prothetische v- sind fast ausschließlich auf das 16. Jhdt. und einige wenige Texte beschränkt: wohledl sem se, sem se wobratil, wo, wopiet (1534), won, Wondreg (1569), od Woriska (Ende 16. Jhdt.), wodtrhaly (1746). Ebenso ist der Diphthong ej (< ý) äußerst selten, Belege treten faktisch nur in zwei Texten auf, die übrigens auch je einen Beleg für das prothetische v- enthalten: Maczko Chudeg, Maczko Nywnyczkeg, Maczko Mladeg, s/Pyskateym Jurom, na Kratineych mostech, S/Krzywo_usteym Gane[m] a z Wogtkem Slepeym, samo_sstwrteg budaucz, druheg kostel (1569), Krziwo_vsteg Gan, Slepeg Wogtek, Mladeg Macek, Gura Chromeg (Ende 16. Jhdt.). Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass es sich in den meisten Fällen um deadjektivische Eigennamen handelt, wie auch in Lifanovs einzigem Beleg für ej < ý (2001: 140).25
Mit anderen Worten, in diesen Bereichen bestätigt sich Lifanovs Beobachtung, dass gewisse spätere tschechische (oder zumindest böhmische) lautliche Entwicklungen sich in Texten slovakischer Herkunft kaum mehr niederschlagen, ja dass sie gar später verschwinden, wenn sie im 16. Jhdt. noch teilweise auftraten (vgl. auch Dvo�áková 2004: 177). Gerade diese Bereiche müssten aber im Tschechischen des 16.-18. Jhdt. besser untersucht werden, und insbesondere die Ergebnisse aus (Ost-)Mähren wären mit denjenigen von Lifanov (2001) zu konfrontieren.26 Lifanovs Arbeit bedeutet nichts-destotrotz dank ihrer Abstützung auf ein umfangreiches Textkorpus einen großen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
Im vorangegangenen Abschnitt habe ich versucht, einige Ergebnisse Lifanovs durch Einbeziehung tschechischen Materials in einen breiteren Kontext zu stellen. Nur so kann letztlich die These Lifanovs von der Entstehung einer eigenständigen slovakischen Schriftsprache ab dem frühen 17. Jhdt. bestätigt werden bzw. es kann bestimmt werden, wann sich die aus der Slovakei stammenden Texte so weit von der gemeinsamen Schriftsprache der Slovaken und Tschechen gelöst haben, dass deren Ende und der Beginn einer eigenständigen slovakischen schriftsprachlichen Tradition postuliert werden kann.27 Die tschechische Schriftsprache des 17. und 18. Jhdt. ist weniger
24 Hier handelt es sich um ein Korpus von 33 handschriftlichen Texten aus Trnava, und zwar Gerichtsakten (Protokolle, Gerichtskorrespondenz). Sieben von ihnen sind in den PDS (2: 11-30) veröffentlicht.
25 Lifanov bemerkt, dass der bei ihm belegte Name Slabey später einen Dativ Slabeyowi aufweist, d.h. vom slovakischen Schreiber offenbar gar nicht mehr als identisch mit dem Adjektiv slabý verstanden wurde. In den hier angeführten Belegen fällt der Instrumental –ejm auf, der im heutigen Tschechischen einen sehr beschränkten zentralböhmischen Regionalismus darstellt ((JA 4: 303). Das weitgehende Fehlen der Entwicklung ý > ej in Texten aus der Slovakei ist auch in Zusammenhang zu sehen mit ihrem Fehlen in der an der Bible kralická orientierten Norm des Tschechischen, welche von den slovakischen Lutheranern verwendet wurde (vgl. Dvo�áková 2004: 169). Vgl. dazu Abschnitt 4.
26 Immerhin zitiert Lifanov (2001: 140) eine Bemerkung von Porák (1979: 130), dass das prothetische v- auch in Texten ostmährischer Herkunft auftrete, da es ein ausgeprägtes Merkmal des gelockerten schriftsprachlichen Usus gewesen sei. Allerdings führt Porák (a.a.O.) auch eine Reihe von Belegen aus der Slovakei an. In beiden Fällen (Ostmähren und Slovakei) ist die Mehrzahl der Belege – Poráks Thema entsprechend – auf das 16. Jhdt. beschränkt. Wiederum stellt sich also die Frage, ob dem zu vermutenden späteren Rückgang des prothetischen v- am Ostufer der March ein solcher westlich von ihr entspricht – oder eben nicht.
27 Einer detaillierteren Konfrontation untereinander und mit zeitgenössischen tschechischen Texten bedürften im übrigen die schriftsprachliche Tradition der slovakischen Lutheraner und Katholiken. Wenn
108 Markus Giger
monolithisch als dies in Lifanovs Charakteristiken (die wie gesagt nicht von Texten, sondern von Aussagen der sprachhistorischen Bohemistik ausgehen) den Anschein macht. Berger (1997: 166) betont, dass das Zulassen von Varianten charakteristisch ist für die Sprache der katholischen tschechischen Autoren des Barock, was auch anhand der aufgeführten Beispiele zu sehen war. Zulassen von Varianten ist aber auch und gerade für Texte slovakisch-katholischer Herkunft typisch (vgl. Dvo�áková 2004: 179-186 zu Má�ay). Ob bzw. ab wann sich die Variabilität der Texte slovakischer Herkunft – die auch Lifanovs Ergebnisse zeigen – in dieser Zeit in einem Rahmen abspielt, welcher sich von demjenigen von Texten aus den Böhmischen Ländern so sehr unterscheidet, dass man sie nicht mehr als Teil derselben schriftsprachlichen Tradition auffassen möchte, bzw. ob und bis wann man die Variabilität der Texte aus der Slovakei nur als weitere Ausprägung der auch in den Böhmischen Ländern vorhandenen Variabilität in der Schriftsprache interpretieren darf (im Sinne der in Anm. 12 zitierten Ansicht Bergers), sollte die weitere Forschung anhand größerer Korpora zeigen.
4. Diglossie in der Slovakei des 17. und 18. Jhdt. Der Begriff ‚Diglossie‘ stammt, wie allgemein bekannt, aus dem bahnbrechenden Aufsatz von Ferguson (1959). Er gehört zu den linguistischen Konzepten, welche im Verlaufe des 20. Jhdt. für Furore gesorgt haben, und es ist fast unmöglich, die Literatur zum Thema Diglossie noch zu überblicken (Hudson 2002a: 1 erwähnt über 3000 Einträge in einer monographischen Bibliographie zum Thema für die Zeit von 1960-1990, vgl. auch Lauersdorf 2002: 245). Ein ansprechender Literaturbericht könnte deshalb auch in einer monographischen Arbeit kaum geleistet werden.
Da außerdem Grundzüge des Konzepts allgemein bekannt sind, mag es ausreichen, sie hier in kürzester Version wiederzugeben: In einer Sprachgemeinschaft werden über längere Zeit in komplementären funktionalen Domänen zwei genetisch relativ eng verwandte Codes (High/H und Low/L) verwendet, von denen H explizit kodifiziert und prestigeträchtig ist, jedoch nicht muttersprachlich erworben wird, während L muttersprachlich erworben und in allen Bereichen informeller Konversation verwendet wird (Ferguson 1959). Als paradigmatische Fälle nennt Ferguson die Sprachsituation in der arabischen Welt, in der deutschsprachigen Schweiz, in Griechenland und in Haiti. Die genannten Eigenschaften wurden später weniger restriktiv ausgelegt und der Begriff der Diglossie ausgeweitet; insbesondere das Kriterium der genetischen Verwandtschaft der beteiligten Codes wurde von vielen Autoren verworfen und die Unterscheidung zwischen einer Diglossiesituation und der Situation von Minderheitensprachen in Frage gestellt (vgl. dazu detailliert Hudson 2002a sowie alle weiteren im selben Band publizierten Beiträge, von denen ich hinsichtlich des Diglossiebegriffs ausgehen werde). Hudson kehrt in den wesentlichen Zügen zur Definition von Ferguson zurück, betont jedoch besonders die diachrone Dimension des Phänomens (ibd.: 8f.) und seine soziale (nicht inhärent sprachliche) Grundlage (ibd.: 13), d.h. er relativiert die oft diskutierte
�urovi� (2000b: 33) schreibt „Ke4že �eskí protestanti sa ocitli ako emigranti v susedných zemiach, t.j. okrem Uhorska najmä v Sasku a Sliezsku, za�ali slovenskí luteráni niekedy od konca XVII. storo�ia prebera starostlivos o spolo�ný spisovný jazyk. Pritom jednozna�ne vždy my, t.j. Slováci a (esi, sme boli dva rôzne národy, s jedným spolo�ným spisovným jazykom“, so steht seine eindeutige Orientierung an der lutheranischen Tradition in einem klaren Gegensatz zu Lifanovs Berücksichtigung von Texten ausschließlich katholischer Provenienz. Lauersdorf (2003: 57f.) unterstreicht die Notwendigkeit, das Verhältnis zwischen Tschechisch und ‚slovakischer Kultursprache‘ auch in den Texten evangelischer Autoren genauer zu untersuchen. Einen interessanten strikt materialorientierten Ansatz bietet Dvo�áková (2004) mit dem Vergleich der Zpráva písma slovenského des Protestanten Masnicius von 1696 mit einem Ausschnitt aus der Predigtsammlung Chleby prvotín des Katholiken Má�ay von 1718.
Die Sprachsituation in der Slovakei 109
Frage des notwendigen „großen Abstands“ zwischen H und L28 und akzeptiert andererseits grundsätzlich die mögliche Existenz einer Diglossiesituation zwischen zwei nicht verwandten Sprachen, sieht sie jedoch als Ausnahme an (ibd.: 15).29 Er betont, dass komplementäre funktionale Domänen allein nicht ausreichen und dass die konzeptuelle Einheit von Fergusons paradigmatischen Fällen darin liegt, dass ein Set von Beziehungen vorliegt zwischen funktionaler Komplementarität von H und L, fehlender Gelegenheit zum Erwerb von H als Muttersprache, dem daraus folgenden Fehlen von Muttersprachlern von H in der Gemeinschaft und der Stabilität von L als informeller Umgangssprache (ibd.: 40).
Die Anwendung des Diglossiekonzepts auf die frühneuzeitliche slovakische Sprachsituation ist bei Lifanov (2001) und Lauersdorf (2002, 2003) unterschiedlich:30 Nach Lifanov (2001: 213) befinden sich ab den ersten Jahrzehnten des 17. Jhdt. Lutheraner und Katholiken in der Slovakei in verschiedenen Sprachsituationen, d.h. sie bilden verschiedene Sprachgemeinschaften, da nach der Entstehung der ‚altslovakischen Schriftsprache‘ die vehement einsetzende Gegenreformation zu einer entschiedenen Rückbesinnung der Lutheraner auf die Schriftsprache der klassischen tschechischen protestantischen Bibelübersetzung, der Bible Kralická führt (ibd.: 211-213), einerseits aus ideologischen Gründen (Abstützung auf die lange reformatorische Tradition in den Böhmischen Ländern), andererseits aufgrund des Zustroms tschechischer protestanti-scher Emigranten nach der Niederschlagung des böhmischen Ständeaufstands 1620. Für die Sphäre von Liturgie, geistlicher Literatur und hoher Poesie gilt ab dieser Zeit, dass gezielt versucht wird, in den entsprechenden Texten Slovakismen zu vermeiden. Allerdings bleibt – so Lifanov – auch bei den Lutheranern das Tschechische nicht nur aus dem mündlichen Sprachgebrauch ausgeschlossen, sondern auch in ihrer Mitte wird
28 Vgl. z.B. bei Wexler (1971: 336): “Diglossia is not meant to refer to any condition of multiple
norms, but specifically to that condition where there is a broad structural gap between the standardized written norm and the unstandardized (as a rule) spoken dialetcs” (Hervorhebung MG).
29 Diese Haltung wird im Band in zweierlei Richtung ausgeführt: Fasold (2002: 87f.) zeigt anhand einer Beschreibung des viel diskutierten Beispiels Spanisch – Guaranì in Paraguay, dass eine Diglossiesituation zwischen zwei gänzlich unverwandten Sprachen grundsätzlich möglich ist. Haas (2002: 111) erklärt – ausgehend vom Beispiel der deutschsprachigen Schweiz –, dass für eine stabile echte Diglossie eine enge Verwandtschaft der zwei Codes fast unabdingbar ist, weil sie das Erlernen von H durch die Muttersprachler von L durch regelmäßige Entsprechungen zwischen L und H erleichtert und somit verhindert, dass H wie eine echte Fremdsprache erlernt werden muss (vgl. auch Schiffman 2002: 146). Dieser Punkt ist auch für das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch von großer Relevanz, wie ich noch zeigen werde.
30 Von Diglossie in der Slovakei vor dem 19. Jhdt. spricht vor ihnen bereits Thomas (1989: 277), allerdings nur sehr kurz, und zwar von einer “super-optimal, user-oriented diglossia”. Super-optimal heißt hier “pertaining to varieties which are over-differentiated for Ferguson’s definition, i. e. bilingualism” (ibd.: 275). Diese überraschende Analyse kann nur so verstanden werden, dass Thomas ohne Rücksicht auf das sprachliche Material und ausgehend vom heutigen Stand a priori Slovakisch und Tschechisch als verschiedene Sprachen sieht und damit jede Form von Diglossie zwischen Varietäten dieser Sprachen als verkappten Fall von Bilingualismus betrachtet. Dies ist aber eine Interpretation ex post, gegen die sich auch Lauersdorf explizit wendet (2002: 253, Anm. 13). Vgl. auch Berger (1997) in Anm. 12. User-oriented heißt “diglossia, where there is partial (i. e. acquisitional and functional) superposition, i. e. there are some native speakers of the H variety, who might (at least potentially) enjoy social advanteges as a result” (ibd.: 274f.). Auch dieser Teil der Interpretation ist kaum akzeptabel: Das Schrifttschechische hatte in der Slovakei nie eine stabile Gruppe von Muttersprachlern, die protestantische tschechische Immigration zu Beginn des 17. Jhdt. verschmolz rasch mit ihrer slovakischen Umgebung (�urovi� 2000a: 23, 2000b: 34). Sollte aber mit Thomas’ Bezeichnung gemeint sein, dass das schriftsprachliche Tschechische als solches Muttersprachler hatte (nämlich in den Böhmischen Ländern), so sind sie für die slovakische Sprachsituation nicht relevant, denn diese Sprecher gehören nicht zur diglossischen Gemeinschaft, wie Fasold (2002: 87) anhand der Irrelevanz der Existenz von standarddeutschen Muttersprachlern in (oder aus) Deutschland für die Diglossiesituation in der deutschsprachigen Schweiz darlegt. Vgl. zu exoglossischen Diglossiesituationen unten, insbes. Anm. 39.
110 Markus Giger
im Bereich des administrativ-rechtlichen Schrifttums und der populären Dichtung weiterhin die ‚altslovakische Schriftsprache‘ verwendet, die bei den Katholiken einzige Schriftsprache bleibt. Mit anderen Worten, während die Katholiken in einer Sprachsituation mit slovakischen Dialekten und ‚altslovakischer Schriftsprache‘ leben (wobei diese Schriftsprache für sie prestigeträchtig ist, ‚���+��!‘ in Lifanovs Worten), befinden sich die Lutheraner in einer Situation mit slovakischen Dialekten, ‚altslovakischer Schriftsprache‘ und tschechischer Schriftsprache, in der nur letztere prestigeträchtig (‚���+��!‘) ist. Die ‚altslovakische Schriftsprache‘ wird dagegen als ‚niedere Sprache‘ (nach Lifanov ‚������! ����‘) empfunden. Die komplementäre Verteilung betrifft also hier zwei Schriftsprachen, Tschechisch ist H, die ‚altslovakische Schriftsprache‘ L. Lifanov stützt sich in der Merkmalscharakteristik (H ist explizit kodifiziert, kann sich auf ein großes Korpus autoritativer geschriebener Texte stützen, ist nicht Muttersprache in der Gemeinschaft und wird nur über formalen Unterricht erworben) explizit auf Ferguson (1959). Es wird jedoch sofort deutlich, dass er sich auch durch die diglossische Interpretation der altrussischen Sprachsituation mit den Schriftsprachen Kirchenslavisch und Altrussisch inspirieren lässt (vgl. Lifanov 2001: 206); entsprechend beruft er sich (ibid.: 213) auch ausdrücklich auf Uspenskij. Uspenskij (2002: 24-32) richtet sich ebenfalls nach Ferguson, er misst bei der Feststellung von Diglossie der komplementären Verteilung der Varietäten großes Gewicht bei und betont die Sicht der Sprecher, dass es sich bei den beiden Varietäten um e i n e Sprache handelt. Besonders weist er auf die Bedeutung der Existenz von s a k r a l e n Texten in H hin, welche nicht in L übersetzt werden dürfen. Diese für den arabisch-islamischen Raum wichtige Feststellung passt natürlich in den altrussischen Kontext, aber eben auch in den slovakisch-evangelischen (aber keineswegs beispielsweise in den deutschschweizerischen). Die entscheidende Parallele ist indessen, dass im alten Russland – bemerkenswert in einer Diglossiesituation – nicht nur das Russisch-Kirchenslavische (H) als Schriftsprache funktionierte, sondern auch das Altrussische (Altostslavische, also L). Die Komplementarität der Distribution verlief nicht zwischen schriftlichem und mündlichem Gebrauch, sondern zwischen verschiedenen Textsorten (Altrussisch v.a. in Rechtsstexten und im Gebrauchs-schrifttum; vgl. Uspenskij 2002: 101-111). Hier zeigt sich also die Parallele zwischen der altrussischen und der slovakisch-evangelischen Situation, wie sie Lifanov sieht: Nicht nur dass sich H und L gegenüberstehen, sondern dass auch L schriftsprachlich verwendet wird, wenn auch nur für weniger prestigeträchtige Textsorten.31
Lauersdorf (2002) hält sich eng an Ferguson (1959) und sieht die Diglossiesituation in der Slovakei entsprechend zu einem früheren Zeitpunkt: Er geht davon aus, dass sie bereits im 15. Jhdt. vorlag, also zu einer Zeit, als die Slovakisierung des Tschechischen in der Slovakei noch wenig fortgeschritten war (ibd.: 254). Mit der zunehmenden Slovakisierung der Schriftsprache im 16. Jhdt. und der Entstehung der ‚(west-)slovakischen Kultursprache‘ entfernt sich die slovakische Sprachsituation nach Lauersdorf (ibd.: 255) bereits von der Diglossiesituation und steuert auf eine der von Ferguson beschriebenen möglichen Auflösungen (resolution) zu, nämlich der „Vereinfachung“ von H unter dem Einfluss von L (ibd.: 257). In dieser Situation kommt es zur Rückbesinnung der slovakischen Lutheraner auf das Tschechische der Bible
31 Die Analogie zwischen der älteren Sprachsituation in der Slovakei und der Slavia orthodoxa geht
im übrigen auf niemand geringeren als �udovít Štúr zurück, der in seiner programmatischen Schrift Náre�ja slovenskuo alebo potreba písa�ja v tomto náre�í 1846 festgehalten hatte, was für Russen und Serben das Kirchenslavische gewesen sei, sei für die Slovaken das Tschechische gewesen (Lifanov 2001: 5).
Die Sprachsituation in der Slovakei 111
Kralická und damit zu einer erneuten Verstärkung des Diglossieaspekts der Sprachsituation (ibd.: 260). Dessen Ende kommt dann im 18. Jhdt. In seiner zweiten Arbeit zum Thema (2003) setzt Lauersdorf die Akzente nach der Rezeption von Lifanov etwas anders: Die Diglossiesituation des 15. Jhdt. findet im 17. Jhdt durch die Rückkehr zum Tschechischen der Bible Kralická eine Neuauflage bei den slovakischen Protestanten (Lauersdorf stimmt also nun mit Lifanov überein). Es handelt sich jedoch nicht um eine einfache Diglossie, sondern um eine Diglossie mit multiplen H (im Sinne von Wexler 1971: 339) oder auch ‚Schizoglossie‘ (ibd.: 341).32 Lauersdorf (2003: 56) sieht eine mögliche ‚Schizoglossie‘ der slovakischen Lutheraner für den Fall, dass es sich bei der Analyse größerer Korpora zeigen sollte, dass die Distribution von Tschechisch und ‚slovakischer Kultursprache‘ (d.h. ‚altslovakischer Schriftsprache‘ im Sinne Lifanovs) nicht wirklich komplementär war, sondern dass beide Varietäten eher koexistierten, sei es generell oder in einer Reihe von Textsorten (dies wäre der ‚Verlust des ursprünglichen Stimulus‘ für die multiplen H nach Wexler). Im Gegensatz zu Lifanov zitiert Lauersdorf (ibd.: 58) eine Feststellung von Habovštiaková, dass das religiöse Schrifttum der Zeit vor Bernolák stärker slovakisiert war als das administrativ-rechtliche, obwohl man davon ausgehen kann, dass es hinsichtlich von Prestigeaspekten höher stand.
So anregend beide Konzeptionen sind, in einem Punkt befriedigen sie nicht: Beide gehen nämlich stillschweigend davon aus, dass die Sprachsituation der slovakischen Katholiken im 17./18. Jhdt. nicht diglossisch ist. Bei Lifanov (2001) hat dies offensichtlich damit zu tun, dass er die Diglossiesituation in der Verwendung zweier Schriftsprachen sieht, bei Lauersdorf (2002) damit, dass er nur die Opposition Tschechisch – slovakische Dialekte für diglossisch hält, nicht jedoch die Opposition slovakisiertes Tschechisch/‚altslovakische Schriftsprache‘/‚(west-)slovakische Kultur-sprache‘ – slovakische Dialekte.33 Bei Lauersdorf (2003) wird mit der Interpretation der Sprachsituation der slovakischen Lutheraner im 17. Jhdt. als Diglossie mit multiplen H implizit angedeutet, dass auch die Sprachsituation der Katholiken als diglossisch gesehen werden könnte (nämlich als einfache Diglossie), aber explizit ausgeführt wird dies nicht.
Stellen wir uns die Frage: Wenn die Sprachsituation der slovakischen Katholiken im 17. Jhdt. nicht diglossisch ist, was ist sie dann? Standard mit Dialekten? Offensichtlich nicht, denn eine solche Situation bedingt, dass der Standard Muttersprachler hat (Schiffman 2002: 145) und – damit untrennbar verbunden – von einem Teil der Sprecher auch für informelle Kommunikation genutzt wird (Uspenskij 2002: 28; vgl. zu beidem auch van Leeuwen-Turnovcová 2001: 251f.). An dieser Prestigegruppe richten
32 Der Unterschied zwischen einer Diglossie mit multiplen H und einer ‚Schizoglossie‘ scheint bei
Wexler nur graduell: Diglossie mit multiplen H kann dort entstehen, wo innerhalb e i n e r Sprachgemeinschaft mehr als eine H-Variante kodifiziert wird, aufgrund soziologischer, politischer oder geographischer Zerklüftung, d.h. z.B. in geographischer Distribution (Armenisch, Albanisch, Wexler 1971: 339f.). ‚Schizoglossie‘ ist das Weiterbestehen einer Diglossie-Situation mit multiplen H ohne den ursprünglichen – z.B. geographischen – Stimulus (Norwegisch, Ukrainisch zwischen 1876 und 1905, ibd.: 341f.). In den Details stellen sich hier Fragen: Funktionale Distribution betrachtet Wexler als untypisch für eine Diglossie-Situation mit multiplen H; im Falle der slovakischen Lutheraner des 17. Jhdt. liegt eine solche jedoch im Hinblick auf verschiedene Textsorten vor. Abgesehen davon muss man sich fragen, ob eine aufgrund geographischer Kriterien aufgeteilte Sprachgemeinschaft noch e i n e Sprachgemeinschaft ist und ob die Kodifizierung aufgrund verschiedener Dialekte (wie sie Wexler explizit für das Armenische und Albanische aufführt) es nicht auch mit sich bringt, dass die H-Varietäten (in der Sprachgemeinschaft) Muttersprachler haben und dass damit gar keine Diglossie-Situation vorliegt.
33 Der Übersichtlichkeit halber versuche ich hier nicht, diese Begriffe voneinander zu lösen. Lauersdorf (2003: 55) identifiziert Lifanovs ‚altslovakische Schriftsprache‘ mit der ‚(west-)slovakischen Kultursprache‘.
112 Markus Giger
sich die übrigen Sprecher aus, was zur Ausbreitung des Standards als gesprochener Sprache und Muttersprache auf Kosten der Dialekte führt (vgl. auch Hudson 2002a: 3, 21, 33; Fasold 2002: 87; Haas 2002: 112f.). Auch wenn wir real sehr wenig wissen über die mündliche Verwendung solcher überregionaler Formen wie der postulierten ‚slovakischen Kultursprachen‘ oder des slovakisierten Tschechischen, so lässt doch die noch im 20. Jhdt. sehr ausgeprägte dialektale Gliederung der Slovakei stark daran zweifeln, dass solche Varietäten im 17. oder 18. Jhdt. hätten muttersprachlich erworben werden können. Mit anderen Worten, unter Abstützung auf die eingangs angeführte Kürzestdefinition von Diglossie als Situation einer Sprachgemeinschaft, in der über längere Zeit in komplementären funktionalen Domänen zwei genetisch relativ eng verwandte Codes H und L verwendet werden, von denen H explizit kodifiziert und prestigeträchtig ist, jedoch nicht muttersprachlich erworben wird, während L muttersprachlich erworben und in allen Bereichen informeller Konversation verwendet wird, kann die Sprachsituation der slovakischen Katholiken getrost als ebenso diglossisch betrachtet werden wie diejenige der Lutheraner.34 Der Unterschied liegt – so man den bisherigen Analysen glauben darf – darin, dass die lutheranische Gemeinschaft mit dem Tschechischen und der ‚altslovakischen Schriftsprache‘ zwei H-Codes besaß (diese aber ebenfalls in komplementärer Funktion und mit verschiedenen Prestigeaspekten), während die katholische Gemeinschaft nur über einen H-Code verfügte. Außerdem hielten die Lutheraner möglicherweise ihren H-Code (d.h. den prestigeträchtigeren H-Code, das Tschechische) expliziter für die eigene Sprache als dies die Katholiken taten.35 Zu einem weiteren Unterschied komme ich im nächsten Abschnitt.
Man kann sich an dieser Stelle allerdings noch eine weitere Frage stellen: Sind nicht alle vormodernen Sprachgemeinschaften, zumal wenn sie über eine Schriftkultur verfügen, mehr oder minder diglossisch? Wenn ich im vorherigen Abschnitt von ‚Standard mit Dialekten‘ als möglicher Alternative zur Diglossie-Situation bei den slovakischen Katholiken im 17. Jhdt. gesprochen habe, dann nur deshalb, weil dieser Terminus in der Literatur als alternativer Terminus verwendet wird. Im Sinne des in Anm. 1 Gesagten rechne ich für diese Zeit nicht mit einer Standardsprache im heutigen Sinne. Haas (2002: 112f.) führt aus, dass sowohl der deutsche als auch der französische Sprachraum – nach der Festigung einer Schriftsprache, also einer frühen ‚Standardisierung‘ – ursprünglich komplett diglossisch war; erst der Prozess der Vernakularisierung dieses Standards führte zu einer Situation ‚Standard mit Dialekten‘, wobei dies im deutschen Sprachraum wesentlich später vor sich ging als im französischen. Coulmas (2002: 61f.) deutet an, dass das Einsetzen einer Schrifttradition
34 Eine weitere mögliche kritische Frage, nämlich ob es überhaupt adäquat ist, die Sprachsituation von
Lutheranern und Katholiken getrennt zu behandeln, wenn sie prinzipiell in denselben Regionen lebten (obschon mit unterschiedlicher Konzentration, vgl. Lifanov 2001: 215) und dieselben Basisdialekte des Slovakischen sprachen, würde ich hingegen positiv beantworten: �urovi� (2000b: 36) formuliert gar so, dass das slovakische Volk im 17./18. Jhdt. als eine Entität nicht existierte, da Katholiken und Lutheraner getrennt lebten und je ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse verfolgten. Dies ändert natürlich nichts daran, dass sie e i n e n Kommunikationsraum bildeten, zumal auf der Basisebene der Kommunikation, der ‚kapillaren Kommunikation‘ (vgl. Gladkova/Likomanova 2002: 20, 76), die in denselben Varietäten (Dialekten) verlief. Zu einem Unterschied kommt es erst auf der Ebene der gehobenen Poesie und der Literatursprache: Hier tritt bei den Lutheranern das Tschechische auf. Am Rande sei angemerkt, dass Lifanov in seinen Überlegungen zur unterschiedlichen Sprachsituation von Katholiken und Lutheranern das Latein nicht berücksichtigt. Dieses dürfte in der Liturgie der Katholiken eine Rolle gespielt haben, die derjenigen des Tschechischen in der Liturgie der Lutheraner nicht ganz unähnlich war.
35 Vgl. �urovi� (1980: 213, 2000a: 24, 2000b: 34), insbesondere das berühmte Zitat von Daniel Krman aus dem Jahre 1722 vom „rozptýlený Národ (eský, y nás, týmž gazykem mluwjcjch“ (Hervorhebung MG).
Die Sprachsituation in der Slovakei 113
fast notwendig zu Diglossie führt, Haas (2002: 112) erklärt, dass jede über eine Schriftsprache verfügende Gemeinschaft zumindest vorübergehend diglossisch war, Schiffman (2002: 149) erläutert, dass in Südostasien jede neu verschriftete Sprache über kurz oder lang diglossisch wird. Hudson (2002a: 19f., 26f.) beschreibt, dass sozial bereits stark differenzierte, aber noch vorindustrielle Gesellschaften einen fruchtbaren Boden für Diglossiesituationen bilden und dass meist frühe Phasen der Modernisierung den Beginn der Überwindung der Diglossiesituation darstellen (Russland ab Peter d. Gr., Japan ab dem 19. Jhdt., ibd.: 32f.). Dennoch führt er auch einige ältere Fälle auf, in denen eine Diglossiesituation abgeschwächt wurde, indem eine Form von L für solche Texte eingeführt wurde, welche sich primär an Bevölkerungsmassen richteten, welche H gar nicht mehr verstanden (so bei Prakrit in Indien 200 v. Chr., Predigten in der Volkssprache – statt in Latein – im karolingischen Mitteleuropa, ibd.: 30f., 34f.). Bestand aber in den nachfolgenden Situationen jeweils keine Diglossie mehr? Bzw. wenn sie vorübergehend abgeschwächt wurde, entstand sie nicht jeweils stets von neuem?36 Nach der von Hudson (2002a: 37) zitierten Literatur kann die Sprachloyalität in vormodernen Gesellschaften sehr viel mehr Varietäten gelten, die sich von der Vernakulärsprache stark unterscheiden, während sie in stark urbanisierten Gesellschaften eher einem Standard gilt, welcher der Sprache einer Mehrheit entspricht.
Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen scheint noch ein weiterer Punkt des Gegensatzes zwischen der Sprachsituation der slovakischen Katholiken und Lutheraner interessant: Die starken Bemühungen der Lutheraner um die Bewahrung der ‚reinen‘ (geschriebenen) Norm des Tschechischen (vgl. Lifanov, Lauersdorf, Dvo�áková) erinnern mehr an eine moderne Diglossiesituation (z.B. Deutschschweiz, arabischer Raum, Südostasien, vgl. Schiffman 2002: 149) als die Haltung der Katholiken, welche sich vor Variabilität nicht scheuten und in dieser Hinsicht auch mit der Entwicklung der Schriftsprache in den (katholischen) Böhmischen Ländern in Übereinstimmung stand (vgl. Anm. 12 und Schluss von Abschnitt 3).
In der Literatur scheint man sich darüber einig zu sein, dass das Ende der slovakischen Diglossiesituation mit der expliziten Kodifikation des Slovakischen durch Anton Bernolák bzw. �udovít Štúr eintritt. So schreibt Thomas (1989: 277): „With the rise of a standard language based on the central Slovak dialects this diglossia was replaced by a “standard with dialects” situation.“
Tatsächlich kann man in der schrittweisen Ablösung des Schrifttschechischen durch eine slovakische Schrift- und letztlich Standardsprache in der Slovakei zumindest Teilaspekte des oben beschriebenen Prozesses der Ablösung einer Diglossiesituationen durch eine Situation Standard mit Dialekten sehen, wobei L mit H in Konkurrenz tritt und es schließlich ersetzt. �urovi� (1987: 710-712, 2000b: 37f., 2000c: 112-115) beschreibt, wie im frühen 18. Jhdt. die Sprache der Bürger der westlichsten slovakischen Stadt Skalica an der unmittelbaren Grenze zu Mähren zur prestigeträchtigsten Varietät des Slovakischen geworden war, während sich diese Funktion später (während der Kodifikation durch Anton Bernolák) nach Trnava und weiter – im Rahmen der Kodifikation durch �udovít Štúr resp. Michal Miloslav Hodža und Martin Hattala – nach Liptovský Svätý Mikuláš und schließlich nach Tur�iansky Svätý Martin verschob. Die Basis der neuen Kodifikation Mitte des 19. Jhdt. ist die
36 Eine interessante Frage unter dieser Perspektive wäre die Interpretation der tschechischen
Sprachsituation im 17./18. Jhdt., zumal die heutige tschechische Sprachsituation deutliche diglossische Züge aufweist (vgl. Giger 2003b: 92f.); sie führt aber erneut zurück zur notwendigen Untersuchung größerer Textkorpora aus verschiedenen Regionen.
114 Markus Giger
Sprache der gebildeten Schicht in der Zentralslovakei (�urovi� 2000c: 114)37, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit hatte und sich in der Zukunft bewähren sollte: �urovi� (1980: 212) konstatiert bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen der ‚zentralslovakischen Kultursprache‘ des 17. Jhdt. und dem heutigen gesprochenen Standardslovakischen. Insofern findet man also auch in der Slovakei eine Verschiebung des Prestiges von H: Dieses geht über von einer Varietät, die niemand in der Sprachgemeinschaft als Muttersprache und zur informellen Kommunikation spricht (dem Tschechischen), zu einer einer muttersprachlichen Varietät eines Teils der Sprecher (oder wenigstens zu gewissen Eigenschaften einer solchen Varietät).
Umgekehrt ist jedoch auch klar, dass eine wirkliche Situation des Typs ‚Standard mit Dialekten‘ in der Slovakei auch 1787 oder 1843 nicht sofort eintritt, denn alle kodifizierten Varietäten des Slovakischen sind Kompromisse zwischen verschiedenen Dialektelementen sowie fortdauernden Elementen des Tschechischen (nach der Štúrschen Kodifikation v.a. noch lexikalische, vgl. �urovi� 2000c: 116; Lifanov 2001: 215-217, 2005). Diese Varietäten gewannen sicherlich kaum sofort Muttersprachler, zumal in der Slovakei des 19. Jhdt. der muttersprachliche Schulunterricht eng begrenzt und in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts praktisch inexistent war.38 Nichtsdestotrotz sind nun die Voraussetzungen gegeben, dass eine elitäre Gruppe von Sprechern des Standards entsteht, welche diesen vernakularisieren können und so eine Situation ‚Standard mit Dialekten‘ schaffen. Wenn dieser Standard erst in der zweiten Hälfte des 20. Jhdt. in größerem Maße zur Muttersprache zumindest eines Teils der Slovaken wird, so unterscheidet sich dies in keiner Art von der Situation z.B. in Deutschland (vgl. Haas 2002: 112f.). Damit endet die Diglossie in der Slovakei.
Ein wichtiger Ansatzpunkt für diese Entwicklung – im Zusammmenhang mit der erwähnten neuen Gewichtung der Prestigeaspekte – scheint die Tatsache zu sein, dass die noch zu Beginn des 18. Jhdt. – zumal von den Lutheranern – als endoglossisch empfundene Diglossiesituation (das Tschechische als H ist die ‚eigene‘ Sprache, obwohl es innerhalb der Gemeinschaft keine Muttersprachler hat) mehr und mehr als exoglossisch empfunden wird (zur Opposition vgl. Thomas 1989: 275). Sie wird damit abgelöst durch eine neue, wiederum als endoglossisch empfundene Diglossiesituation, welche aber nun – da H an sprachlichen Eigenheiten realer Sprechergruppen innerhalb der Sprachgemeinschaft orientiert ist – den Ansatzpunkt bietet für dessen Vernakularisierung und damit schließlich für die Überwindung der Diglossiesituation.
Exoglossische Diglossiesituationen (“The H-variety still enjoys a vernacular speaker base in a separate speech community, the members of which do not regard themselves, and are not regarded as, members of the community that employs H for non-vernacular purposes only”, Hudson 2002a: 21) sind besonders interessant, weil in ihnen eine
37 Bzw. nach Lifanov (2001: 171-204) die Weiterführung der „nordzentralslovakischen
Folklorekoiné“, die Ende des 18./Anfang des 19. Jhdt. bei den – vorwiegend in der Zentralslovakei lebenden – Lutheranern prestgeträchtig wird und in die südliche Zentralslovakei bzw. die Westslovakei expandiert. Die beiden Perspektiven müssen sich nicht ausschließen.
38 Die Frage, inwiefern das Standardslovakische überhaupt in größerem Maße zur Muttersprache geworden ist, kann hier nicht detailliert behandelt werden, aber der diesbezügliche Unterschied zum Tschechischen ist überdeutlich. Thesenhaft zusammengefasst: 1. Das Standardslovakische wird ohne weiteres für informelle, ja vertraute bis intime Kommunikation verwendet, was für das Standard-tschechische nicht gilt; es erfüllt damit Funktionen, welche in Böhmen die obecná �eština erfüllt. 2. Viele Sprecher des Slovakischen aus gehobenen Bildungsschichten beherrschen den Ortsdialekt ihres Herkunftorts nicht mehr aktiv; die frühere endoglossische Diglossie Standardslovakisch – slovakische Dialekte ist also auf dem Rückzug. 3. Zumindest gewisse Merkmale der Standardsprache setzen sich allgemein in den lokalen städtischen Umgangssprachen durch (vgl. Kral�ák 1996: 62). Allerdings sind größere korpusorientierte Untersuchungen des gesprochenen Slovakischen nach wie vor ein Desiderat.
Die Sprachsituation in der Slovakei 115
besondere Distribution von Prestigeaspekten zwischen H und L beobachtet werden kann.39
Die Ablösung des Tschechischen (bzw. der älteren tschechisch basierten Schriftsprache) durch eine neue Standardsprache auf der Basis von einheimischen Varietäten in der Slovakei des 19. Jhdt. kann jedoch noch zu einer weiteren Überlegung zum slovakisch-tschechischen Vergleich Anlass geben: Wenn van Leeuwen-Turnovcová (2001: 252, 2002) Recht hat mit ihrem Postulat, dass die Vernakularisierung des Standardtschechischen nicht gelang, weil das tschechische Bürgertum im 19. Jhdt. eine schwache Stellung hatte, keine eigene Sprachkultur herausgebildet und praktiziert hatte und dass deshalb der weibliche Beitrag zur Herausbildung der elaborierten Rede nicht zustandekam und so die familieninterne, muttersprachliche Weitergabe einer am Standard orientierten Varietät ausblieb, so kann man sich fragen, wie es gekommen ist, dass dies in der Slovakei deutlich besser gelang: Die Bildungssituation der slovakischen Bevölkerung (beiderlei Geschlechts) dürfte im 19. Jhdt. wesentlich schlechter gewesen sein als diejenige der tschechischsprachigen Bevölkerung in den Böhmischen Ländern. Während das tschechische Bildungswesen nach der Teilung der Prager Universität in eine tschechischsprachige und eine deutschsprachige Hochschule 1882 komplett war, fehlte in der Slovakei nach der Schließung der slovakischsprachigen Gymnasien 1874 praktisch jede Bildungs-möglichkeit in slovakischer Sprache (Matula 1998: 47). Gesellschaftlicher Aufstieg war eng mit sprachlich-kultureller Madjarisierung verbunden, und entsprechend bestehen kaum Zweifel, dass die Stellung des slovakischen Bürgertums in Ungarn noch wesentlich schwächer war als diejenige des tschechischen in den Böhmischen Ländern.40 Man kann sich also fragen, ob ein Faktor,41 welcher die Vernakularisierung
39 Die Opposition zwischen H und L wird durch die Opposition zwischen ‚Eigen‘ und ‚Fremd‘ überlagert (vgl. Giger 2003: 90-94), wobei verschiedene Kombinationen entstehen können. So ist in der deutschsprachigen Schweiz das Standarddeutsche zugleich prestigeträchtig (als H) wie auch nicht prestigeträchtig (als die ‚fremde‘ Sprache), Schweizerdeutsch hat Prestigeaspekte (als ‚eigene‘ Sprache) wie auch Aspekte fehlenden Prestiges (als L). Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist auch die weißrussische Sprachsituation, welche von Wexler (1992) als ‚schizoglossisch‘ bezeichnet wurde (d.h., wie oben erläutert, als diglossisch mit multiplen H ohne Erhaltung des ursprünglichen Stimulus). A.N. Rudenka (Minsk) insistierte anlässlich ihres Vortrags an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag am 21. 10. 2004 zur weißrussischen Sprachsituation darauf, dass es sich in Weißrussland nicht um eine Diglossiesituation mit Russisch als H und Weißrussisch als L handle, da die weißrussische Standardsprache durchaus gewisse, wenn auch spezifische, Prestigeaspekte trage (wörtlich konstatierte sie: „2���� �����&����� �������&���� ������ � -����&�� ��� +� ������+�� ��� ��� ��������! �������: �� ��+��& ���“). Ohne hier detailliert auf die weißrussische Sprachsituation eingehen zu können, kann man feststellen, dass auch hier die Opposition ‚Eigen‘ – ‚Fremd‘, welche die Opposition H/L überlagert, dazu führt, dass die Prestigeaspekte untypisch verteilt sind: Rudenka sprach gar von Schuldgefühlen vieler Träger des weißrussischen ethnischen Bewusstseins gegenüber der Sprache, die sie in Volkszählungen mehrheitlich als ihre Muttersprache aufführen, in Wahrheit jedoch – zumal in ihrer standardsprachlichen Form – nicht beherrschen. Das standardsprachliche Weißrussische hat also gewisse Prestigeaspekte als Symbol der Eigenständigkeit des weißrussischen Volkes, als ‚eigene Sprache‘, aber in anderer Hinsicht ist natürlich das Russische prestigeträchtig, weshalb es ja auch nie gelungen ist, dass Weißrussische als reale Standardsprache durchzusetzen (vgl. Wexler 1992 mit Literatur). Gewisse diglossische Aspekte sind damit festzustellen.
40 Zur Illustration sei ein Zitat von Dérer (1968: 42) angeführt: „Dobrý znalec Slovenska prof. Seton-Watson odhadoval vtedy [d.h. 1918, MG] po�et národne prebudených inteligentov na tisíc!“ Matula (1998: 47) zitiert die Erinnerung von V. Šrobár, dass 1919 in der Slovakei etwa 300 slovakische Grundschul- und 20 Mittelschullehrer zur Verfügung standen.
41 Daneben haben sicher auch andere Faktoren eine Rolle gespielt: Die Slovakei war (und ist) dialektal wesentlich stärker gegliedert als die Böhmischen Länder. Diese sprachliche Zerklüftung musste in einer modernen Gesellschaft nicht nur ideell, sondern auch in der praktischen Kommunikation überdacht werden, wozu sich die Standardsprache anbot. In den Böhmischen Ländern war die Koinésierung der obecná �eština im 19. Jhdt. schon fortgeschritten, und sie konnte so diese Funktion weitgehend übernehmen.
116 Markus Giger
des Standardslovakischen in der Slovakei begünstigte, nicht auch die Tatsache war, dass die Schriftsprache bereits im 19. Jhdt. an den sprachlichen Eigenheiten gewisser Sprechergruppen ausgerichtet war, welche damit – im Sinne von Hudson (2002a: 3ff.) und Fasold (2002: 87) – zu einer Gruppe mit Vorbildfunktion für die übrigen Sprecher werden konnten. Im Tschechischen hingegen wurde der Standard im 19. Jhdt. in mancher Hinsicht so gewählt, dass er keinen sprachlichen Eigenschaften realer Sprechergruppen in den Böhmischen Ländern entsprach.
Nicht diskutiert werden kann hier die dritte These von van Leeuwen-Turnovcová (ibd.) zur Entstehung der tschechischen Sprachsituation: „Das tschechische Mentalitätsmodell kennt seit der Wiedergeburtszeit keine neutrale Semiotisierung der gesellschaftlichen Differenz. Auch und vor allem im sprachlichen Umgang nicht.“ Dieses Kriterium ist von großer Bedeutung auch für die Entstehung der Diglossiesituation in der deutschsprachigen Schweiz (vgl. Haas 2002). Ob allerdings hier ein Unterschied zwischen der Slovakei und den Böhmischen Ländern zu finden ist, mit dem sich Unterschiede in der Sprachsituation (mit) begründen ließen, vermag ich nicht zu beurteilen.
5. Slovakisch und Tschechisch nach dem Ende der exoglossischen Diglossie in der Slovakei In diesem Abschnitt möchte ich das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch im 19. und v.a. im 20. Jhdt. besprechen. Oben ist dargelegt worden, dass mit der erfolgreichen Kodifizierung des Slovakischen Mitte des 19. Jhdt. die herkömmliche Diglossiesituation in der Slovakei endgültig überwunden ist. Die Rolle des Tschechischen in der Slovakei ist damit jedoch noch längst nicht ausgespielt, und entsprechend lassen sich auch Spuren des frühneuzeitlichen diglossischen Verhältnisses bis heute finden.42
Einer der wichtigsten Aspekte in dieser Hinsicht ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des gemeinsamen Kulturwortschatzes, über die sich alle Autoren einig sind (vgl. �urovi� 1980: 216, 2000b: 37, 2000c: 116; Lifanov 2001: 216). Dies bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für den bis heute fortdauernden perzeptiven Bilingualismus von Slovaken und Tschechen in der jeweils anderen Sprache (Budovi�ová 1974: 174, �urovi� 2002a: 32). Kodifiziert ist ab Mitte des 19. Jhdt. erst einmal das orthographische und phonetisch-phonologische ‚Gewand‘ sowie das Inventar der grammatischen Endungen (weniger der Wortbildungaffixe) des schriftsprachlichen Slovakischen; das Lexikon ist – natürlich auch im Rahmen der im 19. Jhdt. geltenden Ideologie von der slavischen Wechselseitigkeit – weiterhin offen für Entlehnungen, auch und gerade aus dem Tschechischen (vgl. Thomas 1992, insbesondere 296).43 Daneben ist auch die Beibehaltung orthographischer Parallelen wie der Unterscheidung von {i} und {y} wichtig (�urovi� 2003: 410).
42 Als diglossisch ohne Einschränkungen bezeichnet das heutige slovakisch-tschechische und tschechisch-slovakische Verhältnis Horecký (1995). Er hat allerdings ein sehr weites Verständnis von Diglossie, das nicht kompatibel ist mit der Konzeption von Hudson (2002a und b) und seinen Mitautoren; die slovakisch-tschechische ‚Diglossie‘ illustriert Horecký v.a. durch Zitate aus der jeweils anderen Sprache in belletristischen Texten.
43 Daran ändern auch spätere Wellen von Purismus in der Slovakei nichts Grundsätzliches (vgl. dazu Jelínek 1998, Lifanov 2005). Sie führten und führen allerdings zu einer Schwächung der internalisierten Norm: Auch gebildete und bewusste Sprecher des Slovakischen sind oft verunsichert hinsichtlich der Normativität von Wörtern, welche sie gängig benutzen. Vgl. zu dieser Problematik auch Budovi�ová (1974: 177f., 1982), Buzássyová (1993, 1995), Dolník (1993, 1998a, b), Sokolová (1995), Berger (2000c), Gazdíková (2004, 2005). Die umfangreiche eigentlich sprachpflegerische bis puristische Literatur möchte ich an dieser Stelle nicht aufführen.
Die Sprachsituation in der Slovakei 117
Die zweite Hälfte des 19. Jhdt. bringt infolge der harten Madjarisierungspolitik in
Ungarn keine größeren Veränderungen in der slovakischen Sprachsituation und im Verhältnis zum Tschechischen (vgl. Berger 1997: 173, 2001: 226). Immerhin sei die Bemerkung von �urovi� (2000a: 32) erwähnt, dass gerade in den Zeiten, als slovakische Bücher in der Slovakei kaum mehr erscheinen konnten, die Bewahrung des lexikalischen (und orthographischen) Erbes der frühneuzeitlichen gemeinsamen lingua slavico-bohemica den Slovaken die Rezeption der gesamten tschechischen gedruckten Produktion ermöglichte. Die Kodifikation des schriftsprachlichen Slovakischen wird um die Jahrhundertwende durch Samo Czambel fortgesetzt (vgl. Czambel 1902).
In eine qualitativ und quantitativ völlig neue Phase kommt das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch mit der Gründung der Tschechoslovakei 1918. Der starke Einfluss des Tschechischen auf das Slovakische in der ersten tschechoslovakischen Republik ist oft genug betont worden (vgl. Berger 1997: 173ff., 2001: 227, 2003: 20). Einerseits wird die Konzeption des tschechoslovakischen Staatsvolkes und der tschechoslovakischen Staatssprache (existierend allerdings in einer tschechischen Variante in den Böhmischen Ländern und einer slovakischen Variante in der Slovakei) in der Verfassung verankert (vgl. Marti 1993), andererseits strömen aufgrund des in Anm. 40 angedeuteten Fehlens von Fachkräften für Regierung, Verwaltung und öffentliche Dienste (einschließlich des Bildungswesens; vgl. Matula 1998) Tausende von Tschechen in die Slovakei, um diese vorher von Ungarischsprachigen innegehaltenen Positionen zu füllen, so dass nun das Tschechische plötzlich auch im mündlichen Kontakt in einem Maße relevant wird, wie dies nie vorher der Fall gewesen war. Mit dem Radio entsteht praktisch zeitgleich das erste Massenmedium, welches mündliche Rede überträgt. Dennoch erreicht das Slovakische nun erstmals die Polyvalenz, welche für moderne Standardsprachen charakteristisch ist, wird es doch praktisch auf einen Schlag in die Rolle der Staatssprache katapultiert.44 Dass diese Entwicklung nicht ohne Probleme und Konflikte (u.a. auch über die Abgrenzung zum Tschechischen) vor sich geht, versteht sich von selbst. Es scheint mir jedoch wichtig hervorzuheben, dass sich diese neue Phase des slovakisch-tschechischen Verhältnisses wie eine weitere Schicht auf das oben beschriebene jahrhundertealte sprachliche Miteinander legt. Natürlich gewinnt das Tschechische so neue Prestigeaspekte in der Slovakei, wird es doch weit mehr als vorher zu einem Mittel der Bildung und damit des gesellschaftlichen Aufstiegs. Dass es daneben auch zu negativem Prestige (Bedürfnis nach Abgrenzung) kommt (vgl. Bosák 1988, Dolník 1998a: 92, Stehlík/Lukeš 2004), ist verständlich und gehört zu dieser Art von Bilingualismus, die als Erbe der alten exoglossischen Diglossiesituation entstanden ist. Diese verschiedenen Aspekte von positivem und negativem Prestige ziehen sich durch die ganze Geschichte der Tschechoslovakei und enden auch nach ihrer Auflösung 1993 nicht vollständig, denn die Rezeption tschechischer Medien (v.a. elektronischer, weniger gedruckter), aber auch tschechisch verfasster bzw. ins Tschechische übersetzter Fachliteratur setzt sich fort (vgl. detailliert Berger 2000c). Da sich der Sprachkontakt am intensivsten im privaten Wohnzimmer vor dem Fernseher abspielt, ist er auch weitgehend unberührt von der relativ extensiven gesetzlichen Regelung des Gebrauchs von Staatssprache und
44 Das später in slovakisch-tschechischen Konflikten ab und an verwendete Motto Slovák, ten má
pech, najprv Ma�ar, potom ech ist natürlich im Bereich der Sprachsituation (von anderen Bereichen soll hier nicht die Rede sein) gänzlich unsinnig.
118 Markus Giger
Minderheitensprachen in der Slovakei (vgl. dazu Berger 2003: 25).45 Entsprechend geht auch die Integration von Bohemismen aufgrund der internalisierten regelmäßigen phonetisch-phonologischen Korrespondenzen weiter (vgl. Dolník 1993: 3f.). Obwohl das Tschechische nur passiv rezipiert wird, ist die ‚latente Kompetenz‘, die im Falle einer Notwendigkeit aktiviert werden kann, relativ hoch (Náb�lková 2002).
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass es nach 1945 und v.a. nach der Föderalisierung der Tschechoslovakei 1969 erstmals zum umgekehrten Phänomen kommt, nämlich zur markanten Präsenz des Slovakischen in den Böhmischen Ländern (ebenfalls v.a. über die elektronischen Medien, aber auch über starke slovakische Migration; vgl. Berger 2003: 20-25), die im Tschechischen zwar bescheidene, aber doch feststellbare Spuren hinterlässt (Budovi�ová 1982: 29, 35; Daneš 1998: 22; Náb�lková 2004). Zwar geht diese mediale Präsenz des Slovakischen nach 1993 in der Tschechischen Republik wesentlich stärker zurück46 als umgekehrt diejenige des Tschechischen in der Slovakei (Náb�lková 2000: 109), aber die Zuwanderung ist immer noch relativ stark, v.a. Studierende und gut ausgebildete Arbeitskräfte aus der Slovakei suchen ihre Zukunft in Tschechien, insbesondere im Raum Prag (vgl. auch Berger 2003: 22). Auch wenn diese Migranten den bewussten Übergang zum Tschechischen für den mündlichen Umgang heute wohl häufiger vollziehen als zur Zeit des gemeinsamen Staates (d.h. die sog. ‚Semikommunikation‘, in der im aktiven Sprachgebrauch jeder seine Muttersprache verwendet, geht tendenziell eher zurück; vgl. auch Sloboda 2004: 213), so gilt dies keineswegs generell: Man trifft in Prag geläufig auf slovakisch kommunizierende Verkäuferinnen, Monteure, Rechtskonsultantinnen oder Immobilien-maklerinnen, ja man kann immer noch Angehörige der Armee der Tschechischen Republik kennenlernen, welche konsequent in slovakischer Sprache kommunizieren. Das Slovakische ist zulässig in mündlichen und schriftlichen Prüfungen im tschechischen Schulwesen (sofern nicht das Tschechische Gegenstand der Prüfung ist), und slovakisch verfasste Dokumente bedürfen keiner beglaubigten Übersetzung ins Tschechische, im Gegensatz zu Dokumenten in allen anderen Sprachen. Man darf sogar im Verkehr mit Behörden der Tschechischen Republik eine beglaubigte Übersetzung eines Dokuments (z.B. Geburtsschein) aus einer Drittsprache ins Slovakische
45 Mit Ausnahme der Regelung, dass fremdsprachige Filme für Kinder unter zwölf Jahren nur in
slovakischer Synchronversion ausgestrahlt werden dürfen (vgl. Náb�lková 2000: 110, Berger 2000c: 186). Dies hat zwar zur vermehrten Herstellung solcher Versionen geführt, aber man kann auch ‚kreativen Umgang‘ mit der Gesetzesvorschrift beobachten, wenn nämlich tschechisch gesprochene oder synchronisierte Filme, von denen man dies inhaltlich nicht erwarten würde, bei der Ausstrahlung in slovakischen Fernsehstationen mit der Bemerkung „für Kinder unter zwölf Jahren ungeeignet“ versehen werden ...
46 Sie setzt sich nur spurenweise fort: So stützen sich alle tschechischen Fernsehsender und auch das öffentlich-rechtliche Radio teilweise auf slovakische Korrespondenten ab, insbesondere natürlich bei der Berichterstattung aus der Slovakei, aber manchmal auch bei der Berichterstattung aus Drittländern. Dieses Thema würde eine eigene Untersuchung verdienen, u.a. auch deshalb, weil man sprachliche Ad-hoc-Entlehnungen bei wenig bekannten Wörtern, die sich in den beiden Sprachen unterscheiden, feststellen kann: So verwendete eine slovakische Reporterin im Herbst 2004 im tschechischen Privatfernsehen Nova bei einer Reportage aus der Slovakei den Begriff kolieskové brusle „Rollschuhe“ (nach tsch. kole�kové brusle) statt korrekt standardslk. kolieskové kor�ule, zweifelsohne deshalb, weil der Hungarismus kor�ule dem tschechischen Publikum nicht ohne weiteres verständlich sein muss. Diese Erscheinung findet man auch in informellen Äußerungen von in der Tschechischen Republik lebenden Slovaken (Sloboda 2004: 213). Es ist kaum überraschend, dass man den umgekehrten Vorgang – Ad-hoc-Entlehnungen ins Slovakische bei seiner Verwendung für ein slovakisches Publikum – wesentlich seltener findet; notorisch kommt er bei Monatsnamen vor, da die slavischen Monatsnamen des Tschechischen nicht allen Slovaken ohne weiteres bekannt sind; so konnte man etwa kürzlich im slovakischen Privatfernsehen Markíza in einer tschechisch gesprochenen Reportage v decembru minulého roku hören statt korrekt tsch. v prosinci minulého roku.
Die Sprachsituation in der Slovakei 119
verwenden (die Slovakei hält hier im Rahmen ihrer Sprachgesetzgebung Gegenrecht; vgl. Berger 2000c: 182f., 2003: 26). Der bemerkenswerteste Bereich der Rezeption des Slovakischen in Tschechien heute scheint mir jedoch die populäre Musik: Nicht nur steht in Geschäften die slovakische Produktion ganz selbstverständlich unter domácí tvorba, sondern auch der Anteil slovakisch gesungener Stücke an der gesendeten Musik sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im kommerziellen Rundfunk übertrifft denjenigen aller anderen Fremdsprachen (mit Ausnahme wahrscheinlich des Englischen) bei weitem. Konzerte mancher slovakischer Interpreten locken Tausende oder gar Zehntausende von Fans an, und in tschechischen Talentwettbewerben singen tschechische Halbwüchsige, welche die Tschechoslovakei nicht mehr bewusst miterleben konnten, ihre Stücke.47
In diesem Zusammenhang scheint mir ein Postulat wichtig: Die Slovakei und Tschechien bilden auch zwölf Jahre nach der Staatstrennung immer noch einen k o m m u n i k a t i v e n R a u m , in dem Informationen, politische Schlagworte, Klatsch und kulturelle Trends ausgetauscht werden, nicht viel anders als der deutschsprachige Raum (vgl. Fasold 2002: 92) oder die Frankophonie, wenn auch mit zwei getrennten und selbstständigen Standardsprachen.48 Wenn in diesem Raum gewisse Aspekte der Kommunikation asymmetrisch verteilt sind (slovakischerseits wird mehr Tschechisches rezipiert als umgekehrt), so hat dies nicht primär mit den zwei Standardsprachen zu tun, sondern vielmehr mit dem überall gängigen Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie eines solchen Kommunikationsraumes (auch zwischen Paris und den französischsprachigen Regionen der Schweiz oder Kanadas ist die Kommunikation zweifelsohne asymmetrisch, ebenso zwischen den großen Zentren Deutschlands und der deutschsprachigen Schweiz). Ich möchte es umgekehrt formulieren: Die heute oft diskutierte angeblich abnehmende Kompetenz mancher Tschechen bei der Rezeption des Slovakischen ist ein Ergebnis dieser asymmetrischen Kommunikationssituation (vgl. schon Budovi�ová 1974: 176), deren asymmetrische Züge sich nach 1993 wieder verstärkt haben (vgl. Berger 2000c).
In diesen Zusammenhängen sehe ich die wichtigsten Spuren der alten Diglossiesituation für die Rolle des Tschechischen in der Slovakei heute: Der gemeinsame kommunikative Raum zusammen mit dem gemeinsamen Grundwortschatz
47 In der Literatur (und auch in der Publizistik!) finden sich seit 1993 diverse Aussagen dazu, dass
„die Tschechen“ bzw. „die tschechischen Kinder“ nicht mehr Slovakisch verstehen. Da diese Frage empirisch nicht einfach repräsentativ zu untersuchen ist, kann die Tragweite der Veränderung – welche als solche aufgrund der geänderten Kommunikation in den Massenmedien natürlich wahrscheinlich ist – nur schwer beurteilt werden. Zu Selbsteinschätzungen und einigen Experimenten mit Texten und einzelnen Lexemen vgl. Musilová (2000). Wichtig scheint mir aber in diesem Zusammenhang die Bemerkung von Sloboda (2004: 218), dass sich nicht nur die Qualität der zweisprachigen Kommunikation ändern kann, sondern auch die Art, sie zu beurteilen, was wiederum mit einer vorgefassten Erwartungshaltung verbunden sein kann. Früher „erwartete man“, dass Tschechen und Slovaken sich problemlos verstehen, heute „erwartet man“ dies nicht mehr in gleichem Maße oder rechnet gar von vornherein mit Problemen. Sloboda (2004: 210) zeigt im übrigen auch, dass die regelmäßigen phonetisch-phonologischen Entsprechungen zwischen den beiden Sprachen auch Sprechern des Tschechischen durchaus bewusst sind.
48 Natürlich wird nicht nur innerhalb der angedeuteten kommunikativen Räume Information ausgetauscht, sondern auch zwischen ihnen, aber die Intensität und Selbstverständlichkeit, mit der dies geschieht, ist deutlich schwächer: Auf der CD Du coq à l’âme (2000) der frankokanadischen Chansonniere Linda Lemay findet sich eine Live-Aufnahme des Lieds Les maudits Français, in welchem die Sängerin unter großer Anteilnahme des Publikums mit absichtlich starkem kanadischem Akzent scherzhaft die Hassliebe der Québécois zu den Franzosen besingt. Die Aufnahme ist weder in Montréal entstanden noch in Paris, sondern in Bulle im Freiburger Oberland. Dies ist es, was ich (u.a.) mit „Kommunikationsraum“ meine, und diese Art von Kommunikation verläuft zwischen der Slovakei und Tschechien immer noch praktisch ungehindert.
120 Markus Giger
und den regelmäßigen lautlichen und morphologischen Entsprechungen zwischen dem Standardtschechischen und dem Standardslovakischen bringen es mit sich, dass kein Sprecher die jeweils andere Sprache als wirkliche Fremdsprache lernen muss. Bis heute können Wörter aus der einen Sprache durch einfache phonetisch-phonologische und morphologische Adaption in die andere übernommen werden, wie dies auch in der diglossischen Situation in der deutschsprachigen Schweiz zwischen Standarddeutsch und Schweizerdeutsch geschieht (Haas 2002: 114), und es entstehen weiterhin gemeinsame Innovationen wie tsch. tunelovat / slk. tunelova� „auf betrügerische Art und Weise zum Konkurs bringen“ (vgl. auch Tuguševa 1996, Berger 2000c). Das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch ist asymmetrisch, im Rahmen des gemeinsamen kommunikativen Raums und damit – als Konsequenz – hinsichtlich der passiven und der ‚latent-aktiven‘ Kompetenz in der anderen Sprache sowie was die materiellen Resultate des Sprachkontakts angeht. Das Tschechische hat so immer noch gewisse Aspekte von Funktion und Prestige, die sich mit seiner einstigen Funktion als H im Rahmen der früheren Diglossiesituation verbinden lassen. Das „tschechisch-slovakische Kulturkontinuum“ (�urovi� 2004d) besteht weiter.
6. Schlussbemerkungen Im vorliegenden Text habe ich versucht das Verhältnis zwischen Slovakisch und Tschechisch in der Slovakei in einer diachronen Perspektive zu beleuchten: Einerseits aus der grundsätzlichen Perspektive dessen, was zu beschreiben aufgrund der existierenden Quellen und ihrer sprachlichen Eigenschaften möglich ist und mit welchen Konstellationen dabei zu rechnen ist, andererseits unter der Perspektive der Diglossiekonzeption. Ich habe mich bemüht zu zeigen, dass die Entwicklung der Schrift- und Standardsprache in der Slovakei kontinuierlicher verlief, als dies in manchen existierenden Beschreibungen den Anschein macht und dass auch die Rolle des Tschechischen trotz Phasen von stärkerem und schwächerem Einfluss relativ kontinuierlich ist: Aus einer als endoglossisch empfundenen Diglossie mit Tschechisch als H und slovakischen Dialekten als L bis ins 16. Jhdt. wird mit der Zeit eine immer noch als endoglossisch empfundene Diglossie mit slovakisiertem Tschechisch (‚westslovakischer Kultursprache‘, ‚altslovakischer Schriftsprache‘) in der Funktion von H (bei den slovakischen Lutheranern auch eine Situation mit Tschechisch und slovakisiertem Tschechisch als multiplen H mit verschiedenem Prestige), und je mehr diese Situation als exoglossisch empfunden wird, desto mehr wird H mit sprachlichen Eigenheiten von slovakischen Dialekten bzw. von Gruppen von Sprechern in der Slovakei angereichert. Diese Entwicklung verläuft von Anfang des 18. Jhdt. bis Mitte des 19. Jhdt., und die geographische Basis der als prestigeträchtig empfundenen Eigenschaften verschiebt sich stets nach Osten. Aber auch die endgültige Kodifizierung des Slovakischen beendet die Rolle des Tschechischen in der Slovakei nicht: Aus der einstigen Diglossiesituation wird eine Situation von perzeptivem Bilingualismus, der in der zweiten Hälfte des 20. Jhdt. sein Analogon in den Böhmischen Ländern findet, auch wenn eine gewisse Asymmetrie bestehen bleibt. Diese Situation dauert – in leicht abgewandelter Form – bis heute fort.
Die Sprachsituation in der Slovakei 121
L i t e r a t u r
ASJ: Atlas slovenského jazyka. 1. Vokalizmus a konsonantizmus. 1968. 2. Flexia. 1978. Bratislava. Balák, Š. 1997. Krátky slovník náre�ia slovenského ra�ianskeho. Bratislava. (Krátky slovník najkrajších
slovenských náre�í 10) Barnet, V. 1977. Vztah komunikativní sféry a r5znotvaru jazyka v slovanských jazycích (k
sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace). Slavia 46, 337-347. Barnet, V. 1981. Synchronní dynamika spisovného jazyka. Jazykovedný �asopis 32, 123-130. B�li�, J. 1972. Nástin �eské dialektologie. Praha. Berger, T. 1997. Tschechen und Slowaken: Zum Scheitern einer gemeinsamen tschechoslowakischen
Schriftsprache. In: Hentschel, G. (Hrsg.): Über Muttersprachen und Vaterländer. Frankfurt a. Main, 151-181.
Berger, T. 1999. Der alttschechische „Umlaut“ – ein slavisch-deutsches Kontaktphänomen? In: Hansack, E. et al. (Hrsg.): Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München, 19-27.
Berger, T. 2000a. Nation und Sprache: das Tschechische und das Slovakische. In: Gardt, A. (Hrsg.): Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Berlin, 825-864.
Berger, T. 2000b. Zur Standardisierung und Normierung des Tschechischen und Slovakischen nach der Aufteilung der Tschechoslovakei. In: Zybatow, L. N. (Hrsg.): Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch. II. Frankfurt a. Main etc., 665-681.
Berger, T. 2000c. Die Rolle des Tschechischen in der heutigen Slowakei. In: Panzer, B. (Hrsg.): Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Frankfurt a. M., 179-196.
Berger, T. 2001. Konzeptionen der Hochsprache bei Tschechen und Slovaken und ihre praktische Relevanz. In: Ehlich, K. et al. (Hrsg.): Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft. Freiburg i. Br., 223-240.
Berger, T. 2003. Slovaks in Czechia – Czechs in Slovakia. International Journal for the Sociology of Language 162, 19-39.
Bosák, J. 1988. Vzahy sloven�iny a �eštiny a ich výskum v novej etape. Jazykovedný �asopis 39, 113-119.
Budovi�ová, V. 1974. Spisovné jazyky v kontakte. Slovo a slovesnost 35, 171-181. Budovi�ová, V. 1982. Z konfronta�ného štúdia �eštiny a sloven�iny. (eskoslovenský model
dvojjazykovej komunikácie. Slavica Pragensia 25, 25-38. Buzássyová, K. 1993. Kontaktové varianty a synonymá v sloven�ine a �eštine. Jazykovedný �asopis 44,
92-107. Buzássyová, K. 1995. Aspekty kontaktov sloven�iny a �eštiny. In: Ondrejovi�, S., Šimková, M. (zost.):
Sociolingvistické aspekty výskumu sú�asnej sloven�iny. Bratislava, 163-182. (Sociolinguistica Slovaca 1)
(JA: eský jazykový atlas 4. 2002. Praha. Coulmas, F. 2002. Comment. Writing is crucial. International Journal of the Sociology of Language 157,
59-62. Cu�ín, F. 1985. Vývoj spisovné �eštiny. Praha. Czambel, S. 1902. Rukovä� spisovnej re�i slovenskej. Tur�ianský Svätý Martin. Dalewska-Gre�, H. 2002. J!zyki słowia"skie. Warszawa. Daneš, F. 1998. Situace a celkový stav dnešní �eštiny. In: Daneš, F. a kol.: eský jazyk na p�elomu
tisícletí. Praha, 12-24. Dérer, I. 1968. (echoslovakizmus v diskusii. Sešity pro literaturu a diskusi 25, 41-45. Dolník, J. 1993. Analogiebildungen im Slovakischen unter Einfluss des Tschechischen. Die Welt der
Slaven 38, 1-11. Dolník, J. 1998a. Das Slowakische im Kontakt mit dem Tschechischen. Ein Beitrag zur Darstellung der
slowakischen Standardsprache. Anzeiger für slavische Philologie 26, 87-101. Dolník, J. 1998b. Postoje k bohemizmom v sú�asnej sloven�ine (ako signály vyrovnávania sa so
slovensko-�eskými vzahmi). In: Pospíšil, I. (ed.): Brn�nská slovakistika a �esko-slovenské vztahy. Brno, 41-44.
Doru�a, J. 1977. Slováci v dejinách jazykových vz�ahov. Bratislava. Doru�a, J., Krasnovská, E., Že�uch, P. 1998. Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo
slovensko-�eské vzahy v predspisovnom období. In: Doru�a, J. (ed.): XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava, 65-92.
122 Markus Giger
�urovi�, �. 1980. Slovak. In: Schenker, A.M., Stankiewicz, E. (eds.): The Slavic literary languages: formation and development. New Haven, 211-228. (Yale Russian and East European publications 1)
�urovi�, �. 1987. The Language of Walaska Sskola. In: Sabo, G.J. (ed.): Hugolín Gavlovi�’s Valaská Škola. Columbus, 655-730.
�urovi�, �. 2000a. Pavel Doležal a jeho Grammatica slavico-bohemica. Slovenská re� 65, 22-32. �urovi�, �. 2000b. Koncepcie spisovného jazyka – chrbtová kos slovenskej kultúrnej histórie. OS –
Fórum ob�ianskej spolo�nosti 4, �. 11, 32-38. �urovi�, �. 2000c. Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov. In: Ondrejovi�, S. (ed.): Mesto a jeho jazyk.
Bratislava, 111-117. (Sociolinguistica Slovaca 5) �urovi�, �. 2003. Josef Dobrovský a mluvnice Pavla Doležala. In: Gladkova, H. et al. (ed.): Josef
Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Praha, 403-413. �urovi�, �. [1982] 2004a. Sloven�ina a staroslovien�ina. In: �urovi�, �.: O sloven�ine a Slovensku.
Vybrané štúdie I. Bratislava, 392-395. �urovi�, �. [1984] 2004b. „Slov�ne“ sú Slovania. In: �urovi�, �.: O sloven�ine a Slovensku. Vybrané
štúdie I. Bratislava, 396-397. �urovi�, �. [1973] 2004c. Tipologija flektivnoj osnovy v slavjanskich jazykach. In: �urovi�, �.: O
sloven�ine a Slovensku. Vybrané štúdie I. Bratislava, 125-139. �urovi�, �. 2004d. (esko-slovenské kultúrne kontinuum. In: Št�pán, J. (ed.): Jan Blahoslav apek.
Jubilejní sborník 1903-2003. Brno, 42-47. Dvo�áková, I. 2004. K �esko-slovenským jazykovým vztah5m v raném novov�ku. eština doma a ve
sv�t� 12, 167-191. Fasold, R.W. 2002. Comment. The importance of community. International Journal of the Sociology of
Language 157, 85-92. Ferguson, Ch.A. 1959. Diglossia. Word 15, 325-340. Gazdíková, M. 2004. Zu heutigen Standardisierungstendenzen im Slovakischen (am Beispiel der
tschechischen Kontaktwörter im Krátky slovník slovenského jazyka). Die Welt der Slaven 49, 129-144.
Gazdíková, M. 2005. Die tschechischen Kontaktwörter in der slovakischen Sprachpraxis und in der zeitgenössischen Slovakistik. München. (Slavistische Beiträge 440)
Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka �eského. I. Hláskosloví. 1894. III/1. Tvarosloví - sklo�ování. 1896. III/2. Tvarosloví – �asování. 1898, 21909. IV. Skladba. 1929. Praha
Giger, M. 1999. Prechodné miesto sloven�iny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického h�adiska: syntax. In: Náb�lková, M., Králik, �. (zost.): Varia VIII. Bratislava, 203-215.
Giger, M. 2003a. Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen). Bern etc. (Slavica Helvetica 69)
Giger, M. 2003b. Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. Sborník prací filozofické fakulty brn�nské univerzity A 51, 83-98.
Giger, M. 2004. Recipientné pasívum v sloven�ine. Slovenská re� 69, 37-43. Giger, M. Im Druck. Typ šel jest, šli sú v sloven�ine a �eštine 16. – 18. stor. Erscheint in: Slavica
Pragensia. Giger-Sitárová, M. 2004. Lexika a štýl administratívno-právnych textov zo 16.-18. storo�ia. Bratislava.
(unpublizierte Dissertation, Jazykovedný ústav �udovíta Štúra SAV) Gladkova, G., Likomanova, I. 2002. Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy (bolgarsko-�ešskie
paralleli). Praha. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia 138) Haas, W. 2002. Comment. International Journal of the Sociology of Language 157, 109-115. Havránek, B. 1936. Vývoj spisovného jazyka �eského. In: eskoslovenská vlastiv�da. �ada II: Spisovný
jazyk �eský a slovenský. Praha, 1-144. Horecký, J. 1995. Slovensko-�eská diglosná komunikácia. In: Ondrejovi�, S., Šimková, M. (zost.):
Sociolingvistické aspekty výskumu sú�asnej sloven�iny. Bratislava, 183-187. (Sociolinguistica Slovaca 1)
HSSJ: Historický slovník slovenského jazyka I-V. 1991-2000. Bratislava. Hudson, A. 2002a. Outline of a theory of diglossia. International Journal of the Sociology of Language
157, 1-48. Hudson, A. 2002b. Rebuttal essay. Diglossia, bilinguism, and history: postcript to a theoretical
discussion. International Journal of the Sociology of Language 157, 151-165. Jelínek, M. 1998. O n�kterých puristických tendencích v kultu�e spisovné slovenštiny. In: Pospíšil, I.
(ed.): Brn�nská slovakistika a �esko-slovenské vztahy. Brno, 29-40. Komárek, M. 1958. Historická mluvnice �eská. I. Hláskosloví. Praha.
Die Sprachsituation in der Slovakei 123
Koniáš, A. [1756] 1995. Vejtažní nau�ení. (ed. M. Kopecký). Brno. Kraj�ovi�, R. 1988. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava. Kraj�ovi�, R., Žigo, P. 2002. Dejiny spisovnej sloven�iny. Bratislava. Kral�ák, �. 1996. Sloven�ina na západnom Slovensku a jej postavenie v rámci národného jazyka. In:
Ondrejovi�, S. (zost.): Sociolingvistika a areálová lingvistika. Bratislava, 57-63. (Sociolinguistica Slovaca 2)
KS: Bi�ík, Z. (ed.) 1969. Knihy smolné. Hradec Králové. Lamprecht, A., Šlosar, D., Bauer, J. 1986. Historická mluvnice �eštiny. Praha. Lauersdorf, M.R. 1996. The question of “cultural language” and interdialectal norm in 16th century
Slovakia: a phonological analysis of 16th century Slovak administrative-legal texts. München. (Slavistische Beiträge 335)
Lauersdorf, M.R. 2002. Slovak Standard Language Development in the 15th-18th Centuries: A Diglossia Approach. In: Janda, L. et al. (eds.): Where One’s Tongue Rules Well: A Festschrift for Charles E. Townsend. Bloomington, 245-264. (Indiana Slavic Studies 13)
Lauersdorf, M.R. 2003. Protestant language Use in 17th Century Slovakia in a Diglossia Framework. In: Že�uch, P. (ed.): Život slova v dejinách a jazykových vz�ahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doru�u. Bratislava, 49-59.
Lifanov, K.V. 2000. Jazyk duchovnoj literatury slovackich katolikov XVI-XVIII vv. i kodifikacija A. Bernolaka. Moskva.
Lifanov, K.V. 2001. Genezis slovackogo literaturnogo jazyka. München. (Lincom Studies in Slavic Linguistics 21)
Lifanov, K.V. 2005. Vytesnenie bogemizmov iz lekis�ekogo sostava slovackogo literaturnogo jazyka s konca XIX veka. Die Welt der Slaven 50, 71-82.
Marti, R. 1993. Slovakisch und (echisch vs. (echoslovakisch, Serbokroatisch vs. Kroatisch und Serbisch. In: Gutschmidt, K. et al. (Hrsg.): Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongreß in Preßburg/Bratislava. Köln-Weimar-Wien, 289-315.
Matula, P. 1998. (eskoslovenský jazyk na slovenských stredných školách. (eskí stredoškolskí profesori na Slovensku a jazyková otázka v období I. (SR. Slovanský p�ehled 84, 47-54.
Meš�erskij, N.A. 1972. Russkaja dialektologija. Moskva. Morav�ík, Š. 1996. Krátky slovník náre�ia slovenského záhoráckeho jakubovského. Bratislava. (Krátky
slovník najkrajších slovenských náre�í 7) MS: Sládek, M. (ed.) 1995. Malý sv�t jest �lov�k aneb výbor z �eské barokní prózy. Jino�any. MSJ: Morfológia slovenského jazyka. 1966. Bratislava. Musilová, K. 2000. (esko-slovenský pasivní bilingvismus. In: Ondrejovi�, S. (ed.): Mesto a jeho jazyk.
Bratislava, 280-288. (Sociolinguistica Slovaca 5) Náb�lková, M. 1999. Sloven�ina a �eština dnes. Kontakt �i konflikt. In: Ondrejovi�, S. (ed.): Sloven�ina
v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava, 75-93. (Sociolinguistica Slovaca 4) Náb�lková, M. 2000. Rozdelenie a „vzda�ovanie“. Nieko�ko poh�adov. In: Pospíšil, I., Zelenka, M.
(eds.): esko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno, 104-112. Náb�lková, M. 2002. Medzi pasívnym a aktívnym bilingvizmom (poznámky k špecifiku slovensko-�eských jazykových vzahov). In: Štefánik, J. (ed.): Bilingvizmus. Minulos�, prítomnos�, budúcnos�. Bratislava, 101–114.
Náb�lková, M. 2004. Hospoda premává, i když nefunguje elektrika... Zo života slovakizmov v �eskej komunikácii. eština doma a ve sv�t� 12, 192-207.
Palkovi�, K. 1996. Krátky slovník náre�ia slovenského záhoráckeho senického. Bratislava. (Krátky slovník najkrajších slovenských náre�í 9)
Pauliny, E. 1948. Dejiny spisovnej sloven�iny. Bratislava. Pauliny, E. 1983. Dejiny spisovnej sloven�iny od za�iatkov až po sú�asnos�. Bratislava. PDS: Pramene k dejinám sloven�iny 2. 2002. Zost. T. Laliková, M. Majtán. Bratislava. Porák, J. 1979. Humanistická �eština. Hláskosloví a pravopis. Praha. (Acta Universitatis Carolinae.
Philologica. Monographia 75) Rehder, P. 1995. Standardsprache. Versuch eines dreistufigen Modells. Die Welt der Slaven 40, 352-366. Scharnhorst, J. 1995. Sprachsituation und Sprachkultur als Forschungsgegenstand. In: Scharnhorst, J.
(Hrsg.): Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich. Frankfurt a. M. etc., 13-33. (Sprache. System und Tätigkeit 18)
Schiffman, H.F. 2002. Comment. International Journal of the Sociology of Language 157, 141-150. Sloboda, M. 2004. Slovensko-�eská (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost. eština doma a ve
sv�t� 12, 208-220.
124 Markus Giger
Sokolová, M. 1995. (eské kontaktové javy v sloven�ine. In: Ondrejovi�, S., Šimková, M. (eds.): Sociolingvistické aspekty výskumu sú�asnej sloven�iny. Bratislava, 188-206. (Sociolinguistica Slovaca 1)
SSN: Slovník slovenských náre�í I. 1994. Bratislava. Stanislav, J. 1958. Dejiny Slovenského jazyka. II. Bratislava. Stehlík, M., Lukeš, M. 2004. Die Sprachenfrage in der Ersten Tschechoslowakischen Republik:
Ausgangssituation und Kodifizierungsbestrebungen der slowakischen Sprache am Beispiel Václav Vážnýs. Zeitschrift für Slawistik 49, 420-433.
Štolc, J. 1994. Slovenská dialektológia. Bratislava. Thomas, G. 1989. The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages. Slavisti�na
revija 37, 273-281. Thomas, G. 1992. Ján Kollár’s Thesis of Slavic Reciprocity and the Convergence of the Intellectual
Vocabularies of the Czech, Slovak, Slovene, Croatian and Serbian Standard Languages. Canadian Slavonic Papers 34, 279-299.
Tuguševa, R. 1996. Neologizmy v blizkorodstvennych jazykach (na primere �ešskogo i slovackogo jazykov). Jazykovedný �asopis 47, 25-40.
Uspenskij, B.A. 32002. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Moskva. van Leeuwen-Turnovcová, J. 2001. Nochmals zur Diglossie in Böhmen – diesmal auch aus der Gender-
Perspektive. Zeitschrift für Slawistik 46, 251-280. van Leeuwen-Turnovcová, J. 2002. Familiarisierung elaborierter Sprachstile aus der Gender-Perspektive
– ein tschechisch-russischer Vergleich. In: Kusse, H., Unrath-Scharpenack, K. (eds.): Kulturwissenschaftliche Linguistik. Beispiele aus der Slavistik. Bochum, 249-268.
Vážný, V. 1964. Historická mluvnice �eská II. Tvarosloví 1. Sklo�ování. Praha. Wexler, P. 1971. Diglossia, language standardization and purism. Parameters for a typology of literary
languages. Lingua 27, 330-354. Wexler, P. 1992. Diglossia et schizoglossia perpetua – the fate of the Belorussian language.
Sociolinguistica 6, 42-51. Zhrnutie V štúdii sa diskutuje pomer medzi sloven�inou a �eštinou ako písomnými jazykmi na území Slovenska v tzv. predspisovnom období a vývin tohto pomeru po prvých explicitných kodifikáciách sloven�iny až dodnes. Po úvode sa v odseku 1 prezentujú názory doterajšej slovakistiky na funkcie �eštiny na Slovensku a diskutujú sa termíny ‚predspisovné obdobie‘, ‚slovakizovaná �eština‘, ‚kultúrna sloven�ina‘, ‚spisovná sloven�ina staršieho typu‘, ‚slovensko-�eský jazyk‘ atd. Zvláštna pozornos sa venuje novej koncepcii K.V. Lifanova. V 4alšej �asti (2.) sa uvádzajú možnosti a problémy spojené s identifikáciou geneticky slovenských a �eských prvkov v starších textoch pochádzajúcich zo slovenského etnického územia. Rozlišuje sa sedem základných konštelácií vývinu pod�a toho, �i vývin v sloven�ine a �eštine prebehol paralelne, �i sloven�ina alebo �eština (slovenské �i �eské náre�ia alebo ich �asti) vykazujú inováciu alebo �i jeden z jazykov �asom prevzal nejaký prvok z druhého (porov. tabulku 1). V závislosti od konkrétnych konštelácií dané prvky majú výpovednú hodnotu pre ur�ovanie slovacity konkrétneho textu alebo nie. Vychádzajúc z toho sa relativizujú v tretej �asti niektoré Lifanove postuláty oh�adne možností dokáza osamostatnenie písomného jazyka používaného na Slovensku na za�iatku 17. stor. od písomnej �eštiny tejto doby, iné postuláty sa potvrdzujú. Zdôraz�uje sa nutnos paralelného skúmania textov pochádzajúcich z rôznych oblastí Slovenska aj (eských krajín danej doby pre kone�nú odpove4 na otázku, �i a kedy sa písomná tradícia na Slovensku osamostatnila od písomnej �eštiny svojej doby. Vo štvrtej �asti sa predstavujú dve aplikácie pojmu diglosie na slovenskú jazykovú situáciu 16. – 18. stor. (Lifanov, Lauersdorf). Obidva navrhy sa zara4ujú do svojho pojmového kontextu (staroruská situácia u Lifanova a pojem ‚schizoglosie‘ u Lauersdorfa) a rozvíja sa postulát, že slovenská jazyková situácia raného novoveku je rovnako diglosijná ako vä�šina iných jazykových situácií v Európe danej doby, s tým rozdielom, že evanjelická �as slovenského obyvate�stva používala dve variety H (prestížne variety), totiž �eštinu plus ‚spisovnú sloven�inu staršieho typu‘/‚slovakizovanú �eštinu‘, ktoré medzi sebou boli v ur�itej komplementárnej distribúcii a ktorých aspekty prestíže boli rôzne. Sleduje sa prehodnotenie diglosijnej situácie pociovanej ako endoglosná (�eština je ‚vlastný‘ jazyk) na situáciu pociovanú ako exoglosná (�eština nie je viac ‚vlastný‘ jazyk), ktoré dáva priestor pre zavedenie prvkov konkrétnych slovenských hovorových �i dialektálnych variet do písomného a v kone�nom dôsledku spisovného jazyka. Tým vzniká nová endoglosná diglosia, ktorá je však �asom prekonaná, a etabluje sa situácia
Die Sprachsituation in der Slovakei 125
‚štandard s náre�iami‘, v ktorej spisovný jazyk má rodilých hovorcov a slúži aj informálnej komunikácii. V piatej �asti sa napokon sleduje 4alší vývin pomeru medzi sloven�inou a �eštinou od polovice 19. stor., zdôraz�uje sa kontinuita tohto vývinu napriek rôznym peripetiám spôsobeným politickými zmenami. Berie sa oh�ad nielen na rolu �eštiny na Slovensku, ale aj sloven�iny v (eských krajinách a pod�iarkuje sa, že Slovensko a (esko doteraz tvorí jeden komunika�ný priestor, nie ve�mi inak než frankofónne, anglosaské �i nemecky hovoriace krajiny, aj ke4 s dvoma rozli�nými a plne samostatnými spisovnými jazykmi.








































![Puschkin und Tiflis: Kaukasische Spuren (preprint) [Pushkin and Tbilisi: Caucasian Traces (preprint)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315cc26511772fe45108470/puschkin-und-tiflis-kaukasische-spuren-preprint-pushkin-and-tbilisi-caucasian.jpg)