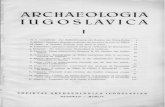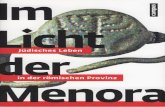Neue Depressionsleitlinien-Zentrale Rolle der Psychotherapie
Neue Funde zur Textilherstellung in Qarara
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Neue Funde zur Textilherstellung in Qarara
NEUE FUNDE ZUR TEXTILHERSTELLUNG IN QARARA
VON
BÉATRICE HUBER
Im Frühjahr 2009 fand eine zweite Grabungskampagne in Qarara statt1. Sie widmete sich dem nördlichen Teil des archäologischen Areals, das von einer Siedlung eingenommen ist2. Ziel der Unter-suchung war die chronologische und funktionelle Erfassung der Siedlungsstrukturen und deren Umfang. Die Bauten weisen meh-rere Phasen auf und wurden zuletzt als Stallung benützt, so dass das Fundmaterial besonders spärlich ausfällt. Dagegen sind die aus Textilien und Holzresten bestehenden Funde aus dem Fried-hof, der unmittelbar unter der Bebauung liegt, umso reicher ver-treten. Zahlreiche Grabräubergruben sind im ganzen Siedlungsbe-reich vorhanden; sie reichen zum Teil bis zum gewachsenen Bo-den und zerstören die Schichtabfolge der Bauten und des Fried-hofs. Das darin verworfene Fundmaterial ist somit stratigraphisch nicht mehr einzugliedern. Das auf dem ganzen Grabungsareal bis jetzt untersuchte archäologische und numismatische Material er-laubt aber eine chronologische Einordnung zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert, während dessen erster Hälfte der Ort wahrschein-lich verlassen wurde.
Gegenstände, die zur Textilherstellung gehören, kommen auf-fallend häufig vor. Die Fundumstände erlauben es nicht immer, sie einem Siedlungs- oder Friedhofskontext zuzuweisen. Unter diesen Funden sind die zwei folgenden Besonderheiten zu erwäh-nen:
1 Wie in den vorigen Jahren wurde die Grabungskampagne durch das Museu Egipci de Barcelona, Fundaciò Arqueològica Clos, finanziert. Seinem Präsidenten, Jordi Clos, sei hier gedankt.
2 s. BSAC XLVII, 2008, 53-71, bes. Abb. 2.
B. HUBER BSAC XLVIII 2009 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
62
1. Fuß einer Haspel Maße: Länge, Breite und Höhe der Balken, jeweils: 32 x 5,5-6,5 x 7-7,5 cm Material: Holz minderer Qualität mit zahlreichen Astlöchern. Holzart
nicht bestimmt. Befund: Aus Grabräubergrube.
Der kreuzförmige Gegenstand ist vollständig erhalten (Abb. 1,
Taf. XVa). Er besteht aus zwei Balken, die auf einer Höhe von 3 cm miteinander verzapft sind. Die Zwischenräume bei der Ver-zapfung sind mit dünnen Holzplättchen verkeilt. Auf der Unter-seite der Kreuzbalken befindet sich eine Auskerbung ca. 5 cm von den jeweiligen Enden der vier Kreuzarme. Zwei Schnurstränge (Palmbast, mehrfacher S-Zwirn) sind quer durch die vier Arme gezogen.
Abb. 1: Kreuzförmiger Fuß der Drehhaspel aus Qarara
FUNDE ZUR TEXTILHERSTELLUNG __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
63
Der Vergleich mit einer ca. 50 Jahre alten Haspel, die im Früh-jahr 2009 bei einem Teppichweber im Dorf Sharuna entdeckt wur-de3, deutet das Kreuz von Qarara als Fuß einer Drehhaspel (Taf.
XVI). Das moderne Stück ist ein zylindrisches und sich nach oben verjüngendes Gestell aus Holzstäben bzw. -speichen, die oben und unten durch ein Kreuz zusammengehalten werden. Die Achse sowie der Sockel, auf den sie gesteckt war, um die Drehung zu erlauben, sind abhanden gekommen. Solche Drehhaspeln sind in zahlreichen ethnographischen sowie volkskundlichen Beispielen zu finden. Bei dem Fuß aus Qarara fehlt die Durchbohrung für die Achse in der Mitte des Kreuzes. Die Auskerbungen auf der Unter-seite der Balken scheinen aber darauf zu deuten, dass die Haspel auf einem kreisförmigen Untersatz von ca. 20 cm Durchmesser eingesetzt war und darauf gedreht werden konnte. Wie beim Ge-rät aus Sharuna waren wahrscheinlich Holzstäbe an beiden Seiten der jeweiligen Arme mit Schnüren festgebunden und die Armen-den ebenso miteinander verbunden, um der Vorrichtung zusätzli-che Stabilität zu verleihen.
Das Haspeln ist ein Vorgang, der zwischen dem Spinnen und dem Schären (s. unten) stattfindet. Dabei wird das fertig gespon-nene Garn aufgewickelt, um Stränge zu bilden. Es ist weder in antiken Bilddarstellungen noch Schriftquellen belegt. Aus den Qarara-Grabungen von 1913-1914 stammt ein anderer Haspeltyp, der aus einem Mittelstab mit an beiden Enden rechtwinklig ange-ordneten Querstäben besteht und der bis zur heutigen Zeit be-zeugt ist4.
3 Das Gerät befindet sich im Besitz der Familie Boutros, Handweber in der 7. Generation. Die Haspel war nicht mehr in Gebrauch und von neueren Geräten (Abb. 3 rechts) ersetzt.
4 C. NAUERTH, Karara und El-Hibe. Die spätantiken („koptischen“) Funde aus den badischen Grabungen 1913-1914. SAGA 15, 1996, Abb. 195. M. VAN RAEM-
DONCK, in: Bulletin des Musées Royaux d’art et d’histoire (im Druck). Dieser Haspel-typ kommt neben der Drehhaspel ab dem Frühmittelalter in Europa vor.
B. HUBER BSAC XLVIII 2009 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
64
2. Schärgerät5
Maße: Gesamtlänge: 41 cm Länge des Mittelstückes: 20,5 cm Länge, Breite und Höhe der Querhölzer: 17 x 5,2 x 8-8,5 cm Länge der Stifte: 13-14,5 cm
Material: Hartholz. Holzart nicht bestimmt. Befund: Aus Friedhofsschicht südlich der Siedlung6.
Abb. 2. Schärgerät aus Qarara Das Schärgerät besteht aus zwei massiven Holzblöcken, in de-
nen zwei bzw. drei Holzstifte verzapft sind und die auf der Längs-seite mit einem dünneren Holzbalken verbunden sind (Abb. 2,
Taf. XVb). An dem Block mit den zwei Stiften ist ein Griff mit ei-
5 Oder Schergerät. 6 Südlich der Sondierung 3 der Grabung 2008: s. BSAC XLVII, 2008, 55, Abb. 2.
FUNDE ZUR TEXTILHERSTELLUNG __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
65
nem Aufhängeloch angebracht. Griff und Querbalken sind in den Blöcken verzapft und mithilfe von Holzstückchen verkeilt. Die Stifte sind auf einer Länge von 4-5 cm in den Blöcken eingezapft. Der Block mit den drei Stiften ist auf der ganzen Länge gespalten, so dass er nachträglich mit drei Eisennägeln genagelt werden musste. Das Gerät ist vollständig erhalten.
Beim Schären werden die Fäden für die Kette vorbereitet. Die Fäden werden in der gewünschten Länge und Fadenzahl um Stifte bzw. Pflöcke geführt, so dass sie in zusammengebunden Strängen abgenommen und dann leicht auf dem Webrahmen aufgebäumt werden können.
Um mit dem aus Qarara gefundenen Gerät die Kettfäden zu schären, ist das Vorhandensein eines oder mehrerer weiterer be-weglicher Stifte notwendig. Diese befinden sich in einer mehr oder weniger großen Entfernung, je nach der herzustellenden Länge der Kettfäden (s. Rekonstruktion in Abb. 3). Das Gerät ist nach demselben Prinzip wie der moderne drehbare Schärbaum, auf dem aber der Faden in Spiralen von oben nach unten und zurück geführt wird, konstruiert. Fünf Stifte sind für die notwendige Bil-dung von Fadenkreuz und Gangkreuz, die das Einsetzen von Trenn- oder Fadenkreuzstäbe nach dem Aufbäumen ermöglichen, erforderlich. Das relativ kleine Gerät erlaubte es sicher nicht, eine große Anzahl an langen Ketten zu schären; es eignete sich eher für die Bereitstellung feinerer Arbeiten, die schmal waren und kürzere Ketten benötigten, wie zum Beispiel Bordüren und Besätze. Mögli-cherweise wurde es bei der Vorbereitung der farbigen, in großer Menge im funerären Bereich für die Wicklung der Verstorbenen notwendigen Bänder benützt, da diese nur 7 bis 11 Ketten breit sind7. Um die sehr hohe Spannung der aufgebrachten Kettfäden standzuhalten, musste das Schärgerät besonders stabil verankert sein. Es war wahrscheinlich in Augenhöhe am Stiel und zusätzlich am Querbalken an der Wand festgenagelt (Abb. 3).
Das Schärgerät aus Qarara ist ein einzigartiger Fund. Bisher ist archäologisch oder ethnographisch nichts Vergleichbares bekannt.
7 s. BSAC XLVII, 2008, 64.
B. HUBER BSAC XLVIII 2009 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
66
Abb. 3. Anwendungsmöglichkeit des Schärgeräts in Abb. 4 und 5
FUNDE ZUR TEXTILHERSTELLUNG __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
67
Der Vorgang des Schärens selbst, der nur in ikonographischen Quellen sowie ethnographischen und volkskundlichen Beschrei-bungen vorkommt, ist archäologisch nicht überliefert. Die häufig-ste Weise der Kettzubereitung, die weltweit bis zu den modernen traditionellen Handwebern verbreitet ist, besteht darin, Pflöcke in die Wand oder in den Boden in bestimmter Entfernung zu schla-gen und das Kettgarn in der erforderlichen Länge um sie zu füh-ren. Im Alten Ägypten sind Schärszenen nur aus Grabwänden und Modellen des Mittleren und Neuen Reichs bekannt. Sie zeigen auf, wie die Kette mithilfe von Pflöcken an einer Wand oder in Boden-höhe geschärt wird8. Eine ähnliche, zeitgenössische Vorgehens-weise konnte im Jahr 2007 im Dorf Sharuna bei traditionellen Tep-pichwebern9, die das Kettgarn um mehrere, in die Wand der lan-gen Eingangshalle des Hauses gerammte Stifte wickeln, dokumen-tiert werden. Diese Schärmethode hinterlässt wenig Spuren und ist archäologisch schwer nachzuprüfen, wie das Beispiel von der Felsnekropole in Sharuna zeigt. Dort sind die Grabkammern als Wohn- und Arbeitsstätte, insbesondere als Weberwerkstatt10, in spätrömisch-byzantinischer Zeit wiederverwendet worden. Die Felswände sind mit Löchern, in denen manchmal noch Holzstifte stecken, übersät. Eine bestimmte Anordnung kann nicht erkannt werden, so dass diese Aufhängevorrichtungen für alle mögliche Zwecke benützt werden konnten. Bei den Teppichwebern aus Sha-runa sind die Pflöcke versetzbar und können je nach Gebrauch in die Wand eingesetzt werden11.
Die zwei vorgestellten Objekte aus Qarara widerspiegeln zwei archäologisch selten nachweisbare Etappen in der „chaîne opéra-toire“ der Textilherstellung: das Haspeln und das Schären. Dage-gen sind die Vorgänge des Spinnens und des Webens ausreichend dokumentiert. Während der Grabung des Frühjahrs 2009 wurden 11 Spindeln und Spinnwirtel, sowie 23 Fragmente von 3- bzw. 5-
8 Zusammenstellung der Quellen in: B.J. KEMP/G. VOGELSANG-EASTWOOD, The Ancient Textile Industry at Amarna, London 2001, 314-342.
9 Familie Qalina. 10 s. BSAC XLV, 2006, 63-64; BSAC XLVI, 2007, 66-68. 11 Ich danke DORIS EHRATH für ihre Hilfe im webtechnischen Bereich.
B. HUBER BSAC XLVIII 2009 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
68
teiligen Webkämmen gefunden. Aus den Grabungen von 1913-1914 stammen ca. 180 Spindeln und Spinnwirtel sowie 55 Web-kämme und Fragmente von Webkämmen, weiterhin Webschwer-te, Spulen und Nadeln. All diese Funde zeugen von einer regen lokalen Textilproduktion, wie die ungeheuerlichen Massen an Stoffen, die im Friedhof vorhanden sind, zur Genüge belegen.