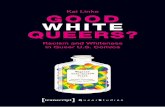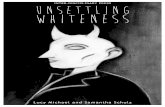Der Weißheit letzter Schluß. Neue Studien zur Rassismusforschung [The Last Conclusion of...
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Der Weißheit letzter Schluß. Neue Studien zur Rassismusforschung [The Last Conclusion of...
Archiv fürSozialgeschichte
Herausgegeben von derFriedrich-Ebert-Stiftungin Verbindung mit demInstitut für Sozialgeschichte e.V.Braunschweig – Bonn
44. Band · 2004
VerlagJ.H.W. Dietz Nachf.
REDAKTION: BEATRIX BOUVIER
DIETER DOWE
PATRIK VON ZUR MÜHLEN
MICHAEL SCHNEIDER
SCHRIFTLEITUNG: FRIEDHELM BOLL
REDAKTIONSASSISTENZ: ANJA KRUKE
Redaktionsanschrift:Institut für SozialgeschichteGodesberger Allee 149, 53175 BonnTel. 02 28/88 34 70, Fax: 02 28/88 34 97e-mail: [email protected]
Frau Bundestagspräsidentin a.D. Dr. h.c. Annemarie Rengerzum 85. Geburtstag gewidmet.
Herausgeber und Verlag danken Herrn Martin Brost für die finanzielle För-derung von Bearbeitung und Druck dieses Bandes.
ISSN 0066-6505ISBN 3-8012-4148-3
© 2004 Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Dreizehnmorgenweg 24, 53175 BonnUmschlag und Einbandgestaltung: Bruno Skibbe, BraunschweigHerstellung: Toennes Druck + Medien GmbH, ErkrathAlle Rechte vorbehaltenPrinted in Germany 2004
Inhalt
BEITRÄGE ZUM RAHMENTHEMA »DIE SIEBZIGERJAHRE. GESELLSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNGEN IN DEUTSCHLAND«
Bernd Faulenbach, Die Siebzigerjahre – ein sozialdemokratisches Jahrzehnt? . . . .
Detlef Siegfried, »Einstürzende Neubauten«. Wohngemeinschaften, Jugendzentrenund private Präferenzen kommunistischer »Kader« als Formen jugendlicherSubkultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietmar Süß, Die Enkel auf den Barrikaden. Jungsozialisten in der SPD in denSiebzigerjahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolfgang Kraushaar, Die Frankfurter Sponti-Szene. Eine Subkultur als politischeVersuchsanordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gisela Notz, Die autonomen Frauenbewegungen der Siebzigerjahre. Entstehungs-geschichte – Organisationsformen – politische Konzepte . . . . . . . . . . . . . . .
Adelheid von Saldern, Markt für Marx. Literaturbetrieb und Lesebewegungen inder Bundesrepublik in den Sechziger- und Siebzigerjahren . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Kleinknecht/Michael Sturm, »Demonstrationen sind punktuelle Plebis-zite«. Polizeireform und gesellschaftliche Demokratisierung von den Sechziger-zu den Achtzigerjahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klaus Weinhauer, Terrorismus in der Bundesrepublik der Siebzigerjahre. Aspekteeiner Sozial- und Kulturgeschichte der Inneren Sicherheit . . . . . . . . . . . . . .
Wolfgang Schroeder, Gewerkschaften als soziale Bewegung – soziale Bewegung inden Gewerkschaften in den Siebzigerjahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franz-Werner Kersting, Abschied von der »totalen Institution«? Die westdeutscheAnstaltspsychiatrie zwischen Nationalsozialismus und den Siebzigerjahren . .
Anja Kruke, Der Kampf um die Deutungshoheit. Meinungsforschung als Instru-ment von Parteien und Medien in den Siebzigerjahren . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruth Rosenberger, Demokratisierung durch Verwissenschaftlichung? BetrieblicheHumanexperten als Akteure des Wandels der betrieblichen Sozialordnung inwestdeutschen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benjamin Ziemann, Zwischen sozialer Bewegung und Dienstleistung am Indivi-duum. Katholiken und katholische Kirche im therapeutischen Jahrzehnt . . .
Frank Fischer, Von der »Regierung der inneren Reformen« zum »Krisenmanage-ment«. Das Verhältnis zwischen Innen- und Außenpolitik in der sozial-libera-len Ära 1969–1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archiv für Sozialgeschichte 36, 1996 V
1
39
67
105
123
149
181
219
243
267
293
327
357
395
Gottfried Niedhart/Oliver Bange, Die »Relikte der Nachkriegszeit« beseitigen. Ost-politik in der zweiten außenpolitischen Formationsphase der BundesrepublikDeutschland im Übergang von den Sechziger- zu den Siebzigerjahren . . . . . .
Axel Schildt, »Die Kräfte der Gegenreform sind auf breiter Front angetreten«. Zurkonservativen Tendenzwende in den Siebzigerjahren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORSCHUNGSBERICHTE UND REZENSIONEN
Ursula Münch, Neuere Arbeiten zur Familienpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oliver Bange, Die Außenpolitik der DDR – Plädoyer für ein vernachlässigtes For-schungsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frank Bösch, »Berlusconi von links«? Die Medien der SPD in historischer Per-spektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Lemberg, Geschichten und Geschichte. Das Gedächtnis der Vertriebenen inDeutschland nach 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jost Dülffer, Europa – aber wo liegt es? Zur Zeitgeschichte des Kontinents . . . .
Jørgen Kühl, Nationale Minderheiten in der Europäischen Union am Beispiel derdeutschen Minderheit in Dänemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wulf D. Hund, Der Weißheit letzter Schluss. Neue Studien zur Rassismusforschung
Ilko-Sascha Kowalczuk, Die gescheiterte Revolution – »17. Juni 1953«. For-schungsstand, Forschungskontroversen und Forschungsperspektiven . . . . . .
Christopher Kopper, Neuerscheinungen zur Geschichte des Reisens und des Tou-rismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michael Prinz, Bürgerrecht Konsum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
Achim Landwehr, Geschichte des Sagbaren. Einführung in die Historische Disk-ursanalyse, Tübingen 2001 (Peter Haslinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt/Main 2003(Peter Haslinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geoff Eley, Forging Democracy. The History of the Left in Europe 1850–2000,New York etc. 2002 (Adelheid von Saldern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frank Uekötter, Von der Rauchplage zur ökologischen Revolution. Eine Ge-schichte der Luftverschmutzung in Deutschland und den USA 1880–1970, Es-sen 2003 (Jens Ivo Engels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI Forschungsberichte und Rezensionen
415
449
481
492
501
509
524
565
580
606
665
678
691
691
695
700
VII Forschungsberichte und RezensionenAndreas R. Hofmann/Anna Veronika Wendland (Hrsg.), Stadt und Öffentlich-
keit in Ostmitteleuropa 1900–1939. Beiträge zur Entstehung moderner Urbani-tät zwischen Berlin, Charkiv, Tallin und Triest, Stuttgart 2002 (Kirsten Bönker)
Vera Bücker, Nikolaus Groß. Politischer Journalist und Katholik im Widerstanddes Kölner Kreises, Münster etc. 2003 (Hans Mommsen) . . . . . . . . . . . . . .
Claus-Dieter Krohn/Axel Schildt (Hrsg.), Zwischen den Stühlen? Remigranten undRemigration in der deutschen Medienöffentlichkeit der Nachkriegszeit, Ham-burg 2002 (Christian Sonntag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résumés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rahmenthemen der nächsten Bände des »Archivs für Sozialgeschichte« . . . . . . .
Einzelrezensionen finden Benutzer des »Archivs für Sozialgeschichte« unter http://www.fes.de/afs-online.de
Archiv für Sozialgeschichte 36, 1996 VII
701
704
707
710
720
730
735
580 Forschungsberichte und Rezensionen
Wulf D. Hund
Der Weißheit letzter Schluss
Neue Studien zur Rassismusforschung
Robert Bernasconi/Sybol Cook (Hrsg.), Race and Racism in Continental Phi-losophy (Studies in Continental Thought), Bloomington, Indiana UniversityPress, Indianapolis 2003, 316 S., kart., $ 24,95.
Patrick Brantlinger, Dark Vanishings. Discourse on the Extinction of PrimitiveRaces, 1800-1930, Cornell University Press, Ithaca etc. 2003, 256 S., brosch., $ 19,95.
Ellis Cashmore (Hrsg.), Encyclopedia of Race and Ethnic Studies, Routledge,London etc. 2004, 491 S., geb., £ 95,00.
Ashley W. Doane/Eduardo Bonilla-Silva (Hrsg.), White Out. The ContinuingSignificance of Racism, Routledge, New York etc. 2003, 328 S., kart., £ 15,99.
Brigitte Fuchs, ›Rasse‹, ›Volk‹, Geschlecht. Anthropologische Diskurse in Öster-reich 1850-1960, Campus Verlag, Frankfurt/Main etc. 2003, 388 S., brosch.,39,90 €.
Cornelia Hecht, Deutsche Juden und Antisemitismus in der Weimarer Republik(Politik- und Gesellschaftsgeschichte, Bd. 62), J. H. W. Dietz Nachf., Bonn2003, 428 S., geb., 32,00 €.
Sarah Jansen, »Schädlinge«. Geschichte eines wissenschaftlichen und politischenKonstrukts 1840-1920 (Historische Studien, Bd. 25), Campus Verlag, Frank-furt/Main etc. 2003, 434 S., kart., 45,00 €.
Karin Priester, Rassismus. Eine Sozialgeschichte, Reclam, Leipzig 2003, 320 S.,kart., 11,90 €.
Colin Tatz, With Intent to Destroy. Reflections on Genocide, Verso, Londonetc. 2003, 222 S., geb., £ 19,00.
Massimo Ferrari Zumbini, Die Wurzeln des Bösen. Gründerjahre des Antise-mitismus: Von der Bismarckzeit zu Hitler, Vittorio Klostermann, Frankfurt/Main 2003, 774 S., Ln., 49,00 €.
In der aktuellen Rassismusforschung ist viel von Körpern die Rede.1 Als Volkskörperrepräsentieren sie Gemeinschaften, die sich nicht zuletzt dadurch konstituieren, dass sie
1 Leider fehlen die Stichworte ›Body‹ oder ›Embodiment‹ in der neu erschienenen Encyclopedia ofRace and Ethnic Relations. Das Buch wird als Produkt eines »world-class team of internationalscholars« angekündigt und soll als »an authoritative […] work on all aspects of race and ethnicstudies« gelten. Cashmore, Klappentext. Tatsächlich ist es das nicht nur, weil es weit gehend kon-kurrenzlos ist: Vgl. aber Guido Bolaffi u.a. (Hrsg.), Dictionary of Race, Ethnicity, and Culture,London etc. 2002. Das Buch von Cashmore vereint auch eine Vielzahl informativer Beiträge. Die
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 581
Fremdkörper ausschließen. Als politische Körper symbolisieren sie einen Zusammen-halt, der durch Krankheit und Vergiftung bedroht wird. Sie bilden Formen, die durchdie Wahrnehmung anderer geprägt werden. Ihre Oberflächen dienen der Projektion undmarkieren Grenzen. Sie werden normiert, fungieren als Chiffren, unterliegen Einschrei-bungen und verkörpern Verhältnisse.
Wenn die Ergebnisse ihrer Analyse, Beschreibung, Charakterisierung und Diskussionals Bücher vorgelegt werden, ist es deswegen nicht eben abwegig, sich den in ihnen ver-sammelten Erkenntnissen als sichtbar und greifbar gemachtem Wissen zu nähern. Dannunterscheidet sich Rassismusforschung im angelsächsischen und deutschen Sprachbe-reich schon optisch und haptisch. Die im Rezensionswesen wie im Studienbetrieb indi-zierten Paperbackeditionen werden von englischen und amerikanischen Verlagen häu-fig, von deutschen Verlagen nahezu nie gebunden. Ihre geleimten Rücken leiden deswe-gen schon beim ersten Aufschlagen und lassen für die ihnen von den Büchermachernzugebilligte Haltbarkeit Böses ahnen. Freilich soll sie in keinem direkten Zusammen-hang mit den Inhalten stehen, wie aus den sich fast immer auf der hinteren Umschlag-seite zu findenden lobenden Informationen hervorgeht, die es praktisch verbieten, dasBuch zu ignorieren. Im englischsprachigen Bereich sind das auch schon bei Erstauflagenoft kurze Ausschnitte aus den dort üblichen Gutachten von dritter Seite. Bei deutschenBüchern handelt es sich häufig um knappe Beschreibungen, mit denen die Autorinnenund Autoren ihre Arbeiten selbst charakterisieren.
Karin Priester macht hierin mit ihrer Übersicht zum Thema Rassismus keine Aus-nahme. Sie, heißt es im Klappentext, »schreibt die Sozialgeschichte des Rassismus und
Artikel sind allerdings nicht immer so neu, wie es den Anschein hat. Viele wurden aus EllisCashmore (Hrsg.), Dictionary of Race and Ethnic Relations, 4. Aufl., London etc. 1996 über-nommen und häufiger kaum überarbeitet. Auch sind die Buchstaben gelegentlich mit einer Samm-lung von Stichworten ausgestattet, die nicht recht durchschaubar ist. Unter ›J‹ etwa finden sichnur ›Jackson, Jesse‹, ›Jackson, Michael‹, ›Jim Crow‹, und ›Jordan, Michael‹, nicht aber ›Jazz‹, ›Jed-wabne‹, ›Jews‹ oder ›Jus Soli‹. Außerdem hätte Jack Johnson erwähnt werden können, der ersteafrikanisch-amerikanische Boxweltmeister im Schwergewicht, nach dessen Sieg gegen die ›Hoff-nung der weißen Rasse‹ in sämtlichen Südstaaten der USA Rassenunruhen ausbrachen und derKongress in Washington gesetzlich verbot, Filme von Boxkämpfen zu zeigen, um die Verbreitungbewegter Bilder dieses Sieges zu unterbinden: Vgl. Randy Roberts, Papa Jack. Jack Johnson andthe Era of White Hopes, New York 1983; Gail Bederman, Manliness and Civilization. A Cultu-ral History of Gender and Race in the United States, 1880-1917, Chicago etc. 1995, insb. S. 1-44.Natürlich muss ein einbändiges Lexikon die Anzahl seiner Beiträge beschränken. Dass aber Pau-line Hanson und die One Nation Party gleich mit zwei Lemmata über zusammen sieben Spaltenvertreten sind, während etwa zur Critical Race Theory kein Stichwort vorgesehen ist, bleibt mehrals problematisch: Vgl. Richard Delgado/Jean Stefancic (Hrsg.), Critical Race Theory. The CuttingEdge, 2. Aufl., Philadelphia 2000 und Francisco Valdes/Jerome McCristal Culp/Angela P. Harris(Hrsg.), Crossroads, Directions, and a New Critical Race Theory, Philadelphia 2002. Gelegent-lich wird ein Artikel zwar von einem kompetenten Autor verfasst, der die Problematik aber ein-seitig darstellt. So verharmlost Michael Bantons Beitrag ›Eugenics‹, S. 150 f., die rassistische Ge-schichte der Eugenik ebenso wie ihre Beziehungen zur Genetik: Vgl. dazu Stefan Kühl, Die Inter-nationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen Bewegung für Eugenik undRassenhygiene im 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main etc. 1997; Daniel J. Kevles, Out of Eugenics.The Historical Politics of the Human Genome, in: Daniel J. Kevles/Leroy Hood (Hrsg.), The Codeof Codes. Scientific and Social Issues in the Human Genome Project, Cambridge/Mass. etc. 1993,S. 3-36. Oder Pierre L. van den Berghe schreibt über ›Sociobiology‹, S. 411 f., ohne konkrete Hin-weise auf die prominenten Kritiker dieses Ansatzes zu geben: Vgl. dazu Ullica Segerstråle, De-fenders of the Truth. The Sociobiology Debate, Oxford 2001. Trotzdem ist die Enzyklopädie einmaterialreiches Nachschlagewerk, dessen Bedeutung im Folgenden durch Hinweise auf einschlä-gige oder fehlende Stichworte unterstrichen wird (siehe Anm. 5, 7, 11, 18, 19, 21, 39, 40, 44, 48,49, 51, 60).
zeigt, dass er stets zur Untermauerung von Herrschaftsansprüchen dient«. Dieses Ver-sprechen wird allerdings in der Einleitung schon wieder zurückgenommen. Dort erklärtdie Verfasserin das auf dem Umschlag angekündigte Unterfangen für »vermessen«, wes-wegen »rassistische Denkmuster« und ihr sozialer »Hintergrund« lediglich »exemplarischaufgegriffen werden« könnten (S. 16). Dabei wäre es verdienstvoll gewesen, den Über-sichten von Imanuel Geiss, George L. Mosse und Patrik von zur Mühlen eine aktuelleund sozialhistorisch orientierte Untersuchung zur Seite zu stellen.2 Der Verfasserin istunbedingt beizupflichten, wenn sie dafür plädiert, dabei neben der Behandlung von»geistigen Strömungen« auch die »ökonomisch-sozialen Entwicklungen« zu untersuchen (S. 11). Zudem verspricht ihre Hypothese, dass rassistische Diskriminierung immer bio-logistische mit kulturalistischer Argumentation verbindet (S. 44), interessante Ergeb-nisse. Doch leider entpuppt sich die im Untertitel ihrer Arbeit angekündigte »Sozial-geschichte« gleich in mehrfacher Hinsicht als Mogelpackung: Sie beschäftigt sich nichtnäher mit der historischen und sozialen Reichweite des Rassismus; sie ersetzt die diffe-renzierte Diskussion der Beziehungen von sozialer Lage, sozialem Handeln und sozia-lem Bewusstsein durch geschichtsphilosophisch geprägte Verallgemeinerungen; sie un-terlegt ihrer Argumentation die Vorstellung eines einfachen und durchgehenden Gegen-satzes fortschrittlichen und reaktionären Denkens; und sie folgt ihrem Konzept eines en-gen Zusammenhangs von Krise und Rassismus selbst gegen die Fakten.
Die Reichweite des Rassismus wird auf die europäisch geprägte Moderne beschränkt.Obwohl das eine verbreitete Auffassung ist, bleibt sie doch begründungspflichtig. Argu-mentative Plädoyers haben sich dafür ausgesprochen, den Begriff des Rassismus weiterzu fassen.3 Demgegenüber beschwört die Autorin die »Gefahr«, Rassismus »zu eineruniversalen, anthropologisch verankerten Konstante menschlichen Verhaltens zu ma-chen«, wenn davon ausgegangen würde, »dass es Rassismus immer und überall gab«(S. 20). Tatsächlich betont der Hinweis auf unterschiedliche Formen rassistischer Dis-kriminierung in unterschiedlich strukturierten Klassengesellschaften unterschiedlicherEpochen aber gerade die Notwendigkeit der historischen Analyse ihrer Besonderheiten.
2 Vgl. Imanuel Geiss, Geschichte des Rassismus. Frankfurt/Main 1988; George L. Mosse, Die Geschichte des Rassismus in Europa, erw. Ausg., Frankfurt/Main 1990 (Originalausgabe: Rassis-mus. Ein Krankheitssymptom in der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts,Königstein 1978); Patrik von zur Mühlen, Rassenideologien. Geschichte und Hintergründe, Berlinetc. 1977.
3 Vgl. u.a. Wolfgang Detel, Griechen und Barbaren. Zu den Anfängen des abendländischen Ras-sismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43, 1995, H. 6, S. 1019-1043; Benjamin Isaac, TheInvention of Racism in Classical Antiquity, Princeton etc. 2004; Christian Delacampagne, L’in-vention du Racisme. Antiquité et Moyen Age, Paris 1983; David Goldberg, The Development ofthe Idea of Race. Classical Paradigmas and Medieval Elaborations, in: International Journal ofthe Classical Tradition 5, 1999, S. 561-570; Thomas Hahn, The Difference the Middle Ages Makes:Color and Race before the Modern World, in: The Journal of Medieval and Early Modern Stu-dies 31, 2001, H. 1, S. 1-37; James H. Sweet, The Iberian Roots of American Racist Thought, in:William and Mary Quarterly 54, 1997, S. 143-166; Bernard Lewis, Race and Color in Islam, NewYork etc. 1971; Ronald Segal, Islam’s Black Slaves. The Other Black Diaspora, New York 2001;John Brockington, Concepts of Race in the Mahabharata and Ramayana, in: Peter Robb (Hrsg.),The Concept of Race in South Asia, New Delhi 1997, S. 97-108; Susan Bayly, Caste, Society andPolitics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age, Cambridge etc. 1999; WolfgangBauer (Hrsg.), China und die Fremden. 3000 Jahre Auseinandersetzung in Krieg und Frieden,München 1980; Frank Dikötter (Hrsg.), The Construction of Racial Identities in China and Ja-pan, London 1997; siehe auch Wulf D. Hund, Inclusion and Exclusion: Dimensions of Racism,in: Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 3, 2003, H. 1, S. 6-19.
582 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 583
Deswegen muss er die theoretische Auseinandersetzung mit anthropologischen Vorstel-lungen primordialer Voraussetzungen von Rassismus nicht scheuen.4 Angesichts der all-gemeinen und erfolgreichen Ausbreitung soziobiologischer Argumentationsmuster inden Sozialwissenschaften wird die Auseinandersetzung nachgerade unverzichtbar.
Geschichtsphilosophische Verallgemeinerungen sind dabei nicht nur wenig hilfreich.Sie können auch unmittelbar in die Falle jener unhistorischen Betrachtungsweisenführen, die als Gefahr deutlich zu machen sie ursprünglich gedacht waren. Das zeigt sichschon im ersten Kapitel, das den Beginn des modernen Rassismus symbolisch auf »1492«fokussiert. In der Geschichte Spaniens steht dieses Jahr für die Entdeckung Amerikasund den Beginn des transatlantischen Sklavenhandels, für den Abschluss der Recon-quista und die territoriale Einigung, für die Vertreibung der Juden und für die Unter-stützung der Entwicklung einer einheitlichen Hochsprache durch die Herausgabe einerkastilischen Grammatik. Es steht auch für die schließlich mit dem Begriff der Rassekombinierte Politik der ›limpieza de sangre‹. Ihre Parole von der ›Reinheit des Blutes‹diente dazu, eine biologistisch begriffene Differenz zwischen zwei angeblich unter-schiedlichen Gruppen von Spaniern zu konstruieren. Hintergrund war die lange Ge-schichte der erzwungenen Konversion von Juden zum Christentum.
Anstatt das darin liegende Problem der »Veranderung«5 theoretisch deutlich und ana-lytisch fruchtbar zu machen, behauptet die Verfasserin, die Conversos hätten nicht erstzu anderen gemacht werden müssen. Sie wären es vielmehr immer schon gewesen, seiensie doch in einer »riesigen Anzahl« nur formal dem Christentum beigetreten, heimlichaber »ihrem alten Glauben treu« geblieben (S. 27). Tatsächlich zeigen, wie Norman Rothin einer akribischen und minutiösen Studie herausgearbeitet hat, sowohl christliche alsauch jüdische Quellen, »that the overwhelming majority of the conversos were quite sin-cere Christians«.6 Während also hätte erklärt werden müssen, warum offizielle Christenzu verkappten Juden gemacht wurden, heißt es in der vorliegenden Studie, dass »diewachsende Zahl der Conversos zu einer offenen Herausforderung für die alte Aristo-kratie« geworden und auch »in den Städten und auf dem Land […] der Unmut über diemissliebige jüdische Konkurrenz« gewachsen wäre (S. 30 f.). »Conversos« und »misslie-bige Juden« werden essenzialistisch in eins gesetzt.
4 Das gilt zumal, weil sie ebenso nachdrücklich wie prominent vorgetragen und einschlägig ver-breitet werden – vgl. u.a. Pierre L. van den Berghe, Race and Ethnicity: A SociobiologicalPerspective, in: Ellis Cashmore/James Jennings (Hrsg.), Racism. Essential Readings, London etc.2001, S. 122-128, bei dem es auf S. 124 heißt: »My central thesis is that both ethnicity and ›race‹(in the social sense) are, in fact, extensions of the idiom of kinship, and that, therefore, ethnic andrace sentiments are to be understood as an extended and attenuated form of kin selection«; CliffordGeertz, Primordial Ties, in: John Hutchinson/Anthony D. Smith (Hrsg.), Ethnicity, Oxford etc.1996, S. 40-45. Er schreibt auf S. 41 f.: »By a primordial attachment is meant one that stems fromthe ›givens‹ […] of social existence: immediate contiguity and kin connection mainly, […] con-gruities of blood, speech, custom, and so on […]. The general strength of such primordial bonds,and the types of them that are important, differ from person to person, from society to society,and from time to time. But for virtually every person, in every society, at almost all times, someattachments seem to flow more from a sense of natural […] affinity than from social interaction.«
5 Mit dieser Wortschöpfung, die ich hier versuchsweise (allerdings ohne das im Original gebrauchtemanierierte große ›A‹) verwende, versucht Julia Reuter, Ordnungen des Anderen. Zum Problemdes Eigenen in der Soziologie des Fremden, Bielefeld 2002, S. 20 u. passim, die im Englischenzwanglos benutzbare Kategorie ›othering‹ zu übersetzen; vgl. auch Jan Nederveen Pieterse, Other,in: Cashmore, S. 306 f.
6 Norman Roth, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain, Madison etc.1995, S. 115.
Mag das noch als faux pas durchgehen, so hat der Versuch Methode, gegen vielfachvorgebrachte, anders lautende Einschätzungen ohne Diskussion die Auffassung aufrechtzu halten, dass Rassismus nur in »Verbindung mit reaktionären, konservativen oderfaschistischen Doktrinen, Organisationen und Programmen« (S. 8) vorkäme. Besondersdeutlich wird das bei der Behandlung des Zusammenhangs von Aufklärung und Ras-sismus. Positionen, die ihn betonen, werden pauschal als »eindimensional« abgetan, weilsie die »gesamte Moderne« als »strukturell rassistisch« betrachten würden (S. 43). Beider Skizzierung der Haltung Immanuel Kants mündet diese Haltung in offene Ignoranzgegenüber den Quellen und der aktuellen Diskussion. Ohne dass er auch nur zitiert oderim Literaturverzeichnis erwähnt würde, heißt es: »Eine Höher- oder Minderwertigkeitvon Menschen lässt sich aus Kants Überlegungen nicht ableiten« (S. 74).7
Nun sind dessen Äußerungen tatsächlich umstritten. Die intensiv geführte Diskussionsetzt sich aber jedenfalls damit auseinander, dass Kant sehr wohl eine Abstufung derMenschen nach ihrer von ihm angenommenen Rassenzugehörigkeit vornahm. In seinerklar gegliederten Vorstellung standen Indianer auf der untersten Stufe der Menschheit,nach ihnen kamen die Afrikaner, auf die die Asiaten folgten. Nur bei der »Race derWeißen« sah er »alle Triebfedern und Talente« zu »Cultur und Civilisierung«. Ihre Mit-glieder wären die einzigen, »welche immer in Vollkommenheit fortschreiten« und so dieEntwicklung der menschlichen Kultur verbürgten, deren Erfolge »immer von denWeißen bewirkt worden« wären.8
Der Stellenwert solcher Überlegungen wird unterschiedlich eingeschätzt.9 Zur Aus-einandersetzung mit ihnen gehört deswegen auch die verstärkte Edition von Quellen im
7 Dass auch Cashmore ohne Einträge zu Enlightenment, Hume, Kant, Sömmering, Voltaire undanderen auskommt und nur unter Blumenbach auf die Stichworte ›Caucasian‹ und ›Geometry ofRace‹ verweist, ist ein unbedingt zu behebender Mangel.
8 Immanuel Kant, Menschenkunde (Die Vorlesungen des Wintersemesters 1781/82 aufgrund derNachschriften), in: Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. v. d. Berlin-Brandenb. Akad. d. Wissensch.,Bd. 25, Berlin 1997, S. 1187 f. (Race der Weißen mit Talenten, von denen immer der Fortschrittausgeht); ders., (Reflexionen zur Anthropologie), in: Kant’s gesammelte Schriften, Bd. 15, Berlinetc. 1923, S. 877 f. (alle Anlagen zur Cultur bei Weißen; deren Fortschreiten zur Vollkommen-heit).
9 Vgl. u.a. Robert Bernasconi, Who Invented the Concept of Race? Kant’s Role in the EnlightenmentConstruction of Race, in: ders. (Hrsg.), Race. Oxford 2001, S. 11-36; Robert Bernasconi, Kant asan Unfamiliar Source of Racism, in: Julie K. Ward/Tommy L. Lott (Hrsg.), Philosophers on Race.Critical Essays, Oxford etc. 2002, S. 145-166; David Bindman, Ape to Apollo. Aesthetics and theIdea of Race in the 18th Century, Ithaca etc. 2002, insb. S. 151 ff.; Emmanuel Chukwudi Eze, TheColour of Reason. The Idea of ›Race‹ in Kant’s Anthropology, in: ders. (Hrsg.), PostcolonialAfrican Philosophy, Oxford 1997, S. 103-140; Gudrun Hentges, Schattenseiten der Aufklärung. DieDarstellung von Juden und ›Wilden‹ in philosophischen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts,Schwalbach 1999, insb. S. 90 ff., 209 ff.; Wulf D. Hund, Im Schatten des Glücks. PhilosophischerRassismus bei Aristoteles und Kant, in: ders., Rassismus. Die soziale Konstruktion natürlicherUngleichheit, Münster 1999, S. 110-126; Rudolf Malter, Der Rassebegriff in Kants Anthropologie,in: Gunter Mann/Franz Dumont (Hrsg.), Die Natur des Menschen. Probleme der Physischen An-thropologie und Rassenkunde (1750-1850), Stuttgart etc. 1990, S. 113-122; Thomas A. McCarthy,On the Way to a World Republic? Kant on Race and Development, in: Lothar R. Waas (Hrsg.),Politik, Moral und Religion. Festschrift für Karl Graf Ballestrem, Berlin 2004 (i. E.); JosephPugliese, Indigeneity and the Racial Topography of Kant’s ›Analytic of the Sublime‹, in: JamesN. Brown/Patricia M. Sants (Hrsg.), Indigeneity: Construction and Re/Presentation, New York1999, S. 15-31; Tsenay Serequeberhan, Eurocentrism in Philosophy: The Case of Immanuel Kant,in: The Philosophical Forum 27, 1996, H. 4, S. 333-356; Alex Sutter, Kant und die ›Wilden‹. Zumimpliziten Rassismus in der Kantischen Geschichtsphilosophie, in: prima philosophia 2, 1989, H. 2, S. 241-265.
584 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 585
Rahmen der englischsprachigen Debatte.10 Dass ausgerechnet eine deutsche Einführungzum Thema Rassismus die gesamte Diskussion unterschlägt, ist durchaus anrüchig. Diesgilt zumal, weil solche Haltung mit einer durchgehenden Tendenz zur Vereinfachung ein-hergeht. Sie zeigt sich auch im Abschnitt über den Antisemitismus im ausgehenden19. Jahrhundert. Er beschränkt sich auf die deutsche Geschichte11 und auch zu der istdie Materiallage dürftig. Die Verfasserin behauptet, »grundlegend für die gesamte Zeit«sei »immer noch das bereits 1949 in den USA erschienene Buch von Massing« (S. 301).12
Entsprechend entschlossen lehnt sie sich daran an. Massing etwa erklärt: »Einer derersten Wortführer der Unzufriedenheit war Wilhelm Marr […], der zu Beginn der Wirt-schaftskrise eine Broschüre unter dem Titel veröffentlichte: ›Der Sieg des Judenthumsüber das Germanenthum […]‹« und fügt hinzu: »Marr lehnt es ausdrücklich ab, diejüdische Religion anzugreifen.« Priester schreibt: »Einer der namhaftesten Wortführerdieser Unzufriedenen war Wilhelm Marr […]. Zu Beginn der Wirtschaftskrise ver-öffentlichte Marr eine Broschüre unter dem Titel ›Der Sieg des Judenthums über dasGermanenthum […]‹« und fügt hinzu: »Marr lehnt es ausdrücklich ab, die jüdische Reli-gion anzugreifen« (S. 148). Wichtiger als die textlichen Ähnlichkeiten ist dabei allerdings,dass es bei Massing anschließend heißt, Marr hätte bereits »[z]ehn Jahre vorher […] seineerste antisemitische Schrift veröffentlicht, den ›Judenspiegel‹«. Davon findet sich beiPriester kein Wort. Der Grund dafür ist einfach. Marr hat mit dem Beginn seiner Lauf-bahn als Antisemit nicht bis zum »Beginn der Wirtschaftskrise« gewartet. Die Autorinaber will darauf hinaus, »dass bei der Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland
10 Vgl. Immanuel Kant, Of the Different Human Races, in: Robert Bernasconi/Tommy L. Lott(Hrsg.), The Idea of Race, Indianapolis 2000, S. 8-22; Robert Bernasconi On the Use of Teleolo-gical Principles in Philosophy, in: Bernasconi, Race, S. 37-56; ders. (Hrsg.), Concepts of Race inthe Eighteenth Century, 8 Bde., Bristol etc. 2001: Bd. 3 enthält u.a. Immanuel Kants, »Von denverschiedenen Racen der Menschen«, »Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace« und »Überden Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie«, Bd. 7 enthält Christoph Girtanners,»Über das Kantische Prinzip für die Naturgeschichte. Ein Versuch, diese Wissenschaft philoso-phisch zu behandeln«. Dieser Beitrag ist deshalb von Bedeutung, weil er von Kant zustimmendgewürdigt worden ist: Girtanner hätte das Thema Rasse nach Kants »Grundsätzen« »schön undgründlich« behandelt. Vgl. Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in: ders.,Werke in sechs Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Wiesbaden 1956-1964, Bd. 6, S. 671; vgl.auch Hans Querner, Christoph Girtanner und die Anwendung des Kantischen Prinzips in der Be-stimmung des Menschen, in: Mann/Dumont, S. 123-136.
11 Zu anderen Entwicklungen vgl. u.a. Bruce F. Panley, From Prejudice to Persecution. A Historyof Austrian Anti-Semitism, Chapel Hill 1998, insb. S. 27-72; Heinz-Dietrich Löwe, Antisemitis-mus und reaktionäre Utopie. Russischer Konservatismus im Kampf gegen den Wandel von Staatund Gesellschaft, 1890-1917, Hamburg 1978; Stephen Wilson, Ideology and Experience. Antise-mitism in France at the Time of the Dreyfus Affair, Rutherford 1982; Colin Holmes, Anti-Semi-tism in British Society 1876-1939, London 1979; Leonard Dinnerstein, Antisemitism in America,New York 1994; Albert Lee, Henry Ford and the Jews, New York 1980; Milton Shain, The Rootsof Antisemitism in South Africa, Charlottesville 1994; David G. Goodman/Masanori Miyazawa,Jews in the Japanese Mind. The History and Uses of a Cultural Stereotype, erw. Aufl., Lanham2000, insb. S. 16-75. Das Stichwort ›Anti-Semitism‹ bei Cashmore, S. 30-32, fällt entschieden zuknapp aus und müsste um theoretische, historische und politische Dimensionen erweitert werden;dabei sollte auch die Schreibweise überdacht werden – bei Tatz heißt es dazu auf S. 18: »Therewas, and is, no ›Semitism‹ to be anti. Neither hyphen nor capial S is needed for antisemitism.«
12 Vgl. Paul W. Massing, Rehearsal for Destruction, New York 1949. In der deutschen Ausgabe(Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, Frankfurt/Main 1959, S. 5) finden sich auch diedrei folgenden Zitate aus diesem Werk. Trotz aller Verdienste enthält die Arbeit, nicht zuletztverursacht durch die schwierige Forschungssituation, eine ganze Reihe von Ungenauigkeiten undist außerdem durch den Stand der Forschung vielfach überholt.
zwischen 1873 und dem Ersten Weltkrieg ein geradezu exemplarischer Zusammenhangzwischen der ökonomischen Krise und dem Aufstieg diffuser Anti-Stimmungen bestand«(S. 168).
Hinsichtlich der historischen Intensität des politischen Antisemitismus in Deutschlandwird solcher Zusammenhang in der Forschung allgemein anerkannt. Schon hinsichtlichder genauen Abläufe wird aber auf deutlich erkennbare Wellen der Bewegung hinge-wiesen, die sich nicht einfach mit ›der ökonomischen Krise‹ erklären lassen. Noch kla-rer wird die Notwendigkeit differenzierter Analyse, wenn einzelne Tendenzen innerhalbder antisemitischen Bewegung genauer betrachtet werden. Dann zeigt sich, wie OlafBlaschke in seiner gründlichen Untersuchung des katholischen Antisemitismus betonthat, dass es einerseits schon wieder wirtschaftlich aufwärts ging, als der Antisemitismusseine erste Hochphase verzeichnete, während andererseits die »Inkubationsphase […]keine Folge des Börsensturzes vom Mai 1873« war, sondern »früher« einsetzte und sichaußerdem »nicht auf eine Wirtschaftskrise, sondern auf religiöse Ängste zurückführen«lässt.13
Der Verknüpfung und Überlagerung dieser Elemente widmet sich die Untersuchungvon Massimo Ferrari Zumbini zum politischen Antisemitimus im deutschen Kaiser-reich.14 Das Buch ist nicht nur solide gebunden, sondern auch lesefreundlich umgebro-chen und setzt die umfangreichen Anmerkungen als Fußnoten. Der Klappentext ver-spricht, die »Wurzeln des Bösen« freizulegen und in der »Topographie der politischen,sozialen und kulturellen Geschichte« zu verorten. Das sind einerseits problematische undandererseits übertriebene Formulierungen – problematisch, weil der Titel und leider auchein Teil der Schlussfolgerungen (S. 677) hinter die Ergebnisse der Analyse zurückfallen,die deutlich macht, dass es nicht um das Böse, sondern um Ideologie, Interesse und Le-gitimation geht; problematisch, weil die organische Metapher aus der Rückschau einenahezu naturwüchsige Notwendigkeit der Entwicklung suggeriert, die sich jedenfallsgeschichtswissenschaftlich nicht verifizieren lässt; übertrieben, weil der umfassende An-spruch eine empfindliche Lücke umso deutlicher erkennbar werden lässt.
Obwohl darauf hingewiesen wird, dass der sozialen Frage für die Entwicklung desAntisemitismus entscheidende Bedeutung zukommt (S. 10) und obwohl der »Aufstiegder Sozialdemokratischen Partei« als »Hauptcharakteristikum der Wahlgeschichte imkaiserlichen Deutschland« (S. 565 f.) gilt, verzichtet die Arbeit auf eine eingehendereBehandlung dieser Problematik. Das ist umso unverständlicher, als andere bedeutsameEntwicklungen wie die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus im Kulturkampf unddie jüdische Migration aus Osteuropa ausführlich gewürdigt werden. Wie immer die vonZumbini entwickelte Konzeption der ›doppelten Schaltkreise‹ – das heißt der »Gleich-zeitigkeit […] differenter Leitlinien«, die sich »mittels Synergie wechselseitig potenzie-
13 Olaf Blaschke, Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 1999,S. 146. Wie Hinweise auf viele wichtige Schriften zu den einzelnen Kapiteln ihrer Arbeit fehlen inPriesters Literaturverzeichnis auch solche auf diese Studie.
14 Diese Studie hätte für Priester durchaus ›grundlegend‹ sein sollen. Da die Verfasserin ihre wis-senschaftliche Karriere mit einer umfangreichen Untersuchung zur Frühgeschichte des italie-nischen Faschismus begonnen hat, wäre von ihr die Kenntnisnahme der Originalfassung einerStudie zu erwarten gewesen, deren deutsche Ausgabe als »profunde[r] Überblick über die ›Grün-derjahre‹ des Antisemitismus« begrüßt worden ist, der »auf lange Sicht Maßstäbe in diesem Feldsetzt«. Stefan Breuer, Muster aus dem Kaiserreich. Ferrari Zumbini über die Gründerjahre desAntisemitismus, in: FAZ vom 25.8.2003; Massimo Ferrari Zumbini, Le radici del male. L’antise-mitismo in Germania: da Bismarck a Hitler, Bologna 2001; Karin Priester, Der italienischeFaschismus. Ökonomische und ideologische Grundlagen, Köln 1972.
586 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 587
ren« (S. 129) – interpretiert wird, fehlt in ihr ganz entschieden die kritische Reflexiondes Verhältnisses von sozialdemokratischer und sozialdemagogischer Politik. Dann hättesich ein Bild einander überlagernder Schaltkreise ergeben, von denen einer Pangermanis-mus und Antislawismus vermittelte und im Bild der ›Ostjuden‹ eine gefährliche äußereBedrohung entwarf (S. 461-562); ein weiterer Schaltkreis diente der Kurzschließung reli-giöser und wirtschaftlicher Konflikte und Probleme, wie sie in Kulturkampf und Wirt-schaftskrise zum Ausdruck kamen (S. 77-150); schließlich wäre als zusätzliche Differen-zierung ein Schaltkreis im Hinblick auf die sozialen Ängste und Warnungen vor Prole-tarisierung, Entchristlichung und Degeneration und die organisatorische Verselbständi-gung der Arbeiterbewegung sowie die wachsenden Erfolge der Sozialdemokratie zuuntersuchen gewesen.
Dass diese Dimension bei Zumbini nicht entfaltet wird, hängt offensichtlich mit eineranalytischen Unschärfe hinsichtlich der sozialen Bewegung zusammen. Immer wiederfinden sich Formulierungen, die einen ihr zugrunde liegenden mangelnden Differenzie-rungswillen andeuten: Marr war ein »radikaler Sozialist«, der Marx »persönlich« kannte(S. 165 f.); Dühring spielte eine »beachtliche Rolle« in der »sozialdemokratischen Bewe-gung« (S. 175); zwischen »Stoeckers Partei« und »einem Flügel der sozialdemokratischenPartei« kam es zu einer kurzfristigen »Zusammenarbeit« (S. 243); »Ahlwardts abstrusePhantasien« fanden auch in der »sozialdemokratischen Presse« Widerhall (S. 304); Marrkehrte zu »sozialistisch geprägten Positionen« zurück (S. 332); Fritsch meinte »trium-phierend«, die Sozialdemokraten würden überall »capitulieren«, wo sich die Antisemi-ten mit ihnen »aussprechen« (S. 371); Liebermann von Sonnenberg hielt die Phrase vomAntisemitismus als »Vorfrucht der Sozialdemokratie« für »erklärlich« (S. 379); Wolt-mann kam »aus der sozialdemokratischen Partei« (409); Nietzsches »Kritik am Egali-tarismus und insbesondere am Sozialismus« war »nicht zuletzt eine Auseinandersetzungmit Dühring« (S. 447). Mit solchen und ähnlichen Formulierungen finden sich Faktenund Zusammenhänge angesprochen, deren Diskussion im Kontext der sozialen Bewe-gung aber nicht stattfindet.15 Hätte Zumbini sich einer stärkeren historiografischen Dis-ziplin befleißigt, den ausufernden Abschnitt über die Lage der Juden in Osteuropa mehrauf seine Fragestellung bezogen, entsprechend gestrafft und auf seine die Zeit der Wei-marer Republik und des Nationalsozialismus nur kursorisch behandelnden Überlegun-gen verzichtet, wäre dafür Platz und Zeit geblieben.
Der Kernbereich der Untersuchung ist als sozialgeschichtlich unterlegte Studie zuIdeologie und Organisation des politischen Antisemitismus im deutschen Kaiserreichdennoch bedeutsam. Das liegt nicht zuletzt an ihrem umfangreichen Kapitel zum »Grals-hüter des Antisemitismus« (Thomas Nipperdey) und »Ahnen des Nationalsozialismus«(Hans-Ulrich Wehler), Theodor Fritsch, einer »Schlüsselfigur des völkischen Lagers«(Stefan Breuer) und »Galionsfigur des rassisch begründeten Antisemitismus« (UwePuschner), die in der Forschung bislang eher unterbelichtet geblieben ist (Zumbini,
15 Die Linie, die etwa Mosse von Proudhon und Toussenel über Drumont bis Schönerer undDühring zieht, ist weder gerade noch durchgängig. Überdies sind mehrere ihrer Abschnitte nurunzureichend oder tendenziös untersucht. Vgl. Mosse, S. 185-203; Edmund Silberner, Sozialistenzur Judenfrage. Ein Beitrag zur Geschichte des Sozialismus vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1914, Berlin 1962 und ders., Kommunisten zur Judenfrage. Zur Geschichte von Theorie undPraxis des Kommunismus, Opladen 1983; vgl. ferner u.a. Micha Brumlik (Hrsg.), Der Antisemi-tismus und die Linke, Frankfurt/Main 1991; Jack Lester Jacobs, On Socialists and ›the JewishQuestion‹ after Marx, New York 1992; Rosemarie Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie und Anti-semitismus im Kaiserreich. Die Auseinandersetzung der Partei mit den konservativen und völ-kischen Strömungen des Antisemitismus 1871-1914, Bonn 1978; Enzo Traverso, Les Marxistes etla Question juive, Montreuil 1990; Robert S. Wistrich, Socialism and the Jews. The Dilemmas ofAssimilation in Germany and Austria-Hungary, Rutherford 1982.
S. 321-422). Fritschs aggressive, geschäftige, vielschichtige und weitreichende antisemiti-sche Aktivitäten werden gründlich dokumentiert, die Grundzüge seiner antisemitischenIdeologie, die er als parteiübergreifende »Weltanschauung« propagierte, herausgearbei-tet. Im Ausblick wird auch sein Wirken in der Weimarer Republik verfolgt – von derIntegration seines Reichshammerbundes in den Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bund über seine Beteiligung an der Mordhetze gegen jüdische Politiker, seine Tätigkeitin der Deutschvölkischen Freiheitspartei und Wahl in den Reichtag im Frühjahr 1924,seine Hinwendung zum Nationalsozialismus und Unterstützung Hitlers bis zu seinerWürdigung als antisemitischer Vordenker nach seinem Tod 1933 (S. 619-628).
Ausführlich und gründlich beschäftigt sich die Studie von Cornelia Hecht mit der Ent-wicklung des Antisemitismus jener Zeit. Das Buch ist nicht nur handfest gebunden undübersichtlich mit Fußnoten layoutet, es verspricht auch auf dem Umschlag nicht mehr,als sein Inhalt einlöst. Untersucht werden die Auswirkungen der »Zunahme des gesell-schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Antisemitismus« auf »das Alltagslebendeutscher Juden«, deren »Umgang« mit dieser Entwicklung und die »in der deutsch-jü-dischen Presse« geführte »kontroverse Diskussion darüber, wie der Antisemitismus zubewerten und wie ihm entgegenzutreten sei« (Klappentext). Obwohl Cornelia Hecht ihreFragestellung nicht auf die Diskussion im Rahmen der Rassismusanalyse bezieht, liefertsie doch Antworten auf einige ihrer Probleme.
Dabei wird zunächst deutlich, dass Ausprägung, Erfahrung und Interpretation desRassismus Tradition und Wandel vielfach verschränken. So befürchteten zwar deutscheJuden schon vor der Novemberrevolution einen »Krieg nach dem Krieg« (S. 66), wur-den von dessen ideologischer Aggressivität und politisierter Gewaltbereitschaft abertrotzdem überrascht. Die intensive Verknüpfung alter antisemitischer Stereotype mitneuen »Legenden von den ›jüdischen Kriegsgewinnlern‹, den ›jüdischen Drückebergern‹,dem ›jüdischen Dolchstoß‹, der ›Judenrevolution‹ und der ›Judenrepublik‹« (S. 68) be-dingte in Verbindung mit dem breiten Spektrum »antisemitisch motivierter Gewalt«, dasvon Pöbeleien über Körperverletzung, Pogrome und Anschläge bis zum Mord reichte(S. 99), dass bei ihrer Erklärung häufig auf das Mittelalter zurückgegriffen und damitbekundet wurde, »wie unfassbar der Ausbruch einer solchen antisemitischen Sturmflut«(S. 107) vielen der Betroffenen war.
Dabei zeigt sich weiter, dass Rassismus zusammen mit unterschiedlichen politischenOptionen auftritt, deren Grenzen und Konfliktlinien aber regelmäßig überwindet undideologisch und sozial weiträumige und übergreifende Muster der Ausgrenzung schafft.In der Weimarer Republik wurde das sichtbar an der »Allgegenwart des Antisemitis-mus« auf der Straße wie im Café oder in der Eisenbahn, in Vereinen und Schulen, amArbeitsplatz wie im Urlaub (S. 119), die bei denen, die diesem Klima ausgesetzt waren,schon früh das Gefühl auslösten, »die Aussätzigen des Volkes« (S. 270) zu sein.
Dabei kommt ferner auch zur Sprache, dass die Verbindung von Diskriminierung undKrise zur Erklärung des Rassismus nicht ausreicht. Die Untersuchung bestätigt vielmehrden Befund, es könne »[m]itnichten […] behauptet werden, der Antisemitismus sei in denJahren der relativen Stabilität […] ›weniger‹ vorhanden gewesen als […] zuvor«.16 Auchdie »deutsch-jüdische Presse vermittelte zwischen 1924 und 1929 keinesfalls den Ein-druck, als habe der Antisemitismus abgenommen« (S. 205).
Dabei fällt schließlich auch Licht auf Rassismus als soziales Verhältnis, eine jenerDimensionen, die in seiner Analyse häufig unterbelichtet bleiben. Rassismus aggregiertund bildet aus durch vielfältige Muster sozial differenzierten Menschen einheitliche
16 Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Repu-blik, Bonn 1999, S. 184.
588 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 589
Gruppen.17 Diese sind aber nach Lage, Einstellung, Herkunft, Rollen und Kultur kom-plex gegliedert und ihre zwangsvergemeinschafteten Mitglieder haben höchst verschie-dene Motive und handeln entsprechend unterschiedlich. Für die Juden in Deutschlandkam hinzu, dass der traditionelle Antisemitismus bis zur Emanzipation »ein ethnozen-trisches Abstammungsbewusstsein« (S. 30) unter ihnen erzeugt hatte. Weil der folgendeAkkulturationsprozess mit einer starken sozialen Mobilität verbunden war, reagiertensie anschließend sehr unterschiedlich auf die stereotypen Diffamierungen des modernenRassenantisemitismus. Angesichts der historischen Erfahrungen und unter Verwendungzeitgenössischer Interpretationsmuster konnten sie zu der Auffassung gelangen, dass eseine »objektive Judenfrage« gäbe und sich mit »Deutschen« und »Juden« zwei »Völker«gegenüberstünden. Sie griffen aber auch zu einer »Art von Gegenstigmatisierung«, in-dem sie ihre soziale Position zum Maßstab für das unzivilisierte und pöbelhafte Ver-halten der radikalen Antisemiten machten, deren Ideologie so einer niedrigen Klassen-lage zuordneten und auf diese Weise sozial entschärften, als »Massenwahnsinn« dem»Mob« zuschrieben (S. 44 f., 116 f.) und wie Arnold Zweig als »komische Ideologie«oder Leo Löwenthal als »›Kaffern‹-Antisemitismus« (S. 93, 330) abtaten. Das wiederumerschien deswegen möglich, weil der Antisemitismus unterschiedlich repräsentiert wurdeund dabei auch verschiedene Ziele angab. Bei nationalkonservativen Juden führte dasbis zu einem »jüdische[n] Antisemitismus«, dem eine Reihe von Vorurteilen als »ange-messene Kritik« (S. 363) galt. In den Reihen des liberalen jüdischen Bürgertums konn-ten daraus Diskussion darüber entstehen, ob gewaltsame Ausschreitungen als »Juden-pogrom« oder als »Ostjudenpogrom« (S. 179 ff.) gewertet werden müssten. Hinzu kam,dass viele liberale Juden das Problem ignorierten und darin durch die von ihnen gelese-nen Tageszeitungen noch bestärkt wurden, die ein sehr viel moderateres Bild der Lagezeichneten als die deutsch-jüdische Presse (S. 391). Auch sie wollten im Übrigen mitlinksorientierten Intellektuellen möglichst wenig und mit sozialdemokratisch oder garkommunistisch orientierten Politikern überhaupt nichts zu tun haben. Zur ErmordungWalther Rathenaus findet sich so in den Quellen Material für ein umfangreiches Kapi-tel, die Ermordung Rosa Luxemburgs hat anscheinend kaum Spuren in der untersuch-ten Presse hinterlassen und wird nur zweimal kurz erwähnt (S. 138-162).
Spätestens hier wird deutlich, dass methodische Eitelkeiten bei der Analyse des Rassis-mus unangebracht sind. Er hat strukturelle, ideologische und diskursive Dimensionen.18
17 Das gilt selbst dort, wo Angehörige unterschiedlicher Völker im Rahmen der modernen Plan-tagensklaverei in eine einheitliche materielle Lage gezwungen werden. Zwar wurde ihnen der vonden Europäern entwickelte Gegensatz von Schwarz und Weiß schmerzhaft aufgeherrscht: »Onboard a slave ship with the slaves always black and the crew largely white, skin colour tended todefine ethnicity.« David Eltis, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge etc. 2000,S. 226. Doch bewahrten sie trotzdem ihre tradierten kulturellen Muster und Identitäten, die nichtselten nach gemeinsamen Aktionen gegen ihre Ausbeuter zu Gegensätzen und Trennungen führ-ten: »The idea of national identity was sufficiently strong among slaves in rural America that iteven affected them when they decided to rebel or run away. […] Runaways often segregated theircommunities by nations.« John Thornton, Africa and Africans in the Making of the AtlanticWorld, 1400-1800, 2. Aufl., Cambridge etc. 1998, S. 201.
18 Hinweise dazu gibt es bei Cashmore, S. 331-355, gleich in einer ganzen Reihe von Stichworten:Michael Banton, Race: As Classification; Ellis Cashmore, Race: As Signifier; Pierre L. van denBerghe, Race: As Synonym; Julia S. Jordan-Zachery, Race Card; Barry Troyna, Race Relations:As Activity; Robert Miles, Race Relations: As Construction; Sarita Malik, Racial Coding; EllisCashmore, Racial Discrimination; Amy I. Kornblau, Racial Profiling; Robert Miles, Racialization;Michael Banton, Racism; Teun A. van Dijk, Racist Discourse; siehe dort außerdem von EllisCashmore die Beiträge Cultural Racism, S. 96-98, Institutional Racism, S. 204-206, InferentialRacism, S. 203 f., Reverse Racism, S. 373; Joe R. Feagin/Leslie A. Houts, Systematic Racism,S. 416-418; Peter Radcliffe, Environmental Racism, S. 126 f.
Seine historischen Ausprägungen müssen deswegen entsprechend komplex untersuchtwerden. Die Studien von Brigitte Fuchs und Sarah Jansen setzen dabei vor allem aufdas diskursive Element. Während das Stichwort ›Foucault‹ bei Hecht fehlt, Zumbini ihmnur eine Fußnote widmet und Priester es nur einmal als Warnung benutzt, signalisiertes bei Fuchs und Jansen eine analytische Perspektive. Dabei stellt sich das Verhältnisvon Einschreibung und Dekonstruktion zunächst äußerlich eher fragil dar. Die Rückender beiden nicht eben preisgünstigen Paperbacks aus dem Campus Verlag sind schon beider ersten Durchsicht mehrfach gebrochen. Doch hat ihr Inhalt die schlechte Ver-packung nicht verdient. Sie enthalten detaillierte und komplexe Untersuchungen. Aller-dings geht Fuchs häufig zu atemlos und pointillistisch mit dem Material um und Jan-sen überdeterminiert es und bürdet ihm zu große Beweislasten auf.
Die von Brigitte Fuchs auf dem Umschlag ihrer Arbeit gegebenen Versprechungenstimmen nicht völlig überein. Zum Titel »›Rasse‹, ›Volk‹, Geschlecht« heißt es im Klap-pentext, die Autorin »untersuch[e] die Überschneidungen von Diskursen über sozialeKlasse, ›Rasse‹ und Weiblichkeit«. Zwischen Untertitel und Titelbild bestehen nochgrößere Diskrepanzen. Der geografisch-politische Kontext Österreichs wird durch einefranzösische Karikatur illustriert, auf der englische Menschen eine afrikanische Frau be-trachten. Nach einem Hinweis auf Sujet und Herkunft des Bildes sucht man im Buchvergebens. Auch dort, wo es die dargestellte Szene inhaltlich behandelt, fehlt jeder Be-zug zu ihrer Abbildung. Dafür erfährt man, dass Saartje Baartman, die »jahrelang inLondon und Paris als ›Hottentottenvenus‹ ausgestellt« und dabei »wie ein wildes Tieran einer Kette aus einem Käfig geführt« wurde, 1815 in Paris starb, woraufhin ihr Leich-nam wissenschaftlich verwertet und ihre Genitalien präpariert wurden (S. 76 f.).
Die Autorin, die im Verlauf ihrer Arbeit immer wieder auf ausgewählte und oft knappgehaltene Sekundärliteratur zurückgreift, stützt sich in diesem Fall zwar auf umfangrei-chere Literatur.19 Trotzdem wird auch hier ein eher einseitiges Bild des zur Diskussionstehenden Sachverhalts vermittelt. Zunächst sollen »weibliche Genitalien als Anschau-ungsobjekte ›wilder Sinnlichkeit‹« (S. 77) gedient haben. Später wäre »in der ›Anthro-pologie der Frau‹ die sexualisierte ›wilde Frau‹ zur ›Frau‹ universalisiert« (S. 173) unddie »angeblich längere Klitoris von Afrikanerinnen […] zum verallgemeinerten Zeicheneiner pathologisierten weiblichen Sexualität« (S. 174) gemacht worden. An diesem Bildhätte auch Cesare Lombroso mitgearbeitet. Die mit seiner Hilfe erfolgte »Zuschreibung«wäre auf »alle Frauen« übertragen worden, »deren Sexualität als Abweichung von derNorm sexueller Passivität betrachtet wurde« (S. 174). Tatsächlich lässt sich Lombrosoaber ausführlich darüber aus, dass die »sexuelle Sensibilität« der Frau geringer als diedes Mannes wäre, dass auch bei »niederen Völkerrassen« Mühe, Technik und Zeit auf-gewandt werden müssten, »um die Geschlechtslust des Weibes zu reizen«, dass die »grös-sere sexuelle Kälte und Passivität […] dem weiblichen Geschlecht innerhalb des ganzenThierreichs gemeinsam« wäre, dass schließlich die Prostitution den »Beweis für die
19 Vgl. Yvette Abrahams, Images of Sarah Bartman. Sexuality, Race, and Gender in Early Nine-teenth Century Britain, in: Ruth Roach Pierson/Nupur Chaudhuri (Hrsg.), Nation, Empire, Co-lony. Historicizing Gender and Race, Bloomington 1998, S. 220-236; Sander Gilman, Hottentot-tin und Prostituierte. Zu einer Ikonographie der sexualisierten Frau, in: ders., Rasse, Sexualitätund Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur, Reinbek 1992, S. 119-154; Ste-phen Jay Gould, Die Venus der Hottentotten, in: ders., Das Lächeln des Flamingos. Betrachtun-gen zur Naturgeschichte, Frankfurt/Main 1995, S. 229-240; Londa Schiebinger, Nature’s Body.Gender in the Making of Modern Science, Boston 1993; vgl. auch Ellis Cashmore, Hottentot Ve-nus und Zine Magubane, Sexuality, beide in: Cashmore, S. 185 f. u. S. 397-400, und als mate-rialreiche Übersicht Zoe S. Strother, Display of the Body Hottentot, in: Bernth Lindfors (Hrsg.),Africans on Stage. Studies in Ethnological Show Business, Bloomington 1999, S. 1-61.
590 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 591
geschlechtliche Gleichgültigkeit des Weibes und für das grössere sexuelle Bedürfnis desMannes« lieferte, weil »es nur eine Prostitution im Dienste des männlichen Geschlech-tes giebt, während für das weibliche Geschlecht nichts entsprechendes existirt; hier fehltwegen mangelnder Nachfrage das Angebot«.20
Die Unklarheiten der Aufmachung und der Argumentation finden sich im Aufbau dervorliegenden Studie wieder. Ihre zeitliche Begrenzung wird weder erläutert noch einge-halten noch ausgefüllt. Die Zeit nach 1945 ist in einem Epilog zusammengefasst, der aufknapp fünf Seiten bis zur Schließung des Rassensaals im Wiener Naturhistorischen Mu-seums 1996 reicht (S. 313 ff.). Dafür kommt erst mit der Wiener Weltausstellung von1873 die Sprache auf Österreich (S. 125 ff.). Auf den Seiten davor pendelt der Text imBemühen, »die Überschneidungen und Überkreuzungen von rassistischen und sexisti-schen Diskursen« (S. 16) zu verdeutlichen, zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundertund zwischen Europa, Afrika und Amerika hin und her. Zwar legt das die theoretischeExposition des Themas als historische Herleitung an. Angesichts der Materialfülle undder Präsentation der ausgewählten Fakten in sehr kurzen Abschnitten mit wechselndenPerspektiven entsteht dabei aber häufig eine eher atemlose Beweisführung.
Allerdings werden – von George Buffons Überzeugung, Afrikaner wären schwarzgeworden, weil sich ihre lüsternen Frauen mit Affen gepaart hätten, bis zu Gustave LeBons Bonmot, europäische Männer müssten, wenn sie Primitive studieren wollten, nichtbis nach Afrika reisen, sondern lediglich einmal in die Küche zu ihren Frauen gehen (S. 50, 114) und von Barthold Georg Niebuhrs aparter These, schon im alten Rom wärenPlebejer und Patrizier verschiedene Völker gewesen bis zu Ludwig Gumplowicz’ Inter-pretation der Klassengegensätze als ›Rassenkampf‹ (S. 64, 130) – nicht nur eine Reihevon Indizien ausgebreitet, die den im Klappentext formulierten Hinweis auf die Über-schneidungen der Kategorien Rasse, Klasse und Geschlecht als Hypothese plausibel ma-chen.21 Sie werden auch zu den beiden rassistischen Phantasmagorien der Mischung undder Reinheit verdichtet, deren unterschiedliche Ausprägungen und konfliktreiche Bezie-hungen die Autorin in zwei umfangreichen Abschnitten am Beispiel der anthropologi-schen Diskussion in Österreich untersucht und damit einen wichtigen Beitrag zu eineraktuellen Debatte leistet.
›Mischung‹ und ›Entmischung‹ liefern die Stichworte für zwei voneinander abgesetztePhasen mit einer stärker nach außen gerichteten kolonialen und einer mehr nach innengerichteten eugenischen Orientierung. Die erste wird von der einzigen österreichischenWeltumseglung zwischen 1857 und 1859 und von der österreichischen anthropologischenExpedition nach ›Deutsch-Südwest‹ 1907 bestimmt, ist charakterisiert durch das kolo-niale Ambiente der Weltausstellungen und mündet in die Entstehung einer WienerSchule der kulturhistorischen Völkerkunde (S. 125-220). Die zweite erstreckt sich zwi-schen den Weltkriegen, wird durch zahlreiche Versuche gekennzeichnet, Österreich ras-
20 Cesare Lombroso/Guglielmo Ferrero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte. Anthropolo-gische Studien, gegründet auf eine Darstellung der Biologie und Psychologie des normalen Wei-bes, Hamburg 1894, S. 54 ff. Auf Gilmans problematischen Umgang mit diesem Text und dieweitreichenden Folgen für dessen Rezeption verweisen Zine Magubane, Which Bodies Matter?Feminism, Poststructuralism, Race, and the Curious Theoretical Odyssey of the ›HottentotVenus‹, in: Gender and Society 15, 2001, H. 6, S. 816-834 und Sabine Ritter, Weibliche Devianzim Fin de Siècle. Die Konstruktion der ›donna delinquente‹, Hamburg 2004 (Masch. Diplomar-beit, Kriminologie).
21 Zwar betont Pieterse, Other, in: Cashmore, S. 307, dass »[c]ultural and postcolonial studies nowexamine how others are represented. The main axis of difference is the Big Three of race, class,and gender. Representations of racial (ethnic, national) others often overlap with those of womenand lower-class people.« Trotzdem enthält die Enzyklopädie keine Einträge zu ›Class‹ und ›Gen-der‹.
senwissenschaftlich an den arischen Mythos anzuschließen und ihm eine ›nordische‹Grundlage zu geben, von der aus rassenhygienische Forderungen vorgetragen und Ver-bindungen zur nationalsozialistischen Rassenideologie hergestellt werden konnten(S. 223-313). Aus der ehedem positiv gewürdigten ›Völkermischung‹ der Doppelmonar-chie (S. 152 ff.) wurde schließlich eine auf ›Reinheit‹ zielende Argumentation und Poli-tik der ›Entmischung‹ und ›Aufartung‹ (S. 235 ff., 286 ff.). Die dabei formulierten unter-schiedlichen Positionen teilten gemeinsame Muster der rassistischen Diskriminierung,des Antifeminismus und des Antisemitismus. Die von den Weltumseglern gesammeltenDaten wurden von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in 21 Bänden her-ausgegeben und bildeten eine Art »Ursprungserzählung österreichischer wissenschaft-licher Forschung« (S. 139). Sie dienten unter anderem zur vergleichenden Differenzie-rung anthropologischer Beschreibungen und Messungen, wobei man Juden als eigeneRasse beschrieb und Frauen eine insgesamt niedrige Schädelhöhe bescheinigte (S. 142,144), europäische sich aber von afrikanischen Frauen durch halbkugelige gegenübereuterähnlichen Brüsten unterscheiden sollten (S. 172). Die Eugeniker vermittelten dietradierten Stereotype mit ihren Züchtungsphantasien und diskutierten ausgiebig die »dif-ferentiellen Fortpflanzungsquoten von ›minderen‹ und ›wertvollen‹ Frauen und ›Men-schenrassen‹« (S. 200).
Die Untersuchung von Brigitte Fuchs ermittelt so in einem konkreten Fall stichhal-tige Beweise für die in der Rassismusdiskussion schon länger formulierte Hypothese,dass in der rassistischen Nomenklatur die »lower races represented the ›female‹ type ofthe human species, and females the ›lower race‹ of gender«.22 Bei Karin Priester findetdagegen keine Auseinandersetzung mit den Debatten über Beziehungen und Vermitt-lungen zwischen unterschiedlichen Kategorien der Einschließung und Ausschließungstatt. Zwar erwähnt sie die Figuren der ›schwarzen Venus‹ und der ›rassigen Jüdin‹(Priester, S. 130, 158) und spricht ›koloniale Rassenmischung‹ und eugenische ›Rein-haltung der Rasse‹ an (S. 106, 237). Doch bleiben das bloße Beschreibungen, die nichtanalytisch aufgenommen werden. Am markantesten zeigt sich das am Beispiel Otto Wei-ningers. Während Brigitte Fuchs nachdrücklich auf dessen Vermittlung von Sexismus,Antisemitismus und Rassismus hinweist (Fuchs, S. 183 f.), schweigt sich Karin Priesterdazu aus und führt Weininger lediglich als Beispiel für jüdischen Selbsthass auf (Pries-ter, S. 193 f.).23 Ähnlich deskriptiv verfährt sie mit den vielfältigen rassistischen Bedro-hungsszenarien der Schädigung. Die Vorstellung vom durch »Bazillen, Schmarotzer undParasiten« bedrohten »Volkskörper« wird zwar erwähnt (S. 235), im Hinblick auf ihreLogik aber nicht weiter untersucht. Hiermit befasst sich indessen eine andere Neuer-scheinung.
Sarah Jansens Studie über Schädlinge »rekonstruiert« laut Klappentext »die Herstel-lung eines wissenschaftlichen Gegenstandes und die damit verbundenen Institutionenund Praktiken. Am historischen Fall der angewandten Entomologie, der Wissenschaft
22 Nancy Leys Stepan, Race and Gender: The Role of Analogy in Science, in: Isis 77, 1986, S. 261-277, hier: S. 264.
23 Eingedenk ihrer Methode karger Nachweise verzichtet Priester auf jede Annotation zum Begriffdes jüdischen Selbsthasses. Vgl. Theodor Lessing, Der jüdische Selbsthass, München 1984 (zuerst1930) und Sander L. Gilman, Jüdischer Selbsthaß. Antisemitismus und die verborgene Spracheder Juden, Frankfurt/Main 1993; zu Weininger vgl. Lessing, S. 80-100; Gilman, Jüdischer Selbst-haß, S. 153-159 u. passim; Nancy A. Harrowitz/Barbara Hyams (Hrsg.), Jews and Gender. Re-sponses to Otto Weininger, Philadelphia 1995; David S. Luft, Eros and Inwardness in Vienna.Weininger, Musil, Doderer, Chicago 2003; Jacques Le Rider, Der Fall Otto Weininger. Wurzelndes Antisemitismus und Antifeminismus, Wien etc. 1985; Chandak Sengoopta, Otto Weininger.Sex, Science, and Self in Imperial Vienna, Chicago 2000; siehe auch Otto Weininger, Geschlechtund Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, München 1980 (Nachdruck der 1. Aufl. 1903).
592 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 593
von der Bekämpfung ›schädlicher‹ Insekten, entwickelt sie eine Theorie und Methodik,womit der ›Schädling‹ als Wirkung und nicht als Ursache der ›Schädlingsbekämpfung‹analysiert wird«. Außerdem will sie zeigen, »wie ein biologisches Fach eigenen politi-schen Einfluss gewann, indem es sich mit gesellschaftlichen Bedeutungsfeldern wie›Reinheit‹, ›Degeneration‹, ›Rasse‹ und ›Vernichtung‹ in Beziehung setzte und Praktikender chemischen Kriegsführung integrierte. Damit trägt das Buch zu zwei aktuellen Dis-kussionen bei: zur historisch-epistemologischen Analyse von Naturwissenschaften undzur Analyse der Voraussetzungen für den Holocaust« (Rückseite).
Angesichts der durch die hervorgehobenen Schlagworte markierten Bedeutung derFragestellung ist es bedauerlich, dass dieses Versprechen nur teilweise, insbesonderejedoch nicht für seine die Rassismusforschung betreffenden Dimensionen eingelöst wird.Dass die Herausbildung der Kategorie und die Konstitution des Objekts ›Schädling‹»untrennbar verknüpft« wäre mit der Entstehung »biosozialer Kollektive«, »symboli-sche[r] Kollektivkörper wie das ›Volk‹ und die ›Rasse‹, die von der Zersetzung durch an-dere, wie ›Degenerierte‹ und ›Juden‹«, »bedroht« schienen, bleibt bloße Behauptung(S. 13). Dass dabei die Vermittlung zwischen sozialen und naturalen Kollektivkörpern,deutschem Volk und deutschem Wald, Wingert oder Acker eine nachhaltige Rolle ge-spielt hätte (S. 14), wird nicht gezeigt. Dass der Kampf gegen Kartoffelkäfer, Reblausund Kiefernspinner nicht nur die »Formierung des ›Schädlings‹« bewirkt, sondern auchzur »Entstehung von Möglichkeitsbedingungen und Möglichkeitsräumen des NS-Geno-zids« geführt hätte (S. 19), kommt über die Hypothese nicht hinaus.
Das scheint nur auf den ersten Blick einen einfachen Grund zu haben. Die Verfasse-rin, die die »interdiskursive Geschichte« ihres Gegenstandes schreiben will und anderenArbeiten bescheinigt, sie hätten sich nicht »um die Verflechtung von Diskursen bei derKonstitution des ›Schädlings‹« gekümmert (S. 17 u. 358), hat sich intensiv mit Insektenund Entomologie beschäftigt. Deutlich zurückhaltender befasst sie sich mit Eugenik undHygiene. Die Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Antisemitismus ist marginal.Dass sie sich weder bei ihren Hypothesen noch bei ihren Schlussfolgerungen entspre-chend zurückhält, verweist den zweiten Blick auf das Elend der Diskursanalyse, die häu-figer weit reichende Schlüsse aus begrenzten Materialien wagt und dabei gelegentlichauch Analyse durch Intuition ersetzt. Wenn die Verfasserin in einem naiv gezeichnetenHemd den Symbolismus von »Unterwerfung, Kreuzigung und Opfer« (S. 252) sieht oderauf einer alten Fotografie, die in Seitenansicht einen Mann mit Tropenhelm zeigt, andessen Gürtel ein Futteral baumelt, in diesem »den symbolischen Körper des Phallus«(S. 246) erkennt, gehen ihre Überlegungen in den freien Fall der Assoziation über.
Dabei entwickelt die Studie im engeren Bereich ihrer Fragestellung das durchaus über-zeugende Szenario eines frappierenden Wandels von Auffassungen und Sichtweisen. Woanfangs Käfer von Bäumen geschüttelt wurden, besprühte man am Ende den Wald ausFlugzeugen. Wo zunächst Landwirtschaft und Insekten seit je zusammenzugehören undnur gelegentlich aus dem Gleichgewicht zu kommen schienen, ging man schließlich lo-gistisch gegen Eindringlinge vor. Wo ursprünglich Theorie und Praxis weit gehend ge-trennt waren, befreiten sich die mit der Erforschung und Bekämpfung der Schädlingebefassten Wissenschaftler zum Schluss von ihrem negativen Image als Kammerjäger undgründeten eine Gesellschaft für angewandte Entomologie. Deren Konstitutionsprozesslief parallel mit der Schaffung des Schädlings.
In der Analyse dieses Prozesses liegen die Stärken von Jansens Arbeit. Sie zeigt, wieaus schädlichen Insekten Schädlinge wurden. Die gehörten nicht länger in eine mehr-dimensionale und von Störungen gelegentlich aus dem Gleichgewicht gebrachte Natur,sondern galten als fremde Eindringlinge in einen ökonomisierten und bilanzierten Na-turhaushalt. Deswegen wurden sie auch nicht nur als lästig, sondern als unerträglichempfunden, so dass schon einzelne ihrer Exemplare auf die allgemeine Bedrohung hin-
deuteten, die durch die Vorstellung ihrer massenhaften Vermehrung noch gesteigertwurde und deswegen ebenso radikal wie präventiv bekämpft werden musste. Dazu wares notwendig, den ›Schädling‹ sichtbar zu machen und kontrolliert und organisiert zubekämpfen. Am Beispiel der Reblaus und des Kartoffelkäfers verdeutlicht die Autorinden unermüdlichen Einsatz der Wissenschaft, die im Verein mit staatlichen Organen undMaßnahmen Winzer dazu bringen musste, die Reblaus als Bedrohung anzuerkennen(S. 218 ff.) und die Bevölkerung davon zu überzeugen hatte, dass Kartoffelkäfer keineniedlichen Krabbeltiere, sondern eine Gefahr für das Vaterland waren (S. 230 ff.).
In diesem Zusammenhang kam der Organisation der Schädlingsbekämpfung einebedeutsame Rolle zu. Sie führte zum Aufbau eines hierarchisch geordneten Überwa-chungsnetzes, das vom lokalen Beobachter bis zur Reichsreblauskommission reichte und»ein veritables preußisches Gesamtkunstwerk« (S. 198) schuf, dessen Existenz und Funk-tion die Vorstellung vom Schädling dauerhaft machte. Dabei wurde allerdings auchdeutlich, dass unter solchen Bedingungen schon existierende soziale Praktiken fortge-schrieben und dem neuen Interpretationszusammenhang eingegliedert werden konnten.Wer gegen die »Suche nach kausalen Ursprüngen« auf die Untersuchung von »Ermög-lichungsbedingungen« setzt, sieht sich einem komplexen Gewebe aus »ursprungs- undendlosen Zeichenketten« (S. 376 f.) gegenüber, die die Autorin schon im Milieu ihrerengeren Fragestellung nicht immer verfolgt.
Der Kampf gegen die Reblaus brachte es nämlich mit sich, dass auch Mehltau undSchimmelpilze den »Maßregeln gegen Rebenschädlinge« unterworfen wurden.24 Sie fan-den sich unter einer älteren Verordnung gegen den Spätfrost subsumiert, in der es darumging, ihn »unschädlich« zu machen. Hier zeigte sich, dass die neue Semantik nicht nurfrühere Formulierungen integrierte, sondern dass diese schon Handlungszusammen-hänge umschrieben hatten, auf die bei der Bekämpfung neuer Bedrohungen aufgebautwerden konnte. Man musste sich nämlich technisch, moralisch und organisatorisch aufdie Abwehr des Spätfrostes vorbereiten. Ein »gutes« und »dauerhaftes« Thermometerwar zu beschaffen, seine Verwahrung und sein Gebrauch konnte nur einem »patriotisch«eingestellten Bürger überantwortet werden, für den Ernstfall mussten Feuerstellen in denWeinbergen vorbereitet sein, ein Benachrichtigungssystem unter Einbeziehung vonNachtwächtern und Glöcknern hatte zu bestehen und eine über individuelle Interessenhinausreichende Verpflichtung war anzuerkennen: die Wärmeerzeugung gegen den Spät-frost galt als »gemeinschaftliche« Aufgabe, die jeder auf dem ihm zugewiesenen »Pos-ten« erfüllen sollte.
Noch ehe die Reblaus auch nur einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hatte, gingendie Winzer schon gegen vergleichbare Bedrohungen mit ebenso vergleichbaren Mittelnvor. Sie bereiteten sich prophylaktisch auf die Bekämpfung und Sichtbarmachung desFrosts vor, indem sie im Frühjahr Feuerhaufen um ihre Weinberge aufschichteten. Ausihrer Mitte wurde ein Sachverständiger bestimmt, der die Gefahr einem ihm anvertrau-ten Instrument ablesen konnte. Alsdann wurde sie sogar hörbar gemacht, wenn Horn-signale, Glockengeläut und Böllerschüsse die zuvor eingeteilten Feueranzünder alar-mierten. Die Feuer selbst waren dann wieder Zeichen für andere Gemeinden, die amt-lich angehalten waren, auf ihren Anblick hin sofort selbst tätig zu werden, auch wennihr eigener Frostbeobachter noch nicht dazu aufgerufen haben sollte.
So wenig die Techniken seiner Bekämpfung den Frost zum ›Schädling‹ machten, sowenig änderte sich nach der Durchsetzung der ›Schädlingsbekämpfung‹ an der seman-
24 Vgl. Maßregeln gegen Rebschädlinge mit Ausnahme der Reblaus, in: [Julius] Moritz, Maßregelnzur Bekämpfung der Reblaus und anderer Rebschädlinge im Deutschen Reiche, Berlin 1902,S. 339-368; dort, S. 342-347, finden sich auch die Zitate zum Thema Spätfrost.
594 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 595
tischen Vielfalt zur Kennzeichnung ihrer Objekte. Ausführungen zum Wortfeld Schäd-ling wären deswegen sicher hilfreich gewesen. Eine einschlägige Arbeit über den Kar-toffelkäfer zum Beispiel bediente zunächst eine Vielzahl von Charakterisierungen, ehedie Kategorie Schädling auftauchte: er erschien als Feind, amerikanisches Schreck-gespenst, Verseuchung, Raubzeug und Pest, Seuche, Überschwemmung und Lawine,Unheil, Erzgauner, Unhold, schlimmes Tierchen, Drachen mit hundert Köpfen, Räu-ber, ägyptische Plage, ehe er Schädling genannt wurde.25 Der Aufruf zu seiner Bekämp-fung bediente nationales Pathos, wenn er die »Gefahr« beschwor, die dem »Gute derNation« durch einen »Feind« drohte, der sich »in Deutschland einnisten« wollte. Er ver-zichtete auch nicht auf antisemitische Untertöne, wenn er beschrieb, wie dieser »gleich-sam von der Wüste ins Land von Milch und Honig« gekommen wäre. Es ist deswegennicht verwunderlich, dass solcher Vergleich schließlich auch in der Rhetorik der Natio-nalsozialisten auftauchte und Joseph Goebbels 1943 im Berliner Sportpalast erklärenließ: »Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muß, so zerstörtder Jude die Staaten der Völker.«26
Auf eine Auseinandersetzung mit dem antisemitischen Wortschatz der Diskriminie-rung wird im Übrigen praktisch völlig verzichtet. 1920 forderte der Völkische Beobach-ter, das »jüdische Ungeziefer« mit »eisernem Besen auszufegen«.27 Im DeutschvölkischenSchutz- und Trutz-Bund kursierten Listen mit den Namen der »schlimmsten jüdischenSchädlinge« (Hecht, S. 141). Personale und ideologische Kontinuität des Antisemitismuszwischen Kaiserreich und Weimarer Republik vermittelte Theodor Fritsch, dessen»Lieblingsbegriff« für Juden »Ungeziefer« (Zumbini, S. 358) war. 1881 nannte ein Funk-tionär des Kartellverbandes der Katholischen Studentenverbände Deutschlands dieJuden »Ungeziefer am Leibe Deutschlands«, worauf er nur vorübergehend der Univer-sität verwiesen wurde.28 Bereits 1819 hatte der Judenspiegel behauptet: »Alles Ungezie-fer mehrt sich schnell; so auch Abrahams Saame.«29 Die Autorin, die »Ungeziefer«, so-weit ihm ökonomische Momente »eingeschrieben« sind, selbst als »Schädlinge« bezeich-net (Jansen, S. 11 f., 337), beschäftigt sich mit dieser Semantik nicht, obwohl sie schondeutlich vor Beginn ihres Untersuchungszeitraums mit der Zuschreibung von Para-sitismus und Schmarotzertum einhergeht. Rainer Erb und Werner Bergmann haben dar-auf hingewiesen, dass die Vorstellung vom Schädling schon im Antisemitismus desfrühen 19. Jahrhunderts existiert30 und in zahlreichen biologischen Metaphern enthaltenist, die der »Pflanzenwelt« wie dem »Tierreich« entnommen sind, in der Funktion des»Schmarotzers« als »Unkraut« oder »Ungeziefer« auftreten und zudem von »der un-heimlich raschen Vermehrung des ›Schädlings‹« handeln.
Eine Arbeit, die sowohl zeigen will, »daß der ›Schädling‹ die Wirkung und nicht dieUrsache der Schädlingsbekämpfung ist« (Jansen, S. 18), als auch eine Verbindung ihrerÜberlegungen zu dem »mit dem Insektizid Zyklon B begangene[n] Massenmord an als
25 Vgl. August Sander, Deutschlands Kampf mit dem Kartoffelkäfer, Mönchengladbach 1914, S. 7,11, 12, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 35, 36; die folgenden Zitate: S. 7 (Nation) u. S. 15 (Milchund Honig).
26 Zit. nach Renate Schäfer, Zur Geschichte des Wortes ›zersetzen‹, in: Zeitschrift für deutsche Wort-forschung 18, 1962, S. 40-80, Zitat: S. 74.
27 Zit. nach Walter, S. 63. 28 Vgl. Norbert Kampe, Studenten und ›Judenfrage‹ im Deutschen Kaiserreich. Die Entstehung einer
akademischen Trägerschicht des Antisemitismus, Göttingen 1988, S. 38.29 Zit. nach Nicoline Hortzitz, ›Früh-Antisemitismus‹ in Deutschland (1789-1871/72). Strukturelle
Untersuchungen zu Wortschatz, Text und Argumentation, Tübingen 1988, S. 180.30 Vgl. Rainer Erb/Werner Bergmann, Die Nachtseite der Judenemanzipation. Der Widerstand gegen
die Integration der Juden in Deutschland 1780-1860, Berlin 1989, S. 195 f.; das folgende Zitat: S. 210.
›Volksschädlingen‹ konzeptualisierten Menschen im Holocaust« (S. 24) herstellt, hättesich mit solchen Fragen befassen müssen.31 Wo »die Verflechtung von Diskursen bei derKonstitution des ›Schädlings‹« (S. 358) Gegenstand der Analyse ist, hätte auch nichtdarauf verzichtet werden dürfen, andere Phantasien und Praktiken in die Überlegungeneinzubeziehen. Die Verfasserin berücksichtigt das im Hinblick auf die Eugenik (S. 257ff.), unterlässt es im Hinblick auf den Antisemitismus und übersieht es unter anderemim Hinblick auf ökologischen Imperialismus, Sozialdarwinismus und Völkermord.
Ehe die Europäer gegen fremde Schädlinge ins Feld zogen, hatten sie die Erfahrunggemacht, was die Verbreitung der eigenen Pflanzen, Tiere und Krankheiten für die neuentdeckten Welten bedeutete. Mitte des 19. Jahrhunderts übermittelte ein Geologe ausNeuseeland Charles Darwin ein angebliches Sprichwort der Maori: »As the white man’srat has driven away the native rat, so the European fly drives away our own, and theclover kills our fern, so will the Maoris disappear before the white man himself.«32 Ihnenwird damit als Einsicht unterschoben, was die Europäer, nachdem sie sich erst einmaldamit angefreundet hatten, dass in Gottes Schöpfung nicht alles ein für allemal vor-handen ist und Lebewesen sich nicht nur entwickeln, sondern auch verschwinden kön-nen, für ausgemacht hielten. Sie rechneten wie schließlich auch Darwin damit, dass inabsehbarer Zukunft »die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Ras-sen auf der ganzen Erde ausgerottet und ersetzt haben«.33 Dass dies nicht ohne Zutunder Zivilisierten abgehen würde, gehörte zur Theorie wie zur Praxis des Umgangs mitden so genannten zum Aussterben verurteilten Primitiven. In der Mitte des 18. Jahr-hunderts hielt Lord Jeffrey Amherst gegenüber den Indianern Nordamerikas alles fürgerechtfertigt, »that can serve to extirpe this (execrable) race« und ließ sie mit pocken-verseuchten Decken und Tüchern versorgen.34 Knapp hundert Jahre später erklärteRobert Knox ›Rasse‹ zur Schlüsselkategorie, betonte die Unausweichlichkeit des ›Ras-senkampfes‹ und war überzeugt, dass die ›dunklen‹ Rassen diesen nicht überleben würden.35 Wieder ein halbes Jahrhundert später, nachdem deutsche Truppen in Südwest-
31 Die aus dem Zusammenspiel von Kriegsforschung und Vernichtungswissenschaft hervorgegan-gene Entwicklung von Zyklon ist ebenso bekannt wie seine Verwendung zur Desinfektion undEntlausung und schließlich dessen Einsatz bei der Ermordung und Vernichtung von Menschen.Bekannt ist aber auch, dass die Entwicklung dieser Mordtechniken im Rahmen des national-sozialistischen Euthanasieprogramms mit Gaskammern begann, in denen Kohlenmonoxyd ver-wendet wurde und dass Giftgas nicht nur im Ersten Weltkrieg, sondern anschließend auch inkolonialen Konflikten eingesetzt wurde. Vgl. Margit Szöllösi-Janze, Von der Mehlmotte zumHolocaust. Fritz Haber und die chemische Schädlingsbekämpfung während und nach dem Ers-ten Weltkrieg, in: Jürgen Kocka/Hans-Jürgen Puhle/Klaus Tenfelde (Hrsg.), Von der Arbeiterbe-wegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für Gerhard A. Ritter zum 65. Geburtstag, Mün-chen etc. 1994, S. 658-682; Angelika Ebbinghaus, Der Prozeß gegen Tesch & Stabenow. Von derSchädlingsbekämpfung zum Holocaust, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und21. Jahrhunderts 13, 1998, H. 2, S. 16-71; Henry Friedländer, Der Weg zum NS-Genozid. Vonder Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, S. 152 ff.; Dieter Martinetz, Der Gaskrieg 1914/18:Entwicklung, Herstellung und Einsatz chemischer Kampfstoffe. Das Zusammenwirken von mili-tärischer Führung, Wissenschaft und Industrie, Bonn 1996; Rudibert Kunz/Rolf-Dieter Müller,Giftgas gegen Abd el Krim. Deutschland, Spanien und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922-1927, Freiburg 1990.
32 Zit. nach Alfred W. Crosby, Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900, Cambridge etc. 2000 (zuerst 1986), S. 267.
33 Zit. nach Sven Lindqvist, Durch das Herz der Finsternis. Ein Afrika-Reisender auf den Spurendes europäischen Völkermords, Zürich 2002, S. 158.
34 Zit. nach Ward Churchill, A Little Matter of Genocide. Holocaust and Denial in the Americas,1492 to the Present, San Francisco 1997, S. 154.
35 Vgl. Nancy Stepan, The Idea of Race in Science. Great Britain 1800-1960, London 1982, S. 41 ff.
596 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 597
afrika gewütet und die Hereros in die Omaheke-Wüste getrieben hatten, schrieb der Chefdes Generalstabs an den Reichkanzler, »[d]er entbrannte Rassenkampf« könnte nurdurch »Vernichtung oder vollständige Knechtung« beendet werden.36
Unter den zahlreichen neueren Untersuchungen zum Thema Völkermord findet sichauch die Studie von Colin Tatz, den der Klappentext als »one of the world’s foremostscholars of genocide« vorstellt. Es trifft sich, dass er zur selben Zeit in einer anderenNeuerscheinung zu den Pionieren der vergleichenden Genozidforschung gezählt wird.37
Seine Arbeit enthält drei unterschiedlich intensive Fallstudien zu Deutschland, Austra-lien und Südafrika, die von zwei theoretischen Kapiteln eingerahmt werden und deneneine biografisch gefärbte Einleitung vorangestellt ist.38 Sie verbindet inhaltliche Über-legungen mit persönlichen Erfahrungen des Autors, die sein Plädoyer für die notwen-dige Vermittlung von Forschung und Lehre, die er selbst als Direktor des AustralianInstitute for Holocaust and Genocide Studies praktiziert, beeindruckend unterstützen.Der Verfasser betrachtet »genocide as the ultimate form of racism« und den Holocaustals »paradigm case« für die Untersuchung und das Verständnis des Genozids (S. 14, 17).Er geht von einem Rassismusbegriff aus, der auf modelltheoretische Annahmen ver-zichtet und auf historischer Konkretisierung besteht, deren Aufgabe gerade die Analysevon Unterschieden wäre: »conceptualise the differences […] between for example whatthe Athenians did to all the people of Melos in 416 BCE, what mediaeval Europe didto people who were classed as witches, and what the Turks did to 1,5 million Armeniansin 1915-16« (S. 19).
Dieser Aufzählung unterliegt offensichtlich ein weites Verständnis von ›genocide‹, dasauch Kategorien wie culturcide, democide, ethnocide, gendercide oder politicide umfasst.39
Trotzdem und obwohl ihr definitorischer Umfang als nicht ausreichend gilt, wird imVerlauf der Untersuchung mehrfach auf die Völkermordkonvention der VereintenNationen Bezug genommen, weil sie das einzige »legally valid instrument« und die ein-zige »solid (and universal) definition« (S. 11, 73) wäre. Das hat einen einfachen Grund.Tatz wendet sich vehement gegen alle Versuche, rassistische und genozidale Verbrechendurch ›denialism‹, ›Wiedergutmachung‹ oder ›reconciliation‹ vergessen zu machen, weildadurch Integrität und Würde der Opfer ein zweites Mal verletzt würden. Dagegenbetont er die Parole der Mütter der Plaza de Mayo in Argentinien: ›We cannot forget‹(S. 122-164).
36 Zit. nach Jürgen Zimmerer, Krieg, KZ und Völkermord in Südwestafrika. Der erste deutscheGenozid, in: ders./Joachim Zeller (Hrsg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonial-krieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin 2003, S. 45-63, Zitat: S. 54. Zu den Aus-einandersetzungen um Reparationen vgl. Janntje Böhlke-Itzen, Kolonialschuld und Entschädi-gung. Der deutsche Völkermord an den Herero 1904-1907, Frankfurt/Main 2004.
37 Vgl. Robert Gellately/Ben Kiernan, Investigating Genocide, in: dies. (Hrsg.), The Specter ofGenocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge etc. 2003, S. 373-380, hier: S. 375.
38 Die einzelnen Kapitel gehen überwiegend auf Vorträge und Zeitschriftenartikel zurück, die zuverschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Anlässen entstanden sind. Vgl. Tatz, S. 209 f. Dasprägt sowohl sie als auch das Gesamtwerk. So bleibt der Beitrag zu Deutschland kursorisch undoberflächlich und entspricht nicht dem Stand der Forschung, während die Studie zu Australienreich an Material und Perspektiven ist. Die Zusammenstellung der Aufsätze führt zu einer ganzenReihe von Dopplungen und Wiederholungen, die durch eine genauere Durchsicht leicht hättenvermieden werden können.
39 Vgl. Rudolph J. Rummel, Democide. Nazi Genocide and Mass Murder, New Brunswik 1992;Mary Ann Warren, Gendercide. The Implications of Sex Selection, Totowa 1985; Helen Fein,Genocide. A Sociological Perspective, London 1993; zu definitorischen Fragen siehe auch IsraelW. Charny (Hrsg.), Encyclopedia of Genocide, 2 Bde., Santa Barbara 1999. In Cashmore findensich durchweg informative Einträge von Stuart Stein zu Culturecide, S. 99 f., Ethnic Cleansing,S. 136-138, Ethnocide, S. 147 f., Genocide, S. 163-165 und Holocaust, S. 181-183.
Solche Intransigenz ist im Hinblick auf die von den Europäern entwickelte Theoriezum Aussterben verurteilter Rassen besonders angebracht.40 Das zeigt ein häufig an-geführtes Beispiel, das bis in die Gegenwart fortgeschrieben wird – »der vollständigeGenozid an den Tasmaniern«: »Zwischen 1803, als der erste Europäer seinen Fuß aufdie Insel südöstlich des australischen Kontinents setzte, und 1876, als die letzte tasma-nische Ureinwohnerin starb, wurde dieses Volk […] gezielt ausgerottet.«41 Tatsächlichhaben die Tasmanier überlebt. Vier von ihnen sind auf dem Titelbild der einschlägigenGeschichte ihres Kontakts mit den Europäern abgebildet.42 Sie haben sich, wie ElazarBarkan in seiner umfassenden Studie über die Schuld der Nationen ironisch bemerkt,»als durchaus lebendig und politisch aktiv« erwiesen.43
Mit Entstehung, Ausprägung und Umfang dieses Konzepts beschäftigt sich die wich-tige Studie von Patrick Brantlinger, der die Referenzen auf dem Umschlag bescheinigen,sie zeige »brilliantly and comprehensively how extinction discourse underwrote geno-cidal practices, supported eugenics, promoted social Darwinism, and founded modernanthropology as a science of mourning« und die zu Recht als »important, passionate,and compelling work of scholarship« bezeichnet wird. Sie verfolgt zunächst die mit derGeschichtsphilosophie der Aufklärung verbundene Herausbildung der Vorstellung zumUntergang verurteilter primitiver Rassen, die durch Naturgeschichte, Ökonomie undAnthropologie befördert wurde. Anschließend werden in Fallstudien zu Nordamerika,Südafrika, Irland, Australien und Neuseeland Ausprägungen und Anwendungen diesesKonzepts untersucht. Ferner werden seine Integration in die Evolutionstheorie und seineRückwirkungen auf das ›weiße‹ Selbstverständnis in den diversen Szenarien von Dege-neration und Untergang diskutiert.
Der Genozid an den Tasmaniern und die Diskussion über ihr Aussterben finden sichausführlich behandelt. Zur Frage, weshalb diese These so lange fortgesponnen wurde,weist der Autor darauf hin, »that the myth of the complete extinction of the Tasmanianrace has been ideologically useful«:– »it meant that the government could ignore the claims to recognition, land rights,
schools, and so forth«;– diente als Beweis dafür, »that primitive people elsewhere in the world […] were
doomed to extinction«;– entlastete das Commonwealth mit der These, die Ausrottung der Tasmanier wäre im
Vergleich zu den Taten Stalins, Hitlers oder Pol Pots nur »a small slaughter« gewe-sen;
– hielt schließlich mit der Vorstellung, »that the Tasmanians were a separate ›race‹«, dasRassenkonzept selbst am Leben (S. 129 f., 214).
Weil die Untersuchung neben politischen und wissenschaftlichen auch literarische Äuße-rungen in ihre Analyse einbezieht, macht sie die kulturelle Verbreitung der Ideologiezum Aussterben verurteilter Rassen ebenso deutlich wie die Aggressivität und Verlogen-
40 Vgl. Sven Lindqvist, Doomed Races Doctrine. in: Cashmore, S. 108-112.41 Philipp Sarasin, Zweierlei Rassismus? Die Selektion des Fremden als Problem in Michel Fou-
caults Verbindung von Biopolitik und Rassismus, in: Martin Stingelin (Hrsg.), Biopolitik undRassismus. Frankfurt/Main 2003, S. 55-79, Zitat: S. 72.
42 Vgl. Lyndall Ryan, The Aboriginal Tasmaniens, 2. Aufl., St Leonards 1996; vgl. auch John J.Cove, What the Bones Say. Tasmanian Aborigines, Science, and Domination, Ottawa 1995; zuAustralien insgesamt vgl. Russell McGregor, Imagined Destinies. Aboriginal Australians and theDoomed Race Theory, 1880-1939, Carlton South 1997.
43 Elazar Barkan, Völker klagen an. Eine neue internationale Moral, Düsseldorf 2002, S. 287. Derdeutsche Titel verballhornt den der Originalausgabe eher, als ihn zu adaptieren oder zu überset-zen: The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices, New York 2000.
598 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 599
heit, mit der der »extinction discourse« als »proleptic elegy« vorgetragen wurde ( S. 3).Die Fallstudien zeigen außerdem die Reichweite des Stereotyps der Primitivität undLebensunfähigkeit, das nicht nur auf so genannte niedere Rassen, sondern auch aufangeblich unzivilisierte europäische Völker und auf Teile der unteren Klassen angewandtwurde. Am Beispiel Irland überlagerten sich sämtliche Argumentationsmuster.44 DieIren galten als primitive Wilde. Politiker siedelten sie »on the lowest scale of humanexistence« an, Karikaturisten zeichneten sie als »missing link between the gorilla and theNegro«, Kleriker betrachteten sie als »white chimpanzees«, Literaten verschmolzen»Native Americans, Africans, and the Irish into a single category«, Ethnologen ent-warfen einen »index of (Irish) nigrecence« und Ökonomen waren der Meinung, dass »agreat part of the population should swept from the soil« (S. 98-110).
Die Vorstellung von weißen Schimpansen verweist darauf, dass rassistische Diskrimi-nierung mit einer an Hautfarben, also phänotypisch orientierten, letztlich dem Selbst-verständnis des auf der Existenz unterschiedlicher Menschenrassen bestehenden moder-nen Rassismus verpflichteten Definition nicht hinreichend erfasst wird.45 BrantlingersAuseinandersetzung mit dem irischen Beispiel macht die Verflechtung stereotyper Argu-mente der Herabminderung deutlich, die sich an Rasse, Klasse und Geschlecht orien-tieren. Neben der Vorstellung, »that the English and the Irish were separate races« unddie Iren in diesem Verhältnis durch »racial inferiority« gekennzeichnet wären, stand dieeiner »insistent feminization of Ireland« (S. 100). Außerdem war die Diskriminierungder Iren Bestandteil eines sich über Jahrhunderte hinziehenden »discourse about exter-minating the poor« (S. 98).
Zusätzlich gibt das Bild vom weißen Schimpansen Anlass, auf den historischen undsozialen Charakter der Hautfarben im Rahmen rassistischer Muster der Eingrenzungund Ausgrenzung hinzuweisen. Das gilt sowohl für die Hautfarben der durch die vommodernen Rassismus konstruierten Menschenrassen46 als auch für die äußerst unter-schiedlich gehandhabte Abschattierung dieser angeblich natürlichen Differenzen47 als
44 Vgl. Steve Garner, Racism in the Irish Experience, London etc. 2004; Hazel Waters, The GreatFamine and the Rise of Anti-Irish Racism, in: Race and Class 37, 1995, H. 1, S. 95-108; EugeneMcLaughlin, Irish, in: Cashmore, 213-215, der aus den ideologischen Beständen der »Irishphobia«einen Ausspruch des nordamerikanischen Historikers Edward A. Freeman zitiert: »This wouldbe a grand country if only every Irishman would kill a Negro and be hanged for it.«
45 George M. Fredrickson, White Supremacy. A Comparative Study in American and South Afri-can History, Oxford etc. 1981, S. 15, hat als »rationale« der neuzeitlichen britischen Irlandpoli-tik die ihr zugrunde liegende Auffassung bezeichnet, »that the Celtic Irish were savages« undhinzugefügt, dass »in the sixteenth century savagary was not yet strongly associated with pig-mentation or physical type and hence was not a ›racial‹ concept in the modern sense«. Vgl. auchTheodore W. Allen, The invention of the White Race, 2 Bde., London etc. 1994 u. 1997, Bd. 1:Racial Oppression and Social Control; Bd. 2: The Origin of Racial Oppression in Anglo-Ame-rica. Er hat gezeigt, dass dabei auf eine weit zurückreichende Tradition zurückgegriffen werdenkonnte, in deren Verlauf zwar schon 1317 das Wort ›race‹ auftaucht, die aber davon unabhängigstrukturell rassistisch war. Vgl. Allen, Bd. 1, S. 27-51 u. passim. Demgegenüber verdeutlich NoelIgnatiev, How the Irish became White, New York etc. 1995 den Prozess, in dessen Verlauf diewilden Iren, die der moderne Rassismus zunächst rassisierte und mit ›Indianern‹ und ›Negern‹verglich, in den Vereinigten Staaten schließlich die Rassenlinie überquerten und ›weiß‹ wurden.
46 Vgl. Walter Demel, Wie die Chinesen gelb wurden. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Rassen-theorien, in: HZ 255, 1992, S. 625-666; Alden T. Vaughan, From White Man to Redskin. Chang-ing Anglo-American Perceptions of the American Indian, in: AHR 87, 1982, S. 917-953; Wulf D.Hund, Die Farbe der Schwarzen. Über die Konstruktion von Menschenrassen, in: ders., Rassis-mus, S. 15-38.
47 Das eindrucksvollste Beispiel für ein komplexes Muster der Abstufung bietet das Genre der me-xikanischen Kastenbilder, deren Maler davon ausgingen, dass sich die vielfältigen Mischungenzwischen den Rassen nicht nur bezeichnen, sondern auch sichtbar machen ließen. Vgl. Magali M.
auch für juristisch, ökonomisch, kulturell und sozial indizierte gruppenspezifische undindividuelle Überschreitungen der durch solche Eigenschaften gezogenen Linien.48 Es giltschließlich auch für die Entstehung, Entwicklung, Veränderung und Verteidigung des alldiesen Operationen zugrunde liegenden Maßstabs der Weißheit.49
Der hierzu von Ashley W. Doane und Eduardo Bonilla-Silva vorgelegte Sammelbandschmückt sich mit prominentem Zuspruch. Howard Winant bezeichnet ihn als »im-mensely valuable book« und für David R. Roediger ist er von allen Anthologien zumThema »far and away the most successful at detailing how and why social structuresmatter when racial ideologies are made« (Rückseite). Unter dem Titel »WhitewashingRace. A Critical Perspectice on Whiteness« erläutert Margret L. Andersen das derartgelobte Unternehmen (in: Doane/Bonilla-Silva, S. 21-34). Nach einem kurzen Verweisauf die Ursprünge der Weißheitsforschung werden deren Verdienste genannt – sie hätteWeißsein als unsichtbare Norm in Frage gestellt, sie als System rassischer Privilegienund kultureller Hegemonie sichtbar machen helfen, das Verständnis von Rasse als so-zialer Konstruktion befördert und zur Destabilisierung weißer Identität beigetragen.Gleichzeitig wird aber angemerkt, dass »the absence of a sociological perspective leaveswhiteness studies without much grounding in the material reality of racial stratification«(S. 22). Ohne Einbeziehung staatlich vermittelter Politik und ökonomischer Strukturenstünden sie deswegen in der Gefahr, ihren kritischen Impetus zu verlieren und zur bloßenSuche nach Identität zu verkommen (S. 34).
In diesem Zusammenhang erinnert die Verfasserin nachdrücklich daran, dass der Begriff der sozialen Konstruktion in der Rassismusanalyse häufig eindimensional undgelegentlich einfach als Ersatz für den des Vorurteils verwandt wird: »Some of the whiteness literature treats race as pure illusion. But recognizing the socially constructednature of race does not mean it is ›not there‹ or that we can just think it away, such asby renunciating white privilege. Race is a social fact in the sense that Emile Durkheim[…] meant« (S. 33). Auch wenn die einzelnen Beiträge dieses Bandes keineswegs einemeinheitlichen methodischen Ansatz verpflichtet sind, richten sie doch alle ihr Augenmerkauf die Vermittlung mentaler und sozialer Strukturen. Dabei wird der hegemonialeCharakter von Weißheit deutlich. In ihrem Beitrag »Rejecting Blackness and ClaimingWhiteness: Antiblack Whiteness and the Biracial Project« setzt sich Minkah Makalanimit Versuchen auseinander, Vorstellungen einer ›biracial race‹ zu etablieren (Makalani,
Carrera, Imagining Identity in New Spain. Race, Lineage, and the Colonial Body in Portraitureand Casta Paintings, Austin 2003; Ilona Katzew, New World Orders. Casta Painting and Colo-nial Latin America, New York 1996; Gary B. Nash, The Hidden History of Mestizo America, in:Martha Hodes (Hrsg.), Sex, Love, Race. Crossing Boundaries in North American History, NewYork etc. 1999, S. 10-32.
48 Vgl. Ian F. Haney López, White by Law. The Legal Construction of Race, New York etc. 1996;Matthew Frye Jacobson, Whiteness of a Different Colour. European Immigrants and the Alchemyof Race, Cambridge/Mass. etc. 1998; Clara E. Rodríguez, Changing Race. Latinos, the Census,and the History of Ethnicity in the United States, New York etc. 2000; Pierre L. van den Berghe,Color Line, in: Cashmore, S. 87 f., spricht zwar das Phänomen des ›passing‹ an, betrachtet es aberlediglich als »a self-serving act of individual evasion« und setzt sich mit den sozialen Dimensio-nen der Farbgebung nicht weiter auseinander.
49 Vgl. Alastair Bonnett, Who Was White? The Disappearance of Non-European White Iden-tities and the Formation of European Racial Whiteness, in: Ethnic and Racial Studies 21, 1998,S. 1029-1055; Christine Clark/James O’Donnell (Hrsg.), Becoming and Unbecoming White.Owning and Disowning a Racial Identity, Westport/Conn. 1999; Michelle Fine u.a. (Hrsg.), OffWhite. Readings on Race, Power, and Society, London etc. 1996; Thomas K. Nakayama/JudithN. Martin (Hrsg.), Whiteness. The Communication of Social Identity, Thousand Oaks 1999; beiCashmore (S. 441-454) finden sich zu diesem Problemkomplex eine Reihe informativer Stichworte:John Gabriel, White Backlash Culture; Barry Troyna, White Flight; Mattias Gardell, White Power;Ellis Cashmore, White Race; Alastair Bonnett, Whiteness.
600 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 601
in: Doane/Bonilla-Silva, S. 81-94). Sie zeigt, dass sie darauf gerichtet sind, am Status desWeißseins und den damit verbundenen Privilegien teilhaben zu können und so dessenBedeutung festigen. Das hebt auch Amanda E. Lewis in »Some Are More Equal thanOthers. Lessons on Whiteness from School« hervor (Lewis, in: Doane/Bonilla-Silva,S. 159-172). Sie kommt zu dem Ergebnis, dass »whiteness« nach wie vor »as a form ofsymbolic capital« (S. 171) funktioniert. Eduardo Bonilla-Silvas abschliesßende Über-legungen zum Thema »›New Racism‹, Color-Blind Racism, and the Future of White-ness in America« werden durch zahlreiche weitere Ergebnisse der Untersuchungen die-ses Bandes gestützt (Bonilla-Silva, in: Doane/ders., S. 271-284): »whiteness« ist »embo-died racial power«; sie unterstützt »new racism practices« als »Trojan horse of whitepower«; sie erlaubt die Aufrechterhaltung eines »white habitus«; und sie deckt als»whiteness of color blindness« die Camouflage und Modernisierung des alten Jim Crow-Rassismus und die Herausbildung einer neuen »racial ideology […] that combineselements of liberalism with culturally based antiminority views to justify the contem-porary racial order« (S. 271, 275, 277, 283, 275).50
In seinem Beitrag »White Supremacy as Sociopolitical System. A Philosophical Per-spective« skizziert Charles W. Mills ebenso informativ wie überzeugend die komplexeStruktur weißer Vorherrschaft (in: Doane/Bonilla-Silva, S. 35-48). Dem Begriff der ›whitesupremacy‹ wird dabei ein theoretisches Gewicht zugeschrieben, das ihn der marxisti-schen ›Klassengesellschaft‹ und dem feministischen ›Patriarchat‹ zur Seite stellt.51 His-torisch begrenzter, reiche er zurück bis zu den Anfängen der kolonialen europäischenExpansion, dem »racial ›big bang‹ that is the source of the present racialized world«(S. 38).52 Weil er ›Rasse‹ sowohl diskursiv als auch sozialstrukturell fasse, erlaube er dieIntegration epistemologischer, somatischer, ökonomischer, kultureller, politischer undmetaphysischer Dimensionen rassistischer Diskriminierung.
Ökonomisch gesehen, müssten nicht nur die über Jahrhunderte summierten mensch-lichen Kosten weißer Dominanz bilanziert werden, durch die eine dritte Welt erzeugtund zum Beispiel in den USA weißer Reichtum aus roter Erde und schwarzer Arbeit ge-zogen worden wäre. Gefordert wird auch, die Kategorie der ›racial exploitation‹ analy-tisch auf Geschichte und Gegenwart weißer Vorherrschaft anzuwenden (S. 43 f.). Poli-tisch in den Blick genommen, wird der Kategorie ›ruling race‹ nicht nur Bedeutung fürdie Geschichte des Kolonialismus attestiert. In den USA spiele sie vielmehr trotz offizi-eller Farbenblindheit auch heute noch eine nachhaltige Rolle, wären Interessen rassi-scher Gruppen nach wie vor bedeutsam, überlagerten alle anderen Identitäten und wür-den von Weißen als Antagonismus gegenüber Schwarzen formuliert (S. 40 ff.). Kulturellgeprüft, wären die ›fantasies of the master race‹ nicht nur von historischer Bedeutung.Sie hätten auch zur Entwicklung und Verfestigung von Mustern geführt, für deren Er-fassung die Kategorie der ›white cultural hegemony‹ durchaus angemessen sei (S. 44 f.).Somatisch wahrgenommen, zeigte sich nicht nur die Markierung roter, gelber, braunerund schwarzer Körper als deviant, fremd, hässlich, komisch, primitiv und unvollkom-men. Die Auswirkungen dieser Körperpolitik rechtfertigten es auch, sie mit der Kate-gorie der ›racial alienation‹ zu diskutieren, die insofern noch weiter reichte als jene von
50 Vgl. dazu auch Eduardo Bonilla-Silva, Racism without Racists. Color Blind Racism and the Per-sistence of Racial Inequality in the United States, Boulder 2003.
51 Zum Eintrag ›White Supremacy‹ enthält Cashmore, S. 451, nur einen Verweis auf ›Neo-Nazism‹und verkürzt die Reichweite der Kategorie auf diese Weise unzulässig. Mills Aufsatz könnte fürdie nächste Auflage als Basis für ein ebenso informatives wie komplexes Stichwort dienen.
52 In diesem Zusammenhang wird auf zwei wichtige Studien verwiesen: Frank Füredi, The SilentWar. Imperialism and the Changing Perception of Race, London 1998; David Theo Goldberg, TheRacial State, Malden etc. 2002. Hinzuzufügen wäre unbedingt Howard Winant, The World is aGhetto. Race and Democracy since World War II, New York 2001.
der Entfremdung der Arbeit, weil man selbst zu Hause nicht aus seiner Haut könne(S. 46 f.). Epistemologisch betrachtet, müssten nicht nur die Traditionen und Variatio-nen rassistischer Ideologie mit ihren gegenwärtigen Ausläufern und Metamorphosenbedacht werden. Es wäre auch davon auszugehen, dass die Kategorie ›white normati-vity‹ auf einen allgemeinen Verkehrungszusammenhang hindeutete, der es schwer ma-che, die Autorität eines eurozentrischen Bildes des Menschen und der Welt in Frage zustellen (S. 45 f.). Metaphysisch ins Auge gefasst, wäre ›white supremacy‹ nicht nur als »abipolar system« zu untersuchen, »whose ontological underpinnings lift an white Herren-volk above nonwhite, particularly black, Untermenschen«. Sie sei auch dafür verant-wortlich, dass die allgemeinen Formulierungen des ›social contract‹ von Anfang an der-art konterkariert wurden, dass die ihm eingeschriebenen diskriminierenden Elemente mitder Kategorie ›racial contract‹ sinnvoll erfasst werden könnten (S. 47 f.).53
Unverkennbar von Marx und Gramsci inspiriert, fordert dieses Konzept, »race andracial dynamics« nicht als »simply reducible to a class logic« zu behandeln, sondern da-von auszugehen, »that through constructions of the self, proclaimed ideals of culturaland civic identity, decisions of the state, crystallizations of juridical standing and groupinterests, permitted violence, and the opening and blocking of economic opportunities,race becomes real and causally effective, institutionalized and materialized by whitesupremacy in social practices and felt phenomenologies« (S. 41). Mills knüpft damit un-ter anderem an Überlegungen von Michael Omi und Howard Winant an, die wie diemeisten wichtigen englischsprachigen Beiträge bislang keine deutsche Übersetzung ge-funden haben. Den Analysen, die Rasse entweder essenziell (»something fixed, concrete,and objective«) oder ideologisch (»a mere illusion«) begreifen, setzen sie ihre Über-legungen zur »racial formation« entgegen, einem »process of historically situated pro-jects in which human bodies and social structures are represented and organized«, indem soziale Strukturen mit kulturellen Repräsentationen vermittelt werden.54
Die Aktualität dieses Vorschlags zeigte sich spätestens, als auf der Weltkonferenz ge-gen Rassismus in Durban die Vertreter der europäischen Staaten einen Eklat auslösten,weil sie darauf bestanden, das Wort Rasse aus den Verlautbarungen zu streichen. Alsder Weißheit letzten Schluss folgerten sie aus der Erkenntnis, dass Rassen soziale Kon-struktionen wären, es gäbe keine und Politik könnte zukünftig ohne ihren Begriff aus-kommen.55 Sie hätten sich über die analytischen Dimensionen der rassistischen Kon-
53 Tatsächlich stellt Mills diesen Zusammenhang her, ohne den ›racial contract‹ zu erwähnen. Ichübernehme den Begriff aus Charles W. Mills, The Racial Contract, Ithaca etc. 1997, wo es vom»golden age of contract theory» heißt, »[t]he evolution of the modern version of the contract,characterized by an antipatriarchalist Enlightenment liberalism, with its proclamations of theequal rights, autonomy, and freedom of all men« wäre zusammengefallen »with the massacre,expropriation, and subjection to hereditary slavery of men at least apparently human«. Das be-deutete, dass dieser Widerspruch durch einen ›racial contract‹ vermittelt werden musste: »TheRacial Contract is the truth of the social contract«, Mills, S. 63 f.
54 Michael Omi/Howard Winant, Racial Formation in the United States. From the 1960s to the1990s, 2. Aufl., New York etc. 1994, S. 54 ff.; vgl. auch Howard Winant, Racial Conditions.Politics, Theory, Comparisons, Minneapolis etc. 1994; Michael Omi/Howard Winant, Reflectionson ›Racial Formation‹, in: Philomena Essed/David Theo Goldberg (Hrsg.), Race Critical Theories.Text and Context, Oxford 2002, S. 455-459.
55 Von den Konferenzteilnehmern aus Lateinamerika und Afrika wurde das als »infamer Schachzug«und »Schlag ins Gesicht« jener gewertet, »die unter Rassismus am meisten zu leiden hätten«. Die-ter Schindlauer, (K)eine ›rassenlose‹ Gesellschaft nach Durban?, in: Das Menschenrecht 256, 2002,H. 1, S. 6-7, Zitat: S. 6; Informationen zur World Conference against Racism, Racial Discrimina-tion, Xenophobia and Related Intolerance 2001 in Durban finden sich u.a. auf den Seiten der betei-ligten UN-Organisationen und der südafrikanischen Regierung im Internet unter den URLs:<http://www.racism.gov.za>; <http://www.un.org/WCAR>; <http://www.unhchr.ch./html/racism>[alle 21.7.2004]; vgl. auch Michael Banton, The International Politics of Race, Cambridge 2002.
602 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 603
struktion des Anderen besser informieren können. Das zeigen mehrere der informativenBeiträge in einem Sammelband über Rasse und Rassismus in der europäischen Philo-sophie. Der auch als Paperback gebundene und mit dem bei englischsprachigen Publi-kationen in der Regel üblichen umfangreichen Register ausgestattete Band verzichtet auffremdes Lob und wird als Erkundigung der »resources that Continental philosophybrings to debates about contemporary race theory« (Bernasconi/Cook, Rückseite) an-gekündigt.56 Dabei geht es unter anderem um zwei eigenwillige Lesarten Hegels durch Wil-liam Edward Burghardt Du Bois und Frantz Fanon und um einen Lernprozess Jean-PaulSartres.
Donna-Dale Marcano setzt sich in »Sartre and the Social Construction of Race« (in:Bernasconi/Cook, S. 214-226) mit der Position auseinander, »race as a category« hätte»no foundation in necessity precisely because it is entirely constructed«, einer »trap ofthinking«, der gegenüber sie »a more dialectical reading of group constitution« fordert(S. 224, 225, 214). In Sartres »Betrachtungen zur Judenfrage« sieht sie ein Modell, dasden anderen völlig von außen bestimmt und mit gegenwärtigen Vorstellungen zur Kons-truktion von Rassen vergleichbar wäre, welche die historischen und sozialen Dimensio-nen dieses Prozesses außer Acht lassen.57 Dagegen hätte er in der »Kritik der dialekti-schen Vernunft« die Konstitution sozialer Gruppen als Handlungszusammenhang be-griffen (S. 220 ff.), so dass sie nicht mehr durch den Blick der Anderen begründet wür-
56 Der dabei aufgegriffene Untertitel hätte mit seiner sprachlich allzu englischen und im Zusam-menhang der Themenstellung eben auch kolonialen und imperialen Tradition ein Augenzwinkernverdient gehabt – zumal im Vorwort darauf hingewiesen wird, dass der Band bewusst auch Arbei-ten zu in kontinentaleuropäischer Tradition stehenden Überlegungen mit einschließt und nebenEssays über Nietzsche, Heidegger, Voegelin, Arendt, Sartre und Lévi-Strauss auch Aufsätze überDu Bois, Suzanne Césaire und Fanon enthält. Deren »attention to the contextuality of racial dis-course« (Bernasconi/Cook, S. 6) wird zu Recht hervorgehoben, wenn auch von den einzelnenBeiträgern unterschiedlich verstanden. So verweist zwar David J. Levy, Ethos and Ethnos. AnIntroduction to Eric Voegelin’s Critique of European Racism, in: Bernasconi/Cook, S. 98-114,ausführlich auf die sie umgebende, von Heidegger, Plessner und Scheler geprägte Begriffswelt.Sehr viel zurückhaltender äußert er sich zu Voegelins »relatively appreciative discussion of therace theories of Ludwig Clauss and Othmar Spann« (S. 102). Zu Alfred Rosenbergs ›Mythus des20. Jahrhunderts‹ erfährt man nur, dass es sich um »intellectually shoddy stuff« (S. 101) handle,nicht aber, dass Voegelin diese »Gesamtwesensidee des nordischen Menschen«, in der »der Geist[…] nicht abhängig vom Leib, sondern Blut und Seele […] nur verschiedene Ausdrücke für dieEinheit des nordischen Menschenbildes« wären, als »erfreuliches Zeichen« gegen »die überstän-digen Reste der darwinistischen Periode in der Rassentheorie« gewertet hat. Sein Vorschlag, die»Kategorie des ›corpus mysticum‹« analytisch zu erweitern, weil die »moderne Rassenidee« eine»Leibidee neben anderen, in der abendländischen Staatengeschichte neben den Leibideen der an-tiken politischen Gemeinschaften und der Leibidee des christlichen Reiches« wäre, kann jeden-falls nicht ohne seine Kritik der Intelligenztests gelesen werden, die er nicht nur ihrer soziologi-schen Ignoranz und methodischen Fragwürdigkeit wegen zurückweist, sondern auch wegen »derAnwendung von Begabungstestes auf Neger, die ihrem Seelentypus nach auf solche Tests nichtpositiv ansprechen können« (Levy); Erich Voegelin, Rasse und Staat, Tübingen 1933, Zitate: S. 15 f.,128, 91.
57 Vgl. Jean-Paul Sartre, Betrachtungen zur Judenfrage, in: ders., Drei Essays, Frankfurt/Main etc.1965, S. 108-190. Dort heißt es auf S. 143: »Der Jude ist der Mensch, den die anderen als sol-chen betrachten.« »Der Antisemit macht den Juden.« Dagegen hat u.a. Hannah Arendt, Elementeund Ursprünge totaler Herrschaft, München etc. 1986, S. 23, eingewandt, »seit dem babyloni-schen Exil« wäre »das Zentralthema der jüdischen Geschichte immer das Überleben des Volkesin der Zerstreuung gewesen« und deshalb sollte »schon ein flüchtiger Blick auf die Geschichte«ausreichen, einen »Mythos« zu entkräften, »der unter Intellektuellen einigermaßen in Mode kam,seit Sartre den Juden ›existentialistisch‹ als jemanden bestimmte, der von anderen als Jude ange-sehen und definiert wird«.
den, sondern sich, wenn auch in von anderen herrschaftlich bestimmten Zusammen-hängen, selbst produzierten. Aus dieser Perspektive könnte Rasse als »a socially con-structed concept« und als »a lived experience« (S. 216 f.) betrachtet werden.
Es ist kein Zufall, dass in diesem Zusammenhang mehrfach von Du Bois die Rede ist,dem sich auch Ronald R. Sundstroms Überlegungen (in: Bernasconi/Cook, S. 32-52) wid-men. Sie wollen unter anderem zeigen, dass dieser Anhänger des »Western Europeanmantra of progress, modernization, and civilization« (S. 36) schon dadurch, dass er die-sem die welthistorische Mission der schwarzen Rasse einschrieb, den Essenzialismus undNaturalismus des Rassenbegriffs transzendieren musste. Weil Hegels Weltgeist Afrikaim Dunkel der Geschichtslosigkeit vergaß, gesellte ihm Du Bois einen ›schwarzen Volks-geist‹ als »co-worker in the kingdom of culture«58 hinzu und erklärte, die Botschaft der»Negro race« an die Welt stünde lediglich noch aus (S. 39). Obwohl er sich damit imRahmen der zeitgenössischen Rassenterminologie bewegte, verwarf er deren ideologi-schen Gehalt und begegnete ihm mit einer »sociohistorical conception of race«, die anden ›Negro spirit‹ appellierte und ›race organizations‹ zu seiner Entfaltung forderte (S. 42).
Kelly Oliver weist in »Alienation and Its Double; or, The Secretion of Race« (in: Ber-nasconi/Cook, S. 176-195) darauf hin, dass sich zu dem im Rahmen von Du Bois’ Ras-sismuskritik formulierten Konzept des zwiespältigen Bewusstseins bei Frantz FanonParallelen finden (S. 191 f.). Auch der habe Hegel gelesen und dabei gefunden, dass dieDialektik von Herr und Knecht für das Verhältnis von ›White Master‹ und ›Negro Slave‹nicht gelte. Es werde vielmehr geprägt »by the colonial situation in which the recogni-tion of humanity is denied to the colonized« (S. 178). Der Mangel an Anerkennung führezu einer pathologischen Situation der Abhängigkeit, die dem Kolonisierten die Arbeitder Selbsterkenntnis verweigere, der es deswegen gerade nicht wie Hegels Knecht zur»Wahrheit des selbständigen Bewußtseins« bringen könne.59 Nur insofern hieße es beiFanon: »It is the racist who creates his inferior«, »it is the white man who creates theNegro« (S. 178). Doch selbst unter den Bedingungen der von ihm diagnostizierten dop-pelten Entfremdung würde dieses Verhältnis als soziale Beziehung begriffen, in der »[t]hewhite man secretes values that force the black man to secrete a race in self-defense« (S. 184). Gerade weil sie depraviert und diskriminiert ist, bildet deren hoffnungslose Lagedoch das Glacis, von dem aus Fanon das Hegelsche Modell praktisch wendet, so dassdas Verhältnis von Herrn und Knecht nicht auf den Kampf um Leben und Tod folgt,sondern umgekehrt das Verhältnis von Kolonisator und Kolonisiertem zum Aufstandführt, weil die »Intuition der kolonisierten Massen begreift […], daß ihre Befreiung durchGewalt geschehen muß«.60
58 William Edward Burghardt Du Bois, The Souls of Black Folk, hrsg. v. Henry Louis Gates/TerriHume Oliver, New York etc. 1999, S. 11; vgl. allgemein David Levering Lewis, W. E. B. Du Bois.Biography of a Race, 1868-1919, New York 1993; ders., W. E. B. Du Bois. The Fight for Equa-lity and the American Century, 1919-1963, New York 2000; Jacqueline M. Moore/Booker T.Washington, W. E. B. Du Bois, and the Struggle for Racial Uplift, Washington 2003. Hegels Dik-tum über »Afrika« als »Kinderland, das Jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichte in dieschwarze Farbe der Nacht gehüllt ist« und vom »Neger«, dessen Charakter »nichts an dasMenschliche Anklingende« zeige, findet sich in Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen überdie Philosophie der Geschichte, in: ders., Sämtliche Werke, hrsg. v. Hermann Glockner, Bd. 11,Stuttgart 1928, S. 135, 137.
59 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. Johannes Hoffmeister, Ham-burg 1952, S. 147.
60 Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Vorwort von Jean-Paul Sartre, Frankfurt/Main 1966,S. 56; vgl. allgemein Alice Cherki, Frantz Fanon. Ein Porträt, Hamburg 2002; David Macey,
604 Forschungsberichte und Rezensionen
Archiv für Sozialgeschichte 44, 2004 605
Die Quintessenz all dieser Überlegungen ist einfach: Das theoretische Konzept derrassistischen Konstruktion des Anderen muss deren Gesellschaftlichkeit und Geschicht-lichkeit einschließen. Damit herrscht in der an ihm orientierten Rassismusdiskussionfreilich weder Einigkeit noch Klarheit. Zwar werden biologische und primordiale Vor-stellungen zurückgewiesen. Rasse und Rassismus sind weder genetische noch anthropo-logische Gegebenheiten. Doch während die hier vorgestellten Arbeiten in dieser Auffas-sung übereinstimmen, gehen sie schon bei der Frage nach dem Charakter rassistischerKonstruktionen weit auseinander. Ob Rassismus aber lediglich als Legitimationsstrate-gie (Priester) oder als komplexes soziales Verhältnis (Mills) verstanden wird, kann fürseine Analyse nicht gleichgültig sein.
Frantz Fanon. A Life, London 2000; Anthony C. Alessandrini, Frantz Fanon. Critical Perspec-tives, London etc. 1999; bei Cashmore gibt es einen informativen Artikel zu ›Fanon, Frantz‹ vonAnthony C. Alessandrini, S. 153-155; ein Stichwort zu Du Bois fehlt und müsste nachgetragen wer-den; zwar wird seine Beschreibung des ›Double Consciousness‹ im gleichnamigen Beitrag von Jo-seph Kling ausführlich gewürdigt (in: Cashmore, S. 112-117), ohne dass seine Bedeutung damitaber hinreichend erfasst wäre.