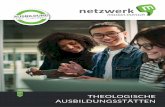Konnektivität, Netzwerk und Fluss: Perspektiven einer an den Cultural Studies orientierten Medien-...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Konnektivität, Netzwerk und Fluss: Perspektiven einer an den Cultural Studies orientierten Medien-...
1
Konnektivität, Netzwerk und Fluss: Perspektiven einer an den Cultural Studies orientierten Medien- und Kommunikati-onsforschung
Andreas Hepp
Erschienen als: Hepp, Andreas (2008): Konnektivität, Netzwerk und Fluss: Perspektiven einer an den Cultural Studies orientierten Medien- und Kommunikationsforschung. In: Hepp, Andreas/Winter, Rainer (Hrsg.): Kultur – Medien – Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. Vierte Auflage. Wiesbaden: VS, S. 155-174. 1 Cultural Studies nach dem ‚Cultural Studies Paradigma‘
Ende der 1980er Jahre konstatierte Meaghan Morris (2003) für die englischsprachige Wissenschaftslandschaft – allen voran Großbritannien, Australien und die USA – einen „Boom“ der Cultural Studies. In den 1990er Jahren führte dieser „Boom“ dann nicht nur zur Etablierung verschiedenster Studienprogramme in diesen Ländern, sondern vor allem zu einer Intensivierung von Forschung und umfassenden Publikationsaktivitäten. Gleich-zeitig setzte parallel eine „Kontroverse“(Hepp/Winter 2003) um die Cultural Studies ein, einerseits als interne Diskussion,wie sich dieser Ansatz bzw. dieses Projekt im Hinblick auf dessen Erfolge entwickeln kann und soll. Andererseits war dies aber auch eine exter-ne Diskussion seitens der Vertreterinnen und Vertreter ‚traditioneller Fachdisziplinen‘, die die Cultural Studies zum Teil nicht unerheblich kritisierten. Bezogen auf den Bereich der Medien-und Kommunikationswissenschaft war – was diese Kritik betrifft – sicherlich der von Marjorie Ferguson und Peter Golding (1997) herausgegebene Band „Cultural Studies in Question“ in dieser Hinsicht eine Zäsur. Vorwürfe, die in dem Band geäußert wurden, betreffen eine Vernachlässigung (makro)politischer und ökonomischer Fragestellungen, was einerseits zu einer umfassenden Textfixierung geführt habe, andererseits zu einer distanzlosen ethnografischen Publikumsforschung.
Bemerkenswert als Reaktion auf die in „Cultural Studies in Question“ und anderen Publikationen formulierte Kritik an der Medienforschung der Cultural Studies ist eine Ver-öffentlichung von David Morley (2003). Morley führt aus, dass man die Kontroverse um die Cultural Studies zuerst einmal positiv sehen müsse. Der Grund dafür ist, dass sie darauf verweist, dass die Cultural Studies im Bereich der Medienforschung Themen und Fragestellungen in den Blick gebracht haben – wie beispielsweise eine Auseinanderset-zung mit alltäglichem Konsum, der Artikulation von Machtverhältnissen durch verschie-dene Mediendiskurse, die Beschäftigung mit populären Medienprodukten etc. –, die die ‚klassische‘ Soziologie der Massenkommunikation bzw. politische Ökonomie nicht im Blick hatten bzw. die als Gegenstand von vornherein negativ konnotiert waren. Dies heißt für ihn aber gleichzeitig, dass die Cultural Studies nicht einfach gegen eine soziologische Auseinandersetzung mit Medienkommunikation gerichtet sind. Vielmehr begreift er die Cultural Studies insofern als zentral für eine sozialwissenschaftliche Medienforschung, weil sie als „Bewahrer einer ‚verloren gegangenen‘ Tradition“ (Morley 2003: 115) fungiert haben, nämlich die einer qualitativen, kritischen Auseinandersetzung mit Medien. Im Hin-blick darauf kann er auch nicht eine ‚Krise‘ der Cultural Studies ausmachen, wie Fer-
2
guson und Golding dies tun. Problematisch erscheinen ihm aber Versuche, die Cultural Studies als textanalytische Kulturwissenschaft festzuschreiben:
„Die Lösung für diese ‚Krise‘, so es sie gibt, besteht […] für mich darin, dass man in Anbetracht der jüngsten ‚Textualisierung‘ der Cultural Studies an ihrem genuin multidisziplinären Charakter festhält – was das bestmögliche Angebot an soziologische Perspektiven mit einschließt.“ (Morley 2003: 117)
Solche Diskussionen wurden von Jan Baetens (2005) wieder aufgegriffen, der damit eine Forderung nach „Cultural Studies nach dem Cultural Studies Paradigma“ verbindet. Was will Baetens mit dieser paradoxen Formulierung fassen? Zuerst einmal versteht Baetens die nach dem Cultural Studies „Boom“ der 1990er Jahre einsetzende Kritik an den Cultu-ral Studies ebenfalls als Hinweis darauf, dass diese sich in der internationalen akademi-schen Landschaft etablieren konnten. In ihrer Kritik des „Paradigmas“ der Cultural Stu-dies als ‚politischem‘ und ‚transdisziplinären‘ Projekt reflektieren die traditionellen Diszip-linen gewissermaßen diesen Umstand (vgl. Baetens 2005: 5). Umgekehrt ist es so, dass mit der Etablierung der Cultural Studies sowohl der ‚politische‘ als auch ‚transdisziplinäre‘ Charakter einer Reformulierungbedürfen, ohne deren Grundorientierung aufzugeben.
Bezogen auf den ‚politischen‘ oder besser ‚interventionistischen Charakter‘ der Cultu-ral Studies (vgl. Hepp 2004a: 18) verweisen die Argumente Baetens auf die Diskussion, dass es darum geht, den kritischen Ansatz der Cultural Studies mit Bezug auf gegenwär-tige Probleme der Zivilgesellschaft bzw. des Alltags weiter zu entwickeln.
1 Im Hinblick auf
den Aspekt der Reformulierung der Transdisziplinarität der Cultural Studies treffen sich die Argumente von Jan Baetens mit denen von David Morley. So streicht auch Baetens heraus, „interdisciplinarity is a good thing“,setzt aber nochmals ein deutliches Akzent dahingehend, dass damit nicht die häufig aus ökonomischen Erwägungen betriebene Auflösung von universitären disziplinären Einrichtungen gemeint ist: „interdisciplinarity is a good thing, which deserves to be encouraged, not as a synonym of antidisciplinarity, but as the creative collaboration of well-established disciplinary backgrounds“ (Baetens 2005: 10). Cultural Studies zu betreiben bedeutet in diesem Sinne gerade nicht, sie als eine ‚neueDisziplin‘ zu etablieren, sondern ihre Perspektive als transdiziplinäres Projekt zu wahren, das sich in unterschiedlichen Disziplinen multidimensional konkretisiert. Hiermit verbunden ist auch ein verändertes Verständnis von ‚wissenschaftlichem Fort-schritt‘, das jenseits von Vorstellungen disziplinären Paradigmawechsels liegt:
„Statt diesen Prozess [des ‚intellektuellen Fortschritts’; A.H.] als lineare Abfolge von Wahrheiten, Paradigmen oder Modellen zu denken, die einander in triumphalen Fortschritt ablösen, sind wir besser mit einem multidimensionalen Modell bedient, das in einem dialogischenTransformations-prozess, der zwar stellenweise selektiv, aber synergetisch und inklusiv ist, neue Einsichten auf den alten aufbaut.“ (Morley 2003: 135)
Solche Überlegungen lassen sich für die Medienanalysen der Cultural Studies und deren Verhältnis zur Medien-und Kommunikationswissenschaft konkretisieren. Im Rahmen einer an den Cultural Studies orientierten Medien-und Kommunikationsforschung geht es nicht darum, diese gegen die Medien-und Kommunikationswissenschaft zu positionieren. Adäquat erscheint vielmehr der Zugang, in der Medien-und Kommunikationswissenschaft verstanden als einer wissenschaftlichen Disziplin Medienanalysen der Cultural Studies zu realisieren. Der Beitrag, den die Cultural Studies für die Medien-und Kommunikationswis-senschaft leisten können, besteht darin, dass sie zum einen darauf zielen, gegenwärtige zivilgesellschaftliche Herausforderungen in ihren Medienanalysen zu fokussieren. Zum anderen geschieht dies mit dem Anspruch einer multiperspektivisch-kritischen Auseinan-dersetzung, oder – um es mit dem Titel dieses Bandes zu formulieren – mit einem Fokus auf das Wechselverhältnis von Kultur, Medien und Macht.
Doch wie kann für ein solches Unterfangen ein begrifflicher bzw. analytischer Rah-men aussehen? Welche – auch von Lawrence Grossberg in diesem Band geforderten – neuen Konzepte und Ansatzpunkte erscheinen für eine auf gegenwärtige Herausforde-rungen fokussierte Medien-und Kommunikationsforschung der Cultural Studies zentral? Der bisher umrissene Gesamtrahmen der Argumentation hat deutlich gemacht, dass es in der Perspektive der Cultural Studies kaum möglich ist, auf diese Frage eine einzig richtige Antwort zu geben. Deswegen müssen die im Weiteren entwickelten Argumente auch als eine mögliche Perspektivierung zukünftiger Medienanalyse im Kontext der Cul-tural Studies verstanden werden.
Mein Ziel auf den folgenden Seiten ist es, anhand von drei miteinander in Beziehung stehenden Konzepten theoretische und analytische Perspektiven einer Medien-und Kommunikationsforschung im Rahmen der Cultural Studies konkret zu machen, die ins-
3
besondere Fragen des Medien-und Kommunikationswandels fokussieren. Greifbar wird dies an der Diskussion um die Globalisierung der Medienkommunikation bzw. anhand der Auseinandersetzung mit der fortschreitenden Digitalisierung von Medienkommunika-tion. In beiden Diskussionssträngen erscheinen mir die die Konzepte ‚Konnektivität‘, ‚Netzwerk‘ und ‚Fluss‘ zentral. In Bezug auf diese ist herauszustreichen, dass sie über verschiedenste Disziplinen hinweg als begriffliche Analyseinstrumente zunehmend Ver-wendung finden. Dennoch kann man meines Erachtens argumentieren, dass diese Kon-zepte in den Cultural Studies auf eine ganz spezifische Weise konkretisiert werden, was exakt der Grund ist, weswegen sie Perspektiven für deren Medien-und Kommunikations-forschung im Rahmen von Cultural Studies eröffnen. Dabei sind die drei Konzepte nur vordergründig auf eine Auseinandersetzung mit der Netzkommunikation fokussiert. Si-cherlich ist dem zuzustimmen, dass es vor allem die Etablierung des Internets war, durch die diese Konzepte eine erhebliche Verbreitung in der Medien-und Kommunikationswis-senschaft erfahren haben. Eine intensivere Auseinandersetzung zeigt aber schnell, dass sie innerhalb der Medienanalysen der Cultural Studies auch über die Netzkommunikation hinaus an Relevanz gewonnen haben, insbesondere im Rahmen einer Aus-einandersetzung mit der Globalisierung der Medienkommunikation (siehe dazu überbli-ckend die Beiträge in Hepp et al. 2005a).
2 Konnektivität
Grundlegend kann man zuerst einmal festhalten, dass ein ‚Konnektivitätsdenken‘ in den klassischen Arbeiten der Cultural Studies durchaus zu finden ist, auch wenn der Begriff der ‚Konnektivität‘ erst später eine Verbreitung erfahren hat. Um diese historische Di-mension greifbar zu machen, möchte ich auf jüngere Argumente von John Storey verwei-sen, der Konnektivitätsvorstellungen in der Artikulationstheorie von Stuart Hall fest macht (vgl. Storey 2000: 63). Hall (2000: 65-69) operiert in seiner Artikulationstheorie bekann-termaßen mit der Doppelbedeutung des englischen Ausdrucks „to articulate“, der einer-seits so viel meint wie „sich äußern“,andererseits auch eine Verbindung herstellen – et-was ‚konnektieren‘. Eine Artikulation ist demnach eine ‚Konnektivitätsform‘, die unter be-stimmten Umständen eine ‚Einheit‘ herstellen kann, in der deren Elemente eine weiterge-hende Bedeutung erfahren. ‚Äußerungen‘ sind in diesem Sinne eine ‚Artikulation‘, aber auch jedes Kulturprodukt kann als eine ‚Artikulation‘ begriffen werden, indem es als ‚Ein-heit‘ auf bestehende kulturelle Ressourcen und Diskurse verweist. Apples iPod beispiels-weise hat – ähnlich wie der Sony Walkman (vgl. du Gay et al. 1997) – seine Bedeutung nicht ‚inhärent‘, sondern vermittelt durch eine auf das materielle Gerät bezogene Artikula-tion Elemente aus Diskursen der Medien und Werbung, aber auch lokalen Alltagsdiskur-sen (vgl. Hepp 2005b). Der Kern der Argumentation von Hall ist, dass solche Artikulatio-nen zuerst einmal immer kontextuell (und damit auch situativ) sind, in diesen Kontexten aber auf verschiedene bestehende Diskurse und Formationen verweisen, die diese Arti-kulationen vermitteln. Dies macht die Möglichkeit anderer Formen der Re-Artikulation derselben Elemente greifbar, gleichzeitig wird in einer solchen Perspektive deutlich, dass bestehende Artikulationen nicht beliebig sind (siehe zu den sich hieraus ergebenden Bezügen zum Symbolischen Interaktionismus den Beitrag von Friedrich Krotz in diesem Band).
Auch über die Artikulationstheorie von Hall hinaus lassen sich andere Überlegungen zu ‚kontextualisierter Konnektivität‘ als einem zentralen Aspekt von Bedeu-tungsproduktion in den Cultural Studies finden. Beispielsweise beschreibt nicht nur Halls (1980) Encoding/Decoding-Modell eine komplexe Konnektivitätsstruktur,ähnliches gilt auch für die verschiedenen Ansätze zur Beschreibung des „Kreislaufs von Kultur“ (vgl. Johnson 1986; du Gay et al. 1997; Hepp 2004b; Johnson et al. 2004). Oder McKenzie Wark (1994) versucht, im Rahmen einer solchen Begrifflichkeit Medienereignisse zu fas-sen. ‚Konnektivität‘ fasst damit das Herstellen einer spezifischen kommunikativen Bezie-hung, die einerseits eine konkrete Artikulation darstellt, andererseits auf übergreifende Diskurse und Formationen verweist. Der Begriff der ‚Konnektivität‘ verweist also – zumin-dest in seiner Grundstruktur – auf weitergehende Diskussionshorizonte innerhalb der Cultural Studies. Gleichzeitig hat ‚Konnektivität‘ auf theoretisch stärker fokussierte Weise zur Beschreibung des Medien-und Kulturwandels in den Cultural Studies an Relevanz gewonnen. Besonders deutlich wird dieser Umstand – wie gesagt – anhand der Globali-sierungsdiskussion. Diese Globalisierungsdiskussion möchte ich als erstes Beispiel für
4
eine weitere Kontextualisierung des Begriffs der Konnektivität nehmen, bevor ich als zweites Beispiel die Diskussion um digitale Medien fokussiere.
Jüngere Arbeiten sowohl innerhalb der Cultural Studies als auch innerhalb der Sozio-logie treffen sich in dem Punkt, dass Globalisierung am ehesten verstanden werden kann als ein Metaprozess einer zunehmenden, multidimensionalen weltweiten Konnektivität (vgl. Hepp et al. 2005c). Diese Formulierung versucht zumindest drei unterschiedliche Argumente zu fassen. Wenn man erstens Globalisierung als einen „Metaprozess“ (Krotz 2005) versteht, verweist dies darauf, dass das Konzept der Globalisierung nicht etwas fasst, das man in dem Sinne ‚beobachten‘ könnte, dass es sich dabei um ein einzelnes ‚empirisches Objekt‘ handelt. Eher ist Globalisierung ein metatheoretisches Konzept wie ‚Individualisierung‘ oder ‚Kommerzialisierung‘, das uns hilft, zumindest in Einzelaspekten widersprüchliche und paradoxe Teilprozesse als Ganzes zu verstehen.
Zweitens ist dieser Prozess „multidimensional“ (Giddens 1990: 70; Tomlinson 1999: 13). Diese Formulierung fasst, dass Globalisierung auf bzw. in unterschiedlichen ‚Pro-zessebenen‘ oder ‚Scapes‘ operiert. Auf welche gegenwärtige Konzepte von Globalisie-rung man sich auch stützt, diese treffen sich in dem Punkt, dass Globalisierung nicht auf eine ‚Hauptdimension‘ reduziert werden kann – z.B. die derÖkonomie –, die die anderen determiniert. Die unterschiedlichen Subprozesse der Globalisierung scheinen eine jeweils ‚eigene Logik‘ zu haben bzw. durch jeweils‚eigene Kräfte‘ gekennzeichnet zu sein. Nichtsdestotrotz scheint es vielfache Beziehungen zwischen den verschiedenen ‚Pro-zessebenen‘ zu geben, deren „Disjunktion“(Appadurai 1996: 27) ist relativ.
Dies verweist auf den dritten, im Zusammenhang meiner Argumentation ent-scheidenden Punkt, der mit dem Ausdruck der ‚Konnektivität‘ verbunden ist. Wie John Tomlinson (1999: 3-10) herausgestrichen hat, weist ‚Konnektivität‘ auf eine vorsichtige Haltung dahingehend hin, welche Folgen mit dem Metaprozess der Globalisierung ver-bunden werden können. Während frühe Arbeiten hierzu die Tendenz hatten zu argumen-tieren, dass das Resultat der Globalisierung eine fortschreitende globale Standardisie-rung, Homogenisierung, „McDonaldisierung“ (Ritzer 1998)oder kurz eine „globale Kultur“ (Featherstone 1990) sei, wissen wir jetzt, dass kulturelle Nähe eine Folge von Globalisie-rung in bestimmten Kontexten sein kann. Ebenso lassen sich aber mit der Globalisierung auch Prozesse der Zunahme von Konflikten, Missverständnissen und der kulturellen Fragmentierung ausmachen: „globalisation divides as much as it unites; it divides as it unites“ (Bauman 1998: 3).Dies ist vor allem ein wichtiges Argument im Feld der Medien-und Kommunikationsforschung: Eine zunehmende kommunikative Konnektivität bringt Menschen nicht zwangsläufig zusammen – wie es Marshal McLuhan in seinem utopi-schen Entwurf eines „global village“ umreißt (vgl. McLuhan/Fiore 1968) – und hat nicht eine ‚weltweite Amerikanisierung‘ zur unhinterfragten Folge. Eher verweist die zuneh-mende weltweite kommunikative Konnektivität auf quantitativer Ebene auf eine wachsen-de Zahl grenzüberschreitender Kommunikationsprozesse. Betrachtet man diese aller-dings auf qualitativer Ebene, so haben diese Prozesse eine sehr unterschiedliche Spe-zifik. Entsprechend erscheint es notwendig, im Detail zu analysieren, was die Folgen der Globalisierung der Medienkommunikation sind, indem man sich auf spezifische Artikulati-onen in spezifischen Kontexten konzentriert.
Wie bereits als zweiter Punkt angemerkt, verweist das Konzept der ‚Konnektivität‘ in Bezug auf Fragen des Medien-und Kommunikationswandels aber auch über die Globali-sierungsdiskussion hinaus auf eine Auseinandersetzung mit Digitalisierung. Anfangs war hier der Ausdruck der „Interkonnektivität“ („interconnectivity“) eine Kategorie zur Be-schreibung von technologischen kommunikativen Vernetzungen. Dies macht exempla-risch Pierre Lévy‘s Begriff des Cyberspace deutlich,den er als „communications space made accessible through the global interconnections of computers and computers memo-ries“ (Levy 2001: 74) definiert
2. Während an diesem Zitat die Nähe zur Diskussion um die
Globalisierung der Medienkommunikation greifbar wird, ist in anderen Ansätzen der Be-griff der Konnektivität generell ein Instrumentarium, um den mit fortschreitender Digitali-sierung verbundenen Wandel kultureller Räume und Orte zu fassen. Exemplarisch wird dies greifbar in den Beiträgen des von Nick Couldry und Anna McCarthy (2004) heraus-gegebenen Band „Mediaspace“, die sich mit jüngsten digitalen Medien befassen.
James Hay und Jeremy Packer (2004) untersuchen in deren Beitrag „Crossingthe Media(-n): Auto-Mobility, the Transported Self and Technologies of Freedom“ die Art und Weise, wie gegenwärtige Vorstellungen von Intelligenten Transportsystemen (ITS) kon-struiert werden und versuchen, solche Artikulationsprozesse über die Kategorie der Konnektivität zu fassen. Die Besonderheit der gegenwärtigen Repräsentation von ITS in
5
Werbung und Technologieszenarios besteht ihrer Argumentation nach darin, dass sie als doppelte – sowohl infrastrukturelle als auch kommunikative – Konnektivität konstruiert werden. Dies ist einerseits die Konnektivität des „smart car“ zum technischen System der automatisch befahrenen Infrastruktur. Andererseits werden diese „smart cars“ selbst als kommunikativ konnektierte,mobile Orte begriffen, die In-Bewegung die Möglichkeit zum Fernsehen und Filme-Schauen, Telefonieren, Internet-Surfen usw. bieten. Sie verbinden also die Vorstellung von ‚Freiheit‘ durch (in diesem Fall automatisierten!) Individualver-kehr mit der von Freiheit umfassender Kommunikationspotenziale: „Its connectivity is imagined as being most important to creating freedom“ (Hay/Packer 2004: 228).
Einen anderen Gegenstand fokussiert Fiona Allon (2004), sucht diesen aber wie-derum mit dem Konzept der Konnektivität zu fassen. Ihr geht es um Konstruktionen des „smart house“, also um Entwürfe von ‚intelligenten‘, ‚kommunikativ vernetzen‘ Häusern. Wiederum finden wir den Gedanken, dass ein und derselben (technologischen) Konnek-tivität unterschiedliche Bedeutungen in kulturellen Auseinandersetzungen und Machtver-hältnissen zukommt (vgl. Allon 2004: 271). Einerseits eröffnet die digitale Technologie im „smart house“ mit der umfassenden internen und externen Konnektivität verschiedenster Endgeräte weitreichende Gestaltungsräume. Beispiele hierfür sind durch Mobiltelefone gesteuerte Beleuchtungs- oder Rolladensysteme oder Funknetze in allen Räumen des Hauses. Diese Technologien bieten neue Möglichkeiten der ‚Steuerung‘ des Zuhauses, aber auch neue Räume des kommunikativen Handelns nach ‚Außerhalb‘ für diejenigen, die über diese Technologien verfügen und sie beherrschen. Gleichzeitig bietet die selbe kommunikative Konnektivität aber auch Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung, nicht nur des Hauses als Besitz selbst (bspw. durch Webcams), sondern vor allem derje-nigen Menschen, die in diesem Haus Heimarbeit (beispielsweise am heimischen Compu-ter) verrichten. Hier wird die Technologie des „smart houses“ zu Kontrolltechnologie für neue Formen von Ausbeutung.
Als dritter Beitrag des Bandes, in dem das Konzept der Konnektivität eine bemer-kenswerte Rolle spielt, ist der von Michael Bull zu nennen. Dieser setzt sich auf der Basis von qualitativen Interviews mit der Aneignung von mobilen Endgeräten (Autoradios, Walkmans, Mobiltelefonen etc.) auseinander. Im Fokus steht dabei die Frage, inwieweit diese ‚devices‘ kommunikativ „mobile spaces“ (Bull 2004: 275) in der Stadt eröffnen. Bull kann zeigen, wie durch die Konnektivität mobiler Endgeräte bewegliche individualisierte Kommunikationsräume geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür sind die privaten Sound-welten von mobilen Abspielgeräten, die die Illusion von ‚beweglicher Nähe‘ vermitteln (vgl. Bull 2004: 283). Aber auch Mobiltelefone gestatten eine mobile Konnektivität perso-naler Kommunikation im städtischen Raum (Bull 2004: 286). In der Argumentation von Bull werden gegenwärtige städtische Strukturen personaler Kommunikation als selbst mobile individualisierte Kommunikationsgefüge greifbar (siehe für eine ähnliche Perspek-tive auch den Beitrag von Caroline Düvel in diesem Band).
Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass John Tomlinson (2005)über seine globalisierungstheoretischen Überlegungen hinaus das Konzept der Konnektivität erweitert, um den Medien-und Kommunikationswandel von Mobilkommunikation zu fas-sen. Während die Terminals von physischer Konnektivität – hier verstanden als Endorte von Reisenden – in der industriellen Moderne glamourös gestaltete Bahnhofsgebäude waren, wurden in den letzten anderthalb Jahrhunderten Terminals als Endgeräte ‚kom-munikativer Konnektivität‘ nicht nur kleiner, vor allem wurden sie mobil. Und auch Tom-linson argumentiert, dass diese mobile kommunikative Konnektivität einerseits kulturell-technologische Ängste schafft, andererseits Möglichkeiten eröffnet, die Grenzen der ge-lebten Lokalität kommunikativ zu überwinden. Die Technologien mobiler digitaler Endge-räte können in diesem Sinne als „unvollendete Instrumente [betrachtet werden], mit de-nen die Menschen versuchen – unter den Bedingungen einer weltweiten Deterritorialisie-rung – etwas von der Sicherheit eines kulturellen Ortes, von Beständigkeit in einer Kultur des Flows zu erhalten“ (Tomlinson 2005).
Die bisher skizzierten Aktualisierungen von ‚Konnektivität‘ im Rahmen der Auseinan-dersetzung mit Digitalisierung machen eine ähnliche Leistung des Konzeptes deutlich, wie im Rahmen der Globalisierungsdiskussion: ‚Konnektivität‘ ermöglicht die Beschrei-bung und Analyse des Wandels von kommunikativen Beziehungen in einer Art und Wei-se, die zuerst einmal vor-analytische Bewertungen dieser Kommunikationsbeziehungen im Hinblick auf damit verbundene Machverhältnisse und Folgen vermeidet.
Möglicherweise ist exakt dies der Grund, warum sich ‚Konnektivität‘ auf besondere Weise dazu anbietet, Medien-und Kommunikationswandel zu fassen. Auf einer abstrak-ten Ebene lässt sich jedes Medium als ein Instrument zur ‚Etablierung von kommunikati-
6
ver Konnektivität‘ begreifen. Sprache beispielsweise ist ein Werkzeug, das Menschen dazu verwenden ‚kommunikativ‘ in Beziehung zu treten. So kann man – wie es Werner Faulstich und Carsten Winter machen (Faulstich 1996; Winter 1996) – Wandermönche als „Menschmedien“ beschreiben, indem diese Reisenden kommunikative Konnektivitä-ten zwischen Menschen in unterschiedlichen Regionen herstellen. Aber auch elektroni-sche Medien wie Film, Fernsehen, Radio und das Internet können als Werkzeuge der Herstellung von kommunikativer Konnektivität verstanden werden. Ihre Repräsentationen stellen symbolische Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschen und Kulturen her.
Abbildung 1: Konnektivitätstheoretische Konzepte
Diese Beispiele illustrieren zwei Aspekte. Erstens ist Konnektivität ein generelles Moment von Kommunikation. Es ist nichts Neues oder Spezifisches für elektronische Medien oder das Internet
3. Eher hilft das Konzept uns, die Überlegung zu fassen, dass Kommunikation
auf das Herstellen einer bestimmten Art von ‚Beziehung‘ verweist, deren Folge ‚Verste-hen‘ sein kann, aber ebenso auch ‚Missverstehen‘ und ‚Konflikt‘. Zweitens hat sich die Spezifik von kommunikativer Konnektivität im Verlauf der Mediengeschichte verändert: Frühe Formen der Etablierung von kommunikativer Konnektivität basierten in hohem Maße auf ‚physischen Aspekten‘, beispielsweise der Person, die reist. Im Gegensatz dazu basieren die Formen von Konnektivität, die in den letzten Jahrzehnten an Relevanz gewonnen haben, in wesentlich geringerem Maße auf ‚physischen Aspekten‘. Selbstver-ständlich haben beispielsweise Internetverbindungen nach wie vor ihre ‚physische Basis‘ in elektronischen Kabelnetzwerken. Aber deren Formen der Konnektivität sind mehr und mehr losgelöst von dieser ‚Basis‘: Die Kommunikationsmuster, die in der Netzkommuni-
kation über verschiedene Territorien hinweg zugänglich sind, scheinen kaum mehr auf deren ‚physische Aspekte‘ rückführbar.
All diese Verweise auf verschiedene Studien und Theoretisierungen haben damit deutlich gemacht, in welchem Maße ein auf ‚Konnektivität‘ fokussiertes Denken hilfreich erscheint, die in der Globalisierung der Medienkommunikation un Digitalisierung greifba-ren Herausforderungen des gegenwärtigen Medien-und Kommunikationswandels zu fassen. Allerdings bedarf meines Erachtens das Konzept der Konnektivität einer weiteren begrifflichen Differenzierung. Wie ich argumentieren möchte, verbinden konnektivitäts-theoretische Überlegungen letztlich zwei Perspektiven oder Aspekte in diesem Konzept. Dies ist zum einen der Strukturaspekt, der sich mit dem bereits mehrfach genannten Ausdruck des ‚Netzwerks‘ zur Beschreibung von ‚Konnektivitätsstrukturen‘ verbinden lässt. Zum anderen ist dies die des Prozessaspekts, der mit dem Ausdruck des Flusses („flow“) zur Beschreibung von ‚Konnektivitätsprozessen‘ in Verbindung gebracht werden kann (siehe oben stehende Abbildung). Es erscheint mir wichtig, dass man beide Aspek-te im Blick hat, wenn man sich mit Fragen kommunikativer Konnektivität auseinander setzt – ob in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung oder in Bezug auf die Globali-sierung der Medienkommunikation.
3 Netzwerk
7
Der Ausdruck ‚Netzwerk‘ bietet einen Ansatzpunkt, die strukturierenden Kräfte von Konnektivität zu fassen
4. Um dies verständlich zu machen, bietet es sich an, Manuel Cas-
tells Definition von ‚Netzwerk‘ zu zitieren, die sich mit der Definition vieler anderer trifft. Für Castells sind Netzwerke
“offene Strukturen und in der Lage, grenzenlos zu expandieren und dabei neue Knoten zu integrie-ren, solange diese innerhalb des Netzwerks zu kommunizieren vermögen, also solange sie die selben Kommunikationskodes besitzen – etwa Werte oder Leistungsziele.“ (Castells2001: 528f.)
Dieses Zitat verweist auf einige wichtige Aspekte, die man beim Theoretisieren von ‚Netzwerk‘ berücksichtigen sollte. In einem bestimmten Sinne ist es tautologisch zu ar-gumentieren, Netzwerke bestehen aus Konnektivitäten (‚Verbindungen‘, ‚Fäden‘,‚Kurven‘ usw.), die miteinander in Knoten verbunden sind. Dies ist bloß eine Beschreibung von Netzwerk im Sinne einer alltagssprachlichen Metaphorik. In der gegenwärtigen Theo-riediskussion bekommen diese Ausdrücke jedoch mit einer spezifischen Bedeutung. Es ist zunehmend offensichtlich, dass sich die Konnektivität eines Netzwerks entlang be-stimmter Kodes artikuliert. ‚Strukturen‘ sozialer Netzwerke sind nicht einfach da, sondern werden in einem fortlaufenden kontextualisierten Prozess (re)artikuliert. Dies macht es beispielsweise möglich, dass ein und dieselbe Person Teil unterschiedlicher Netzwerke sein kann: Er oder sie kann Teil eines Freundschaftsnetzwerks sein (wo eine bestimmte Art sozialer Beziehung der ‚dominante Kode‘ ist), oder auch Teil des Netzwerks einer sozialen Bewegung (wo bestimmte kulturelle Werte und politische Ziele der ‚dominante Kode‘ sind). Dies scheint der Grund dafür zu sein, warum Netzwerkstrukturen so offen und die Grenzen von Netzwerken so unscharf sind, während Netzwerke nichtsdestotrotz strukturierende Kräfte darstellen: Ein Freundschaftsnetzwerk stellt an uns bestimmte Anforderungen, ebenso wie das politische Engagement in einer sozialen Bewegung an-dere Möglichkeiten politischen Handelns ausschließt.
5
Diese Anmerkungen helfen zu fassen, was man unter dem Ausdruck ‚Knoten‘ verste-hen kann. Auf einer neutralen Ebene kann man sagen, ein Knoten ist der Punkt, wo eine Konnektivität (‘Verbindung‘, ‚Faden‘, ‚Kurve‘ usw.) eines Netzwerks sich selbst kreuzt.
6
Auf einen ersten Blick mögen solche Formulierungen irritieren. Nichtsdestotrotz helfen sie uns, den wichtigen Punkt zu verstehen, dass Knoten innerhalb von Netzwerkstrukturen vollkommen unterschiedliche Dinge sein können. Wir können personale Kommunikation als einen Prozess der Herstellung einer bestimmten Art von Konnektivität verstehen, in der die sprechenden Personen die zentralen ‚Knoten‘ sind. ‚Knoten‘ können aber ebenso andere soziale Formen haben. Zum Beispiel kann man lokale Gruppen als ‚Knoten‘ in dem Netzwerk einer weitergehenden sozialen Bewegung beschreiben oder man kann Organisationen wie lokale Unternehmungen als ‚Knoten‘ in einem weitergehenden Fir-mennetzwerk begreifen.‚Netzwerk-Strukturen‘ können auf vollkommen unterschiedlichen Ebenen ausgemacht werden – und das ist der Grund, warum dieses Konzept eine Chan-ce eröffnet, strukturierende Kräfte über verschiedene Ebenen hinweg zu beschreiben und zu vergleichen.
Ein dritter Punkt, der wichtig erscheint, wenn wir die Strukturaspekte von Kon-nektivität diskutieren, ist der des ‚Schalters‘. Wiederum war es Manuel Castells, der die-sen Ausdruck in die wissenschaftliche Diskussion gebracht hat. Für Castells ist ein ‚Schalter‘ ein spezifischer Knoten, der verschiedene Netzwerke miteinander verbindet. Der Ausdruck ‚Schalter‘ bezieht sich auf die Idee, dass dieser Knoten dazu in der Lage sein muss, den Kode eines Netzwerks in den eines anderen zu ‚übersetzen‘. Um dies verständlicher zu machen ist es hilfreich, sich die Knoten näher zu betrachten, die Cas-tells als ‚Schalter‘ beschreibt. Die Beispiele, auf die er sich fokussiert, sind hier die Netz-werke von Kapital, Information und Management(siehe Castells 2001: 529). Deren unter-schiedliche Strukturen sind über spezifische‚Schalter‘ miteinander ‚verbunden‘, die er in so genannten globalen Städten ausmacht. ‚Schalter‘ sind in diesem Sinne die Orte, wo zentrale Momente von Macht innerhalb von Netzwerkstrukturen konzentriert sind, wobei sich diese Machtkonzentration in der ‚Übersetzungsfähigkeit‘ der Kodes von einem Netz-werk zum anderen manifestiert. Genau durch solche ‚Übersetzungsleistungen‘ sind glo-bale(Medien-)Städte gekennzeichnet (vgl. Krätke 2002). Diese Idee eröffnet neue Mög-lichkeiten, Machtbeziehungen innerhalb von (globalen) Netzwerken zu analysieren: Wäh-rend Machbeziehungen in der Gesamtheit sozialer Netzwerke fußen – wie Michel Foucault herausgestrichen hat (vgl. Foucault 1996: 43) –, hilft uns das Konzept des ‚Schalters‘ zu verstehen, wo Machbeziehungen innerhalb von Netzwerken insbesondere konzentriert sind, nämlich an der Position, wo verschiedene Netzwerke miteinander inter-agieren.
8
Dieses ‚Netzwerk-Denken‘, wie ich es beschrieben habe, eröffnet meines Erachtens eine Art und Weise, die strukturellen Aspekte von Konnektivität zu beschreiben, die die-sem Paradox der gleichzeitigen ‚Offenheit‘ und ‚Geschlossenheit‘ von Netzwerken ge-recht wird. Auf der einen Seite sind die Strukturen von Netzwerken in dem Sinne ‚offen‘, dass sie (mehr oder weniger) einfach neue ‚Knoten‘ integrieren und wachsen können, ohne deren ‚Stabilität‘ zu verlieren. Hierauf Bezugnehmend sind Netzwerke ‚offen‘. Auf der anderen Seite sind Netzwerke gleichzeitig geschlossen, indem diese Prozesse der Ausdehnung entlang bestimmter ‚Kodes‘ geschehen, die das Spezifische eine Netzwerks und dessen Macht bestimmen. Aber wiederum besteht eine bestimmte ‚Offenheit‘ von Netzwerken, indem ‚Schalter‘ die Möglichkeit bieten, über ‚Kodegrenzen‘ hinweg zu ‚kommunizieren‘. Dies ist der Punkt, an dem die Netzwerkmetapher produktiver zu sein scheint als die Systemmetapher der gegenwärtigen funktionalistischen Systemtheorie: ‚Systeme‘ werden – wie beispielsweise in den Arbeiten von Niklas Luhmann (1997) – als ‚geschlossene Strukturen‘ gedacht, die sich selbst auf ‚autopoietische Weise‘ reproduzie-ren.Wegen deren ‚autopoietischer Struktur‘ besteht für Systeme keine Möglichkeit, auf direkte Weise miteinander zu interagieren. Anstatt dessen sind sie miteinander durch ‚strukturelle Kopplung‘ verbunden. Mit solchen Konzepten eröffnet die funktionalistische Systemtheorie sicherlich einen kohärenten Begriffsrahmen. Ihre Schwäche besteht aber in deren Fokus auf eineindeutige Systemgrenzen und Systemintegration. ‚Netzwerk‘ als Konzept eröffnet einen wesentlich offenere Möglichkeit des Denkens, das angemessen erscheint für die Paradoxien gegenwärtiger Medienkulturen (siehe Karmasin 2004 zum Konzept des Paradox in der Medien- und Kommunikationswissenschaft).
4 Fluss
Wie ich argumentiert habe, ist der Fokus auf ‚Netzwerke‘ nur eine Möglichkeit, Konnekti-vität zu betrachten. Ebenso wichtig wie dieser Strukturaspekt ist der Prozessaspekt. Der verbreiteste Ausdruck, um diese Prozesse zu beschreiben, ist der des ‚Flusses‘ im Sinne von Englisch „flow“ oder „fluid“
7. Flüsse operieren entlang bestimmter Netzwerkstruktu-
ren. Beispielsweise muss der ‚Nachrichtenfluss‘ auf der Basis unterschiedlicher Medien-netzwerke gefasst werden (vgl. Boyd-Barrett/Thussu1992; Boyd-Barrett 1997; Boyd-Barrett/Rantanen 1998), während der Fluss von Migranten entlang bestimmter Perso-nennetzwerke erfolgt (vgl. Pries 2001).
Insbesondere John Urry hat argumentiert, dass das Konzept des Flusses8 in hohem
Maße geeignet erscheint, die sozialen und kulturellen Prozesse der Gegenwart zu fas-sen, indem dieses die Möglichkeit für eine neue Form von Soziologieeröffnen würde, der es gelingen kann, die zunehmend mobilen kulturellen Formen zu fokussieren. Urry argu-mentiert, „[the] development of a ‚mobile sociology‘ demands metaphors that view social and material life as being ‚like the waves of a river‘“ (Urry 2003: 59). Ausgehend von die-ser Vorstellung favorisiert Urry das Konzept des ‚globalen Flusses‘ (‚global fluids‘), mit dem er betonen möchte, dass Flüsse unzweifelhaft Netzwerke nötig machen, nichtsdes-totrotz die Spezifik dieser globalen Flüsse darin besteht, dass sie Netzwerke überschrei-ten und zum Teil selbst organisierend sind im Hinblick auf deren Schaffen und Aufrecht-erhalten von Grenzen (vgl. Urry 2003: 60). Solche Argumente sind aus meiner Perspekti-ve sehr interessant, da sie gleichzeitig hilfreich und problematisch erscheinen. Sie sind hilfreich,indem sie den überschreitenden Charakter von Flüssen betonen: Flüsse wie der Fluss bestimmter Informationen ‚überschreiten‘ unterschiedliche Netzwerke, und dies ist der Grund, warum das Konzept des Flusses und das des Netzwerkes voneinander zu unterscheiden sind. Auf der anderen Seite erscheinen seine Argumente problematisch, indem Urry hieraus – trotz seiner Kritik an der funktionalistischen Tradition – einen selbstorganisierenden Aspekt globaler Flüsse folgert. Wenn wir jedoch solch abstrakte Argumentation auf die Ebene der Alltagserfahrungen herunter brechen, stellen wir fest, dass zumindest die globalen Kommunikationsflüsse nicht ‚autonome‘ Phänomene sind, sondern strukturiert werden durch die Kommunikationsnetzwerke, entlang derer sie ‚rei-sen‘ – und dass diese strukturierenden Aspekte etwas mit Macht und der Machtkonzent-ration an bestimmten ‚Schaltern‘ zu tun haben.
Was ich hier deutlich machen möchte ist, dass Urry sicherlich recht hat mit seiner Be-tonung der Komplexität (globaler) Flüsse. Was problematisch erscheint ist seine Tendenz aufzugeben danach zu fragen, was die strukturierenden Aspekte globaler Komplexität
9
sind und wie diese mit Machbeziehungen verwoben sind9. Trotz deren provisorischen
Charakters erscheinen mir theoretische Konzepte wie das des ‚Schalters‘ als machtge-prägter ‚Überschreitungspunkt‘ unterschiedlicher Netzwerke und entlang dieser verlau-fender Flüsse ein geeignetere Art und Weise, über Macht in ‚globaler Komplexität‘ und ‚zunehmender Mobilität‘ nachzudenken als von ‚selbstorganisierenden‘ Aspekten von Flüssen zu sprechen. Es sind exakt diese ‚Schalter‘, die im Alltagsleben sehr manifest sind: Wenn wir Medienflüsse betrachten, müssen wir unseren Blick auf ‚global‘ handelnde Medienkonzerne lenken, während wir gleichzeitig anerkennen müssen, dass diese Teil eines zunehmend globalen Kapitalismus mit entsprechenden Finanznetzwerken und -flüssen sind – ein Kapitalismus, der sich an spezifischen globalen Medienstädten konkre-tisiert (vgl. Hepp2004c: 259-274) und eher Unsicherheit und Ambiguität produziert als ein kollektives Verstehen (vgl. Ang 2003).
Ausgehend hiervon können wir folgern, dass Flüsse kein momentanes Ereignissind, sondern langfristige Konglomerate von Prozessen konstituieren. Es gibt unterschiedliche Begriffe, die sich etabliert haben, um diese Konglomerate zu bezeichnen, wie beispiels-weise ‚Space‘ in Castells Konzept des Raums der Ströme (sieheCastells 2001: 431) oder ‚scape‘ wie in in Arjun Appadurais (1996: 33) bekannter Unterscheidung von Ethnos-capes, Mediascapes, Technoscapes, Financescapes und Ideoscapes. Theoretische Konzepte wie diese versuchen zu fassen, dass unterschiedliche (globale) Flüsse ‚kom-plexe Landschaften‘ konstituieren, die in deren eigenen Logik zu beschreiben sind. Die Flüsse bestehender Konnektivitäten existieren nicht als isolierte Einzigartigkeiten, son-dern konstituieren den Teil eines komplexeren Gefüges.
Während man im Allgemeinen zeigen kann, wie zielführend räumliche Konzepte sind, um diese Langzeitkonglomerate von Flüssen greifbar zu machen (siehe für solche Argu-mente Morley 1996: 327-331), erscheint mir insbesondere ein bestimmtes theoretisches Konzept konkrete empirische Analysen zu ermöglichen, nämlich das der ‚Verdichtung‘ (vgl. Löfgren 2001). Wenn wir unsere Gegenwart begreifen als gekennzeichnet durch eine fortschreitende ‚globale Konnektivität‘ von zunehmend mobilen ‚Netzwerken‘ und ‚Flüssen‘, die ineinander übergehen und unklare Grenzen haben, müssen wir doch die Frage beantworten, wie wir dennoch nach wie vor bestehende kulturelle, ökonomische und andere Gefüge fassen. Wenn wir diese als ‚bedeutungstragende Verdichtungen‘ von Flüssen entlang von und über Netzwerke hinweg beschreiben, betonen wir einerseits die Spezifik solcher Konglomerate wie staatliche Gebilde und Kulturen, gleichzeitig aber an-dererseits deren unscharfe Grenzen. Es ist damit offenkundig, dass das Konzept der ‚Verdichtung‘ den ‚überschreitenden Charakter‘ von Flüssen greifbar macht und gleichzei-tig das Charakteristische des jeweiligen ‚Raums‘ oder ‚Scapes‘ lang anhaltender Konglo-merate: Verdichtungen sind gewissermaßen eine fokussierte und bedeutungsvolle Spe-zifik von Flüssen mit unscharfen Grenzen.
5 Kontextualisierte Netzwerk-und Flussanalysen
Man mag meinen bisher entwickelten Argumenten den Vorwurf machen, es handle sich bei ihnen um keine weitergehende Klärung der Konzepte ‚Konnektivität‘, ‚Netzwerk‘ und ‚Fluss‘, die deren Eignung als Ansatzpunkt von Medien-und Kommunikationsforschung im Rahmen der Cultural Studies deutlich machen. Vielmehr verbleiben sie auf einer ähn-lich abstrakten und selbstbezogenen Ebene, wie man es beispielsweise der Theoriedis-kussion der Systemtheorie oder dem (radikalen) Konstruktivismus vorwirft. Sicherlich waren die bisher erfolgten Argumentationen abstrakt und verweisen zumindest zum Teil auf eine partiell geschlossene Globalisierungsdiskussion.
10 Dennoch bieten sie meines
Erachtens die Basis für eine ganzkonkrete Medien-und Kommunikationsforschung im Rahmen der Cultural Studies.
Fasst man die bisherigen Argumente nochmals zusammen, so ist dies dahingehend möglich, dass ‚Konnektivität‘ ein spezifisches Konzept zur Fokussierung soziokultureller, insbesondere translokaler kommunikativer Beziehungen ist, das dem gerecht werden versucht, dass solche Beziehungen vollkommen unterschiedliche, zum Teil widersprüch-liche bzw. paradoxe Qualitäten haben können und dennoch als kontextuelle Artikulatio-nen Bestand haben. Konkret wird eine auf Konnektivität fokussierte Betrachtung, wenn sie einzelne Netzwerke als Strukturaspekte von Konnektivität analysiert oder aber einzel-ne Flüsse als Prozessaspekte von Konnektivität. Fokus einer Medien-und Kommunikati-
10
onsforschung in diesem Begriffsrahmen kann entsprechend nicht ‚Konnektivität‘ ‚als sol-che‘ sein, es sind vielmehr konkrete Netzwerke und Flüsse, die es zu untersuchen gilt.
Geht man von allgemeinen methodologischen Überlegungen der Cultural Studies aus, so müssen diese Netzwerk-und Flussanalysen kontextualisiert erfolgen. Diese For-mulierung verweist auf den radikalen Kontextualismus als einem zentralen Bezugspunkt von Cultural Studies überhaupt (siehe dazu auch Ien Ang und Rainer Winter in diesem Band). Die Argumente von Lawrence Grossberg (1994: 26) aufgreifend ist unter radika-lem Kontextualismus eine grundlegende Orientierung der Cultural Studies zu verstehen, die sich in einem spezifischen Anti-Essenzialismus manifestiert, wonach kein kulturelles Produkt und keine kulturelle Praxis außerhalb des kontextuellen Zusammenhangs fass-bar ist, in dem diese stehen. Befassen sich die Cultural Studies also mit der Rolle kultu-reller Praktiken bei der Konstitution soziokultureller Wirklichkeit, so geschieht dies unter Einbezug der verschiedenen in diesem Zusammenhang relevanten ‚Kräfte‘ und ‚Interes-sen‘, ohne dass eine von diesen monokausal als die ‚eigentlich relevante‘ apostrophiert wird. In diesem Sinne kann man davon sprechen, Fokus einer ‚Konnektivitätsforschung‘ im Rahmen der Cultural Studies muss eine kontextualisierte Netzwerk-und Flussanalyse sein. Doch wie kann man sich diese vorstellen? Und welche Bezüge sind hier zu einem kritischen, auf Fragen der Macht ausgerichteten Vorgehen zu sehen?
Für eine kontextualisierte Netzwerkanalyse ist zuerst einmal herauszustreichen, dass ein netzwerkanalytisches Vorgehen allgemein in der Medien-und Kommunika-tionsforschung etabliert ist. So lassen sich bereits die Arbeiten von Lazarsfeld et al. zum Zwei-Stufen-Fluss von Kommunikation als frühe netzwerkanalytische Ansätze verstehen, indem hier die ‚indirekte Wirkung‘ von Medien über auf Meinungsführerzentrierte Kom-munikationsnetzwerke untersucht wurde (vgl. Schenk 1983). Aber auch in der Folge ha-ben (quantitative) netzwerkanalytische Studien in der Medien-und Kommunikationswis-senschaft ihre Tradition, insbesondere wenn es um die Untersuchung der Relevanz von Personennetzwerken in Prozessen des Agenda-Setting geht (vgl. überblickend Schenk 1995). Einen weiteren Schub haben Netzwerkanalysen mit einer auf das Internet bezo-genen Netzwerkforschung erfahren (vgl. exemplarisch für andere Wellman et al. 1996; Wellman 2000), aber auch in der Journalismusforschung sind sie zunehmend etabliert (vgl. Quandt 2005). Wo wird also eine Netzwerkforschung ‚kontextuell‘ im Sinne der Cul-tural Studies?
Man kann diese Frage dahingehend beantworten, dass es darum geht, Netzwerk-strukturen in deren Konkretisierung in Prozesse der Auseinandersetzung um Wirk-lichkeitsdefinitionen zu fokussieren. Es geht also gerade nicht um eine abstrakte Medien-theorie entlang der Kategorie des Netzwerks
11 oder um eine rein deskriptive Beschrei-
bung von Netzwerken. Vielmehr geht es um eine konkrete und materialbasierte Analyse von Netzwerkstrukturen und der in bzw. anhand von ihren greifbaren Machtverhältnisse, sei dies auf der Ebene von Personennetzwerken, von technologischen Netzwerken wie dem Internet oder komplexen Organisationsnetzwerken beginnend bei sozialen Bewe-gungen über die Netzwerke deterritorial agierender Medienkonzerne bis hin zu den Fi-nanz-und Handelsnetzwerken globaler Medienstädte.
Die Spezifik der Cultural Studies ist damit, dass das strukturierende Potenzial solcher Netzwerke in sozialen und kulturellen Auseinandersetzungen in den Mittelpunkt der Be-trachtung rückt. Machtbeziehungen, die sich in Netzwerken strukturieren, können sowohl bestehende Herrschaftsverhältnisse stabilisieren als auch Möglichkeiten von deren Kritik eröffnen. Ganz konkret wird dies innerhalb des Medienbereichs in Bezug auf das Internet greifbar. Einerseits ist das Internet als Infrastrukturnetzwerk zu begreifen, das zentral für die Etablierung einer globalen Ökonomie in Echtzeit bzw. für die Etablierung von inner-halb dieser agierender deterritorialer Netzwerkunternehmen ist (vgl. Castells 2001: 83-228). Die Technologie des Internets stützt hier eine spezifische Form des ‚globalen Kapi-talismus‘. Gleichzeitig ermöglicht das Internet aber auch eine Organisationskommunikati-on sozialer Bewegungen bzw. gestattet es diesen, ‚alternative Medienangebote‘ zumin-dest für die Mitglieder solcher Netzwerke zugänglich zu machen (vgl. Atton 2002;Couldry/Curran 2003). Ein konkretes Beispiel hierfür sind das globalisierungskriti-sche Netzwerk Attac bzw. das Angebot von Indymedia (vgl. Hepp/Vogelgesang2005). Geht man – wie es Chris Barker (2003) im Anschluss an Tony Bennett (1996,1997) macht – davon aus, dass Cultural Studies nicht einfach ‚Textanalyse‘ betreiben, sondern sich den institutionellen Dimensionen kultureller Macht und Auseinandersetzung zuwen-den sollten und gesteht ein, dass beides in heutigen, westlichen Gesellschaften weniger in einem Zentrum fokussiert ist, sondern nur in dezentralen Strukturen greifbar wird, so
11
erscheint eine kontextualisierte Netzwerkanalyse in hohem Maße zielführend. Wie auch für die Netzwerkanalyse lässt sich für eine Flussanalyse festhalten, dass
die Kategorie des ‚Flows‘ bzw. des ‚Fluids‘ in den Medienanalysen der letzten Jahre ei-nen Relevanzgewinn erfahren hat und in der Medien- und Kommunikationswissenschaft die damit verbundenen raumanalytischen Konzepte fest etabliert sind. Exemplarisch lässt sich, um dies zu belegen, auf die Arbeiten von Harold Innis verweisen (vgl. Kleinsteuber 1992; Innis 1997). Aber auch in der empirischen Medienforschung hat das Konzept des Kommunikationsraums seinen festen Stellenwert und es gab Ende der 1980er bezie-hungsweise Anfang der 1990er Jahren auch im deutschen Sprachraum einen regelrech-ten Boom der Kommunikationsraumforschung(vgl. Jarren 1987; Kleinsteuber and Ross-mann 1994). Mit Etablierung des Internets haben raumanalytische Konzepte einen weite-ren Relevanzgewinn erfahren (vgl.Beck 2003; Thiedeke 2004). Wo ist also das Spe-zifische der Cultural Studies zu sehen?
Setzt man an dieser Stelle wiederum beim Begriff der kontextualisierten Fluss-analyse an, so geht es darum, die Konstitution von (Kommunikations-)Flüssen in deren alltäglichen Kontexten zu untersuchen. Es geht also nicht um eine abstrakte Bestimmung von Kommunikationsräumen, sondern um deren kontextuelle – und damit auch situative und momentane – Artikulation im Alltag. Nähert man sich in einer solchen Perspektive den kulturellen Verdichtungen, die Kommunikationsflüsse konstituieren, so stellt man fest, dass deren Grenzen gegenwärtig weit weniger scharf sind, als von Alltagsprozessen abstrahierende Überlegungen vermuten lassen. Mit fortschreitender globaler und mobiler kommunikativer Konnektivität und entsprechend vielfältigen Kommunikationsflüssen ist bspw. der Kommunikationsraum von ‚Nationalstaaten‘ vielfach gebrochen durch die de-territorialen kulturellen Verdichtungen von Minderheiten und Diasporagemeinschaften (vgl. Morley 2000: 149-170; Gillespie 2002). Aber auch die Grenzen ‚nationaler Kommu-nikationsräume‘ werden untereinander unscharf, indem beispielsweise einzelne (Sprach-)Regionen selbst spezifische kommunikative Verdichtungen bilden (vgl. Sinclair et al. 1996). Eine kontextualisierte Untersuchung kommunikativer Flüsse und diesen ent-sprechenden Kommunikationsräumen bzw. kulturellen Verdichtungen ermöglicht es, sol-che Zusammenhänge zu fassen.
Insgesamt machen solche Überlegungen deutlich, dass die Konzepte ‚Konnektivität‘, ‚Netzwerk‘ und ‚Fluss‘ nicht spezifisch sind für die Cultural Studies. Sie sind ebenso in anderen Bereichen der Sozial-und Kulturwissenschaften etabliert. Als kennzeichnend für die Cultural Studies kann man aber die Notwendigkeit einer kontextualisierten Netzwerk-und Flussanalyse begreifen, die es gestattet, Beziehungen zwischen Kulturwandel, Me-dienwandel und dem Wandel von Machtverhältnissen zu untersuchen. Begreift man Cul-tural Studies – wie am Anfang dieses Beitragsskizziert – als ein transdiziplinäres Projekt, das es auch in der Medien-und Kommunikationswissenschaft zu konkretisieren gilt, und sieht hier den gegenwärtigen Medienwandel als eine der zentralen analytischen Heraus-forderungen an, so müssen sich die Medienanalysen der Cultural Studies darin bewäh-ren, diesen kritisch zu fassen. Genau darin liegen meines Erachtens die Potenziale der Konzepte von ‚Konnektivität‘, ‚Netzwerk‘ und ‚Fluss‘ für eine Medien-und Kommunikati-onsforschung im Rahmen der Cultural Studies.
Anmerkungen
1 Ich selbst habe in diesem Kontext das Konzept der ‚multiperspektivischen Kritik‘ favorisiert. Siehe dazu Hepp 2004c: 424-427 sowie die Einleitung in diesen Band.
2 Es ist bemerkenswert, dass in diesem Forschungsfeld nach einem Boom von „Cyberculture“-Studien bis Ende der 1990er Jahre (vgl. beispielsweise Levy 2001; Bell/Kennedy2000; Silver 2000; Bell 2001; Loader et al. 2004) sich seit den letzten vier Jahren eine kritischere bzw. diffe-renziertere Tradition der Auseinandersetzung mit digitalen Medien entwickelt, die entsprechend auch bei anderen begrifflichen Konzepten als dem der ‚Cyber-Kultur‘ ansetzt (siehe hierzu überblickend, wenn auch teilweise mit ‚positivistischem‘ Fokus Gurak 2004, sowie in einer älte-ren Auflage aber bis heute instruktiv Silver 2000).
3 Dies herauszustreichen erscheint mir wichtig, da gegenwärtige Theorien immer wieder dazu tendieren – wie beispielsweise die erwähnte Netzwerktheorie von Manuel Castells (2001) – sol-che Zusammenhänge aus dem Blick zu verlieren.
4 Im Gegensatz zu John Urry (Urry 2003: 59), gehe ich nicht davon aus, ein „‘strukturel-ler‘Zugang“ sei mit einer zunehmenden globalen Konnektivität obsolet. (Globale) Konnektivität scheint mir eine auch strukturierende Kraft zu sein, was es notwendig macht, diesen Aspekt
12
theoretisch zu fassen. Auf der anderen Seite minimiert dies selbstverständlich nicht die Rele-vanz eines Zugangs, der sich auf „flow“ und „fluid“ fokussiert. Siehe dazu meine weiter unten folgende Argumentation.
5 Selbiges lässt sich auch ausschließlich am Beispiel des Freundschaftsnetzwerks deutlich ma-chen: Während alle diese Netzwerke entlang des ‚Kodes Freundschaft‘ operieren, wechselt der ‚Fokus von Freundschaft‘ (‚Freundschaft mit wem‘) über das Netzwerk. Dies ist exakt der Grund, warum es nicht möglich ist, eineindeutige ‚Grenzen‘ von Personennetzwerken zu be-stimmen. Auf diese Weise lässt sich auch das „small world theorem“ einordnen (selbst wenn zwei Personen keinen direkten Freund gemeinsam haben, stehen sie doch nur durch eine kur-ze Kette von Zwischenpersonen miteinander in Kontakt, siehe Watts 2004).
6 Selbstverständlich erscheint es dabei wichtig, zwischen ‚starken‘ und ‚schwachen Verbin-dungen‘ zu unterschieden. Siehe dazu beispielsweise die klassischen Argumente von M. Gra-novetter (1983).
7 Im Englischen bestehen durchaus begriffliche Differenzen zwischen beiden Ausdrücken, indem „fluid“ nicht nur ‚Strom‘ bzw. ‚Flüssigkeit‘ impliziert, sondern ebenso ‚Gas‘ und dessen ‚Flüchtig-keit‘. Dies eröffnet sicherlich ein produktives Feld von Metaphern, wie das Buch „Liquid Moder-nity“ (dt. „Flüchtige Moderne“) von Zygmunt Bauman (2000)deutlich macht. Nichtsdestotrotz verbleibt hier das Risiko, strukturelle Aspekte von Konnektivität aus dem Blick zu verlieren, in-dem man sich ausschließlich auf die Auflösung traditioneller Institutionen der Moderne fokus-siert, anstatt deren Transformation in neue Strukturen ebenso in das Blickfeld zu rücken.
8 Urry gebraucht beide Ausdrücke ‚flow‘ und ‚fluid‘ synonym. Zu deren begrifflichen Nuancen siehe meine vorherige Anmerkung.
9 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass Urry keine Fragen von Macht diskutieren würde. Siehe dazu Urry 2003: 104-119.
10 Vgl. einführend zu dieser die Beiträge in Hepp et al. 2005b. 11 Vgl. für einen solchen Zugang aus radikalkonstruktivistischer Sicht Weber 2001.
Literatur
Allon, F. (2004): The Ontology of Everyday Control: Space, Media Flows and ‚Smart‘ Livingin the Absolute Present. In: Couldry, N./McCarthy, A. (Hrsg.): Mediaspace. Place, Scale and Culture in a Media Age, London u.a., 253-274.
Ang, I. (2003): Im Reich der Ungewissheit. Das globale Dorf und die kapitalistische Postmoderne. In: Hepp, A./Winter, C. (Hrsg.): Die Cultural Studies Kontroverse, Lüneburg,84-110.
Appadurai, A. (1996): Modernity at Large. Minneapolis. Atton, C. (2002): Alternative Media. London u.a. Baetens, J. (2005): Cultural Studies after the Cultural Studies Paradigm. In: Cultural Studies 19, 1-
13. Barker, C. (2003): Kaleidoskopische Cultural Studies. Fragen von Politik und Methode. In: Hepp,
A./Winter, C. (Hrsg.): Die Cultural Studies Kontroverse, Lüneburg, 181-201. Bauman, Z. (1998): Globalization. The Human Consequences. Cambridge/Oxford. Bauman, Z. (2000): Liquid Modernity. Cambridge/Oxford. Beck, K. (2003): No Sense of Place? Das Internet und der Wandel von Kommunikationsräumen. In:
Funken, C./Löw, M. (Hrsg.): Raum – Zeit – Medialität. Interdisziplinäre Studien zu neuen Kommunikationstechnologien, Opladen, 119-138.
Bell, D. (2001): Introduction to Cyberculture. London u.a. Bell, D./Kennedy, B.M. (Hrsg.) (2000): The Cybercultures Reader. London.
Bennett, T. (1996): Putting Policy into Cultural Studies. In: Storey, J. (Hrsg.): What is Cultural Stu-dies? A Reader. London u.a., 307-321.
Bennett, T. (1997): Towards a Pragmatics for Cultural Studies. In: McGuigan, J. (Hrsg.): Cultural Methodologies. London u.a., 42-61.
Boyd-Barrett, O. (1997): Global News Wholesalers as Agents of Globalization. In: Sreberny-Mohammadi, A./Winseck, D./McKenna, J./Bod-Barrett, O. (Hrsg.): Media in Global Context. A Reader. London/New York, 131-144.
Boyd-Barrett, O./Rantanen, T. (Hrsg.) (1998): The Globalization of News. London u.a. Boyd-Barrett, O./Thussu, D.K. (Hrsg.) (1992): Contra-Flow in Global News. London. Bull, M. (2004): ‚To Each Their Own Bubble‘: Mobile Spaces of Sound in the City. In: Couldry,
N./McCarthy, A. (Hrsg.): Mediaspace. Place, Scale and Culture in a Media Age,London u.a., 275-293.
Castells, M. (2001): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie Das Informa-tionszeitalter. Opladen.
Couldry, N./Curran, J. (Hrsg.) (2003): Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World (Critical Media Studies: Institutions, Politics & Culture S.). London u.a.
Couldry, N./McCarthy, A. (Hrsg.) (2004): Media Space: Place, Scale and Culture in a Media Age. London u.a.
du Gay, P. et al. (1997): Doing Cultural Studies. The Story of the Sony Walkman. London. Faulstich, W. (1996): Die Geschichte der Medien Band 2: Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter
13
(800 – 1400). Göttingen. Featherstone, M. (1990): Global Culture: An Introduction. In: Theory, Culture & Society 7,1-14. Ferguson, M./Golding, P. (Hrsg.) (1997): Cultural Studies in Question. London u.a. Foucault, M. (1996): Wie wird Macht ausgeübt? In: Foucault, M./Seitter, W. (Hrsg.): Das Spektrum
der Genealogie, Frankfurt a.M., 29-47. García Canclini, N. (1995): Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Moderni-
ty.Minneapolis. Giddens, A. (1990): The Consequences of Modernity. London u.a. Gillespie, M. (2002): Transnationale Kommunikation und die Kulturpolitik in der südasiatischen
Diaspora. In: Hepp, A./Löffelholz, M. (Hrsg.): Grundlagentexte zur Transkulturellen Kommuni-kation. Konstanz, 617-643.
Granovetter, M. (1983): The Strenght of Weak Ties. A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory 1, 203-233.
Grossberg, L. (1994): Cultural Studies. Was besagt ein Name? In: Ikus Lectures 17 + 18,11-40. Gurak, L J. (2004): Internet Studies in the 21. Century. In: Gauntlett, D. (Hrsg.): Web.Studies. 2nd
Edition, London, 24-33. Hall, S. (1980): Encoding/Decoding. In: Hall, S./Hobson, D./Lowe, A./Willis, P. (Hrsg.): Culture,
Media, Language. Working Papers in Cultural Studies 1972–79, London/New York,128-138. Hall, S. (2000): Postmoderne und Artikulation. In: Hall, S. (Hrsg.): Cultural Studies. Ein politisches
Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3, Hamburg, 52-77. Hay, J./Packer, J. (2004): Crossing the Media(-n): Auto-Mobility, the Transported Self and Techno-
logies of Freedom. In: Couldry, N./McCarthy, A. (Hrsg.): Mediaspace. Place,Scale and Culture in a Media Age, London u.a., 209-232.
Hepp, A. (2004a): Cultural Studies und Medienanalyse. Eine Einführung. Zweite Auflage.Wiesbaden.
Hepp, A. (2004b): Networks of the Media. Media Cultures, Connectivity and Globalization. In: AS-NEL (Hrsg.): Cross/Cultures: Global Fragments – Dis-Orientation In The New World Order, Frankfurt.
Hepp, A. (2004c): Netzwerke der Medien. Medienkulturen und Globalisierung. Reihe „Medien – Kultur – Kommunikation“. Wiesbaden.
Hepp, A. (2005): Translokale Medienkulturen: Netzwerke der Medien und Globalisierung. In: Hepp, A./Krotz, F./Moores, S./Winter, C. (Hrsg.): Netzwerk, Konnektivität und Fluss. Analysen ge-genwärtiger Kommunikationsprozesse. Wiesbaden, in Vorbereitung.
Hepp, A. et al. (Hrsg.) (2005a): Netzwerk, Konnektivität und Fluss. Analysen gegenwärtigerKom-munikationsprozesse. Wiesbaden.
Hepp, A.,/Krotz, F./Winter, C. (Hrsg.) (2005b): Globalisierung der Medien. Eine Einfüh-rung.Wiesbaden.
Hepp, A./Krotz, F./Winter, C. (2005c): Einleitung. In: Hepp, A./Krotz, F./Winter, C. (Hrsg.):Globalisierung der Medien. Eine Einführung. Wiesbaden, 2-17.
Hepp, A./Vogelgesang, W. (2005): Medienkritik der Globalisierung. Die kommunikative Vernetzung der globalisierungskritischen Bewegung. In: Hepp, A./Krotz, F./Winter, C. (Hrsg.): Globalisie-rung der Medien. Wiesbaden, 229-260.
Hepp, A./Winter, C. (2003): Cultural Studies als Projekt: Kontroversen und Diskussionsfelder. In: Hepp, A./Winter, C. (Hrsg.): Die Cultural Studies Kontroverse. Lüneburg, 9-32.
Innis, H.A. (1997): Kreuzwege der Kommunikation. Ausgewählte Texte. Wien/New York. Jarren, O. (1987): Kommunikationsraumanalyse — Ein Beitrag zur empirischen Kommunika-
tionsforschung? In: Bobrowsky, M./Langenbucher, W.R. (Hrsg.): Wege zur Kommuni-kationsgeschichte, Frankfurt a.M./Berlin: 560-588.
Johnson, R. (1986): What is Cultural Studies Anyway? In: Social Text 16, 38-80. Johnson, R. et al. (2004): The Practice of Cultural Studies: A Guide to the Practice and Politics of
Cultural Studies. London u.a. Karmasin, M. (2004): Paradoxien der Medien. Wien. Kleinsteuber, H. J. (1992): Zeit und Raum in der Kommunikationstechnik. Harold A. Innis‘ Theorie
des ‚technologischen Realismus‘. In: Hömberg, W./Schmolke, M. (Hrsg.): Zeit,Raum, Kommu-nikation. München, 319-336.
Kleinsteuber, H.J./Rossmann, T. (Hrsg.) (1994): Europa als Kommunikationsraum. Akteu-re,Strukturen und Konfliktpotenziale in der europäischen Medienpolitik. Unter Mitarbeit von Arnold C. Kulbatzki und Barbara Thomaß. Opladen.
Krätke, S. (2002): Medienstadt. Urbane Cluster und globale Zentren der Kulturproduktion.Opladen. Krotz, F. (2005): Von Modernisierungs-über Dependenz-zu Globalisierungstheorien. In: Hepp,
A./Krotz, F./Winter, C. (Hrsg.): Globalisierung der Medien. Eine Einführung,Wiesbaden, 21-44. Lévy, P. (2001): Cyberculture. Minneapolis. Loader, B. et al. (2004): Cyberculture: The Key Concepts (Routledge Key Guides). London
u.a. Löfgren, O. (2001): The Nation as Home or Motel? Metaphors of Media and Belonging. In: Sosiologisk Årbok 2001, 1-34.
Luhmann, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bde. Frankfurt a.M. McLuhan, M./Fiore, Q. (1968): War and Peace in the Global Village. New York. Morley, D. (1996): EurAm, Modernity, Reason and Alterity. Or, Postmodernism, the HighestStage
of Cultural Imperialism? In: Morley, D./Chen, K.-H. (Hrsg.): Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies. London/New York, 326-360.
Morley, D. (2000): Home Territories. Media, Mobility and Identity. London, New York.
14
Morley, D. (2003): Die ‚sogenannten Cultural Studies‘. In: Hepp, A./Winter, C. (Hrsg.): Die Cultural Studies Kontroverse. Lüneburg, 111-136.
Morris, M. (2003): Das Banale in den Cultural Studies. In: Hepp, A./Winter, C. (Hrsg.): Die Cultural Studies Kontroverse. Lüneburg, 51-83.
Pries, L. (2001): Internationale Migration. Münster. Quandt, T. (2005): Journalisten im Netz. Wiesbaden. Ritzer, G. (1998): The McDonaldization Thesis. London u.a.
Schenk, M. (1983): Meinungsführer und Netzwerke persönlicher Kommunikation. In: Rund funk und Fernsehen 31, 326-336.
Schenk, M. (1995): Soziale Netzwerke und Massenmedien. Untersuchungen zum Einfluss der persönlichen Kommunikation. Tübingen.
Silver, D. (2000): Looking Backwards, Looking Forwards: Cyberculture Studies 1990-2000. In: Gauntlett, D. (Hrsg.): Web.Studies. Rewiring Media Studies for the Digital Age. London, 19–30.
Sinclair, J./Jacka, E./Cunningham, S. (1996): Peripheral Vision. In: Sinclair, J./Jacka, E./Cun-ningham, S. (Hrsg.): News Patterns in Global Television. Oxford, 1-32.
Storey, J. (2000): Cultural Studies: The Politics of an Academic Practice; an Academic Practice as Politics. In: Baetens, J./nLambert, J. (Hrsg.): The Future of Cultural Studies. Leuven, 61-71.
Thiedeke, U. (Hrsg.) (2004): Soziologie des Cyberspace. Handbuch zu Medien, Strukturen und Semantiken. Wiesbaden.
Tomlinson, J. (1999): Globalization and Culture. Cambridge, Oxford. Tomlinson, J. (2005): „Your Life – To Go“ Der kulturelle Einfluss der neuen Medientechnologien. In:
Hepp, A./Krotz, F./Moores, S./Winter, C. (Hrsg.): Netzwerk, Konnektivität und Fluss. Analysen gegenwärtiger Kommunikationsprozesse. Wiesbaden, in Vorbereitung.
Urry, J. (2003): Global Complexity. Cambridge u.a. Wark, M.K. (1994): Virtual Geographies: Living with Global Media Events. Bloomington. Watts, D.J. (2004): Small Worlds: The Dynamics of Networks Between Order and Randomness
(Princeton Studies in Complexity). Princeton. Weber, S. (2001): Medien-Systeme-Netze. Elemente einer Theorie der Cyber-Netzwerke.Bielefeld. Wellman, B. (2000): Die elektronische Gruppe als soziales Netzwerk. In: Thiedeke, U. (Hrsg.):
Virtuelle Gruppen. Charakteristika und Problemdimensionen. Wiesbaden,134-167. Wellman, B. et al. (1996): Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work,Telework,
and Virtual Community. In: Annual Review of Sociology 22, 213-238. Winter, C. (1996): Predigen unter freiem Himmel. Die medienkulturellen Funktionen der Bet-
telmönche und ihr geschichtlicher Hintergrund. Bardowick.