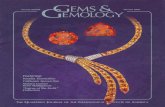Poster_A0-Gr-n.-Netzwerk v2.indd - SIFO.de
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Poster_A0-Gr-n.-Netzwerk v2.indd - SIFO.de
Jahrestreffen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“Mit dem Graduierten-Netzwerk „Zivile Sicherheit“ unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses und den interdisziplinären Austausch in der zivilen Sicherheitsforschung.
Am 18. Juni 2018 fand im Vorfeld des BMBF-Innovationsforums „Zivile Sicherheit“ das Jahrestreffen des Graduierten-Netzwerks im Café Moskau statt. Im Mittelpunkt des Jahres-treffens standen dabei die alltäglichen Herausforderungen in der Forschungs- und Projekt-arbeit sowie der persönliche und fachliche Austausch. Über 80 Nachwuchswissenschaft-lerinnen und Nachwuchswissenschaftler haben sich dazu im Rahmen von moderierten Kleingruppen zu ihren aktuellen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten ausgetauscht.
Das Graduierten-Netzwerk „Zivile Sicherheit“ ist ein offenes Netzwerk, in dem alle Nach-wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der zivilen Sicherheitsforschung eingeladen sind, sich aktiv zu engagieren.
Aktuelle Informationen und Hinweise zu weiteren Aktivitäten des Graduierten- Netzwerks „Zivile Sicherheit“ fi nden Sie unter: www.sifo-graduierten.de
© BMBF/VDI Technologiezentrum GmbH– Jörg Carstensen
© BMBF/VDI Technologiezentrum GmbH– Jörg Carstensen
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitsprozeduren
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Mitgestaltung/Entwicklung von Prozeduren zur Erhöhung von Sicherheit. Bspw.: Kommunikationsstrategien, Handlungsleitfäden, Trainingskonzepte, Verfahren zur Verbesserung der Zusammenarbeit, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Inner- und interdisziplinäre Verständnisprobleme
• Verwertbarkeit der Forschungsergebnisse
• Interessenskonflikt zwischen politischer Agenda und Freiheit der Forschung
• Forschung kommt der Praxis nicht hinterher, da die Praxis zu dynamisch ist
• Der Feldzugang ist schwierig
• Interessenskonflikt: Sicherheitsthemen und Publikation (Geheimhaltung)
Kooperation kommunaler Akteur*innen der Entwicklung und Anwendung diversitätsorientierter Sicherheitsstrategien im Wohnumfeld und öffentlichen Raum sowie Digitalisierung von Überwachungs- und Wissenspraktiken der NYPD qualitative sozialwissenschaftliche Methode Expert*inneninterviews, Dokumentenanalyse, BegehungNiklas Creemers, DIFU, Berlin
Prognoseforschung, Radikalisierungsprozesse und -faktoren, sowie Risikomanagement (RadigZ)Mixed Methods, Qual. Expert*inneninterviews, Biografieforschung anhand von Probanden und egozentrierter Netzwerkanalyse; rechtliche Einordnung Miriam Meyer, Georg-August-Universität Göttingen, Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie
Gestaltung von Prozesssicherheit in der Unternehmensarchitektur Sicherheitserweiterungen im Enterprise Architecture Management und Prozess Management (InPoSec EU Driver+)Michael Middelhoff, Universität Münster
Vulnerabilität und Obsoleszenz von technischen Infrastrukturen: Fluidität von Prozessen am Beispiel von High-Reliability Organisations (DFS)Mixed Methods: Prozessanalyse (KPI), Qualitative Interviews, Quantitativer SurveySasha Skudelny, Universität Siegen, Institut für Medienforschung, Institut für Mikrosystemtechnik
IS-Richtlinie: Europäische Strategie zum Schutz von KRITIS Empirische Studie und Erarbeitung einer Typologie der policy Ansätze und policy AssessmentSusanne Zels, FU Berlin
Cybersicherheit erlebbar machen, um Awareness zu erhöhen (Fokus: öffentlicher Sektor)Public Cyber Security Lab, Multimodale Interaktion, Psycho-Physiologische MethodenOtto Lutz, Fraunhofer FOKUS, A. Weizenbaum Institut
Akteure/Institutionen/Organisationen in Vorbereitung und Bearbeitung biologischer Lagen (Infektion/Intoxikation) sowie Risikowahrnehmung/Kommunikation, Governance risikobehafteter Forschung (Nachwuchsgruppe BIOAUGE)Governance-Theorien, vorwiegend qualitative Forschung, Skalierung für Qualifizierung in Analyse-SoftwareGunnar Jeremias, Universität Hamburg, ZNF/INFABRI, Leiter der Nachwuchsnetzwerkgruppe BIOAUGE
Methoden zur Evaluation von (Stabs-Rahmen-)ÜbungMixed Methods, Prozessanalyse , KPI, Sozial-wissenschaftliche MethodenPatrick Drews, Universität Stuttgart, Fraunhofer IAO/IAT
Rekommunalisierung von nicht-polizeilichen Sicherheitsleistungen (Rekon-S)Reflexion, Interviews, Einbeziehung von Unternehmen und VerwaltungTom Hasport, Feuerwehr Hannover, BF Offenbach
Massenanfall an Erkrankten im Hamburger HafenQualitative Analyse, Prozessanalyse und -entwicklung, strukturierte Interviews, Entwicklung von Stabs- und GroßübungenDr. Simon Bakir, Universitätsmedizin Greifswald
Analyse und Entwicklung von strategischer Kommunikation als Werkzeug gesellschaftlicher Kontinuität in Sonderlagen (KONTIKAT)Qualitative Methoden der Medienwissenschaften , CSCW (Wirtschaftsinformatik)Amanda Langer, Universität Siegen
Katastrophenschutz für Menschen mit BehinderungPhilosophische Analyse der Perspektive einer gerechten Verteilung von (Katastrophen)SicherheitFriedrich Gabel, Universität Tübingen, IZEW
Gesuche:• Suche: Betreiber von Cybersicherheitslaboren/ Showrooms (Otto Lutz, Fraunhofer FOKUS)
• Suche: Stabs-Rahmen-Übungen zur Evaluation (Patrick Drews Uni Stuttgart IAT)
• Suche: Unternehmensarchitekt mit Sicherheitsinteressen (in der Logistik oderProzessgestaltung) (Michael Middelhof, Uni Münster)
• Suche: Experten mit Erfahrung im Bereich Outsourcing (Tom Hasport, FeuerwehrHannover)
• Suche: Experten für medizinische Großschadenslagen (Simon Bakir, Uni Greifswald)
• Suche: Methoden für Policy Assessment von Resilienz bei KRITIS (Susanne Zels, FU Berlin)
• Biete: Zugang zu Anwendern im Bereich KRITIS (Energie&Wasser) (Susanne Zels, FUBerlin)
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitsperspektiven
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Erschließung/Einbringung von neuen Pers-pektiven der Sicherheitsforschung.Bspw.: ethische, rechtliche, sozialwissenschaftliche Perspektiven, neu-artige Forschungsmethoden/-designs, bisher vernachlässigte Themen, neue Herausforderungen, Grund-fragen von Sicherheitsforschung, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Standing of the shoulder of giants (Notwendigkeit von Lernen aus Literatur von anderen
(früheren Projekten)
• Reflexion der Begriffe: Sicherheit, Risiko, Gefahren
• Angewandte Forschung braucht auch grundlagenorientierte Forschung (Verständigungüber Konzepte wie etwa Sicherheit, Vulnerabilität, Resilienz)
• Zielgruppenorientierte Kommunikation von Ergebnissen und offenen Fragen/ Punkten
• Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit
Gesuche:• Netzwerk von (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen im Bereich
Sicherheitsforschung sichtbarer machen (Bsp. Katnet)
• Interdisziplinären Austausch und disziplinäre Exzellenz weiterhin stärken
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Individuelle Entwicklungsdynamiken von Radikalisierung (PANDORA) Qualitative Inhaltsanalyse, Objektive Hermeneutik, Aktenanalyse, Auswertung von Daten aus sozialen MedienMika Moeller, Technische Universität Berlin, Zentrum für Technik & Gesellschaft
Abwehr von Betrug und ManipulationGrundlagenorientiert und wirtschaftsvernetzend, Interdisziplinäres Wissen in Verbindung mit praxisorientiertem MethodenwissenMatthias Schmidt, IT-Transfusion, Berlin
Governance biologischer Hochrisikoforschung, Theorie und konzeptuelle VerbesserungQualitative Methoden (Interviews, Dokumentenanalyse, ethnologische Methoden)Jan Opper, Universität Hamburg, ZNF
Beobachten der Technikentwicklung als Journalistin und Forschung an der Frage wie und ob Big Data diskriminiertExpert*inneninterviews zu Big-Data DiskriminierungEva Köhler, NDR, Tech-Journalistin
Präventive digitale SicherheitskommunikationAnalyse bestehender „Narrative“ bezüglich Zivilcourage, Vermittlung von Werten & Normen durch das Erzählen von „Geschichten“Matteo Riatti, Hochschule der Medien, Institut für digitale Ethik
Diffusion der Konzepte Vulnerabilität und Resilienz und den verschiedenen Perspektiven der Risiko- und Sicherheitsforschung Auswertung von englisch-sprachigen Veröffentlichungen mit Resilienz oder Vulnerabilität im TitelCelia Norf, TH Köln, Institut für Rettungsingenieurswesen und Gefahrenabwehr
Soziologische Perspektiven auf Kontinuität und Wandel in Zivilgesellschaft (Konkret: Notbevorratung) und KMU (Vorsorgekonzepte und Vernetzung von KMU/BOS)Soziologisch qualitative Methoden (Interviews, Beobachtungen) und InteraktionsforschungDr. Maren Schorch, Universität Siegen, BMBF Nachwuchsforschergruppe KONTIKAT
Resilienz durch sozialen Zusammenhalt: Sozialräumliche Entstehungsbedingungen von sozialem Zusammenhalt im städtischen und ländlichen Raum (ResOrt)Bevölkerungsumfrage, Lost-Letter-Experiment Bo Tackenberg, Bergische Universität Wuppertal, Lehrstuhl Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe, Objektsicherheit
Verhältnis von Risikowahrnehmung und Disruptionspotential im professionellem Diskurs zu biologischen Risiken (BIGAUGE) Qualitative Expert*inneninterviews und DokumentenanalyseHares Sarwary, Universität Hamburg
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitsprozeduren
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Mitgestaltung/Entwicklung von Prozeduren zur Erhöhung von Sicherheit. Bspw.: Kommunikationsstrategien, Handlungsleitfäden, Trainingskonzepte, Verfahren zur Verbesserung der Zusammenarbeit, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Die „Säulen der Sicherheitsforschung“ sind eine Komplexitätsreduktion. Das muss stets
mitgedacht werden, sonst ist es eine problematische Vereinfachung
• Die Säulen der Sicherheitsforschung erzeugen einen Anpassungsdruck, derkontraproduktiv und hemmend für bestimmte Perspektiven und Forschungsfragen seinkann
• Zusammenarbeit als Anwender mit Universitäten ist schwierig, da keine personelleKontinuität gewährleistet ist
• Internationaler Austausch von Forschungsergebnissen
• Praktische Implementierung von Forschungsergebnissen
Gesuche:• Abschlussbericht besser finanziell und zeitlich unterstützen
• Projektpauschale oder Verwaltungskosten sollten für alle Partner*innen gewährt werden
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Wasserversorgung in Notsituationen System Dynamics Modellierung und BevölkerungsbefragungLisa Bross, Universität der Bundeswehr, Institut für Wasserwesen
Fachdialog Sicherheitsforschung der Geistes- und Sozialwissenschaften – Veranstaltungsplanung, AdministrationOrga, Akquise, MarketingFriederike Schreiber, Universität Freiburg, Center for Security and Society
Interorganisationale Zusammenarbeit zwischen BOS und anderen Beteiligten, mit dem Schwerpunkt Informationsmanagement Netzwerkanalyse, Beobachtung von Realsituationen und Übungen; Einbindung von Anwendern im Rahmen von WorkshopsAndreas Lotter, Universität Wuppertal, Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz
Maritime Sicherheit & Gefahrenabwehr; Verkehrsträgerübergreifende Sicherheit; Human Factors & (Teil-)autonome Systeme Nautischer Schiffsoffizier, Simulation, 3D-Game Engines, Web-Based Learning, Ressource-Management-KurseGerrit Tuschling, Hochschule Wismar, Bereich Seefahrt; Rostock/Warnemünde
Organisationale Fragestellungen & Entwicklung technischer Unterstützungssysteme für den maritimen SAR-DienstQuantitative und Qualitative Methoden aus Soziologie und Erziehungs-wissenschaft, u.a. Videographie, Sekundärdatenanalyse, Feldversuche Thomas Lübcke, DGzRS, F+E
Massenanfall von Verletzten auf See und im HafenWissenschaftliche und praktische KonzeptentwicklungEsther Henning, Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Unfallchirurgie
Veranstaltungssicherheit und Koordination; Unternehmenssicherheit, Arbeits- und BrandschutzEntwicklung generischer resilienter Konzepte, die szenarienorientiert sind oder Situationsbezogen angewandt werden könnenManuel Huber, Veranstaltungssicherheit (selbstständig)
Ethische Dimensionen und Fragestellungen um Spannungsfeld Katastrophenschutz und Menschen mit PflegebedarfEthische Reflexionen, Evaluationen und Beratung der Partner*innen zu ethischen Fragen bereits im ProjektDr. Marcel Vondermassen, Universität Tübingen, IZEW
Organisatorische und individuelle Sicherheitspraktiken/ SicherheitskommunikationInterviews, Umfragen, Social Media AnalyticsThea Riebe, Universität Siegen, Computer Supported Cooperative Work
Unternehmenssicherheit; Corperate Security (Betriebswirtschaftliche Perspektive)Qualitative und quantitative Forschung in Zusammenarbeit mit UnternehmenspartnernAnna Schleicher, Technische Hochschule Ingolstadt, Business School
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitstechnik
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Mitgestaltung/Entwicklung von Sicherheits-technologien. Bspw.: Gefahrenerkennungs-, Bewältigungs-, Unterstützungs-, Sicherheitstechnik, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Interdisziplinäre Kommunikation und Methoden
• Interdisziplinarität versus Spezialwissen
• Beschaffung grundlegender Daten und Informationen
• Wunsch versus Wirklichkeit
• Kommunikation im interdisziplinären Projekten
• Daten und Manipulationssicherheit
Gesuche:• Interviewmethoden für Ingenieure (Steffen Franz – TU Darmstadt)
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Digitalisierung der Tatortarbeit – Optimierung der Datenaufnahme und DokumentationAus der Perspektive der Bau-InformatikSteffen Franz, TU Darmstadt
Entwicklung eines Verfahrens zur Identifizierung von Nanopartikeln zur Detektion von im TrinkwasserAus der Perspektive der Bio-PhysikStefan Achtsnicht, Forschungszentrum Jülich
IT-Sicherheit, Anonyme Kommunikation, Darknet PrivacyAus der Perspektive der MathematikMarcel Schäfer, Fraunhofer SIT Darmstadt
Forensische Methoden im DarknetAus der Perspektive der InformatikKatharina Haselhorst, Fraunhofer SIT Darmstadt
Mathematische Modelle zur Krankheitsausbreitung sowie Risikomodellierung von biologischen GefahrenAus der Perspektive der MathematikBirte Schmidtmann, Universität Hamburg
Design und Nutzung kollaborativer Technologien in Krisenlagen Business Continuity Management für KMUAus der Perspektive der InformatikMarc-André Kaufhold, Universität Siegen
Visualisierung Front-End Usability für EntschärfungenAus der Perspektive der InformatikJochen Nelles, RWTH Aachen
Übungsplanung und Evaluation in der Gefahrenabwehr Aus der Perspektive der IngenieurwissenschaftenTim Brüstle, TH Köln
Antennendesign und SignalverarbeitungAus der Perspektive der ElektrotechnikDi Shi, Uni Freiburg
Schadensanalyse von technischen TextilienAus der Perspektive der IngenieurwissenschaftenAnnett Schmieder, Technische Universität Chemnitz
Asynchrone, computervermittelte Kommunikation unter der Bedingung reduzierter HinweisreizeAus der Perspektive der MedienpsychologieAlexandra Lux, Fraunhofer SIT
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitstechnik
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Mitgestaltung/Entwicklung von Sicherheits-technologien. Bspw.: Gefahrenerkennungs-, Bewältigungs-, Unterstützungs-, Sicherheitstechnik, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Festlegung des Bedrohungsszenarios
• Erwartungshaltung der Anwender (z.B. „eierlegende Wollmilchsau“)
• Dünne oder nicht vorhandene Datengrundlage
• Konkurrenz und Wettbewerb zwischen Forschungseinrichtungen
• Mangelnde Kooperationsbereitschaft (von Firmen und Anwendern)
• Anwendungsorientierte Forschung braucht auch Raum für Grundlagenforschung
Gesuche:• Schaffung von Formaten für den Austausch thematisch verwandter Projekt
• Festlegung von Richtlinien für interdisziplinäre Projekte
• Feste Verankerung der „Phase Null“ im Projektmanagement
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Rechtliche Begleitforschung zur zivilen Drohnenabwehr (Grundrechtebetroffenheit und Eingriffsbefugnisse) Grundrechteprüfung, Analyse polizeilicher Eingriffsbefugnisse, Aufstellen von Voraussetzungen für EingriffsbefugnisseSusanne Schuster, FÖPS Berlin, HWR Berlin
Rechtliche Aspekte der polizeilichen Durchleuchtung von Gegenständen zur Detektion von USBVRechtliche Analyse verfassungsrechtlicher Anforderungen an polizeiliche Eingriffsbefugnisse und Anforderungen an ggf. Verwendung als Beweismittel in StrafverfahrenViktoria Rappold, FÖPS Berlin, HWR Berlin
Kooperativer Formationsflug und verteilte Steuerung von Quadrocoptern/Drohnen (indoor/outdoor)Simulation und Erprobung unter Realbedingungen Julian Rothe, Universität Würzburg
Konstruktion von textilen Maschinenelementen sowie Entwicklung von Prüftechnikinterne und externe Entwicklung, interne Prüfung von textilen Maschinenelementen FeldversucheDirk Fischer, Technische Universität Chemnitz, Professur für Fördertechnik
Rechtliche Begleitung der Entwicklung eines Assistenzsystems zur Detektion und Abwehr von DrohnenInterpretation von Gesetzen, Auswertung von Rechtsprechung und LiteraturEva Skobel, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Lehrstuhl für öffentliches Recht und Informationsrecht
Digitalisierung der Tatortarbeit als Grundlage der TatortdokumentationErstellung digitaler räumlich-semantischer Modelle, Vor-Ort-Datenaufnahme, räumliche Rekonstruktion – TatortmodellRobert Irmler, TU Darmstadt, Institut für Informatik im Bauwesen
Explosionshemmende Wirkung von HeckenpflanzenExperimentelle Untersuchungen, numerische Modellbildung und SimulationPaul Warnstedt, Universität der Bundeswehr München, Institut für Mechanik und Statik
Personenstromsimulation – Auswirkungen von Bewegungen von Menschenmengen, Untersuchung der Navigation von Menschenmengen Modellierung und Simulation, Experimentelle Untersuchung im Labor und Freifeld, StatistikauswertungBenedikt Zönnchen, Hochschule München
Definition von Bedrohungsszenarien durch den Missbrauch von Drohnen und rechtliche Betrachtungen zum Einsatz von Drohnendetektion und AbwehrmöglichkeitenRisikoanalyse von Bedrohungssituationen (technische Möglichkeit von Drohnen)Rico Pelz, European Aviation Security Center
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitsperspektiven
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/Erschließung/Einbringung von neuen Pers-pektiven der Sicherheitsforschung. Bspw.: ethische, rechtliche, sozialwissenschaftliche Perspektiven, neu-artige Forschungsmethoden/-designs, bisher vernachlässigte Themen, neue Herausforderungen, Grund-fragen von Sicherheitsforschung, etc.
Zentrale Fragen und Herausforderungen• Stärkere Verknüpfung der Bedarfe der einzelner Forschungsakteure auf zentraler Ebene,
um Synergieeffekte zu nutzen
• Zusammenarbeit mit Dritten: Bedenken bezüglich Herausgabe von Daten für Projekte
• Stärkere Unterstützung bei der Vernetzung mit Akteuren, die Wissen/Erfahrung zumeigenen Themenbereich beisteuern können
• Die drei Bereiche der Sifo bieten zu wenig Raum für andere Perspektiven
• Optimierung der Umsetzungskompetenz und Befähigung zum Transfer vonForschungsergebnissen in die Praxis
Gesuche:• Suche: Expert*innen internationaler Organisationen (der humanitären Hilfe) zu den
Themen „sozialer Zusammenhalt“ und „soziales Kapital“ (Carolin Borgmann, Ruhr-Universität Bochum)
• Suche: Expert*innen im Bereich Radikalisierung, v. a. Programme auf kommunaler Ebene(Philip Sendrowski, Fraunhofer INT)
• Suche: Unterstützung zur Fragestellung „Wie kann man die wirtschaftlichen Auswirkungenvon Schadensereignissen berechnen / kalkulieren?“ (Jürgen Harrer, EBS UniversitätWiesbaden/Oestrich-Winkel)
• Suche: Austausch zu den Themen „Sicherheitsherausforderungen durch Digitalisierung/ Technologisierung“ und “Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen (z. B. auf zukünftigeEntscheidungen)“ (Julia Giessler, EBS Universität für Wirtschaft und Recht)
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Einfluss von sozialen und städtebaulichen Aufwertungsmaßnahmen auf Kriminalität und subjektives Sicherheitsempfinden (Stadtentwicklung und Kriminalitätsfurcht)Quantitative Befragung, quantitative Auswertung von Sozial- und Kriminalitätsdaten, qualitative ExperteninterviewsMoritz Quel, Bergische Universität Wuppertal
Innovationsmanagement für öffentliche Auftraggeber im Bereich zivile Sicherheit, Krisenmanagement und grenzüberschreitende Kooperation Hauptsächlich qualitativ (Workshops, Interviews, Literaturrecherche), teilweise quantitativ (Big data-Analyse)Philip Sendrowski, Fraunhofer INT
Förderung der Vernetzung, schwerpunktmäßig der Geistes- und Sozialwissenschaften, in der zivilen SicherheitsforschungFormate: Konferenzen, Workshops etc. (Konzeption und Organisation) Andrea Absenger, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Unterstützende Stelle des Fachdialogs Sicherheitsforschung, Centre for Security & Society
Reaktionen von Unternehmen auf Sicherheitsvorfälle vor dem Hintergrund der Digitalisierung / TechnologisierungPrimärdaten: Interviews und Case Studies Sekundärdaten: Nachrichten und AktienkursentwicklungenJulia Giessler, EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Notfall- und Krisenmanagement am Beispiel von Verschüttetensuche und GroßschadenslagenInterdisziplinäre und anwenderorientierte Anforderungsermittlung und Konzeptentwicklung, Evaluationen in Labor- und RealübungSebastian Schmitz, TH Köln, Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr
Stärkung von sozialem Zusammenhalt und der Resilienz der Bevölkerung sowie der Rolle von Organisationen (formell/informell) Sozialwissenschaftlicher Zugang, Literaturrecherche, Expert*inneninterviews, schriftlich-postalische Bevölkerungsumfrage und Lost Letter ExperimentCarolin Borgmann, Institut für Friedenssicherungsrecht & Humanitäres Völkerrecht, Ruhr-Universität Bochum
Betriebswirtschaftliche Perspektive auf die Fragen „Wie kann man Sicherheit messen?“, „Welchen Mehrwert bringt Sicherheit?“ Qualitative Expert*inneninterviews, Fallstudien, Fokusgruppen (Entwicklung) und Action-Research (Modelltest)Jürgen Harrer, EBS Universität Wiesbaden/Oestrich-Winkel Forschungsdirektor Security und Management
Rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer Gefahrenlage und polizeiliche Gefahrenprognosen im Bereich Staatsschutz und Terrorismus Rechtliche Perspektive auf polizeiliche Gefahrenprognosen im Bereich Staatsschutz und TerrorismusMaja Werner, FH Polizei Sachsen-Anhalt
Aktuelle Forschungsthemen des Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“
Forschungsthemen der Graduierten mit Schwerpunkt: Sicherheitsakteure
Die Forschung widmet sich der Beforschung/Identifizierung/ Berücksichtigung/Einbindung von Ak-teuren, die für Sicherheitshandeln als wichtig erachtet werden. Bspw.: Ungebundene/freiwillige Helfer*innen, bürgerschaftliches Sicherheitsengagement, private Sicherheitsdienstleister, etc.
Zentrale Fragen und HerausforderungenHerausforderungen auf Seiten der Praxispartner • Mangelnde Ressourcen/Bewusstsein für Forschung sowie hohe Einstiegshürden• Unterschiedliche Erwartungen an Forschungsergebnisse (im Vergleich zu den Forschenden)• Anwender*innen sehen sich selbst nicht als sicherheitsrelevant, v. a. wenn privat• Grenzen zwischen staatlichen und privaten Akteuren führen zu Ängsten statt zu Zusammenarbeit• Forschungsergebnisse finden nicht immer nachhaltigen Eingang in Praxis• Angst vor negativen Ergebnissen/Imageverlust
Herausforderungen auf Seiten der Forschung• Sicherheit als sensibles Thema: Datenschutz, Zugang zur Zielgruppe und zu Daten, Geheimhaltung• Feldabgrenzung schwierig: Sicherheit als Querschnittsthema, welches viele Bereiche berührt• Hohe Fluktuation des Personals aufgrund befristeter Verträge erschweren Wissensweitergabe• Keine Förderung von Managementaufgaben
Gesuche:• Suche: Expertise Aushandlungsprozesse (A. Schuchardt)
Doktorvater im Bereich Techniksoziologie (S. Lamprecht)
• Biete: Zugang zu privaten Sicherheitsdienstleistern (K. Wiegand)Psychosoziale Belastungen von Einsatzkräften (nicht polizeilich) (A. Schuchardt)
• Einrichtung einer übergeordneten/unabhängigen Instanz für ethische und rechtlicheFragen → z. B. KEF; bilden Gremien mit interdisziplinärer Zusammensetzung; auffreiwilliger Basis; bisher haben 80 Universitäten teilgenommen
Schutz vor Kriminalität und Terrorismus
Schutz kritischer Infrastrukturen
Schutz und Rettung von Menschen
Weitere Fragen der Sicherheitsforschung
Bevölkerung zur Installation von Einbruchsschutz aktivieren – via APP und ohne Kriminalitätsfurcht zu erzeugen (Kommunikation von Einbruchrisiken) Quantitative App-Umfrage (Panel)-Evaluation Selma Lamprecht, Weizenbaum Institut und Fraunhofer FOKUS Berlin
Sicherheit in U-Bahnen und KommunikationsstrukturenPraxistest (Großübung) und WorkshopsAnja Kleinebrahn, Berliner Feuerwehr, Bereich Forschungsprojekte
Beitrag ziviler Sicherheitswirtschaft – Kooperationen mit der Polizei – neue Geschäftsmodelle/Tätigkeitsfelder privater Sicherheitsdienstleister Umfragen – Expertenworkshops – Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis Kirsten Wiegand, Referentin für Sicherheitsforschung, BDSW-Bundesverband der Sicherheitswirtschaft
Multi-Level Security Governance biologischer Gefahren (natürliche Ausbrüche, Unfälle, Terrorismus) (BIGAUGE)Governance-Analyse, Dokumentenanalyse insbesondere „Graue Literatur“, Experteninterviews/-workshops, Fragebögen (insbesondere Behörden) Helge Martin, Universität Hamburg, Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung
Projekt DiverCity (Kommunalperspektive) – Akteure (Kooperationen optimieren; Kooperationsstrukturen: Best Practice) der Diversität UND Sicherheit (diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien) Qualitativ: Experteninterviews, Fokusgruppen, Internationaler Workshop Quantitativ: 3-stufige Kommunalbefragung in allen Kommunen in Deutschland mit mehr als 50.000 Einwohnern Gabriel Bartl, Forschungsbereich Infrastruktur und Finanzen
Bevölkerungseinbindung (aktiv) in die Gefahrenabwehr – Eigenvorsorge Thema – Kritis BehördeForschungsergebnisse umsetzen Projektbeteiligung – Bezirksamt/Kommune als Praxispartner – Bevölkerungsbeteiligung Robert Zückmantel, Bezirksamt Lichtenberg von Berlin – Bereich Katastrophen- und Zivilschutz – Katastrophenschutzbeauftragter
Digitale Freiwillige, Partizipationsformen und Nutzung von Social Media – Analytics in der GefahrenabwehrFeldforschung – Workshops – quantitative und qualitative Methoden Ramian Fathi, Bergische Universität Wuppertal, Lehrstuhl Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objekt-sicherheit + Virtual Operations Support Team (VOST)
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Katastrophenschutz: Beispiel Deutschland-Frankreich-Fokus; interorganisationale Zusammenarbeit – Szenario: langanhaltender, flächendeckender StromausfallExpertenworkshops mit Experten aus DE und FR –Experteninterviews Yannic Schulte, Bergische Universität Wuppertal, Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit
Verbesserung polizeilicher Abläufe/Praktiken – Evidenzbasiertes Handeln Vernetzung mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und mit weiteren Anwendern Benjamin Schmidt, Geschäftsführer eines Forschungsinstituts (zukünftig Single Point of Contact der Berliner BOS zu Fragen der Sicherheitsforschung)
Kommunikation und Koordination mit/von Spontanhelfern – Bindung von Ehrenamtlichen – ambulante Versorgung von Pflege- und Hilfsbedürftigen im KrisenfallSozialwissenschaftliche Methoden (quantitativ und qualitativ)Rebecca Nell, Universität Stuttgart, Fraunhofer IAO/IAT
Schutz kritischer Infrastrukturen durch Überwachungstechnik, TunnelüberwachungEntwicklung von Bildverarbeitungsmethoden – Verkehrsanalyse – Risikoabschätzung Adrian Fazekas, RWTH Aachen
Schutzziele kritischer Infrastrukturen, Fokus auf dem Bereich Ernährungsnotfallvorsorge Expertenworkshops, in dem der Aushandlungsprozess eines Schutzziels analysiert wird Agnetha Schuchardt, FU Berlin, AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung