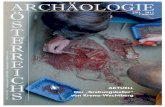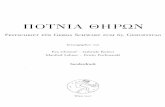Archäologische Baubegleitung im Erdgeschoss der Domschule von Güstrow
J. Schneeweiß, Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla, Archäologische Berichte des...
Transcript of J. Schneeweiß, Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla, Archäologische Berichte des...
Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg(Wümme)
Band 16
Herausgegeben im Auftrag des Landkreises Rotenburg (Wümme) und derArchäologischen Gesellschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) e. V. durch
Stefan Hesse
2010
KommissionsverlagIsensee Verlag, Oldenburg
Die Archäologischen Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) erscheinen alsOrgan des Landkreises Rotenburg (Wümme). Seit 2000 werden sie gemeinsam mit derArchäologischen Gesellschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. herausgegeben.
Die Archäologischen Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) wurden 1990von W.-D. Tempel begründet.
Für den Inhalt der Beiträge, die Gestaltung der Abbildungen und deren Nachweissind die Autoren verantwortlich.
Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi-bliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.deabrufbar.
ISSN: 0946-8471
Redaktion: Stefan Hesse, Uwe Meitzner, Wolf-Dieter TempelSatz und Layout: Stefan Hesse mit LATEXÜbersetzungen: Frauke Schindel (FS)Umschlaggestaltung: Uwe Meitzner und Stefan Hesse (Grabungssituation RotenburgFStNr. 247)Druck und Binden: Isensee GmbH, Oldenburg
Printed in Germany© 2010 Landkreis Rotenburg (Wümme)Kommissionsverlag Isensee Verlag, Oldenburg
Inhaltsverzeichnis
Beiträge 4
Holger Niemann, Klaus Gerken, Elisabeth Namyslo
Holzkohlenanalyse als Indikator für natürliche und anthropogen verur-sachte Brände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Stefan Hesse, Silke Grefen-Peters, Christina Peek, Jennifer Rech, Ul-rich Schliemann
Die Moorleichen im Landkreis Rotenburg (Wümme) . . . . . . . . . . 31
Jan Bock
Ein Grubenhaus bei Visselhövede, Ldkr. Rotenburg (Wümme) . . . . . 89
Jens Schneeweiß
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla . . . . . . . . . . . . 119
Stefan Hesse, Can Tegge
Eine gusseiserne Ofenplatte vom Schloss Vörde, Stadt Bremervörde, Ldkr.Rotenburg (Wümme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Stefan Hesse
Möglichkeiten und Grenzen einer Stadtarchäologie im Landkreis Roten-burg (Wümme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Berichte und Fundchronik 213
Stefan Hesse, Klaus Gerken, Meike Mittmann, Ingo Neumann
Fundchronik 2008–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
2 Inhaltsverzeichnis
Stefan Hesse
Literaturschau 2008–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Stefan Hesse
Tätigkeitsbericht der Kreisarchäologie Rotenburg (Wümme) für die Jahre2008–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Stefan Hesse, Ulrich Schliemann
Nachrichten aus dem Bachmann-Museum 2008–2009 . . . . . . . . . . 305
Wolf-Dieter Tempel
Tätigkeitsbericht der Archäologischen Gesellschaft im Landkreis Roten-burg (Wümme) für die Jahre 2008–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Rezensionen 320
Frank Sirocko (Hrsg.)
Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung. Von der Eiszeit bis ins 21. Jahr-hundert. Stuttgart 2009 (Meike Mittmann) . . . . . . . . . . . . . . . 321
Brunecker, Frank (Hrsg.)
Raubgräber - Schatzgräber. Stuttgart 2008 (Stefan Hesse) . . . . . . . 326
Biel, Jörg, Heiligmann, Jörg, Krausse, Dirk (Hrsg.)
Landesarchäologie. Festschrift für Dieter Planck zum 65. Geburtstag.Stuttgart 2009 (Stefan Hesse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) 16, 2010 3
Vorwort
Der vorliegende Band veranschaulicht wieder einmal eindrücklich, was für einreiches Forschungspotential unsere Geschichte birgt. Ein Projekt im Umfeldder archäologisch untersuchten alt- bis mittelsteinzeitlichen Station von Olden-dorf zeigt neue Analysemöglichkeiten zum Nachweis menschlich verursachterBrände auf. Neuere Grabungen im Rahmen eines länder- und fächerübergrei-fenden Forschungsprojektes am Höhbeck, Ldkr. Lüchow-Dannenberg, könnendie Diskussion um die Lokalisierung des Ortes Schezla – der bisweilen mitdem hiesigen Scheeßel gleichgesetzt wurde – wesentlich bereichern.
Mit älteren Funden bzw. Grabungen befassen sich drei Aufsätze. Ein Projekt-team nahm sich der Moorleichen im Landkreis an. Hier konnten umfangreicheneue Erkenntnisse gewonnen werden. Unter anderem gelang es, bereits vormehr als 250 Jahren geborgene Textilreste aus dem Rieper Moor zu datieren.Ein weiterer Aufsatz betrachtet eine bereits 1966 beim Bau des Bremervör-der Kreishauses entdeckte eiserne Ofenplatte unter restauratorischen undikonografischen Gesichtspunkten. Einer Grabung aus dem Jahr 1939 in Vis-selhövede nimmt sich ein weiterer Beitrag an. Auch hier gelang es die damalsgewonnenen Ergebnisse in Teilen zu revidieren bzw. zu konkretisieren. Esist durchaus bemerkenswert, dass dieser Beitrag aus einem studentischenPraktikum in der Kreisarchäologie resultiert.
Eher perspektivisch ist die Auslotung stadtarchäologischer Fragestellungenund Möglichkeiten im Landkreis. Sicherlich ein Thema, was in Zukunfthäufiger in den „Archäologischen Berichten“ erscheinen wird.
Die am Ende des Bandes stehenden Tätigkeitsberichte und die Fundchronikzeigen sowohl das umfangreiche Aufgabenspektrum von Kreisarchäologie undBachmann-Museum als auch deren Rückhalt in breiten Bevölkerungsschichten.
Mit dieser knappen Skizzierung des Inhaltes zeigt sich die Bandbreite der The-men, die sicherlich auf ein großes Interesse in Wissenschaft und Öffentlichkeitstoßen werden.
Viel Vergnügen bei den Einblicken in die regionale Geschichte wünscht Ihr
Hermann LuttmannLandrat
Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wümme) 16, 2010
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla
Jens Schneeweiß
Schlagwörter: Diedenhofener Kapitular; Schezla; Hitzacker; Höhbeck; Elbe; Kas-tell; Handel; Grenze; Heiligenfibel
Keywords: Diedenhofen Capitulary; Schezla; Hitzacker; Höhbeck; Elbe; Fort; Trade;Border; Saint’s brooch
1 Einleitung
Im Dezember des Jahres 805 verkündete Karl der Große in Diedenhofen(Thionville, Lothringen) ein Kapitular, das einerseits durch Mängel in derFunktionsweise der geistlichen Institutionen veranlasst wurde, für dessenEntstehung andererseits aber auch das historische Umfeld Aufschluss bringt.1
Dieses so genannte Diedenhofener Kapitular besitzt die Form eines capitularemissorum, besteht also aus Anweisungen an die missi des Reiches.2 Der ersteTeil des Kapitulars ist ausschließlich kirchlichen Belangen gewidmet, währenddarauf folgend der Außenhandel an der Ostgrenze des Reiches geregelt wird.Dabei handelt es sich um das Verbot der Ausfuhr von Grundnahrungsmitteln,sofern im Reich Hungersnot herrsche, sowie insbesondere um das Verbot desWaffenexports in slawische Gebiete und die Anweisung, den Handel mit den
1 Verhulst 1986. Brunner 1982.2 MGH Capitularia regum Francorum I, 44.
119
120 Jens Schneeweiß
Slawen auf bestimmte, namentlich aufgeführte Kontrollstellen zu beschränken.Diese Grenzhandelsplätze werden offensichtlich in geographischer Reihenfolgevon Nord nach Süd aufgezählt und die jeweiligen Zuständigkeitsbereicheder Aufsicht führenden kaiserlichen Funktionsträger genannt. Mehrere injener Zeit stattfindende Feldzüge gegen die Slawen3 sowie die nur wenigeWochen nach dem Diedenhofener Kapitular ebenfalls dort vorgenommenedivisio regnorum4 aus dem Jahre 806 deuten den historischen Hintergrundfür das Kapitular an und unterstreichen die offensichtliche Intention Karlsdes Großen, die Verhältnisse an der teilweise noch recht jungen Ostgrenzedes Reiches klar und eindeutig zu regeln.
Die historische Bedeutung des Diedenhofener Kapitulars, seine Rezeptionund Umsetzung werden nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags sein.Vielmehr sollen der intensiv und umfangreich geführten Debatte um dieLokalisierung des Ortes Schezla einige neue Aspekte hinzugefügt werden.Schezla ist ausschließlich durch das Diedenhofener Kapitular überliefert, derOrt taucht in keiner anderen Quelle noch einmal auf. Verständlicherweisehat die Lokalisierung dieses Ortes schon früh das Interesse der historischenForschung auf sich gezogen, so dass zu diesem Thema heute ein umfangreichesSchrifttum vorliegt.5 Der aktuelle Forschungsstand wurde jüngst von StefanHesse (2009) noch einmal zusammengefasst, wobei er resümierend bezeich-nenderweise Fritz Timme aus dem Jahre 1964 zitiert: „Vielleicht schenktuns aber der Zufall in Zukunft noch einmal bessere Einsichten: sei es dochnoch für unser Scheeßel an der Wümme, oder sei es – und auch das hat wohlkeine geringeren Aussichten – an ganz anderem, heute noch völlig unbekann-tem Ort.“ (Timme 1964, 144). Obwohl die Versuche einer Lokalisierung vonSchezla auch in der Folgezeit niemals aus der Literatur verschwanden undinzwischen die beachtliche Zahl von 14 verschiedenen vorgeschlagenen mehroder weniger konkreten Orten vorliegt,6 konnte doch seit den AusführungenTimmes wenig überzeugendes Neues beigesteuert werden.
Fast allen bislang vorliegenden Überlegungen zur Lage von Schezla ist gemein,dass sie beinahe ausschließlich auf historisch-geographischen und vor allem
3 Annales a. 805; a. 806.4 MGH, Capitularia regum Francorum I, 45.5 Hammerstein-Loxten 1871. Hostmann 1874, 1. Schuchhardt 1934, 323 f. Miesner
1937. Meyer 1953, 45 f. Jankuhn 1953, 193 ff. S.A. Wolf 1956; 1957. Schwineköper
1957. Timme 1964. Pudelko 1967, 143. Harck 1972, 145 f. Schulze 1972, 2 ff. Last
1977, 619 ff. Stoob 1984. Hübener 1989, 251 ff. Tempel 1991. Gröll 1994. Wachter
1998, 125. Schmauder 2000, 65 ff. Hesse 2009, 25 ff.6 Vgl. zuletzt die Aufzählung und eindrucksvolle Karte bei Hesse 2009, 27 und Abb. 11.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 121
namenkundlichen Argumentationen beruhen. So werden für die IdentifizierungScheeßels beispielsweise folgende Hauptargumente angeführt:
1. die Lage an einem Fernweg
2. die Nähe zum slawischen Gebiet
3. die Ähnlichkeit des Namens7
Archäologische Indizien wurden nur in seltenen Fällen ins Feld geführt,was jedoch nicht weiter verwundert, da sie in den meisten Fällen nichtvorliegen.8 Das zeigen die auch immer wieder von Seiten der Archäologievorgenommenen Stellungnahmen zu Schezla. Es ist aber nach archäologischenBelegen unbedingt zu fragen, denn durch sie können zusätzliche – und vonder Geschichte und Namenkunde unabhängige – Erkenntnisse erlangt werden.Neben der Forderung nach positiven archäologischen Indizien ist genauso dieDiskussion des eventuellen Fehlens von archäologischen Belegen aus heutigerSicht unverzichtbar, wenn eine überzeugende Argumentation geführt werdensoll. Ein entsprechender Überblick in diesem Sinne ist Wolfgang Hübener
(1989) zu verdanken, der sich dessen bereits vor über zwei Jahrzehntenannahm. Hinsichtlich der Zusammenfassung des Forschungsstandes zu den inihrer topographischen Lage gesicherten sieben Orten des Kapitulars9 konnteer nur konstatieren, dass zwar ihr Name bis heute überliefert und auch eineSiedlungskontinuität bis zur Gegenwart gesichert sei, aber dennoch von ihrergenauen Lage, ihrem Umfang und ihrem Siedlungsbild im Jahre 805 nichtsSicheres bekannt sei. Die Annahme der Platzidentität der heutigen Ortskernemit jenen von 805 sei demnach allgemein.10 Archäologische Zeugnisse vonSiedlungselementen des frühen Mittelalters fehlen, von einer Erkenntnisder Siedlungsstruktur ist man noch weit entfernt.11 Zur Lokalisierung vonSchezla äußert sich W. Hübener (1989, 260) knapp und pessimistisch: „DieArchäologie wird zu diesem Problem nichts beitragen können“, eine Auffassung,der durch die vorliegenden Zeilen widersprochen werden soll.
7 Hesse 2009, 27.8 Wachter 1998.9 Bardaenowic (Bardowick), Magadoburg (Magdeburg), Erpisfurt (Erfurt), Halazstat
(Hallstadt bei Bamberg), Foracheim (Forchheim), Ragenisburg (Regensburg), Lauriacum
(Lorch/Enns).10 Hübener 1989, 252.11 Hübener 1989, 263.
122 Jens Schneeweiß
2 Zur Lokalisierung Schezlas bei Hitzacker
Den Versuch, Schezla hauptsächlich aufgrund archäologischer Indizien zulokalisieren, hat kurze Zeit nach W. Hübeners Grundsatzaussage Wolf-DieterTempel (1991) unternommen, als er sich für eine mögliche Lage von Schezlabei Hitzacker an der Elbe aussprach. Anlass bot sich ihm ein aus dem 15.Jahrhundert überlieferter Flurname Schetzell, der später nicht mehr genanntwurde, aber wohl mit der Jeetzel verbunden werden kann.12 Seines Erach-tens sprachen aber insbesondere die topographische Lage sowie zahlreicheZufallsfunde von einer ausgedehnten Flächensiedlung am Jeetzelufer (heuteam Hitzacker-See) für einen „bedeutenden Siedlungsplatz, der sehr gut auchHandelsplatz gewesen sein“ könne (Tempel 1991, 143). Der implizite Ver-gleich mit Haithabu13 bezeugt das große Potential und die Hoffnungen, diesich lange Zeit mit dieser frühmittelalterlichen Siedlung am Hitzacker-Seeverbanden, die vor allem in den 1990er Jahren großflächig untersucht wurde.Im Zusammenhang mit den Grabungsauswertungen der Weinbergsburg inHitzacker setzte sich Berndt Wachter (1998, 125) auch mit W.-D. Tem-pels Schezla-These auseinander. Obwohl einige, insbesondere archäologischeIndizien s. E. dafür sprachen – es sind dies in erster Linie zwei ’Kreuzfibeln’aus der Siedlung am Hitzacker-See und drei Lanzenfunde zwischen Drawehnund Elbe –, sei die Verbindung der Jeetzel mit Schezla aus onomastischerSicht jedoch nicht vertretbar. Dies war für ihn der Hauptgrund, diese Thesenicht weiter zu verfolgen. Die Vorlage seiner Grabungen auf dem Weinberglegen zwar einen recht frühen Beginn der Besiedlung schon im 7. Jahrhun-dert nahe, die jedoch für die Frühzeit nur schwer greifbar wird. Außerdemhielt B. Wachter den Weinberg für eine slawische Burg, so dass sie als Sitzeines fränkischen missus im Jahre 805 nicht in Frage kommen konnte.14 FürHitzacker versprach die lange Zeit desiderate Auswertung der frühmittel-alterlichen Siedlungsbefunde am Hitzacker-See neue Erkenntnisse in dieserFrage. Jüngst wurden diese im Rahmen einer Magisterarbeit bearbeitet.15
Das Ergebnis in Bezug auf Schezla ist so ernüchternd wie eindeutig: „aufder Grundlage der vorliegenden Materialbasis muss einer Identifizierung derSiedlung am Hitzacker-See mit dem Handelsort Schezla widersprochen werden“(Linnemann in Vorb.). Hauptgrund sind die fehlenden Befunde aus der Zeitdes Diedenhofener Kapitulars, es lässt sich im 9. Jahrhundert allenfalls eine
12 Tempel 1991, 141.13 Tempel 1991, 14314 Wachter 1998, 127.15 Linnemann 2007.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 123
beginnende slawische Besiedlung fassen. Die ’Kreuzfibeln’ stellten sich beigenauerer Betrachtung als kreuzförmige Riemenverteiler heraus, die zudemins 10./11. Jahrhundert zu datieren sind.16
Als Prämisse für zukünftige Forschungen nannte B. Wachter abschließendals die „drei unabdingbaren Voraussetzungen“, die ein Ort erfüllen müsse, umüberzeugend für eine Lokalisierung von Schezla in Frage zu kommen:
1. die Lage zwischen Bardowick und Magdeburg an der fränkisch-slawischenGrenze, d. h. im elbnahen Raum,
2. die Namenübereinstimmung mit einem Siedlungsplatz jener Zeit, auchunter der Annahme eines Namenwechsels sowie
3. eine archivalisch oder archäologisch nachweisbare Handelsaktivität um800, die durchaus nur von kurzer Dauer gewesen sein könne.17
Für Hitzacker dürften nunmehr alle Argumente entkräftet sein, abgesehenvon der Lage an der Elbe zwischen Bardowick und Magdeburg. Diese Voraus-setzung erfüllen allerdings zahlreiche Orte, und dennoch ist auch sie schonkontrovers diskutiert worden.18
3 Zur Lage am Höhbeck
Ein Platz, der ebenfalls zwischen Bardowick und Magdeburg an der Elbegelegen ist, ist der Höhbeck, etwa 40 km elbaufwärts von Hitzacker gelegen.Mit Platz ist hier nicht etwa eine Ortschaft im modernen Sinne gemeint,sondern ein engeres Gebiet, das nicht ganz scharf umgrenzt werden kann, sichaber vor allem durch seinen eindeutigen Lagebezug auf den Höhbeck und dieElbe auszeichnet. Die Orte des Diedenhofener Kapitulars sind dort auch nur
16 Linnemann in Vorb.17 Wachter 1998, 148.18 Vgl. besonders Gröll 1994 und ebenso Saile 2007, 184 Anm. 1119. Der zuständige
missus für Schezla hieß Madalgaudus. Ein missus mit gleichlautendem Namen war fürErfurt und Hallstadt im Süden zuständig. Es wird daher eine Identifizierung Schezlas
mit Seßlach a. d. Rodach erwogen, unter Aberkennung der geographischen Reihenfolgeder Ortsnennung. Es gibt allerdings gute Argumente, die dafür sprechen, dass es sich umzwei verschiedene Personen gleichen Namens handelte (Miesner 1937, 176), abgesehendavon, dass der Nennung von Nord nach Süd eine recht hohe Wahrscheinlichkeit nichtabgesprochen werden kann.
124 Jens Schneeweiß
Abbildung 1: Karte der Höhbeck-Region mit dem Verlauf des Elbübergangs nachSchuchhardt.
mit ihrem Namen bezeichnet, es wird keine Art des Ortes angegeben (locus,vicus, civitas o. ä.). Es sei auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Ortdes frühen 9. Jahrhunderts gesucht wird, nicht eine heutige Ortschaft.
Aktuelle Ausgrabungen des bekannten Kastells auf dem Höhbeck haben durchseine eindeutige Datierung in das Jahr 810 die bislang immer nur vermuteteIdentifizierung mit dem aus den fränkischen Annalen bekannten castellumhohbuoki bestätigt.19 Damit kann kein berechtigter Zweifel mehr daran be-stehen, dass hier am Höhbeck zu Beginn des 9. Jahrhunderts die Grenze desfränkischen Reiches verlief. Nun ist das keine neue Erkenntnis und insofernhat der Höhbeck, vor allem natürlich das Höhbeck-Kastell, in mancherleiArgumentation um die Lage von Schezla eine wichtige Rolle gespielt. Alserster ist in dieser Hinsicht Carl Schuchhardt zu nennen, der auch die erstenAusgrabungen auf dem Kastell durchführte. Seine Argumentation ging davon
19 Annales a. 810; a. 811. – Schneeweiß 2009; in Vorb.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 125
aus, dass die Elbe in der „vordeichlosen Zeit, wo bei Hochwasser das ganzeGebiet von Stendal bis Spandau überschwemmt sein konnte“ (Schuchhardt
1924, 56) nur drei Übergänge gehabt habe, die für ein Heer geeignet gewesenwären, erstens bei Magdeburg (Wolmirstedt), zweitens beim Höhbeck unddrittens bei Artlenburg.20 Alle drei Übergänge hätte Karl der Große im Laufeder Zeit gesichert, wobei Schuchhardt die Ursprünge der Ertheneburg21 indie Zeit Karls des Großen zurückführte.22 Dafür, dass Karl bereits 789 denElbübergang am Höhbeck nutzte, spricht die Beschreibung in den fränkischenAnnalen in Verbindung mit der speziellen Topographie am Höhbeck: „Hierbezieht er am Ufer ein Lager und schlägt zwei Brücken über den Fluss, dereneine er an beiden Enden mit einem Kastell sichert und mit einer Besatzungbelegt“.23 Die Lorscher Annalen geben noch präzisere Angaben in Bezugauf die Befestigung, nämlich dass „die Kastelle aus Erde und Holz erbaut“waren.24 Vor allem die Bemerkung, dass es zwei Brücken waren, von denenjedoch nur eine gesichert wurde, führte nun Schuchhardt zu der Ansicht,dass Karl die erste Brücke anlegen musste, um überhaupt auf den Höhbeckhinaufzukommen, die zweite aber vom Höhbeck nach Lenzen schlug. Die erstebrauchte er nicht zu schützen, weil sie für die Feinde unerreichbar gewesensei. Für die Befestigung der Brücke auf feindlicher Seite nimmt er Lenzen an,die dann aber nicht direkt zum Kastell, sondern gerade über die Elbe zurFähre gelaufen sei (Abb. 1). „Die zweite, rückwärtige Brücke Karls d. Gr. hatwahrscheinlich in der Linie Kastell – Meetschow gestanden, da wo auch heutenoch eine Furt ist“ (Schuchhardt 1924, 62). Die weitere Argumentationlässt Schuchhardt auch auf die drei Orte des Diedenhofener Kapitulars zusprechen kommen, die „für diese Gegend der Slavengrenze“ genannt sind:Magdeburg, Schezla und Bardowick. „Man sieht sofort, dass Magdeburg undBardowiek [sic!] hinter dem 1. und 3. Elbübergang liegen, man möchte alsoSchezla hinter dem 2., dem Höhbeck vermuten“ (Schuchhardt 1924, 63).Er lokalisiert den gesuchten Ort dann 23 km westlich vom Höhbeck bei dem
20 Es geht um den Heerzug von Karl dem Großen gegen die Wilzen im Jahr 789, als Karlzwei Brücken über die Elbe schlug, von denen eine an beiden Enden mit Befestigungengesichert war. Annales a. 789. – Wasserbaudirektor Hübbe im Korrespondenzblatt desGeschichtsvereins, April 1901, zit. nach Schuchhardt 1924, 57.
21 Annales a. 822.22 Hier und im Folgenden: Schuchhardt 1924, 57 ff.23 „... castris in ripa positis, amnem duobus pontibus iunxit quorum unum ex utroque
capite vallo munivit et inposito praesidio firmavit“ (Annales a. 789; Übersetzung nachSchuchhardt 1924, 57).
24 „ibique duos pontes construxit, quorum uno ex utroque capite castella ex ligno et terra
aedificavit“ (Ann. Laurissenses, a. 789)
126 Jens Schneeweiß
Dorfe Jeetzel, wo er karolingische Scherben gefunden habe. Hierbei zog er einegermanisch-slawische Lautverschiebung von Schezla zu Jeetzel in Betracht,25
was sich aus onomastischer Sicht allerdings als nicht haltbar erwies (s. o.).
Auch F. Timme kam, 40 Jahre später, immer wieder auf den Höhbeck zurück,als er die Schezla-Problematik mit Blick auf Scheeßel an der Wümme ausführ-lich beleuchtete. Ähnlich wie Schuchhardt ist es besonders der Elbübergang„etwa in der Mitte zwischen Bardowick und Magdeburg, besonders die Engezwischen Gartow und Lenzen mit dem inselartigen Berg Höhbeck “ (Timme
1964, 128), der sich ihm als geeignet anbot. Nach allem Für und Widerschien ihm doch die Lage zwischen Bardowick und Magdeburg am ehesten zuvermuten, wobei „die Elbenge [...] von Höhbeck [...] wegen ihrer Gunst dabeibeachtet bleiben“ müsse (Timme 1964, 142).
Es kann an dieser Stelle konstatiert werden, dass zwischen Bardowick undMagdeburg an der Elbe der Höhbeck offenbar die bei weitem besten Lagevor-aussetzungen für einen Elbübergang und damit auch für die Lage von Schezlamit sich brachte. Doch eine theoretisch günstige Lage allein hilft nicht weiter,wenn es keine weiteren Argumente gibt.
4 Zum Handel in den Orten des Diedenhofener Kapitulars
Den Ergebnissen der jüngsten archäologischen Untersuchungen seien einigeÜberlegungen zum Grenzhandel vorausgeschickt. B. Wachter (1998,148)hatte gefordert, dass an einem in Frage kommenden Ort archivalisch oderarchäologisch eine Handelsaktivität um 800 nachweisbar sein müsse. Wiesieht diese aber aus? Wie kann man sich diese Handelsaktivität vorstellen?Als W.-D. Tempel (1991, 143) Hitzacker ins Feld führte, schien ihm einPlatz wie Haithabu vor dem inneren Auge gestanden zu haben. Haithabuwar ohne Zweifel ein Fernhandelsplatz von überregionaler Bedeutung, desseneigentliche Blütezeit jedoch überwiegend im 9. und 10. Jahrhundert lag.26 Imfrühen 9. Jahrhundert spielte Haithabu in den dänisch-fränkisch-slawischenAuseinandersetzungen zwar eine wichtige Rolle, blieb aber erhaben über dieGrenzregulierungen des fränkischen Reiches und ist insofern nur bedingt
25 Schuchhardt 1934, 305, 32326 Aus der umfangreichen Forschungsliteratur zu Haithabu seien lediglich zwei jüngere
Werke angeführt, die sich vor allem der Funktion und Einbindung des Handelszentrums indas Hinterland einerseits und in das System der Seehandelsplätze andererseits widmen.Vgl. Müller-Wille 2002; Sindbæk 2007.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 127
vergleichbar mit den Orten des Diedenhofener Kapitulars. Den üblichenHandel entlang der fränkisch-sächsischen-slawischen Grenze wird man sichwohl eher wie den heutigen ’kleinen Grenzverkehr ’ vorstellen können.27 Esist daher zu fragen, worin denn tatsächlich die Aufgabe dieser Orte an derOstgrenze des Reiches in erster Linie lag, zumindest in dieser frühen Phasekurz nach dem Sieg über die Sachsen. Ihre Bedeutung hing sicherlich mit denkontinentalen Fernverkehrswegen des Frühmittelalters zusammen.28 Es mussdavon ausgegangen werden, dass der Fernhandel genau über die genanntenOrte lief, ansonsten hätte er dort nicht wirksam kontrolliert werden können.F. Timme (1964, 126) stellte heraus, dass die im Diedenhofener Kapitularnamentlich genannten missi Überwachungsbeamte gewesen seien, „Dienststel-lenleiter [...] einer Aufsichtsbehörde über die Kontrollorgane der verbotenenWaffenausfuhr “, obwohl sie wohl auch militärische Aufgaben erfüllt habenwerden. Die Gebiete zwischen Aller und Elbe standen zur Zeit des Kapitularsnoch unter Militärverwaltung. Der missus war einem comes unterstellt,29 obfür diese Zeit allerdings schon von Markgrafschaften gesprochen werden kann,ist strittig.30 Es ist jedoch wohl davon auszugehen, dass die im Kapitulargenannten Grenzorte über einen Königshof verfügten.31 Nicht der Handelstand in Diedenhofen im Vordergrund, sondern seine Kontrolle, auch ein Teilder anderen Orte – so beispielsweise Hallstadt – ließe sich eher als Grenz-passierort denn als fester Handelsort charakterisieren, ohne kaufmännischeSiedlung und wirtschaftlich entwickeltes Hinterland.32 Ihre Aufgabe lag ebenvordergründig in der Kontrolle des Auslandsverkehrs, des Warenumschlags.Einen weiteren wichtigen Punkt hat F. Timme ebenfalls bereits angespro-chen: willentliche Verstöße gegen das Verbot, also Schmuggel, wurden aufSchleichwegen unternommen,33 so dass man sich die Kontrolle wahrscheinlichweniger (nur) in Form einer festen Zollstation vorstellen muss als auch durchzusätzliche Kontrollen an Wegen und Pässen.
Dies alles führt nun zu der Frage, welchen Fundniederschlag (Art und Umfang)wir an einem derart charakterisierten Ort zu erwarten haben, an einem Ort
27 So schon Timme 1964, 129.28 Vgl. besonders für Magdeburg, Erfurt und Regensburg Hardt 2005a.29 Dies geht aus einer Abschrift des Diedenhofener Kapitulars in der Nationalbibliothek
Paris (latin 9654, fol. 17r) hervor, den übrigen erhaltenen Handschriften ist keine eindeutigeTrennung zu entnehmen (Timme 1964, 125, 128 und Anm. 35).
30 Timme 1964, 126 f. und Anm. 27.31 So Timme 1964, 128, obwohl nicht für alle Orte nachweisbar. Im gleichen Sinne auch
Hübener 1989, 252.32 Timme 1964, 131.33 Timme 1964, 131.
128 Jens Schneeweiß
– um bei Schezla zu bleiben –, der offenbar an Bedeutung verlor, bevor einKloster oder Stift eingerichtet wurde.34 Ausgeprägte Fernhandelsaktivitätensind zwar nicht ausgeschlossen, aber bei weitem nicht zwingend. Im Gegensatzzu beispielsweise Magdeburg oder Erfurt entwickelte sich Schezla eben nichtzu einem wichtigen Handelsort, sondern seine Rolle scheint auf eine relativkurze Zeit im frühen 9. Jahrhundert beschränkt geblieben zu sein, als diemilitärischen Aspekte der Grenzsicherung und -kontrolle noch überwogen.Ein ausgeprägter Niederschlag von Fernhandel im Fundmaterial ist insofernnicht zu erwarten. Ebenso gibt es keinen Anlass, ein ortsansässiges Handwerkvorauszusetzen, wie es in den großen Handelsplätzen geläufig ist. Die Versor-gung der Kontrollstelle selbst wie auch der hindurchziehenden Händler, kannauch ohne entwickeltes Hinterland als räumlich begrenzter Grenzhandel im’kleinen Grenzverkehr ’ gedacht werden. Dieser dürfte hauptsächlich, wennnicht ausschließlich, Waren des Alltagsgeschäfts betroffen haben, also im We-sentlichen wohl Lebensmittel, Kleidung, Werkzeug. Es dürfte kaum gelingen,Überreste davon im archäologischen Fundmaterial sicher als ’Handelsware’zu identifizieren. Allerdings wäre zu erwarten, dass sich die Anwesenheitvon Militär bzw. wenigstens die Anzeichen einer sozialen Hierarchie, wiesie sich im Rahmen einer staatlichen Aufsichtsbehörde vorzustellen ist, imFundmaterial widerspiegeln.
Für die zu erwartenden Befunde seien die folgenden Darstellungen der Orte desDiedenhofener Kapitulars angeführt: „Sie besaßen einen Stapelhof, eine Kauf-gasse und einige Herbergen, dazu natürlich die Gebäude für die Militär- undZollstellen und die übrigen Behörden der Ortsverwaltung“ (Timme 1964, 131),oder: „neben einem Saalbau und Wirtschaftsgebäuden [dürften] vermutlichmindestens eine Kapelle oder Kirche (nebst Friedhof) und eine Befestigung[...] zu erwarten sein“ (Hübener 1989, 252 f.). Daraus ein archäologischzu erwartendes Befundbild ableiten zu wollen, würde das zulässige Maß anSpekulation übersteigen, zumal die Beschreibungen beide nicht auf archäolo-gischen Befunden beruhen. So wie W. Hübener (1989, 259 f.) bei der Suchenach topographisch-archäologischen Gemeinsamkeiten bzw. dem „kleinstengemeinsamen topographischen Nenner “ der lokalisierten Orte des Diedenhofe-ner Kapitulars zu der Einsicht gelangte, dass diese nicht leicht auszumachenseien und die Individualität eines jeden Platzes offenbar stärker wiege, so istwohl auch bei der tatsächlichen Struktur eines jeden Platzes davon auszuge-hen, dass sie sich individuell den örtlichen Gegebenheiten anpasste. Ähnlich
34 Dies hätte ihm möglicherweise mehr Dauerhaftigkeit verliehen. Zur Kontinuität weltli-cher und geistlicher Zentralorte vgl. Ehlers 2007, 231, 402.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 129
ernüchternd wirkt seine Erkenntnis, dass von keinem einzigen der genanntenOrte überhaupt sichere archäologische Befunde bekannt sind, die eindeutigin die Zeit des Diedenhofener Kapitulars datiert werden könnten.35
Die von B. Wachter an dritter Stelle genannte archäologische Voraussetzungwäre demnach zu korrigieren. Obgleich der Handel eine Grundvoraussetzungfür die Orte des Diedenhofener Kapitulars darstellt, ist nicht der Nachweisvon Handelsaktivität um 800 als unabdingbar zu fordern, denn dies dürftein Abhängigkeit vom Ausmaß und der Dauer des Handels sowie der Art derverhandelten Güter im Einzelfall schwer fallen. Es ist zu unklar, wie derGrenzverkehr an den kontinentalen Fernhandelswegen und vor allem seineKontrolle aussahen. Entsprechend der vordergründigen Aufgabe der Ortedes Kapitulars erscheint vielmehr der archäologische Nachweis militärischerPräsenz um 800 von entscheidender Bedeutung für die Interpretation eines inFrage kommenden Platzes zu sein. Als Minimalforderung wäre also wenigstensder archäologische Nachweis einer umfangreicheren Besiedlung um 800 zuerbringen, und zwar von allen Plätzen des Diedenhofener Kapitulars, auchvon jenen, deren Namen heute noch bestehende Ortschaften bezeichnen.
5 Zur Rolle des Namens bei der Lokalisierung von Schezla
Eines der wichtigsten Argumente für oder wider die Identifizierung von Schezlawar immer die als unabdingbar angesehene Voraussetzung der Namenüber-einstimmung, die in der bisherigen Schezla-Forschung nie grundsätzlich inFrage gestellt wurde. Fast alle bisher unternommenen Lokalisierungsversuchegründen sich nahezu ausschließlich auf eine Namensähnlichkeit oder gehendoch wenigstens von dieser aus.
Es sei jedoch die Frage gestattet, ob die Tradierung des Namens für einen Orttatsächlich vorausgesetzt werden kann, für dessen Existenz in nachkarolingi-scher Zeit keinerlei Belege angeführt werden können? Die Frage zu stellenheißt sie zu verneinen. Zunächst sei noch einmal kurz das Umfeld von Schezlabetrachtet, wie es sich aus historischer Sicht darstellt. Die Sachsenkriegeendeten im Jahre 804 endgültig mit den Deportationen der Sachsen aus
35 Als einzige Ausnahme galten W. Hübener (1989, 263) die Spitzgräben in Magdeburg,deren Datierung in die Zeit Karls des Großen sich jedoch nicht aufrecht erhalten ließ(Schmauder 2000, 68). Neueste Grabungsergebnisse am Magdeburger Domplatz habenjüngst karolingerzeitliche Befestigungen nachweisen können (Kuhn 2009a; 2009b sowie frdl.Mitteilung R. Kuhn, Magdeburg).
130 Jens Schneeweiß
Nordelbien, das den Abodriten überlassen wurde. Bei diesem Anlass weilteKarl der Große in Hollenstedt, wo das Treffen mit dem AbodritenfürstenThrasco und die Gebietsübergabe stattfand. Auch während der Zeit der Krie-ge war Karl sehr häufig in Sachsen gewesen. Im Jahre 789 hat er anlässlicheines Feldzugs gegen die Slawen die Elbe überquert, möglicherweise beimHöhbeck.36 Es kann davon ausgegangen werden, dass er eine sehr konkreteVorstellung von dem sächsischen Gebiet im Nordosten des Reiches gehabthatte, als er 805 das Kapitular erließ und kurz darauf die divisio regnorum desJahres 806 verkündete. Das Gebiet im Nordosten sollte auch sein Haupterbe,Karl der Jüngere erhalten, der in der Folgezeit ebenfalls häufiger in Sachsenwar. Im Jahre 808 zog jener über die Elbe gegen die slawischen Linonenund Smeldinger, als Vergeltung des Angriffs des Dänenkönigs Gudfred aufdie mit den Franken verbündeten Abodriten. Wahrscheinlich ist, dass auchdieser Elbübertritt am Höhbeck stattfand. Karl der Große befahl im gleichenJahr den Bau von zwei Kastellen an der Elbe gegen die Slawen.37 Überhauptwaren diese Jahre unmittelbar nach dem Diedenhofener Kapitular stark vonden Auseinandersetzungen an der jungen Grenze zwischen Dänen, Sachsen-Franken und Slawen geprägt, hinzu kamen erste Einfälle der Normannen inFriesland.38 In diesen Jahren überschlugen sich die Ereignisse: 808 griff derDänenkönig Gudfred Rerik an und zerstörte es,39 im nächsten Jahr ermordeteer Karls Verbündeten, den Abodritenfürsten Thrasco ebendort.40 Im gleichenJahr befahl Karl den Bau einer Burg bei Itzehoe gegen die Dänen41; im Jahre810 weilte er zum letzten Mal selbst im Nordosten seines Reiches, als ermit den Abodriten den Vertrag um den limes saxoniae aushandelte, der dasGebiet nördlich der Unterelbe nun ins Frankenreich eingliederte.42 Zu einemAngriff der Dänen kam es nicht, da Gudfred noch 810 innerdänischen Macht-kämpfen zum Opfer fiel.43 Im selben Jahr griffen die Wilzen das neu erbauteHöhbeck-Kastell an.44 Im Folgejahr 811 fand ein Vergeltungsfeldzug über die
36 So auch Langen 1989, 206 f. Willroth 2000, 723. Saile 2007b, 91. – Für einenÜbertritt an der Ohremündung dagegen Schmauder 2000, 68 und Ruchhöft 2008, 97. –Vgl. zum Elbübertritt 789 am Höhbeck auch Schneeweiß 2010, 258 Anm. 22.
37 Annales a. 808.38 Annales a. 810.39 Annales a. 808.40 Annales a. 809.41 Burg Esesfeld. Annales a. 809.42 Adam v. Bremen, II, 18. Zu Verlauf und Bewertung des limes saxoniae: Hardt 2000,
46 ff. Schmauder 2000, 58 ff. Hardt 2005c.43 Annales a. 81044 Annales a. 810.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 131
Elbe statt und das Kastell wurde wiedererrichtet; mit den Dänen konnte einFriedensvertrag ausgehandelt werden.45 In jenen beiden Jahren starben dreiSöhne und Erben Karls,46 so dass die divisio regnorum Makulatur wurdeund Ludwig als Alleinerbe zurückblieb. Er wurde 813 zum Mitkaiser gekrönt,bevor im Januar 814 Karl der Große starb. Die Verhältnisse im Nordostenhatten sich danach jedoch noch nicht beruhigt, gegen die ehemals verbündetenAbodriten wurde nun zu Felde gezogen47 und es wurden auch jenseits derElbe Kastelle gegen sie errichtet.48 Nach 822 wurden aber anscheinend keinemilitärischen Unternehmungen mehr gegen Dänen und Abodriten geführt.Es ist ein auffälliger Unterschied zur Regentschaft seines Vaters, dass sichLudwig der Fromme nach Aussage der Quellen nur ein einziges Mal selbstin Sachsen aufgehalten hat, und zwar im Jahre 815 in Paderborn.49 SeineRegierungszeit war geprägt von normannischen Überfällen und vor allemvon den Streitigkeiten mit seinen Söhnen. Diese Konflikte betrafen auch densächsischen Raum. Wahrscheinlich hat die instabile Situation in Sachsendie Normanneneinfälle begünstigt, oder sogar erst verursacht, wie CasparEhlers (2007, 291) annimmt. Nach dem Tod Ludwigs des Frommen 840mündeten sie im Bruderkrieg und letztlich 843 im Vertrag von Verdun mitder dann vollzogenen Reichsteilung.
In seiner Analyse der Konventgründungen in Sachsen kann C. Ehlers (2007,238 f.) einen Bruch in der Mitte des 9. Jahrhunderts ausmachen. In der Wendevom 8. zum 9. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts sindalle Gründungen von Klöstern und Stiften auf die Karolinger zurückzufüh-ren, es gab keine durch den Adel. Das änderte sich nach der Mitte des 9.Jahrhunderts, als nun Gruppen oder Verbände mit Grundbesitz begannen,eigene geistliche Zentren in Sachsen zu gründen und damit den Grundsteinfür ihre Beteiligung an der Macht zu legen. Seitdem wird eine Entwicklungeiner sächsischen Elite sichtbar, die letztlich zur Herausbildung der Ottonen-herrschaft führt. So weit soll der Bogen hier jedoch nicht geschlagen werden.Es bleibt festzuhalten, dass nach dem Tode Karls des Großen, spätestens abder Mitte des 9. Jahrhunderts, der Nordosten des Reiches aus dem Blickfeldder Könige geriet, die stark in innere Auseinandersetzungen verstrickt waren,und es insofern zu einem Politikwechsel kam, dass immer stärker sächsischeGroße einbezogen und mit Macht ausgestattet wurden. Die kirchlichen Struk-
45 Annales a. 811.46 810 Pippin; 811 Pippin der Bucklige und Karl der Jüngere.47 Annales a. 817.48 Zuletzt im Jahre 822 an einem Ort namens Delbende, Annales a. 822.49 Annales a. 815.
132 Jens Schneeweiß
turen verfestigten sich, es war für Sachsen eine Zeit der inneren und äußerenKonsolidierung, worauf auch das Ende der Grenzunternehmungen hinweist.50
Was aber passierte mit Schezla, was passierte mit dem Höhbeck-Kastell?Von Bardowick erfahren wir durch die Gründung eines Kanonikerstifts (vor)829 in der Diözese Verden.51 Es wurde somit Bestandteil der kirchlichenStrukturen und war als solches einerseits nicht mehr so abhängig vom Laufder politischen Geschichte, und blieb andererseits stärker im Interessenfeldder Kleriker, die ja die Verfasser der meisten Quellen waren. Ähnliches giltin noch stärkerem Maße für Magdeburg, wobei auf die besondere Situationvon Magdeburg hier nicht weiter eingegangen werden soll.52 Schezla dagegenwurde nie wieder erwähnt, ebenso verhält es sich mit dem Höhbeck-Kastellnach 811. Das mag damit zu tun haben, dass ihrer beider Funktion mitder Nordostgrenze des Reiches in Verbindung stand, um die es nach 822deutlich ruhiger wurde. Über den Grenzverlauf im mittleren Elbgebiet sindwir nach 811 nicht mehr informiert, die erwähnten Auseinandersetzungenbis 822 fanden entweder weiter im Norden oder weiter im Süden statt. Dasgroße Gebiet zwischen den Bistümern Hildesheim, Verden und Halberstadt,die Gegend ostwärts von Hannover längs von Aller und Elbe,53 blieb vondem Auf- und Ausbau der kirchlichen Strukturen lange Zeit ausgespart undtaucht also entsprechend auch nicht in den Quellen auf. Es verwundert indiesem Zusammenhang nicht, dass das Höhbeck-Kastell dort, fernab von denGeschehnissen des fortgeschrittenen 9. Jahrhunderts, keine Bedeutung mehrhatte und aufgegeben wurde. Einen ähnlichen Bedeutungsverlust, verbundenmit einer Aufgabe des Platzes, darf man wohl mit Recht für Schezla annehmen,wenn es denn in dieser soeben umschriebenen Region gelegen hat – ohne dassdamit natürlich die genauen Ursachen geklärt wären.54
Das umschriebene Gebiet zwischen Bardowick und Magdeburg lag also füretwa ein Jahrhundert – oder drei Generationen – weit außerhalb der Interes-sensphären des ostfränkischen Reiches, und es darf gemutmaßt werden, dassdies nicht nur die Überlieferung durch die Kleriker betrifft, sondern auch dentatsächlichen Verhältnissen entsprach. Der von Karl dem Großen gedachte
50 Ehlers 2007, 289 f.51 Nach Ehlers 2007, 293 sowie Regesten Nr. 161.52 U. a. Hardt 2007, zuletzt Kuhn et al. 2009.53 Vgl. z. B. Ehlers 2007, 101 Abb. 31 und zahlreiche weitere Karten.54 Andersherum darf wohl unterstellt werden, dass die Lage von einem Ort wie Schezla
beispielsweise in Scheeßel (also im Bistum Hamburg-Bremen) sicherlich zu einer nochkarolingerzeitlichen Gründung eines Konvents geführt hätte und damit zu einer Nennungweit vor 1200. Aber das ist zugegebenermaßen Spekulation.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 133
und eingerichtete Grenzverlauf wurde nicht gehalten, die slawische Besied-lung überschritt die Elbe in weiten Teilen.55 Erst in ottonischer Zeit wurdedieses Gebiet wieder interessant, inzwischen war es aber von Slawen besiedeltworden, zumindest bis zum Drawehn. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Nameeines Ortes tradiert wird, der in Verbindung mit einem Bevölkerungswech-sel aufgelassen wird, ist m.E. nicht besonders hoch, zumal wenn sich keinereligiösen oder andere Traditionen mit diesem Ort verbanden und er nichtsehr lange bestand. Wenn also Einigkeit darin besteht, dass der Ort Schezlades Diedenhofener Kapitulars nicht lange bestand und aufgegeben wordensein könnte, dann kann eine Namenübereinstimmung und also -tradierungnicht als unabdingbare Voraussetzung angesehen werden. Eine Tradierungdes Namens als Orts-, Flur- oder Flussname ist zwar nicht auszuschließen,aber nicht besonders wahrscheinlich. Im Falle des Höhbeck hat sich der Namehohbuoki offenbar bis heute gehalten,56 trotz des Bevölkerungswechsels. Hierhaben wir es allerdings mit einem anders gelagerten Sachverhalt zu tun. DieBezeichnung hat sich auf die gesamte Anhöhe übertragen, die als Landmar-ke und bekannter Elbübergang sicherlich weiterhin bekannt war. Vielleichtwurde auch die Bezeichnung des schon bestehenden Landschaftsnamens fürdie Benennung des Kastells benutzt. Es ist bei Weitem wahrscheinlicher,dass solch ein Name in Gebrauch bleibt57 als der einer ’Grenzpassierstelle’an einer nicht mehr existenten politischen Grenze. Der Höhbeck hatte alsLandmarke eine Funktion für die Orientierung im Raum, Schezla war anpolitische Verhältnisse gebunden und hatte nach deren Wegfall keine Relevanzmehr. Tradierungen von Namen sind generell so vielfältigen Prozessen undEinflüssen unterworfen, dass sich die a priori Annahme, ein Name müsse sicherhalten haben, streng genommen verbietet.
6 Archäologisches vom Höhbeck
In der folgenden archäologischen Annäherung wird die Perspektive des nachSchezla Suchenden für einen Moment verlassen. Die Höhbeck-Region warvon 2005 bis 2010 Ziel von archäologischen Untersuchungen des Seminars für
55 Hardt 1991; 2000, 45; 2005b; 2009. – Vgl. dagegen Hardt 2000, 42 f. und 50 ff., wovon einer schon zur Zeit des Diedenhofener Kapitulars weit nach Westen über die Elbereichenden slawischen Besiedlung ausgegangen wird. Aus heutiger Sicht ist das zumindestfür das Wendland und die Altmark zu bezweifeln (s. u.).
56 Im 14. Jh. wird eine villa hobeke erwähnt (vgl. H. Wolf 1963).57 Wir wissen allerdings nicht, wie die Slawen den Höhbeck nannten.
134 Jens Schneeweiß
Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen im Rahmen eines länder-und fächerübergreifenden Forschungsprojektes, das von der DFG gefördertwurde.58 Dabei wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen, die zur Erhellungder Geschichte der Grenzregion am Höhbeck beitragen, so auch zu der hierbehandelten Frage. Die Ausgrabungen auf dem Kastell haben oben schonErwähnung gefunden. Abgesehen von der wichtigen dendrochronologisch ab-gesicherten Datierung der Anlage in das Jahr 81059 ist ein weiterer Aspektunbedingt erwähnenswert, den die Ausgrabungen zutage gefördert haben. Erbetrifft den Wallaufbau. Der westliche Wall wurde an zwei Stellen geöffnet,zum einen wurde ein kompletter Wall-Graben-Schnitt von der Innenfläche bisnach außen angelegt, zum anderen wurde in einer Sondage der alte Wallschnittvon Ernst Sprockhoff aus dem Jahre 1964 wieder geöffnet. Das hatte zurunmittelbaren Folge, dass uns derselbe Befund, nämlich der Aufbau des Wal-les, in zwei unterschiedlichen Erhaltungszuständen entgegentrat. Einerseitszeigte er heftige Brandspuren, so dass ein Großteil der Hölzer der Wallkon-struktion in Holzkohle erhalten geblieben war. Das war in der Sondage derFall. Andererseits blieben im großen Wallschnitt die Brandspuren marginalund auf wenige Holzkohlestückchen an der Wallaußenfront beschränkt. Hierwaren also sämtliche Hölzer der Wallkonstruktion vergangen und nur nochals Verfärbungen zu erkennen.
Die verkohlten Balken in der Sondage brachten unzweifelhaften Aufschlussüber den inneren Aufbau des Walles. Es handelte sich um einzelne, allerdingsrecht mächtige senkrechte Pfosten, die in größeren Abständen im Wallinnernund an dessen Front eingebracht worden waren, ansonsten waren etliche Hölzerquer zum Wallverlauf im Wechsel mit Sandlagen aufgeschichtet worden. DieseHölzer verliehen dem Wall offenbar die notwendige Stabilität. Insgesamtentspricht dieser Befund durchaus dem, den auch E. Sprockhoff seinerzeit anverschiedenen Stellen des Walles fand.60 Auffällig war, dass es sich nicht umausgesuchte Hölzer zu handeln schien, sondern dass zum einen verschiedeneHolzarten (Eiche, Erle und Ulme) verwendet wurden und zum anderen sowohlSpaltbohlen als auch unbearbeitete Rundhölzer mit in den Wall gekommenwaren. Insgesamt entstand so der Eindruck, als sei der Wall in Eile unddaher ohne besondere Sorgfalt errichtet worden. Im Wallschnitt, in dem sichkeine Hölzer erhalten hatten, ließ sich ihre Lage anhand von Verfärbungen
58 Willroth 2007. Schneeweiß 2007a. Lüth, Messal 200859 Schneeweiß in Vorbereitung.60 Sprockhoff 1955; 1958a; 1958b. – Vgl. besonders auch den Befund in der Nordwestecke
des Kastells, der erst jüngst bei Saile (2007b, 93 Abb. 4) vorgelegt wurde.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 135
Abbildung 2: Grabungsschnitt durch den Westwall des Höhbeck-Kastells im Herbst2008, Südprofil. Deutlich zu erkennen ist die horizontale Bänderung, die auf ehemalige
Balkenlagen zurückgeführt werden kann.
bzw. Tonanreicherungsbändern noch deutlich erkennen (Abb. 2). Darauf wirdspäter zurückzukommen sein.
Sehr wichtige Ergebnisse für die hier interessierende Frage brachten auch dieAusgrabungen der Jahre 2006 und 2007 in der bekannten slawischen Burg-anlage von Meetschow.61 Es konnte hier nämlich eine unbefestigte Siedlungentdeckt werden, die der slawischen Burg des 10. Jahrhunderts vorausging.Sie zeichnete sich durch eine überwiegend lehmige Kulturschicht aus, die zahl-reiche Tierknochen62 und etwas weniger Keramik enthielt. Die Keramik warunregelmäßig verteilt und fand sich häufiger in Form von ’Scherbennestern’,die sich teilweise zu vollständigen Gefäßen restaurieren ließen. Auffällig wardie hohe Zahl von 30 Herdstellen, Brandgruben und Öfen in einer Grabungs-fläche von 400m2, die sich auf einen bestimmten Bereich zu konzentrierenschienen. Ihre teilweise Überlagerung belegt, dass diese Siedlung über einen
61 Hier haben bereits in den 1970er Jahren Ausgrabungen stattgefunden, die bereitswesentliche Erkenntnisse der slawischen Burg liefern konnten: Steuer 1973; 1974a; 1976.Bernatzky-Goetze 1986; 1991. Im Jahre 2005 wurden die Ausgrabungen hier wiederaufgenommen. Sie brachten bereits im ersten Jahr eine deutliche Präzisierung der Datierung(vgl. Schneeweiß 2007a, 272 f.; 2007b).
62 Offenbar überwiegend Speiseabfälle, vgl. Morgenstern in Vorb.
136 Jens Schneeweiß
längeren Zeitraum bestand. Spuren ebenerdiger Gebäude deuteten sich durchWandgräbchen und Pfosten an, dafür ist allerdings die endgültige Auswertungabzuwarten in der Hoffnung, dass sich – trotz der verhältnismäßig kleinen ar-chäologisch untersuchten Fläche von insgesamt etwa 1000 m2 – Aussagen zurinneren Gliederung der Siedlung machen lassen werden. Hervorzuheben sindim Fundmaterial mehrere Wetzsteine, ein rechteckiges eisernes Klappmessermit zugehörigem Abziehstein, eine Lanzenspitze, eine Pfeilspitze sowie zweieiserne Sporen und eine Riemenzunge. Für die Datierung stehen demnachverschiedene Ansätze zur Verfügung. Die Sporen, von denen einer sicher alsSchlaufensporn angesprochen werden kann (Abb. 3), sind an den Anfang des9. Jahrhunderts oder um 800 zu datieren,63 ebenso die Riemenzunge, die miteinem von ihnen gemeinsam gefunden wurde.64 Die Auswertung der Keramikist noch nicht abgeschlossen, doch bereits die Durchsicht der komplett oderzu einem großen Teil restaurierbaren Gefäße legt eine Zeitstellung in das7.–9. Jahrhundert nahe. Machart und Gefäßformen finden dabei ihre bestenParallelen in Komplexen mit sächsischer Siedlungskeramik,65 es kommenjedoch auch einige Formen des Sukower Typs vor (Abb. 4–7). Eine Analysevon ausgewählten Scherben unter chemisch-technologischen Gesichtspunk-ten konnte zeigen, dass die Gefäße offenbar nicht alle vor Ort hergestelltwurden, sondern in verschiedenen Siedlungen der Umgebung.66 Zum gegen-wärtigen Stand der Auswertungen gehen wir davon aus, dass es sich hierum eine spätsächsische Siedlung handelte. Dafür sprechen zum einen dieBefunde (ebenerdige Bebauung), aber auch ein Teil des Fundmaterials, wieetwa Klappmesser, Schlaufensporn mit eingenietetem kräftigem Stimulus, deran der Basis eine Rippenverzierung trägt, und Keramik. Es ist dabei vor allemdie Summe, die zu einem klaren Ergebnis führt, die Stücke einzeln für sichgenommen besäßen sicher nicht die ganze Aussagekraft. Für die Anwesenheitvon Slawen an diesem Platz sprechen in erster Linie die Gefäße vom SukowerTyp, die sich deutlich von den sächsischen Keramikgefäßen unterscheiden.Weitere klare Hinweise gibt es nicht. Die Datierung wird durch eine Reihe von14C-Daten gestützt. Zur Zeit liegen sechs Datierungen vor, die die Siedlungin das 7. bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts weisen.67 Für den Beginn der
63 Stein 1967, 85 f., 100. Gabriel 1991, 182 ff.64 Freundl. Mitt. N. Goßler, Berlin.65 Steuer 1974b; 1975; 1979. Hornig 199366 Brorsson 2009.67 Die Angaben betreffen den 2 Sigma-Bereich. Die Werte konzentrieren sich auf die 2
Jahrhunderte zwischen 650 und 850. Vgl. Schneeweiß in Vorb. Weitere Datierungen sindin Auftrag gegeben, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 137
Abbildung 3: Meetschow FStNr. 1. Eiserner Schlaufensporn aus der älteren, sächsi-schen Siedlungsschicht. M. 1:2.
Besiedlung sind die beiden frühesten Daten von besonderer Relevanz, die sieauf jeden Fall vor 775 n. Chr. ansetzen lassen, möglicherweise aber auch schondeutlich eher, im 7. Jahrhundert.68 Besonders die eisernen Sporen, aber auchdie Keramik sprechen für eine Laufzeit der Siedlung bis in das beginnende9. Jahrhundert, zusammen mit den 14C-Daten vielleicht bis maximal in dieMitte des 9. Jahrhunderts. Während also das Ende der Siedlung relativ sicherin die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts datiert werden kann, muss der Beginnetwas vage bleiben. Eine Siedlungsdauer von 200 Jahren scheint angesichtsder Fundmenge und der Befunddichte zu hoch gegriffen, ein Siedlungsbeginnin der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts dürfte daher wahrscheinlicher sein.
Die Grabungsergebnisse im Zusammenhang mit der Magnetprospektion desFundplatzes ergaben nun ein völlig neues Bild der Anlage (Abb. 8). Demnachwurde die unbefestigte Siedlung, nachdem sie schon eine Zeitlang bestandenhatte, mit einem Wall versehen, der eine etwa ovale Fläche von ca. 2 haeinschloss. Der Südwall wurde mit Sicherheit auch im 10. Jahrhundert nochgenutzt, der zugehörige Graben ist teilweise heute noch sehr gut im Geländezu erkennen. Ob das gleiche auch für den Nordwall gilt, lässt sich nicht mitSicherheit sagen. Von diesem Wall war lediglich die Basis erhalten, denn erfiel zum größten Teil einer späteren Einebnung zum Opfer. Dennoch wurdenhier einige interessante Beobachtungen gemacht, die einen Anhaltspunkt fürseine Datierung liefern könnten. Teilweise zog die Siedlungsschicht des 8.Jahrhunderts unter den Wall, teilweise zog sie aber auch an ihn heran. Diesstützt stratigraphisch die Annahme, dass die zunächst offene Siedlung später
68 Erlangen: Erl-13668 (verkohltes Getreide): 1361 ± 38 BP, cal. AD: 606–713 (88,0%),744–767 (7,4%); Kiel: KIA 33563 (Knochen): 1274 ± 22 BP, cal. AD: 674–775 (95,4 %).
138 Jens Schneeweiß
Abbildung 4: Meetschow FStNr. 1. Keramik aus der älteren Siedlungsschicht. Gefäße,die sich dem sächsischen Formenspektrum und seiner Machart zuordnen lassen (1–4).
M. 1:3.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 139
Abbildung 5: Meetschow FStNr. 1. Keramik aus der älteren Siedlungsschicht. Gefäße,die sich dem sächsischen Formenspektrum und seiner Machart zuordnen lassen (1–3).
M. 1:3.
140 Jens Schneeweiß
Abbildung 6: Meetschow FStNr. 1. Keramik aus der älteren Siedlungsschicht. Essind sowohl Gefäße vertreten, die sich dem sächsischen Formenspektrum und seinerMachart zuordnen lassen (1–2) als auch Gefäße, die dem aus dem slawischen Sied-lungsgebiet geläufigen Sukower Typ entsprechen (3). Aufgrund von Übergangsformen
ist nicht in jedem Falle eine eindeutige Zuordnung vorzunehmen. M. 1:3.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 141
Abbildung 7: Meetschow FStNr. 1. Keramik aus der älteren Siedlungsschicht. Gefäße,die dem aus dem slawischen Siedlungsgebiet geläufigen Sukower Typ entsprechen.
M. 1:3.
142 Jens Schneeweiß
Abbildung 8: Topographischer Lageplan und Magnetogramm der Fundstelle Meet-schow 1 am Ufer des Laascher Sees. Farbig gekennzeichnet ist schematisch die Lageder beiden slawischen Ringwälle Meetschow I und II sowie der Verlauf des älteren
Nord- und Südwalles.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 143
befestigt wurde. Obwohl der Wall augenscheinlich abgebrannt war,69 hattensich an seiner Basis nur wenige Konstruktionshölzer in Holzkohle erhalten.Ihre Erhaltung war so schlecht, dass eine dendrochronologische Datierungnicht gelang, wohl aber eine Holzartbestimmung.70 Demnach wurden hierEiche, Erle und Ulme verwendet, dieselben Holzarten wie auf dem KastellHöhbeck. Auch konstruktiv lassen sich einige Parallelen anführen. Dies be-trifft insbesondere die dichte Lage der Hölzer quer zum Wallverlauf. Diesewaren zwar vergangen, aber ihre Lage wurde deutlich von den Verfärbungennachgezeichnet (Abb. 9). Wie auch am Kastell wurden hier mächtige Pfostennur in größeren Abständen eingebracht. Diese hatten eine Mächtigkeit von biszu 60 cm (Abb. 10). Diese auffälligen Parallelen zwischen der großen Befesti-gung von Meetschow und dem Kastell, die sie gleichzeitig von den slawischenBurgen stark unterscheiden, führen dazu, einen zunächst chronologischenZusammenhang beider Anlagen anzunehmen. Demnach wäre die Errichtungder Befestigung um 800 anzunehmen, das Auftreten der Sporen in diesemZeitraum stützt diese Annahme.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass dem Nordwall kein Graben vorgelagertwar, sondern hier offenbar das Ufer eines Gewässers befestigt wurde. DieMikrotopographie muss sich demnach stark von den heutigen Verhältnissenunterschieden haben.
Sowohl der Nord- als auch der Südwall zeigten deutliche Brandspuren, al-lerdings kann der Zeitpunkt der Brandzerstörung nicht genauer bestimmtwerden. Wie bereits angesprochen wurde, ist von einer Nachnutzung dergroßen Wallanlage in mittelslawischer Zeit auszugehen, so dass die Zerstörungwahrscheinlich eher in das 10. Jahrhundert datiert werden muss. Dafür sprichtweiterhin, dass die sächsische Siedlung keinerlei Spuren einer gewaltsamenZerstörung zeigte, sie scheint geräumt worden zu sein. Der größte Teil dieserSiedlungsschicht war von einer sandig-lehmigen Auftragsschicht überdeckt,die sie dadurch klar von der slawischen Siedlungsschicht des 10. Jahrhundertstrennte. Sinn und Zweck dieses Bodenauftrags sind nicht eindeutig zu be-stimmen. Es lässt sich zunächst nur konstatieren, dass in mittelslawischerZeit (Ende 9. und 10. Jahrhundert) zwei Ringwälle in Meetschow errichtet
69 Das legt einerseits der Magnetometerplan nahe und andererseits regelrechte Brandver-sturzschichten, die nur vom Wall herrühren können.
70 Der Versuch einer dendrochronologischen Datierung wurde von Dr. H.-H. Leuschner(Göttingen) unternommen. Eine in Auftrag gegebene 14C-Datierung liegt noch nicht vor.Die erste Ansprache der Holzart führte Dr. H.-H. Leuschner, Göttingen, durch. Eineausführliche und detaillierte Analyse der Holzarten ist derzeit an der Universität Kiel inArbeit.
144 Jens Schneeweiß
Abbildung 9: Meetschow FStNr. 1, Nordwall. Im Planum ließen sich stellenweisedeutlich die Verfärbungen vergangener, senkrecht zum Wallverlauf liegender Hölzererkennen. Direkt vor dem inneren Wallfuß befand sich eine auffällige Stein- und
Knochenkonzentration (links im Bild).
wurden, deren chronologisches und funktionales Verhältnis zueinander nichtgeklärt ist. Meetschow I, seit langem bekannt, zeichnete sich durch sehr guteHolzerhaltung aus, so dass seine Datierung keine Schwierigkeiten bereitete.71
Meetschow II wurde dagegen erst durch die Magnetprospektionen entdeckt.Diese Befestigung lag etwa 100m entfernt von Meetschow I, wie jene inner-halb der älteren großen Befestigung, doch wurde sie komplett eingeebnet,so dass von ihr keine Spuren mehr obertägig zu erkennen sind. Dieser Wallgründete über der Auftragsschicht und dadurch etwa 1,6m höher als derRingwall Meetschow I. Das hatte zur Folge, dass hier kein Holz erhalten war.
71 Baubeginn: 906–915 (Wk), Erneuerung/Ausbau: 929 (Wk), Erneuerung/Ausbau: 940–950 (Kern/Splint), Erneuerung: 1014 (Wk). Vgl. Schneeweiß in Vorb. b
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 145
Abbildung 10: Meetschow FStNr. 1, Nordwall. Einzelner, etwa 60 cm starker Pfostenim Inneren des Walles. Er ist nur partiell in Holzkohle erhalten und zeigt deutliche
Brandspuren innerhalb seiner Verfüllung.
Über die Keramik gelang bisher nur eine Einordnung in das 10. Jahrhundert.Eine mögliche Hypothese besagt, dass der Ringwall Meetschow II angelegtwurde, nachdem Meetschow I in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhundertsdurch eine Flutkatastrophe zerstört wurde.72 Dies würde den Bodenauftragals Hochwasserschutzmaßnahme erklären helfen, ihn allerdings ebenfalls erstin das 10. Jahrhundert datieren. Die Art der Überdeckung von Befunden undKulturschicht der älteren Siedlung spricht allerdings für einen nur sehr kurzenZeitraum zwischen Auflassung der älteren Siedlung und Bodenauftrag, wasfür dessen Datierung in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts sprechen würde.Da die Analysen des Fundmaterials aus Meetschow noch nicht abgeschlossensind, kann auf eine Klärung dieser Frage gehofft werden, die allerdings fürdie hier behandelte Thematik zweitrangig ist. Lange stand auch die Frageim Raum, woher das Material für den Bodenauftrag genommen wurde. Einenaheliegende Antwort scheint zu sein, dass der große Wall in seinem östlichenBereich teilweise abgetragen und ausgebreitet wurde. Darauf wurde dannspäter der Ringwall Meetschow II errichtet.
72 Dafür gibt es verschiedene Indizien, vgl. Schatz in Vorb., Schneeweiß in Vorb. c.
146 Jens Schneeweiß
Abbildung 11: Fragment einer bronzenen Fibel mit Verzierungim germanischen Tierstil II. Sie wurde auf dem Terrain derslawischen Siedlung Brünkendorf FStNr. 13 auf der Meetschowgegenüber liegenden Seite des (rezenten) Laascher Sees gefun-den, in etwa 200m Entfernung von der Meetschower Burg.
M. 1:1.
Wie dem auch sei, entscheidend sind für die hier interessierende Frage vorallem zwei Punkte. Erstens, dass die sächsische Siedlung offensichtlich vorder Mitte des 9. Jahrhunderts verlassen wurde, und zweitens, dass nacheinem klaren Bruch Slawen an dieser Stelle eine Befestigung errichteten, undzwar nicht vor dem ausgehenden 9. Jahrhundert. Es bleibt noch festzuhalten,dass die slawische Besiedlung offenbar nur im Ringwall Meetschow I überdas 10. Jahrhundert hinausging. Nach der mutmaßlichen Zerstörung durchÜberflutung in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts wurde er zu Beginn des11. Jahrhunderts erneut instand gesetzt, während die Wallanlage MeetschowII keine späteren Nutzungsspuren aufweist. Meetschow I wurde später auchnoch zu einer Motte umgebaut, bevor die Niederung durch den Deichbauvernässte und gänzlich aufgegeben werden musste.
Wie sieht die nähere Umgebung von Meetschow aus, was gibt es zwischen dersächsischen Siedlung in der Niederung und dem etwa 3 km entfernten Kastellauf dem Steilufer des Höhbeck? In direkter Nachbarschaft der MeetschowerBurg, am gegenüberliegenden Ufer des (rezenten) Laascher Sees, befindetsich eine Siedlung, deren Schwerpunkt in mittel- und spätslawischer Zeitliegt. Es ist nicht ganz sicher auszumachen, wann diese Siedlung beginnt,möglicherweise im 9. Jahrhundert. Auch hier ist die Auswertung noch nichtabgeschlossen, bislang liegen keine Hinweise vor, die auf eine Besiedlung andieser Stelle schon im 8. Jahrhundert deuten könnten. Hervorzuheben istindes der Fund des Bruchstücks einer im germanischen Tierstil II verziertenFibel, die bislang singulär an diesem Platz ist (Abb. 11). Wie auch immerman es genau bewerten möchte,73 es belegt doch eine gewisse Bedeutungdes Höhbeck auch in der befundarmen Zeit der Völkerwanderung und des
73 Vgl. dazu Willroth in Vorb.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 147
Abbildung 12: Heiligenfibel mit Resten rötlichen Grubenemails.Sie wurde auf dem mehrphasigen Fundplatz Vietze FStNr. 63gefunden, in etwa 1 km Entfernung von der Meetschower Burg.
M. 1:1.
aufkommenden Frühmittelalters und unterstreicht die Möglichkeit eines hiergelegenen Elbübergangs auch schon in früherer Zeit.
Ein weiterer slawischer Siedlungsplatz, knapp 1 km von Meetschow entfernt,ist Vietze FStNr. 63. Von diesem Fundplatz sind Hinterlassenschaften seitdem Neolithikum bekannt.74 Die slawische Besiedlung beginnt hier wahr-scheinlich im 9. Jahrhundert. Die Auswertung ist jedoch auch hier noch nichtabgeschlossen. Bemerkenswert, und in Bezug auf die hier behandelte Thema-tik von großer Bedeutung, ist der Fund einer Heiligenfibel im Randbereichder slawischen Siedlung von Vietze (Abb. 12).75 Der Fund stammt aus demPflughorizont und ist daher – wie die meisten Heiligenfibeln – ohne eindeuti-gen Kontext. Eine Betrachtung seines Fundkontextes in kleinerem Maßstabzeigt jedoch, dass er durchaus für unsere Fragestellung aussagekräftig ist.Derartige Scheibenfibeln mit eindeutig christlichem Symbolgehalt bleiben inihrer Verbreitung klar auf das sächsisch-fränkische Gebiet beschränkt (Abb.13), im slawischen Siedlungsgebiet wurde bislang noch kein einziger derar-tiger Fund bekannt. Die Datierung wird durchaus kontrovers diskutiert.76
Ein Zusammenhang dieses Fundes aus Vietze mit der sächsischen Siedlungvon Meetschow bzw. dem fränkischen Kastell auf dem Höhbeck (in dem einsächsischer Legat namens Odo saß)77 scheint jedoch im Gesamtkontext mehrals nahe liegend, denn es lässt sich nach der Mitte des 9. Jahrhunderts bisweit ins 10. Jahrhundert kein sächsisch-fränkischer Einfluss im archäologi-schen Fundmaterial mehr feststellen. Einerseits kann die Heiligenfibel aus
74 Schneeweiß, Wittorf in Vorb.75 Schneeweiß 2010.76 Vgl. die Zusammenfassung der Debatte bei Krüger 1999, 150 ff.77 Annales a. 810.
148 Jens Schneeweiß
Abbildung 13: Die Verbreitung der Heiligenfibeln. Nicht kartierte Neufunde derletzten Jahre verändern das Verbreitungsbild nicht, sondern verdichten es nur.
Vietze also den Befund untermauern, dass das linkselbische Gebiet inklusiveHöhbeck bis in das beginnende 9. Jahrhundert hinein sächsisch-fränkisch war,andererseits liefern ihr nahe liegender Zusammenhang mit der sächsischenSiedlung in Meetschow und dem Höhbeck-Kastell Argumente für ihre (Früh-)Datierung in das beginnende 9. Jahrhundert – ohne dass dies ein Zirkelschlusswäre. Sowohl Datierung als auch sächsisch-fränkische Einordnung der älte-ren Siedlung von Meetschow und des Höhbeck-Kastells sind auch ohne dieHeiligenfibel tragfähig.
Die Besiedlungsgeschichte an der unteren Mittelelbe kann aus archäologi-scher Sicht also folgendermaßen zusammengefasst werden: Nach vereinzeltenHinweisen auf menschliche Anwesenheit in der Völkerwanderungszeit wirdeine Besiedlung frühestens im 7. Jahrhundert greifbar. Linkselbisch liegendie Anfänge einer sächsischen Siedlung in Meetschow vielleicht schon im 7.Jahrhundert, wahrscheinlicher jedoch erst im 8. Jahrhundert, eine weitere
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 149
sächsische oder slawische linkselbische Besiedlung lässt sich zur Zeit nichtgesichert nachweisen. Auf der rechten Elbseite wird die früheste slawischeBesiedlung wohl für das 7. Jahrhundert am Rudower See gefasst.78 Um dieWende vom 8. zum 9. Jahrhundert kommt es zum Bau von Befestigungen.Die sächsische Siedlung von Meetschow wird befestigt,79 das Höhbeck-Kastellwird errichtet, auch auf der anderen Elbseite in Lenzen-Neuehaus wird Anfangdes 9. Jahrhunderts eine slawische Burg gebaut.80 Hier wird sehr deutlichdie Grenzsituation fassbar. Im weiteren Verlauf werden jedoch noch in derersten Hälfte des 9. Jahrhunderts sowohl die sächsische Siedlung als auch dasHöhbeck-Kastell aufgegeben. Spätestens ab der Mitte des 9. Jahrhundertskommt es dann zur slawischen Besiedlung und zum slawischen Burgenbauauf linkselbischer Seite. Wahrscheinlich ersetzte von nun an die Waldzonedes Drawehn die (kurzfristige) Grenzfunktion der befestigten Elblinie.81 DasÜberdenken und Verwerfen bis vor kurzem vorherrschender Ansichten gündetin erster Linie auf einem Überlieferungs- und Datierungsproblem. Dadurch,dass die Schriftquellen keine Auskunft über die Gebiete westlich der Elbebis zur Ilmenau und zum Drawehn geben, ist man auf andere Quellen an-gewiesen. Der Verlauf der Westgrenze des gehäuften Auftretens slawischerOrtsnamen fällt in auffälliger Weise mit Ilmenau und Drawehn zusammen,82
was jedoch noch nichts über ihr Alter aussagt. Für ihr jüngeres Alter sprichtallein schon die früh aufgefallene stellenweise Diskrepanz zur Westgrenze derslawischen Fundverbreitung;83 aber es war vor allem die frühe Datierungder Burgwälle,84 die zu der Annahme führte, dass „die Slaven bereits vorAnkunft der Franken hier selbständig siedelten und diesen Raum herrschaftlichorganisierten“ (Ernst 1976, 163). In den letzten zwei Jahrzehnten wurde vorallem durch die Dendrochronologie eine Korrektur der Datierung der meistenRingwälle in das späte 9./10. Jahrhundert vorgenommen.85 So wurde dasGebiet des Hannoverschen Wendlands vermutlich erst im Laufe des 9. Jahr-hunderts von den Slawen aufgesiedelt. Es muss folglich von dem Bild Abschiedgenommen werden, dass „die alte linonische Siedlungslandschaft mit ihremMittelpunkt und Fürstensitz Lenzen entlang ihrer Lebensader, der Elbe“ zuvor
78 Goßler, Kinkeldey in Vorb.79 Wahrscheinlich ist in diesem Zusammenhang auch die Errichtung der Schwedenschanze
auf dem Höhbeck zu sehen (vgl. Schneeweiß in Vorb).80 Biermann et al. 200981 Hardt 2000, 50; 2005b; 2009.82 Beispielsweise Lübke 2001, 66 Abb. 1.83 Ernst 1976, 163 Anm. 207.84 Grimm 1958, 81 ff. Schulze 1963, 6 f. Wachter 1972. Herrmann 1985.85 Richtungsweisend Henning, Heußner 1992.
150 Jens Schneeweiß
von Karl dem Großen zerschnitten worden sei,86 vielmehr muss von einer erstim 9. Jahrhundert einsetzenden linkselbischen Besiedlung durch die Slawenausgegangen werden. Dies entspricht übrigens dem von Matthias Hardt
(2000, 51) selbst festgestellten „deutlich slawische[n] Charakter “ der Burgenim Hannoverschen Wendland „vom ausgehenden 9. bis zum 12. Jahrhundert “.Eine aktuelle Überprüfung seitens der Archäologie auch im Kerngebiet desHannoverschen Wendlands wäre wünschenswert. Die sächsisch(-fränkische)Landnahme in diesem Gebiet während des 7./8. Jahrhunderts blieb offenbarso schwach, dass letzten Endes für die befestigte Siedlung am Höhbeck dasHinterland fehlte und das Gebiet im Rahmen von veränderten Interessenlagenaufgegeben wurde. Erst im 10. Jahrhundert rückt das Gebiet dann wieder indas Blickfeld der historischen Quellen, als es in der Höhbeck-Region zur sogenannten Schlacht bei Lenzen kam.87 Diese Auseinandersetzungen findenauch in der archäologischen Überlieferung ihren Widerhall. Ein stärkerersächsisch-deutscher Einfluss wird im Fundmaterial allerdings erst mit demausgehenden 10. und vor allem ab dem 11. Jahrhundert spürbar.
7 Schlussfolgerungen
Es kann nun abschließend zusammengefasst werden, dass eine ganze Reihevon Indizien dafür spricht, dass der im Jahre 805 im Diedenhofener Kapitulargenannte Ort Schezla am Fuße des Höhbeck gelegen hat. Werden die imAllgemeinen in der Diskussion um die Lokalisierung von Schezla angelegtenKriterien zu Grunde gelegt, so lässt sich feststellen, dass sie alle auf dieein oder andere Weise erfüllt werden. Am wenigsten Widerspruch dürftedie Lage des Ortes hervorrufen, denn der Höhbeck figurierte gerade wegenseiner Lage bereits seit langem in der Schezla-Diskussion. Er liegt zwischenBardowick und Magdeburg sowie zu Beginn des 9. Jahrhunderts unzweifelhaftan der Grenze des fränkischen Reiches zu den Slawen, wahrscheinlich kreuztensich hier die Elbe als wichtige Kommunikationsader und ein bedeutenderLandweg.88 Dieser wird in erster Linie durch einen hier zu vermutendenwichtigen Elbübergang begründet, der möglicherweise bei den überlieferten
86 Hardt 2000, 50 f. Im gleichen Sinne auch Schmauder 2000, 67.87 Widukind I, 36. – Neuere archäologische Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass
die Lokalisierung und möglicherweise auch der Verlauf dieser Schlacht neu diskutiertwerden muss. Dies führt jedoch über den hier behandelten Themenkreis hinaus. Vgl. dazuBiermann in Vorb. Rossignol in Vorb. Schneeweiß, Kennecke in Vorb.
88 Saile 2009, 138.
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 151
Elbübertritten 789 und 808 genutzt worden ist. Wie W. Hübener (1989,263) feststellte, sind die 805 ausgewählten Orte des Diedenhofener Kapi-tulars aus archäologischer Sicht offenbar nicht erst aus der Grenzlage von805 heraus entstanden, sondern deutlich älteren Ursprungs. Das gilt auchfür die Siedlung am Fuße des Höhbeck, die spätestens um die Mitte des8. Jahrhunderts angelegt wurde, vielleicht sogar deutlich früher. Über dieGröße und Struktur des Ortes lassen sich leider bis auf einige wenige Ansätzekeine sehr genauen Aussagen machen. Es ist festzuhalten, dass der Ort inder Niederung um 800 befestigt wird, ob vielleicht 789, 805 oder erst 808,kann auf Grund der gegebenen Datierungsunschärfe nicht gesagt werden. Diedurch die Befestigung eingeschlossene Fläche beträgt etwa 2 ha. Damit wäreder Ort im Vergleich zu den übrigen Orten des Kapitulars, für die Flächenvon 30–50 ha angenommen werden,89 vergleichsweise klein. Allerdings bestehtAnlass zu der Annahme, dass der Grenzhandelsort sich hier nicht auf dasAreal der großen Meetschower Befestigung beschränkte, sondern sich aufein weiteres Areal erstreckte, möglichweise in mehreren Teilbereichen, beidenen eine funktionale Trennung nahe liegen würde. Für eine solche Annahmespricht u. a. der Fund einer Heiligenfibel in etwa 1 km Entfernung von derMeetschower Siedlung in Richtung Kastell, allerdings ohne Befundkontext.Letzteres kann jedoch einerseits auf die geringe Größe der archäologisch un-tersuchten Fläche in Vietze FStNr. 63 zurückzuführen sein, sowie andererseitsauf die Überlieferungsbedingungen, denn an dieser Stelle ist sowohl einedichte frühkaiserzeitliche Besiedlung als auch eine durchgehende slawischeBesiedlung seit dem 9. Jahrhundert nachgewiesen – es ist daher vorstellbar,dass eine nur kurzfristige Besiedlung um 800 im Fundmaterial untergeht.Weiterhin spricht für die Annahme eines größeren Siedlungsbereiches dasKastell selbst, das ganz sicher im Zusammenhang mit der Siedlung in derNiederung gesehen werden muss. Vielleicht ist der für das Kastell namentlichüberlieferte (sächsische) legatus Odo90 gleichzusetzen mit dem comes, demder missus Madalgaudus von 805 unterstellt war, wenn eine solche Rangfolgeund Personaltrennung nach F. Timme (1964, 128) angenommen werden darf.
Die Topographie im Elbetal um den Höhbeck und insbesondere in der heutigenSeegeniederung hat sich offenbar stark verändert, so dass eine Rekonstruktionvon Schezla – und sei es hypothetisch – schwer fallen dürfte. Sicherlich kannin Meetschow ein zentraler und wohl auch der älteste Bereich gefasst werden,was durch die Intensität der Besiedlung nahegelegt wird. Die Befunde und
89 Hübener 1989, 260.90 Annales a. 810
152 Jens Schneeweiß
das Fundspektrum lassen einen militärischen Charakter der hier gelegenenSiedlung möglich erscheinen. Eindeutige Hinweise auf Fernhandel fehlen,allerdings belegt die Analyse des keramischen Fundmaterials einen Austauschvon Alltagsgütern zwischen Sachsen und Slawen im Rahmen des ’kleinenGrenzverkehrs ’.91 Es wurde herausgearbeitet, dass dieser Befund für Schezlain der Entstehungszeit des Diedenhofener Kapitulars dem zu erwartendennicht widerspricht.
Es konnte auch gezeigt werden, dass der Lauf der Geschichte, der mit der Ver-änderung des Grenzverlaufes, einem Bevölkerungswechsel – vielleicht durchden Abzug von hier stationierten Beamten und ihrer Familien – und einerveränderten Ausrichtung der politischen Interessen verbunden war, die Tradie-rung des Ortsnamens zwar nicht ausschließt, aber doch sehr unwahrscheinlichwerden lässt. Ob die Erinnerung an den Ort Schezla sich eventuell in derNamengebung durch die nachrückenden Slawen niederschlug und sich mögli-cherweise in dem Ortsnamen Meetschow (slawisch mečь = Schwert; Erstbeleg13. Jahrhundert) wiederfinden lässt, ist ein reizvoller Gedanke, den M. Hardtäußerte. Er verdiente eine gesonderte sprachwissenschaftliche Untersuchung,obwohl zu befürchten ist, dass hier viele Zusammenhänge höchst spekulativbleiben müssen. Die nur von einer Namensähnlichkeit ausgehenden Lokalisie-rungsversuche von Schezla dürften damit letztlich zum Scheitern verurteiltsein.
Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass im Diedenhofener Kapi-tular alle relevanten Orte an der ostfränkischen Grenze genannt wordensind. In Meetschow in der Seegeniederung hat zur Zeit des Kapitulars einesächsisch-fränkische Siedlung an der Grenze zu den Slawen bestanden, derenherausgehobener Charakter durch Befestigung, Funde und den Bezug zumHöhbeck-Kastell belegt ist. Hierbei kann es sich eigentlich nur um Schezlahandeln, wenn man nicht annehmen möchte, dass es noch weitere, ähnlicheOrte an der Grenze gegeben hat, die im Diedenhofener Kapitular nicht er-wähnt wurden. Eine solche Annahme dürfte allerdings schwer zu begründensein, denn das Kapitular zielt ja gerade auf die Kontrolle entlang der gesamtenGrenze. Im Gegenteil, es sollte herausgestellt werden, dass sich hier im Grundedie Gelegenheit bietet, Einblick in einen Grenzort jener Zeit zu erhalten, dernicht durch mittelalterliche und vor allem neuzeitliche Überbauungen gestörtist, sondern dessen Nachnutzung sich im Wesentlichen auf die mittelslawischeZeit beschränkt. Durch den Abbruch der sächsisch-fränkischen Besiedlung vorder Mitte des 9. Jahrhunderts steht aus Meetschow ein Komplex aus Funden
91 Chemisch-technologische und typologische Analyse der Keramik bei Brorsson (2009).
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 153
und Befunden zur Verfügung, der als Orientierung für die Untersuchung undBeurteilung der übrigen Plätze des Diedenhofener Kapitulars dienen kann.In Meetschow liegt der zur Zeit archäologisch am besten belegte befestigteOrt an der Ostgrenze des fränkischen Reiches im frühen 9. Jahrhundert vor,ob er nun Schezla hieß oder nicht.
Zusammenfassung
Die Lokalisierung des ausschließlich im Diedenhofener Kapitular von 805 erwähnten
Grenzhandelsortes Schezla ist seit langem viel diskutierter Forschungsgegenstand. Die
Ergebnisse aktueller archäologischer Ausgrabungen am Höhbeck bieten den Anlass,
diese Frage erneut aufzugreifen, denn sie sprechen dafür, dass der genannte Ort
hier gelegen hat. Ausgehend von bisherigen Lokalisierungsversuchen, insbesondere
des bei Hitzacker an der Elbe, werden die hauptsächlich angeführten Kriterien für
eine Identifizierung mit Schezla näher beleuchtet. Die Lage zwischen Bardowick und
Magdeburg an der Elbe wirft dabei am wenigsten Widersprüche auf. Ausführlicher
und überwiegend kritisch wird das Argument der Namenähnlichkeit diskutiert, denn
Namentradierung muss als Funktion des individuellen Geschichtsverlaufs eines Ortes
gesehen werden. Sie kann somit nicht als unabdingbare Voraussetzung für eine
Identifizierung angesehen werden. Die zu erwartenden archäologischen Befunde und
Funde stehen in engem Zusammenhang damit, welche konkrete Funktion und Gestalt
den Grenzhandelsorten zur Zeit des Kapitulars zugeschrieben wird. Auch wenn
die großen Linien durch das Kapitular bekannt sind, so bleibt doch das meiste im
Detail stark hypothetisch, so dass sich im Grunde keine unstrittige spezifische Fund-
bzw. Befundzusammensetzung herausarbeiten lässt. Zu unklar ist, besonders für die
ersten Jahre nach dem Diedenhofener Kapitular, welche Rolle der Handel selbst
gegenüber seiner Kontrolle in den Grenzorten tatsächlich spielte. Archäologischer
Nachweis von Siedlung und militärischer Präsenz im frühen 9. Jahrhundert lassen
sich als Minimalforderung daraus ableiten. Die neu entdeckte sächsische Siedlung
in Meetschow bietet zahlreiche Argumente, die ihre Identifizierung mit Schezla
sehr wahrscheinlich machen. Einiges spricht dafür, dass sich Schezla dabei nicht
ausschließlich auf diese Siedlung beschränkte, sondern ein größeres Areal westlich
des Höhbeck im Gebiet der heutigen Seegemündung umfasste und möglicherweise –
wenigstens funktional – auch das Höhbeck-Kastell mit einschloss.
154 Jens Schneeweiß
New Thoughts on the Location of Schezla
The location of the border trade town of Schezla, mentioned exclusively in the
Diedenhofen Capitulary of 805, has been the subject of many scholarly debates. The
results of recent archaeological excavations at the Höhbeck offer a reason to return
to this question, as they indicate that Schezla might have been located in this area.
Starting with previous attempts of localizing Schezla, especially the one concerning
Hitzacker at the Elbe river, the main criteria listed for an identification of this
place are examined. A position between Bardowick and Magdeburg at the Elbe river
offers the least amount of contradictions. The concept of a similarity of names is
critically discussed, because a name tradition has to be viewed as a function of the
individual history of a place. Thus a name cannot be used as indispensable condition
for the identification of its location. The kind of archaeological finds and features
that can be expected to be found has to be determined by the exact function and
form ascribed to such border trade towns during the time of the capitulary. Even
though a basic outline is known from the capitulary, most details remain hypothetic,
which makes it impossible to work out a specific and undisputed configuration of
finds and features to expect. The role of trade, as opposed to its control through the
border towns is too obscure for predictions, especially for the first years following
the Diedenhofen Capitulary. Therefore it is argued that archaeological evidence of a
early 9th century settlement with military should be requested as a sine qua non. The
recently discovered Saxon settlement in Meetschow offers many criteria which make
an identification as Schezla quite likely. Several facts indicate that Schezla did not
refer only to this settlement alone but maybe to a larger area west of the Höhbeck
in the region of the present Seege estuary, which possibly – at least functionally –
included the Höhbeck fort. (FS/JS)
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 155
Literatur
Adam von Bremen
Gesta Hammaburgensis ecclesiaepontificum, hrsg. von BernhardSchmeidler, Hannover, Leipzig 1917(MGH Scriptores rerum Germanica-rum in usum scholarum separatimediti, 2).
Annales
Die Reichsannalen (Annales regniFrancorum). In: Quellen zur karo-lingischen Reichsgeschichte Teil 1,bearbeitet von R. Rau (Darmstadt1955) 1–156.
Widukind von Corvey
Rerum gestarum Saxonicarum libritres, hrsg. von G. Waitz, K. A. Kehr,Paulus Hirsch und H.-E. Lohmann,Hannover 1935 (MGH Scriptores re-rum Germanicarum in usum schol-arum separatim editi, 60).
Bernatzky-Goetze, Monika 1986:Die slawisch-deutsche Burganla-ge von Meetschow. In: Hannover.Wendland. Führer zu archäologi-schen Stätten in Deutschland 13.Stuttgart 1986, 197–200.
Bernatzky-Goetze, Monika 1991:Die slawisch-deutsche Burganlagevon Meetschow und die slawischeSiedlung von Brünkendorf, Land-kreis Lüchow-Dannenberg. NeueAusgrabungen und Forschungen inNiedersachsen 19, 1991, 229–367.
Biermann, Felix, Goßler, Norbert,Kennecke, Heike 2009:Archäologische Forschungen zuden slawenzeitlichen Burgen undSiedlungen in der nordwestlichenPrignitz. In: J. Müller, K. Neit-mann, F. Schopper (Hrsg.), Wiedie Mark entstand. 850 Jahre MarkBrandenburg. Wünsdorf 2009, 36–47.
Brorsson, Torbjörn 2009:Slavonic and Saxon pottery from
Meetschow, Niedersachsen. Wareanalyses and ICP analyses, Cera-mic Studies Report 46. Landskrona2009.
Brunner, Karl 1984:Diedenhofener Kapitular. RGA2,Band 5. Berlin, New York 1984, 407–408.
Ehlers, Caspar 2007:Die Integration Sachsens in dasfränkische Reich (751–1024). Ver-öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 231. Göt-tingen 2007.
Ernst, Raimund 1976:Die Nordwestslaven und das frän-kische Reich. Beobachtungen zurGeschichte ihrer Nachbarschaft undzur Elbe als nordöstlicher Reichs-grenze bis in die Zeit Karls desGroßen. Gießener Abhandlungenzur Agrar- und Wirtschaftsfor-schung im europäischen Osten 74.Berlin 1976.
Gabriel, Ingo 1991:Hofkultur, Heerwesen, Burghand-werk, Hauswirtschaft. In: M. Müller-Wille (Hrsg.), Starigard/Oldenburg.Ein slawischer Herrschersitz desfrühen Mittelalters in Ostholstein.Neumünster 1991, 181–250.
Grimm, Paul 1958:Die vor- und frühgeschichtlichenBurgwälle der Bezirke Halle undMagdeburg. Berlin 1958.
Gröll, Walter 1994:Überlegungen zu Schezla. Hanno-versches Wendland 14, 1992/93, 73–76.
Hammerstein-Loxten, Wilhelm von1871:Wahrscheinliche Lage des von Karldem Großen genannten Handelsor-tes Schezla. Jahrbücher des Ver-eins für Mecklenburgische Geschich-
156 Jens Schneeweiß
te und Altertumskunde 36, 1871,107–110.
Harck, Ole 1972:Nordostniedersachsen vom Beginnder jüngeren Bronzezeit bis zum frü-hen Mittelalter. Materialhefte zurUr- und Frühgeschichte Niedersach-sens 7. Hildesheim 1972.
Hardt, Matthias 1991:Das Hannoversche Wendland – ei-ne Grenzregion im frühen und ho-hen Mittelalter. In: W. Jürries(Hrsg.), Beiträge zur Archäologieund Geschichte Nordostniedersach-sens. Berndt Wachter zum 70. Ge-burtstag. Schriftenreihe des Heimat-kundlichen Arbeitskreises Lüchow-Dannenberg 8. Lüchow 1991, 155–167.
Hardt, Matthias 2000:Linien und Säume, Zonen und Räu-me an der Ostgrenze des Reiches imfrühen und hohen Mittelalter. In: H.Reimitz, W. Pohl (Hrsg.), Grenzeund Differenz im frühen Mittelal-ter. Forschungen zur Geschichte desMittelalters 1. Wien 2000, 39–56.
Hardt, Matthias 2002:Prignitz und Hannoversches Wend-land. Das Fürstentum der slawi-schen Linonen im frühen und ho-hen Mittelalter. In: R. Aurig, R.Butz, I. Gräßler, A. Thieme (Hrsg.),Im Dienste der historischen Lan-deskunde. Beiträge zu Archäologie,Mittelalterforschung, Namenkundeund Museumsarbeit vornehmlich inSachsen. Festgabe für Gerhard Bil-lig zum 75. Geburtstag, dargebrachtvon Schülern und Kollegen. Beucha2002, 95–103.
Hardt, Matthias 2005a:Erfurt im Frühmittelalter. Über-legungen zu Topographie, Han-del und Verkehr eines karolinger-zeitlichen Zentrums anlässlich der1200sten Wiederkehr seiner Erwäh-
nung im Diedenhofener KapitularKarls des Großen im Jahr 805. Mit-teilungen des Vereins für Geschichteund Altertumskunde von Erfurt 66,N. F. 13, 2005, 9–39.
Hardt, Matthias 2005b:Zur Konzeption der Elbe als Reichs-grenze im frühen und hohen Mittel-alter. In: C. von Carnap-Bornheim,H. Friesinger (Hrsg.), Wasserwe-ge: Lebensadern – Trennungslini-en. Schriften des archäologischenLandesmuseums, Ergänzungsreihe3. Neumünster 2005, 193–209.
Hardt, Matthias 2005c:The Limes Saxoniae as Part of theEastern Borderlands of the Fran-kish and Ottonian-Salian Empire.In: F. Curta (Hrsg.), Borders, Bar-riers, and Ethnogenesis. Frontiersin Late Antiquity and the MiddleAges. Studies in the Early MiddleAges 12. Turnhout 2005, 35–49.
Hardt, Matthias 2007:Mauritius, Innocentius, Petrus,Christus Salvator, Paulus und ande-re. Von Laurentius kaum eine Spur.Zu den ottonenzeitlichen Kirchen-bauten auf dem Magdeburger Dom-platz. In: G. H. Jeute, J. Schnee-weiß, C. Theune (Hrsg.), AedificatioTerrae. Beiträge zur Umwelt- undSiedlungsarchäologie Mitteleuropas.Festschrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag. Inter-nationale Archäologie, Studia hono-raria 26. Rahden/Westfalen 2007,177–183.
Hardt, Matthias 2009:Contra Magadaburg . . . contra Scla-
vorum incursiones. Zum Verhältnisvon Geschichtswissenschaft und Ar-chäologie bei der Erforschung derElbe als Nordostgrenze des Franken-reiches in der Zeit Karls des Großen.In: S. Grunwald, J. K. Koch, D.Mölders, U. Sommer, S. Wolfram
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 157
(Hrsg.), ArteFact. Festschrift fürSabine Rieckhoff zum 65. Geburts-tag, Teil 1. Universitätsforschungenzur prähistorischen Archäologie 172.Bonn 2009, 261–269.
Henning, Joachim, Heußner, Karl-Uwe 1992:Zur Burgengeschichte im 10. Jahr-hundert. Neue archäologische unddendrochronologische Daten zu An-lagen vom Typ Tornow. Ausgrabun-gen und Funde 37, 1992, 314–324.
Herrmann, Joachim 1985:Slawen in Deutschland. Ein Hand-buch. Berlin 1985:2.
Hesse, Stefan 2009:Grenzen im Landkreis Rotenburg(Wümme). Betrachtungen zur re-gionalen Ausprägung eines kultur-geschichtlichen Phänomens. In: St.Hesse (Hrsg.), Grenzen in Archäolo-gie und Geschichte. ArchäologischeBerichte des Landkreises Rotenburg(Wümme) 15. Oldenburg 2009, 5–41.
Hornig, Cornelius 1993:Das spätsächsische Gräberfeld vonRullstorf, Ldkr. Lüneburg. Interna-tionale Archäologie 14. Buch amErlbach 1993.
Hostmann, Christian 1874:Der Urnenfriedhof von Darzauin der Provinz Hannover. Braun-schweig 1874.
Hübener, Wolfgang 1989:Die Orte des Diedenhofener Capi-tulars von 805 in archäologischerSicht. Jahresschrift für mitteldeut-sche Vorgeschichte 72, 1989, 251–266.
Jankuhn, Herbert 1953:Der fränkisch-friesische Handel zurOstsee im frühen Mittelalter. Vier-teljahresschrift für Sozial- und Wirt-schaftsgeschichte 40, 1953, 193 ff.
Krüger, Kristina 1999:Eine Heiligenfibel mit Zellenemail
aus Ochtmissen, Stadt Lüneburg,Ldkr. Lüneburg. Zu Auswertungs-und Aussagemöglichkeiten einer ar-chäologischen Materialgruppe. DieKunde N. F. 50, 1999, 129–204.
Krüger, Kristina 2000:Eine Heiligenfibel aus Cluvenhagen,Gde. Langwedel, Kr. Verden. DieKunde N. F. 51, 2000, 109–116.
Kuhn, Rainer 2009a:Die Vorgängerbauten unter demMagdeburger Dom. In: R. Kuhnet al., Aufgedeckt II. Forschungs-grabungen am Magdeburger Dom2006–2009. Archäologie in Sachsen-Anhalt, Sonderband 13. Halle/S.2009, 31–86.
Kuhn, Rainer 2009b:Die Kirchen des Domhügels. EinVorschlag zu ihrer Identifizierungnach den Grabungen. In: R. Kuhnet al., Aufgedeckt II. Forschungs-grabungen am Magdeburger Dom2006–2009. Archäologie in Sachsen-Anhalt, Sonderband 13. Halle/S.2009, 221–234.
Kuhn, Rainer, Brandl, Heiko, Eh-
lers, Caspar, Forster, Christi-an, Hartung, Claudia, Helten,Leonhard, Möller, Roland, Riese,Torsten, Schenkluhn, Wolfgang,Zickgraf, Benno 2009:Aufgedeckt II. Forschungsgrabun-gen am Magdeburger Dom 2006–2009. Archäologie in Sachsen-Anhalt, Sonderband 13. Halle/S.2009.
Langen, Ruth 1989:Die Bedeutung von Befestigun-gen in den Sachsenkriegen Karlsdes Großen. Westfälische Zeitschrift139, 1989, 181–211.
Last, Martin 1977:Niedersachsen in der Merowinger-und Karolingerzeit. In: H. Patze(Hrsg.), Geschichte Niedersachsens1. Hildesheim 1977, 543–652.
158 Jens Schneeweiß
Linnemann, Sophie 2007:Die slawischen Befunde amHitz acker-See, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Unveröffentl. Magis-terarbeit im Fach Ur- und Früh-geschichte an der PhilosophischenFakultät der Georg-August Univer-sität. Göttingen 2007.
Linnemann, Sophie in Vorb.: NeueUntersuchungen zur slawischen Be-siedlung an der Jeetzel bei Hitza-cker In: K.-H. Willroth (Hrsg.), Sla-wen an der Elbe. Göttinger For-schungen zur Ur- und Frühgeschich-te 1 (in Vorbereitung).
Lübke, Christian 2001:Die Ausdehnung ottonischer Herr-schaft über die slawische Bevölke-rung zwischen Elbe/Saale und Oder.In: M. Puhle (Hrsg.), Otto derGroße. Magdeburg und Europa I.Mainz a. R. 2001, 65–74.
Lüth, Fritz, Messal, Sebastian 2008:Slawen an der unteren Mittelelbe.Archäologie in Deutschland 4/2008,2008, 6–11.
Miesner, Heinrich 1937:Lag das alte Schezla im wendischenoder sächsischen Gebiet? Eine Fragean die Vorgeschichtsforscher. Nach-richten aus Niedersachsens Urge-schichte 11, 1937, 166–187.
Meyer, Hinrich 1953:Alte Wege um Scheeßel. Die KundeN. F. 4, 1953, 44–46.
Morgenstern, Peggy in Vorb.:Die Tierknochenfunde von Meet-schow im Wandel der Besiedlung.In: K.-H. Willroth (Hrsg.), Slawenan der Elbe. Göttinger Forschun-gen zur Ur- und Frühgeschichte 1(in Vorbereitung).
Müller-Wille Michael 2002:Frühstädtische Zentren der Wikin-gerzeit und ihr Hinterland. DieBeispiele Ribe, Hedeby und Re-ric. Akademie der Wissenschaften
und der Literatur. Abhandlungender Geistes- und sozialwissenschaft-lichen Klasse 2002, Nr. 3. Mainz2002.
Ruchhöft, Fred 2008:Vom slawischen Stammesgebiet zurdeutschen Vogtei. Die Entwicklungder Territorien in Ostholstein, Lau-enburg, Mecklenburg und Vorpom-mern im Mittelalter. Rahden/Westf.2008.
Pudelko, Alfred 1967:Der Sieleitz von Schlannau, KreisLüchow-Dannenberg, ein frühmit-telalterlicher Handelsplatz? DieKunde N. F. 18, 1967, 133–143.
Saile, Thomas 2007a:Slawen in Niedersachsen. Zur west-lichen Peripherie der slawischenÖkumene vom 6. bis 12. Jahrhun-dert. Göttinger Schriften zur Vor-und Frühgeschichte 30. Neumünster2007.
Saile, Thomas 2007b:Franken in den Elblanden. Nach-richten aus Niedersachsens Urge-schichte 76, 2007, 87–100.
Saile, Thomas 2009:Aspekte des Grenzbegriffs in denfrühgeschichtlichen Elblanden. In:St. Hesse (Hrsg.), Grenzen in Ar-chäologie und Geschichte. Archäolo-gische Berichte des Landkreises Ro-tenburg (Wümme) 15. Oldenburg2009, 121–163.
Schmauder, Michael 2000:Überlegungen zur östlichen Gren-ze des karolingischen Reiches unterKarl dem Großen. In: W. Pohl, H.Reimitz (Hrsg.), Grenze und Dif-ferenz im Mittelalter. Forschungenzur Geschichte des Mittelalters 1.Wien 2000, 57-97.
Schneeweiß, Jens 2007a:Teilprojekt 3: Slawische Burgen undihr ländliches Umfeld im nordöst-lichen Niedersachsen. Archäologi-
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 159
sches Nachrichtenblatt 12, 2007,272–276.
Schneeweiß, Jens 2007b:1100 Jahre Meetschow – neue Ein-blicke in eine alte Burg. Archäologiein Niedersachsen 10, 2007, 102–105.
Schneeweiß, Jens 2009:Kastell Karls des Großen an der El-be eindeutig datiert. Archäologie inDeutschland 4/2009, 2009, 52–53.
Schneeweiß, Jens 2010:Eine Heiligenfibel aus Vietze-Höhbeck, Lkr. Lüchow-Dannenberg,an der Ostgrenze des FränkischenReiches. In: C. Theune, F. Bier-mann, R. Struwe, G. H. Jeute(Hrsg.), Zwischen Fjorden und Step-pe. Festschrift für Johan Callmer.Internationale Archäologie. Studiahonoraria 31. Rahden/Westf. 2010,251–262.
Schneeweiß, Jens in Vorb.:Die Datierung des Höhbeck-Kastells an der Elbe. In: F. Bier-mann, T. Kersting, A. Klammt(Hrsg.), Beiträge der Sektion zurslawischen Frühgeschichte der 18.Jahrestagung des MOVA in Greifs-wald, 23.–26. März 2009 (in Vorbe-reitung).
Schneeweiß, Jens in Vorb. b:Slawenzeitliche Befestigungen amHöhbeck. Akten des Kolloquiumszum Abschluss des DFG-Projekts„Slawen an der unteren Mittelelbe“vom 7.-9.4.2010 in Frankfurt/Main(in Vorbereitung).
Schneeweiß, Jens in Vorb. c:Raumnutzung und Siedlungsgefü-ge im Seegemündungsgebiet. Aktendes Kolloquiums zum Abschluss desDFG-Projekts „Slawen an der unte-ren Mittelelbe“ vom 7.-9.4.2010 inFrankfurt/Main (in Vorbereitung).
Schneeweiß, Jens, Wittorf Danie-la in Vorb.:Nur eine neolithische Scherbe aus
Vietze? Hannoversches Wendland(in Vorbereitung).
Schuchhardt, Carl 1924:Die frühgeschichtlichen Befestigun-gen in Niedersachsen. Bad Salzuflen1924.
Schuchhardt, Carl 1934:Vorgeschichte von Deutschland.München 1934:2.
Schulze, Hans K. 1963:Adelsherrschaft und Landesherr-schaft. Studien zur Verfassung- undBesitzgeschichte der Altmark, desostsächsischen Raumes und des han-noverschen Wendlandes im hohenMittelalter = Mitteldeutsche For-schungen 29. Köln-Graz 1963.
Schulze, Hans K. 1972:Das Wendland im frühen und ho-hen Mittelalter. NiedersächsischesJahrbuch für Landesgeschichte 44,1972, 1–8.
Schwineköper, Berent 1957 :Die Lösung des Schezla-Problems.Eine Richtigstellung. Blätter zurDeutschen Landesgeschichte 93,1957, 244–248.
Sindbæk, Søren M. 2007:Networks and nodal points: theemergence of towns in early VikingScandinavia. Antiquity 81, 2007,119–132.
Sprockhoff, Ernst 1955:Neues vom Höhbeck. Germania 33,1955, 50–67.
Sprockhoff, Ernst 1958:Kastell Höhbeck 1956. In: NeueAusgrabungen in Deutschland. Ber-lin 1958, 518–531.
Sprockhoff, Ernst 1958b Die Gra-bung auf dem Höhbeck 1956. Ger-mania 36, 1958, 229–233.
Stein, Frauke 1967:Adelsgräber des 8. Jahrhunderts inDeutschland. Germanische Denk-mäler der Völkerwanderungszeit A9. Berlin 1967.
160 Jens Schneeweiß
Steuer, Heiko 1973:Slawische Siedlungen und Befesti-gungen im Höhbeck-Gebiet – Kur-zer Bericht über die Probegrabun-gen 1972 und 1973. HannoverschesWendland 4, 1973, 75–86.
Steuer, Heiko 1974a:Die slawische und deutsche Burgan-lage bei Meetschow, Kr. Lüchow-Dannenberg. In: H.-G. Peters(Hrsg.), Archäologie des Mittelal-ters und der Neuzeit in Niedersach-sen. Eine Ausstellung des Nieder-sächsischen Ministers für Wissen-schaft und Kunst. Hannover 1974,80–81.
Steuer, Heiko 1974b:Die Südsiedlung von Haithabu. Stu-dien zur frühmittelalterlichen Kera-mik im Nordseeküstenbereich undin Schleswig-Holstein. Die Ausgra-bungen in Haithabu 6. Neumünster1974.
Steuer, Heiko 1975:Die frühgeschichtliche Siedlung beiLiebenau, Kr. Nienburg (Weser). I.Frühmittelalterliche Keramik ausder Siedlung Liebenau. Nachrichtenaus Niedersachsens Urgeschichte 44,1975, 199–244.
Steuer, Heiko 1976:Die slawische und deutsche Burgan-lage bei Meetschow, Kreis Lüchow-Dannenberg. Archäologisches Kor-respondenzblatt 6, 1976, 163–168.
Steuer, Heiko 1979:Die Keramik aus der frühgeschicht-lichen Wurt Elisenhof, Die frühge-schichtliche Marschensiedlung beimElisenhof in Eiderstedt 3. Frank-furt/Main, Bern, Las Vegas 1979.
Stoob, Heinz 1984:Salzwedel. Deutscher StädteatlasIII. Dortmund 1984, Bl. 8.
Tempel, Wolf-Dieter 1991:Lag das historische Schezla in Schee-ßel, Landkreis Rotenburg? In: W.
Jürries (Hrsg.), Beiträge zur Ar-chäologie und Geschichte Nord-ostniedersachsens. Berndt Wachterzum 70. Geburtstag. Schriftenreihedes Heimatkundlichen Arbeitskrei-ses Lüchow-Dannenberg 8. Lüchow1991, 139–144.
Timme, Fritz 1964:Scheeßel an der Wümme und dasDiedenhofener Capitular von 805.Zur Frage nach Lage und Aufgabender karolingischen Grenzkontrollor-te von der Elbe bis zur Donau. Blät-ter für deutsche Landesgeschichte100, 1964, 122–144.
Verhulst, Adriaan 1986:Diedenhofener Kapitular. Lex. MA3, 1986, Sp. 998–999.
Wachter, Berndt 1972:Deutsche und Slawen im hanno-verschen Wendland – ein Beitragder Archäologie. NiedersächsischesJahrbuch für Landesgeschichte 44,1972, 9–26.
Wachter, Berndt 1998:Die slawisch-deutsche Burg aufdem Weinberg in Hitzacker/Elbe.Bericht über die Grabungen von1970–1975. Ein Beitrag zur Frühge-schichte des Hannoverschen Wend-lands. Göttinger Schriften zur Vor-und Frühgeschichte 25. Neumünster1998.
Willroth, Karl-Heinz 2000:Das Hannoversche Wendland um1000. In: A. Wieczorek, H.-M. Hinz(Hrsg.), Europas Mitte um 1000.Beiträge zur Geschichte, Kunst undArchäologie. Stuttgart 2000, 723–726.
Willroth, Karl-Heinz 2007:DFG-Projekt: Die slawische Besied-lung an der unteren Mittelelbe. Un-tersuchungen zur ländlichen Be-siedlung, zum Burgenbau, zu Be-siedlungsstrukturen und zum Land-schaftswandel. Einführung. Archäo-
Neue Überlegungen zur Lokalisierung von Schezla 161
logisches Nachrichtenblatt 12, 2007,261–263.
Wolf, Herbert 1963:Hohbuoki, Hobeke, Höhbeck. Jahr-buch für die Geschichte Mittel- undOstdeutschlands 12, 1963, 189–194.
Wolf, Siegmund Andreas 1956:Die Lösung des Schezla-Problems.
Beiträge zur Namensforschung 7,1956, 294–298.
Wolf, Siegmund Andreas 1957:Die slavische Westgrenze in Nord-und Mitteldeutschland im Jahre805. Die Welt der Slawen 2, 1957,31–34.
Abbildungsnachweis
Abb. 1: Schuchhardt 1924, 56 Abb. 24. – Abb. 2, 9–10: Foto J. Schneeweiß. – Abb. 3,
11–12: Zeichnung P. Fleischer. – Abb. 4: Zeichnungen A. Beyer (1), P. Fleischer (2–3), S.Woditschka (4). – Abb. 5: P. Fleischer (1–2), M. Franke (3). – Abb. 6: P. Fleischer. – Abb.
7: P. Fleischer (1), D. Feiner (2). – Abb. 8: Plan Firma Posselt & Zickgraf, Graphik P.Fleischer und J. Schneeweiß. – Abb. 13: P. Fleischer, J. Schneeweiß nach Krüger 1999und 2000.
Anschrift des Verfassers:
Dr. Jens SchneeweißGeorg-August-Universität GöttingenSeminar für Ur- und FrühgeschichteNikolausberger Weg 15D-37073 Gö[email protected]://www.uni-goettingen.de/de/110560.html