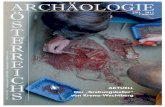Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen zur latènezeitlichen Eisenverhüttung im...
Transcript of Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen zur latènezeitlichen Eisenverhüttung im...
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 433
I. Abhandlungen
Markolf Brumlich, Michael Meyer, Bernd Lychatz
Archäologische und archäometallurgischeUntersuchungen zur latènezeitlichenEisenverhüttung im nördlichen Mitteleuropa
Abstract: In der bisherigen Forschung bestand völlige
Unklarheit darüber, ab wann im nördlichen Mitteleuropa
eine eigenständige Erzeugung von Eisen existierte und
wie die frühe Entwicklung dieser Innovation in der Spät-
hallstatt- und Latènezeit ausgesehen hat. Verschiedene
hierfür geschaffene Modelle basierten auf einer sehr
schmalen Materialbasis und konnten keine hinreichende
Klärung dieser Fragen bringen. Mit einem interdisziplinär
angelegten Forschungsprojekt war es nun möglich, erst-
mals für eine ausgewählte Region Technologie, Kapazität
und Organisation der latènezeitlichen Eisenerzeugung
ansatzweise zu erschließen. Für das Arbeitsgebiet des
Teltow ist ab der Frühlatènezeit eine Eisenverhüttung als
sicher nachgewiesen anzusehen, wobei der Stand der Ent-
wicklung zeigt, dass die Anfänge noch weiter davor zu su-
chen sind. Einem aus dem Material heraus erarbeiteten
Modell zufolge beruhte das System der Eisenversorgung
wahrscheinlich auf der Tätigkeit mobiler Spezialisten.
Keywords: Latènezeit; Vorrömische Eisenzeit; Teltow;
Glienick; Siedlung; Eisenverhüttung; Rennofen; Wander-
handwerker; Schlacke; Metallurgie.
Abstract: Autrefois, le monde de la recherche n’avait pas
de vision claire sur les débuts d’une production autonome
du fer dans le Nord de l’Europe centrale ainsi que sur
l’évolution précoce de cette innovation au Hallstatt final
et à l’époque de La Tène. Les différents modèles utilisés à
cet effet reposaient sur une très faible quantité d’objets et
ne pouvaient donc répondre à ces questions de manière
satisfaisante. Grâce à un projet de recherche interdiscipli-
naire, il fut pour la première fois possible de reconstituer
partiellement les technologie, capacité et organisation de
la production du fer d’une région donnée. Il est établi que
des activités sidérurgiques existaient dans la région étu-
diée de Teltow dès La Tène ancienne, l’état de la recherche
indiquant cependant que les débuts de la sidérurgie re-
montent encore plus loin. Le modèle développé à partir du
matériel archéologique a révélé que le système d’approvi-
sionnement en fer reposait sur la par de spécialistes itiné-
rants.
Keywords: La Tène; âge du Fer préromain; Teltow; Glie-
nick; habitat; sidérurgie; bas fourneau; artisans itiné-
rants; scories; métallurgie
Abstract: Until now, there was no clear picture in the lit-
erature of when independent iron production began in
northern Central Europe and how the innovation evolved
in the Late Hallstatt and La Tène Periods. The various re-
search models used in the past had a very narrow material
basis as their foundation and were unable to adequately
clarify these questions. An interdisciplinary research pro-
ject has for the first time been able to answer some ques-
tions respecting the technology, capacity and organi-
sation of La Tène iron production for a selected region. For
the Teltow region, there is clear evidence of iron smelting
beginning in the Early La Tène Period, although its state
of development shows that it began some time earlier.
According to a model constructed from the material, the
system of iron supply probably relied on the work of mo-
bile specialists.
Keywords: La Tène Period; Pre-Roman Iron Age; Teltow;
Glienick; settlement; iron smelting; smelting furnace;
wandering artisan; slag; metallurgy.
Markolf Brumlich M. A.: Exzellenzcluster 264 ‘Topoi. The Formationand Transformation of Space and Knowledge in AncientCivilizations’. Postadresse: Institut für Prähistorische Archäologie,Freie Universität Berlin, Altensteinstraße 15.E-Mail: [email protected]. Dr. Michael Meyer: Institut für Prähistorische Archäologie,Freie Universität Berlin, Altensteinstraße 15.E-Mail: [email protected]. Bernd Lychatz: Technische Universität BergakademieFreiberg, Institut für Eisen- und Stahltechnologie, LeipzigerStraße 34, 09599 Freiberg. E-Mail: [email protected]
DOI 10.1515/pz-2012-0021 Praehistorische Zeitschrift 2012; 87(2): 433–473
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
434 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
1 Forschungsstand undInnovationsmodelle
Die kulturelle, ökonomische und soziale Entwicklung des
prähistorischen Menschen wurde von unterschiedlichen
Innovationen geprägt. Die Technologie der Verhüttung
von Eisenerzen ist eine der nachhaltigsten und folgen-
reichsten, ohne Eisen ist selbst unser gegenwärtiges Le-
ben kaum vorstellbar.
In ihrer ersten Phase vollzieht sich diese Innovation
über einen sehr langen Zeitraum hin, genutzt wird zuerst –
soweit wir das heute wissen – Meteoreisen. Erste verläss-
liche Belege für eine Verhüttung von Eisenerzen liegen aus
der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v.Chr. aus Anatolien
vor. Der Prozess der Ausbreitung dieser Innovation nach
Norden kann heute allenfalls in groben Zügen nachvollzo-
gen werden. Zu lückenhaft ist der Forschungsstand in vie-
len Gebieten und immer wieder kommt es zu Korrekturen
der vorliegenden Daten und Beobachtungen1. Die zuletzt
von R. Pleiner2 vorgelegte gesamteuropäische Zusammen-
schau zeigt in aller Deutlichkeit, wie wichtig konzentrierte
regionenbezogene Forschungen nach wie vor sind, um die
Grundtendenzen richtig einschätzen zu können.
Im Gebiet nördlich der Alpen ist in den letzten Jahren
eine Reihe von Verhüttungsregionen in den Blickpunkt
der Forschung geraten. Besonders bemerkenswert sind
die Untersuchungen im Nordschwarzwald3, wo erstmals
im nordalpinen Raum eine späthallstattzeitliche Eisenver-
hüttung sicher nachgewiesen werden konnte. In anderen
Regionen wie an der mittleren Lahn4 oder im Umfeld des
Titelberges5 gelang inzwischen der Nachweis einer latène-
zeitlichen Eisenerzeugung. Wichtige Befunde wie etwa
der Rennofen aus Hillesheim erfuhren eine Neubewertung
und Jüngerdatierung6. Für das Alpenvorland ist nach dem
derzeitigen Kenntnisstand also von einer seit der Späthall-
stattzeit etablierten Eisenverhüttung auszugehen, für die
nördliche Mittelgebirgszone ist diese bislang ab der Früh-
latènezeit zu belegen (Abb. 1).
Aus dem Bereich nördlich der Latènekultur lagen
bis vor wenigen Jahren sicher datier- und ansprechbare
Befunde von Rennöfen erst vom Ende der vorrömischen
Eisenzeit vor (Abb. 2). Eine wesentlich frühere lokale
Eisenverarbeitung können dagegen regionale, in Eisen ge-
1 Vorbildlich in diesem Zusammenhang z.B. Nieling 2009.
2 Pleiner 2000.
3 Hierzu z.B. Gassmann/Rösch/Wieland 2006.
4 Schäfer 2011.
5 Ders. 2007.
6 Nortmann 2004/2005.
arbeitete Typen belegen7. Daneben verweisen Schlacken-
funde aus Gräbern der älteren vorrömischen Eisenzeit auf
derzeitige eisenmetallurgische Aktivitäten8. Eine genaue
Zuordnung der Schlacken zur Eisenverhüttung oder -ver-
arbeitung wurde jedoch nirgendwo vorgelegt. Der Versuch
einer Sichtung dieser Schlacken führte zu einem ernüch-
ternden Ergebnis, denn die Funde sind größtenteils nicht
mehr vorhanden, keinen Fundkomplexen zuordenbar
oder es handelt sich anstatt von Eisenschlacke um Rasen-
eisenerz. Nur im Fall eines Grabes aus Leese (Lkr. Nien-
burg/Weser) liegt noch eine Schlacke vor. Diese dürfte aus
einem Rennfeuerprozess stammen und könnte auf eine
entsprechend frühe Verhüttungstätigkeit hinweisen9.
Auf der Basis dieses Forschungsstandes wurde eine
Reihe von Modellen zum Ablauf der Innovation der Eisen-
verhüttung im nördlichen Mitteleuropa entworfen (Tab. 1).
So entwickelte L. Nørbach10 auf der Grundlage der syste-
matischen Durchsicht von Schlackenfundplätzen Däne-
marks ein dreistufiges Modell mit einer ‚introduction
phase‘, die er mit der Stufe I der vorrömischen Eisenzeit
Dänemarks parallelisierte (500–300 v. Chr.), einer ‚conso-
lidation phase‘, welche die Stufe II der vorrömischen
Eisenzeit und die ältere römische Kaiserzeit umfasst
(300 v. Chr.–200 n. Chr.), und einer anschließenden ‚cen-
tralization phase‘ (200–700/800 n. Chr.). Von Phase zu
Phase steigt sowohl die Anzahl der Fundplätze mit Eisen-
schlacken als auch das jeweilige Gesamtgewicht der
Schlacken. Dabei fehlt insbesondere für die introduction
phase eine sichere Bestimmung der Funde als Verhüt-
tungsschlacken. Aus dieser Phase stammen zudem bis-
lang keine Befunde von Rennöfen, in der zweiten Phase
liegen erst ab dem Übergangshorizont zur römischen Kai-
serzeit sichere Hinweise auf verschiedene Ofentypen vor.
C. Zimmermann11 gliedert die Entwicklung in Skandi-
navien und Schleswig-Holstein in vier Phasen. Nach einer
Phase mit dem Auftreten erster Eisenobjekte (1200–500
v. Chr.) trennt sie – mit regional zeitlich unterschiedlichen
Grenzen – in eine Phase mit ersten Schlackenfunden
und eine Phase unbedeutender, immer siedlungsgebun-
dener Eisenverhüttung mit ersten sicheren Rennöfen (500
v. Chr.–200 n. Chr.), gefolgt von der vierten Phase mit mas-
sivem Produktionsaufschwung (200–750 n. Chr.). Andere
Zäsuren setzt F. Nikulka12, der in eine Experimentierphase
(jungbronze- bis früheisenzeitlich), eine Phase mit Hin-
7 Schneider 2006; Derrix 2001.
8 Brumlich 2005.
9 Brumlich i. Vorb.
10 Nørbach 1998.
11 Zimmermann 1998.
12 Nikulka u.a. 2000.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 435
Abb. 1: Karte nachgewiesener latènezeitlicher Eisenverhüttungsreviere im nordalpinen Raum. 1) Teltow, 2) mittleres Lahntal, 3) Südharz,4) Siegerland, 5) Hillesheim, 6) Nordschwarzwald, 7) nördliche Schwäbische Alb, 8) Markgräfler Land, 9) mittleres Rothtal, 10) Donauried,11) Donaumoos, 12) unteres Altmühltal, 13) Titelberg 14) Böhmen (Grafik: M. Brumlich; Karte: maps-for-free.com)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
436 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 2: Karte sicher in die vorrömische Eisenzeit datierter Rennöfen im Jastorfgebiet und seinen Peripherien. 1) Skydebjerggård,2) Groß Siemz, 3) Lebehn, 4) Hetzdorf, 5) Delmenhorst, 6) Quedlinburg, 7) Glienick. Datierung: 1–6) späte vorrömische Eisenzeit/um Chr. Geb., 7) ältere und jüngere vorrömische Eisenzeit (Grafik: M. Brumlich; Karte: maps-for-free.com)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 437
weisen auf eine vorhandene Eisenverhüttung (ältere und
mittlere vorrömische Eisenzeit), eine dritte Phase mit zu-
nehmender technologischer Erfahrung (jüngere vorrömi-
sche Eisenzeit) und eine Phase mit allgemein etablierter
Kenntnis des Verhüttungsverfahrens (römische Kaiserzeit)
untergliedert.
Im Gegensatz zu älteren Vorstellungen von H. Hingst
betonte H. Jöns13 1998 zu Recht, dass bislang keine siche-
ren Nachweise für eine eigenständige Eisenverhüttung im
nördlichen Mitteleuropa vor dem Übergang von der spä-
ten vorrömischen Eisen- zur römischen Kaiserzeit vorlie-
gen. Die Eisenversorgung beruhe dementsprechend vor
allem auf dem Import von Eisenluppen. Im Jahr 2007 legte
er ein modifiziertes Modell vor, das unter anderem bereits
auf der Kenntnis von Daten aus dem Teltow14 beruhte.
Basierend auf den frühen Datierungen E. Hjärthner-Hol-
dars15 definiert er eine Vorphase (1500–500 v. Chr.) mit
eisernen Gegenständen, aber auch mit einer in Skandina-
vien bereits sehr früh einsetzenden Eisenerzeugung. Es
schließt sich eine Frühphase (550–300 v. Chr.) an, in der
Eisenschlacken als Belege für den Beginn der Eisenpro-
duktion gesehen werden, wobei er jedoch bemerkt, dass
bislang kaum gesicherte Spuren bekannt geworden sind.
13 Jöns 1998.
14 Jöns 2007, 58.
15 Hjärthner-Holdar/Kresten/Lindahl 1993; Hjärthner-Holdar/Risberg
2003.
Aus der Experimentierphase (300 v. Chr.–200 n. Chr.) lie-
gen erste Rennöfen vor, während in der Ausbauphase
(200–500 n. Chr.) eine deutliche Produktionssteigerung
gezeigt werden kann.
Dem schütteren Forschungsstand ist es geschuldet,
dass diese Modelle sehr grob sind. L. Nørbach16 betont,
dass „the reason for the relatively coarse chronological
scheme […] is that the material is not yet sufficiently com-
prehensive for a fine-chronological sequence.“ Allen Mo-
dellen ist in dieser Generalisierung gemeinsam, dass sie
ein lineares Innovationsmodell zugrunde legen, auch
wenn Begriffe wie Experimentierphase oder introduction
phase die Option für nicht-lineare Verläufe enthalten.
In der heutigen Innovationsforschung sind es vor
allem folgende Punkte, die nicht-linearen Modellen den
Vorzug geben: sie repräsentieren ein System unterschied-
licher und rekursiv verknüpfter Ursache-Wirkungs-Ketten
gegenüber einer einzigen im linearen Modell, sie sehen
Diskontinuitäten in der technischen Entwicklung und
betonen, dass sich unterschiedliche Phasen im Innova-
tionsprozess nicht klar voneinander abgrenzen lassen17.
Die Ausbreitung der Eisentechnologie muss und sollte
demnach wohl nicht als einfache, geradlinige Diffusion
gesehen werden. Im Gegenteil liegt ein erhebliches Er-
kenntnispotenzial in der Herausarbeitung von Diskonti-
16 Nørbach 1998, 56.
17 Braun-Thürmann 2005, 63.
Tab. 1: Modelle zur Innovation der Eisenerzeugung im norddeutsch-südskandinavischen Raum (Grafik M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
438 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
nuitäten, lokalen technischen Neuerungen und regiona-
len Unterschieden. Die Heterogenität der verwendeten
Ofentypen und die regional unterschiedliche Aufnahme
der neuen Technologie verweisen bereits beim heutigen
Forschungsstand in diese Richtung.
Einen Beitrag zu einer differenzierten Sicht auf die
Innovation Eisenverhüttung im nördlichen Mitteleuropa
sollen die Forschungen in der mittelbrandenburgischen
Landschaft des Teltow liefern, die im Rahmen eines von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projektes18 durchgeführt werden (Abb. 3) und inzwi-
schen in ein Anschlussprojekt des Berliner Exzellenz-
clusters 264 ‘Topoi. The Formation and Transformation of
Space and Knowledge in Ancient Civilizations’ gemündet
sind.19 Bereits H. Seyer20 hatte das Potenzial des Teltow für
die Untersuchung der Anfänge der Eisenverhüttung her-
vorgehoben. Eine vorzügliche und langjährige ehrenamtli-
che bodendenkmalpflegerische Betreuung der Landschaft
hat zur Auffindung einer Vielzahl von eisenzeitlichen Sied-
lungsstellen mit Schlackenfunden geführt, die bereits eine
intensive Nutzung der anstehenden Raseneisenerze an-
deuteten und eine gute Basis für gezielte Analysen darstel-
len (Abb. 4). Sondierende Grabungen und Feldbegehun-
gen in den Jahren 2000–2004 und anschließende erste
Radiokarbondatierungen an Schlackenklötzen und Ofen-
schachtfragmenten bestätigten zweifelsfrei die eisenzeit-
liche Datierung einiger Siedlungen und der in ihnen statt-
gefundenen Eisenverhüttung21. Für eine umfassendere
Ausgrabung im Rahmen des DFG-Projektes wurde die
Siedlung auf dem Fpl. Glienick 14 (Lkr. Teltow-Fläming)
ausgewählt, die bei einer der früheren Sondagegrabungen
eine besonders große Menge an Verhüttungsschlacken ge-
liefert hatte22.
18 DFG-Projekt Me 1251/4 „Eisenverhüttung in der vorrömischen
Eisenzeit des nördlichen Mitteleuropas. Das Fallbeispiel des Teltow“.
Projektleitung: Prof. Dr. Michael Meyer, Grabungsleitung und ar-
chäologische Auswertung: Markolf Brumlich M. A., archäometallur-
gische Analysen: Dr.-Ing. Bernd Lychatz. Zur Genese des Projektes
vgl. ausführlich Brumlich/Meyer/Lychatz 2011. Der vorliegende Auf-
satz stellt den Vorbericht des Projektes dar, eine ausführliche Vorlage
des gesamten Materials ist in Vorbereitung und wird in der Reihe Ber-
liner Archäologische Forschungen erfolgen. An die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) geht an dieser Stelle Dank für die Förde-
rung und Unterstützung.
19 Forschungsprojekt A-5-1 (Iron Smelting in the Teltow).
20 Seyer 1982, 35–37.
21 Brumlich 2010, 64–80.
22 Ebd. 75–82; Meyer u.a. 2004.
2 Eine Siedlung mit Eisen-verhüttung und -verarbeitungbei Glienick
2.1 Die eisenzeitliche Siedlungskammer
Eine besondere Stellung innerhalb des Teltow nimmt die
Glienicker Grundmoränenplatte ein (Abb. 4). Durch kon-
zentrierte Feldbegehungen der ehrenamtlichen Boden-
denkmalpflege ist hier eine Siedlungskammer erschlossen
worden, die deutlich das eisenzeitliche Besiedlungsmus-
ter erkennen lässt: Das höher gelegene Innere der weich-
selzeitlichen Grundmoräne mit einem großenteils aus Ge-
schiebelehm und -mergel bestehenden Untergrund wurde
gemieden, die Siedlungen reihten sich dafür auf Sand-
böden entlang des Randes der Grundmoränenplatte auf.
Letztere war von einem teils mehrere Kilometer breiten,
feuchten Moorgebiet mit Torf- und Wiesenkalkbildungen
umgeben. Die Lage der Siedlungen unmittelbar am Niede-
rungsrand gewährleistete eine konstante Wasserversor-
gung. Daneben besaß sicherlich auch der leichtere Zugang
zu Ressourcen wie Raseneisenerz und Wiesenkalk eine
Bedeutung bei der Siedlungsplatzwahl23. In den ausge-
dehnten Moorgebieten mit ihren jahreszeitlich schwan-
kenden Grundwasserständen dürften gute Bedingungen
für die Bildung von Raseneisenerzen geherrscht haben
(Abb. 5)24. Die Grundmoräne selbst wurde als Lieferant für
Lehm und Holz genutzt, beides gleichermaßen wichtige
Grundlagen für die Anlage von Siedlungen und die Eisen-
verhüttung.
Der Abstand der einzelnen Siedlungen zueinander be-
trägt teils nur wenige hundert Meter25, die zugehörigen
Gräberfelder liegen in unmittelbarer Nähe der Siedlun-
gen26. Das Bild der Besiedlung an der Glienicker Grund-
23 Eine Nutzung des Rangsdorfer und des inzwischen weitgehend
verlandeten Horstfelder Sees ist daneben ebenfalls anzunehmen.
Wichtige Verkehrswege für die überregionale Anbindung waren si-
cherlich die nahe gelegenen Flüsse Notte und Nuthe, die in nordöst-
licher und -westlicher Richtung abfließen und dann in Dahme/Spree
und Havel münden.
24 Vgl. z.B. Jöns 2010, 112.
25 Die Karte (Abb. 4) zeigt insbesondere am östlichen Rand der
Grundmoränenplatte eine ganze Kette dicht beieinanderliegender
Siedlungen. Deren feinchronologische Datierung und eine mögliche
Abfolge lassen sich durch Prospektionen nur schwer ermitteln.
26 Während es sich bei den Siedlungen bis auf den Fpl. Glienick 14
um Oberflächenfundplätze handelt, fanden auf einem großen Teil
der Gräberfelder vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Notgrabungen oder Fundbergungen statt. Zu den Gräberfeldern siehe
Seyer 1982, Kat. 424, 426, 438, 454, 455, 467, 476.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 439
Abb. 3: Geologische Karte des Teltow mit den im Rahmen des DFG-Projektes untersuchten Siedlungen.1) Fpl. Groß Schulzendorf 18, 2) Fpl. Glienick 14, 3) Fpl. Schenkendorf 4, 4) Fpl. Waltersdorf 15(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann; Grundlage: GÜK 300 Land Brandenburg, 1997)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
440 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 4: Geologische Karte der Glienicker Grundmoränenplatte mit Siedlungen und Gräberfeldern der vorrömischen Eisenzeit.Hervorgehoben sind die Fundplätze mit Eisenschlacken. 1) Fpl. Groß Schulzendorf 18, 2) Fpl. Glienick 14(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann; Grundlage: GÜK 100 Landkreis Teltow-Fläming, 2004)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 441
moränenplatte entspricht genau dem von H. Seyer für die
vorrömische Eisenzeit herausgestellten Besiedlungsmus-
ter27. Von großem Interesse ist, dass hier auf nahezu allen
Siedlungsplätzen neben eisenzeitlichen Keramikscherben
auch Eisenschlacken auftreten. Die Sichtung und mor-
phologische Bestimmung führte zu dem Ergebnis, dass es
sich größtenteils um Verhüttungsschlacken handelt. Da-
neben sind auch typische Schlacken der Weiterverarbei-
tung des erzeugten Eisens zu registrieren. Im Rahmen des
DFG-Projektes konnten zwei dieser Fundplätze am Nord-
rand der Grundmoränenplatte mittels Feldbegehungen
und geophysikalischen Messungen systematisch prospek-
tiert und einer davon durch Grabungen erschlossen wer-
den (Abb. 3; 4).
Einer dieser beiden Fundplätze, der Fpl. Groß Schul-
zendorf 18 (Lkr. Teltow-Fläming), weist eine etwa 300 ×
100 m große Fundstreuung auf, die zugleich die Größe des
ehemaligen Siedlungsareals anzeigt. Es ist ein flächen-
deckendes Vorkommen von Verhüttungsschlacken und
27 Seyer 1982, 22–29.
Ofenschachtfragmenten zu verzeichnen, daneben kom-
men auch eindeutige Verarbeitungsschlacken vor. Im öst-
lichen Randbereich der Siedlung zeigt eine sehr hohe
Konzentration der Funde starke eisenmetallurgische Akti-
vitäten an, hier befand sich anscheinend ein spezielles
Areal für die Eisenverhüttung und -verarbeitung. Dies
wird auch durch die Ergebnisse der geomagnetischen
Messungen28 bestätigt, da sich an dieser Stelle klare Ano-
malien befinden, die man teils als Rennöfen interpretie-
ren kann. Zur direkten Datierung der Eisenverhüttung
wurden aus zwei Verhüttungsschlacken Holzkohlen29 ent-
nommen. Den kalibrierten Radiokarbondaten nach kann
die Eisenproduktion auf diesem Siedlungsplatz in einem
Zeitraum von der ersten Hälfte des 4. bis in die Mitte des
1. Jahrhunderts v. Chr. stattgefunden haben und ist damit
zweifelsfrei latènezeitlich (Abb. 24; Tab. 2). Eines der bei-
28 Geomagnetische Kartierung durch K. Hannemann (Institut für
Geowissenschaften, Univ. Potsdam).
29 Die Bestimmung der Holzarten durch K.-U. Heußner (Dendro-
chronologie, Deutsches Archäologisches Institut Berlin [i. F. DAI Ber-
lin]).
Abb. 5: Fpl. Glienick 14. Luftbild des Fundplatzes am Rand der Glienicker Grundmoränenplatte,aufgenommen im Frühjahr 2009. Blick in Richtung Nordosten mit dem Rangsdorfer See und derangrenzenden feuchten Niederung. Links der Bildmitte eine der Grabungsflächen im Kernbereichder Siedlung (Foto: J. Wacker, BLDAM)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
442 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
den Daten deutet dabei auf einen Beginn der Eisenpro-
duktion in der Früh- oder Mittellatènezeit (Lt B/C1)30 hin.
2.2 Prospektionen und Ausgrabungenauf dem Fpl. Glienick 14
Ein großflächiges Vorkommen von eisenmetallurgischen
Funden ist auch auf dem zweiten Fundplatz, dem Fpl.
Glienick 14 (Lkr. Teltow-Fläming), festzustellen (Abb. 6).
Die gesamte Streuung der einzeln eingemessenen Funde
erstreckt sich über ein 380 × 200 m großes Areal entlang
des Hanges der Grundmoräne und reicht bis unmittelbar
zum Niederungsrand hinab31. Es sind drei größere Kon-
zentrationen von Funden erkennbar: Zwei Kernbereiche
der eisenzeitlichen Besiedlung mit Resten der Eisenver-
hüttung und -verarbeitung sowie Keramikfunden liegen
demnach im Süd- und im Nordosten, im Westen befindet
sich hangaufwärts eine starke Anhäufung von Verhüt-
tungsabfällen und nur wenigen Keramikscherben. Am
Mittelhang ganz im Nordwesten fand sich nochmals etwas
Keramik, dabei auch spätkaiserzeitliche Drehscheiben-
ware, die hier neben der eisenzeitlichen auch eine jüngere
Besiedlungsphase anzeigte.
30 Sämtliche auch im Folgenden angegebenen Stufen der Latène-
chronologie nach J. Brandt (2001, 67).
31 Wegen eines Waldstückes, einer Wiese und eines Feldweges
konnte nicht der gesamte Siedlungsbereich oberflächig prospek-
tiert werden. Auch die geophysikalischen Prospektionen waren we-
gen des Waldes nicht flächendeckend möglich. Bei einer früheren
Feldprospektion wurde nicht die vollständige Ausdehnung des
Siedlungsplatzes erfasst (Brumlich 2010, 75; Meyer u.a. 2004, 163
Abb. 2).
Die Ergebnisse der geomagnetischen Messungen32
stimmen mit denen überein, die durch die Feldprospektio-
nen gewonnen wurden (Abb. 7). In den Bereichen mit
Konzentrationen eisenmetallurgischer Funde befinden
sich ausgeprägte Anomalien, die unter anderem auf Anla-
gen und größere Abfallmengen der Eisenproduktion hin-
weisen können33. Besonders stark tritt ein großer Komplex
solcher Anomalien an der Stelle der hangaufwärtigen
Streuung von Verhüttungsschlacken hervor. Eine dichte
Lage ist zudem im südlichen Kernbereich der Siedlung zu
verzeichnen. An der östlichen Peripherie, also im Über-
gangsbereich zur Niederung, finden sich dagegen meh-
rere einzelne Anomalien.
Auf der Grundlage der archäologischen und geophysi-
kalischen Prospektionsergebnisse und in Anpassung an
die während der fortlaufenden Grabungen gewonnenen
Erkenntnisse wurden mehrere Grabungsschnitte geöffnet
und komplett untersucht34. Zielsetzung war es dabei, einer-
seits Befunde der Eisenverhüttung und -verarbeitung frei-
zulegen, andererseits sollte aber zugleich auch die Struk-
tur der Siedlung erfasst werden, um die Einbindung der
32 Geophysikalische Arbeiten unter der Leitung von E. Lück (Institut
für Geowissenschaften, Univ. Potsdam) und B. Ullrich (Eastern Atlas,
Berlin). Neben der Geomagnetik kamen kleinräumig auch weitere
Messverfahren zum Einsatz (Geoelektrik, -radar und Metalldetektor).
33 Die großen linearen Störungen in der Magnetik werden durch pa-
rallel zu einem Feldweg verlaufende Leitungs- und Kabelgräben ver-
ursacht, die damals ohne archäologische Begleitung mitten durch
den Fundplatz geführt wurden.
34 In den Jahren 2009 und 2010 fanden im Rahmen des DFG-Projek-
tes unter der Leitung von M. Brumlich vier Grabungskampagnen
statt, bei denen insgesamt 4950 m2 untersucht worden sind. Erste Er-
gebnisse wurden bereits in mehreren kleinen Berichten publiziert
(z.B. Brumlich 2010; 2011; 2012a; 2012b; 2012c; i. Vorb.; Brumlich/Fi-
scher 2012; Brumlich/Meyer/Lychatz 2011).
Tab. 2: Fpl. Groß Schulzendorf 18 und Schenkendorf 4. Radiokarbondatierungen (AMS) der Oberflächenfunde von Verhüttungsschlacken.OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Fundplatz (Lkr.) Proben-Nr. Probenmaterial 14C-Alter[BP]
Kalenderalter 1s (68,2 %)[calBC]
Kalenderalter 2s (95,4 %)[calBC]
Groß Schulzendorf 18(Teltow-Fläming)
Poz-44086 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2100 ± 35 172 BC (57.2 %) 89 BC75 BC (11.0 %) 57 BC
341 BC (1.3 %) 328 BC204 BC (94.1 %) 40 BC
Poz-44087 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2225 ± 35 369 BC (10.8 %) 350 BC304 BC (57.4 %) 210 BC
385 BC (95.4 %) 203 BC
Schenkendorf 4(Dahme-Spreewald)
Poz-44083 Holzkohle(Fraxinus excelsior)aus Schlacke
2200 ± 50 360 BC (40.6 %) 274 BC260 BC (27.6 %) 201 BC
391 BC (93.4 %) 157 BC135 BC (2.0 %) 116 BC
Poz-10219 Holzkohle(nicht bestimmt)aus Schlacke
2225 ± 35 369 BC (10.8 %) 350 BC304 BC (57.4 %) 210 BC
385 BC (95.4 %) 203 BC
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 443
Abb. 6: Fpl. Glienick 14. Einzelfundkartierung der Feldprospektionen (Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
444 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 7: Fpl. Glienick 14. Übersichtsplan der Geomagnetik des Siedlungsareals mit Eintragung der Grabungsschnitte(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 445
Eisenproduktion in das Siedlungsgefüge beurteilen zu
können.
Die Grabungen innerhalb des südlichen Siedlungs-
kernes erbrachten eine Vielzahl von eisenzeitlichen Be-
funden, unter denen hunderte von zylinderförmigen Spei-
chergruben, die wahrscheinlich primär der Lagerung von
Nahrungsmitteln dienten und sekundär auch zur Abfall-
entsorgung genutzt wurden, klar dominieren (Abb. 8; 9).
Zwischen diesen Gruben fanden sich auch etliche Pfosten-
gruben, die aber keine vollständigen und schon während
der Ausgrabung sicher erkennbaren Hausgrundrisse erga-
ben. Im Nachhinein lassen sich zumindest vier mögliche
Hausstandorte rekonstruieren35. In drei Fällen handelte es
sich anscheinend um recht schmale zweischiffige Lang-
häuser unterschiedlicher Ausrichtung. Daneben liegt der
Rest eines wohl ebenfalls zweischiffigen Kleingebäudes
vor. Im Umfeld der Häuser lagen vier Kalkbrennöfen und
mehrere flach eingetiefte Steinpflaster mit Lehmverstrich,
die als Fundamente von Backöfen angesprochen werden
können. Herausragend ist die Deponierung eines kom-
pletten Pferdes im westlichen Teil der Grabungsfläche36.
Von allergrößtem Interesse sind jedoch zwei Rennöfen
(Ofen 1/Bef. 412, Ofen 2/Bef. 81b), die hier im Wohn- und
Speicherareal der Siedlung freigelegt werden konnten
und auf die anschließend noch näher eingegangen wird
(Abb. 9). Neben Ofen 1 ließ sich ein Werkplatz zur Verar-
beitung der erzeugten Eisenluppen mit einem Ausheiz-
herd und der Standspur eines Ambosssteins nachweisen.
Am südöstlichen Siedlungsrand fanden sich in zwei
an geomagnetischen Anomalien angelegten Grabungs-
schnitten zwar kaum noch Siedlungsbefunde wie Spei-
chergruben, dafür aber zwei schlecht erhaltene Rennöfen
(Ofen 3/Bef. 378, Ofen 4/Bef. 405) sowie verlagerte eisen-
metallurgische Abfälle37. In einem kleinen Schnitt weiter
nördlich – ebenfalls an der Peripherie der Siedlung und
am Übergang zur feuchten Niederung – wurde ein Brun-
nen entdeckt. In seinem unteren Teil zeigte sich ein gut er-
35 Die Erkennbarkeit der zudem nicht sonderlich tief erhaltenen
Pfosten- und teils auch der Siedlungsgruben war wegen der ungüns-
tigen Bodenverhältnisse sehr schlecht, viele Befunde waren erst
beim Anlegen tieferer Plana zu erfassen. Das Fehlen von Pfosten ist
dadurch teilweise zu erklären. Es sei noch einmal ausdrücklich be-
tont, dass es sich um keine gesicherten Hausgrundrisse handelt. Die
detaillierte Vorlage der zugehörigen Einzelbefunde und eine umfas-
sende Diskussion folgen mit der Gesamtpublikation der Grabungser-
gebnisse.
36 Brumlich/Hanik 2012.
37 Die beiden Rennofenreste konnten erst im Zuge der fortgeschrit-
tenen Grabungsauswertung erkannt werden und das auch nur, weil
durch nachfolgend gegrabene Rennöfen das genaue Aussehen des
Ofentyps mit allen seinen Merkmalen geklärt wurde.
haltener Brunnenkasten aus dünnen Kiefernstämmen38.
Unmittelbar neben dem Brunnen befand sich ein Renn-
ofen (Ofen 5/Bef. 830) und neben diesem ein 4,3 × 3,4 m
großer Meiler zur Erzeugung von Holzkohle (Abb. 8).
Randlich in den Meiler eingetieft waren ein weiterer Aus-
heizherd und eine flache Vertiefung zur Aufnahme des
Ambosssteins, zwischen beiden konzentrierten sich meh-
rere Kilogramm Hammerschlag. Auch an dieser Stelle ist
von einer Luppenverarbeitung im direkten Umfeld des
Rennofens auszugehen.
Zwei Grabungsschnitte an weiteren Anomalien im
Norden des Siedlungsplatzes erbrachten im zentralen Be-
reich der dortigen Fundkonzentration einen fünften siche-
ren und einen fraglichen Kalkbrennofen sowie wenige
Pfosten und Gruben. In peripherer Lage zum Siedlungs-
kern wurde wiederum ein Rennofen (Ofen 6/Bef. 835) an-
getroffen. Im nördlichsten der Grabungsschnitte konnte
ein zweiter Kastenbrunnen ausgegraben werden. Bemer-
kenswert ist, dass der Brunnenkasten im unteren Teil an
zwei Seiten eine Reparatur aufwies, für die an Stelle von
Hölzern – aus denen die Brunnenkonstruktion ansonsten
nachweislich bestand – Schlacken- und Erzbrocken sowie
einige Steine verwendet wurden. Auch in der oberen Ver-
füllung des Brunnens lagerten zahlreiche Eisenschlacken.
Insgesamt enthielt der Brunnen rund 167 kg Verhüttungs-
schlacke. Die Schlacken dürften von zwei Rennöfen
(Ofen 7/Bef. 833, Ofen 8/Bef. 834) stammen, die sich ana-
log zur Befundsituation von Ofen 5 in unmittelbarer Nähe
des Brunnens befanden (Abb. 8). Die Entsorgung der
Schlacken erfolgte hier ansonsten auf einer flachen Schla-
ckenhalde, die bei der Grabung teilweise erfasst wurde.
Die Luppenverarbeitung lässt sich durch Funde von Ham-
merschlag und Verarbeitungsschlacken belegen.
Im Westen wurde am Hang der Grundmoräne ein grö-
ßerer Grabungsschnitt geöffnet, um den Charakter der
dortigen geomagnetischen Anomalien zu untersuchen.
Diese sind auf einen Komplex aus Lehmentnahmegruben
zurückzuführen, die sukzessive erweitert und anschlie-
ßend teilweise mit Abfällen der Eisenverhüttung verfüllt
wurden (Abb. 8). Auf der Sohle des Grubenkomplexes
fand sich der Rest einer kleinen Ofenanlage39. Keramik-
38 Brumlich 2012a, Abb. 63. Die Bestimmung der Holzart durch
K.-U. Heußner (Dendrochronologie, DAI Berlin). Eine Dendrodatie-
rung konnte trotz ansonsten guter Voraussetzungen mangels Ver-
gleichsmaterials aus der vorrömischen Eisenzeit bisher nicht erfol-
gen. Eine Datierung der Hölzer ins 4./3. Jahrhundert v. Chr. ist aber
durch zwei Radiokarbondatierungen gesichert.
39 Die Vermutung, dass eventuell ein eingebauter Rennofen vorlie-
gen könnte (Brumlich 2012a, 65; Brumlich/Meyer/Lychatz 2011, 354),
fand keine Bestätigung.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
446 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 8: Fpl. Glienick 14. Grabungsplan mit Siedlungsbefunden. Markierung wichtiger Befunde der Eisenproduktion(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 447
Abb. 9: Fpl. Glienick 14. Grabungsplan der Siedlungsbefunde im Kernbereiches der eisenzeitlichen Siedlung mit Hervorhebungwichtiger Befunde der Eisenproduktion und Vorschlägen für mögliche Hausstandorte (Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
448 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
funde und Radiokarbondatierungen (Abb. 20; Tab. 3) zei-
gen klar, dass der Grubenkomplex mit dem Ofen und den
Verhüttungsabfällen in die vorrömische Eisenzeit gehört.
Zeitgleiche Speicher- oder Pfostengruben fanden sich hier
dagegen nicht, Nachweise von Rennöfen fehlen ebenfalls.
Der Grundmoränenhang wurde in der Eisenzeit anschei-
nend ausschließlich zum Lehmabbau und zur Entsorgung
von Abfällen der Eisenproduktion genutzt. Erst für die
späte römische Kaiserzeit ist eine Besiedlung dieses Berei-
ches nachgewiesen40. Es war eine Überlagerung der eisen-
zeitlichen Lehmentnahmegruben durch kaiserzeitliche
Befunde wie Pfostengruben und steingepflasterte Feuer-
stellen feststellbar. Etwas weiter nördlich befand sich ein
Grubenhaus. Die Datierung dieser Siedlung kann in die
Stufen Eggers C2 und 3 erfolgen, also etwa in die zweite
Hälfte des 3. und das 4. Jahrhundert n. Chr.41. Belege für
40 Brumlich/Fischer 2012; Fischer 2012.
41 Ebd. 67f.
eine lokale Eisenverhüttung während der römischen Kai-
serzeit liegen nicht vor42.
2.3 Rennöfen Typ „Glienick“
Die acht in der eisenzeitlichen Siedlung ergrabenen Renn-
öfen zeigen alle weitgehend dieselben Merkmale und kön-
nen so einem einzigen Ofentyp zugeordnet werden
(Abb. 10)43. Da ein identischer Ofentyp in Mitteleuropa bis-
her nicht bekannt war, wurde dieser zur Vereinfachung der
Ansprache nach dem ersten Fundort als Typ „Glienick“ be-
42 Bei den wenigen Schlacken aus sicher kaiserzeitlichen Befunden
scheint es sich einer eingehenden Analyse nach eher um verlagertes
Material der vorrömischen Eisenzeit zu handeln (ebd. 55–58).
43 Zu den vormals erwähnten sechs Rennöfen (Brumlich 2012b, 254;
Brumlich/Meyer/Lychatz 2011, 350) kommen die beiden erst im Zuge
der Grabungsauswertung entdeckten hinzu (siehe Anm. 36).
Abb. 10: Fpl. Glienick 14. Zusammenstellung der Plana von sechs Rennöfen des Typs „Glienick“ (Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 449
nannt44. Im Grundprinzip handelt es sich um einen freiste-
henden Schachtofen mit eingetiefter Schlackengrube, also
einen Ofentyp mit vertikaler Schlackenführung. Von ähn-
lichen Rennöfen unterscheidet ihn jedoch eine vorgela-
gerte Arbeitsgrube, von der aus die Schlackengrube geöff-
net und für den nächsten Ofengang ausgeräumt werden
konnte. Es liegt also ein mehrfach verwendbarer Rennofen
vor (Abb. 18).
Ausschlaggebend für die Interpretation der Befunde
war der vorzüglich erhaltene Ofen 1 (Bef. 412). Dessen ein-
getiefte Teile waren mit der Situation nach dem letzten
Ofengang nahezu ungestört konserviert (Abb. 10–13)45.
Die Schlackengrube war bei diesem Ofen etwa 70 × 60 cm
groß und noch bis zu 50 cm tief. An drei Seiten war sie von
einem massiven Steinrahmen eingefasst und innen mit
einer Lehmauskleidung versehen. Durch den Steinrah-
men erhielt die Grube eine annähernd rechteckige Form.
Die Lücken zwischen den großen Steinplatten waren mit
kleineren Steinen gefüllt, des Weiteren fanden sich auch
kleine Verkeilsteine. Der Steinrahmen war so konstruiert,
44 Brumlich 2011, 61; 2012c, 76–77.
45 Grund hierfür ist anscheinend eine kolluviale Überdeckung des
am Hangfuß gelegenen Rennofens, die eine Zerstörung durch die
moderne Pflugtätigkeit verhinderte. Die Erhaltung reicht fast bis an
die eisenzeitliche Geländeoberfläche heran.
dass eine nahezu waagerechte Oberkante entstand, auf
die der Ofenschacht aufgesetzt werden konnte.
Am oberen Rand der Schlackengrube waren an drei
Stellen Spuren extrem starker Hitzeeinwirkung festzustel-
len, die den Rückschluss auf dort befindliche Düsenöff-
nungen gestatten. Der Rennofen war demnach mit drei
Düsen versehen, die wenig oberhalb des Steinrahmens in
der Wand des aufgehenden Ofenschachtes gesessen ha-
ben müssen. Eine der rechtwinklig zueinander angeord-
neten Düsen befand sich an der Rückseite des Ofens, die
beiden anderen jeweils ungefähr mittig an den Längssei-
ten. Aus anderen Befunden liegen Ofenschachtfragmente
mit teilweise oder komplett erhaltenen Düsenlöchern vor
(Abb. 14). Deren geringe Durchmesser zwischen 2,5 und
3 cm verweisen darauf, dass zum Einbringen der notwen-
digen Luftmenge Gebläse eingesetzt wurden46. Vom Ni-
veau des umgebenden Geländes aus wurde dem Rennofen
also mittels Blasebälgen künstlich Luft zugeführt.
In der Schlackengrube steckte ein zusammenhängen-
der Schlackenklotz, der die Grube nicht ganz ausfüllte
und nach seiner vollständigen Freilegung eine markante
46 de Rijk 2007, 157. Siehe auch im Folgenden die Berechnungen von
B. Lychatz zur Massenbilanz eines Modellofens vom Typ „Glienick“
(Kap. 3.2).
Abb. 11: Fpl. Glienick 14. Rennofen Typ „Glienick“ (Ofen 1/Bef. 412), Planum 2.In der Arbeitsgrube verstürzte Teile des Ofenschachtes und ein Mahlstein (Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
450 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
rechteckige Form erkennen ließ. Insgesamt befanden sich
noch rund 111 kg Schlacke in situ im Inneren des Renn-
ofens. Die Sohle der Schlackengrube war von annähernd
horizontal geflossener, kompakter Schlacke mit einigen
Halmabdrücken bedeckt, über der sich der damit zusam-
menhängende Schlackenklotz mit Fließstrukturen und
zahlreichen Negativen von Holzkohlestücken aufbaute.
Die Oberfläche lässt noch in etwa die Position der im letz-
ten Ofengang erzeugten Eisenluppe erkennen.
An ihrer Nordseite war die Schlackengrube aufgebro-
chen. Auf der Sohle der sich hier anschließenden Arbeits-
grube von etwa 1,0 × 1,2 m Größe lagerte ein Gemenge aus
gebranntem Lehm, Eisenschlacken und Steinen (Abb. 12).
Neben Bruchstücken des Schlackenklotzes war auch krü-
melige Eisenschlacke mit nicht komplett aufgeschmolze-
nen Erzresten vorhanden, die beim Öffnen der Schlacken-
grube aus dem Ofenschacht nachgerutscht sein dürfte.
Aus der Verfüllung der Arbeitsgrube stammen rund 35 kg
Schlacke, die dem letzten Ofengang zugeordnet werden
kann, so dass es sich um insgesamt 146 kg gehandelt hat47.
47 Eine etwas abweichende frühere Angabe (Brumlich 2011, 61) ent-
stand während der derzeit noch nicht abgeschlossenen Grabungs-
aufarbeitung. Insgesamt beinhaltete der Befund rund 151 kg Eisen-
schlacke, ein Teil davon stammt jedoch aus der oberen Verfüllung
und ist nicht sicher dem letzten Ofengang zuzuweisen. Ein theoreti-
Die Steine und ein Teil des Lehms gehörten offenbar zum
entfernten Verschluss der Schlackengrube. Darüber be-
fanden sich eine Lage großer Brocken gebrannten Lehms –
Reste des verstürzten Ofenschachtes – und ein Mahlstein,
der zuvor vermutlich beim Pochen des Erzes als Unterlage
gedient hatte (Abb. 11).
Ähnlich gute Erhaltungsbedingungen existierten bei
den Öfen 7 und 8 (Bef. 833, 834), diese wurden jedoch in
historischer Zeit gestört, die Steinrahmen und Schlacken
teilweise entfernt48. Der Ofen 8 scheint zudem bereits kurz
nach dem Betrieb auf wieder verwendbare Steine hin aus-
gebeutet worden zu sein. Beide Öfen liegen genau in einer
Linie und besaßen eine vorgelagerte Arbeitsgrube mit
identischer Ausrichtung. Konstruktion und Bedienung
des Ofentyps lassen auf eine zeitliche Abfolge der beiden
Rennöfen schließen, wobei Ofen 8 der ältere von beiden
sein muss. Möglicherweise fanden die Steine beim Bau
sches Gesamtgewicht je Ofengang von maximal etwa 150 kg erscheint
aber durchaus realistisch.
48 Wie bei Ofen 1 lag ein Kolluvium über dem Bereich mit den Öfen
(siehe Anm. 44). Dieses entstand durch Erosion im Zusammenhang
mit der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Ackerwirtschaft. Die Öfen
wurden nachweislich in dieser Zeit angegraben, vermutlich weil sie
wiederholt bei der Beackerung gestört hatten. Bei Ofen 7 wurden der
komplette Steinrahmen und der größte Teil des Schlackenklotzes
entfernt, bei Ofen 8 nur rückwärtige Teile der Schlackengrube.
Abb. 12: Fpl. Glienick 14. Rennofen Typ „Glienick“ (Ofen/Bef. 412), Planum 3a. Zustand nach demletzten Ofengang mit aufgebrochener, aber nicht mehr ausgeräumter Schlackengrube(Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 451
von Ofen 7 Wiederverwendung. Am besser erhaltenen
Ofen 8 konnten noch Maße der wiederum rechteckigen
Schlackengrube von 70 × 60 cm und eine Tiefe von 40 cm
ermittelt werden. Ein Steinrahmen mit Lehmauskleidung
war noch einwandfrei nachweisbar. In der Schlacken-
grube befanden sich die Reste eines kompakten Schla-
ckenklotzes von insgesamt rund 93,5 kg Gewicht. Zusam-
men mit den in die Arbeitsgrube verlagerten Schlacken
lassen sich 128 kg dem letzten Ofengang zuweisen. An der
Längsseite des Schlackenklotzes ist auch diesmal die Po-
sition einer Düse zu erkennen. Die Schlackengrube des
stärker zerstörten Ofens 7 war mit 35 cm Tiefe etwas fla-
cher, die anderen Maße sind nicht mehr sicher ermittel-
bar, scheinen aber in etwa denen von Ofen 8 entsprochen
zu haben.
Eine relativ kleine Schlackengrube besaß mit 60 ×
40 cm und einer Tiefe von nur 30 cm der Ofen 6 (Bef. 835).
Bei diesem war der Steinrahmen an einer Seite noch erhal-
ten, aber auch hier bereits durch die moderne Pflugtätig-
keit gestört. Die Befundsituation ist ansonsten mit jener
der anderen Rennöfen vergleichbar. Wesentlich stärkere
Zerstörungen wiesen die Öfen 2 und 5 (Bef. 81b, 830) auf,
bei diesen existierten jeweils nur noch die Unterteile der
Schlacken- und Arbeitsgruben. Standspuren herausgeris-
sener Steinplatten an den Seiten der Schlackengruben
und Splitter großer Steine können ehemals vorhanden ge-
wesene Steinrahmen belegen (Abb. 10). Bei beiden lassen
sich mit einiger Wahrscheinlichkeit noch Größen der
Schlackengruben von wiederum etwa 70 × 60 cm ermit-
teln. Die Öfen 3 und 4 (Bef. 378, 405) waren dagegen so
schlecht erhalten, dass sie nur noch mittels einiger Merk-
male demselben Ofentyp zugeordnet werden können.
Von den aufgehenden Lehmschächten war in keinem
Fall mehr etwas in situ vorhanden. Funde von Ofen-
schachtfragmenten (Abb. 14), die in andere Siedlungsbe-
funde umgelagert wurden, zeigen aber, dass die Rennofen-
schächte aus Lehm mit einer Magerung aus Getreidespreu
bestanden. Es konnten große Fragmente geborgen wer-
den, denen nach zu urteilen die Schächte aus Lehmzie-
geln errichtet wurden49. Die Wandstärke hat nachweislich
bis zu 10 cm betragen, am Übergang zur Schlackengrube
dürfte sie bei etwa 15 cm gelegen haben. Eine ähnliche
Konstruktionsweise, wenn auch mit etwas kleiner dimen-
sionierten und vorgetrockneten Ziegeln, ist für die
Schächte der Rennöfen mit Schlackengrube des Eisenver-
49 Hierbei werden größere Lehmziegel geformt und in noch feuch-
tem Zustand aufeinander gesetzt. Eine Lufttrocknung oder ein Bren-
nen der Ziegel vor dem Ofenbau findet dabei nicht statt. Der Schacht-
aufbau erfolgt in diesem Fall sukzessiv.
hüttungszentrums der Spätlatène- bis römischen Kaiser-
zeit im Heilig-Kreuz-Gebirge (Polen) nachgewiesen wor-
den50. Vergleichbar sind die Funde von Glienick zudem
mit Lehmziegeln des kaiserzeitlichen Verhüttungsplatzes
von Snorup (Dänemark), auf dem ebenfalls Schachtöfen
mit Schlackengrube betrieben worden sind51.
An den Schlacken im Bereich der Sohlen der Schla-
ckengruben waren Abdrücke von Halmen zu beobachten,
die auf eine entsprechende Füllung der Schlackengruben
vor dem Verhüttungsprozess hindeuten. Auch an zahlrei-
chen verlagerten Bruchstücken von Schlackenklötzen,
die – wie einige bestimmte Merkmale zeigen – eindeutig
aus Rennöfen vom Typ „Glienick“ stammen, waren solche
festzustellen (Abb. 15). Die Schlackengruben wurden
demnach mit einer Halmfüllung ausgestattet. Diese sollte
einerseits zu Beginn des Ofenganges die Charge aus Holz-
kohle und Raseneisenerz im Ofenschacht halten und ein
Durchfallen in die Schlackengrube verhindern, anderer-
seits im Laufe des fortschreitenden Prozesses auch genü-
gend Hohlraum für das Abfließen der Schlacke bieten52.
Stärke, Struktur und relative Gleichförmigkeit der Halme
lassen am ehesten auf Getreidehalme schließen. Wenn
solche verwendet wurden, dann wohl wegen der besseren
Hitzeresistenz im grünen Zustand. Da sich in den Schla-
cken keine Einschlüsse von Ähren oder Körnern finden
lassen, ist eine direkte Artbestimmung nicht möglich53. Es
ist vielleicht auch davon auszugehen, dass die Ähren-
stände mit den Körnern absichtlich entfernt worden sind.
Das Schlämmen der untersten und ungestörten Inhalte
der Schlackengruben erbrachte bei Ofen 7 und 8 jeweils
zwei verkohlte Körner von Spelzgerste (Hordeum vulgare),
bei Ofen 6 einmal Spelzgerste, einmal Weizen (Triticum
spec.) und ein nicht bestimmbares Getreidekorn54. Die ver-
einzelten Körner könnten von der Halmfüllung stammen,
eventuell aber auch aus der Magerung des Lehms mit Ge-
treidespreu. Die Verwendung von Halmen als Schlacken-
grubenfüllung ist für die römische Kaiserzeit inzwischen
von Skandinavien über Norddeutschland bis in die Lau-
sitz hinein nachgewiesen55, die ältesten Belege liefern bis-
lang die Funde aus Glienick.
Für einen mehrfachen Betrieb der Rennöfen spricht
einerseits deren recht aufwendige und sehr stabile Kon-
50 Pleiner 2000, 161–162.
51 Voss 1995, 133.
52 Vgl. z.B. de Rijk 2007, 117–118; 133; 146–147 Abb. 18; 37.
53 Frdl. Mitteilung von R. Neef (Archäobotanik, DAI Berlin) nach der
Begutachtung einer ersten Stichprobe.
54 Archäobotanische Bestimmungen durch R. Neef (Archäobotanik,
DAI Berlin).
55 Brumlich 2012c, 79.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
452 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
struktion mit einem massiven Steinrahmen und einem
dickwandigen Ofenschacht. Andererseits wurde mit der
vorgelagerten Arbeitsgrube eine Möglichkeit geschaffen,
die Schlackengrube seitlich zu öffnen und ohne größere
Beeinträchtigung des Ofenschachtes nach jedem Ofen-
gang auszuräumen (Abb. 18). Die rechteckige Grundform
der Schlackengrube mit ihren geraden Wänden erleich-
terte dabei das Entfernen des Schlackenklotzes. Von der
Arbeitsgrube aus konnte über die geschaffene Öffnung
auch zugleich die entstandene Eisenluppe entnommen
werden, ohne dass dafür der Schacht zusätzlich zerstört
oder zumindest erheblich beschädigt werden musste. Des
Weiteren konnten bei Ofen 2 (Bef. 81b) und an einigen
Fundstücken aus anderen Befunden Ausbesserungsspu-
ren an der Lehmauskleidung der Schlackengruben festge-
stellt werden, die Öfen sind also repariert worden.
Eine große Anzahl von Speichergruben im Kernbe-
reich der eisenzeitlichen Siedlung, die mit hunderten Ki-
logramm Verhüttungsschlacke verfüllt waren, ist eben-
falls durch den mehrfachen Betrieb der einzelnen
Rennöfen zu erklären (Abb. 9; 17). Die Gruben enthielten
kleine und große Bruchstücke von Schlackenklötzen, die
über verschiedene Merkmale dem Ofentyp „Glienick“ zu-
weisbar sind. Es handelt sich hierbei um die aus den
Schlackengruben entfernten Schlackenklötze. Außerdem
fanden sich in den Gruben Ofenschachtfragmente, die we-
gen ihrer starken Verschlackung und Verziegelung des
Lehms aus den Düsenbereichen stammen, die nach den
einzelnen Ofengängen freigemacht und ausgebessert wer-
den mussten. Aus diesem Grund ließen sich auch immer
wieder fragmentarische oder sogar komplette Düsenöff-
nungen bei diesen Funden beobachten (Abb. 14).
Die folgenden Kriterien konnten anhand der Funde
und Befunde vom Fpl. Glienick 14 für eine Definition des
Ofentyps „Glienick“ herausgearbeitet werden56:
A. Konstruktion
1. Freistehender Ofenschacht aus Lehm
2. Schlackengrube mit Steinrahmen und Lehmausklei-
dung
3. Halmfüllung der Schlackengrube
4. Vorgelagerte Arbeitsgrube
5. Düsenöffnungen in der unteren Ofenschachtwand
B. Funktion
1. Senkrechte Schlackenführung mit Bildung eines
Schlackenklotzes
2. Wiederverwendung von Ofenschacht und Schlacken-
grube
3. Entnahme der Luppe und Ausräumen der Schlacken-
grube von der Arbeitsgrube aus
4. Künstliche Luftzufuhr mittels Gebläsen auf Niveau
des umgebenden Geländes.
Um noch mehr Kenntnisse über den Aufbau und die Be-
dienung des Ofentyps erlangen zu können, wurden zwei
Rennofenversuche durchgeführt57. Bei den Experimenten
56 Ebd.
57 In den Jahren 2011 und 2012 im Rahmen der „Langen Nacht der
Wissenschaften“ beim Topoi Excellence Cluster und am Institut für
Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin. Eine detail-
lierte Vorlage der Versuche, die unter der Leitung von M. Brumlich
und B. Lychatz standen, wird an anderer Stelle erfolgen.
Abb. 13: Fpl. Glienick 14. Rennofen Typ „Glienick“ (Ofen 1/Bef. 412).Seitenansicht des freigelegten Steinrahmes der Schlackengrube vonSüdosten (Foto: M. Brumlich)
Abb. 14: Fpl. Glienick 14. Stark verschlacktes Ofenschachtfragmentmit Düsenloch (Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 453
wurde jeweils ein an den ergrabenen Befunden orientier-
ter Rennofen gebaut und betrieben. Im ersten Versuch
konnte nachgewiesen werden, dass das Öffnen der Schla-
ckengrube und das Ausräumen derselben ohne Zerstö-
rung des Ofenschachtes durchführbar sind. Die erzeugten
Schlacken zeigten zudem dieselben Merkmale wie die ar-
chäologischen Funde. Mit dem zweiten Versuch galt es he-
rauszufinden, wie eine Reparatur des Ofens funktioniert.
Diese war problemlos durchführbar, so dass ein zweiter
Ofengang stattfinden konnte und mindestens ein dritter
möglich gewesen wäre. Die Wiederverwendbarkeit des
Ofentyps „Glienick“ konnte so auf experimentalarchäolo-
gische Weise belegt werden (Abb. 19).
2.4 Datierung der Eisenproduktion
Erhebliche Bedeutung kam der Gewinnung von Material
für die zeitliche Einordnung der Eisenverhüttung auf dem
Siedlungsplatz bei Glienick zu. Für eine Datierung der
Rennöfen sowie der verlagerten Schlackenklötze aus den
Siedlungsgruben und dem Brunnen wurden 17 Radiokar-
bondatierungen veranlasst (Abb. 16)58. Für die Analysen
58 Alle Radiokarbondatierungen (AMS) unter der Leitung von T.
Goslar im Radiokarbonlabor Poznañ. Die Bestimmung der Holzarten
durch K.-U. Heußner (Dendrochronologie, DAI Berlin) und E. Naß
(Archäobiologie, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologisches Landesmuseum [i. F. BLDAM]).
standen direkt aus den Schlacken stammende Holzkohlen
zur Verfügung. Als sehr günstig erwies es sich, dass neben
Holzkohlen auch anderes datierbares Material vorliegt, so
aus der Arbeitsgrube von Ofen 1 der Beckenknochen eines
Pferdes (Equus)59. Aus den Schlackengruben der Öfen 6, 7
und 8 konnten zudem Getreidekörner geborgen werden,
ebenso aus einem in eine Speichergrube (Bef. 448) verla-
gerten Ofenschachtfragment. Durch die Datierung dieses
Probenmaterials können einerseits partiell Kern- und Alt-
holzeffekte ausgeschlossen werden, andererseits kann ein
Vergleich der aus unterschiedlichem Probenmaterial für
einen Befund gewonnenen Daten erfolgen (Tab. 3).
Die zwei aus dem Pferdeknochen und einer Holzkohle
für Ofen 1 gewonnenen Daten von 397–206 und 400–208
calBC60 passen hervorragend zusammen. Beide liegen
zwar in einem der latènezeitlichen Plateaus der Kalibrati-
onskurve, die genauere zeitliche Einordnungen erschwe-
ren, die Daten verweisen aber einheitlich in das 4./3. Jahr-
hundert v. Chr. Bei Ofen 2 besteht dagegen eine gewisse
Diskrepanz zwischen den zwei Radiokarbondaten von
Holzkohlen, beides Splitter von Kiefer (Pinus). Einer Da-
tierung von 398–202 calBC steht eine von 191 calBC–1 cal-
AD gegenüber. Für das ältere Datum ist hier einer der ne-
59 Archäozoologische Bestimmung durch C. Becker (Institut für Prä-
historische Archäologie, Freie Universität Berlin).
60 Alle im folgenden Text angeführten Daten sind Kalenderalter mit
der Standardabweichung 2s (95,4 % Wahrscheinlichkeit). Alle weite-
ren Angaben und die Einzeldaten sind Tab. 3 zu entnehmen.
Abb. 16: Fpl. Glienick 14. Verhüttungsschlacke mit eingeschlossenenHolzkohlen (Foto: M. Brumlich)
Abb. 15: Fpl. Glienick 14. Verhüttungsschlacke mit Halmabdrücken(Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
454 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
gativen Effekte zu vermuten, die bei der Datierung von
Holzkohlen auftreten können. Bei einem zeitlichen Ver-
satz des Alters der datierten Hölzer von einigen Jahrzehn-
ten erscheint momentan eine Datierung des Rennofens
ins 2. Jahrhundert v. Chr. am wahrscheinlichsten. Wesent-
lich größere Probleme bereitet die Datierung einer Holz-
kohle aus Ofen 6, denn die kalibrierten Daten liegen bei
802–539 calBC, also im Hallstattplateau der Kalibrations-
kurve (Abb. 20). Gegen ein derart hohes Alter des Renn-
ofens spricht eindeutig die mittels eines verkohlten Ge-
treidekorns gewonnene Datierung von 390–203 calBC, die
mit der chronologischen Einordnung der anderen Renn-
öfen übereinstimmt. Es hat sich bei der ersten Probe wie-
der um einen nicht näher bestimmbaren Splitter von Kie-
fernholzkohle gehandelt, so dass ein Kernholzeffekt die
mögliche Ursache für das hohe Alter sein könnte. Da die
eisenzeitliche Siedlungstätigkeit nach bisherigem Kennt-
nisstand erst im 4. Jahrhundert v. Chr. einsetzte, ist im Ge-
gensatz dazu eine Verwendung von Altholz wenig wahr-
scheinlich61.
Für die beiden hintereinander gebauten Öfen 7 und 8
liegen jeweils zwei Radiokarbondatierungen von Getrei-
dekörnern und Holzkohlen vor. Das Getreidekorn aus der
Schlackengrube von Ofen 8 ergab ein kalibriertes Datum,
das wegen des Probenmaterials auf einen Betrieb des
61 Anderenfalls könnte das Datum auch als statistischer Ausreißer
bewertet werden.
Rennofens vor 368 calBC hinweist. Eine Holzkohle aus der
Arbeitsgrube datiert ältestenfalls 402 calBC, so dass sich
beide Datierungen über eine Zeitspanne von rund drei
Jahrzehnten überlappen. Aus beiden Daten lässt sich ein
kombiniertes Datum errechnen, das eine sehr hohe Wahr-
scheinlichkeit bei 406–361 calBC besitzt (Abb. 21). Der
Rennofen ist damit in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts
v. Chr. einzuordnen. Bei den Radiokarbondatierungen für
Ofen 7 ist zwar keine Überlappung der wahrscheinlichen
Zeitspannen festzustellen, doch ist die Wahrscheinlich-
keit für eine Datierung in denselben Zeitraum recht hoch.
Dem datierten Getreidekorn nach ist der Rennofen jünger
als 370 calBC, die Holzkohle aus der Schlackengrube er-
bringt ein Datum, das mit 721–383 calBC im selben Bereich
wie das Getreidekorn aus Ofen 8 zu verorten ist. Die etwas
ältere Datierung der Holzkohle ist sicherlich einer der sys-
temischen Fehler der Radiokarbonmethode. Wie bereits
beschrieben wurde, sind die Öfen 7 und 8 der Befundsitua-
tion nach relativ kurz nacheinander gebaut und betrieben
worden. Es kann somit eine Datierung dieser Rennöfen in
die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. erfolgen. Hier-
für kann auch eine Kombination der vier Radiokarbonda-
ten aus beiden Öfen sprechen (Abb. 22). Der Brunnen (Bef.
925) unmittelbar neben diesen Öfen, der eine große Menge
Verhüttungsschlacke enthielt, dürfte zeitgleich mit ihnen
sein62. Aus den übrigen Öfen war kein Probenmaterial für
eine naturwissenschaftliche Datierung zu gewinnen. Diese
werden aber indirekt durch die Befundsituation und ihre
Zuordnung zum Ofentyp „Glienick“ in die vorrömische
Eisenzeit datiert.
Weitere Radiokarbondaten existieren für vier der mit
verlagerten Schlackenklötzen verfüllten Speichergruben
(Bef. 35, 59a, 254, 448) aus dem Siedlungskern (Abb. 20;
Tab. 3). Es zeigt sich hier, dass die Verhüttungsabfälle ins
4.–2. Jahrhundert v. Chr. gehören und damit aus derselben
Zeit stammen wie die Rennöfen, die sich in diesem Areal
befanden. Dasselbe gilt für die Schlacken und Ofenschacht-
fragmente aus den großen Lehmentnahmegruben am
Hang der Grundmoräne. Daneben liegen verschiedentlich
geschlossene Funde von eisenmetallurgischen Abfällen
und Keramik vor. Da eine typo-chronologische Analyse
der in großen Mengen geborgenen Keramikfunde aus der
Siedlung noch nicht stattfinden konnte63, sei zum einen
62 Eine Dendrodatierung war wegen der nur noch in wenigen Resten
vorhandenen Brunnenhölzer bedauerlicherweise nicht möglich. Die
Radiokarbondatierung eines Holzrestes aus dem Bereich der Brun-
nensohle verweist die Bauzeit ins 4./3. Jh. v. Chr. (Abb. 20; Tab. 3).
63 Insgesamt wurden 35568 Scherben geborgen, von denen einer
ersten Einschätzung nach rund 97 % aus der vorrömischen Eisenzeit
stammen.
Abb. 17: Fpl. Glienick 14. Profil einer mit Abfällen der Eisenproduktionverfüllten Speichergrube (Bef. 722). Diese Grube enthielt allein415 kg Verhüttungsschlacke (Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 455
Tab. 3: Fpl. Glienick 14. Radiokarbondatierungen (AMS) der Rennöfen und Befunde mit verlagerten Schlackenklötzen. OxCal v4.1.7 BronkRamsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Befund Bef.-Nr. Proben-Nr. Probenmaterial 14C-Alter [BP] Kalenderalter 1s (68,2 %)[calBC]
Kalenderalter 2s (95,4 %)[calBC/calAD]
Rennofen (Ofen 1) 412 Poz-34666 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2275 ± 35 396 BC (40.4 %) 357 BC284 BC (20.1 %) 256 BC247 BC (7.7 %) 234 BC
400 BC (46.2 %) 349 BC310 BC (49.2 %) 208 BC
Poz-34667 Knochen (Equus)aus Arbeitsgrube
2260 ± 35 390 BC (30.3 %) 356 BC286 BC (37.9 %) 234 BC
397 BC (36.3 %) 347 BC318 BC (59.1 %) 206 BC
Rennofen (Ofen 2) 81b Poz-39702 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2250 ± 50 389 BC (22.9 %) 352 BC296 BC (40.0 %) 228 BC221 BC (5.2 %) 211 BC
398 BC (95.4 %) 202 BC
Poz-34643 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2075 ± 35 160 BC (17.4 %) 132 BC117 BC (50.8 %) 46 BC
191 BC (95.4 %) 1 AD
Rennofen (Ofen 6) 835 Poz-39709 Getreidekorn(Hordeum vulgare)aus Schlackengrube
2235 ± 35 380 BC (17.8 %) 352 BC296 BC (44.5 %) 228 BC221 BC (6.0 %) 211 BC
390 BC (25.6 %) 338 BC330 BC (69.8 %) 203 BC
Poz-39710 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2540 ± 40 794 BC (28.3 %) 749 BC688 BC (12.9 %) 666 BC643 BC (23.3 %) 592 BC578 BC (3.8 %) 568 BC
802 BC (36.8 %) 706 BC695 BC (58.6 %) 539 BC
Rennofen (Ofen 7) 833 Poz-39707 Getreidekorn(Hordeum vulgare)aus Schlackengrube
2175 ± 35 354 BC (39.3 %) 291 BC231 BC (28.9 %) 176 BC
370 BC (92.4 %) 155 BC136 BC (3.0 %) 115 BC
Poz-39708 Holzkohle (Pinus)aus Schlackengrube
2365 ± 35 506 BC (29.3 %) 460 BC452 BC (7.4 %) 440 BC419 BC (31.6 %) 392 BC
721 BC (3.1 %) 694 BC540 BC (92.3 %) 383 BC
Rennofen (Ofen 8) 834 Poz-39705 Holzkohle (Pinus)aus Arbeitsgrube
2280 ± 30 397 BC (53.0 %) 359 BC277 BC (15.2 %) 259 BC
402 BC (56.0 %) 351 BC296 BC (37.0 %) 227 BC222 BC (2.4 %) 210 BC
Poz-39706 Getreidekorn(Hordeum vulgare)aus Schlackengrube
2350 ± 35 503 BC (1.8 %) 498 BC488 BC (13.9 %) 461 BC451 BC (4.8 %) 440 BC418 BC (47.6 %) 384 BC
703 BC (0.5 %) 696 BC538 BC (94.9 %) 368 BC
Kastenbrunnen mitSchlackenklötzen
925 Poz-39716 Holz(nicht bestimmbar)vom Brunnenkasten
2235 ± 35 380 BC (17.8 %) 352 BC296 BC (44.5 %) 228 BC221 BC (6.0 %) 211 BC
390 BC (25.6 %) 338 BC330 BC (69.8 %) 203 BC
Poz-39717 Knochen (Equus)aus Verfüllung
2090 ± 35 166 BC (51.8 %) 86 BC80 BC (16.4 %) 54 BC
202 BC (93.4 %) 37 BC30 BC (0.9 %) 21 BC11 BC (1.1 %) 2 BC
Speichergruben mitSchlackenklötzen
35 Poz-10054 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2190 ± 30 356 BC (46.5 %) 286 BC234 BC (21.7 %) 198 BC
364 BC (95.4 %) 176 BC
59a Poz-39699 Getreidekorn(Hordeum vulgare)aus Verfüllung
2175 ± 35 354 BC (39.3 %) 291 BC231 BC (28.9 %) 176 BC
370 BC (92.4 %) 155 BC136 BC (3.0 %) 115 BC
254 Poz-34661 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2200 ± 40 358 BC (42.0 %) 279 BC258 BC (7.9 %) 242 BC236 BC (18.3 %) 202 BC
382 BC (95.4 %) 174 BC
448 Poz-45349 Getreidekorn(Hordeum vulgare)aus Ofenschacht
2165 ± 35 354 BC (35.4 %) 291 BC231 BC (32.8 %) 167 BC
363 BC (95.4 %) 108 BC
Lehmentnahmegrubemit Schlackenklötzen
555b Poz-39719 Holzkohle (Pinus)aus Schlacke
2220 ± 30 363 BC (7.8 %) 350 BC307 BC (60.4 %) 209 BC
381 BC (95.4 %) 203 BC
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
456 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 18: Schematische Rekonstruktion von Aufbau und Funktionsweise eines Rennofens Typ „Glienick“. 1) Ofen mit Halmfüllung in derSchlackengrube vor dem Betrieb, 2) Beschickung des Ofens mit Erz und Holzkohle über die Gicht und Luftzufuhr mittels Gebläse,3) Bildung eines Schlackenklotzes, 4) Aufbrechen der Schlackengrube und Entnahme der Eisenluppe, 5) Entfernen des Schlackenklotzesaus der Schlackengrube und anschließende Reparatur des Ofens für den nächsten Ofengang, 6) Verarbeitung der Eisenluppe(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 457
auf die detaillierte Auswertung des Materials der früheren
Sondagegrabung verwiesen64. Zum anderen kann eine
erste grobe Einschätzung hinsichtlich der Zeitstellung der
bei den letzten Grabungen geborgenen Keramik gegeben
werden. Erschwerend ist dabei der Umstand, dass für die
Siedlungskeramik der vorrömischen Eisenzeit im bran-
denburgischen Raum bislang keine allgemeine und alle
Zeitstufen erfassende, typologische und chronologische
Gliederung vorgelegt wurde65. Nach wie vor stützt man
sich überwiegend auf das anhand von Grabfunden von
H. Seyer66 erarbeitete Chronologieschema67. Erste Analy-
sen zeigen jedoch neben vorhandenen Übereinstimmun-
gen auch deutliche Unterschiede zwischen der Grab- und
der Siedlungskeramik68.
64 Meyer u.a. 2004, 165–174 Taf. 1–7.
65 Vgl. Bräunig 2006, 6–13; Meyer u.a. 2004, 165–169.
66 Seyer 1982.
67 Die folgenden Stufenbezeichnungen für die vorrömische Eisen-
zeit auch alle nach H. Seyer (1982).
68 Meyer u.a. 2004, 173–174.
Ein Einsetzen der Besiedlung noch in der älteren vor-
römischen Eisenzeit (Stufe I) legen neben den Radiokar-
bondaten vor allem einige Scherben mit Dellen-Sparren-
Ornamenten nahe (Abb. 23.3)69. Das sehr seltene Vor-
kommen dieser typischen Verzierungsform kann auf ein
bereits vorhandenes Ausklingen derselben hinweisen,
was für einen Siedlungsbeginn in der Stufe Ib spricht. In
diese Richtung deuten auch wiederholt vorkommende
Reste von Schalen mit einbiegendem Rand. Die jüngsten
Keramikformen gehören bereits der Stufe IIb an70. Exem-
plarisch für geschlossene Funde mit Eisenschlacken
werden die keramischen Inventare von zwei Speicher-
gruben abgebildet: Eine der beiden Gruben (Bef. 699) er-
brachte allein rund 459 kg Verhüttungsschlacke und
30 kg Ofenschachtfragmente (Abb. 23.2), die andere
Grube (Bef. 450) vor allem Abfälle der Eisenverarbeitung
(Abb. 23.1).
Die Zahl der Metallfunde aus der Siedlung ist nur sehr
gering. Insbesondere Eisenfunde sind durch die Boden-
verhältnisse sehr schlecht erhalten und größtenteils na-
hezu vollständig korrodiert. In die ältere vorrömische
Eisenzeit (Stufe Ib) gehört der Lesefund eines kleinen Zun-
gengürtelhakens. Chronologisch relevant sind zudem die
wenigen fragmentarisch erhaltenen Fibeln. Solche stam-
men auch aus vier Befunden mit Verhüttungsschlacken.
Soweit noch erkennbar, hat es sich hier um Fibeln Kostr-
zewski Variante B und C gehandelt71. Hinzu kommt als Le-
sefund das sicher ansprechbare Fragment einer Variante
H. Diese Fibeln vom Mittellatèneschema verweisen in die
Stufen Lt C–D172. Die Datierungen der Keramik- und der
Metallfunde lassen sich demnach gut miteinander syn-
chronisieren. Anzumerken ist, dass sich weder beim Me-
tallsachgut noch im Keramikinventar ein Bestehen der
Siedlung bis in den Übergangshorizont zur römischen Kai-
serzeit erkennen lässt.
Zusammenfassend kann die eisenzeitliche Siedlung
inklusive der Eisenverhüttung dem gegenwärtigen Kennt-
nisstand nach in die Zeit von der ersten Hälfte des 4. bis
ins 2./1. Jahrhundert v. Chr. datiert werden. Relativchrono-
logisch entspricht das den Stufen Lt B1–D1 bzw. den Stu-
fen Ib–IIb der vorrömischen Eisenzeit. Der Besiedlungs-
zeitraum hätte demnach etwa 300 Jahre betragen. Ein
Abbrechen der eisenzeitlichen Besiedlung im Laufe des
69 Ebd. 172 Taf. 2.20; 7.2.
70 Ebd. 170–173.
71 Auch beim Fund der früheren Sondagegrabung (Meyer u.a. 2004,
164–165; 171; 173 Taf. 3.26) liegt vielleicht eher das Fragment einer Fi-
bel Variante B vor. Auf Unsicherheiten bei der Ansprache wurde be-
reits damals hingewiesen.
72 Brandt 2001, 79–83.
Abb. 19: Rekonstruierter Rennofen Typ „Glienick“ bei einem Renn-ofenversuch am Institut für Prähistorische Archäologie der FreienUniversität Berlin (2012). Zustand nach dem zweiten Ofengangmit aufgebrochener und ausgeräumter Schlackengrube vor der Re-paratur (Foto: M. Brumlich)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
458 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 20: Fpl. Glienick 14. Radiokarbondatierungen (AMS) der Rennöfen und Befunde mit verlagerten Schlackenklötzen.95,4 % Wahrscheinlichkeit. OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 459
Abb. 22: Fpl. Glienick 14. Rennöfen Typ „Glienick“ (Ofen 7/Bef. 833, Ofen 8/Bef. 834). Kombiniertes Radiokarbondatum(AMS) der Rennöfen. OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Abb. 21: Fpl. Glienick 14. Rennofen Typ „Glienick“ (Ofen 8/Bef. 834). Kombiniertes Radiokarbondatum (AMS)des Rennofens. OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
460 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 23: Fpl. Glienick 14. Keramik aus zwei mit eisenmetallurgischen Abfällen verfüllten Speichergruben und zwei Lesefundeaus dem Kernbereich der Siedlung. 1) Bef. 450, 2) Bef. 699, 3) Quadrat D54A. M 1 : 4 (Zeichnung: S. Wadt)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 461
letzten Jahrhunderts v. Chr. ist auch auf anderen Fund-
plätzen an der Glienicker Grundmoränenplatte zu beob-
achten.
2.5 Organisation und Kapazitätder Eisenproduktion
Bei Glienick konnte erstmals im nördlichen Mitteleuropa
eine Siedlung der vorrömischen Eisenzeit ergraben wer-
den, für die eine intensive Eisenproduktion nachweisbar
ist. Anhand der Ergebnisse der Grabungen sind verschie-
dene Arbeitsschritte nachzuvollziehen: Der Abbau des
Lehms für den Bau der Rennöfen, die Erzeugung von Holz-
kohle in Meilern, die Verhüttung von Raseneisenerz, die
anschließende Weiterverarbeitung des erzeugten Eisens
und die Entsorgung der entstandenen Abfallprodukte auf
Halden oder in Gruben. Nur indirekt zu belegen sind der
Abbau und die Aufbereitung des Erzes.
Da die Siedlung auf sandigem Untergrund angelegt
wurde, musste die Gewinnung des Lehms außerhalb der
Siedlung in speziellen Abbaugruben erfolgen. Wichtig ist
jedoch das Vorhandensein von Lehmvorkommen im un-
mittelbaren Umfeld der Siedlung. Die Länge der Transport-
wege zu den Ofenstandorten hat bei maximal 150 m ge-
legen (Abb. 8). Die Position von drei der Rennöfen direkt
neben Brunnen ist sicherlich kein Zufall, denn insbeson-
dere bei der Verarbeitung des Lehms werden größere Men-
gen Wasser benötigt. Bei einer Betrachtung der anderen ge-
sicherten und der anhand geomagnetischer Anomalien zu
vermutenden Ofenstandorte und ihrer Höhenlage fällt eine
Nähe zum Niederungsrand auf, an dem auch die Brunnen
gebaut worden sind. Die Standortwahl wurde möglicher-
weise auch hier vom leichteren Zugang zum Wasser mit be-
einflusst. Daneben wurde das verhüttete Raseneisenerz in
der Niederung abgebaut, so dass die Rennöfen zwischen
den Lehm- und den Erzvorkommen positioniert waren. Zu-
gleich befinden sich die Öfen damit großenteils im Rand-
bereich der Siedlung. Dass der letztere Umstand eine unter-
geordnete Rolle spielte, zeigt allerdings die Lage der Öfen 1
und 2 innerhalb des Siedlungsareals (Abb. 9).
Eine erste Analyse von Holzkohlen aus den Rennöfen
und aus verlagerten Schlackenklötzen (Abb. 16) im Zu-
sammenhang mit der Radiokarbondatierung führt zu dem
vorläufigen Ergebnis, dass bei der lokalen Eisenverhüt-
tung ausschließlich Kiefernholzkohle (Pinus)73 Verwen-
dung fand (Tab. 3). Als Grundlage hierfür diente mit hoher
73 Die Bestimmung der Holzarten durch K.-U. Heußner (Dendro-
chronologie, DAI Berlin) und E. Naß (Archäobiologie, BLDAM).
Wahrscheinlichkeit der Wald der Grundmoräne. Die Ent-
deckung des Holzkohlemeilers am Niederungsrand ist nur
dem Umstand geschuldet, dass hier auch ein Rennofen
und ein Arbeitsplatz zur Luppenverarbeitung existierten,
die als deutliche geomagnetische Anomalien hervortra-
ten. Zahlreiche weitere Meiler sind in der Umgebung der
Siedlung zu vermuten, diese können sich aber auch etwas
weiter entfernt in umliegenden Waldgebieten befunden
haben. Nach modellhaften Berechnungen74 auf der Basis
einer Schätzung der Gesamtproduktion hat der Verbrauch
an Kiefernholzkohle allein für die Eisenverhüttung über
den Besiedlungszeitraum hinweg bei immerhin etwa 39,5 t
gelegen.
Während der Untersuchungen sind eisenmetallurgi-
sche Funde mit einem Gesamtgewicht von rund 13,5 t ge-
borgen worden. Davon entfallen bei den Schlacken 11.771 kg
(94,1 %) auf die Verhüttungsschlacke und 734 kg (5,9 %)
auf die Verarbeitungsschlacke. Die zweitgrößte Fund-
gruppe bilden mit 920 kg die Ofenschachtfragmente. Hin-
zu kommen in weitaus geringeren Mengen Raseneisenerz,
Bruchstücke von Essesteinen und Hammerschlag. Von
den erzeugten Eisenluppen wurden insgesamt rund 8 kg
gefunden. Es handelt sich dabei durchweg um kleine
Reste, die verloren gingen oder aussortiert wurden. Das
größte Stück wiegt gerade einmal 136 g und weist – wie
alle anderen auch – Spuren fortgeschrittener Korrosion
auf. Halbfabrikate wie Barren liegen nicht vor, der deso-
late Zustand der angetroffenen Fertigprodukte wurde be-
reits beschrieben.
Sicher erschlossen wurden für den Siedlungsplatz also
rund 11,8 t Verhüttungsschlacke. Nach den im Zuge der
geophysikalischen und archäologischen Untersuchungen
gewonnenen Erkenntnissen, welche die Ausdehnung und
Struktur der eisenzeitlichen Siedlung betreffen, kann hy-
pothetisch angenommen werden, dass damit nur etwa die
Hälfte der Schlacke erfasst wurde. Für die Gesamtproduk-
tion ist von schätzungsweise 24 t auszugehen75.
Die Eisenverhüttung in der Siedlung fand in einem
Ofentyp statt, der nachweislich mehrfach nacheinander
betrieben werden konnte. Die Entsorgung der aus den
Schlackengruben entfernten Schlackenklötze und ihrer
Bruchstücke erfolgte überwiegend in Siedlungsgruben
(Abb. 9; 17). Die dichte und teils nahezu ausschließliche
74 Vgl. Kap. 3.2.
75 Eine frühere Schätzung (Brumlich 2012c, 81) von etwa 20 t er-
folgte während der noch nicht abgeschlossenen Grabungen. Für die
daraus folgende Berechnung des erzeugten Luppeneisens konnten
noch keine Analysen des lokalen Materials herangezogen werden,
die nun vorliegen (vgl. Kap. 3.2). Selbst bei den hier nun angegebe-
nen 24 t handelt es sich noch um eine zurückhaltende Schätzung.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
462 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Verfüllung dieser Eintiefungen mit Verhüttungsabfällen
spricht dafür, dass letztere in einem sehr kurzen Zeitraum
hineingelangten. Vermutlich repräsentiert der Inhalt
eines solchen Befundes den Abfall von jeweils einem
Rennofen. In diesem Fall ließe sich daraus die Kapazität
eines Rennofens vom Typ „Glienick“ ermitteln. So enthielt
eine der Gruben (Bef. 448) das Maximum von insgesamt
621 kg Verhüttungsschlacke, dabei vier fragmentarische
Schlackenklötze von bis zu 97,5 kg Gewicht, die ihrer Mor-
phologie nach aus einem Ofen zu stammen scheinen. Unter
Berücksichtigung der Unvollständigkeit der Schlacken-
klötze aus diesem Befund kann ein Gesamtgewicht der in
einem Ofengang erzeugten Schlacke von über 100 kg an-
genommen werden. Diesem Richtwert nach wäre der
Rennofen sechsmal betrieben worden. Sieben weitere
Gruben enthielten jeweils über 400 kg Verhüttungsschla-
cke, die Maximalgewichte der bruchstückhaft überliefer-
ten Schlackenklötze haben hier 90,7 und 95,2 kg betragen.
Bei diesen Befunden könnte auf vier bis fünf Ofengänge je
Rennofen geschlossen werden. Den bei den erwähnten
Rennofenversuchen im Ofentyp „Glienick“ gemachten Er-
fahrungen nach erscheint ein vier- bis sechsfacher Betrieb
eines solchen Ofens vollkommen realistisch. Die Experi-
mente haben zudem gezeigt, dass ein mehrfacher Betrieb
des Ofens direkt nacheinander aus verschiedenen Grün-
den am effektivsten ist.
Mit dem Ofentyp „Glienick“ wurde anscheinend in
einem sehr kurzen Zeitraum eine große Menge Eisen ge-
wonnen. Nach Berechnungen76 kann bei sechs Ofengän-
gen mit jeweils 100 kg anfallender Schlacke von insge-
samt rund 112 kg Luppeneisen ausgegangen werden.
Neben der Beschaffung von Steinen und Lehm für den Bau
des Rennofens wären hier 824 kg Raseneisenerz und allein
für die Ofencharge 988 kg Kiefernholzkohle bereitzustel-
len. Das Gewicht der Luppe verringert sich beim Aushei-
zen und Verdichten etwa um die Hälfte, davon gehen beim
Schmieden eines Barrens 30 % und von diesem bei der Er-
zeugung von Fertigprodukten dann nochmals 20 % verlo-
ren77. Aus 112 kg Luppeneisen könnten also beispielsweise
Eisengegenstände von zusammen etwa 31 kg Gewicht her-
gestellt werden. Zur Veranschaulichung dieser Eisen-
menge sei ein Vergleich mit den von H. Seyer78 ermittelten
Durchschnittsgewichten von Gürtelhaken des Gräberfel-
des von Plötzin (Lkr. Potsdam-Mittelmark) angestellt:
Zungengürtelhaken der Stufe I wogen dort durchschnitt-
lich 8,25 g und für Bandgürtelhaken mit angenietetem
76 Vgl. Kap. 3.2.
77 Ganzelewski 2000, 65.
78 Seyer 1982, Tab. 1.
Ösenende der Stufe IIb2 werden 86 g angegeben. Die er-
rechneten 31 kg Eisen würden demnach ausreichen, um
3758 Zungen- oder 360 Bandgürtelhaken anzufertigen.
Die geringe Anzahl der bei den Grabungen angetroffe-
nen Rennöfen und der Ofentyp selbst führen zu der Hypo-
these, dass die Eisenproduktion in der untersuchten Sied-
lung schubweise erfolgte. Dass während der gesamten
Besiedlung nur der Ofentyp „Glienick“ zum Einsatz kam,
darf als erwiesen gelten. Für eine relativ kontinuierliche
Produktion innerhalb der eisenzeitlichen Besiedlungs-
phase sprechen einerseits die Datierungen der Rennöfen
selbst, andererseits ist eine flächendeckende Streuung
von Verhüttungsabfällen zu beobachten, die in nahezu
alle Siedlungsstrukturen in unterschiedlicher Menge ent-
halten waren. Mit „kontinuierlich“ ist in diesem Zusam-
menhang gemeint, dass keine Konzentration der Eisen-
verhüttungsaktivitäten auf einen bestimmten Abschnitt
der Besiedlung feststellbar ist. Problematisch für eine
genauere Beurteilung ist die unbekannte Anzahl der ehe-
mals vorhanden gewesenen Rennöfen und ihrer jewei-
ligen Produktionsleistung79. Wenn man modellhaft für ei-
nen Rennofen vier Ofengänge mit insgesamt 400 kg
Schlacke annimmt, würde das bei der geschätzten Ge-
samtproduktion von 24 t Verhüttungsschlacke auf 60 Öfen
schließen lassen. Bei 300 Jahren Besiedlungsdauer hieße
das wiederum, dass nur alle fünf Jahre ein Ofen betrieben
wurde. Es dürfte sich hier um eine Vorratsproduktion ge-
handelt haben.
Aus diesem Modell ergibt sich die Fragestellung, wie
die Produktion organisiert war. Da für eine erfolgreiche
Eisenverhüttung neben den entsprechenden Kenntnissen
und Fertigkeiten, die zudem erst in einem längeren Lern-
prozess erworben werden müssen, auch langjährige Er-
fahrung und Routine notwendig sind, erscheint es kaum
vorstellbar, dass die Bewohner der Siedlung die Eisenver-
hüttung allein durchführten. Es ist eher anzunehmen,
dass mobile Spezialisten diese und andere Siedlungen des
Teltow periodisch aufsuchten und die Eisenerzeugung als
Auftragsarbeit leisteten. Die Bereitstellung der in erheb-
lichen Mengen nötigen Rohstoffe in Form von Holzkohle
und Raseneisenerz sowie die Beschaffung von Baumate-
rial für den Rennofen kann dabei nach Absprache schon
längerfristig im Vorfeld durch die Bewohner der jewei-
ligen Siedlungen erfolgt sein. Diese kommen ebenso als
79 Erschwerend machen sich hierbei die modernen Störungen und
die teilweise Bewaldung des Siedlungsplatzes bemerkbar, die eine
geophysikalische und archäologische Gesamtprospektion verhin-
dern. Den Erfahrungen der Grabungen nach sind die Rennöfen in der
Geomagnetik zudem nicht sicher von sekundär mit Eisenschlacken
verfüllten Gruben zu unterscheiden.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 463
Bedienungen der Blasebälge in Betracht. Die Leitung des
Ofenbaus und der Eisenverhüttung an sich sowie die pri-
märe Verarbeitung des Luppeneisens dürften bei den Spe-
zialisten gelegen haben. Die am Bedarf orientierte Weiter-
verarbeitung des Eisens kann später durch einen vor Ort
ansässigen Schmied vorgenommen worden sein80.
Bezogen auf die geschätzte Gesamtproduktion sind in
der Siedlung bei Glienick 4,46 t Luppeneisen erzeugt wor-
den, aus denen rund 1,25 t Eisenobjekte hergestellt wer-
den konnten. Im Durchschnitt würde das bei 300 Jahren
eisenzeitlicher Besiedlung jährlich Eisengegenstände mit
einem Gesamtgewicht von etwa 4,17 kg bedeuten. Greift
man das Beispiel der Gürtelhaken noch einmal auf, so hät-
ten aus dem Eisen in jedem Jahr theoretisch 505 Zungen-
oder 48 Bandgürtelhaken hergestellt werden können.
Über die Ausstattung eines Gehöftes der vorrömischen
Eisenzeit mit eisernen Trachtbestandteilen, Werkzeugen
und Waffen liegen gegenwärtig keine Erhebungen vor.
Für ein Gehöft der römischen Kaiserzeit Dänemarks geht
J. Lund81 von einer Ausstattung mit 5–10 kg Eisen und
einem jährlichen Verlust von 1–2 kg aus. Wie viele Gehöfte
auf dem Siedlungsplatz bei Glienick existierten, lässt sich
unter anderem wegen des dafür zu geringen Ausschnittes
der Grabungen nicht sicher sagen. In Anbetracht der lan-
gen Besiedlungsdauer und der nur wenigen erschlosse-
nen Hausstandorte wäre es aber denkbar, dass es sich nur
um ein Einzelgehöft gehandelt hat, das mit der Errichtung
neuer Gebäude immer wieder etwas verlagert wurde
(Abb. 8). Die teils hohe Dichte der Siedlungen am Rand der
Grundmoränenplatte dürfte die Entstehung wesentlich
größerer Ansiedlungen auch kaum zugelassen haben
(Abb. 4). Hat es sich tatsächlich nur um ein oder zwei Ge-
höfte gehandelt, würde die Produktionskapazität für eine
Deckung des Eigenbedarfes bei weitem ausgereicht ha-
ben. Der Überschuss ging vielleicht unmittelbar als Lohn
an die mobilen Spezialisten82, die so ihren Eisenbedarf de-
cken konnten, ohne die aufwendigen Vor- und Nebenar-
beiten der Eisenverhüttung selbst durchführen zu müs-
sen. Möglicherweise fungierten sie auch als Distribuenten
des Eisens, was sich gut mit ihrer Mobilität in Überein-
stimmung bringen ließe.
Hinweise auf die Verwendung des Ofentyps „Glie-
nick“ liegen in Form von Schlackenklotzbruchstücken mit
entsprechenden Merkmalen wie Halmabdrücken, anhaf-
tenden Splittern von großen Steinen und gebranntem
80 Vgl. zu diesem Absatz auch Jöns 1997, 170–175; de Rijk 2007,
176–177.
81 Lund 1991, 166.
82 Vgl. auch Jöns 1997, 175.
Lehm der Auskleidung der Schlackengruben auch von
anderen Fundplätzen vor. So von dem bereits eingangs
vorgestellten Fpl. Groß Schulzendorf 18 (Lkr. Teltow-Flä-
ming) und von vier weiteren eisenzeitlichen Siedlungs-
plätzen der Glienicker Grundmoränenplatte. Den Funden
von Verhüttungsschlacken nach zu urteilen, wurde in
nahezu allen Siedlungen dieser Siedlungskammer Eisen
erzeugt, so dass von einer flächendeckenden Produktion
gesprochen werden kann (Abb. 4). Dagegen zeichnet sich
keine Struktur einer zentralen Eisenproduktion ab, bei der
von nur wenigen spezialisierten Siedlungen aus eine Mit-
versorgung des Umlandes erfolgt, auch wenn eine solche
Organisation in Einzelfällen nicht vollkommen auszu-
schließen ist83. Weiterführende Untersuchungen lassen
bereits jetzt erkennen, dass sich das aufgezeigte System
der Eisenversorgung über die Glienicker Grundmoränen-
platte hinaus fortsetzte, diese Siedlungskammer scheint
also keinen Sonderfall darzustellen.
Eine weitere Verbreitung des Ofentyps in der Region
des Teltow zeigen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwei Ober-
flächenfundplätze am Rand der Notte-Niederung. Wahr-
scheinlich dem Typ „Glienick“ zuzuordnende Schlacken
stammen vom Fpl. Schenkendorf 4 (Abb. 3)84 und vom we-
nige Kilometer weiter westlich gelegenen Fpl. Mitten-
walde 21 (Lkr. Dahme-Spreewald). Beide Siedlungsplätze
erbringen neben Schlackenfunden auch Keramik der vor-
römischen Eisenzeit. Für den Fundplatz bei Schenkendorf
liegen zudem zwei an Holzkohlen aus Verhüttungsschla-
cken durchgeführte Radiokarbondatierungen vor. Die Da-
ten decken in etwa denselben Zeitraum ab wie die der zwei
Fundplätze bei Glienick und Groß Schulzendorf (Abb. 24;
Tab. 2). Dass der Ofentyp über den Teltow hinaus bisher
nicht bekannt ist, kann dem Forschungsstand geschuldet
sein. Festzustellen ist aber, dass direkte Parallelen aus
den nachgewiesenen Eisenverhüttungsrevieren der Latè-
nezeit in Mitteleuropa fehlen (Abb. 1). Beim Typ „Glie-
nick“ handelt es sich allem Anschein nach um eine regio-
nalspezifische Modifikation. Die in der Region agierenden
Spezialisten kamen demzufolge wohl auch nicht aus ent-
legenen Landschaften, sondern waren eher kleinräumig
mobile Wanderhandwerker. Der Grad der Spezialisierung
wird nicht so hoch gewesen sein, dass die Metallurgen mit
der Eisenverhüttung komplett ihren Lebensunterhalt be-
streiten konnten. Es dürfte sich um einen saisonalen Ne-
83 Dabei ist anzumerken, dass gerade bei vier der sechs kartierten
Fundplätze ohne Eisenschlacken die Datierung in die vorrömische
Eisenzeit nur wahrscheinlich ist (Abb. 4). Grund hierfür ist das nur in
geringer Menge vorliegende keramische Fundmaterial. Die detail-
lierte Gesamtvorlage aller Fundplätze erfolgt an anderer Stelle.
84 Brumlich 2010, 66f. Abb. 2–5.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
464 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
benerwerb gehandelt haben, parallel zur bäuerlichen
Subsistenzwirtschaft85.
3 Archäometallurgische Analysender Funde aus Glienick
3.1 Analytik, Metallografieund Interpretation
Für die archäometallurgische Bewertung des Fundkomple-
xes wurden neben den Verhüttungs- und Verarbeitungs-
schlacken umfangreiche Funde von Erz sowie vereinzelte
Eisenluppenfragmente herangezogen. Die Fundmengen an
Schlacken, Luppe und Erz boten eine sehr gute Basis für die
notwendigen Analysen und die darauf aufbauende tiefge-
hende Evaluation des Fundkomplexes nach metallurgi-
schen Gesichtspunkten.
Erzfunden sowie typischen Schlacken wurden Stich-
proben entnommen und im Institut für Eisen- und Stahl-
technologie der TU Bergakademie Freiberg mithilfe der
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)86 bzw. der ICP-Methode
85 Jöns 1997, 173–174; 2010, 108; 114; 116; de Rijk 2007, 175–176.
86 Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA): Die Röntgenfluoreszenzana-
lyse ist eine häufig eingesetzte Methode zur qualitativen und quantita-
tiven Bestimmung der elementaren Zusammensetzung einer Probe.
Dabei wird die zu untersuchende Probe mit Röntgenstrahlung be-
strahlt und dadurch zur Eigenstrahlung angeregt. Die Röntgenemis-
sion wird gemessen und besteht aus verschiedenen, von den einzelnen
Elementen der Probe erzeugten charakteristischen Wellenlängen. Die
qualitative Bestimmung dieser Wellenlängen zeigt, welche Elemente
in der Probe vorhanden sind. In welcher Konzentration jedes Element
vorliegt, wird durch die quantitative Bestimmung der Intensität der
Wellenlängen ermittelt.
(Inductively Coupled Plasma)87, Schlacken zusätzlich mit
der Brommethanolmethode (nasschemisch) untersucht.
An den Luppenfunden wurden die chemischen Analysen
via ICP und Kohlenstoff-/Schwefelanalyseverfahren CS-
Mat 60088 vorgenommen. Ihre metallografische Untersu-
chung erlaubt Rückschlüsse auf die Kohlenstoffverteilung
und die Gefügezustände des Luppeneisens.
Die Abmaße der Erzfundstücke, die aufgrund ihrer
Farbe und Struktur als Raseneisenerz angesprochen wer-
den können, und der in der Analyse festgestellte Glühver-
lust belegen, dass es sich um Erze im unaufbereiteten Zu-
stand handelt. Die in diesem Erz noch enthaltenen
Hydroxidanteile wurden gewöhnlich durch Rösten auf
holz- oder holzkohlegeheizten Feuern vor dem Verhütten
ausgetrieben. Diese thermische Vorbehandlung erleich-
terte auch die nachfolgende Aufbereitung des Erzes durch
Pochen und Klassieren.
Die Analysen des Glienicker Raseneisenerzes zeigen
aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung (Tab. 4)
eine für die Eisenverhüttung gute Eignung: die Gehalte an
87 Inductively Coupled Plasma (ICP): Die Massenspektrometrie mit
induktiv gekoppeltem Plasma ist eine Analysenmethode in der anor-
ganischen Elementanalytik, die die gleichzeitige Bestimmung von
nahezu allen Elementen des Periodensystems und ihrer Isotope
erlaubt. Es werden sehr niedrige Nachweisgrenzen im Bereich von
Nanogramm pro Liter (ng/l) erreicht. Durch einen hochfrequenten
Strom wird zunächst ionisiertes Argon induziert und die Probe er-
hitzt. Dabei werden die Atome ionisiert und ein Plasma entsteht. An-
schließend werden die im Plasma generierten Ionen in Richtung des
Massenanalysators durch ein elektrisches Feld beschleunigt und so
die einzelnen Elemente und deren Isotope messtechnisch erfasst.
88 CS-Mat 600: Hierbei wird die Probe in einem Sauerstoffstrom ver-
brannt, anschließend erfolgt eine infrarotanalytische Detektion des
entstandenen CO2 und SO2.
Abb. 24: Fpl. Groß Schulzendorf 18 und Schenkendorf 4. Radiokarbondatierungen (AMS) der Ackerlesefunde vonVerhüttungsschlacken. 95,4 % Wahrscheinlichkeit. OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 2009
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 465
SiO2 liegen unter 15 % und der Fe2O3-Anteil bei nahezu
70 %. Die ermittelten Werte weisen die für Raseneisenerz
typischen hohen Streuungen auf89, die in seiner komple-
xen Genese als sedimentäres Erz begründet sind.
Das enthaltene Eisen stammt aus Gesteinsverwitte-
rung und aus eiszeitlichen Ablagerungen, in denen es als
dreiwertige feste Verbindung vorliegt. Von Grund- und
Niederschlagswässern unter Kohlendioxid-Beteiligung
gelöst, fällt es aufgrund physiko-chemischer Prozesse als
positiv geladenes Eisenhydrogel aus und konzentriert sich
an negativ geladenen Partikeln wie z.B. Sandkörnern. Auf
diese Weise entstehen unterhalb der Rasendecke an der
Grenze zum Grundwasserspiegel Ablagerungen, die an
Mächtigkeit zunehmen, sich verfestigen und in Form von
Knollen, Klumpen oder zusammenhängenden Schichten
mit Dicken von einigen Zentimetern bis zu maximal einem
Meter auftreten90.
Die Auswahl des optimalen Erzes, das auch innerhalb
eines Fundortes kleinräumigen Schwankungen in der Zu-
sammensetzung unterliegt, konnten prähistorische Me-
tallurgen nur empirisch gestützt vornehmen. Neben opti-
schen, haptischen und sogar gustatorischen91 Prüfungen
mussten sicher auch Verhüttungsversuche Aufschluss
über die Eignung des jeweiligen Erzes geben.
Die Qualität des Erzes schlägt sich u.a. in der Höhe
des Ausbringens an Eisen nieder und bestimmt wesentlich
die Menge der anfallenden Schlacken. Letztere, als not-
wendige Begleiter des Verhüttungsprozesses, sind die am
häufigsten vorkommenden Zeugnisse metallurgischer Ak-
tivitäten auf archäologischen Fundplätzen. Die beim
Rennverfahren gebildete Verhüttungsschlacke setzt sich
aus Eisenoxiden, Bestandteilen der Gangart92, Holzkoh-
lenasche und aufgelösten Teilen der Ofenwandung zu-
sammen.
89 Ernst 1966.
90 Lychatz/Janke 1999.
91 Evenstad 1991.
92 Gangart: Bezeichnung für die in den Erzen enthaltenen nichtme-
tallischen Stoffe (z.B. Kieselsäure, Kalk, Tonerde).
Typische Rennofenschlacken93 wie die hier analysier-
ten (Tab. 5) weisen in Abhängigkeit von den eingesetzten
Eisenerzen folgende Zusammensetzung auf:
1) 55 bis 70 % FeO mit einem geringen Anteil Fe2O3,
2) 15 bis 30 % SiO2 und
3) 5 bis 15 % Al2O3, MnO, K2O, CaO, MgO, P2O5, TiO2,
Na2O.
Metallurgisch werden diese Schlacken nach ihren Haupt-
bestandteilen dem System FeOn-SiO2 zugeordnet (Abb. 25).
Bedeutsam für die Rennofenmetallurgie ist der Bereich
um das niedrigschmelzende Doppeleutektikum; bei einem
Molverhältnis von 2 : 1 (29 Masse- % SiO2) bildet sich die bei
1208 °C schmelzende Verbindung Fayalit (2 FeO·SiO2). Die
Existenz des Fayalits zeigt an, dass zwischen der Kiesel-
säure und dem Eisen-(II)-Oxid eine Tendenz zur Verbin-
dungsbildung besteht, die abgeschwächt auch im flüs-
sigen Zustand vorliegt. Diese Tendenz begünstigt die
Existenz von zweiwertigem Eisen in der Schlacke und
drängt die von dreiwertigem bis auf geringe Gehalte zu-
rück. Die Analysenwerte (Tab. 5) spiegeln das divergente
Verhältnis der Oxide von zwei- (FeO) und dreiwertigem Ei-
sen (Fe2O3) wider.
Für Rennofenschlacken auf der Basis von Raseneisen-
erz typisch ist ein hoher Phosphor-Anteil in Form von
P2O5, der am Fpl. Glienick 14 bis zu 5,14 % beträgt (Tab. 5);
unter den Prozessbedingungen im Rennofen wird der
über die Einsatzstoffe eingebrachte Phosphor zum Teil
über die Verhüttungsschlacke ausgetragen. Die Verhüt-
tung der oben beschriebenen Erztypologie bringt so hohe
Phosphor-Mengen (Tab. 4) in den Prozess ein, dass nicht
allein die Schlacke, sondern auch das Luppeneisen ent-
sprechend hohe Werte aufweisen.
Obwohl metallurgisch demselben Schlackensystem
zugehörig, grenzen sich die Verhüttungs- von den Verar-
beitungsschlacken in Form und chemischer Zusammen-
93 Vgl. Leineweber/Lychatz 1998.
Tab. 4: Fpl. Glienick 14. Analysen Raseneisenerz
Proben-Nr. Bef.-Nr. Glühverlust Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O MnO P2O5 Cr2O3 TiO2 Na2O S
600 °C 1000 °C in Masse-%
EP 2/1 925 11,27 13,31 68,04 13,47 1,04 1,15 0,11 0,09 1,35 4,06 < 0,01 0,04 0,05 0,001
EP 2/2 925 11,29 13,40 69,86 12,00 0,87 1,27 0,12 0,07 1,27 4,46 < 0,01 0,03 0,03 0,001
EP 2/3 925 11,42 13,55 72,48 10,03 0,48 1,14 0,08 0,03 1,12 4,19 < 0,01 0,02 < 0,01 0,001
EP 2/4 925 10,62 12,96 62,27 14,80 1,00 1,09 0,11 0,09 2,18 3,55 < 0,01 0,04 < 0,01 0,001
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
466 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
setzung deutlich ab. So weisen die bei der Weiterverarbei-
tung der Luppen anfallenden Schlacken signifikant
geringere Gehalte an P2O5, MnO und CaO auf (Tab. 6) als
die in diesem Fundzusammenhang aufgetretenen Verhüt-
tungsschlacken.
Die bisherigen Grabungskampagnen konnten keine
Funde von Halbfabrikaten (Barren) oder Fertigerzeugnis-
sen – als angestrebtes Ergebnis des Verhüttungs- und
Schmiedeprozesses – ausweisen, die eine noch genauere
wissenschaftliche Einschätzung der Fähigkeiten der Me-
tallurgen im Glienicker Komplex zugelassen hätten. Die
Beurteilung der Erzeugnisse stützte sich daher auf wenige
eisenmetallurgische Relikte in Form von Luppenfragmen-
ten, deren Erhaltungszustand durch die Lage im anste-
henden Sandboden nahe einer feuchten Niederung nega-
tiv beeinflusst wurde.
Es gelang bei der eingehenden Sichtung der umfang-
reichen archäometallurgischen Funde insgesamt rund 8 kg
Eisenluppenfragmente in verschiedenen Korrosionssta-
dien zu identifizieren. Dazu gehörten neben durchkorro-
Tab. 5: Fpl. Glienick 14. Analysen Verhüttungsschlacken
Proben-Nr. Bef.-Nr. Femet FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O MnO P2O5 Cr2O3 TiO2 Na2O S
in Masse-%
SP 1/1 254 0,20 62,70 9,98 14,44 0,51 1,95 < 0,05 0,20 2,43 2,98 < 0,01 0,05 0,07 0,013
SP 1/2 254 0,23 63,40 8,07 13,33 0,31 1,95 < 0,05 0,15 2,58 3,08 < 0,01 0,03 0,05 0,012
SP 2/1 254 0,22 58,90 5,87 19,36 1,09 2,36 < 0,05 0,21 3,08 2,64 0,02 0,07 0,09 0,027
SP 2/2 254 0,22 58,40 4,68 19,85 1,30 2,07 < 0,05 0,21 2,72 2,56 0,02 0,08 0,10 0,022
SP 3/1 412 0,25 53,90 4,15 21,33 0,75 3,45 < 0,05 0,86 4,18 2,96 0,02 0,05 0,11 0,031
SP 3/2 412 0,17 56,00 3,41 21,69 0,93 3,13 < 0,05 0,63 3,84 2,86 0,02 0,05 0,13 0,024
SP 6/1 833 < 0,1 56,99 8,69 25,39 1,02 2,89 0,20 0,36 1,72 2,40 < 0,01 0,04 0,02 0,022
SP 6/2 833 < 0,1 58,10 7,73 25,05 1,05 2,89 0,19 0,35 1,69 2,43 < 0,01 0,04 0,02 0,033
SP 7/1 834 < 0,1 58,59 8,87 19,67 0,71 3,06 0,19 0,33 3,17 4,32 < 0,01 0,03 < 0,01 0,030
SP 7/2 834 < 0,1 56,93 8,84 20,75 0,77 3,28 0,18 0,36 3,22 4,61 < 0,01 0,03 0,01 0,038
SP 8/1 835 < 0,1 63,48 7,63 17,83 0,66 3,08 0,19 0,17 2,38 3,96 < 0,01 0,03 < 0,01 0,019
SP 8/2 835 < 0,1 62,63 8,14 18,15 0,64 3,10 0,20 0,17 2,39 3,98 < 0,01 0,03 < 0,01 0,019
SP 9/1 830 < 0,1 55,13 10,71 21,07 0,82 3,71 0,21 0,15 2,26 5,08 < 0,01 0,04 < 0,01 0,018
SP 9/2 830 < 0,1 56,33 8,99 21,66 0,80 3,78 0,20 0,16 2,31 5,14 < 0,01 0,04 < 0,01 0,025
Abb. 25: Ausschnitt aus dem Schlackensystem FeO-SiO2 (TU BA Freiberg, IEST)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 467
dierten auch wenige randkorrodierte Stücke. Diese wurden
aufgetrennt und konnten, vor allem aufgrund der vorhan-
denen Hohlräume, in einer ersten Augenscheinnahme als
nicht ausgeschmiedete Luppenfragmente angesprochen
werden (Abb. 26). Anschließend wurden Proben für die
chemischen Analysen und die metallografische Präpara-
tion (Ätzung mit 2%iger HNO3) entnommen.
Die hohe Bandbreite der Kohlenstoff-Werte (Tab. 7)
weist auf eine heterogene Aufkohlung der Luppen hin. Die
geringen Mengen an Silizium und Mangan lassen auf eine
geringe Zahl nichtmetallischer Einschlüsse schließen, da
diese Elemente im Rennofenprozess nicht reduziert werden
(Abb. 26). Die Ergebnisse der chemischen Analysen werden
von den Resultaten der metallografischen Untersuchungen
gestützt. Deutlich lassen die mikroskopischen Aufnahmen
verschiedenartige Gefüge erkennen (Abb. 27–30). Dabei
reicht die Bandbreite von ferritischen über ferritisch-perliti-
sche bis hin zu perlitischen Gefügen mit Sekundärzementit
(Abb. 30).
Die Analyseergebnisse der Funde erlauben den
Schluss, dass die am Ort tätigen Metallurgen Luppen mit
unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten herstellen konn-
ten: die analysierten Abfälle des Glienicker Fundplatzes
verweisen auf die Fähigkeit der frühen Metallurgen, die
Verhüttungsparameter so zu variieren, dass sie Ergebnisse
im Spektrum von nahezu kohlenstofffreiem Schmiede-
eisen bis zu hochgekohltem Stahl mit ca. 1 % Kohlenstoff
erzielen konnten.
Einschränkend muss festgestellt werden, dass die zur
Untersuchung gekommenen Luppenstücke nur fragmen-
tarisch und in einem zur Schlackenmenge sehr kleinen
Verhältnis vorlagen; es kann daher zum jetzigen Zeit-
punkt bezüglich der metallurgischen Bewertung noch
nicht von einer repräsentativen Basis gesprochen werden.
3.2 Berechnung der Produktionshöhe
Auf der Basis der Ergebnisse der archäologischen und me-
tallurgischen Untersuchungen kann nun nach dem Be-
rechnungsansatz von Lychatz94 über Bilanzgleichungs-
systeme eine Bestimmung der Eisenproduktion für den
Fundplatz bei Glienick durchgeführt werden.
Zum Aufstellen der Bilanzgleichungssysteme wird an-
hand von Grabungsbefunden95 ein virtueller Modellrenn-
ofen erschaffen. Mithilfe dieses Berechnungsverfahrens
werden die Menge an Einsatzstoffen, die Produktions-
höhe sowie das Ausbringen festgestellt. Die wissenschaft-
lich verifizierbaren Resultate erweisen sich in Präzision
und Umfang wesentlich überlegen gegenüber Schätzun-
gen oder Bestimmungen nach Faustformeln und können
durch die Ergebnisse späterer Grabungskampagnen ohne
größeren Aufwand aktualisiert werden. Perspektivisch
wird auch eine hinreichend genaue Hochrechnung aus
geomagnetischen, durch Grabungen authentifizierten Da-
ten erreichbar sein.
Die Arbeit mit einem statischen Modell kann jedoch
keine möglichen Entwicklungen des Verfahrens im Unter-
suchungszeitraum berücksichtigen; sollte ein signifikan-
ter Umschlag der zum Einsatz gebrachten Technologie
94 Lychatz 2012.
95 Vgl. vor allem Ofen 1, Kap. 2.3.
Tab. 6: Fpl. Glienick 14. Analysen Verarbeitungsschlacken
Proben-Nr. Bef.-Nr. Femet FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O MnO P2O5 Cr2O3 TiO2 S
in Masse-%
SP 4/1 375 0,11v 53,10 10,62 26,98 0,95 0,84 < 0,05 0,38 0,57 0,92 0,01 0,09 0,03
SP 4/2 375 0,14 55,20 13,93 23,99 0,79 0,75 < 0,05 0,32 0,55 0,91 0,01 0,06 0,028
SP 4/3 375 0,11 58,50 5,09 23,67 0,75 0,72 < 0,05 0,29 0,58 0,92 0,01 0,07 0,013
SP 16/1 258 0,16 55,11 12,54 28,87 0,76 1,15 0,21 0,32 1,03 1,62 < 0,01 0,05 0,012
SP 16/2 258 < 0,10 59,68 1,44 33,66 0,99 1,21 0,22 0,43 1,04 1,69 < 0,01 0,07 0,025
SP 16/3 258 0,12 59,99 6,46 28,94 0,84 1,22 0,21 0,34 0,98 1,60 < 0,01 0,05 0,023
Tab. 7: Fpl. Glienick 14. Analysen Luppeneisen
Proben-Nr. Bef.-Nr. C Mn Si P S
in Masse-%
SP 12/1 254 0,158 0,002 0,045 0,404 0,010
SP 12/2 254 0,387 0,002 0,045 0,506 0,012
SP 13 376 1,060 0,040 < 0,01 0,700 0,123
SP 23 259 0,097 0,014 0,130 0,370 0,108
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
468 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
(oder sogar mehrere) archäologisch nachweisbar sein,
müsste eine Kombination von Bilanzsystemen aufgestellt
werden. Bislang weisen aber keine Indizien auf einen der-
artigen Technologiesprung im latènezeitlichen Glienicker
Verhüttungsareal hin.
Für die Berechung der Eisenproduktion sind somit
alle erforderlichen Randbedingungen erfüllt; für den
Fundplatz bei Glienick sind sie im Folgenden mit den not-
wendigen Werten präzisiert:
1) Während des gesamten Zeitraums wurde konstant ein
Ofentyp eingesetzt. Am untersuchten Fundplatz war dies
der Ofentyp „Glienick“, dessen Konstruktionsart die Nut-
zung über mehrere Ofengänge erlaubte.
2) Die Gesamtmenge der am Standort angefallenen Ver-
hüttungsschlacke kann bestimmt werden: Es wurden
rund 11,8 t ergraben; geomagnetische Untersuchungen
und die bei den Grabungen gewonnenen Erkenntnisse
lassen den Schluss zu, dass im Areal mit ca. 24 t gerechnet
werden kann96.
3) Anhand der Funde und Befunde kann man von Schla-
ckenklötzen in einer Größe von 50 bis 150 kg pro Ver-
hüttungsgang ausgehen. Modelltechnisch wird daher
eine durchschnittliche Menge von 100 kg/Ofengang ange-
nommen.
4) Die Zusammensetzung bzw. die Parameter der verwen-
deten Einsatzstoffe konnten analysiert werden. Funde be-
legen den Einsatz von Raseneisenerz (Tab. 4). Die Analyse
96 Vgl. Kap. 2.5.
der Holzkohle erbrachte die hauptsächliche Verwendung
von Kiefernholz (vgl. Kap. 2.5). Es ist von einem in Versu-
chen verifizierten Verhältnis von geröstetem Eisenerz zu
Holzkohle von 1 : 1,2 auszugehen.
5) Aus Versuchen ist der Eintrag von Materialien aus der
Ofenwandung in die Verhüttungsschlacke bekannt97. Der
am Siedlungs- und Verhüttungsplatz anstehende Lehm
wurde analysiert und das Ergebnis in die Bilanzrechnung
übernommen.
Diese Randbedingungen definieren nun die Grenzen und
Parameter des Modellrennofens. Er stellt, wie die meisten
metallurgischen Systeme, ein offenes System dar, das von
seiner Umwelt trennbar ist, gleichzeitig jedoch mit ihr in
Wechselwirkung steht98. Die Grenzen des Modellsystems
entsprechen in diesem Fall der Außenseite der Ofen-
wandung des Rennofens. Erz- und Holzkohlezugabe,
Windzufuhr, entweichendes Gichtgas und Wärmeverluste
repräsentieren die Wechselwirkung mit der Umwelt bzw.
die Ein- und Ausgabedaten des Systems.
Für den Rennofen, wie für jedes Reaktionssystem,
kann der Konzentrationsverlauf der Reaktanten, der Tem-
peratur- und Druckverlauf sowie das Geschwindigkeits-
feld des strömenden Mediums berechnet werden.
Grundlage für diese Berechnungen sind die Erhal-
tungssätze von Masse, Impuls und Energie. Die voll-
ständige Erfassung von Stoff- und Wärmetransport unter
Berücksichtigung von Strömungsvorgängen erfordert die
simultane Lösung der Differenzialgleichungen für Stoff-,
Energie- und Impulstransport, was – wenn überhaupt –
nur numerisch möglich ist99.
Die zeitliche Änderung der Masse eines Stoffes ergibt
sich aus der Summe der pro Zeiteinheit durch Strömung
und Diffusion zu- bzw. abgeführten und der innerhalb des
Systems in der Zeiteinheit durch Reaktion gebildeten oder
verbrauchten Stoffmengen. Mathematisch lässt sich eine
Massenbilanz wie folgt definieren:
dci = –div (ci · w) + div (Deff. · grad(ci)) + ∑rij (1)dt
ci Konzentration des Stoffes i
w Strömungsgeschwindigkeit
Deff. effektiver Diffusionskoeffizient
rij Reaktionsgeschwindigkeit der i-ten Komponente der
j-ten Reaktion
97 Lychatz 2012.
98 Uhrmacher/Brassel 2002.
99 Baerns/Hoffmann/Renken 1999; Levenspiel 1998.
j
Abb. 26: Fpl. Glienick 14. Luppeneisen (Probe SP 12).Makroskopische Aufnahme eines Schnittes durch das Luppen-fragment (TU BA Freiberg, IEST)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 469
Im speziellen Fall von Wanderbettreaktoren mit nichtkata-
lytischen Gas-Feststoff-Reaktionen, wie sie u.a. Schacht-
öfen (z.B. Renn-, Hoch-, Verkokungsöfen) darstellen, wer-
den die Massenumsätze zweckmäßigerweise statt mit der
o.g. Differenzialgleichung durch Bilanzgleichungssysteme
beschrieben100. Die notwendigen, umfangreichen Berech-
nungen sind im Detail an anderer Stelle aufgeführt101.
Die Gleichungssysteme greifen auf Modellansätze für Stoff-
100 Budde/Rückauf/Turek 1988.
101 Lychatz 2012.
und Gesamtwärmebilanzen102 von Hochöfen zurück, die in
einem umfangreichen Prozess an die speziellen Bedingun-
gen des Rennofens adaptiert wurden. Ihre Gültigkeit wurde
durch Feld- und Laborversuche verifiziert.
Die Ergebnisse der Massenbilanz für den Modell-
Rennofen sind in einer kompakten Übersicht wiederge-
geben (Abb. 31). Den höchsten Massenumsatz ergeben die
gasförmigen Stoffe: das austretende Gichtgas mit 872 kg
102 Vgl. Pawlow 1952; Ramm 1980; Hunger 1997; Pochwisnew u.a.
1954.
Abb. 27: Fpl. Glienick 14. Luppeneisen (Probe SP 12). MikroskopischeAufnahme (Auflicht), Ätzung mit 2 %iger HNO3. Ferritisches Gefügemit nichtmetallischen Einschlüssen (TU BA Freiberg, IEST)
Abb. 28: Fpl. Glienick 14. Luppeneisen (Probe SP 12). MikroskopischeAufnahme (Auflicht), Ätzung mit 2 %iger HNO3. Ferritisch-perlitischesGefüge in Widmannstättischer Anordnung (TU BA Freiberg, IEST)
Abb. 29: Fpl. Glienick 14. Luppeneisen (Probe SP 23).Mikroskopische Aufnahme (Auflicht), Ätzung mit 2 %iger HNO3.Ferritsch-perlitisches Gefüge in Widmannstättischer Anordnung(TU BA Freiberg, IEST)
Abb. 30: Fpl. Glienick 14. Luppeneisen (Probe SP 13). MikroskopischeAufnahme (Auflicht), Ätzung mit 2 %iger HNO3. Perlit mit nadeligemSekundärzementit (TU BA Freiberg, IEST)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
470 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
Abb. 31: Fpl. Glienick 14. Massenbilanz des Modellrennofens Typ „Glienick“(Grafik: M. Brumlich, E. Jagemann; TU BA Freiberg, IEST)
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 471
und der dem System zugeführte Wind (Luft). Bei jedem
Ofengang mussten dem Rennofen 690,7 kg Wind als
Sauerstofflieferant und Steuerungsmittel für die Verbren-
nungsleistung zugeführt werden. Bei einem durch zahlrei-
che Funde belegten Düsendurchmesser von 2,5–3 cm er-
folgte die Windbeaufschlagung der Öfen mittels Gebläsen
(Blasebälgen), da sie über natürlichen Zug nicht in erfor-
derlicher Höhe zu erreichen gewesen wäre.
An weiteren Einsatzstoffen konnten je Verhüttungs-
vorgang 164,7 kg Holzkohle und 137,3 kg Erz errechnet
werden, auf 100 kg Verhüttungsschlacke kamen ferner
0,6 kg Tonmineralien (verziegelt) aus der Ofenwandung,
die als Rechengröße Berücksichtigung finden. Auf der Er-
tragsseite der Bilanzgleichung des virtuellen Rennofens
stehen 18,6 kg Luppeneisen. Unter Berücksichtigung der
geborgenen 11,8 t Verhüttungsschlacke und einer durch-
schnittlichen Schlackenproduktion von 100 kg/Ofenreise
(entspricht 118 Ofenreisen) bedeutet dies eine Gesamtpro-
duktion von 2,2 t Luppeneisen bzw. bei den geschätzten
24 t Verhüttungsschlacke dementsprechend 4,46 t im Zeit-
raum von jeweils 300 Jahren.
4 Synthese derUntersuchungsergebnisse
Den Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen
nach ist für den Teltow – als bisher einzige Region des
nördlichen Mitteleuropas – von der Frühlatènezeit (Lt B1)
bis in die Spätlatènezeit eine etablierte Eisenverhüttung
nachzuweisen. Die Technologie war, wie die ergrabenen
Rennöfen und die metallurgischen Analysen zeigen, be-
reits in der Frühlatènezeit voll entwickelt und das Verhüt-
tungsverfahren wurde ebenso wie die Weiterverarbeitung
des erzeugten Eisens routiniert beherrscht. Eine Expe-
rimentierphase ist hier nicht zu erkennen. Auf Grund der
bekannten Siedlungsplätze mit Schlackenfunden und der
mittels Grabungen erschlossenen Ofentechnologie er-
scheint ein System der Eisenerzeugung möglich, das zu-
mindest teilweise von mobilen Spezialisten getragen
wurde und eine flächendeckende Bedarfsdeckung in der
Region erlaubte. In Anbetracht der ermittelten Produkti-
onskapazitäten hat eine Abhängigkeit von Importen dage-
gen offenbar nicht mehr bestanden.
Der Beginn des Verlaufes der Innovation der Eisenver-
hüttung in der Region des Teltow ist bislang nicht zu beur-
teilen. Bei einer Tätigkeit kleinräumig agierender Wander-
handwerker könnte diesen jedoch eine maßgebliche Rolle
hinsichtlich der sukzessiven Verbreitung der technologi-
schen Kenntnisse zugekommen sein. Ein möglicher Eigen-
anteil an der Innovation, etwa in Form der regionalspezi-
fischen Modifikation eines Rennofentyps, bleibt unklar.
Welche Kontinuitäten oder Diskontinuitäten in der unmit-
telbar nachfolgenden Entwicklung der regionalen Eisen-
verhüttung bestanden, bleibt mangels ergrabener Sied-
lungen und Eisenverhüttungsanlagen vorerst ähnlich
diffus wie die früheste Phase des Innovationsverlaufes.
Die in der Vergangenheit geschaffenen Modelle der
Entwicklung der Eisenerzeugung sind hinsichtlich der
Datierung und Einschätzung der frühen Phasen zu hinter-
fragen. Die Entwicklung eines neuen Modells für einen
größeren geografischen Raum erscheint allerdings noch
verfrüht, da hierfür weitere Untersuchungen über den
zeitlichen und regionalen Rahmen des vorliegenden Auf-
satzes hinaus notwendig sind.
LiteraturBaerns/Hoffmann/Renken 1999: M. Baerns/H. Hoffmann/A. Renken,
Chemische Reaktionstechnik. Lehrbuch der Technischen Che-mie 1 (Stuttgart 1999).
Brandt 2001: J. Brandt, Jastorf und Latène. Kultureller Austausch undseine Auswirkungen auf soziopolitische Entwicklungen inder vorrömischen Eisenzeit. Internat. Arch. 66 (Rahden/Westf.2001).
Bräunig 2006: R. Bräunig, Hausbau und Siedlungswesen imöstlichen Bereich der Jastorfkultur. Zum Forschungsstand.Ethnogr.-Arch. Zeitschr. 47, 2006, 3–17.
Braun-Thürmann 2005: H. Braun-Thürmann, Innovation (Bielefeld2005).
Brumlich 2005: M. Brumlich, Schmiedegräber der älteren vor-römischen Eisenzeit in Norddeutschland. Ethnogr.-Arch.Zeitschr. 46.2, 2005, 189–220.
– 2006: –, Essen rauchten und Hämmer klangen. LatènezeitlicheEisenverhüttung und -verarbeitung auf dem Teltow. Arch. Berlinu. Brandenburg 2005, 2006, 78–80.
– 2010: –, Eisenverhüttung und -verarbeitung in der vorrömi-schen Eisenzeit. Funde von der Hochfläche des Teltow. In:M. Meyer (Hrsg.), Haus – Gehöft – Weiler – Dorf. Siedlungen derVorrömischen Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. BerlinerArch. Forsch. 8 (Rahden/Westf. 2010) 61–84.
– 2011: –, Tonnenweise Schlacke. Latènezeitliche Eisenproduk-tion bei Glienick, Lkr. Teltow-Fläming. Arch. Berlin u. Branden-burg 2009, 2011, 59–62.
– 2012a: –, Heiße Öfen. Frühe Eisenverhüttung bei Glienick, Lkr.Teltow-Fläming. Arch. Berlin u. Brandenburg 2010, 2012, 63–66.
– 2012b: –, Glienick: Eisenzeitliches Produktionszentrum. In:F. Schopper/J. von Richthofen, Ausflüge im Südwesten Bran-denburgs. Zauche, Teltow, Fläming. Ausflüge zu Archäologie,Geschichte und Kultur in Deutschland 54 (Stuttgart 2012)252–255.
– 2012c: –, Neues zur Eisenproduktion in der Jastorfkultur. DerOfentyp „Glienick“. In: P. Łuczkiewicz/M. Meyer (Hrsg.), TheYounger Generation. Akten des ersten Lublin-Berliner Doktor-andenkolloquiums am 09.–10. 06. 2010 in Lublin (Lublin 2012)55–88.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
472 Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen
– i. Vorb.: –, Alte Thesen und neue Forschungen zur Eisenproduk-tion in der Jastorfkultur. In: Bd. zur Tagung „Das Jastorf-Konzeptund die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa“ am18.–22. 05. 2011 in Bad Bevensen.
Brumlich/Fischer 2012: M. Brumlich/P. Fischer, Gesponnen undgewoben. Grubenhaus der späten Kaiserzeit bei Glienick,Lkr. Teltow-Fläming. Arch. Berlin u. Brandenburg 2010, 2012,77–80.
Brumlich/Hanik 2012: M. Brumlich/S. Hanik, Tieropfer für Eisen?Arch. Deutschland 1, 2012, 42–43.
Brumlich/Meyer/Lychatz 2011: M. Brumlich/M. Meyer/B. Lychatz,Das DFG-Projekt „Eisenverhüttung in der Vorrömischen Eisen-zeit des nördlichen Mitteleuropas. Das Fallbeispiel des Teltow“.Arch. Nachrbl. 16.4, 2011, 345–358.
Budde/Rückauf/Turek 1988: K. Budde/H. Rückauf/F. Turek,Reaktionstechnik I. Lehrbuch (2Leipzig 1988).
Derrix 2001: C. Derrix, Frühe Eisenfunde im Odergebiet. Studienzur Hallstattzeit in Mitteleuropa. Univforsch. Prähist. Arch. 74(Bonn 2001).
Ernst 1966: F.-J. Ernst, Die vorgeschichtliche Eisenerzeugung. Mitt.Bezirksfachausschuss Ur- u. Frühgesch. Neubrandenburg 14(Waren 1966).
Evenstad 1991: O. Evenstad, Praktische Abhandlung von den Eisen-steinen, welche sich in Norwegen in Sümpfen und Morästenfinden, und über die Methode solche in Eisen und Stahl zu ver-wandeln. Reprint des Originals von 1782, hrsg. von A. Espelund(Trondheim 1991).
Fischer 2012: P. Fischer, Die kaiserzeitliche Besiedlung auf derGlienicker Grundmoränenplatte (Unpubl. Masterarbeit im FachPrähist. Arch. an der Freien Univ. Berlin 2012).
Ganzelewski 2000: M. Ganzelewski, Archäometallurgische Unter-suchungen zur frühen Verhüttung von Raseneisenerzen amKammberg bei Joldelund, Kreis Nordfriesland. In: A. Haffner/H. Jöns/J. Reichstein (Hrsg.), Frühe Eisengewinnung inJoldelund, Kr. Nordfriesland. Ein Beitrag zur Siedlungs- undTechnikgeschichte Schleswig-Holsteins. Teil 2: Naturwissen-schaftliche Untersuchungen zur Metallurgie- und Vegetations-geschichte. Univforsch. Prähist. Arch. 59 (Bonn 2000)3–100.
Gassmann/Rösch/Wieland 2006: G. Gassmann/M. Rösch/G. Wieland,Das Neuenbürger Erzrevier im Nordschwarzwald als Wirt-schaftsraum während der Späthallstatt- und Frühlatènezeit.Germania 84.2, 2006, 273–306.
Hjärthner-Holdar/Kresten/Lindahl 1993: E. Hjärthner-Holdar/K. Kresten/A. Lindahl, Järnets och järnmetallurgins introduktioni Sverige. Aun 16 (Uppsala 1993).
Hjärthner-Holdar/Risberg 2003: E. Hjärthner-Holdar/C. Risberg,The Introduction of Iron in Sweden and Greece. In: L. Nørbach(Hrsg.), Prehistoric and Medieval direct Iron Smelting inScandinavia and Europe. Aspects of Technology and Society.Symposium Sandbjerg 1999. Acta Jutlandica 76.2, Human.Ser. 75 (Aarhus 2003).
Hunger 1997: J. Hunger, Einsatz fester Brenn- und Reststoffe überdie Windformen des Hochofens (Freiberg 1997).
Jöns 1997: H. Jöns, Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen.In: H. Jöns u.a., Frühe Eisengewinnung in Joldelund, Kr. Nord-friesland. Ein Beitrag zur Siedlungs- und TechnikgeschichteSchleswig-Holsteins. Teil 1: Einführung, Naturraum,Prospektionsmethoden und archäologische Untersuchungen.Univforsch. prähist. Arch. 40 (Bonn 1997) 45–196.
– 1998: –, Zur Eisenversorgung Norddeutschlands und Süd-skandinaviens während der Eisenzeit. In: A. Müller-Karpe u.a.(Hrsg.), Studien zur Archäologie der Kelten, Römer und Germa-nen in Mittel- und Westeuropa. Festschr. A. Haffner. Internat.Arch. = Stud. honoraria 4 (Rahden 1998) 277–289.
– 2007: –, Zur ältesten Eisenverhüttung in Norddeutschlandund im südlichen Skandinavien. In: S. Möllers/ W. Schlüter/S. Sievers (Hrsg.), Keltische Einflüsse im nördlichen Mittel-europa während der mittleren und jüngeren VorrömischenEisenzeit. Koll. Vor- u. Frühgesch. 9 (Bonn 2007) 53–71.
– 2010: –, Eisen und Macht – Gesellschaftliche Strukturen derEisenökonomie von der Eisenzeit bis zur Völkerwanderungszeitim Raum zwischen Mittelgebirge und Ostsee. Siedlungs- u.Küstenforsch. im südlichen Nordseegebiet 33, 2010, 107–118.
Leineweber/Lychatz 1998: R. Leineweber/B. Lychatz, Versuche imRennofen – eine Bilanz. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 80,1998, 263–304.
Levenspiel 1998: O. Levenspiel, Chemical Reaction Engineering(3New York 1998).
Lund 1991: J. Lund, Jernproduktion i Danmark i romersk jernalder.In: C. Fabech/J. Ringtved (Hrsg.), Samfundsorganisation ogRegional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevand-ringstid. Jysk Ark. Selskabs Skr. 27 (Aarhus 1991) 163–170.
Lychatz 2012: B. Lychatz, Metallurgie des Rennverfahrens(Unpubl. Habilitationsschr. Freiberg 2012, eingereicht am5. 7. 2012).
–/Janke 1999: –/D. Janke, Technologie der Eisenerzeugung im Renn-ofen. Braunkohle – Surface Mining 51.3, 1999, 377–381.
Meyer 2001: M. Meyer, Schlacken aus der Eisenzeit. Sondagen inWaltersdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, und Glienick, Land-kreis Teltow-Fläming. Arch. Berlin u. Brandenburg 2000, 2001,62–64.
– u.a. 2004: – u.a., Die latènezeitliche Siedlung Glienick 14, Ldkr.Teltow-Fläming. Bemerkungen zum Forschungsstand latène-zeitlicher Siedlungen in Brandenburg. In: H. Machajewski(Hrsg.), Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej(Poznañ 2004) 161–198.
Nieling 2009: J. Nieling, Die Einführung der Eisentechnologie inSüdkaukasien und Ostanatolien während der Spätbronze- undFrüheisenzeit. Black Sea Stud. 10 (Aarhus 2009).
Nikulka u.a. 2000: F. Nikulka u.a., Zur Genese der Eisenmetallurgiein Nordwestdeutschland. Die Rennöfen von Heek-Nienborg,Kr. Borken. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland 23, 2000, 59–106.
Nortmann 2004/2005: H. Nortmann, „Fürstengräber und Eisenerze“.Zum Jubiläum eines problematischen Erklärungsmusters.Trierer Zeitschr. 67/68, 2004/05, 23–38.
Nørbach 1998: L. Nørbach, Ironworking in Denmark from the LateBronze Age to the Early Roman Iron Age. Acta Arch. (København)69, 1998, 53–75.
Pawlow 1952: M. A. Pawlow, Metallurgie des Roheisens 2(Berlin 1952).
Pleiner 2000: R. Pleiner, Iron in Archaeology: The European BloomerySmelters (Prag 2000).
Pochwisnew u.a. 1954: A. N. Pochwisnew u.a., Der Hochofenbetrieb(Berlin 1954).
Ramm 1980: A. N. Ramm, Der moderne Hochofenprozeß (Moskau1980).
Reimer et al. 2009: P. J. Reimer et al., IntCal09 and Marine09radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP.Radiocarbon, 51,4, 2009, 1111–1150.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57
Markolf Brumlich et al., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen 473
1. ZeileÜberhang
de Rijk 2007: P. de Rijk, De scoriis. Eisenverhüttung undEisenverarbeitung im nordwestlichen Elbe-Weser-Raum.Probl. Küstenforsch. südl. Nordseegebiet 31, 2007,95–242.
Schäfer 2007: A. Schäfer, „Economic Archaeology“ in Luxemburg.A Landscape-Related Approach to Early Iron Production in theHinterland of the Titelberg Oppidum. In: P. Crew/S. Crew(Hrsg.), Early Ironworking in Europe II. Archaeology, Technologyand Experiment. Abstracts. Second International ConferencePlas Tan y Bwlch 17th–21st September 2007. Plas Tan y BwlchOcc. Paper 4 (Plas Tan y Bwlch 2007) 80.
– 2011: –, Zur Erforschung der frühen Eisenproduktion an dermittleren Lahn. In: A. Abegg/D. Walter (Hrsg.), Die Germanenund der Limes. Ausgrabungen im Vorfeld des Wetterau-Limesim Raum Wetzlar-Gießen. Röm.-Germ. Forsch. 66 (Mainz 2011)231–238.
Schneider 2006: R. Schneider, Der Übergang von der Bronze- zurEisenzeit – Neue Studien zur Periode VI des Nordischen Kreises
in Teilen Dänemarks und Norddeutschlands. Univforsch. Prä-hist. Arch. 129 (Bonn 2006).
Seyer 1982: H. Seyer, Siedlung und archäologische Kultur der Ger-manen im Havel-Spree-Gebiet in den Jahrhunderten vor Beginnu. Z. Schr. Ur- u. Frühgesch. 34 (Berlin 1982).
Uhrmacher/Brassel 2002: A. Uhrmacher/K.-H. Brassel, Modellierungund Simulation. Grundlagen, Institut für Praktische Informatik,Universität Rostock (Rostock 2002), elektronische Ressourcehttp://www.informatik.uni-rostock.de/mosi/Vorlesung/Folien/SS02/Lehr er/Uebersicht.pdf (Stand: 2002).
Voss 1995: O. Voss, Snorup – an Iron Producing Settlement in WestJutland, 1st–7th Century AD. In: G. Magnusson (Hrsg.), TheImportance of Ironmaking. Technical Innovation and SocialChange. Vol. I. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott, H 58(Stockholm 1995) 132–139.
Zimmermann 1998: C. Zimmermann, Zur Entwicklung der Eisen-metallurgie in Skandinavien und Schleswig-Holstein. Praehist.Zeitschr. 73, 1998, 69–99.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 160.45.210.5
Heruntergeladen am | 10.09.13 09:57