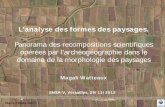Des Amis des rois aux amis des Romains, RPhil LXXII 1998, 65-86
E. Steigberger - B. Tober, Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum....
-
Upload
uni-salzburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of E. Steigberger - B. Tober, Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum....
Akten des 14. Österreichischen Archäologentagesam Institut für Archäologie der Universität Graz
vom 19. bis 21. April 2012
Herausgegeben von
Elisabeth Trinkl
Sonderdruck
Wien 2014
Die Fallstudie des Heiligtums des IuppiterHeliopolitanus in Carnuntum
Neue Forschungsergebnisse im nördlichen Teil des Heiligtums
Eva Steigberger – Barbara Tober
Einführung
Das Heiligtum des Iuppiter Heliopolitanus in den östlichen Canabae von Carnuntum in Panno-nien ist das einzige bisher ergrabene Heiligtum der Syrischen Gottheiten in den Nordwestprovin-zen. Seine Ausgrabung verdanken wir den Rettungsgrabungen, die 1978 bis 1991 vonM. Kandler und H. Zabehlicky durchgeführt wurden. Die Forschungen wurden jüngst als Teil ei-nes FWF-Programmes am Institut für Kulturgeschichte der Antike an der ÖAW wieder aufge-nommen1.
Die Hauptgottheit, Iuppiter Heliopolitanus, stammt ursprünglich aus Baalbek. Nördlichder Alpen kennt man ihn hauptsächlich von Inschriften, die vor allem in Pannonien und beson-ders in Carnuntum gefunden wurden. Dies kann man mit der Tatsache eines bestehenden Heilig-tums in Verbindung bringen – das einzige bekannte nördlich der Alpen.
Der rechteckige Grundriss des frühen Tempels A und die Tatsache, dass man ihn nicht alsrömischen Podiumstempel sondern auf einer nur leicht erhöhten Basis gebaut hat, könnten aufden östlichen Ursprung hinweisen, da für diese Bauweise in Syrien gute Vergleichsbeispiele exis-tieren. Die Nutzungszeit des Carnuntiner Heiligtums umfasst zumindest drei Steinbauphasenvom frühen 2. bis zum späten 3. bzw. der 1. Hälfte 4. Jh.s. Die frühere Holzbauphase des1. Jh.s soll hier nicht besprochen werden, sondern es sollen Kontexte aufgezeigt werden, die miteiner extensiven Reorganisation des Heiligtums vor Phase 2.3 in Zusammenhang zu bringen sind.
Zu seiner Blüte im frühen 3. Jh. lag das Heiligutm in Carnuntum in einem 110690 mgroßen, von einer Mauer umgegebenen Areal (Abb. 1). Der trapezoide Zentralhof, der an min-destens drei Seiten von einer Portikus umgeben war, bildete das Zentrum, im Osten stand derkleine Tempel. Die südliche Portikus verband den Hof mit zwei Hallen, im Südosten lag einekleine Badeanlage mit Latrine. Ehe dieser Tempel B errichtet wurde, nahm der ältere Tempel Amit Hofareal C den Ostteil des Areals ein – beide ebenfalls mit einer Stützenstellung zum Zent-ralhof hin abgegrenzt.
Das Heiligtum
Im frühen 2. Jahrhundert wurde Tempel A gemeinsam mit einem zugehörigen Architekturkon-zept aus dem Hofareal C und dem angeschlossenen Portikus-Komplex errichtet. Eine Halle fürFeste lag etwas weiter südlich. Alle Gebäude dieser Phase 2.1 sind gelb auf dem Plan dargestellt(Abb. 2). Erkennbar ist die neuere Forschung, die sich aktuell auf die Nordhälfte des Heiligtumskonzentriert.
1 Zu den jüngsten Ergebnissen und der Geschichteder Ausgrabung siehe Gassner u. a. 2011 und Gassner u. a.2010. Zu einem umfangreicheren Beitrag zum Thema Zer-störung anhand der Fallstudie des Tempelbezirks des Iuppi-ter Heliopolitanus in Carnuntum s. Steigberger – Tober
2013. – 2012 wurde eine geophysikalische Prospektiondurchgeführt, deren Ergebnisse zu einer grundsätzlichenNeubewertung der Bebauungsstruktur im Heiligtum ge-führt haben; Gassner – Steigberger in Druck. Die Ausfüh-rungen in diesem Beitrag behalten dennoch ihre Gültigkeit.
369
Tempel A bestand aus einem einfachen rechteckigen Raum, 9,564,8 m groß und nachWesten zum Zentralhof hin orientiert. Südlich folgte Hofareal C mit 17618,4 m und einerleicht abweichenden Orientierung. Eine kleine Portikus, die so genannte Ostportikus, war ihmvorgelagert und man erreichte damit einen homogenen architektonischen Abschluss nach Osten.Die Südportikus verband die Gebäude im Süden mit dem Nordteil des Heiligtums und bildetegleichzeitig die Grenze des Zentralhofs.
Im Lauf des 2. Jahrhunderts wurden Umbauarbeiten durchgeführt und eine zweite modifi-zierte Bauphase ist in der Nordportikus und im Süden des Hofareals C feststellbar, wo die so ge-nannten Osträume adaptiert wurden und die Südportikus umgebaut wurde (in dunkelrot aufdem Plan erkennbar, Abb. 2).
Das Hauptaugenmerk dieser Diskussion richtet sich auf Straten, die mit dem Ende der Pha-sen 2.1 und 2.2 zusammenhängen. Lassen sich hier Kontexte herausarbeiten, die auf eine gewalt-same plötzliche Zerstörung schließen lassen, auf die die Reorganisation folgte, oder war derAbbruch des Heiligtums intentionell und geplant aufgrund einer Renovierung, deren Resultat dieErrichtung von Tempel B darstellt (Phase 2.3).
Das Problem
Straten, die mit dem Ende von Phase 2.2 zusammenhängen, zeigen sich generell als eine massiveSchuttschicht, die von der Nordportikus über Tempel A bis zu den späteren Thermen verfolgbarist. Sie beinhaltete eine signifikante Menge an Fragmenten von Architekturteilen und Kultinstal-lationen der Phasen 2.1 und 2.2.
Die Umbauten wurden wie erwähnt hauptsächlich im Süden und Südosten, sowie in derNordportikus durchgeführt, und berührten Tempel A nicht. Beim aktuellen Bearbeitungsstandbereitet das Wesen dieser Zerstörung bzw. Demolierung immer noch Schwierigkeiten, da dieStraten Hinweise auf eine mögliche gewaltsame und plötzliche Zerstörung nur in einem sehr limi-tierten Bereich zeigen, während der Großteil des Schutts in Zusammenhang mit intentionellemAbbruch der älteren Kultgebäude und der Vorbereitung für einen neuen Bauplatz gesehen wer-den kann. In diesem Kontext ist es wichtig, zwischen der Zerstörung durch einen natürlichenVorgang wie ein Erdbeben und jene durch menschliche Einwirkung zu unterscheiden, indemman beispielsweise den Kategorien von Eckhard Deschler-Erb folgt2. Diese zweite Kategorie –
Zerstörung durch Menschen – ist wieder zu unterteilen in eine zufällige, etwa durch Feuer, oderabsichtliche Zerstörung. Im Fallbeispiel des Heiligtums wird von einer friedlichen, intentionellenZerstörung ausgegangen, die als Abbruch klassifiziert wird.
Nur einige wenige Schichten in den Osträumen zeigten einen etwas höheren Anteil vonSchutt und Brandspuren. Es scheint daher möglich, dass zumindest in diesem Bereich bzw. rundum die Südportikus ein Schadensfeuer und somit eine zufällige Zerstörung der Grund gewesensein könnte3, aber es gibt kaum genug Nachweise für eine Zerstörung des Heiligtums als Ganzes.In der Nordportikus, die ebenfalls von den Umbaumaßnahmen betroffen ist, können Brandspu-ren nicht damit in Zusammenhang gebracht werden. Bereits Eric Birley stellt in seinen Forschun-gen am Hadrianswall fest, dass solche Schichten nicht immer als Auswirkungen von Zerstörungzu interpretieren sind, sondern auch als routinemäßige Renovierungsarbeiten gesehen werdenkönnen. Nachdem ein Gebäude für etwa 30 Jahre bestanden hat, kann erwartet werden, dass eingewisses Ausmaß an Renovierung notwendig war4. Zudem muss in Betracht gezogen werden,dass kleinräumige Spuren eines Feuers eher auf Schadensfeuer als auf eine großräumige Zerstö-
2 Deschler-Erb 2003, 43–44.3 Dabei könnte es sich wohl um ein Schadensfeuer
handeln, aber auch um Holzabfälle, die verbrannt wurden.Es lässt sich nicht leugnen, dass auch mit rituellen Vor-
gängen in diesem Bereich zu rechnen ist, die in der rituel-len Deponierung in Grube G7 gipfelten, da die Brandspu-ren sich in unmittelbarer Nähe der Grube befinden.
4 Birley 1930, 171–174.
370
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
rung hinweisen. Bei der Interpretation von einzelnen Schichten in einer komplexen Situationmuss vorsichtig vorgegangen werden, wie bereits Thomas Fischer in Bezug auf Köln-Alteburgdeutlich gemacht hat5. Auch der Charakter der Funde, die in diesen Schichten gemacht wurden,ist wichtig, da ein struktureller Zusammenbruch des Gebäudes Funde auf Böden bringt, die alsKonstruktionsmaterial im Einsatz waren6. In den Schuttschichten im Heiligtum fehlen aber bei-spielsweise sowohl Mauerwerk im Verband und Brandreste in größeren Mengen wie auch Dach-ziegel – und damit Hinweise auf den Einsturz von Gebäuden.
Die Brandspuren in den Osträumen könnten aber in Zusammenhang mit gewissen rituel-len Tätigkeiten stehen, die während der Aufgabe von Phase 2.2 stattgefunden haben. Obwohldas least-effort-Modell in der so genannten „curate behaviour“ eine große Bandbreite an archäologi-schen Fundkomplexen erklären kann, kommt eine weitere Kategorie der „Rituellen Formations-prozesse“ hinzu, die in einer Deponierung resultiert, die deutlich von den Erwartungen einesleast-effort-Modells abweicht. Rituelle Formationsprozesse resultieren häufig in speziell angerei-cherten Befundkomplexen, die leicht mit ergiebigem de facto-Abfall zu verwechseln sind7. Im vor-liegenden Fall wurden zwei große Gruben im südlichen Teil des Heiligtums gefunden – G7 undG11, die ein charakteristisches Fundspektrum aufweisen und aufgrund dessen als Überreste vonsogenannten closing rituals interpretiert werden. In diesem Zusammenhang sollen sie als Spezial-fall erwähnt werden, der sich deutlich in der Verfüllung von anderen Grubenkomplexen, die alsEntsorgungsgruben verfüllt wurden, unterscheidet. Sie reflektieren deutlich auf gewisse Aspektedes Kultlebens. So bestand die deponierte Keramik nur aus einer kleinen Auswahl an Trinkgefä-ßen. Passscherben wurden in verschiedenen Verfüllungsschichten gefunden, was auf einen Verfül-lungsvorgang hinweist. Zusätzlich waren Schichten von Tierknochen, Glasbechern undsogenannten Schlangengefäßen, die ebenfalls auf rituellen Gebrauch hinweisen, vorhanden aller-dings keine Architekturbestandteile oder größere Wandmalereifragmente8.
Während eines geplanten Abbruchs und Neubaus ist zu erwarten, dass Innen- und Außen-dekor der Gebäude entfernt wurden, da sie hohe Ersatzkosten nach sich ziehen, tragbar und gutweiterverwendbar sind – sie daher hohe Priorität bei der Bewahrung haben, wie Schiffers Theorieder Curate Behaviour feststellt9, während tatsächlicher Abfall wohl beseitigt worden wäre. NachSchiffer wird ein Gebäude, dessen Fundkomplexe über Gehniveau viele tragbare, wertvolle und/oder wieder verwendbare Objekte beinhalten, typischerweise rasch und ungeplant verlassen wor-den sein. Im Gegensatz dazu deutet eine Fundzusammensetzung, die durch Kuratierung stark de-zimiert ist – z. B. eine nur mit großen oder bereits beschädigten Objekten – auf ein langsamesund geplantes Verlassen hin10.
Die Steine und Steinfragmente in den Planierschichten des Heiligtums sind klein, lose ver-streut und unregelmäßig verteilt. Es zeigen sich keine Konzentrationen großer Blöcke. SpezielleFragmente von Architekturdekoration des Tempels und der Portiken der beiden ersten Phasensind Reste von Teilen, die für die Wiederverwendung in der folgenden Bauphase durch Abschla-gen und Blockzurichtung aufbereitet wurden. Auch die sorgfältige Entfernung von Wandmalerei,die in Gruben entsorgt wurde, kann in diesem Sinne als Vorbereitung der Steinblöcke für dieWiederverwendung gesehen werden. Siehe dazu unten. Es scheint jedenfalls, dass Teile der Stein-dekoration während des Abbruchs entfernt und später wieder verwendet wurden.
Bei den festgestellten Schuttschichten handelt es sich also eher um Planierschichten, umden Bauplatz für die Errichtung des neuen Tempels B herzurichten. Dem entspricht, dass sichnur kleinteilige Architekturfragmente (Abb. 3) und Baukeramik im Material feststellen lassen.Daraus ist zu schließen, dass die älteren Gebäude aufgegeben und intentionell am Ende von Pha-se 2.2. abgebrochen wurden.
5 Fischer 2005, 162–163.6 Schiffer 1985, 1996; LaMotta – Schiffer 1999, 25.7 LaMotta – Schiffer 1999, 23 referring to Szuter
1991, 219.
8 Zur Weiterführung: Gassner in Druck.9 LaMotta – Schiffer 1999, 22.10 LaMotta – Schiffer 1999, 22–23.
371
Eva Steigberger – Barbara Tober
Die Stratigraphie zeigt verschiedene Mechanismen für Recycling und Wiederverwertungvon Baumaterial und Schuttentsorgung. Bereits Ertel stellte während der Bearbeitung der Archi-tektur des Heiligtums fest, dass Teile von Architekturelementen, die nicht in ihrer Originalformwiederverwendet werden konnten, überarbeitet wurden, indem vorstehende Teile abgeschlagenwurden, sodass ein Steinblock übrig blieb, der verbaut werden konnte. Die Reste, die nicht ver-wendbar waren, endeten in Abfall und damit im archäologischen Befund11. Einfache Bauquaderwurden ebenso wiederverwendet wie jene Teile, von denen Wandmalerei und Verputz abgeschla-gen wurden.
Der Abfall wurde in Gruben entsorgt, die durch den Abbruch von Strukturen erst entstan-den sind. Ein Beispiel dafür ist Grube G19, eine quadratische, 464 m große Fundamentgrubezentral in Hofareal C. Am Ende von Phase 2.2 wurde das Monument komplett entfernt und dieGrube mit Schutt und Architekturfragmenten verfüllt, danach das Gelände planiert. Einige derGruben wurden auch eigens für die Entsorgung gegraben, wie G1, G3 und G6 (Abb. 4) entlangder Mauern von Hofareal C. In ihnen wurden hauptsächlich Architektur- und Wandmalereifrag-mente gefunden. Auffällig waren die Unterschiede im Verfüllungsmaterial. Manche Gruben wa-ren nur mit Steinfragmenten und Architekturresten verfüllt wie G19 und G3, andere mitWandmalereifragmenten wie G6. Daraus lässt sich vielleicht auf verschiedene Arbeitstruppsschließen – einige spezialisiert auf die Vorbereitung der Quader für die Wiederverwendung, ande-re einfach zum Abschlagen des Putzes eingesetzt. Die Entsorgung der Architektur- und Wandma-lereifragmente in Gruben nahe der ursprünglichen Gebäude stellt einen glücklichen Umstand fürdie Forschung dar, weil es zumindest teilweise eine Rekonstruktion von Architekturausstattungund Innendekoration der Heiligtumsgebäude ermöglicht12.
Eine exakte Datierung dieser Reorganisierung ist nicht einfach zu geben13: Wenn man dieFunde aus den beiden Ritualgruben in engem Zusammenhang mit der Reorganisation hernimmt,lässt sich aufgrund der Datierungsproblematik der Rheinzaberner Terra Sigillata nur ein Deponie-rungszeitraum zwischen 170/80 bis 220 n. Chr. herausarbeiten. Die Gebäude wären logischer-weise davor abgebrochen worden14.
1 1 So fanden sich plastisch ausgeformte Schnecken-Voluten, die Ertel der Dekoration von Tempel A zuordnet,fast ausschließlich in Grube G3 und G19. Vgl. Ertel 1991,282–284. 291–297. Eine Steinlage in Hofareal C (SE 426)enthält in erster Linie wenig aussagekräftige Teile von „Ar-chitektur“. Das sind vor allem abgeschlagene Ecken vonQuadern und Ähnliches, nur wenige Reste von Bauorna-mentik und einige Altarteile. Ertel charakterisiert diesesMaterial so: „Steinlage, die offensichtlich vom Arbeitsplatzder Steinmetzen zurückblieb, an dem aus alten Altären undArchitekturstücken Baumaterial zurechtgeschlagen wurde“.(Ertel 1991, 266) Nach freundlicher Mitteilung G. Kremerkönnte dies wohl zutreffen.
12 Die Entsorgung und Deponierung von ungebrauch-tem Material wurde häufig im Kontext der Untersuchun-gen am Handrainswall festgestellt – so beispielsweise inIchtuthil durch Pitts und Joseph und später Bishop undCoulston. Pitts – Joseph 1985, 109–113; Bishop – Couls-ton 1993, 34.
13 Einerseits das ungelöste Problem der Datierung derRheinzaberner und Westerndorfer Terra Sigillata (zu De-
tails siehe Eschbaumer – Radbauer 2007), andererseitsdie laufende Diskussion über die Wertigkeit von Münzfun-den – besonders das Fehlen von kleineren Nominalen derBronzewährung des frühen 3. Jahrhunderts n. Chr. inCarnuntum (zu Details siehe Vondrovec 2007; Pfisterer2003, 139–140).
14 Für Informationen zur Datierung von Terra Sigillatasei P. Eschbaumer und S. Radbauer gedankt, die sich mitdieser Fundkategorie beschäftigen. – Ähnliche Objekteund Schuttschichten wurden bei den Ausgrabungen imwestlichen Teil des Auxiliarkastells in Carnuntum festge-stellt, wo massive Planierschichten unterhalb der Gebäudeder Severischen Periode andere Schichten, die mit der Zer-störung des Lagers in Verbindung stehen, bedeckten. Auchdort treten ähnliche Probleme in der Datierung dieserSchichten auf, da die Ausgrabungen 1978 bis 1983, paral-lel zu denjenigen auf den Mühläckern, stattfanden und diedamaligen Grabungsmethoden Funde verschiedenerSchichten vermischten. (Weiterführend siehe Jilek 2005,167 mit Anm. 9).
372
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
Wandmalerei als Fallstudie
Die Wandmalerei eignet sich gut um Überlegungen zu Zerstörung oder Abbruch zu vertiefen, dagerade sie aufgrund der strukturellen Verbindung zwischen der Malerei und dem Mauerwerk da-für prädestiniert scheint15.
Die Kategorisierung in 31 Dekorationsgruppen ergab die Möglichkeit, auch aus dem sehrfragmentierten Material Dekorsysteme zu rekonstruieren. Mittels stratigrafischer Analyse wurdeversucht, diese Dekorationen einzelnen Gebäuden zuzuweisen. Kann damit aber auch der Cha-rakter der Zerstörung oder des Abbruchs definiert werden?
Die Analyse ergab Kategorien von Dekoren, die sich in Herkunft, Aussehen und Zusam-mensetzung der Fragmente unterscheiden. Die bestmögliche Kategorie der in situ-Komplexe fehlt– dem stratigraphischen Befund entsprechend – im Heiligtum16, da keine Mauern höher als Bo-denniveau erhalten sind. Zur Zeit lassen sich für die Bauphase 2.1 und 2.2. drei Kategorien vonKontexten unterscheiden (gegliedert nach Verteilung der Fragmente, horizontaler Funddichte,Oberflächengröße und Fragmentierungsgrad)17:
– Kategorie: Malereien aus Planierschichten, die von einer nicht näher spezifizierten Reorgani-sation herrühren, (1 a)18 und Malereien aus Abfallgruben (1b), die mit einem geplanten Ab-bruch verbunden werden können. Diese Kategorie ist relevant für die Fallstudie und sollnäher diskutiert werden.
– Kategorie: Malereien aus Gruben, die während Kultvorgängen verfüllt wurden (G7 undG11) in denen sehr kleine Reste von Dekorationsgruppen gefunden wurden, die keinemGebäude zugewiesen werden konnten.
– Kategorie: so genannte „residuals“ die über das gesamte Areal verstreut waren und häufigumgelagert wurden.
Zwei Dekorationen der ersten Kategorie (12 und 19) dienen als Beispiele, um die Komplexitätdes Problems darzustellen: Aufgrund der Stratigraphie konnte festgestellt werden, dass beide De-korationen am Ende von Periode 2.2 in Verwendung standen.
Dekoration 12 besteht aus zahlreichen und hauptsächlich aus großen Fragmenten mit gel-bem Untergrund. Die Rekonstruktion (Abb. 5) zeigt Ranken in weißem Stuck mit weißer Male-rei auf gelbem Grund19. Man erkennt Stängel und Blätter ohne genaue Form – vielleichtWeinblätter. Ähnliche Beispiele sind aus Aquincum in Pannonien bekannt20. Ein Fragment deu-tet die Verbindung der Ranken mit Akanthusblättern an. Der gelbe Untergrund verbindet auchTeile der Stuckleisten und mittelgroßer Stucksäulen oder Pilaster mit dieser Dekoration21. DieFragmente waren weit verteilt in der Schuttschicht um Tempel A. Die erhaltene Oberfläche vonetwa 5000 cm² scheint auf den ersten Blick unbedeutend, aber sie besteht aus mehr Fragmentenals alle anderen Dekorationsgruppen unter Ausnahme von Dekor 19 im Nordosten. Die Planier-schicht enthielt andere Reste von Baumaterial wie Ziegel- und kleine Steinfragmente sowie Kera-mik. Während der Planierung des Schuttes wurde die Wandmalerei wie alle anderen Reste rundum das Tempelareal verteilt (Abb. 7). Die fast ausschließliche Konzentration von Dekor 12 indiesen Schichten weist darauf hin, dass die Reste eines absichtlich oder unabsichtlich zerstörtenGebäudes, das mit Ranken auf gelben Grund dekoriert war, verteilt wurde, um Platz für den Bau
1 5 Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammen-fassung der Beiträge zur Wandmalerei aus dem Heiligtum,Steigberger – Tober 2013; Gassner u. a. 2011, bes. 150–165.
16 Tober 2003; Tober 2010.17 Gassner u. a. 2011.18 Eine vergleichbare 35–50 cm starke Planierung aus
überwiegend Mörtelbrocken mit Bruchsteinen, Lehm und
Keramik bildet den Untergrund für die Errichtung neuerBauten mit veränderter Ausrichtung: Vgl. Gugl 2007, 54.
19 Tober (in Vorbereitung); Gassner u. a. 2010, 15–16, F. 33 Abb. 5; Gassner u. a. 2011.
20 Madarassy 2004, 295–296 Abb. 7, 6–7; Parragi2004, 292–294.
2 1 Gassner u. a. 2011 Abb. 23 und 24.
373
Eva Steigberger – Barbara Tober
von Tempel B zu schaffen. Die Absicht ist klar, aber der primäre Grund für den Hergang kannnicht durch die Analyse der Wandmalerei festgestellt werden. Dekor 12 schmückte aufgrund derhohen Konzentration der Fragmente in diesem Areal (Abb. 7) vermutlich Tempel A, die mittlereSäulengröße weist auf eine Innendekoration hin.
Dekoration 19 wurde als Zaun rekonstruiert (Abb. 6), der aus roten Rahmen und imitier-ten Metallscheiben an den Kreuzungspunkten besteht. Aus den Zwischenräumen wächst grünesBlattwerk22. Es lassen sich mindestens vier Abschnitte des Zauns rekonstruieren, der etwa 59 cmhoch war und damit etwa 2 römischen Fuß entspricht. Zäune dieser Art sind typisch für Garten-malereien, wie von einem sehr ähnlichen Beispiel aus Pannonien – dem Hof der römischen Villavon Balacapuszta in Ungarn23 – bekannt ist oder vom Mitreo delle Sette Porte in Ostia24. DieDekoration ist definiert durch große und zahlreiche anpassende Fragmente, die insgesamt einesehr gut erhaltene Oberfläche von insgesamt etwa 1,6 m² ergeben. Die Anpassungen deuten da-rauf hin, dass der Putz nicht weit verbracht oder häufig umgelagert wurde. Im Gegensatz zu De-kor 12 wurden fast alle Fragmente in einer großen Grube, G6, gefunden, die in der Südwest-Ecke von Hofareal C gelegen ist (Abb. 7). Die Verfüllung enthielt fast keinen anderen Schuttund es wurden kaum Fragmente an anderer Stelle etwa in Planierschichten gefunden. Daherscheint es wahrscheinlich, dass diese Dekoration systematisch von abgebrochenen Mauern abge-schlagen und dann in der Grube entsorgt wurde – möglicherweise als Ergebnis der Steinwieder-verwendung. Dekoration 19 kann vielleicht mit Hofareal C in Verbindung gebracht werden –
einerseits wegen der Fundkonzentration in diesem Bereich andererseits wegen des Dekorsystems,denn Gartenmalereien scheinen eine beliebte Dekoration für geschlossene Höfe gewesen zu sein.Im Kontext privaten Wohnens erzeugen sie einen imaginären, offenen Raum mit Pflanzen hintereinem Zaun, wie die Dekorationen in den Höfen von Hanghaus 2 in Ephesos oder Balacapusztain Ungarn belegen25.
Die Analyse von Wandmalerei in Verbindung mit einer stratigraphischen Analyse zeigtletztendlich nicht nur Ergebnisse in Form schöner Rekonstruktionen, sondern kann als wesentli-cher Bestandteil von römischen Gebäuden helfen, geplante Demolierungen nachvollziehbar dar-zustellen und zu verstehen.
Zusammenfassung
Als Ergebnis der Analyse sei festgehalten, dass das Fallbeispiel des Heiligtums als intentionellerAbbruch und geplanter Wiederaufbau zu sehen ist und nicht als Ergebnis einer plötzlichen Zer-störung. Es lassen sich Spuren eines Feuers nur kleinräumig feststellen, Funde oder vielmehr ihrFehlen in den Schichten, die Wandmalereifragmente und die Zusammensetzung der Planier-schicht geben keine Hinweise auf Zerstörung. Grubenverfüllungen zeigen Abfall vom Überarbei-ten von Steinquadern für spätere Wiederverwendung und es ließen sich im nordöstlichen Teil desHeiligtums keine Wandmalereireste in situ feststellen. Daher wird von einem eigenen Entsor-gungsvorgang ausgegangen. All dies deutet auf eine geplante Reorganisation des Heiligtums zuBeginn des 3. Jahrhunderts hin.
AbbildungsnachweisAlle Abbildungen ÖAW, Institut für Kulturgeschichte der Antike,Wien.Abb. 3: Foto G. KremerRekonstruktion der Wandmalerei von B. Tober
22 Tober (in Vorbereitung); Gassner u. a. 2011; Gass-ner u. a. 2010, 19–21. 34 Abb. 7.
23 Palágyi 2004, 275 Abb. 12; 276.
24 Becatti 1953, 96 Taf. XXII, 1–2.25 Gassner u. a. 2011, 162–163.
374
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
BibliographieBecatti 1953 G. Becatti, I Mitrei, Scavi di Ostia II. Libreria dello Stato (Rom 1953)Birley 1930 E. Birley, Excavations on Hadrian’s Wall west of Newcastle upon Tyne in 1929,
Archaeologia Aeliana 3rd Series 7, 1930, 171–174Bishop – Coulston 1993 M. C. Bishop – J. C. N.Coulston, Roman Military Equipment (London 1993)Borhy 2004 L. Borhy, Plafonds et voûtes à l’époque antique, Actes du VIIIe Colloque inter-
national de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIP-MA), Budapest–Veszprém 15–19 mai 2001 (Budapest 2004)
Deschler-Erb 2005 E. Deschler-Erb, Militaria aus Zerstörungshorizonten – grundsätzliche Überle-gungen. „Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten“,in: Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference Wien,27.–31. August 2003, CarnuntumJb 2005, 43–44
Ertel 1991 Chr. Ertel, Römische Architektur in Carnuntum. RLÖ 38 (Wien 1991)Eschbaumer u. a. 2003 P. Eschbaumer – V. Gassner – S. Jilek – M. Kandler – G. Kremer –
M. Pfisterer – S. Radbauer – H. Winter, Der Kultbezirk des Iuppiter OptimusMaximus Heliopolitanus in den östlichen Canabae von Carnuntum – ein Zwi-schenbericht, CarnuntumJb 2003, 117–164
Eschbaumer – Radbauer 2007 P. Eschbaumer – S. Radbauer, Ausgewählte Fundkomplexe aus dem Tempel-bezirk der orientalischen Gottheiten in Carnuntum (Ausgrabungen Mühläcker),CarnuntumJb 2007, 9–25
Fischer 2005 Th. Fischer, Militaria aus Zerstörungsschichten in dem römischen FlottenlagerKöln – Alteburg. „Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungsho-rizonten“, in: Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Confe-rence Wien, 27.–31. August 2003, CarnuntumJb 2005, 2005, 162–163
Gassner in Druck V. Gassner, Die Grube G 11 im Heiligtum des Iuppiter Heliopolitanus in denCanabae von Carnuntum – Zeugnis eines großen Festes oder „sacred rubbish“?,in: G. Lindstroem – A. Schäfer – M. Witteyer (Hrsg.), Rituelle Deponierungenin Heiligtümern der hellenistisch-römischen Welt. Tagung vom 28.4. bis30.4.2008 in Mainz (in Druck)
Gassner u. a. 2010 V. Gassner – G. Kremer – E. Steigberger – B. Tober, Die Anfänge des Heilig-tums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum (Flur Mühläcker). Die For-schungen 2010, AnzWien 145, 2, 2010, 11–36
Gassner u. a. 2011 V. Gassner – E. Steigberger – B. Tober, Das Heiligtum des Iuppiter Heliopolita-nus in Carnuntum. Überlegungen zu den älteren Kultbauten an der Ostseite, ih-rer Ausstattung und den Mechanismen ihrer Aufgabe CarnuntumJb 2009–2011,129–171
Gassner – Steigberger in Druck V. Gassner – E. Steigberger, Das unsichtbare Heiligtum – die Ergebnisseder geophysikalischen Prospektion im Westteil des Heiligtums des Iuppiter He-liopolitanus in Carnuntum, CarnuntumJb 2012 (in Druck)
Gugl 2007 Chr. Gugl, Periode 3A: Das Lager des 3. Jahrhunderts, in: Chr. Gugl –R. Kastler (Hrsg.), Legionslager Carnuntum. Ausgrabungen 1968–1977, RLÖ45,Wien 2007, 54–66
Jilek 2005 S. Jilek, Militaria aus einem Zerstörungshorizont im Auxiliarlager von Carnun-tum, „Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten“, in:Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference Wien,27.–31. August 2003, CarnuntumJb 2005, 165–180
LaMotta – Schiffer 1999 V. M. LaMotta – M. B. Schiffer, Formation processes of house floor assembla-ges, in: P. M. Allison (Hrsg.), The Archaeology of Household Activities (Lon-don 1999) 19–25
Madarassy 2004 O. Madrassy, Wall-Painting from the Severan Period from the Military Town,in: L. Borhy, Plafonds et voûtes à l’époque antique, Actes du VIIIe Colloque in-ternational de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique(AIPMA), Budapest–Veszprém 15–19 mai 2001 (Budapest 2004) 295–296
Palágyi 2004 S. Palágyi, Villa romana und ihre Wandgemälde in Baláca, in: L. Borhy, Pla-fonds et voûtes à l’époque antique, Actes du VIIIe Colloque international del’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA), Buda-pest–Veszprém 15–19 mai 2001 (Budapest 2004) 271–277
375
Eva Steigberger – Barbara Tober
Parragi 2004 G. Parragi, Town Palace in the Folyamoer-Búvár Street (Aquincum, MilitaryTown), in: L. Borhy, Plafonds et voûtes à l’époque antique, Actes du VIIIe Col-loque international de l’Association Internationale pour la Peinture Murale An-tique (AIPMA), Budapest–Veszprém 15–19 mai 2001 (Budapest 2004) 292–294
Pfisterer 2003 M. Pfisterer, Fundmünzen, in: P. Eschbaumer – V. Gassner – S. Jilek – G. Kre-mer – M. Kandler – M. Pfisterer – S. Radbauer – H. Winter, Der Kultbezirkdes Iuppiter Optimus Maximus Heliopolitanus in den östlichen Canabae vonCarnuntum – ein Zwischenbericht, CarnuntumJb 2003, 139–140
Pitts – Joseph 1985 L. F. Pitts – J. K. St. Joseph, Inchtuthil. The Roman legionary fortress, Britan-nia Mon. Ser. 6 (London 1985)
Schiffer 1985 M. B. Schiffer, Is there a„Pompeii Premise“ in archaeology?, Journal of Anthro-pological Research 41, 1985, 18–41
Schiffer 1996 M. B. Schiffer, Some relationships between behavioral and evolutionary archaeo-logies. American Antiquity 61, 1996, 643–662
Steigberger – Tober 2013 E. Steigberger – B. Tober, The sanctuary of Iuppiter Heliopolitanus at Carnun-tum. Destruction or demolition? A case study, in: Proceedings to the Internatio-nal Round Table „Destruction – Archaeological, philological and historicalperspectives“ at Louvain-La-Neuve. Presses Universitaires de Louvain (Louvain-La-Neuve 2013) 435–448
Szuter 1991 C. R. Szuter 1991, Hunting by Prehistoric Horticulturalists in the AmericanSouthwest (New York 1991)
Tober 2003 B. Tober, Vorläufige Ergebnisse zu Wand- und Deckenmalereien aus Saalfelden/Wiesersberg, in: B. Asamer – W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 9. Österreichi-schen Archäologentages am Institut für Klassische Archäologie der Paris LodronUniversität Salzburg, 6.–8. Dezember 2001 (Wien 2003) 211–214
Tober 2010 B. Tober, The decorative programme of an apsidal room in the Roman villa Saal-felden/Wiesersberg – Austria, in: I. Bragantini (Hrsg.), Atti del X Congresso In-ternazionale dell’AIPMA, Napoli 17–21 settembre 2007 (Annali di archeologiae storia antica 18/2) (Neapel 2010) 857–864
Tober in Vorbereitung B. Tober, The painted decoration of the sacred area of the Heliopolitanian godsin Carnuntum, in: N. Zimmermann (Hrsg.), Akten des 11. AIPMA-Kolo-quiums Ephesos 2010 (in Vorbereitung)
Vondrovec 2007 K. Vondrovec, Gesamtdarstellung und Auswertung des antiken Fundmünzenma-terials im Museum Carnuntinum, in: M. Alram – F. Schmidt-Dick (Hrsg.), Nu-mismata Carnuntina – Forschungen und Material. Die Fundmünzen derrömischen Zeit in Österreich, Abteilung III, Niederösterreich, Bd. 2: Die anti-ken Fundmünzen im Museum Carnuntinum (Wien 2007) 55–340
376
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
Abb. 2: Detail der Bauphasen 2.1 and 2.2
Abb. 3: Altarfragment aus Grube G3, o. Maßstab
378
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
Abb. 4: Grube G6 nach Westen
Abb. 5: Rekonstruktion von Dekoration 12
Abb. 6: Rekonstruktion von Dekoration 19
379
Eva Steigberger – Barbara Tober
Abb. 7: Verteilung der Fragmente von Dekoration 12 und 19 (Oberfläche in cm²)
380
Die Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum
VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS FÜR ARCHÄOLOGIEDER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
BAND 11
Phoibos Verlag,Wien 2014
Gedruckt mit Unterstützung durch:Land Steiermark. Abteilung Wissenschaft und Gesundheit
Bibliografische Information Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Bibliographic information published by Die Deutsche BibliothekDie Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie;detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.
Einband: Gipsmuseum des Instituts für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz; © Institutfür Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz. Photo: J. KraschitzerRedaktion: Hanne Maier
Copyright # 2014, Phoibos Verlag,Wien. All rights reservedwww.phoibos.at; [email protected] in the EUISBN 978-3-85161-114- 4
Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cristina-Georgeta Alexandrescu – Gerald Grabherr – Christian Gugl –
Barbara KainrathVom mittelkaiserzeitlichen Legionslager zur byzantinischen Grenzfestung: Die rumänisch-österreichischen Forschungen 2011 in Troesmis (Dobrudscha, RO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TomÆš Aluš�k – Anežka B. SosnovÆMöglichkeiten einer 3D-Rekonstruktion der Architektur und der Fundorte imminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Martin AuerDas „Atriumhaus“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Maria Aurenhammer – Georg A. PlattnerDer Eroten-/Satyrfries vom Theater in Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Claudia-Maria BehlingDer sog. Rundmühle auf der Spur – Zug um Zug zur Neudeutung römischer Radmuster . . . . 63
Fritz BlakolmerDas orientalische Bildmotiv der Gottheit auf dem Tier in der Ikonographie desminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Andrea CsaplÆros – Tina Neuhauser – Ott� SosztaritsDie Rolle des Isis-Heiligtums in Savaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nina Dornig
Eine archäologische Landschaft zur Römerzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Josef EitlerEine weitere Kirche des 6. Jahrhunderts am Gipfel des Hemmabergs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Claudia Ertl – Daniel Modl
Die Habsburger zwischen Antikenschwärmerei und Archäologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Nicole Fuchshuber – Franz Humer – Andreas Konecny – Mikulaš FenikEin Nekropolenbefund an der südlichen Peripherie von Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Robert F�rhacker – Anne-Kathrin KlatzDie Anwendung moderner Methoden der Konservierung und Restaurierung am Beispielarchäologischer Funde aus dem Laßnitztal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Monika Hinterhçller-KleinPerspektivische Darstellungsmodi in der Landschaftsmalerei des Vierten Stils und dieRekonstruktion des Freskenprogramms im Isistempel von Pompeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Denise Katzj�gerSpätantikes Wohnen auf Elephantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Doris KnausederÜberlegungen zu den kräftig profilierten Fibeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Johanna KçckRömische Zwischengoldgläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Andreas KonecnyDie Wasserversorgung der Zivilstadt Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5
Julia KopfIm Westen viel Neues … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Gabrielle KremerZur Wiederverwendung von Steindenkmälern in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Susanne LammZwischenland – Zur Grenze zwischen Noricum und Pannonien abseits des Wienerwaldes . . . 209
Felix Lang – Raimund Kastler – Thomas Wilfing – Wolfgang Wohlmayr
Die römischen Ziegelbrennöfen von Neumarkt-Pfongau I, Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Claudia Lang-AuingerRömische Tempelanlagen in griechischen Städten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Hannes LeharDem Ignis Languidus auf der Spur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Johann LeidenfrostDas Holzfass vom Magdalensberg und seine Rekonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Stephan LeitnerDie Römer im Oberen Vinschgau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Patrick Marko
Κἀπὶ Κυρβάντεσι χορεύσατε. Ein soziologischer Versuch zu veränderten Bewusstseins-zuständen in der Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Daniel Modl
Zum Stand der Experimentellen Archäologie in der Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Tina Neuhauser – Marina UgakovićEpetion (Stobreč, HR) – City wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Karl Oberhofer – FØlix TeichnerIm Schatten der Colonia Emerita Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Toshihiro Osada
Ist der Parthenonfries sinnbildlicher Ausdruck des athenischen Imperialismus ? . . . . . . . . . . . . 307
Lisa PeloschekFunktionell oder rituell ? Technologische Charakterisierung spätklassisch-hellenistischerKeramik aus der Nekropole von Aphendrika (Zypern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
RenØ PloyerUntersuchungen zur Besiedlung des südlichen Hausruckviertels (Oberösterreich) währendder römischen Kaiserzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Sven SchipporeitTriumphal- und Siegesdenkmäler außerhalb von Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
G�nther SchçrnerHäuser und Hauskulte im römischen Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Yvonne SeidelEx oriente ? – Zur Entstehung und Entwicklung von Beleuchtungsgeräteständern . . . . . . . . . . 353
Stephanie SitzFirmalampen des EVCARPVS. Produktion und Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Eva Steigberger – Barbara ToberDie Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Karl StrobelNoreia – Atlantis der Berge ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
6
Inhaltsverzeichnis
Magdalena St�tzDen Gürtel um die Hüfte geschlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Attila Botond SzilasiWohlsdorf: The Bronze Age Settlement and the Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Ingrid Tamerl„Baccus fecit“ – Überlegungen zum Fassbinderhandwerk in der römischen Antike . . . . . . . . . 413
Susanne TiefengraberSt. Jakob am Mitterberg – Romanische Kirchenruine und frühe mittelalterliche Burgstelle . . 423
Barbara ToberDie Wandmalereien von Immurium-Moosham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Jçrg Weilhartner
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern derägäischen Bronzezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Gudrun Wlach
Arnold Schober – Leben und Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Programm des Archäologentages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
7
Inhaltsverzeichnis