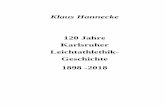18 Jahre Rehwildbewirtschaftung im nördlichen Waldviertel
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 18 Jahre Rehwildbewirtschaftung im nördlichen Waldviertel
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
1
18 Jahre Rehwildbewirtschaftung im nördlichen Waldviertel
Erfahrungen, Erfolge, Überlegungen,
Abschlussarbeit im Rahmen des Universitätslehrganges
Jagdwirt
Universität für Bodenkultur,
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft,
Prof. Klaus Hackländer
Verfasser:
Erich Hofer
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
2
I N H A L T
1. Vorwort ……………………………………………………………………… 3
2. Überlegungen zur Rehwildhege …………………………………………….. 4
3. Wovon kann der „Erfolg“ abhängig sein …………………………………… 8
4. Unsere Ziele ………………………………………………………………… 10
5. Das Revier …………………………………………………………………... 11
5.1. Lage ………………………………………………………………………. 11
5.2. Geologische Situation ……………………………………………………. 11
5.3. Klimatische Situation …………………………………………………….. 11
5.4. Lufttemperatur ……………………………………………………………. 12
5.5. Niederschlag ……………………………………………………………… 13
5.6. Schnee, Hagel, Gewitter ………………………………………………….. 14
5.7. Revierdaten ……………………………………………………………….. 14
5.8. Die wesentlichen Kriterien im Überblick ………………………………… 14
5.9. Vorhandene Wildarten ……………………………………………….…… 15
5.10. Reviernamen und Abkürzungen ………………………………………….. 15
5.11. Übersicht über die flächigen Anteile ……………………………………... 16
5.12. Wie gut ist das Revier als Rehwildlebensraum geeignet …………………. 17
5.13. Landwirtschaftliche Bewirtschaftung …………………………………….. 18
6. Fütterungen ………………………………………………………………… 24
6.1. Welche Parameter kann der Jagdpächter beeinflussen …………………… 26
7. Das Futter …………………………………………………………………... 28
8. Bejagung ……………………………………………………………………. 32
8.1. Abschusspläne ……………………………………………………………. 34
8.2. Wonach haben wir unsere Abschusspläne erstellt ……………………….. 38
9. Auswirkungen ……………………………………………………………... 40
9.1. Gesundheit ………………………………………………………………. 44
10. Resümee …………………………………………………………………… 49
11. Literaturliste ……………………………………………………………….. 50
Fotonachweis: alle Fotos Hofer, bis auf Seite 6 (oben): B.Winsmann-Steins, Seite 17
(unten): Wandaller, Seite 18 (oben) ÖBF, Seite 18 (unten) Trumler
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
3
1. Vorwort:
Seit meinen ersten jagdlichen Schritten mit ca.13 Jahren hatte ich die Gelegenheit, Rehwild
zu beobachten und zu bejagen. Aufgewachsen in rehwildreichen Revieren im Bereich der
Wachau und des Waldviertels war und ist das Rehwild die für mich jagdlich interessanteste
Wildart. Vermutlich auch deshalb, weil ich bisher ganz hervorragende Möglichkeiten im In-
und Ausland hatte, diese, für mich auch durch ihre besonders variablen und beeindruckenden
Geweihe, faszinierende Wildart zu bejagen.
Da mein um zwei Jahre ältere Bruder diese Leidenschaft mit mir teilt und wir den gleichen
jagdlichen Werdegang hatten, war es für uns als junge Jäger natürlich ein Traum, einmal
selbstständig ein gutes Rehwildrevier zu bewirtschaften. Nachdem wir uns diesen Traum
gemeinsam erfüllten, wird im Text immer das wir stehen, da wir die gesamte Bewirtschaftung
immer gemeinsam gemacht haben und viele Überlegungen und Erkenntnisse aus langen, für
uns beide aber immer interessanten Diskussionen und Gesprächen stammen.
„Angestiftet“ von den Erfolgen Herzogs von Bayern1 sowie Giacomo Maggios
2 und den
Hofmanschen Erkenntnissen und Überlegungen zur Herbstmastsimulation3 begannen wir
natürlich mit Fütterungsversuchen. Das uns damals (1983) zur Verfügung stehende Revier
waren aber von der Größe her ungeeignet (nur ca. 140 ha), um einen halbwegs reviereigenen
Rehbestand zu bewirtschaften.
Im Jahr 1992 pachteten wir dann unser erstes größeres Revier (Mühlbach) mit ca. 745 ha, im
nördlichen Waldviertel. Durch glückliche Umstände gelang es uns nach Ablauf der ersten
Jagdperiode (9 Jahre) noch weitere 6 Reviere anzupachten bzw. unter unseren jagdlichen
Einfluss zu stellen. Dadurch waren wir nun in der Lage, auf einer zusammenhängenden
Fläche von nahezu 5000 ha nach unseren Vorstellungen „Rehwildhege“ zu betreiben.
Erich Hofer Jänner 2010
1 v. Bayern 1975
2 Maggio 1978
3 Hofman 1978
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
4
2. Überlegungen zur Rehwildhege
Um ganz ehrlich zu sein stand auch bei uns am Anfang unserer Überlegungen die
Trophäe im Vordergrund. Besonders nervte uns das endlose Lamentieren der
ortsansässigen Jäger auf den sogenannten Hegeschauen (früher hießen sie
Trophäenschauen, was sie auch nach wie vor sind) über immer schlechter werdende
Rehböcke und schwächeres und auch weniger Rehwild. Durch verschiedenste
(untaugliche) Maßnahmen wie Selektionsabschüsse (Hege mit der Büchse!), Entwurmen,
Blutauffrischungen etc. versuchte man, die Lage zu verbessern. Allerdings ohne
sichtbaren Erfolg.
Kaum eine Berufsgruppe hätte es sich leisten können so lange wie die Jäger erfolglos und
mit untauglichen Mitteln ihre Ziele zu verfolgen. Da unter den Jägern auch viele
Landwirte sind, herrscht sehr häufig der aus der Landwirtschaft stammende Zucht- und
Auslese-Gedanke vor, der natürlich bei einem Wildtier wie dem Rehwild zu keinem
Erfolg führen kann, wenn man sich auf phänotypische Merkmale konzentriert und die
Fortpflanzung nicht kontrollieren kann. Es gab und gibt aber zweifellos Gebiete, oft
einzelne, relativ kleine Reviere, die eine völlig abweichende „Qualität“ im Vergleich zu
den Nachbarrevieren aufweisen. Nun kann man natürlich den Begriff Qualität bezüglich
einer jagdlich intensiv zu nutzenden Wildart hinterfragen. Ich bin der Ansicht, dass man
„Qualität“ durchaus mit hohem Wildbretgewicht, guter Trophäenqualität, Vitalität, hoher
Reproduktion und gutem Gesundheitszustand umschreiben kann.
Dass die Bestandeshöhe unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher und besonders
forstwirtschaftlicher Interessen sein muss, bzw. dass ein eventueller Einfluss des
Rehwildes auf andere Tierarten bedacht werden muss, ist Grundvoraussetzung für solche
Überlegungen.
Bei den vorher erwähnten Revieren und Gebieten gibt es einige, bei denen eine
Qualitätssteigerung durch besondere Reviergestaltung und menschlichen Einfluss
erklärbar ist. Das oft erwähnte Kaunertal ist hier ein typisches Beispiel4:
- Ein nahezu geschlossener Talkessel, aus dem es aufgrund der Topographie, eigentlich
kein Auswechseln des Rehwildes über die begrenzenden Berge gibt.
- Eine Höhenlage, die ein geringeres natürliches Äsungsangebot im Spätherbst und
Winter bietet und daher die Annahme des vorgelegten Futters begünstigt.
- Absolute Ruhe in den Fütterungszonen (gut gelenkter Wintertourismus).
- Tägliche Futtervorlage ad libitum mit einer langen Fütterungsperiode.
- Und nicht zuletzt, von Hegemeister Gitterle in seinem Buch 5 so nebenbei erwähnt, die
Vorlage von Sesam mit einem 20 % Anteil (40% Maisbruch, 40% Hafer) in der
Ration.
Die Wirksamkeit der Sesamzugabe bei Rot- und Rehwildfütterung ist seit den Versuchen
von Franz Vogt und Ferdinand Schmid ausreichend bekannt6. Die schon vorher erwähnte
gatterähnliche Situation, erlaubt auch eine vollkommen unterschiedliche Abschussplanung
mit einem Anteil von über 81,8 % (!) an sogenannten Ernteböcken (Anteile männl.
Rehwildes in % über 20 Jahre: 3,1% Bockkitze, 6,3% Jahrlinge, 8,8% „Zweierklasse“,
81,8% „Einserklasse“, als mind. 5-jährig). Da es ja, wie erwähnt, nahezu keine
Abwanderungsmöglichkeit gibt, können fast alle Böcke, die im Revier gesetzt werden,
4 Gitterle 2006
5 Vogt 1950
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
5
sofern sie nicht schon vorher auf andere Weise ums Leben kamen, jagdlich genutzt
werden, was wiederum eine hohe Wertsteigerung für das Revier bedeutet.
Ein weiteres, vollkommen anders geartetes Revier ist Rimavska Sobotka in der
Slowakischen Republik. Es erstreckt sich an den südlichen Abhängen des slowakischen
Erzgebirges. Das, damals (1990) ca. 6000 ha große, im Eigentum des Slowakischen
Staates7 stehende, gut strukturierte Revier, verfügt über große geschlossene Waldflächen
in die lange Wiesenstreifen vom Tal aus weit hineinragen. Die Wiesen wurden vor langer
Zeit als Schafweiden, danach, bis zur der Zeit der „sanften Revolution“, nur mehr
teilweise landwirtschaftlich genutzt.
Auffällig war auch der damals viel zu hohe Schwarzwildbestand, der aber mit dem
Ausbruch der Schweinepest Ende der 1980iger Jahre, völlig zusammenbrach. Auch das
Rotwildvorkommen war sehr gut. Es gab überhaupt keine Rehwildfütterung. Trotzdem
wurden jedes Jahr ca. 20, zum Teil hochkapitale Böcke erlegt. Abgesehen davon, wurde
das Rehwild eigentlich nicht bewirtschaftet. Bei Durchsicht der slowakischen
Trophäenlisten8 findet man bis ca. 1930 zurückreichend eine Vielzahl kapitaler Böcke, die
in diesem Revier erlegt worden sind.
Nur wenige Kilometer weiter, im Raum Lucenec, ein wie man vermuten könnte, für das
Rehwild besser geeigneter Lebensraum als Rimavska Sobota (geringere Meereshöhe,
weniger Schneelage, landwirtschaftliche Nutzung – also große Luzernenschläge etc.), hat
man in all den Jahren nicht annähernd so starke Böcke erlegt. Wenn man davon ausgeht,
dass zwischen sicherlich zusammenhängenden und sich austauschenden Populationen
kein genetischer Unterschied vorliegt, so müssen es standortspezifische Faktoren sein,
welche die unterschiedliche Qualität beeinflussen, da man von einer Bewirtschaftung im
herkömmlichen Sinn in beiden Fällen nicht sprechen konnte.
Eine weitere interessante Besonderheit stellen verschiedene, relativ kleine Reviere in
Südschweden im Bezirk Schonen dar. Nicht nur, dass der aktuelle Weltrekord aus einem
dieser Reviere stammt, bringen es Reviere ohne jeglichen menschlichen Einfluss
(vielleicht auch deshalb) jährlich zu einigen Kapitalböcken, die ihresgleichen suchen.
Der bekannte Wildfotograf und begeisterte Jäger Burkard Winsmann-Steins schreibt
darüber in seinem Buch9 :
Die beiden Reviere in Schonen, in denen ich hauptsächlich fotografierte und auch jagte,
lagen nur 25 Kilometer auseinander, doch sie zeichneten sich durch gravierende
Unterschiede aus. Das 700 Hektar Revier, liegt fast an der Südküste. Die Eiszeit hat hier
steile Schluchten hinterlassen und die Felder sind wesentlich kleiner als im 3800 Hektar
Revier in der Mitte Schonens. Das südliche Revier wurde fast gar nicht bejagt, das
größere normal - jedenfalls für schwedische Verhältnisse. In dem 700 Hektar Revier im
Süden Schonens ließ der Jagdherr jedes Jahr nur zwei bis drei Böcke erlegen – meist
kapitale – die Abschüsse wurden an Ausländer verkauft. Weibliches Rehwild wurde so gut
wie gar nicht erlegt und auch Jährlinge genossen ganzjährige Schonzeit…Die Wilddichte
lag bei etwa 30 Stück auf 100 Hektar, d.h. es gab mindestens 200 Rehe in diesem Revier.
Man kann sagen, dass eigentlich keine geregelte Bejagung stattfand. Für mich als
Fotograf war das Revier natürlich ideal, denn ich konnte die Rehböcke – wenn sie nicht
zu nah an der Grenze standen - von Jahr zu Jahr fotografieren. Die meisten Böcke starben
einen normalen Alterstod. Die Schädel fanden wir oft, meist noch mit einer
abgeschliffenen, aber intakten Zahnreihe. Leider verendeten die Alten immer nach dem
7 Quelle: Stredoslovenske Lesy 1992
8 Quelle: Stredoslovenske Lesy 1988 – Die stärksten Trophäen der Tschechoslowakei
9 Winsmann-Steins 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
6
Abwerfen. Der Durchschnitt der älteren Böcke war stark bis kapital. Doch gab es auch
außerordentlich dünnstangige Vertreter ihrer Art, die mehr in ein deutsches Revier
gepasst hätten. Der Qualitätsdurchschnitt wäre sicher angehoben worden, wenn man
diese „Mickerböcke“ aus der Wildbahn entnommen hätte. Doch der Jagdherr blieb hart –
sie mussten am Leben bleiben.
Was dieses Revier in punkto Gehörnqualität geleistet hat, möchte ich anhand folgenden
Beispiels darlegen: Nach Wagenknecht kamen in der ehemaligen DDR in den Jahren
1961 bis 1970 im Durchschnitt fünf Goldmedaillenböcke zur Strecke. Da man alle
Trophäen herzeigen musste, werden es auch nicht mehr gewesen sein. Wenn man wollte-
ein gutes Gehörnjahr natürlich vorausgesetzt –könnte man diese fünf Goldmedaillenböcke
allein auf der knapp 700 Hektar großen Fläche des Reviers in Schonen erlegen……..
Auch vor dem zweiten Weltkrieg hat es dort bei etwas geringerer Wilddichte
Goldmedaillenböcke gegeben, die Spitzenböcke fielen jedoch alle im letzten Jahrzehnt bei
der genannten, extrem hohen Bestandesdichte. (Zitat Ende)
Habitat Südschweden
Habitat Waldviertel
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
7
Wenn man die klein strukturierten, landwirtschaftlich genutzten, Flächen in Schonen sieht,
fallen mir die durchaus vergleichbaren Verhältnisse im Waldviertel ein. Dennoch gibt es,
offensichtlich nicht sofort erkennbare, Unterschiede in den Lebensräumen.
Einer der wesentlichen Faktoren könnte die unterschiedliche Verfügbarkeit von
Mineralstoffen in den Äsungspflanzen sein.
Burkard Winsmann-Steins in seinem Buch10
: (Zitat) Der einzige, allerdings sehr auffällige,
Unterschied ist der ungeheure Steinreichtum, den hier die Endmoränen abgelagert haben.
Riesige Findlinge und Steinmauern geben überall der Landschaft ihr Gepräge, und die Felder
sind mit kleinen Steinen übersät. Sicher scheint mir, dass durch den fortgesetzten
Verwitterungsprozess die Böden und damit die Pflanzen, die auf ihnen wachsen,
außerordentlich reich an Mineralstoffen sind. (Zitat Ende).
10
Winsmann-Steins 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
8
3. Wovon kann der „Erfolg“ abhängig sein?
Was sind die entscheidenden Faktoren und sind unsere Rehe
durch „Hegemaßnahmen“ zu beeinflussen?
Wie aus den Beispielen hervorgeht, lässt sich überhaupt kein Schema aufstellen. Natürlich
kann man sagen, das Ganze ist ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren und
Bedingungen wie Dichte, Höhenlage, durchschnittliche Schneelage, Temperaturen,
Äsungsangebot, Ruhe, Landschaftsstrukturen und vieles mehr wie z.B. die so oft zitierte
überhöhte Dichte: Das 700 Hektar Revier in Schonen belehrt uns eines Besseren.
Auch Herzog von Bayern hat dahingehend seine besonderen Erfahrungen gemacht: 11
(Zitat)
Als Enklave liegt im Revier ein 70 ha großer Waldbesitz von Herrn Lotteraner, dem wir ganz
besonders danken, dass wir unsere Fütterungsversuche und Beobachtungen auch dort
durchführen konnten. Dieser Besitz ist vor einigen Jahren eingezäunt worden, um ihn
hochwildfrei zu halten. Aus verschiedensten Ursachen ist uns der dortige Rehwildbestand
weit über die vorgesehene Zahl angewachsen. Es war auch aus vielerlei Gründen nicht
möglich, die gewünschte Reduktion in der vorgesehen Zeit durchzuführen. Weil dort das
überzählige Jungwild nicht abwandern konnte, ist die Wilddichte trotz eines hohen
Abschusses rapid angestiegen und zwar im Gegensatz zum übrigen Revier, im dem sich der
Wildbestand, wie im Kapitel VII ausführlich beschrieben, ziemlich unabhängig vom Abschuss
durch Abwanderung fast von selbst reguliert . Um aber in diesem Gatter bei der übermäßig
hohen Wilddichte etwaigen Verbiss-Schäden an den vielen Fichtenkulturen zuvorzukommen,
bis der geplante Reduktionsabschuss durchgeführt werden konnte, wurden sofort auf diesen
70 ha zwölf verschiedene Futterstellen errichtet und dort vorsichtshalber ganzjährig
durchgefüttert. Diese Maßnahme hatte Folgen, die wir vorher nicht für möglich gehalten
hätten. Die erstaunlichste war die Auswirkung auf den Wildverbiss an den nach wie vor in
gleicher Weise gestrichenen Fichtenkulturen. Vor dieser Fütterungsweise waren dien
Schäden bei dem früheren niederen Rehwildbestand zwar nicht ernst aber immerhin
vorhanden. Trotz der spätern übermäßigen Wilddichte sind diese nicht nur zurückgegangen,
sondern haben fast aufgehört. Hievon konnten sich auch mehrere führende Forstmänner
überzeugen.
Die nächste überraschende Tatsache war, dass der Durchschnitt der Rehe die bei der
höchsten Wilddichte herangewachsen sind, sowohl im Körpergewicht und
Gesundheitszustand als auch in der Vermehrungsrate und Geweihbildung mit Abstand der
beste des Gesamtreviers wurde. Weiterhin haben sich die Größen der Territorien der
einzelnen Böcke derart reduziert, dass einige davon kaum 100 m im Durchmesser betragen,
ohne dass es zu größeren Auseinandersetzungen zwischen den Böcken kommt als im übrigen
Revier. In einem Jahr wurden aus diesem 70 ha großen Gatter 33 Rehe herausgeschossen.
Im Jahr darauf wurde der Zaun durch Windwürfe und Steinschlag undicht. Dadurch ist
obendrein zu unserer großen Erleichterung der größte Teil der Jahrlinge beiderlei
Geschlechts ausgebrochen, was durch markierte Kitze festgestellt werden konnte. Jedoch ist
unseres Wissens keine einzige der markierten Altgaisen ausgebrochen nur 2 starke Böcke.
Diese wurden zwar mehrmals außerhalb des Zaunes gesehen, waren aber noch bevor der
Zaun repariert werden konnte, schon wieder eingewechselt….
Nebenbei sei noch bemerkt, dass dieses Gatter der kälteste Platz im ganzen Revier ist. Ein tief
gelegener Graben, in den lange Zeit im Winter kaum ein direkter Sonnenstrahl fällt. Von
11
v. Bayern 1981
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
9
Mitte Dezember bis 21. Januar hat dieses Gebiet überhaupt keine und erst ab Ende Januar
haben solche Plätze, an denen Rehe stehen können, eine Stunde Sonne. (Zitat Ende)
Die alleine aus diesem Teil der Untersuchungen von Herzog von Bayern gewonnenen
Erfahrungen bezüglich Trophäenstärke zeigen auf, dass etliche der für die Trophäenqualität
als besonders relevant eingestuften Faktoren wie Dichte, Anzahl der Sonnentage, Stress etc.,
die von den sogenannten „Rehpäpsten“ genannt werden, hier nicht zutreffen. 12
/13
Der einzig
entscheidende Faktor war hier offensichtlich, unbegrenzte Nahrung. Ein möglicher Schluss
daraus wäre, dass unbegrenzte Nahrung andere Faktoren, die bisher für die
Geweihentwicklung als wesentlich betrachtet wurden, anscheinend kompensieren kann.
Man könnte die Ausführungen über „wichtige“, veränderbare, bzw. durch den Jäger zu
beeinflussende Faktoren hinsichtlich „Rehwildhege“ ziemlich lange fortsetzen und wird
immer Beispiele in der Literatur und Praxis finden, welche das Gegenteil oder zumindest den
weniger gewichtigen Einfluss beweisen.
Eine Konsequenz - wage ich zu behaupten - kann man aus all den mehr oder weniger
wissenschaftlich nachvollziehbaren Untersuchungen und Versuchen ziehen:
Ohne Verbesserung der Nahrungsgrundlagen, auf welchen Wegen auch immer, wird man eine
Steigerung des Körpergewichtes und der Trophäenqualität nicht erreichen!
12
Stubbe 2008 13
Elßmann 1971
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
10
4. Unsere Ziele
Wie schon erwähnt war am Anfang die Trophäenqualität Mittelpunkt unserer Überlegungen.
Die eigene Jagdleidenschaft, Freude an starken Trophäen und der Ärger über den allgemeinen
Schwachsinn, der nicht nur auf den „Hegeschauen“, Hegeringsitzungen und in den
verschiedensten Medien diverser Landesjagdverbände, bezüglich Rehwildbewirtschaftung
immer wieder verzapft wurde (und wird), waren unser Triebfedern.
Und das alles 40 Jahre nach Vogt und nach den Erkenntnissen Herzogs von Bayern. Das
Beharren der meisten, noch dazu wie man annehmen konnte erfahrenen Jäger, auf alten
Zöpfen, begonnen bei der Altersansprache über Abschusspläne und Zuwachsmodelle bis zur
Winterfütterung oder Entwurmung, war für uns damals die Herausforderung, es „besser“ zu
machen.
Im Laufe der Jahre haben wir zwar die Trophäenstärke nicht „aus den Augen verloren“, aber
mit zunehmenden Erfahrungen war die Gesamtentwicklung unseres Rehbestandes, unter
Einbeziehung anderer Aspekte wie Gesundheit, Populationsdynamik, Auswirkungen auf den
Wald etc., für uns wichtig.
Natürlich muss ich rückblickend sagen, dass unser damaliger Wissens- und Erkenntnisstand
ein vollkommen anderer war, als er es heute ist. Dennoch glaube ich, dass die unter großem
persönlichen Einsatz gemachten Erfahrungen, die erreichten Erfolge und Misserfolge, vor
allem aber die intensive Beschäftigung mit diesen Themen zu einer persönlichen jagdlichen
Weiterentwicklung geführt hat, welche uns heute so manches durchaus selbstkritisch und
auch anders als damals beurteilen lässt.
Die Diskussion darüber, was der Jagdausübungsberechtigte an Bewirtschaftungsmaßnahmen
setzen darf, um seinen Ertrag und jagdlichen Nutzen aus einem, von ihm für gutes Geld
gepachteten Jagdgebiet zu ziehen, ohne als „ Verhausschweiner“ des Wildes zu gelten, ist
sicherlich notwendig. Ohne hier Namen zu nennen wird diese Diskussion aber häufig von
jenen begonnen, die selbst jagdlich immer aus dem Vollen schöpfen durften, und das meist
noch unentgeltlich, und daher kaum Überlegungen über Kosten, Ertrag und vor allem auch
jagdlichen Nutzen anstellen mussten.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
11
5. Das Revier
Eignung der Jagdfläche für Rehwild
5.1. Lage
Bei den von uns bewirtschafteten Revieren handelt es sich um sieben zusammenhängende
Genossenschaftsjagdreviere mit einer Gesamtfläche von 3873 Hektar.
Die Reviere liegen im nördlichen Waldviertel in den politischen Bezirken Gmünd und Zwettl.
Sie gehören zu den Gemeinden Groß Gerungs, Langschlag und Bad Großpertholz mit
insgesamt 14 Katastralgemeinden.
5.2. Geologische Situation
Geologisch ist das Waldviertel ein Teil des Böhmischen Massivs, eine Grundgebirgs-
landschaft mit Höhen bis zu 1000 Metern, hauptsächlich aus Graniten und Gneisen bestehend.
Das Böhmische Massiv wird durch eine breite Palette unterschiedlicher Umwandlungs-
gesteine und magmatischer Gesteine gebildet. Sehr typisch für die verwitterungsgeformte,
hügelige Rumpflandschaft sind die häufig in allen Größen zu findenden Granitblöcke,
Restlinge genannt.14
Das Revier erstreckt sich von 625 bis 1045 Meter Seehöhe.
5.3. Klimatische Situation
Im Untersuchungsgebiet herrscht kontinental geprägtes Hochflächenklima.
Die nachstehenden Klimadaten basieren auf den im ca. 8 km entfernten Weitra erhobenen
Daten. Da der Großteil des Untersuchungsgebietes aber im oberen Bereich der
durchschnittlichen Seehöhe liegt, muss man für die betrachtete Revierfläche, Schneelage und
Minus-Temperaturen betreffend, durchwegs die extremeren Werte annehmen.
14
Quelle: Wandaller 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
12
5.4. Lufttemperatur15
Die Lufttemperaturdaten zeigen, dass im Untersuchungsgebiet relativ tiefe
Wintertemperaturen über längere Zeiträume vorherrschen.
Nur der Juli ist im Allgemeinen als einzig frostfreier Monat anzusehen.
15
Quelle: Wandaller 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
13
5.5. Niederschläge16
Die langjährigen Niederschlagsmengen liegen zwischen 500 und 800 mm, wobei das
Niederschlagsmaximum im Sommer liegt.
16
Quelle: Wandaller 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
14
5.6. Schnee, Hagel, Gewitter17
Der Winter im Waldviertel ist geprägt durch Schnee und Sonnenschein. Da die größten
Niederschlagsmengen in den Sommern fallen, sind die absoluten Schneehöhen nicht zu hoch.
Allerdings ist in den Monaten November bis März mit ca. 65 Tage mit geschlossener
Schneedecke zwischen 1-20 cm zu rechnen.
17
Quelle: Wandaller 2007
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
15
5.7. Revierdaten
5.8. Die wesentlichen Revierdaten im Überblick
Gesamtgröße : 3873 Hektar
Die Form der Gesamtjagdfläche ähnelt der eines Croissants, dessen Spitzen nur ca.600 Meter
voneinander entfernt liegen und in dessen innerem Bereich ein ca. 540 ha großes Revier liegt,
welches noch von einem anderen Pächter bewirtschaftet wird, von unserem Jagdgebiet aber
nahezu zur Gänze umschlossen ist. Da der dort zuständige Jagdpächter seit vielen Jahren
außer 2-4 älteren Böcken absolut kein Rehwild erlegt, wirkt sich dieser Umstand deutlich auf
unsere umgebende Revierfläche aus.
Vier Reviere liegen im politischen Bezirk Gmünd, drei im politischen Bezirk Zwettl.
Diese Tatsache wirkt sich auf die Abschussplanung der jeweiligen Reviere aus, da die
Bezirksverwaltungsbehörde als Jagdbehörde von den jeweilig verantwortlichen
Forsttechnikern und Bezirksjagdbeiräten, die zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten
bezüglich Wildbestand und Abschussplanung vertreten, beeinflusst wird.
5.9. Vorkommende Wildarten
Hauptwildart:
- Rehwild,
weiters vorkommende Schalenwildarten:
- Schwarzwild,
- Rotwild, (Wechselwild aus den benachbarten Großbesitzen Waldgut Pfleiderer,
FVW Fürstenberg,)
- Damwild, Muffelwild, (jeweils einige Stücke, welche offensichtlich aus Gattern
stammen, sich jedoch bereits in freier Wildbahn vermehren, aber auf Grund des
geringen Gesamtbestandes jagdlich nicht relevant sind.)
Sonstige:
Haar- Niederwild:
- Hasen
-
Beutegreifer:
- Fuchs, Dachs, Stein- u. Edelmarder, Fischotter
Fallweises Auftreten von Luchs, Uhu, Habicht und Wanderfalke (es gab in den Jahren 1990
bis 2000 vier Luchsbegegnungen mit uns bekannten Jägern, Fotofalle 2010 im Revier P, die
genannten Greifvögel werden alljährlich von uns selbst mehrmals beobachtet).
Haselhuhn ist in weiten Teilen des Reviers zu finden.
Birkhuhn nach Meliorationsmaßnahmen zu Beginn der 1970er Jahre praktisch verschwunden,
fallweise nicht gesicherte Sichtmeldungen. Ab 1965 wurden Trockenlegungsmaßnahmen vom
Land Niederösterreich massiv gefördert. Allein im Revier W wurden bis 1970 über 40km
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
16
Drainagen verlegt und damit weit über 200 ha Wiesen entwässert. Bis 1965 wurden Jahr für
Jahr 4 Birkhähne im Revier W erlegt, 1973 noch 1 Birkhahn erlegt und in den
darauffolgenden Jahren Birkwild nur mehr fallweise beobachtet.
5.10. Reviernamen und Abkürzungen
Reichenau am Freiwald R
Bad Großpertholz P
Watzmanns W
Abschlag A
Oberkirchen O
Bruderndorf B
Langschlag L
5.11. Übersicht über die flächenmäßigen Anteile
von Wald, Feld, Wasser für die jeweiligen Reviere und Gesamtübersicht
Revie
rbezeic
hu
ng
ha -
gesam
t
ha -
Wald
ha -
Feld
ha -
Wa
sse
r
ha -
"R
uh
en
d.
Jag
d"
Reichenau R 354,22 208,67 144,75 0,08 0,72
Pertholz P 465,12 404,26 60,94 0,09 0,25
Watzmanns W 736,39 318,01 413,68 0,90 3,80
Abschlag A 352,00 94,29 257,02 0,40 1,90
Oberkirchen O 831,76 320,25 505,13 1,13 5,25
Bruderndorf B 702,92 329,89 369,16 0,67 3,10
Langschlag L 431,55 176,55 226,00 2,00 27,00
ha gesamt 3.873,96 1.851,92 1.976,68 5,27 42,02
Verteilung in % 47,80% 51,02% 0,14% 1,08%
Im Wald dominiert nach wie vor die Fichte als „Brotbaumart“ der Landwirte. Wie in vielen
Teilen Österreichs, kam es erst in den letzten 15 Jahren zu einem Umdenken und zum
Bestreben, wieder vermehrt Laubholz einzubringen. Kiefer und Buche sind in geringem
Ausmaß vertreten.
Die Hauptfruchtfolge auf den Feldern ist Hafer, Kartoffel und Winterroggen. Erst durch
relativ junge Saatguttypen ist es in den letzten Jahren auch möglich, Weizen, Wintergerste
oder Tritikale anzubauen. Abhängig von der Viehbewirtschaftung findet man auch häufig
mehrjährige Kleefelder. Die Zuckerrübe wird nur selten als Futterpflanze angebaut.
Mais für Silagezwecke wird insgesamt nur auf einer Fläche von ca. vier Hektar gebaut und
ergibt lediglich im Zusammenhang mit Schwarzwild ein Problem.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
17
5.12. Wie gut ist das Revier als Rehwildlebensraum geeignet?
Der Großteil des Reviers ist geprägt, von der für das Waldviertel typischen, hügeligen
Terrassenlandschaft mit zahlreichen Büschen und Einzelgehölzen.
Für die Gesamtbeurteilung der Habitateignung ist auch der Anteil von Wald und Feld an der
Gesamtfläche mitentscheidend. In unserem Fall beträgt der Waldanteil gerundet 48 %, der
Feldanteil 51%. In dem Feldanteil sind auch die zahlreichen mit Strauchbewuchs
vorhandenen Feldraine enthalten. Mindestens so wichtig wie die jeweiligen Anteile ist auch
die Verteilung und Vermischung der Wald- und Feldanteile. Auf den nachfolgenden Bildern
kann man die vorhandenen Strukturen sehr gut erkennen.
Einer der Revierteile mit der höchsten Rehwilddichte „Watzmanns“
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
18
Auf dem Luftbild sind die entstehenden Grenzlinien in verschiedenen
Revierteilen gut erkennbar.
5.13. Landwirtschaftliche Bewirtschaftung
Die im Untersuchungsgebiet vorherrschende landwirtschaftliche Bewirtschaftungsform ist die
Mischwirtschaft auf Basis der klassischen 3-Felder Wirtschaft. Die ursprünglichen
Betriebsgrößen lagen bei 8 - 15ha Grünland / Felder und 2-10 ha Wald. Durch die
Veränderungen in der Landwirtschaft und neue Einflüsse wie EU Erweiterungen und
Ostöffnung kommt es zu massiven Strukturveränderungen.
Im Waldviertel nicht allzu lange her. Foto: Trumler
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
19
Da laufend Betriebe, nicht nur infolge eines Generationswechsels, sondern auch aus Gründen
der Überlebensfähigkeit ihren Betrieb einstellen, können andere Betriebe zusätzliche Flächen
anpachten, sodass sich die Betriebsgrößen zunehmend verändern und der Durchschnitt der im
Vollerwerb geführten Landwirtschaften schon über 35 ha liegt.
Leider wurden in den letzten 15 Jahren sehr häufig, vor allem an Waldrändern liegende,
kleinere Wiesenflächen, deren Bewirtschaftung sich aus Gründen der Erreichbarkeit,
Futterqualität und Topographie für die Landwirte nicht mehr „rechnete“, aufgeforstet.
Erschwerend kommt hinzu, dass hauptsächlich Fichten gesetzt wurden.
Da Waldflächen im Allgemeinen nicht verpachtet werden, sind die bei den aufgelassenen
Betrieben verbliebenen bäuerlichen Kleinwaldflächen, sehr unterschiedlich gepflegt und
forstlich bewirtschaftet. Das wirkt sich auf die Einstands- und Äsungsqualität bezüglich des
Rehwilds aus.
Ein wesentlicher Faktor in der Betrachtung der Habitateignung, ist die durchschnittliche
Grundstücks- und Parzellengröße im Untersuchungsgebiet und die Gestaltung und das
Vorhandensein von Feldrainen. Durch Erbteilung und Verkäufe, kam es sowohl im Feld wie
im Wald, zu häufigen Grundstücksteilungen, die zu extrem schmalen Flurbreiten führten
(sogenannte „Hosenträger Luß“). Die daraus entstehenden Grenzlinien und Strukturen sind
von maßgeblicher Bedeutung für rehwildgerechte Lebensräume.
Die hohe Verfügbarkeit von Knospen und Kräutern an den unzähligen Feldrainen und
Strauchreihen (die auch regelmäßig auf den Stock gesetzt werden) war und ist für die hohe
Lebensraumqualität mitentscheidend.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
20
Der Einfluss der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung hat sich in den letzten 15 Jahren (auch
durch den EU Beitritt und die Teilnahme an der GAP) deutlich verändert. Die jahrzehntelange
Dreifelderwirtschaft führte früher im Herbst zu einer deutlichen Reduktion, der im Feld
vorhandenen Äsung. Nach der Ernte von Hafer (aufgrund der Höhenlage oft erst im
September) und Kartoffel, gab es kaum mehr Äsungsangebote im Feld. Auch die intensive
Nutzung der Grünlandflächen (bis zu 4 Schnitte), zusammen mit relativ häufigem Frost schon
im Oktober, minderte die Verfügbarkeit von Wiesenäsung für Rehwild. Erst das Aufgehen der
Winterroggensaat, veränderte dann wieder vorübergehend die Äsungssituation. Wenn man
früher zu dieser Zeit die Feldflächen betrachtete, war der Gesamteindruck eher einfärbig
braun.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
21
Durch den Einfluss verschiedenster Förderungsmodelle (ÖPUL / ÖKOPUNKTE / Biol.
Landbau etc.) kam es zu einer massiven Änderung. Gründecken, Winterbegrünung mit
frostharten Pflanzen und viele geförderte Bodenverbesserungsmaßnahmen führen im
Spätherbst zu einem vollkommen anderen Bild in der Landschaft. Auf großen Flächen ist ein
üppiges Äsungsangebot von Raps, Senf, Perko, und Facaelia zu finden. Aus Kostengründen
werden von den Landwirten natürlich jene Pflanzen gewählt, die den Förderungsauflagen
entsprechen, aber möglichst preisgünstig sind (in den meisten Fällen Senf). Diese Sorten sind
aber nicht immer gute Äsungspflanzen für Rehwild. Um dieses Angebot qualitativ noch zu
verbessern, werden den Bauern von uns Saatgutmischungen (Raps, Markstammkohl, Rotklee
u.a.) zur Verfügung gestellt, die sie dann einmischen und damit die Äsungsvielfalt erhöhen.
Einen durchaus hohen Einfluss hat aber die großflächige, und noch dazu vollkommen
zeitgleiche Bewirtschaftung großer zusammenhängender Grünlandflächen ohne eingestreute
Feldflächen. Abhängig von der Vegetationshöhe und Dichte der Wiesen zu den
Hauptsetzzeiten und dem auch witterungsbedingten Mähzeitpunkt, kommt es auf diesen
Flächen zu massiven Mähverlusten. Es ist sehr schwierig für uns, diese Verluste zu
quantifizieren, da diese ja von den Bauern nicht gemeldet werden und eine exakte Erhebung
sehr zeitaufwendig wäre.
Um diese Mähverluste zu verringern, werden in enger Zusammenarbeit mit den
Grundeigentümern, einige Maßnahmen getroffen. Da die meisten Betriebe auf
Silagewirtschaft umgestellt haben, kommt es zu wesentlich früheren Mähterminen (oft schon
Mitte Mai), an denen die Kitze oft erst wenige Tage alt sind und noch ein absolutes
„Drückeverhalten“ haben. Manchmal gelingt es durch kurzfristige Vergrämungsmaßnahmen
die Muttergais dazu zu veranlassen, das Kitz an einer anderen Stelle abzulegen. In den stark
strukturierten Revierteilen werden dann häufig auch Waldränder oder andere Abliegeplätze
im Wald aufgesucht. Ein Problem stellen manche zusammenhängende, manchmal bis zu 100
ha große Wiesenflächen dar, da dort je nach Witterungsverhältnissen sehr häufig die gesamte
erste Mahd oft in wenigen Stunden bzw. maximal verteilt auf drei Tage erledigt ist. Hier kann
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
22
man eigentlich nur direkt vor dem Mähtermin mit einem geeigneten Kitzsuchgerät (mit
Wärmesensoren) die Fläche absuchen.
Auf Grund der Flächengröße kann man aber nur einen Teil der Wiesen absuchen und muss
sich auf jene Flächen beschränken, auf denen man führende Gaisen beobachtet hat, oder beim
abgehen, Lager von Gaisen und Kitzen wahrnimmt. Um die gesamten Flächen zu
kontrollieren, bräuchte man einige „Suchtrupps“. Außerdem kann man mit diesen
„Kitzrettern“ nur so lange effizient suchen, solange die Umgebungstemperatur nicht zu hoch
wird. Dann muss man die Sensibilität der Geräte herabsetzen, um nicht dauernd Fehlanzeigen
zu haben und in der Folge auch Kitze zu übersehen. Das heißt, man kann eigentlich nur die
Zeit zwischen 4 Uhr und 9 Uhr früh nützen.
Die Grundlage für so eine Zusammenarbeit ist natürlich ein gutes Verhältnis zu den
Grundeigentümern. Wir wickeln die Kommunikation sehr häufig an den „Milchhäusern“ ab,
da man die Landwirte dort, natürlich nur zu einer bestimmten Zeit, antrifft und man meistens
mehrere Bauern zugleich informieren kann bzw. auch selbst informiert wird.
Durch Verwendung von schweren Maschinen, verbunden mit hohen Arbeitsgeschwindig-
keiten, nimmt der bearbeitende Landwirt einen „Kitzverlust“ eigentlich nicht mehr wahr.
Häufig sieht man am nächsten Tag Gaisen, die ihre Kitze auf den abgemähten Flächen suchen
bzw. kann man Krähen und Elstern beobachten, welche die kaum mehr sichtbaren Überreste
aus dem Mähgut herauspicken. Eine gesamte Beurteilung der jährlichen Mähverluste und eine
Berücksichtigung in Abschussplänen und Bestandesdynamik sind äußerst schwierig.
Kitzsuche mit elektronischem Wildretter
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
23
Damit man uns im „Ernstfall“ erreichen kann, haben wir nahezu flächendeckend an alle
Grundeigentümer unsere „Visitenkarte“ im Postkartenformat (damit man sie auch wieder
findet) verteilt. Auf diese Art bekommen wir immer wieder, mehr oder weniger wichtige,
Anrufe und Informationen, das Wesentliche ist uns aber dabei der Kontakt mit der
Bevölkerung.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
24
6. Fütterungen
Zu Beginn des Versuches errichteten wir 28 Futterstellen auf ca. 750 ha. Die ursprüngliche
Variante war der klassische Typ, mit abgeschrägten Vorratsbehältern und beiderseits
zugänglicher Futterlade.
Da wir immer wieder beobachten konnten, wie sowohl Böcke als auch Gaisen vor allem zu
Beginn der Fütterungsperiode kaum andere Stücke zum „Trog“ lassen, selbst führende Stücke
die eigenen Kitze nur bedingt aus der selben Fütterung fressen lassen, wurden an jeder
Futterstelle mehrere Futterkrippen aufgestellt, um auch sozial schwächer gestellten Stücken
den Zugang zu ermöglichen. Im Verlauf der Fütterungsperiode konnte man eine steigende
Vertrautheit bzw. Akzeptanz unter den Rehen bemerken - gegen Ende der Saison nehmen oft
mehrere Stücke, dicht aneinandergereiht, aus derselben Futterlade Futter auf.
Mit Bewirtschaftung der großen Jagdfläche (ca. 3900 ha) wurde die Anzahl der Futterstellen
auf ca.120 Plätze erweitert. Um die Befüllung und Nachbeschickung arbeitstechnisch
einigermaßen zu erleichtern und den Zeitaufwand zu optimieren, wurden nun die Futterstellen
auf Kisten umgestellt, welche ein Fassungsvermögen von ca. 850 kg pro Fütterung haben.
Prototyp des 2.ten Fütterungssystems mit angebrachten „Geweihernter“ (= Querstangen, an denen die Böcke mit den Geweihen immer wieder anstoßen und dann, wenn die Stangen „abwurfbereit“ sind, abgestreift werden und so leicht
gefunden werden); die zweite Futterlade auf der gegenüberliegenden Seite fehlt bei dieser Fütterung.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
25
Diese Fütterungen werden mit speziell dafür ausgestatteten Unimogs über bewegliche
Förderschnecken befüllt.
Mit ansteigenden Schwarzwildbeständen stiegen auch die „Übergriffe“ der Sauen auf unsere
Rehwildfütterungen, mit einhergehenden Verwüstungen und Zerstörungen derselben.
Sicherlich stellte der darin enthaltene Mais eine wesentliche Verlockung dar. Als
„Begleitmaßnahme“ erhöhten sich auch die Grünlandschäden im Umfeld. Da wir aber absolut
nicht das ohnehin landergreifende Schwarzwild noch zusätzlich durch ungewolltes Füttern
fördern wollten, waren Gegenmaßnahmen ein Gebot der Stunde. Wir dachten über ein System
nach, das die Sauen nicht an das Rehfutter herankommen lässt, die Rehe aber trotzdem
möglichst ungehindert fressen können.
Sämtliche Arten von Einzäunungen, ähnlich den Rotwildkälberställen, waren, aufgrund der
Anzahl der Futterstellen und der notwendigen Stabilität gegenüber den extrem listigen und
kräftigen Sauen undurchführbar. Ich kam daher auf die Idee, die anatomischen Unterschiede
der Wildarten auszunützen. Ähnlich wie in der Fabel, in der der Storch dem eingeladenen
Fuchs das Fressen so anbietet, dass eben nur der Storch daran kommen kann, wurden unsere
Fütterungen umgebaut.
Alle Futterladen wurden mit eigens dafür zugeschnittenen Baustahlgittermatten, (mit 10x10
cm Gitter) umfasst. Je nach Breite der Fütterung wurden drei bis vier „Fenster“ mit 20x30 cm
herausgeschnitten, sodass Rehwild mit dem Haupt noch bequem durchkommt. Diese Gitter
wurden so angebracht, dass vom Gitter zum Futter noch ca. 20 bis 30 cm Abstand besteht,
welcher aber von den Rehen mit den langen Trägern leicht überbrückt wird.
Unsere Versuche haben gezeigt, dass zwar Frischlinge bis zu einem ungefähren Gewicht von
15-20 kg (aufgebrochen), noch mit dem Haupt durch das Fenster durchkommen, aber das
Futter trotzdem nicht erreichen, weil es einfach zu weit weg ist. Stärkere Sauen bleiben aber
schon mit dem Haupt am „Eingang“ stecken.
Mit dieser Methode ist es uns, praktisch fast zu hundert Prozent, gelungen, das Schwarzwild
nicht an das Futter herankommen zu lassen. Nahezu an allen Fütterungen sieht man Spuren in
Form von abgewetzten Borsten und Schmutz am Gitter, wie die Sauen versuchen an das
Futter zu gelangen. Nur wenn Vögel oder Eichhörnchen das Futter hervorscharren, gelingt es
den Wildschweinen, an geringe Mengen heranzukommen.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
26
„Sauensicher“ umgebaute Fütterung . Gut sichtbar an den beiden seitlichen Brettern die
Verschmutzung und am vorderen Brett die Bissspuren von den Eindringversuchen der Wildschweine.
Es dauerte nach dem Umbau oft ein paar Tage, bis die Rehe mit der neuen Situation zurecht
kamen, danach konnte man aber beobachten, dass sie sogar mit den Vorderläufen durch die
Öffnung schlüpften, um zu fressen.
6.1. Welche Parameter, abgesehen vom „Füttern“ und „Schießen“ kann der
Jagdpächter noch beeinflussen?
Sieht man sich in der Rehwildliteratur etwas um, gibt es fast immer die gleichen rührenden
Hinweise, wie man den Lebensraum und damit auch das Äsungsangebot der Rehe, verbessern
kann.
Im jüngst erschienenen Buch Hubert Zeilers „Rehe im Wald“18
widmet sich der Autor in
einigen Kapiteln auch ausgiebig diesem Thema.
Eine Vielzahl von Maßnahmen, die im Buch nachzulesen sind, wird dort angeführt. Ich
möchte nur einige herausgreifen:
.) Winterschlägerungen von Tannen
.) Schlägeln der Forststrassenbankette
.) Anlage von kleinen Wildwiesen (1000-2000qm) im Wald
.) Gestaltung der Waldränder
.) Freihalteflächen in Windwürfen
.) Almwirtschaft
.) Anlage von größeren Wildäckern
.) Gewinnung von Laubheu !
.) Ruhe im Revier
18
Zeiler 2009
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
27
Mit Ausnahme der Anpachtung und Bewirtschaftung in Eigenregie von kleinen Wildackern
oder Wiesen, welche manchmal von Grundeigentümern mehr oder weniger großzügig
überlassen werden, ist praktisch keine Maßname durch einen durchschnittlichen Jagdpächter
umsetz- oder beeinflussbar.
All die gutgemeinten Ratschläge kann natürlich der Grundbesitzer, wenn er ein Herz für die
Jagd und noch dazu für Rehwild hat, umsetzen. Wenn man die Anlage von Wildwiesen unter
Einsatz von Bagger (zur Rodung) und sonstiger Begleitmaßnahmen wie Kalkdüngung etc.
auch wirtschaftlich betrachtet, so erkennt man, dass auch diese Maßnahmen in der Praxis nur
vom Grundbesitzer wirklich umgesetzt werden können.
Nach mündlicher Mitteilung eines „Dauerjagdgastes“ in den Stainzer Revieren (DI Hannes
Stelzl, selbst Forstmann), wurde das Laubheu durch das Forstpersonal gewonnen. Ich erlaube
mir zu bemerken, dass selbst bei Annahme eines Kollektivlohnes die Gewinnung und der
damit erhaltene Futtervorrat in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen. Was kann aber nun
der durchschnittliche Jagdpächter einer der zahlreichen Genossenschaftsjagdgebiete in
Österreich, mit jeweils zig verschiedenen Grundbesitzern, welche oft gar nicht mehr im Ort
wohnen, machen, um seinen Rehstand zu bewirtschaften und jagdlich zu nutzen?
Selbst wenn der eine oder andere Mitpächter Grundbesitzer in der Jagdgenossenschaft ist,
stößt man sehr rasch an die Grenzen der Umsetzbarkeit. Hier werden die Ratschläge in all den
Büchern und Artikeln schon sehr dünn und meistens hat man den Eindruck, dass die diversen
Autoren noch nie einen Jagdpachtvertrag unterschrieben haben.
Kein einziger Grundbesitzer denkt bei Entscheidungen hinsichtlich der land- und
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung seiner Flächen darüber nach, welche Auswirkungen
seine Maßnahmen auf Wildtiere haben. Auch er kann nur vom Ertrag leben und davon seine
Rechnungen bezahlen. Verschiedene Fördermodelle mit finanziellen Anreizen auf
europäischer Ebene können natürlich auch positive Auswirkungen auf Wildtiere haben. Wie
man aber im Falle der Brachflächen sieht, unterliegen solche Maßnahmen auch einem
ständigen Wandel. Nur in wenigen Musterrevieren gelingt es manchen starken
Persönlichkeiten unter großem Einsatz, Bauernkollegen dahingehend zu beeinflussen, in ihrer
Bewirtschaftung etwas Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen. (z.B. DI Paul Weiss / Lassee )
Wir wissen sehr gut, dass gerade in den von uns bewirtschafteten Revieren eine
Rehwildfütterung aus wildbiologischer Sicht nicht notwendig ist. In den manchmal wirklich
schneereichen und kalten Wintermonaten wäre dann der Fallwildabgang sehr hoch, aber das
könnte man ja als das natürliche Geschehen betrachten.
Wir sehen unsere Aufgabe als Jäger und Revierpächter nicht nur darin, das zu Ernten, was uns
die Natur fallweise überlässt, sondern wir wollen auch eine nachhaltige Nutzung unserer
häufigsten Schalenwildart mit durchaus auch wirtschaftlichem Interesse.
Dieses betrifft sowohl die Vermarktung des anfallenden Wildbrets wie auch die Steigerung
des jagdlichen Nutzens.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
28
7. Das Futter
Wenn man sich nur oberflächlich mit der sogenannten Herbstmast19
beschäftigt, scheinen
diese Überlegungen vorerst schlüssig, da sich doch so manche Gedanken gut mit dem
Wunschdenken des „Hegers“ decken. Eine Stellungnahme zu diesem „Irrweg der Hege“20
,
zeigt kritisch die Widersprüchlichkeiten und auch die teilweise fragwürdige wissenschaftliche
Fundierung dieser so oft zitierten Methode auf.
Auch an diesem Beispiel zeigt sich, wie sehr die Jägerschaft gefordert ist, nicht nur kritisch
Sachverhalte zu hinterfragen, sondern wie notwendig auch ein hohes Ausbildungsniveau der
Jäger und Jagdfunktionäre ist. Ein Fütterungsbeginn mit dem empfohlenen 1. August war für
uns auch nicht sinnvoll, da einerseits bei uns noch die Rehbrunft am Höhepunkt ist,
andererseits auch ein Ausbringen von Kraftfutter im Hochsommer nicht nur bei den Bauern
auf Unverständnis stößt. Wir beschicken daher unsere Fütterungen „erst“ September bis Mitte
Oktober. Selbst zu diesem Zeitpunkt ist die Futterannahme noch gering, weil das Angebot in
der Natur und Landwirtschaft eben noch vielseitig ist. Dies bringt uns möglicherweise um
einen Teil unseres „Erfolges“, wenn man die Verhältnisse mit den Hochlagen vergleicht. Es
entspricht den natürlichen Gegebenheiten des Reviers und wir versuchen auch nicht, die Rehe
durch irgendwelche Maßnahmen früher an die Fütterung zu bringen. Am Anfang lag natürlich
nahe, die schon lange gewonnen Erkenntnisse Vogts und von Bayerns auch bei uns
umzusetzen. Wer sich aber mit der Erzeugung diverser Futtermittel schon beschäftigt hat,
wird draufkommen, dass die Beschaffung der, in den vorher erwähnten Versuchen
verwendeten Komponenten, abgesehen vom Preis, nicht ganz einfach ist. Sesamexpeller und
Kokoskuchen sind am freien Markt in kleineren Mengen, das heißt unter 10 Tonnen, schwer
zu bekommen. Noch dazu ist eine Qualitätskontrolle als Nichtfachmann sehr schwierig.
Außer dem verwendeten Mais, der natürlich erhältlich ist, mussten wir uns um Alternativen
umsehen oder eine andere Mischung nehmen. Es schien uns daher naheliegend und auch
sinnvoll, jene Futtermittel einzusetzen, die in der Region wachsen und auch verfügbar sind.
Wir kauften daher von Beginn an Hafer, Futtergerste, Erbsen, Tritikale von den
ortsansässigen Bauern an, was auch den günstigen Nebeneffekt hatte, dass wir zwar ein wenig
mehr als die örtlichen Lagerhäuser bezahlten, aber die Grundbesitzer positiv für uns
stimmten. Um eine einigermaßen gleichmäßige Mischung zu erhalten setzten wir zuerst
Betonmischwagen ein.
„Irrwege der Hege“ ?
19
Hofmann, Kirsten 1982 20
Schröder etal. (undatierte Kopie)
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
29
Im Jahr 1999 bestand sich die Futtermischung aus nachstehenden Komponenten:
Hafer 15 200 kg
Mais 7000 kg
Gerste 1500 kg
Futtererbse 8000 kg
Trockentrester 6000 kg
Mineralstoffmischung 5500 kg
Gesamt 43 500 kg
Um einen anzustrebenden Anteil von Calcium und Phosphor zu erreichen wurde
phosphorsaurer Futterkalk beigemischt was aber bei der Verarbeitung „etwas“ mühsam war.
Die Beimischung von Futterkalk wirbelt etwas Staub auf
Um das für Wiederkäuer verwertbare Eiweiß zu steigern, mischten wir am Beginn
sogenannten Kälberstarter zu ca. 20 % dazu.
Da aber bei einer Gesamtmenge von 100 000 kg pro Jahr die Kosten eine wesentliche Rolle
spielen, verzichteten wir auf diese“ Eiweißaufbesserer“ und beschränkten uns auf übliche
Getreidesorten, wie vorhin erwähnt.
Die Mengen waren aber immer so, dass Rehwild ad libitum Futter aufnehmen konnte.
Natürlich waren uns von Beginn an die Probleme rund um den Ernährungszyklus des
Rehwildes im Jahresablauf, gerade im Zusammenhang mit Kraftfuttergaben, bekannt, es war
aber die Problematik der technischen Umsetzung diese Dinge zu berücksichtigen.
Wir wissen, dass Kraftfuttergaben zum Zeitpunkt der natürlichen Vegetationsruhe, noch dazu
wo sich das Rehwild mit seinem Verdauungsapparat auf nährstoffarme Äsung eingestellt hat
und auch den Grundumsatz dementsprechend drosselt, bei einseitigem Angebot auch zur
Belastung werden können.
Es ist aber in der Praxis technisch unmöglich, bei vorher nicht abschätzbarem
Futterverbrauch, zum notwendigen Zeitpunkt bei über 120 Futterstellen das Kraftfutter durch
ein wesentlich eiweißärmeres Erhaltungsfutter zu ersetzen. Noch dazu gewöhnt sich Rehwild,
wie die Erfahrung bei den meisten Versuchen gezeigt hat, an gewisse
Futterzusammensetzungen und jede Umstellung, auch auf davor bekannte Mischungen,
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
30
verursacht immer eine relativ lange Gewöhnungsphase21
. Wir vertrauten daher auf den
natürlichen Instinkt einer, so lange in der Evolution entwickelten Wildart, sich das zu holen
was sie in der jeweiligen Phase benötigt. Wir wussten ja auch, dass prinzipiell das
reichhaltige Angebot an Strauch- und Knospenäsung, sowie das Angebot auf den Feldern für
ein Überleben der Rehe vollkommen ausreicht. Wir hatten aber, wie im Kapitel „Ziele“
erwähnt, noch andere Zielsetzungen im Kopf.
Um die „Ausweichmöglichkeiten“ ein wenig zu erweitern, bieten wir bei Einsetzen des
Frostes (ca. ab November) Futterrüben und Nasstrester in ausreichender Menge an.
21
v. Bayern 1975
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
31
Des öfteren wird von Wildbiologen dem Rehwild die Fähigkeit abgesprochen, das richtige
Futter zur richtigen Zeit an- und aufzunehmen22
. Offensichtlich gibt es auch hier wesentliche
Unterschiede, oder der ganze Sachverhalt ist noch nicht eingehend genug erforscht.
Zeiler erwähnt in seinem Buch „Rehe im Wald“ eine Untersuchung von Professor Oslage
(Hannover), aus der, so der Autor, klar hervorgeht, dass Rehe, so man sie lässt, angebotenes
künstliches Futter so auswählen, dass der Eiweißgehalt dem zyklischen Jahresbedarf
entspricht. Dies deckt sich auch mit unseren langjährigen Erfahrungen: Deutlich spüren wir,
dass so etwa ab Mitte Dezember der Verbrauch an Kraftfutter sinkt und die Annahme der
alternativen Futtermittel wie Nasstrester und Futterrüben steigt.
Natürlich, ist bei eingeschränktem Futterangebot, z.B. dort wo Rehwild in Hochlagen
vollkommen auf das vorgelegte Futter angewiesen ist und kaum ausreichend natürliche
Äsung gefunden werden kann, die Gefahr der so oft zitierten Pansenübersäuerung nicht zu
unterschätzen. Wir hatten in all den Jahren nur drei Stück Fallwild aus diesem Grund.
Dies war aber auf meine damalige Unkenntnis und den Umstand zurückzuführen, dass eine
Fütterung überraschend leer war und ich in Ermangelung anderen Futters, und wie gesagt
ahnungslos, reine Futtergerste vorlegte. Nach wenigen Tagen saßen in unmittelbarer Nähe der
Fütterung drei verendete Rehe in ihren Lagern. Eine Untersuchung am Institut für
Wildtierkunde in Wien brachte uns Aufklärung und seither sind wir uns dieser Problematik
bewusst.
Dazu muss ich erwähnen, dass jedes aufgefundene Stück Fallwild, bei unbekannter
Todesursache, soweit es noch untersuchungstauglich ist, den dafür zuständigen Stellen für
Untersuchungszwecke vorgelegt wird.
Durch Berechnung der Futterwerte versuchten wir natürlich immer die Zusammensetzung so
zu steuern, dass das Verhältnis verdauliches Eiweiß zu Stärke, sich im Bereich von 1: 4-6
bewegte. Um auch den Rohfasergehalt ausreichend zu halten, wurde nie eine Getreideart
gequetscht oder gemahlen und dazu noch Trockentrester (Apfel) hinzugemischt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass unser Futter hinsichtlich der ursprünglichen
Zielsetzung natürlich „mangelhaft“ ist, wir halten es aber mit der Aussage Herzog von
Bayerns23
:
Wahrscheinlich kommt es gar nicht so darauf an was gefüttert wird, sondern auf das wie, wo
und wann.
22
Muralt 2009 23
v. Bayern 1981
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
32
8. Bejagung
Da wir ja gerne jagen und auch der Abschuss der Herbstrehe für uns keine „Belastung“
darstellt, bejagen wir das Rehwild an sich während der gesamten Schusszeit, aber mit zwei
Schwerpunktbejagungen. Der erste Höhepunkt ist naturgemäß die Rehbrunft. Die zweite
Schwerpunktbejagung erfolgt anfangs November. Wir machen eine Woche Ansitzjagd und
laden dazu mehrere Freunde und Gäste ein. Pro Revier ein Morgen- und ein Abendansitz.
Dabei erlegen wir einen Großteil des weiblichen Abschusses ohne anhaltenden Jagddruck.
Dazu muss man sagen dass auf Grund der Reviergröße und der geringen Anzahl von
kontinuierlich jagenden Personen (4-5) trotz der „laufenden“ Bejagung kaum Jagddruck
herrscht. Das heißt Revierteile werden im Laufe eines Jahres nur wenige Male begangen und
es gibt viele Revierteile die nahezu unbejagt sind bzw. oft nur im Abstand von mehreren
Jahren bejagt werden.
Brunftjagd :
Um erfolgreich die Blattjagd zu betreiben, gibt es Einiges zu beachten und vorzubereiten. Da
es nun auf diesem Gebiet schon etliche Experten und auch einige Bücher gibt, möchte ich
nicht näher auf diese, meistens schon bekannten Weisheiten eingehen.
Wir verfügen über ca. 100 erfasste Rufplätze, welche vor der Brunft noch kontrolliert werden
bzw. die Pirschsteige dorthin noch gereinigt werden. Die Rufplätze selbst verfügen meistens
über keine besonderen Einrichtungen, abgesehen davon, dass der Platz bei der Erstanlage
nach einigen wichtigen Gesichtspunkten (Wind, Aussicht, Erreichbarkeit, Einstands-
verhältnisse, Störanfälligkeit, usw.) angelegt wird.
Durch das vorher angelegte Netz wird auch eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung der
Abschüsse erreicht und man neigt nicht immer dazu, nur auf den „guten“ Plätze zu blatten.
Vom ersten bis zum zehnten August werden bei der Ruf- und Ansitzjagd die Mehrheit unserer
Ernteböcke aber natürlich auch einige Jährlinge erlegt.
Strecke am Ende der Blattjagdtage
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
33
Auch für die sogenannten „Ansitzjagdtage“ sind einige Vorbereitungen zu treffen.
Bevor ich darauf eingehe, sei noch erwähnt, dass wir Anfangs dachten, den Rehwildabschuss
im Rahmen von herbstlichen Bewegungsjagden zu erfüllen, um vielleicht auch das eine oder
andere Stück Schwarzwild mitzuerlegen. Obwohl wir diese Jagden genau planten und
vorbereiteten, z.B. über 90 Drückjagdhocker aufstellten und jeden Trieb sorgfältig planten,
war das Ergebnis mehr als ernüchternd. Es gelang uns nicht, trotz Einsatz einiger Hunde und
Treiber, das Wild vor die Schützen zu bringen. Die meisten Anblicke hatten die Treiber und
auch mittreibende Hundeführer, die aber aus Sicherheitsgründen nie schießen konnten.
Außerdem kam es noch zu einigen Fehlschüssen, da das Rehwild, wenn es aus dem Trieb
flüchtet, doch sehr schnell ist.
Wir änderten daher rasch unsere Strategie und stellten auf Ansitzjagd um. Anstatt aber
mehrere Monate lang morgens und abends das Revier durch Ansitz- und Pirschjagden auf
Gaisen und Kitze zu beunruhigen, versuchten wir aus der „Not eine Tugend“ zu machen und
planten eine zeitlich und örtlich konzertierte Bejagungsstrategie. Das heißt für eine Woche
Ende Oktober luden wir viele Jagdfreunde zur Ansitzjagd ein. So konnten wir pro Ansitz
zwischen 15 und 20 Jäger gleichzeitig ansetzen und wählten pro Ansitz immer nur ein Revier,
bzw. einen Revierteil aus, da wir jedes Revier nur zweimal beunruhigen wollten. Durch die
sich daraus ergebende große Anzahl von „Wildbegegnungen“ haben wir die Möglichkeit zu
selektieren und müssen nicht auf jedes Stück das in Anblick kommt „Dampf machen“ um den
Abschussplan zeitgerecht erfüllen zu können.
Nicht unerwähnt soll dabei auch die gesellschaftliche Seite dieser konzertierten
Ansitzjagdtage bleiben. Eine Woche zusammen mit Jagdfreunden jagen, am Abend gemütlich
zusammenzusitzen und Erfahrungen über die Jagd auszutauschen hat auch etwas für sich.
Mit dieser Methode erlegten wir zum Beispiel im November 2009 in einer Woche 115 Stück Rehwild und einige Füchse.
Mit den davor und danach noch ohne großen Zeitaufwand erlegten Stücken, können wir ohne
andauernden Jagddruck, den nicht geringen Abschuss leicht durchführen.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
34
8.1. Abschusspläne
Wer viel füttert, der muss viel schießen.
Eine Forderung die uns von Anfang auch vollkommen klar war und als Credo in unzähligen
Publikationen über Rehwild immer zu lesen ist. Nun, viel schießen heißt auch höherer
jagdlicher Nutzen. Die Frage ist nur wie viel und nach welchen Kriterien?
Wenn man die wahren Abschusszahlen so mancher Reviere kennt, muss man erkennen, dass
sich Rehwild in idealen Lebensräumen den meisten Regulierungsversuchen herkömmlicher
Abschusspläne vollkommen entzieht.
Zwei Beispiele aus der Praxis:
Als im Revier MB der Verpächter plötzlich verstarb, wurde das Revier von einem
„Jagdaufseher“ für die restliche Periode bewirtschaftet. Nun ist es nicht unüblich, dass
Reviere, wenn sie nicht für die nächste Jagdperiode gepachtet werden können, etwas stärker
„beerntet“ werden und man dem Nachfolger nicht die höchsten Wilddichten hinterlässt, um
ihn nicht gleich zu „überfordern“. Im besagten Revier MB wurden im letzten Jahr der Periode
nach eigener Auskunft des Betreuers auf einer Fläche von 740 ha etwas über 200 (!) Rehe
erlegt. Der jahrzehntelange Abschussantrag, lag bei jährlichen 28 Stück! Im darauffolgenden
Frühjahr merkte man natürlich, dass die Dichte gering war, aber ein weiteres Jahr später,
hätte jeder „ Experte“ einen guten Rehbestand attestiert. Natürlich war der Zuzug aus den
Nachbarrevieren stark, aber auch die jeweiligen Nachbarjäger haben nicht wirklich eine
„Verdünnung“ bemerkt.
Einige Jahre vorher vermuteten die Jäger in mehreren Revieren, dass Wilderer unterwegs
seien. Nicht weil keine Rehe mehr da waren, sondern, weil man immer wieder
angeschossenes Wild fand. Durch Zufall wurden die beiden Täter (übrigens Jäger) überführt
und man konnte ihnen auf Grund der eigenen Aufzeichnungen nachweisen, dass sie in einigen
Revieren in zwei Jahren über 600 (!) Rehe gewildert hatten. Und das alles haben die Rehe
„trotz“ Abschussplan und „Zuwachsberechnungen“ blendend überstanden.
Die offiziellen, in den Abschussplänen und Abschusslisten enthaltenen Zahlen sind mit großer
Vorsicht zu betrachten und entsprechen sehr häufig nicht der Realität. Da seit einiger Zeit der
Obmann des Jagdausschusses, als Vertreter der Grundeigentümer, die Abschusspläne
unterzeichnen muss, sind die Pächter oft nicht daran interessiert, hohe Abschusszahlen
auszuweisen, um die Pachtpreise niedrig zu halten. Den mit der Abstimmung der
Abschusspläne auf Hegeringebene betrauten Personen fehlt häufig die fachliche
Qualifikation, Wildbestandsverhältnisse beurteilen zu können und meistens auch die
Durchsetzungskraft neue Erkenntnisse im Kreise uninformierter und konservativer Jäger
umzusetzen.
Man kann also annehmen, dass der wirkliche, nachhaltig mögliche Abschuss im Allgemeinen
wesentlich höher liegen kann, was auch dem Reproduktionspotenzial des Rehwilds dieser
Reviere durchaus entspricht. Alleine schon die jahrelange Unterscheidung von
„anrechenbarem“ und „nicht anrechenbarem“ Fallwild in den Abschusslisten zeigt mit welch
geringem Verständnis für Zusammenhänge in der Natur gearbeitet wurde. Aus unserer in etwa
35-jährigen Erfahrung wissen wir, dass die wirklichen Abschusszahlen bis zu 200% von den
angegebenen abweichen. Viele wollen dies nicht wahr haben und haben ein Problem mit
dieser Realität. Den Rehen aber ist das vollkommen egal, sie vermehren sich munter und
trotzen den meisten Berechnungsmodellen.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
35
Abschusspläne brauchen als Grundlage Zuwächse. Zuwachsraten und verbleibender Zuwachs
brauchen wiederum Bestandeszahlen als Ausgangsbasis. Und genau die kennt aber niemand!
Die Behörden haben schon etwas darauf reagiert und immerhin gibt es jetzt für drei Jahre
gültige Abschusspläne. Das spart zumindest in der Verwaltung etwas Zeit, den Rehen ist dies
ohnehin egal. Durch die Möglichkeit bei weiblichen und Nachwuchsstücken den
Mindestabschuss zu überziehen, böte der Abschussplan eine Möglichkeit, auf
Bestandesveränderungen zu reagieren. Aber wie will ich auf etwas reagieren, wenn ich es
nicht kenne. Die jährlichen Schwankungen in den Abschussstatistiken bewegen sich im
Allgemeinen unter der Zehn-Prozent-Grenze. Ich glaube daher nicht, dass diese Zahlen, umso
mehr ich sie überhaupt in ihrer Richtigkeit bezweifle, mit der Bestandesdynamik in
irgendeiner Form korrelieren.
Werfen wir kurz einen Blick auf den Verwaltungsbezirk Gmünd (NÖ).
Rehwildabschuss aus dem Jahr 2002 7 Tab.24
:
BEZIRK GMÜND ältere Böcke Jahrlinge Summe Böcke
Geissen Kitze Summe Rehwild
verfügter Abschuss 746 381 1127 768 851 2746
78 626,06 ha durchgeführter Abschuss 657 354 1011 603 601 2215
3,77 Stk/100 ha anrechenbares Fallwild 87 58 145 225 381 751
Die Daten darin sind die von der Jagdbehörde erfassten Daten, die übernommen worden sind.
Der durchgeführte Abschuss pro 100 ha schwankt, über den gesamten Bezirk betrachtet, vom
Minimum 1,49 bis zum Maximum von 10,78 (bei beiden Jagden handelt es sich um
Eigenjagdgebiete). Der durchschnittliche Gesamtabschuss beträgt bezirksweit (78 626 ha
Jagdfläche) 3,77! Und das, wenn man so sagen, kann im besten Rehwildlebensraum.
Schaut man sich die Tabelle genauer an, so entdeckt man, dass der verfügte Gesamtabschuss,
inkl. anrechenbaren Fallwilds, um 220 Stück erweitert wurde. Das sind ca. 8% des
Gesamtabschusses. Bei noch genauerer Betrachtung sieht man, dass der Bockabschuss bei
immerhin 746 „verfügten“ auf 2(!) Stück genau (das entspricht 0,2 %), trotz anrechenbarem
Fallwild, eingehalten wurde.
Welch großartige Leistung der Jägerschaft! Oder gibt es hier doch einige Fehlerquellen?
24
Quelle: Gmünder Jagdjournal 1/2003
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
36
Abschusspläne setzen natürlich auch voraus, dass der Jäger das Wild nach dem Alter
einschätzen kann. Gott sei Dank sind wir in NÖ schon weitgehend von diesem Unsinn befreit,
wo es doch noch Bundesländer gibt, in denen auch noch das Geweihgewicht geschätzt werden
muss.
Nun, auch die Beschäftigung mit dieser Frage zeigt uns, wie sehr wir im Dunkeln tappen.
Dazu einige ganz interessante Beispiele aus der Literatur:
Egon Wagenknecht zeigt in seinem Buch25
(S 138) einen, von den meisten Jägern vermutlich
als Jährling eingestuften Rehbock (auch meine Meinung).
Der Text dazu
Schmaler Kopf; langer, dünner Hals mit deutlichem Knick im
Übergang zur Rückenlinie; hinten leicht überbaut; sehr schmaler
Stich; Vorderläufe stehen unter dem Körper eng zusammen:
Jährling bester Veranlagung = Güteklasse IIa.
Das offensichtlich selbe Foto in Herbert Krebs Buch,26
allerdings
seitenverkehrt aufgemacht, lässt den Rehbock gleich um ein Jahr
älter werden. Der Text zum Bild:
Zweijähriger :>>Buntes << Gesicht mit klarem Muffelfleck.
So weit so gut. An sich wildbiologisch nicht ganz so wichtig, ob ein Jährling mehr oder
weniger erlegt wird, oder dem Straßenverkehr zum Opfer fällt. Unangenehm könnte es aber
eventuell für einen Jagdleiter werden, wenn der Abschuss falsch eingestuft wird und dann
doch in die Klasse der mehrjährigen Böcke fällt. Schon bei zweimaligen Irrtum kann einem
dass die Jagdkarte und in weiterer Folge auch Jagdpacht kosten. Da stellt sich schon die
Frage, wie sinnvoll solche Gesetze sind oder ab man nicht dadurch die Jäger eher zum
„Schummeln“ zwingt.
25
Wagenknecht, Rehwildhege mit der Büchse ,Neumann Verlag Leipzig 1976 (S138 Abb.20) 26
Herbert Krebs. Jung oder alt, Schalenwild richtig ansprechen BLV 1979 (S 30 Abb. 36)
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
37
Auch beim nächsten Beispiel sieht man wie schnell auch sicherlich gute Kenner der Materie
an die Grenzen stoßen.
Bei Wageknecht: ….Mindestens fünfjährig…..
Bei Herbert Krebs : Mittelalter Bock ,wohl eher
noch unter fünf Jahren………
Je mehr man jagt, desto mehr gewinnt man die Erkenntnis, dass man Rehböcke und noch viel
weniger Gaisen wirklich nach dem Alter ansprechen kann. Im Winterhaar ist meiner Ansicht
nach nur eine Einschätzung in eher jung und eher alt möglich. Wer sein Handeln kritisch
hinterfragt und versucht nach erfolgtem Abschuss über zusätzliche Bestimmungshilfen seine
vorherige Schätzung zu beurteilen wird nicht selten überrascht.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
38
8.2. Wonach haben wir unsere Abschusspläne erstellt?
Aus vielen Überlegungen war uns klar, dass über herkömmliche Methoden eine zielführende
Abschussplanung nicht wirklich möglich ist. Wir versuchten daher über andere Parameter das
richtige Maß der Nutzung zu finden. Natürlich versuchten wir auch über Futterverbrauch und
Anzahl der Rehe bei den Fütterungen, auf eine grob geschätzte Zahl eines Frühjahrsbestandes
zu kommen. Da unsere Reviere in vielen Teilen durch ein Güterwegenetz erschlossen sind,
lässt sich im Frühjahr, wenn das Rehwild besonders gut auf den Wiesen zu beobachten ist,
eine Art Leitlinienzählung durchführen. Aber es gibt immer zu viele unbekannte Faktoren.
Zum Beispiel: Wirkt sich die Anzahl der erlegten Winterfüchse oder auch des erlegten
Schwarzwildes auf die Kitzverluste aus? Oder wie soll man die kaum einschätzbaren
Mähverluste in einigen Revieren berücksichtigen?
Wir gingen daher von folgenden Überlegungen aus. Solange die Körper- und
Geweihgewichte steigen, bzw. auf hohem Niveau gleich bleiben, die Kondition und der
Gesundheitszustand unseres Rehwildes in Ordnung ist (wir lassen nicht nur die wenigen
anfallenden Stücke Fallwild u. bedenkliche Stücke, sondern auch immer wieder
stichprobenartig „gesunde“ Stücke untersuchen) und der Abschuss im Vorjahr ohne
besonderen Jagddruck erfüllt werden konnte, wurden die Abschusszahlen jährlich gesteigert.
Das auch unter der Voraussetzung, dass in der Strecke ausreichend reife Böcke vorkommen
und keine Probleme in der Land und Forstwirtschaft auftreten. Da alte Böcke in der Regel
ihre Territorien über Jahre beibehalten und nicht aus den Nachbarrevieren zuwandern, kann
man davon ausgehen, dass bei nachhaltiger Erlegung reifer Böcke auch eine einigermaßen
strukturierte Alterspyramide vorhanden ist.
In der Grafik kann man die Abschussentwicklung im Zeitraum 1993 bis 1999 sehen.
Interessant ist auch zu sehen, wie die Fallwildkurve im Verhältnis zur Gesamtstrecke
verläuft. Dabei ist hinzuzufügen, dass 1993 der Beginn unserer Pacht war und wir, wie schon
beschrieben, ein Revier übernahmen, in dem im Jahr davor über 200 Rehe erlegt worden sind.
Rehwildstrecke gesamt
0
20
40
60
80
100
120
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pro
zen
t Fallwild
Böcke
Jahresstrecke ges.
Gaisen & Kitze
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
39
Im Lauf der Jahre wurde versucht, die Abschusszahlen anzuheben und dem tatsächlichen
Wildbestand anzupassen. Obwohl die Abschusszahlen heute doch wesentlich höher als zu
Beginn sind, vermuten wir, dass wir aber noch immer nicht den wirklichen Zuwachs
abschöpfen.
Stefan Fellinger 27
beschäftigt sich in seiner Diplomarbeit 1987 mit dem Schalenwild im
Lehrforst der Universität für Bodenkultur Wien (Rosaliagebirge) besonders aber mit dem dort
vorkommenden Rehwild. Er zeigt, dass auch dort offensichtlich das Rehwild lange Zeit sich
selbst überlassen war.
Erst ab den Siebzigerjahren setzte aus forstlichen Gründen eine stärkere Bejagung ein, um
eine Reduktion zu erreichen. Die Abschussentwicklung zeigt auch dort, dass man den
jährlichen Zuwachs bei weitem nicht genutzt hat. Der Abschuss wurde in den Jahren 1956 bis
1971 mehr als verdoppelt und von 1972 bis 1981 nochmals verdreifacht. Dass heißt im
Gesamtbeobachtungszeitraum mehr als verzehnfacht.
Fellinger schreibt dazu: Die Jagdgesinnung und die wildbiologischen Erkenntnisse haben sich
im Laufe dieser 30 Jahre erheblich geändert. Während früher nur einige wenige reife Böcke,
überalterte Gaisen und kümmernde Kitze entnommen wurden, versuchte man in den letzten
Jahren den Rehwildstand zu reduzieren und erlegte auch gesunde Kitze und junge Gaisen.
Nach einer kurzen Abschusserhöhung 1961 und 1962 auf 16 bzw. 14 Stück, gegenüber einem
durchschnittlichen Abschuss von 6,6 Rehen während der vorangegangen Periode, sprach
man zwar von einer deutlichen „Rehwildabnahme“. Die konnte aber unmöglich der Fall
gewesen sein. Vermutlich reguliert sich der Rehwildbestand des Lehrforstes, selbst bei einem
Abschuss in der jetzigen Höhe, noch immer selber.
27
Fellinger 1987
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
40
9. Auswirkungen
Das erste, was sich rasch veränderte, war erwartungsgemäß das Körpergewicht der Rehe.
(Alle Gewichtsangaben aufgebrochen mit Haupt max. eine Stunde nach Erlegung, außer
Fallwild)
Grafik 1 - Entwicklung der Körpergewichte - Böcke
0
5
10
15
20
25
30
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Erlegungsjahr
au
fgeb
r. m
. H
au
pt
in k
g
dschn. Gew. ab 2 J.
d. stärksten 10
d. schwerste Bock im Jahr
Das Gewicht des schwersten Bockes hängt natürlich auch vom Erlegungszeitpunkt ab.
Das heißt, es ist ausschlaggebend ob er vor oder nach der Brunft erlegt wurde. Daher sind die
rückläufigen Werte ab 1997 für den jeweils Jahresstärksten, nicht ganz aussagekräftig, da der
Zeitpunkt nicht berücksichtigt wurde.
Da wir in den ersten drei Jahren etwas zurückhaltend eingriffen, sind daher auch die
Durchschnittswerte noch nicht so aussagekräftig, da wir in manchen Klassen oft nur 1-2 Stück
erlegten (1993). Ich nehme daher das Jahr 1997 als erstes Referenzjahr, da wir in diesem Jahr erstmals einen
den damaligen Verhältnissen entsprechenden Abschuss durchführten. Die
Durchschnittsgewichte nach immerhin 4 jähriger Fütterung betrugen damals:
1997: 2008:
Bockkitze 9,1 kg 11,93 max. 15 kg
Gaiskitze 9,9 kg 11,52 max. 16 kg
Schmalgaisen 14,1 kg 16,06 max. 20 kg
Ältere Gaisen 15,3 kg 17,79 max. 22 kg
Einj. Böcke 14,0 kg 15,84 max. 19 kg
Mehrj. Böcke 18,5 kg 19,55 max. 24 kg
Die Trophäengewichte erhöhten sich nicht ganz so rasch wie erhofft und auch nicht ganz den
hohen Erwartungen entsprechend. Natürlich wussten wir, dass es für solche Veränderungen
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
41
einiger Rehgenerationen bedarf, weil erst das Kitz einer starken Gais, das auch selbst
genügend Futter bekam, dann in der Folge starke Kitze setzten kann. Diese körperlich starken
Bockkitze haben dann erst die körperlichen Grundlagen für starke Trophäen. Trotzdem gab es
ein kontinuierliches Ansteigen und in wenigen Jahren lagen wir mit unserem Durchschnitt
schon weit über den Bezirks-Durchschnitt. Z.B.: von den vorgelegten 746 Rehbocktrophäen
einer Hegeschau im Bezirk Gmünd 2002, überschritten nur 32 Rehgeweihe die 300
Grammgrenze.
Da ich im Rahmen dieser Arbeit aber der Trophäe nicht allzu viel Bedeutung geben will,
möchte ich die Gesamtentwicklung nur mit einigen Fotos, die für sich selbst sprechen,
dokumentieren.
Geweihgewicht 560 Gramm (großer Schädel)
Geweihgewichte: 520 und 540 Gramm (großer Schädel)
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
42
Ein interessanter „Nebeneffekt“ trat aber mit zunehmender Dauer unserer Fütterung auf. Die
Geweihfärbung wurde deutlich dunkler und, vor allem bei den mehrjährigen stärkeren
Böcken, stellte sich unabhängig vom Einstand und den dort vorhandenen Holzarten ein sehr
ähnlicher dunkelbrauner Farbton ein.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
43
Man kann auch bei den in den Nachbarrevieren erlegten Böcken aufgrund „unserer“ Färbung
leicht erkennen, ob sie bei einer unserer Fütterungen standen.
Wenn man die gängige Rehwildliteratur, in der die Geweihbildung und Farbe behandelt wird,
liest, muss man erkennen, dass es über die Färbung der Geweihe sehr unterschiedliche
Aussagen und Erklärungsansätze gibt.
Die Zusammensetzung des Futters an sich, so glauben wir, ist nicht ausschlaggebend für die
Geweihfarbe, denn unsere Mischungen änderten sich eigentlich von Jahr zu Jahr. Unser
Erklärungsansatz geht eher in die Richtung, dass sich mit zunehmend stärkerer
Geweihbildung die Dichte des Geweihes verändert und die Trophäen einfach poröser oder
spongiöser werden. Dadurch werden offensichtlich eindringende Pflanzensäfte, oder auch
eigene Sekrete, anders aufgenommen. Unserer Erfahrung nach, sind die verwendeten
Fegegehölze von geringerer Bedeutung als allgemein angenommen. Betrachtet man
Abwurfserien von Böcken sieht man über Jahre eine fast absolut gleiche Farbgebung, sodass
man die unterschiedlichen Jahrgänge miteinander kombinieren könnte. Man kann aber davon
ausgehen, dass die Rehböcke nicht jedes Jahr exakt die gleichen Gehölze in der gleichen
Reihenfolge verwenden.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
44
9.1. „Gesundheit“
Die offensichtlich doch hohen Dichten und die intensive Fütterung geben natürlich auch
Anlass, über den Gesundheitszustand unserer Rehe nachzudenken. Da wir zwar im
Allgemeinen sauber arbeiten aber z.B. die Fütterungen nicht, wie in den Lehrbüchern
angegeben, nach jeder Fütterungsperiode desinfizieren, sondern nur reinigen, war eine
etwaige Parasitenbelastung der Rehe von besonderem Interesse. Die Gelegenheit bei den
Ansitztagen eine größere Stichprobenanzahl zu nutzen, wurde daher vom Institut für
Parasitologie der Vet. Med. Uni Wien (Prof. Prosl) im Jahr 2007 aufgegriffen und durch zwei
Diplomanden die Parasitenbelastung im Labmagen bei über fünfzig Rehen untersucht.
Das Ergebnis war durchaus beruhigend. Trotz der hohen Dichte und sicherlich
vorübergehender Konzentration bei den Fütterungen, war die Befallsquote mit Ausnahme
von zwei schwachen, offensichtlich kranken Stücken, äußerst gering und vernachlässigbar.
Nach mündlicher Aussage der Beiden Diplomanden wurden die Proben untersucht, aber es
waren praktisch bis auf die beiden erwähnten Ausnahmen kaum Parasiten nachweisbar.
Prof. Prosl meinte man hätte so einen Befund nach einer „Entwurmungskampagne“ als großen
Erfolg bezeichnet. Nur dass wir natürlich absolut nichts in diese Richtung unternommen
haben.
Die Proben aus dem Jahr 2010 sind leider noch nicht ausgewertet und daher liegen noch keine
Vergleichsergebnisse vor.
Da wir sehr engen Kontakt zur Bevölkerung haben, können wir davon ausgehen, dass uns
jedes, bei Wald- oder Feldarbeiten aber natürlich auch beim Pilze suchen gefundene Stück,
auch gemeldet wird. Dass heißt, ein etwaiger Anstieg von Fallwild - außer den wirklich
altersbedingten Abgängen - würde daher sofort auffallen. Wir gehen daher davon aus, dass
das krankheitsbedingtes Fallwild einen sehr geringen Anteil einnimmt.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
45
In einer Reihe von Sachbüchern28
und Publikationen29
wird immer auf die drohende Gefahr
der Pansenübersäuerung bei energiereicher Fütterung hingewiesen. Um zu sehen wie gut
unserer Rehe mit unserem Futter leben können, haben wir bei den Ansitztagen 2009 bei ca.
100 Rehen den pH - Wert im eröffneten Pansen direkt im Pansenbrei erhoben.
Dazu muss man ergänzen dass die meisten Rehe in den letzten Tagen bzw. Stunden vor der
Erlegung, Nasstrester (Apfel) aufgenommen haben und der pH - Wert auch möglicherweise
unmittelbar (kurzfristig) dadurch beeinflusst war. Es wurden auch grob sensorisch die Anteile
von Getreide bzw. Trester im Pansen erhoben. Trester hat nach vollständiger Vergärung im
Idealfall einen pH - Wert zwischen 3 und 3,5.
silierter Apfeltrester so wie wir ihn vorlegen
Pansen (links im Bild) vor der Eröffnung
28
Deutz etal 2009 29
Vodnansky 2010
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
46
Pansen nach Eröffnung, Messung mittels pH –Meter
Es wurden auch von jedem bearbeiteten Pansen eine Probe des Panseninhaltes gezogen und
gefrostet, um einerseits unsere erhobenen Werte noch einmal überprüfen zu lassen und
anderseits, wenn es der Aufwand erlaubt, etwas mehr über die jeweilige Zusammensetzung
des Inhaltes aussagen zu können.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
47
Zugleich wurde auch das Nieren und Peritoneal- Fett herausgelöst und gewogen.
Unserer Erfahrung nach, kommt es bei diesen Fettdepots bis Ende Dezember noch zu einem
erheblichen Zuwachs.
Messergebnisse30 - Ansitzjagdtage 2009
Böcke Gaisen Gaiskitze Bockkitze
pH - Wert Minimum 4,95 4,90 4,76 4,86
Maximum 6,48 6,32 6,04 6,30
Mittelwert 5,66 5,44 5,50 5,55
in Gramm
Nieren- plus Peritonealfett
Minimum 62,00 0,00 10,00 10,00
Maximum 284,00 420,00 240,00 190,00
Mittelwert 145,00 170,88 64,11 57,96
30
Anm.: In der Literatur (Clauss M.) werden pH-Werte von über 5 als normal und unter 5 als abweichend
bezeichnet.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
48
Im Vergleich dazu ein im Dezember erlegtes Reh mit ungefähr gleichem Körpergewicht:
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
49
10. Resümee
„18 Jahre Rehwildbewirtschaftung im Waldviertel“ gibt Einblick in die Tätigkeit passionierter
Jagdpächter, die den jagdwirtschaftlichen Ertrag und Nutzen eines Genossenschafts -
Jagdreviers zum Ziel hat. Allein in Niederösterreich gibt es über 3300 (!) Jagdgebiete.
Viele der Pächter stehen hier vor den gleichen Fragen. Darf ich und kann ich den
jagdwirtschaftlichen Nutzen aus meinem Pachtverhältnis steigern?
Wenn ja, was ist der gesetzliche Rahmen dafür, was ist dem Wild zumutbar, der Bevölkerung
vermittelbar und gibt es überhaupt auch ein bewertbares Kosten-Nutzen Verhältnis.
Im Allgemeinen geht man durchaus davon aus, dass ein Pächter auch Nutzen aus einem
Pachtverhältnis zieht. Niemand würde das z.B. bei der Landwirtschaft in Frage stellen.
Es gibt meines Wissens nach nur ganz wenige, vermutlich wie man sagt an einer Hand
abzuzählende Genossenschaftsreviere wo noch ein echter monetärer Gewinn zu erzielen ist.
In den meisten Fällen ist es ja die Absicht, durch Steigerung des jagdlichen Nutzen (das heißt
höhere Abschusszahlen) und auch durch einen höheren Wildbreterlös einen gewissen „Return
of Investment“ zu haben.
Was sonst in jedem wirtschaftlichen Verhältnis als vollkommen klar scheint, wird aber bei
den Jagdpächtern sehr häufig in Frage gestellt.
Natürlich gibt es bei Wald, Wild, Natur-, Tier- und Umweltschutz, alles Bereiche mit denen
die Jagd direkt in Zusammenhang steht, auch übergeordnete Interessen die es zu
berücksichtigen gilt. Es erhebt sich aber auch die Frage, wie weit solche Einschränkungen
gehen dürfen, wo doch das Jagdrecht, zumindest in Österreich, ein direktes Recht des
Grundeigentümers ist.
Wie ich in meiner Arbeit darstellte, sind die Möglichkeiten für einen Jagdpächter ziemlich
beschränkt. Wir haben uns damals für die Variante „ Füttern und Jagen“ entschieden.
Im Laufe der Jahre kam es aber aus verschiedenen Gründen zu einigen Inkonsequenzen und
Änderungen. So änderten wir, bedingt durch das lokale Angebot, unsere Futtermischung
nahezu jährlich. Auch unsere Abschussstrategien wie z.B. die Anzahl der jährlich zu
erlegenden Jährlinge, oder der Gesamtjahresabschuss, wurden im Laufe der Zeit geändert.
Obwohl noch eine Fülle von Daten noch zur Verfügung steht, welche man auswerten hätte
können, wählte ich den deskriptiven Weg unsere Maßnahmen, Erfahrungen und Erfolge
darzustellen.
Mit zunehmender Wissenserweiterung, und nicht zuletzt durch den von uns besuchten
Universitätslehrgang Jagdwirt/In stellten wir uns die Fragen: Was dürfen wir unserem Wild
zumuten? Wie weit beeinflussen wir mit unserer Methode die Kondition, das Wohlbefinden
und die Gesundheit?
Wir begannen daher im Jahr 2009 mit der Erhebung einiger Parameter wie pH –Wert des
Panseninhaltes und Nieren- inklusive Peritonealfettgewichtes der Herbstrehe.
Bei der Recherche zum Ermittlungsverfahren stellte sich leider erst nachträglich heraus, dass
auch sogenannte Experten nicht immer wirklich Bescheid wissen. Da wir aber vorhaben,
diese Messungen unter wissenschaftlicher Betreuung fortzusetzen, können wir die im Vorjahr
erhobenen Daten eventuell noch einmal auf ihre Aussagekraft bewerten.
Trotzdem möchte ich zusammenfassen, dass wir aus jetziger Sicht einige Ziele durchaus
erreicht haben. Wir haben einen hohen Wildbestand, gesundes vitales Wild mit durchaus
hohem Körpergewicht und auch hohen Fettreserven für den Winter und nicht zuletzt auch
eine überdurchschnittliche Trophäenqualität.
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
50
Literaturverzeichnis:
v. Bayern, A. und J. 1975: Über Rehe in einem steirischen Gebirgsrevier
von Bayern J. Bauer Klischeeanstalt, Hamburg
Berdar, B. 1983: Az öz es vadaszata, Verlag Mezögazdasagi Kiado
Budapest,
Bubenik A. B. 1966: Das Geweih, Paul Parey, Hamburg
Bruns,H. O. Satorius 1958: Das Ansprechen des Rehwildes Grundzüge zum
und K. Lotze geforderten Aufbau des Rehwildbestandes,
M.& H. Schaper, Hannover
Deutz, A. , Gasteiner J., 2009 : Fütterung von Reh- und Rotwild ,ein Praxisratgeber
Buchgraber K. Leopold Stocker Verlag, Graz
-
Ellenberg, H. 1978 : Zur Populationsökologie des Rehes (Capreolus
capreolus L.) in Mitteleuropa. Spixiana , Zeitschrift für Zoologie
(München), Supplement 2,
Elßmann, H. 1971: Rehwildhege und das Knopfbockproblem.
F. C. Mayer Verlag, München
Fellinger, St. 1987: Zur Schalenwildsituation des Lehrforstes Ofenbach
(Unter besonderer Berücksichtigung des Rehwildes).
Diplomarbeit am Institut für Wildbiologie an der Universität für
Bodenkultur Wien
Gitterele O. 2006: Traumböcke. Das Rehwild im Kaunertal und im Tiroler
Jagdbezirk Landeck. Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien
Hespeler, B. 1989: Rehwild heute: Lebensraum, Jagd und Hege. BLV,
München
Hofmann R. R. 1978: Die Ernährung des Rehwildes im Jahresablauf nach dem
Modell Weichselboden. Wildbiologische Informationen für den
Jäger. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart
Hofmann R. R. 1982 :Die Herbstmast-Simulation. Untersuchungsergebnisse
und N. Kirsten und kritische Analyse eines praxisorientierten AKW- Projektes
zur Problematik der Schalenwildfütterung. Heft 9 der
Schriftenreihe des Arbeitskreises für Wildbiologie und
Jagdwissenschaft an der Justus- Liebig Universität Gießen. Enke
Verlag, Stuttgart.
Kurt, F. 1991: Das Reh in der Kulturlandschaft , Sozialverhalten und
Ökologie eines Anpassers. Verlag Paul Parey, Hamburg und
Berlin
Universitätslehrgang Jagdwirt 2008/09 Abschlussarbeit Erich Hofer
51
Krebs, H. 1979: Jung oder alt? Schalenwild richtig ansprechen
BLV, München
Linnell J.D.C. 2008: Quo vadis, Rehwild? St. Hubertus Ausgabe 4/2008
Maggio G. 1978: Ist Rehwildhege im Sinne der Forschungserkenntnisse
aus Weichselboden in der Praxis möglich? Wildbiologische
Informationen für den Jäger. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart:
S. 169-186.
Nussbaum H., Pegel M., 2004: Apfeltrestersilagen für die Wildfütterung
Elliger, A. WFS-Mitteilungen ,Wildforschungsstelle des Landes Baden-
Württemberg, Aulendorf Ausgabe 4 /2004
Osgyan, W. 1989: Rehwild Report Fakten, Erfahrungen, Konsequenzen
Nimrod Verlag Düsterneichen, Bothel
Reimoser, F. 2005: Rehwild in der Kulturlandschaft, Zitat aus
Tagungsbericht - 11. Österreichische Jägertagung, Gumpenstein
Richter V., Balis M., 1967: Polovnicke Trofeje Slovenska
Krasula R., Sprocha J. Verlag Slovenske vydavatdeltvo podohospodarskejv literatury,
Bratislava
Schäfer, E. 1979: Hegen und Ansprechen von Rehwild
BLV, München
Schröder W., Eisfeld D., Die „Herbstmastsimulation“ Ein Irrweg der Hege /
Ellenberg H., Gossow H. Stellungnahme zu einem von Prof. Dr. R. R. Hofmann
und Nikolaus Kirsten vorgestellten Konzept zur Fütterung von
Reh- und Rotwild, undatierte Kopie
Stubbe, C. 2008: Rehwild- Biologie. Ökologie. Bewirtschaftung
Kosmos, Stuttgart
Uekermann, E. 1969 (3. Auflage) Der Rehwildabschuss
Paul Parey, Hamburg und Berlin
Vogt, F. Schmid, F. 1950: Das Rehwild. Österreichischer Jagd und Fischerei-Verlag,
Wien
Vodnansky, M. 2010: Rehwild. Sinnvolle Winterfütterung
Österreichisches Weidwerk, Heft 2 / 2010,
Wagenknecht, E. 1976: Rehwildhege mit der Büchse
Neumann Verlag, Leipzig- Berlin
Wandaller E., Manhart D. 2007: Unbeachtetes Waldviertel. Das Streifen- und
Terassenland. Eigenverlag Gmünd. ISBN: 978-3-200-00925-7