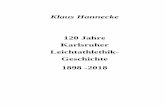Prähistorische und paläökologische Forschungen im Djado-Plateau, Nordost-Niger
Archäologische Forschungen der Jahre 2007 und 2008 im Anden-Transekt, Süd-Peru
Transcript of Archäologische Forschungen der Jahre 2007 und 2008 im Anden-Transekt, Süd-Peru
Zeitschrift für Archäologie Außereuropäischer Kulturen 3 (2010): 207–296
Archäologische Forschungen der Jahre 2007 und
2008 im Anden-Transekt, Süd-Peru
Die umfangreichen Untersuchungen zur Sied-lungs- und Kulturgeschichte im Raum Palpa, an der Südküste Perus, wurden im Jahr 2007 zu Ende geführt. Im Rahmen eines vom Bun-desministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektverbundes waren in Zu-sammenarbeit mit Partnern aus Natur- und Ingenieurwissenschaft neue Technologien und Methoden für die archäologische Forschung entwickelt worden. Durch deren Einsatz in der Forschung konnten vielfältige Erkenntnissen zur Kultur- und Landschaftsgeschichte gewonnen werden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden inzwischen in einem umfangreichen Sammelband veröffentlicht1.
Ein wichtiges Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Archäologen und Naturwissenschaft-lern war die Erkenntnis, dass das Siedlungsver-halten der vorspanischen Bevölkerung im Raum Palpa im Lauf der Geschichte in erheblichem Maße von Klima- und Landschaftsveränderungen beeinfl usst wurde. Änderungen im Feuchtehaus-halt, die in der äußerst klimasensitiven Region am Wüstenrand anhand von Sedimentarchiven nachgewiesen werden konnten, führten zu erheblichen Fluktuationen in der Anzahl, der Konzentration und der Lage von Siedlungen in vorspanischer Zeit. Während günstige kli-matische Verhältnisse zur intensiven Besiedlung der Täler von Palpa in der Paracas-Zeit (800 v. Chr. – 200 v. Chr.) führten, war ein lang-
samer Aridisierungsprozess die Ursache für Siedlungsverschiebungen und schließlich für den Zusammenbruch der Nasca-Kultur (200 v. Chr. – 600 n. Chr.). Aufgrund der ausgeprägten Tro-ckenheit war der Raum um Palpa in der Zeit des Mittleren Horizontes (600–1000 n. Chr.) nur sehr spärlich besiedelt. Ein Wechsel zu wesentlich feuchteren Bedingungen in der Späten Zwischenperiode (1000–1400 n. Chr.) führte dann zu einer massiven Wiederbesiedlung mit ausgedehnten, nahezu stadtähnlichen Zentren.
Die Beobachtung, dass die drastischen Kli-maänderungen in der Siedlungskammer von Palpa im Verlauf der Geschichte zu massiven Migrationsbewegungen der Bevölkerung geführt haben, eröffnet zahlreiche Fragen hinsichtlich der großräumigen Landschafts- und Siedlungs-geschichte. Da der Feuchtehaushalt in den Flussoasen der Küstenwüste abhängig ist von den Niederschlagsverhältnissen in den Anden, ist die Hochlandregion der Anden von unmittelbarem Interesse für weitere geoarchäologische Studien. Gleiches gilt für siedlungsarchäologische Studien, welche zum Verständnis und der Erklärung der Bevölkerungsfl uktuationen auf die Kenntnis der Siedlungsprozesse in einem weiteren Um-feld angewiesen sind. Es lag daher nahe, als Konsequenz aus den vorausgehenden Studien das zunächst auf den Andenfuß beschränkte Forschungsgebiet auszudehnen, und zwar
Berichte für die Jahre 2007– 2008
der Projekte der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
des Deutschen Archäologischen Instituts
1 M. Reindel, G. A. Wagner: New Technologies for Archaeology. Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru. Natural Science in Archaeology. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg, 2009.
208 Jahresbericht
zum einen in die Region des Hochlandes der Anden und zum anderen bis zum Pazifi schen Ozean (Abb. 1).
Im Rahmen der Aktivitäten des Forschungs-clusters 1 des Deutschen Archäologischen
Instituts (Von der Sesshaftigkeit zur komplexen Gesellschaft: Siedlung, Wirtschaft, Umwelt)2
Abb. 1. Untersuchungsgebiet des Projektes Anden-Transekt an der Südküste Perus. Die Forschungen orientieren sich an einer gedachten Linie, die von der Küste des Pazifi ks bis zur Westkordillere der Anden reicht (Karten-grundlage: Landsat).
2 Deutsches Archäologisches Institut: Menschen, Kultu-ren, Traditionen. Die Forschungscluster des Deutschen Archäologischen Instituts. Berlin, 2009.
209Jahresbericht
wurde das Projekt „Anden-Transekt“ entworfen. Die Anden Perus sind ein tropisches Hochge-birge. Von der Pazifi kküste bis zu den höchsten Gipfeln auf fast 7000 m Höhe fi nden sich klar ausgeprägte Höhenstufen mit jeweils spezifi schen ökologischen Merkmalen, an die sich die Men-schen mit jeweils besonderen Lebensformen und Wirtschaftweisen angepasst haben. Ziel des Projekts Anden-Transekt ist es zu untersuchen, welche Strategien menschliche Gemeinschaften zur Nutzung dieser ökologischen Lebensräume entwickelten, wie sie die Vielfalt der Ressourcen unterschiedlicher Gebiete durch den Austausch von Gütern, aber auch durch Migration nutzten und welchen Einfl uss die Veränderungen von Umweltbedingungen auf kulturelle Umbrüche im Verlauf der Siedlungsgeschichte in den Anden hatten. Als Untersuchungsregion wurde das Einzugsgebiet der nördlichen Zufl üsse des Rio Grande, in Süd-Peru, defi niert (Abb. 1). Diese Flüsse durchqueren auf ihrem Weg vom Quellgebiet an der Westseite der peruanischen Anden bis zur Mündung in den Pazifi schen Ozean eine Vielzahl von Landschaften, von den eisigen Hochgebirgssteppen bis zu der heißen Atacama-Wüste.
Die Feldforschungen konzentrierten sich 2007 auf die bisher archäologisch unerforschten Quellgebiete der Flüsse Rio Viscas und Rio Palpa in den Gebirgsregionen zwischen 2200
und 4500 m Höhe (Abb. 2). Mit Hilfe von hoch aufl ösenden Satellitenbildern und auf-wändigen Geländeprospektionen konnten dort in der ersten Feldkampagne 81 archäologische Siedlungsplätze entdeckt werden. Auf dieser Datengrundlage ließen sich erste Aussagen über die Siedlungsstrukturen der Hochlandregion in vorspanischer Zeit treffen. Die registrierten Siedlungen stammten aus der Formativzeit (Paracas-Kultur, 800–200 v. Chr.), der Frühen Zwischenperiode (Nasca-Kultur, 200 v. Chr. – 600 n. Chr.), dem Mittleren Horizont (Hua-ri-Kultur, 600–1000 n. Chr.) und der Späten Zwischenperiode (1000–1500 n. Chr.).
Auffällig ist die deutliche Verteilung beson-derer Siedlungstypen auf unterschiedliche Hö-henstufen und charakteristische topographische Lagen. In Höhen über 3300 m bis zum Rand der Puna des zentralen Hochlandes von Peru befi nden sich unzählige ausgedehnte Einfrie-dungen mit angrenzenden Gebäudeeinheiten, die einmal als Weide-, Wirtschafts- und Siedlungs-plätze von Kamelidenhirten (Lamas, Alpakas) dienten (Abb. 6). Die darunter liegende Höhen-stufe bis 2800 m ist geprägt von ausgedehnten Hängen, die in relativ ebenen Schulterbereichen auslaufen, bevor sie wieder mit einem starken Knick zu den tief eingeschnittenen Tälern der Flüsse abfallen. Auf den Berghängen fi nden sich Ackerbauterrassen mit kleinen Siedlungs-
Abb. 2. Geländemodell der Hochlandregion des Anden-Transektes mit den bis zur Feldkampagne 2008 registrierten archäo-logischen Fundplätzen (Karte: V. Soßna, C. Hoh-mann).
210 Jahresbericht
einheiten, in den Schulterbereichen und insbe-sondere auf spornartigen Ausläufern komplexe Siedlungsgefüge, die zumeist in ausgedehnte Terrassenanlagen eingebettet sind (Abb. 3). Im Gegensatz zur Viehzucht der hohen Lagen stand hier also die Landwirtschaft im Mittelpunkt der Aktivitäten.
Mit Ausnahme der Siedlungen aus dem Mittleren Horizont befi nden sich die Sied-lungen bevorzugt auf Spornlagen, Bergkuppen und Höhenzügen mit sehr guter Rundumsicht. Auffällig sind weiterhin dichte Siedlungskom-plexe in strategischer Lage und mit Wall- und Grabenanlagen in einer fest umgrenzten Region, die auf einen erheblichen Bevölkerungsdruck
und Konfl ikte in bestimmten Zeiten hindeuten. Dies ist erstaunlich, ist das Gebiet doch heute sehr dünn besiedelt und aufgrund der großen Trockenheit nur begrenzt landwirtschaftlich nutzbar. Andere Umweltbedingungen in der Vergangenheit müssen wohl die Grundlage für ein wesentlich größeres wirtschaftliches Po-tential der Region gewesen sein. Ein Großteil der Siedlungen der Späten Zwischenperiode liegt in Höhen unterhalb von 2800 m Höhe. Auch die im Vergleich zu früheren Epochen größere Ausdehnung der Fundorte der Späten Zwischenperiode deutet darauf hin, dass die Umweltverhältnisse einen entscheidenden Ein-fl uss auf das Siedlungsverhalten hatten.
Abb. 3. Der Fundort Santa María, eine der vielen Siedlungen mit ausgedehnten Anbauterrassen in der Hoch-landregion des Anden-Transektes. Siedlungs- und Grabbauten befi nden sich im oberen, die landwirtschaftlichen Nutzfl ächen im unteren Teil des Fundortes, der auf 2800 m Höhe liegt und in die Späte Zwischenperiode datiert (1000–1400 n. Chr.) (Foto: M. Reindel).
211Jahresbericht
Seit 2008 werden die archäologischen Ar-beiten im Rahmen eines interdisziplinären Verbundprojektes mit dem Titel „Anden-Transekt: Klimasensitivität präkolumbischer Mensch-Umwelt-Systeme“ vom Bundesminis-terium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderschwerpunkt „Wechselwirkungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften“ gefördert. Der zeitliche Rahmen der Forschungen reicht von der Einwanderung menschlicher Gemeinschaften in Südamerika um 10.000 v. Chr. bis zum Beginn der Kolonialzeit im frühen 16. Jh. n. Chr. In Zusammenarbeit mit Geowissenschaftlern liegt ein besonderes Augenmerk des Forschungsprojektes auf dem Einfl uss klimatischer Veränderungen auf die Siedlungsdynamik zwischen Küstenwüste und Hochgebirge der Anden3.
Die Feldarbeiten gliedern sich in drei Ar-beitsprozesse: Die archäologische Prospektion soll mit Geländebegehungen möglichst viele oder zumindest eine repräsentative Auswahl vorspanischer Siedlungsplätze im Forschungs-gebiet des Anden-Transektes dokumentieren. Die Fundplätze werden zunächst anhand der Oberfl ächenfunde datiert. In einem zweiten Schritt werden Testgrabungen an ausgewählten Siedlungsplätzen vorgenommen, die detailliertere Informationen zur Zeitstellung und zur Art der Nutzung der Fundplätze liefern sollen. In einem dritten und letzten Schritt werden einige wenige Siedlungsplätze, die als reprä-sentativ für bestimmte Regionen, Zeiten oder Nutzungsarten angesehen werden, großfl ächig ausgegraben.
Nachdem die Siedlungsprospektion am An-denfuß in Vorprojekten bereits abgeschlossen werden konnte, werden im vorliegenden Bericht zunächst die Ergebnisse der Siedlungsprospek-tion im Hochland vorgestellt. Dort wurden in den Kampagnen 2007 und 2008 die ersten Testgrabungen vorgenommen, die im Anschluss beschrieben werden. Der einzige Fundort am Andenfuß, an dem archäologische Arbeiten durchgeführt wurden, ist Pernil Alto. Dort waren die bislang einzigen Befunde aus dem Archaikum (3800–3000 v. Chr.) festgestellt worden. Aufgrund der besonderen Bedeutung
des Fundortes für die andine Frühzeit wurden dort intensive Flächengrabungen vorgenommen. Schließlich werden noch die Arbeiten an einem Geographischen Informationssystem vorgestellt, welches die Ergebnisse aus den Teilprojekten des interdisziplinären Projektverbundes zu-sammenführt und als wichtiges Werkzeug zur Speicherung und Auswertung des komplexen Datenmaterials dient.
Archäologische Siedlungsprospektion im Hochland des Anden-Transektes
Die paläoklimatischen Untersuchungen am Andenfuß hatten ergeben, dass die Nieder-schlagsmenge und die Verfügbarkeit von Was-ser in den letzten 10 000 Jahren bedeutenden Schwankungen unterworfen war. Diese hatten ständige Veränderungen in der Bevölkerungs-dynamik und Migrationsbewegungen zwischen
3 Das Teilprojekt „Archäologie“ der KAAK wird von Markus Reindel geleitet, der während der Feldkampagnen die Arbeiten koordinierte und mit Vermessungs- und Prospektionsarbeiten beschäftigt war. Johny Isla, der die archäologischen Arbeiten vor Ort koordiniert, war für die Gesamtleitung der Ausgrabungen und die Durchführung von Prospektionen und Testgra-bungen im Hochland zuständig. Er wurde von José Palomino unterstützt, welcher das Kleinfundelabor leitete, wo unter anderen Gabriela Contreras mit der Dokumentation von Paracas-Keramik beschäftigt war. Uta Karrer wertete im Rahmen ihrer Magisterarbeit die initialzeitliche Keramik des Fundortes Pernil Alto aus. Carolina Hohmann leitete die Prospektionsarbeiten im Hochland. Sie wurde dabei von Alfredo Bautista und Irela Vallejo unterstützt. Außerdem waren an den Prospektionen Daniel Geiger (Keramikbearbeitung) und Benedikt Gräfi ngholt (Rohstoffkunde) beteiligt. Volker Soßna nahm an Prospektionsarbeiten teil und beschäftigte sich mit der Strukturierung und Pfl ege der Projektdatenbank sowie der Weiterentwicklung des GIS-Systems. Judith Astahuaman führte gemeinsam mit Hermann Gorbahn die Ausgrabungen in Pernil Alto durch. Als Kooperationsprojekte des Verbundprojek-tes waren Teilnehmer des Teilprojektes „Klima- und Umweltgeschichte“ unter Leitung von Bertil Mächtle (Vertretung von Bernhard Eitel) an den Feldarbeiten beteiligt. Stefan Hölzl leitete die Arbeiten des Teil-projektes „Isotopenanalyse“ und Lars Fehren-Schmitz diejeningen des Teilprojektes „Paläogenetik“.
212 Jahresbericht
Abb. 5. Plan der Bauten auf dem Cerro Llamoca. Zahlreiche Schreine in Form von Steinanhäufungen (Apachetas, kleine Punkte) und ein sogenanntes D-förmiges Gebäude (Mittlerer Horizont, ca. 600–1000 n. Chr.) wurden zu rituellen Zwecken genutzt (Zeichnung: J. Isla, J. Palomino).
Abb. 4. Der Cerro Llamo-ca (4433 m ü. M.) markiert das nordöstliche Ende des Anden-Transektes. Er wurde in vorspanischer Zeit als heiliger Berg ver-ehrt. Sowohl auf seinem Gipfel als auch an seinem Fuß befi nden sich archä-ologische Fundplätze aus verschiedenen Zeitstufen. Davor erstreckt sich ein ausgedehntes Hochmoor, welches ein exzellentes Klimaarchiv für geomor-phologische und paläobo-tanische Untersuchungen darstellt (s. Abb. 19) (Foto: M. Reindel).
213Jahresbericht
Hochland und Küste zur Folge. Die weit rei-chenden Kontakte der Bevölkerung werden auch durch Handelsprodukte wie Obsidian deutlich, der nur im Hochland vorkommt, jedoch seit frühesten Zeiten auch an Siedlungsplätzen der Küste auftritt (Abb. 7).
Die Forschungen der Feldkampagne 2008 in den Bergregionen zwischen 2100 m und 4500 m Höhe haben den Eindruck bestätigt, dass die Hochlandregion ein wichtiges Siedlungsgebiet war, welches von den durch die klimatischen Veränderungen bewirkten Bevölkerungsfl uktua-tionen betroffen war. Inzwischen konnten mehr als 200 Siedlungen nahezu aller Siedlungsepochen in den Bergen registriert werden. Ausgedehnte Terrassen in Höhen um 3000 m und unzählige Viehgehege zur Haltung von Lamas und Alpa-
kas in Höhen über 3800 m bezeugen eine rege Wirtschaftstätigkeit in vorspanischer Zeit. Das Untersuchungsgebiet muss damals ein äußerst dynamischer und dicht besiedelter Kulturraum gewesen sein, die Siedlungsdichte muss deutlich höher gewesen sein als in heutiger Zeit. Es ist anzunehmen, dass die hohe wirtschaftliche Produktion nicht nur dem Eigenbedarf diente, sondern auch der Versorgung der Küstengebiete. Die archäologisch fassbaren Transportrouten und Handelswege müssen hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben.
Mit den Arbeiten der Feldkampagne 2008 konnte die allgemeine Grundlage für die weiteren Analysen der Siedlungsdynamik im untersuchten Anden-Transekt erheblich erweitert werden. Einzelne Aspekte der bisherigen Untersuchungen
Abb. 6. Satellitenbild des Fundortes Pichqa Puquio (4000 m ü. M.). Die Einfriedungen sind Pferche für Kame-liden. Der Ort diente wahrscheinlich als wichtige Station an einem Transportweg, der das Hochland mit der Küste verband (Foto: Quickbird).
214 Jahresbericht
Abb. 7. Obsidianlagerstätte im Hochland bei Huan-casancos. Obsidian wurde dort in geringer Tiefe im Pingenbau gewonnen und unbearbeitet oder roh behauen über große Distanzen transportiert. Unten rechts ein fein gearbeitetes Werkzeug aus Obsidian (Foto: C. Hohmann).
Abb. 8. Grabkonstruktion in einem Felsüberhang am Fundort Layuni (Späte Zwischenperiode, ca. 1200–1400 n. Chr., 3600 m ü. M.). Im Untersuchungsgebiet des Anden-Transektes fi nden sich zahlreiche Typen von Grabkonstruktionen, darunter neben diesen Felsengräbern auch runde und rechteckige Grabhäuser mit z. T. me-galithischen Ausmaßen, sowie unterirdische Grabbauten unterschiedlicher Konstruktion (Foto: C. Hohmann).
konnten außerdem vertieft werden. So konnte die Region der Quellgebiete (Cabezadas) als wichtiges Verbindungsglied zwischen Küste und Hochland identifi ziert werden. Mindestens zwei Fernwege führten von der Küste ins Hochland. In größeren Höhen lagen in der Nähe der Fernwege große Hirtensiedlungen, von denen bisher 46 registriert wurden. Als Beispiel kann der Fundplatz Pichqa Puquio (fünf Quellen) genannt werden, wo sich mehr als 50 solcher Pferche fi nden (Abb. 6). An die-ser Stelle quert auch eine der Inkastraßen, die Teil eines Wegesystems war, das den gesamten zentralen Andenraum umfasste.
Einer der Fernwege wurde auf eine Länge von zwei Kilometern intensiv begangen. Er war auf dieser Strecke von sieben kleineren Fundor-ten mit einfachen Gebäuden aus verschiedenen Zeitphasen gesäumt. Am Übergang von den trockenen Talabschnitten zu den feuchteren Landwirtschaftszonen befanden sich Großsied-lungen (gateway communities) mit deutlichen Architekturmerkmalen, die auf eine ausgeprägte soziale Differenzierung hindeuten. In Fortset-zung des Fernweges befi ndet sich im Hochland bei Huancasancos ein Obsidianabbaugebiet mit riesigen Halden von Obsidianabschlägen in der Nachbarschaft zugehöriger Siedlungen
215Jahresbericht
(Abb. 7). Obsidian war eine wichtige Ressource, die nur im Hochland vorkommt und die mit Sicherheit auf diesen Fernwegen an die Küste transportiert wurde.
Eine weitere Besonderheit des Hochlandes gegenüber der Küstenregion sind Felsgräber mit z. T. sehr gut gearbeiteten Grabbauten, die bisher an 16 Fundstellen beobachtet wurden (Abb. 8). Da keine zugehörigen Siedlungen ge-funden wurden, muss man annehmen, dass die Toten über große Distanzen dorthin gebracht wurden oder dass es sich um Bestattungsorte mobiler Hirten handelte.
Die besondere Perzeption der Landschaft durch die Hochlandbewohner zeigt sich in der Verehrung von Bergheiligtümern. Prominente Berge (Apus) wurden im Andenraum als Sitz spiritueller Kräfte verehrt. In kolonialzeitlichen Quellen wird der im Untersuchungsgebiet ge-legene Berg Llamoca als einer der wichtigsten heiligen Berge bezeichnet (Abb. 4, 5). Dieser Berg steht unmittelbar an der Grenze zwischen der Puna-Hochfl äche und dem Andenwestab-hang auf etwa 4500 m Höhe. Auf der Spitze dieses beeindruckenden Berges stehen zahl-reiche Schreine und ein einfaches Gebäude, das sich aufgrund seiner D-Form als Kultbau des Mittleren Horizontes (600–1000 n. Chr.) identifi zieren lässt. Aufgrund seiner prominenten Lage und seiner kulturhistorischen Bedeutung kann dieser Berg hervorragend als Endpunkt des als Schnittlinie gedachten Anden-Transektes betrachtet werden (s. Abb. 1, 4).
Testgrabungen im Hochland des Anden-Transektes
Bedingt durch die Trockenheit und die fehlende Vegetation, aber auch wegen der zahlreichen Raubgrabungen, lassen sich am Andenfuß deut-lich mehr Oberfl ächenfunde als im Hochland registrieren. Im Hochland sind die Fundschichten zumeist von Böden und Vegetation bedeckt, Grabräuberei ist viel weniger verbreitet als an der Küste. Dadurch gestaltet sich die Be-stimmung der Zeitstellung der Fundplätze im Hochland anhand von Oberfl ächenfunden als deutlich problematischer. Neben den Gelände-
prospektionen wurden daher in den Feldkam-pagnen 2007 und 2008 verstärkt Testgrabungen vorgenommen.
Die begrenzten Grabungen sollten in erster Linie der genaueren Bestimmung der Zeitstellung der Fundorte dienen. Außerdem sollte repräsen-tatives Fundmaterial aus der bisher noch wenig bekannten Region gewonnen werden. Schließlich sollten erste Hinweise auf den Charakter der Nutzung der Siedlungsplätze gesammelt wer-den. Die Testgrabungen wurden vorzugsweise im Zusammenhang mit Architekturresten an-gelegt. Sie umfassten zumeist nur eine Fläche von wenigen Quadratmetern und stießen oft schon in geringer Tiefe auf den natürlichen Untergrund. Anhand der Keramikfunde ließ sich in der Regel eindeutig die Zeitstellung bestimmen. Die Ergebnisse von Radiokarbon-datierungen werden weitere Anhaltspunkte zur Datierung ergeben.
Vermessungen und Testgrabungen in Cuta-malla
Im Laufe der Arbeiten des Projektes Anden-Transekt sollten repräsentative Siedlungen aller Zeitstufen im Detail kartiert werden. Als erste dieser Siedlungen wurde der Fundplatz Cuta-malla ausgewählt, der sich auf Höhen zwischen 3200 m und 3400 m befi ndet. Innerhalb eines mehrere Quadratkilometer umfassenden Kom-plexes von Landwirtschaftsterrassen liegen zwei Gebäudegruppen (Abb. 9). Eine davon zeigt eine bisher unbekannte Architekturform: um einen runden, vertieften Hof sind D-förmige Gebäude so angeordnet, dass ein Grundriss in Form einer Blüte entsteht. Mehrere dieser Strukturen bilden die beiden Kernbereiche der Siedlung aus. Dazwischen fi nden sich zahlreiche kleinere Rundbauten.
Anhand von Oberfl ächenfunden ließ sich der Fundort Cutamalla in die Paracas-Zeit datieren. Erste Testgrabungen in einer dieser Rundstrukturen in der Feldkampagne 2007 ergaben weitere Keramikfunde und Radio-karbondatierungen, die eine Präzisierung der Datierung in die mittlere bis späte Paracas-Zeit (600–200 v. Chr.) zuließen.
216 Jahresbericht
Abb. 9. Topographischer Plan des Fundplatzes Cutamalla (Paracas-Zeit, 600–200 v. Chr.). Der Fundplatz liegt auf 3200 m Höhe, der idealen Höhenstufe für den Anbau von Getreide wie z. B. Mais. Innerhalb ausgedehnter Terrassenanlagen befi nden sich Rundstrukturen mit vertieften Höfen, die als Speicheranlagen dienten. Isoliert ste-hende Gebäude waren wahrscheinlich Wohngebäude (Zeichnung: J. Palomino, M. Reindel).
217Jahresbericht
Abb. 10. Plan der ersten Testgrabung in Cutamalla. In einem Schnitt wurden die Gebäudekomponenten einer der kreisförmigen Anlagen freigelegt: der vertiefte runde Platz mit Speichergruben, die umgebende Terrasse, und zwei D-förmige Einfriedungen mit im Boden eingelassenen und mit Stein gemauerten Speichern (Zeichnung: J. Isla).
Der in der Kampagne 2007 angelegte Profi l-schnitt erfasste eine der etwa 40 m messenden Rundstrukturen sowie je eine der beiden D-förmigen Strukturen am Ende des Testschnittes (Abb. 10). Der etwa 2 m tief eingelassene In-nenhof war von einer Bankette umgeben und mit einem sorgfältig ausgeführten Boden aus Stampfl ehm versehen. Im Bereich des Test-schnittes konnten drei konische Vertiefungen von 1 m Durchmesser und 90 cm Tiefe do-kumentiert werden. Die Ausgrabungen in den D-förmigen Bauten ergaben weitere zylindrische Einlassungen von 85 cm Tiefe und 2,4 m Durch-messer, deren Wände sorgfältig vermauert waren (Abb. 11). Neben wenigen Keramikfragmenten und aschedurchsetztem Füllmaterial konnte nur eine Gruppe von Geschossspitzen aus Obsidian geborgen werden. Als vorläufi ge Interpretation dieser Gruben und des Gesamtkomplexes kann vermutet werden, dass es sich um Speicheran-lagen im Zusammenhang mit den umgebenden landwirtschaftlichen Anbauterrassen handelte. Agrarlandschaften werden auch in skulptierten
Felsen dargestellt, von denen in der Region mehrere gefunden wurden (Abb. 12). Durch botanische Untersuchungen wird zu klären sein, welche Produkte hier angebaut wurden.
In der Kampagne 2008 wurde in einer zweiten, etwas höher liegenden Gebäudegruppe gegraben, in der Annahme, dass es sich um einen Siedlungsbereich gehandelt haben könnte. Ein erster Testschnitt wurde an einer Terras-senkante angelegt und lieferte Informationen über mehrere bauliche Einheiten. Allerdings wurde dort kaum keramisches Fundmaterial geborgen.
Ein zweiter Testschnitt erbrachte dagegen mehr Fundmaterial und Teile von Gebäuden und Plattformen. Die Keramik bestand zum größten Teil aus wenig diagnostischer Gebrauchsware. Die wenigen Fragmente diagnostischer Feinke-ramik bestätigten jedoch eindeutig die Zeitstel-lung Späte Paracas-Zeit (400–200 v. Chr.). Die im Testschnitt freigelegten Gebäudeteile lassen diesen Bereich als geeignet für eine größere Siedlungsgrabung erscheinen.
218 Jahresbericht
Abb. 11. Blick auf die in Abb. 10 dargestellte Testgrabung. Im Vordergrund eine der D-förmigen Einfriedungen mit eingelassenem Speicher, im Hintergrund der vertiefte, kreis-förmige Platz mit umlaufender Terrasse (Foto: J. Isla).
Abb. 12. Skulptierter Fels am Fundort Lindero. In den Felsen ist ein Abbild der umge-benden Agrarlandschaft mit Terrassierungen, Feldern und Bewässerungskanälen gearbeitet. Die agrarische Nutzung ist typisch für diese Höhenstufe zwischen 2800 m und 3500 m in den Anden (Foto: M. Reindel).
219Jahresbericht
Testgrabungen in Lindero
Lindero ist ein weiterer bedeutender Fundort in Spornlage mit zahlreichen Rundbauten. Der Platz liegt oberhalb eines der wichtigen Quellfl üsse der Region. Der Zugang zur Siedlung ist mit Wall- und Grabenanlagen strategisch befestigt. An mehreren Stellen des Fundortes fi nden sich skulptierte Felsen verschiedener Größe, die Agrarlandschaften mit Bewässerungskanälen darstellen (Abb. 12).
Durch die Ausgrabung von zwei Testschnitten in Siedlungsbauten konnte die zeitliche Einord-nung von Lindero in die mittleren Nasca-Zeit (300–450 n. Chr.) belegt werden. Lindero ist somit eine der vielen bisher registrierten Nas-ca-Siedlungen im Untersuchungsgebiet, die mit den Küstensiedlungen offenbar in so engem Kontakt standen, dass sich kein bedeutender Unterschied im Stil der Keramik beider Re-gionen feststellen lässt.
Testgrabungen in Huayuncalla
An dem Fundort Huayuncalla wurden Testgra-bungen in zwei unterschiedlichen Gebäudetypen durchgeführt, die am Fundort zu beobachten
sind: Eine Gruppe runder bzw. ovaler Bauten unterscheidet sich von rechtwinklig angelegten Bauten. Bezeichnenderweise stehen in Huay-uncalla auch Grabbauten (Chullpas) in runder und rechteckiger Form. Die Testgrabungen bestätigten den Oberflächenbefund, näm-lich dass die Siedlung sowohl in der späten Nasca-Zeit (450–600 n. Chr.) als auch in der Zeit des Mittleren Horizontes genutzt wurde (Abb. 13). Rundbauten sind eher der Nasca-Zeit, rechteckige Bauten eher dem Mittleren Horizont zuzuweisen. Dieser Befund bestätigt eine Tendenz in der Architektur des Mittleren Horizontes, die durch rektanguläre Bauformen geprägt ist.
Testgrabungen in Ocoro
Am Fundort Ocoro wurden Testgrabungen so-wohl in Siedlungsbauten als auch in Grabbauten durchgeführt. Aufgrund von Funden von Ober-fl ächenkeramik war zunächst vermutet worden, dass es sich um einen Fundort der Paracas-Zeit handelte. Die Ausgrabungen ergaben jedoch, dass sowohl Siedlungen als auch Gräber in der Zeit des Mittleren Horizontes (600–1000 n. Chr.) errichtet worden waren. Dieser Befund
Abb. 13. Testgrabung an dem Fundort Huay-uncalla (3000 m ü. M.). Gebäudereste aus der Zeit des Mittleren Hori-zontes (600–1000 n. Chr.) überlagern Mauern aus der Nasca-Zeit (300–600 n. Chr.) (Foto: J. Isla).
220 Jahresbericht
passt auch zur Form der Siedlungsbauten, die im wesentlichen nach rektangulärem Muster angelegt sind.
Die Grabbauten sind dagegen oval. Einer davon war intakt und wurde daher für eine Testgrabung ausgewählt. Im Inneren fanden sich die Skelette von zehn offenbar sekundär bestatteten Individuen (Abb. 14). Als Grabbei-
gaben fanden sich Keramikgefäße im typischen Stil des Mittleren Horizontes, Obsidianspitzen und Kupfernadeln (Abb. 15).
Die bisherigen Testgrabungen haben mit nur relativ geringem Arbeitsaufwand erheblich zur Klärung von Fragen zur Zeitstellung und Funktion von Siedlungsstrukturen beigetragen. Die Nutzung der Siedlungen zur Paracas- und
Abb. 14. Blick in einen der runden Grabbauten (Chullpa) von Ocoro, wo bei Testgrabungen die Reste von zehn sekundär bestatteten Individuen freigelegt wurden (Foto: J. Isla).
Abb. 15. Funde aus dem Grabbau von Ocoro. Obsidianspitzen, Gewand-nadeln aus Kupfer und Fragment eines Keramik-gefäßes aus dem Mittle-ren Horizont (600–1000 n. Chr.) (Foto: J. Isla).
221Jahresbericht
Nasca-Zeit sowie zur Zeit des Mittleren Hori-zontes kann nun als gesichert angesehen werden. Besonders interessant ist die Feststellung einer intensiven Besiedlung zur Zeit des Mittleren Horizontes. Im Fundortinventar der Küste war diese Zeitstufe nur wenig repräsentiert. Dies hing offenbar mit den verschlechterten klimatischen Verhältnissen zusammen. Im Hochland wird somit die Kultur des Mittleren Horizontes, die ja in dieser Region auch den Ausgangspunkt ihrer Verbreitung hatte, viel deutlicher fassbar.
Ausgrabungen in Pernil Alto
Das Projekt Anden-Transekt strebt eine Re-konstruktion der Siedlungsentwicklung aller Siedlungsepochen im Untersuchungsgebiet in Süd-Peru an. Pernil Alto datiert in das 4. Jt. v. Chr. und ist der bisher älteste identifi zierte Fundort am Andenfuß. Seine Nutzung fällt in die Zeit des so genannten Mittleren Archaikums und somit in eine Zeitstufe, in der sich die Sesshaftwerdung ehemals mobiler Gemein-schaften vollzog. Der Fundort ist somit für die Thematik des Forschungsclusters 1 des DAI von unmittelbarer Relevanz. Die Erforschung
Abb. 16. Blick auf die Ausgrabungen an dem archaischen Fundplatz Pernil Alto (3800–3000 v. Chr.). Links im Bild ist der bewässerte Talboden zu sehen, die Siedlung selbst mit den im Gra-bungsbereich sichtbaren Grubenhäusern liegt am ariden Talrand (Foto: M. Reindel).
dieser Zeitstufe im Zentralen Andenraum be-fi ndet sich noch in den Anfängen.
Pernil Alto liegt am rechten Talrand des Rio Grande, auf einer Höhe von etwa 350 m. ü. M. Die archäologischen Befunde konzentrieren sich auf eine Terrasse am trockenen Talrand und ein angrenzendes Trockental (Abb. 16). Bei vorausgehenden Grabungskampagnen waren unter Paracas- und Initialzeitlichen Siedlungs-schichten Spuren einer archaischen Besiedlung festgestellt worden, die in die Zeit zwischen 3800 und 3000 v. Chr. datiert werden konnten. Bisher waren lediglich Gräber und Gruben freigelegt worden. Ziel der Grabungskampagne 2008 war es, weitere Flächen zu öffnen, um den Charakter der Nutzung des Platzes in archaischer Zeit festzustellen.
Während der Grabungen 2008 wurde eine Fläche von weiteren 60 qm freigelegt. Darin befanden sich neun zumeist ovale Gruben von 3 m bis 3,5 m Länge und 2 m bis 3 m Breite, bei einer Tiefe von 0,8 m bis 1 m (Abb. 16, 17). Der Boden der meisten Gruben bestand aus gestampftem Lehm. Am Umriss weniger Gruben waren Reste von dünnen Pfostenlöchern zu erkennen. Bei den Gruben handelt es sich somit wahrscheinlich um überdachte Grubenhäu-
222 Jahresbericht
ser, so wie sich die besser erhaltenen Befunde des Ortes Chilca, an der Zentralküste Perus, rekonstruieren ließen. Nur in wenigen Gruben fanden sich Reibsteine, Mörser und einfache Steinwerkzeuge. An zwei Stellen zwischen den Grubenhäusern ließen sich Aktivitätsbe-reiche mit Pfostensetzungen und Feuerstellen identifi zieren.
In die Böden der meisten Grubenhäuser waren Bestattungen eingetieft. Bisher wurden 19 Bestattungen aus dem Archaikum gefun-den (Abb. 17, 18). Weitere acht Bestattungen
stammten aus der Nasca-Zeit (200 v. Chr. – 600 n. Chr.). Die Toten des Archaikums lagen in einfachen Gruben und waren mit Bruchsteinen oder Mahlsteinen abgedeckt. Die Körper waren in gefl ochtene Schilfmatten eingewickelt. In einem Fall war die Schilfumhüllung noch fast vollständig erhalten (Abb. 18). Mehrere Kinder waren fötal in Seitenlage bestattet, Adulte eher in gestreckter Seitenlage mit angewinkelten Beinen. Die wenigen Beigaben bestanden aus Anhängern aus Knochen, Horn und Muscheln. Eine der Bestattungen hatte allerdings an Hand-gelenken und am Hals Ketten aus Muschelperlen mit Anhängern aus Grünstein (Malachit oder Türkis). Einer weiteren Bestattung waren außer einer Kette und einer Mütze ein Futteral mit Knochengeräten, wahrscheinlich Werkzeuge zur Textilherstellung, beigelegt.
Abb. 17. Pernil Alto. Plan der bis 2008 ergrabenen Befunde aus dem Archaikum (3800–3000 v. Chr.). In die Grubenhäuser sind zahlreiche Bestattungen, wahrscheinlich nach deren Aufl assung, eingebracht worden. Zwischen den Grubenhäusern befi nden sich freie Flächen mit Pfostenlöchern und Feuerstellen, die als Aktivitätsbereiche interpretiert werden (Zeichnung: J. Isla, J. Palomino).
Abb. 18. Pernil Alto. Umhüllung einer der Bestattungen aus dem Archaikum (4. Jt. v. Chr.) aus Schilfmatten. Als Grabbeigabe sind ein Futteral mit einem einfachen Knochengerät und ein Netz aus Pfl anzenfasern zu erkennen (Foto: J. Isla).
223Jahresbericht
Die einfachen Gerätschaften aus Stein, Kno-chen und Muscheln deuten auf noch wenig differenzierte Wirtschaftsformen hin. Teile von Speerschleudern und Geschossspitzen sowie Fragmente von Hirschgeweihen zeigen, dass die Jagd noch eine bedeutende Rolle spielte. Eine große Anzahl an intensiv genutzten Reibsteinen und Mörsern lässt jedoch vermuten, dass die Siedlung permanent genutzt wurde. Von allen Nutzungsschichten und Grubeninhalten in Pernil Alto wurden Proben genommen, die auf den Gehalt von pfl anzlichem und tierischem Material untersucht werden sollen. Diese sollen Rückschlüsse auf Domestikationsprozesse von Pfl anzen und Tieren, aber auch auf die Um-weltverhältnisse im Archaikum ermöglichen.
Kooperationen mit Projektpartnern
Im Rahmen des Verbundprojektes Anden-Transekt fand während der Feldkampagne ein intensiver Austausch statt. Die Teilnehmer des Projektes „Klima- und Umweltgeschichte“ nah-men umfangreiche Arbeiten zur Lokalisierung und Beprobung von Geoarchiven an der Küste und im Hochland vor. In dem Moor von Atocata, welches sich im Quellgebiet des Rio Laramate in 4300 m Höhe befi ndet, wurden Bohrungen bis in 10 m Tiefe vorgenommen,
um Bohrkerne aus den abwechselnden Lagen von organischem und anorganischem Material zu gewinnen (Abb. 19). Es ist anzunehmen, dass das Moor über mehrere Jahrtausende ge-wachsen ist und somit ein ideales Klimaarchiv darstellt. Die noch anstehenden Radiokarbon-datierungen werden ergeben, welches Alter die untersten Schichten haben und so zeigen, ob in diesem Geoarchiv das gesamte Holozän, also der gesamte archäologisch relevante Zeitraum, abgebildet ist.
Die Teilnehmer des Projektes „Isotopen-analyse“ sammelten während der Feldkampagne Boden- und Gesteinsproben als Referenzmaterial für die Untersuchung archäologisch relevanter Materialien. Später sollen Knochen und Zäh-ne, aber auch Artefakte aus organischem und anorganischem Material beprobt werden, um Hinweise auf Mobilität und Migration der vorspanischen Bevölkerung zu gewinnen.
Anthropologisches Probenmaterial wurde derweil von den Teilnehmern des Teilprojektes „Paläogenetik“ gesammelt. Ziel ist es, eine möglichst große Probenanzahl von verschie-denen Fundstellen des Anden-Transektes (Küste, Andenfuß, Hochland) zu vereinen, um auf dieser Grundlage Aussagen zur Migration und Populationsdynamik zu treffen. Während der Feldkampagne wurden insbesondere die neuen
Abb. 19. Geomorpho-logen vom Geogra-phischen Institut der Universität Heidelberg bei der Entnahme von Bohr-kernen in dem Hochmoor von Atocata (4200 m ü. M.). Die wechselnden Lagen von Pfl anzen und Sedimenten, die bis min-destens ins 6. Jt. v. Chr. zurückreichen, können als hochaufl ösendes Archiv für Klimarekonstruktionen verwendet werden (Foto: A. Hein).
224 Jahresbericht
Skelettfunde von Pernil Alto beprobt. Ferner wurden Proben von 60 Individuen genommen, die während der Späten Zwischenperiode in einer Grabhöhle auf etwa 3500 m Höhe be-stattet worden waren. Diese Proben sollen mit denjenigen eines Kollektivgrabes gleicher Zeitstellung von einem Fundort bei Palpa, am Andenfuß, verglichen werden.
Konzeption eines Geographischen Informati-onssystems
Die Ergebnisse der Teilprojekte des interdiszip-linären Verbundprojektes fl ießen in ein Geo-graphisches Informationssystem ein, mit dessen Hilfe unter anderem die Siedlungsdynamik in vorspanischer Zeit im Anden-Transekt analysiert werden kann. Die bisherigen Untersuchungen legen nahe, dass wechselnde Umweltbedingungen eine Hauptmotivation für ein verändertes Sied-lungsverhalten darstellen. Die große Anzahl der im Verbundprojekt gesammelten Daten bietet die Möglichkeit zur statistischen und räumlichen Analyse von Daten zur Verteilung und Verbreitung archäologischer Phänomene im Zusammenhang mit geographischen und klima-tischen Gegebenheiten. Während Werkzeuge, Abschläge, Anbauterrassen und Viehpferche Hinweise auf die Produktion bestimmter Güter liefern, belegen Nahrungsabfälle und Fertig-waren aller Art die Bandbreite des Konsums. Da oftmals Güter nicht vor Ort produziert wurden, muss ein umfangreicher Austausch stattgefunden haben. Zu klären ist, in welchen Gebieten unter welchen Bedingungen welche Güter hergestellt bzw. angebaut werden konnten und an welchen Orten welche Kosumgüter nachweisbar sind. Durch Analysen mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) können Entfernungen von Siedlungen zu be-stimmten Rohstoffl agerstätten und zu wichtigen Handelswegen untersucht werden. Produkte, die weit außerhalb der Zone dokumentiert wurden, in der sie hergestellt werden konnten, belegen Ausmaß und Richtung des Austausches.
Bei der Erstellung von Klimamodellen für die verschiedenen Epochen der vorspanischen Geschichte durch die Geographen der Universität
Heidelberg kommen ebenfalls GIS-Analysen zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Niederschlagsverhältnisse, die ent-scheidenden Einfl uss auf die Verfügbarkeit von Weidefl ächen und Bewässerungswasser haben, nicht konstant. Die daraus resultie-renden starken Schwankungen des Potentials der landwirtschaftlichen Nutzung wären eine nahe liegende Erklärung für Änderungen im Siedlungsmuster, die sich im archäologischen Befund beobachten lassen. Bereits jetzt zeich-nen sich deutliche Korrelationen zwischen Siedlungsart und -verteilung und wechselnden Umweltbedingungen ab.
Markus Reindel