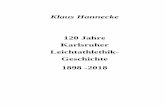Faist_Finkbeiner_2002_Emar. Eine syrische Stadt unter hethitischer Herrschaft
Schachmatt. Die letzten Jahre der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow
-
Upload
uni-bamberg -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Schachmatt. Die letzten Jahre der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow
2
Johannes GROTZKY, Dr. phil. (*1949), Studium der Slawistik, Balka-nologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb.1983-1998 Korrespondent für Ost- und Südosteuropa in Moskau, Wienund München. 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks.Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an derUniversität Bamberg.
Bücher: Gebrauchanweisung für die Sowjetunion (1984, 41990). HerausfoderungSowjetunion. Eine Weltmacht sucht ihren Weg (1991). Konflikt im Vielvölkerstaat.Die Nationen der Sowjetunion im Aufbruch (1991). Lenins Enkel. Reportagen auseiner vergangenen Welt (2009). Tschernobyl. Die Katastrophe (2018).
4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Johannes Grotzky 2004, erw. Neuaufl. 22014, TB 2019© für die Einzelbeiträge siehe Anmerkungen.Umschlaggestaltung: Swift PublisherTitelfoto: Grotzky. Foto Rückseite: Privat.Herstellung und Verlag: BoD - Books on Demand GmbH, NorderstedtPrinted in Germany, ISBN 978-3-74944-672-8
VORWORT 9VORWORT ZUR TASCHENBUCHAUSGABE 15PERESTROJKA AUS ERSTER HAND 17
MENSCHEN UND MÄCHTIGE 37
NEUER MANN AUF ALTER LINIE? 37DIKTATOR UND POET DAZU 42POLITISCHE NEUERUNGEN BEIM WECHSEL 45HERZENSDIENST FÜR DIE MÄCHTIGEN 47NEUE LEHREN FÜR DIE GENOSSEN 51PERESTROJKA DURCH KADERPOLITIK 55WACHTWECHSEL IM MILITÄR 59DAS POLITISCHE SYSTEM HAT VERSAGT 63
POSITIONSKÄMPFE 75
„DEMOKRATIE WIE DIE LUFT ZUM ATMEN!“ 75DIE GRENZEN DER BELASTBARKEIT 79ANHÄNGER UND GEGNER 97DEMOKRATISIERUNG 110ERSTMALS FREIE WAHLEN 112DIE SUCHE NACH DEM DIALOG 114DIE GUTEN UND DIE BÖSEN 118
HERAUSFORDERUNGEN IM INNERN 121
UNHEILE UMWELT 121EIN ROCKSTAR BETET UM ERRETTUNG 128FEHDEHANDSCHUH FÜR DIE GENOSSEN 132ERSTE WAHRHEITEN ÜBER DIE TRAGÖDIE 135EIN LAND LÄHMENDER WIDERSPRÜCHE 138„MIT WELCHEM RECHT KÄMPFEN WIR DORT?” 151
6
MEDIEN UND KULTUR 155
DIE HEIMLICHEN VERFÜHRER 155DAS THEATER ALS POLITISCHE BÜHNE 159VERBORGENE KRÄFTE DER IDENTITÄT 163GLASNOST AUF DEM BILDSCHIRM 167
RÜCKKEHR DER GESCHICHTE 175
“DER FASCHIST FLOG VORÜBER” 175STALINISMUS UND FASCHISMUS 181KEIN VERSTECKSPIEL VOR DER GESCHICHTE 185HÄFTLING IN DER STALINZEIT 189STREIT UM DEN STALINISMUS 191ZUR ZARENZEIT WAR ALLES BESSER 196
NATIONALE KONFLIKTE 199
PROTESTE AUF DEM ROTEN PLATZ 199EIN VOLK ERHEBT SICH 204GLASNOST IN KLEINEN DOSEN 210„MIT DER GANZEN MACHT DES STAATES“ 215„GEFÄNGNIS DER VÖLKER“ 218UNRUHEN IN GEORGIEN 221NATIONALE SPRENGKRAFT 223
SIGNALE NACH AUSSEN 231
DAS ENDE EINES TABUS 231POLITIK DER NADELSTICHE 233„DER REAGAN IST DOCH GEKAUFT“ 235DIE ASIATISCHE KARTE 237AFGHANISTAN 241TRUPPENABZUG IN ZWÖLF MONATEN 243
7
DAS ENDE DES SYSTEMS 245ERNEUERER UND ZAUDERER 245DER GROSSE GEWINNER JELZIN 250EINE REVOLUTION DES ZERFALLS 254NEUORIENTIERUNG 262
ZEITTAFEL 277SCHRIFTEN VON M.S. GORBATSCHOW AUF DEUTSCH 287NAMENSREGISTER 292
9
VORWORT
Wer in der Sowjetunion gelebt hat und heute nach Moskaukommt, der glaubt, seinen Augen nicht zu trauen. Nahezu alles,was in kommunistischer Zeit verboten war, gilt heute als selbst-verständlich. Die wirtschaftlichen Freiheiten scheinen einemDammbruch gleich alles niedergerissen zu haben, was früher instrenger Kontrolle kaum gedeihen konnte. Die Straßen sind mitAutos überfüllt, in den Geschäften werden Luxusgüter aus allerWelt vertrieben, beste und teuerste Hotels sind aus dem Bodengewachsen. Und dennoch finden sich immer wieder Spuren jenerHerrschaft, die nicht alleine dem Kommunismus, sondern be-reits dem Zarismus entstammen. Der Kreml in Moskau bleibtInbegriff einer zentralen Machtausübung, die den Prozess derMeinungsbildung im Land ebenso wie die Konstituierung derpolitischen Kräfte lenkt und überwacht.
Nach dem Ende der Sowjetunion wurden die Versuche zurDemokratisierung Russlands unter Präsident Jelzin vom Westennahezu hymnisch gefeiert. Doch der Verfassungswirklichkeitstanden Dutzende von Präsidialerlassen entgegen, mit denenJelzin die Verfassung umging, um das Land zu regieren. Derhäufige Wechsel der Regierungschefs unter Jelzin, die vom Prä-sidenten nahezu willkürlich in das Amt gehoben und wiederentlassen wurden, mündete 1999 schließlich in der Ernennungvon Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten, der von Jelzingleichzeitig als Nachfolger im Amt des Präsidenten im Jahr 2000gefördert wurde. Unter Putin profitierte Russland wirtschaftlichzunächst von einem unglaublichen Anstieg der Erdöl- und Erd-gaspreise. Doch auch unter Putin entwickelten sich kein funktio-nierendes Mehrparteiensystem, keine klare Gewaltenteilung undkeine wirklich unabhängigen Massenmedien. Ähnlich wie Jelzinschlug auch Putin seinen eigenen Nachfolger im Präsidialamtvor, nachdem er laut Verfassung nach achtjähriger Amtszeitnicht mehr wieder kandieren durfte. Sein Favorit Dmitri Med-wedew, seit 2005 Erster stellvertretender Ministerpräsident unterPräsident Putin, erhielt als neuer Mann im Kreml die Zustim-
10
mung der Bevölkerung. Trotz mancher Wahlfälschungen durfteman bei seiner Wahl 2008 davon ausgehen, dass die Menschenmehrheitlich das Verfahren der Machtübertragung vom Vorgän-ger auf den von ihm ausgewählten Nachfolger bislang gut gehei-ßen haben. Putin kehrte in das Amt des Ministerpräsidentenzurück, blieb jedoch für viele Russen weiterhin die beherrschen-de politische Figur. Spekulationen, die von einem kommendenMachtkampf zwischen Putin und Medwedew ausgingen, habensich nicht bewahrheitet. Bereits nach vier Jahren verzichtetMedwedew auf den Anspruch einer weiteren Amtszeit als Präsi-dent Russlands zugunsten seines Vorgängers Putin, der trotzeiner landesweiten Protestbewegung 2012 erneut in das Amt desPräsidenten gewählt wurde. Auch hier bemängelten Wahlbe-obachter zahlreiche Manipulationen; doch selbst unter Abzugder vermuteten Wahlfälschungen dürfte dennoch die Mehrheitder Wähler für Putin gestimmt haben. Bereits unter PräsidentMedwedew hatte 2008 die Duma, das Parlament, einer Verfas-sungsänderung zugestimmt, der zufolge künftige Präsidentenjeweils für sechs statt für vier Jahr gewählt werden mit der Mög-lichkeit einer einmaligen Wiederwahl. Damit hat Wladimir Putindas Mandat, bis 2024 zu regieren. Diese Wiederwahl erfolgte2018. Somit wird er 25 Jahre lang, davon 20 Jahre Jahre als russi-scher Präsident, die Geschicke Russlands gelenkt haben.
Diesem neuen Machtverständnis der „gelenkten“ russischerDemokratie ging die von Michail Gorbatschow verantwortetePolitik von Glasnost und Perestrojka voraus. Damit sollte ur-sprünglich der Kommunismus zu einer lebensfähigen Gesell-schaftsordnung entwickelt werden. Doch die Bestandsaufnahmeder Mangelerscheinungen führte zu einer immer sprunghafterenReformpolitik, die letztlich die Unreformierbarkeit der sozialisti-schen Gesellschaftsordnung unter Beweis stellte. Ein Boykottder Parteibürokratie führte schließlich zu einem Putsch gegenGorbatschow und leitet damit das Ende der Sowjetunion ein.Heute ist Gorbatschow im Westen geachtet, in seiner Heimathingegen von vielen vergessen, wenn nicht gar verachtet. Denntrotz aller politischen Aufbruchsstimmung hatten sich die Hoff-nungen auf einen höheren Lebensstandard unter Gorbatschow
11
nicht erfüllt. Gleichwohl war das Tor geöffnet für einen funda-mentalen Wandel in der Geschichte Russlands.
Der vorliegende Sammelband ist keine Gesamtdarstellung al-ler Vorkommnisse aus diesen letzten, aufregenden Lebensjahrender Sowjetunion. Es handelt sich mehrheitlich um Zeitungs- undZeitschriftenbeiträge sowie Radio-Dokumentationen, die wäh-rend dieser Jahre von mir publiziert wurden. Die meisten vonihnen befassen sich mit den innerparteilichen und innenpoliti-schen Veränderungen. Die vielen außenpolitischen AktivitätenGorbatschows, seine zahlreichern Auslandsreisen, seine Gipfel-treffen mit den beiden US-amerikanischen Präsidenten Reaganund Bush, seine Abrüstungsinitiativen sowie seine Deutschland-politik, die – entgegen seiner ursprünglichen Absichten – in derWiedervereinigung beider deutscher Staaten mündete, scheinenin diesem Band nur im innenpolitischen Zusammenhang derSowjetunion auf. Zumindest an dieser Stelle soll darauf hinge-wiesen werden, dass der damalige Außenminister Eduard Sche-wardnadse und einer der Chefdenker der Perestrojka, AlexanderJakowlew, entscheidend Anteil hatten an der Neuorientierungder sowjetischen Position hinsichtlich einer deutschen Vereini-gung.
Im Rückblick wundert man sich, mit welcher Aufmerksam-keit die Welt zu Beginn der Perestrojka scheinbar unbedeutendeVorgänge wahrgenommen hat, die heute bereits vergessen sind.So hat die internationale Presse mit großer Aufmerksamkeit überdie Eröffnung des ersten Privatrestaurants in der KropotkinskajaUliza in Moskau berichtet, während in anderes sozialistischenLändern wie Ungarn oder Polen die Kleinprivatisierung in die-sem Bereich bereits zum Alltag zählte und dort selbstverständ-lich keine Schlagzeilen hervorrief. Vieles ist zur Normalität ge-worden, was damals einem ideologischen Erdbeben gleichkam:so die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte, die Veröffentli-chung verbotener Filme und Bücher wie auch der unbeholfeneVersuch, die kommunistische Partei zu demokratisieren. Andereswiederum wie die Nationalitätenkonflikte und deren Auswirkungauf die Stabilität des Staates bleiben von wiederkehrender Aktua-lität. Das letzte Drittel der Perestrojka war von weitreichenden
12
Widersprüchen geprägt. Zunächst beherrschte der Konflikt zwi-schen Jelzin und Gorbatschow die öffentliche Meinung wie auchden Kampf um die Machtverteilung.
Eine weitere Front erwuchs für Gorbatschow aus dem nach-haltigen Widerstand zahlreicher „konservativer“ Parteigenossen.Schließlich sah sich Gorbatschow von Unabhängigkeitsbewe-gungen in nahezu allen Teilrepubliken konfrontiert, die er geradeerst mit einem neuen Unionsvertrag für eine gemeinsame Zu-kunft gewinnen wollte.
Es ist erstaunlich, dass Gorbatschow dennoch in dieser Phaseentscheidende Reformen vorantrieb, die staatsrechtlich für seinLand eine ungeheure Veränderung bedeuteten, vom Westenjedoch eher als Selbstverständlichkeit wahrgenommen oder gar„eingefordert“ wurden. Dazu zählten – innerhalb nur wenigerWoche von Sommer bis Herbst 1990 – die Einführung der ge-setzlich verankerten Pressefreiheit und der allgemeinen Religi-onsfreiheit, die Rehabilitierung von Millionen Stalin-Opfer, dieAnnullierung der Ausbürgerung von Intellektuellen, die Einfüh-rung der Marktwirtschaft und des Parteienpluralismus.
Die gesamten Reformleistungen, die letztlich auf eine Über-windung des Ost-West-Konfliktes hinausliefen, wurden 1990durch die Verleihung des Friedensnobelpreises an Michail Gor-batschow gewürdigt. Doch genau auf diesem Höhepunkt warnteAußenminister Schewardnadse vor einem drohenden Putsch; ertrat von seinem Amt zurück und verließ ein halbes Jahr späterdie Kommunistische Partei. Diesem Schritt folgte kurz daraufauch Alexander Jakowlew, einer der wichtigsten Perestrojka-Strategen. Anlass dafür war vermutlich der Positionswandel vonGorbatschow, der sich in der Bekämpfung der Unabhängigkeits-bewegungen in den baltischen Staaten wie im Kaukasus auf dieSeite des Militärs gestellt hatte mit dem Versuch, diese Bewegun-gen blutig, aber erfolglos zu unterdrücken.
In diesem Auflösungsprozess, der auch von Streikbewegun-gen der Arbeiter begleitet wurde, setzte Gorbatschow immerrigoroser seine Präsidialdekrete ein, um seine Ordnungsvorstel-lungen durchzusetzen. Den konservativen Parteikräften war auchdies noch zu wenig. Mit einem eher operettenhaften Putsch
13
versuchten sie, Gorbatschow von der Macht zu verdrängen unddas Rad zurückzudrehen. Im Rückblick muss man noch einmaldaran erinnern, dass auch Boris Jelzin damals von den Putschis-ten verhaftet werden sollte. Der kämpferische Jelzin zog dieArmee auf seine Seite, widersetzte sich erfolgreich den Putschis-ten und konnte Gorbatschow aus dessen Hausarrest befreien.Doch auf der Straße skandierten damals die Menschen nichtmehr den Namen Gorbatschows, sondern den seines Gegenspie-lers Jelzin, der dann die eigentliche Entmachtung von Gor-batschow und das staatsrechtliche Ende der Sowjetunion betrieb.
Die Beiträge in diesem Band sind aus verschiedenen Anlässengeschrieben worden. Sie spiegeln den jeweiligen Entwicklungs-stand der Ereignisse wieder. Sie sind das Ergebnis journalisti-scher Tagesarbeit. Man kann also von einem zeitgeschichtlichenLesebuch sprechen, das auf keinen Fall die quellenkritische Auf-arbeitung der Historiker ersetzt, die inzwischen auf eine reicheMemoirenliteratur der Zeitzeugen von Glasnost und Perestrojkawie auch auf manches Archivmaterial aus dem Politbüro derKPdSU zurückgreifen können. Gerade die aktuelle Berichterstat-tung setzt inhaltlichen Wiederholungen voraus, wie sie sich inden hier veröffentlichten Beiträgen zuweilen widerspiegeln; dennder Journalist ist angehalten, bei immer neu entstehenden Zu-sammenhängen wie auch bei fortschreibender, ereignisbegleiten-der Berichterstattung auf die jüngste Vergangenheit in seinemBerichtsgebiet zurückzugreifen. Nur so kann er in der Kürze derZeit für den Hörer und Leser eine Einordnung dessen ermögli-chen, worüber gerade aktuell berichtet wird.
Dies gilt vor allem für die Darstellungen im Bereich der kul-turellen Veränderungen und der nationalen Frage, die in immerneuen Zusammenhängen, aber meist mit ähnlichem Ausgangs-punkt für die Rückbesinnung auf eine postsowjetische Identitätvor allem Russland von entscheidender Bedeutung waren. Fürden Leser dieses Sammelbandes erscheinen solche Wiederholun-gen im Einzelfall unentbehrlich, um den Charakter der in sichgeschlossenen Beiträge nicht zu verfälschen. Schließlich kannman den vorliegenden Band ebenso linear wie selektiv nutzen.Zur besseren Orientierung ist bei jedem Beitrag ein kommentier-
14
ter Quellennachweis als Fußnote beigefügt. Mit dieser Hilfe kannder Leser die Relevanz der jeweils geschilderten Tatbeständeeinordnen.
Bei der deutschen Schreibweise der russischen Namen wirddie allgemein verständliche Form der lautlichen Übertragungangewandt und nicht die wissenschaftliche Transkription. AlsoTschernenko statt �ernenko (russ. ��������) oder Breschnew stattBre�nev oder Breshnev (russ. ��e����). Bei den Vornamen wirddie volle Lautform angegeben, also Jurij (russ. ����) statt – wieoft vereinfacht – Juri.
Abweichungen gibt es bei der Schreibung des Namens Gor-batschow (russ. ��������; in wissenschaftlicher TransliterationGorba��v), der von der Neuen Zürcher Zeitung Gorbatschew undim Englischen Gorbachev geschrieben wird.
Im Text ist gleichbedeutend von Sowjetunion, Union der Sozialis-tischen Sowjetrepubliken oder der UdSSR (russ. CCCP) die Rede. InAnlehnung an den deutschen Sprachgebrauch verwende ich denBegriff Russische Förderation statt der wörtlichen ÜbersetzungRussländische Föderation (russ. ���������� ���������). Im Russi-schen unterscheidet man dagegen zwischen der national-ethnischen (������� – russisch) und der staatsrechtlichen (����������– russländisch) Bezeichnung. Dieser Unterschied ist staatsrechtlichvon Belang, weil Russland auch heute noch als größter Flächen-staat der Welt mit über 17 Mio. qkm und über 145 Mio. Ein-wohner nahezu einhundert verschiedene Völker und Völker-schaften beherbergt, unter denen die Russen knapp 80 Prozentder Bevölkerung stellen. [...]
München/Roaring Branch, Vt., 2012
15
VORWORTZUR TASCHENBUCHAUSGABE
Die Taschenbuchausgabe wurde um drei Beträge gekürzt, dieim Rückblick keine entscheidende Bedeutung für den histori-schen Prozess der Perestrojka unter Gorbatschow haben. Eshandelte sich dabei thematisch um den Sonderfall Mongolei1, umdie außenpolitischen Konsequenzen des Zerfalls der Sowjetuni-on im Bereich der ehemaligen Verbündeten2 und um eine ersteaußenpolitische Bestandsaufnahme der russischen Außenpolitikunter Putin3. Ferner wurde der Untertitel der Taschenbuchaus-gabe umgestellt, der in der Erstausgabe lautete: Die letzten Jahre derSowjetunion unter Michail Gorbatschow. Durch die inzwischen langeRegierungszeit von Vladimir Putin als Präsident, Ministerpräsi-dent und dann wieder als Präsident der Russländischen Föderati-on wurde eine ursprüngliche Einschätzung überholt. Sie gingnoch von einem kooperativen Pragmatismus der russischenAußenpolitik unter Putin bei gleichzeitiger ideologischer Ab-schottung aus. Die Turbulenzen und Verhärtungen im Verhältniszwischen Russland und dem Westen, die Ukraine-Krise, derAnschluss der Krim an die Russländische Föderation, der Kriegin der Ostukraine und die beiderseitige Sanktionspolitik waren zudieser Zeit noch nicht abzusehen. Auch die innenpolitischenDeterminanten der russischen Politik haben sich unter Putingewandelt. Die gelenkte Demokratie hat sich noch weiter wegentwickelt von der pluralistischen, marktwirtschaftlichen Demo-kratie westlicher Prägung. Der Entmachtung und Disziplinierungder Oligarchen durch Putin, die unter Jelzin das Land ausge-
1 Die Mongolei zwischen nationaler Identität und sowjetischem Vorbild.Ein politischer Reisebericht. In: Osteuropa 2-3, 1989, 253-259.2 Katastrophe oder Chance? Die wirtschaftliche und politische ZukunftOsteuropas und der früheren Sowjetunion. Verband der Baden-Württembergischen Textilindustrie. Stuttgart 19923 Von der Konfrontation zur Kooperation. Der Wandel der russischenAußenpolitik unter Putin. Vortrag am Institut für Politikwissenschaften derUniversität Regensburg [11. Dezember] 2001
16
plündert hatten, ist eine Art neuer staatlich gelenkter Kapitalis-mus gefolgt, flankiert von einer Zurückdrängung des Medienplu-ralismus, der sich nur noch in wenigen Nischen behaupten kann.Dies alles zu bewerten, haben sich bereits genügend neue Auto-ren und Fachleute gefunden.
So bleibt dieses Buch eine zeitgenössische, wenn auch selek-tive Bestandsaufnahme im Stil eines historischen Lesebuchs derGorbatschow-Zeit. Zur Ergänzung findet sich im Anhang einLiteraturverzeichnis mit Titeln, die von Michail S. Gorbatschowauf deutscher Sprache erschienen und damit für deutschsprachi-ge Leser als Originalquellen leicht zugänglich sind. Darunterbefinden sich seine Reden und Aufsätze aus seiner Amtszeit alsGeneralsekretär der KPdSU, als Präsident der Sowjetunion undauch seine spätere Memoirenliteratur. Viele seiner Rückerinne-rungen werden von seinen politischen Weggefährten ergänzt,reflektiert, aber auch konterkariert. Einige dieser Titel, die eben-falls in deutscher Sprache erschienen sind, werden hier als Er-gänzung zur Darstellung der Gorbatschow-Zeit angeführt.4
4 Agangbegjan, Abel [Wirtschaftsberater von Gorbatschow]: Ökonomie undPerestrojka. Gorbatschows Wirtschaftsstrategie. Hoffmann und Campe:Hamburg 1989.Falin, Valentin [Mitglied des Zentralkomitees, Leiter der Internationalen Abteilung]:Konflikte im Kreml. Zur Vorgeschichte der Einheit und Auflösung derSowjetunion. Blessing: München 1997.Jakowlew, Alexander [Mitglied des Politbüros, ‚Architekt’ der Perestrojka]: DieAbgründe meines Jahrhunderts. Faber&Faber: Leipzig 2003.Jelzin, Boris [Mitglied des Politbüros, Rivale von Gorbatschow]: Aufzeichnungeneines Unbequemen. Droemer Knaur: München 1990.Ligatschow, Jegor [Mitglied des Politbüros, Reformgegner]: Wer verriet die Sow-jetunion. Das neue Berlin: Berlin 2012.Ryschkow, Nikolai [Vorsitzender des Ministerrates]: Mein Chef Gorbatschow.Die wahre Geschichte eines Untergangs. Das neue Berlin: Berlin 2013.Saslawskaja, Tatjana [Reformorientierte Wirtschaftswissenschaftlerin]: Die Gor-batschow-Strategie. Wirtschafts- und Sozialpolitik der UdSSR. Orac: Wien1989.Schwardnadse, Eduard [Außenminister]: Die Zukunft gehört der Freiheit.Rowohlt: Reinbeck 1991.
17
PERESTROJKA AUS ERSTER HANDErlebnisse im Alltag eines Auslandskorrespondenten5
Als ich im Sommer 1983 als junger Korrespondent nachMoskau kam, lebte die Sowjetunion in trotziger Abschottunggegenüber dem Westen. Mein späterer Freund Sascha schriebromantische Lieder, die er zur Gitarre sang, Lieder, die ein Landschilderten, das von unendlichem Schnee bedeckt ist, Menschen,die in diesem Schnee unentrinnbar gefangen sind. Zaghaft klangder Wunsch nach Veränderungen durch. Alles war noch system-konform. Im Kreml regierte Parteichef Andropow, von schwererKrankheit gezeichnet. Da passierte ein unglaublicher Zwischen-fall, der mein Verhältnis zur Informationspolitik des Regimesnachhaltig prägte. Sowjetische Jagdflugzeuge schossen ein südko-reanisches Linienflugzeug ab, das sich - aus bis heute ungeklärtenGründen - in den sowjetischen Luftkorridor verirrt hatte. 269Menschen starben. Tagelang schwieg der Kreml. TASS wieder-holte stets dieselbe Meldung: Ein Flugzeug fremder Herkunft seiin den sowjetischen Luftraum eingedrungen und dann RichtungJapanisches Meer entschwunden. Unter internationalem Druckmusste Moskau knapp eine Woche später den Abschuss derLinienmaschine eingestehen.
Die absurde Krönung der sowjetischen Informationspolitiklieferte dann der damalige Sprecher des Außenministeriums,Leonid Samjatin, auf einer internationalen Pressekonferenz. Einwestlicher Korrespondent stellte die Frage, warum die sowjeti-sche Führung sechs Tage lang habe Lügen verbreiten lassen,bevor sie die Wahrheit eingestand. Der Regierungssprecher ver-
5 Gesamtüberblick über meine Jahre in Moskau, beginnend mit einer neuenTauwetterperiode unter Andropow, dem Förderer von Michail Gor-batschow; diese Phase wurde durch das kurze Interregnum von Tschernen-ko unterbrochen, bevor Gorbatschow mit seinen Reformen beginnenkonnte, von denen jedoch die alten Partei- und Gesellschaftsstrukturenüberfordert waren. Erstveröffentlichung: Perestrojka in der Sowjetunion.In: gehört-gelesen 3,1997, 42-49. Nachdruck in: G. Friedl (Hg.), Begegnun-gen mit der Zeitgeschichte. Olzog 1997, S. 194-211.
18
fiel einem regelrechten Wutausbruch und schrie zornentbrannt:„Wir haben in dieser Sache nie gelogen. Wenn Sie das behaup-ten, dann verstehen Sie unsere Sprache nicht, vor allem nichtunsere politische Sprache. Was wollen Sie dann überhaupt inunserem Land?“ Ja, was wollte ich eigentlich in diesem Land, indem die Informationspolitik aus dem Verschweigen der Wahr-heit und dem Suggerieren der Unwahrheit bestand? Staats- undParteichef Jurij Andropow hatte nur noch wenige Monate zuleben. Ansätze einer Reformdiskussion, die von ihm stammten,verschwanden schnell in den Schubladen. Dann folgte der eben-falls schwerkranke Konstantin Tschernenko. Ein grausamesSpiel begann: Maskenhaft geschminkt wurde Tschernenko vordie Kamera geschleppt. Er sollte die Stärke des Regimes de-monstrieren. Doch inzwischen wusste jeder: Es tobt ein Macht-kampf im Kreml. Informanten und Zuträger aus allen Richtun-gen versuchten, die ausländischen Korrespondenten zu instru-mentalisieren, für und gegen die Reformer, die nun immer stär-ker ihre Stimme erhoben.
Ein Erlebnis im Stadtpark von Riga: im Freien, also abhörsi-cher, diskutierte ich mit einem Vertreter des Moskauer Außen-ministeriums, der mich pflichtgemäß auf der Reise nach Lettlandbegleitete. Nach russischer Sitte waren wir schnell per Du. „Han-nes, ich sage Dir, wir brauchen mehr Demokratie“, platzte esplötzlich aus meinem sowjetischen Begleiter heraus. „Nicht nurTschernenko ist krank. Seine Amtszeit ist eine Krankheit unseresSystems.“ Provokation oder echtes Anliegen? Ich blieb vorsich-tig. Doch dann entwickelte mein Begleiter ein Szenario, das ausdem Handbuch für Glasnost und Perestrojka hätte stammenkönnen. „Keine Demokratie wie Du Dir das vorstellst, nicht mitmehreren Parteien. Wir müssen erst einmal innerhalb der KPaufräumen, die meisten Genossen wissen doch nicht, was einefreie Meinung ist!“ Mein sowjetischer Begleiter von damals sollteRecht behalten. Er entpuppte sich als Anhänger von Reformen.Heute ist er ein wichtiger russischer Diplomat, der weiterhinnach Wegen sucht, um Russland in Richtung Demokratie zubringen. Unser Kontakt ist über alle politischen Umbrüche hin-weg erhalten geblieben.
19
Dann kam der 13. März 1985. Die Luft schien gefroren.Doch trotz eisiger Kälte hatten Hunderte von neugierigen Kor-respondenten und Diplomaten mühselige Kontrollen von Polizeiund Armee über sich ergehen lassen, um einer Totenfeier beizu-wohnen, die den Machtwechsel im Kreml einleitete. Da stand ernun auf dem Leninmausoleum, der neue starke Mann der Sow-jetunion, Michail Gorbatschow. Vor ihm auf dem Roten Platzruhte der offene Sarg mit seinem verstorbenen Vorgänger Kon-stantin Tschernenko. Nur mit wenigen Sätzen betrauerte Gor-batschow den Tod von Tschernenko. Was dann folgte, warenmassive Verstöße gegen das Protokoll der kommunistischenRituale, ein Schock für die Nomenklatura. Gorbatschow wettertein seiner ersten öffentlichen Rede als Generalsekretär plötzlichüber die verlogene, heuchlerische Gesellschaft im Land. Erschwang die Peitsche weitreichender Drohungen: Lügner müssenbestraft und Nichtstuer zur Arbeit angehalten werden. Glasnostund Perestrojka deuteten sich an. So etwas hatte die Welt bei derBeerdigung eines sowjetischen Parteichefs noch nicht zu hörenbekommen. Dies war ein Vorgeschmack auf die Ungeduld, mitder Gorbatschow sein Land zu Reformen drängte.
Der neue Stil brachte noch eine weitere Überraschung. Gor-batschow verweigerte dem Sarg von Tschernenko die letzte Eh-re, wie sie seit Lenins Zeiten üblich war. Nicht mehr die Mitglie-der des Politbüros, sondern nur noch Offiziere der Armee tru-gen den Sarg zur Kremlmauer. Dazwischen lag eine Beobach-tung, die man als junger Korrespondent nicht mehr vergisst: DieWitwe von Tschernenko stürzte sich tränenüberströmt auf denoffenen Sarg und schlug mehrfach das Kreuz über den Toten,der bis zuletzt im Namen der Partei den Atheismus zu propagie-ren hatte. Der Benjamin des Politbüros, Michail Gorbatschow,war mit seinem ersten großen Auftritt für die meisten Sowjet-bürger eine Entdeckung. Urteile über ihn: „Der Mann kann freisprechen. Er muss nicht jeden Satz ablesen. Er sagt offensicht-lich, was er denkt.“
Der Kreml öffnete sich auch für Vertreter aus dem Westen.Unter den vielen durchreisenden Politikern sind mir die Reaktio-nen von zwei Personen deshalb in lebhafter Erinnerung geblie-
20
ben, weil sie niemals im Verdacht standen, mit den kommunisti-schen Herren im Kreml geliebäugelt zu haben. Die britischePremierministerin Margaret Thatcher und der bayerische Minis-terpräsident Franz-Josef Strauß. Frau Thatcher wurde in dersowjetischen Presse gerne mit einem feindlichen Panzerkreuzerverglichen. Sie kam als Klassengegner und verließ Moskau alsSiegerin nach Punkten. Dazwischen lag eine der überraschends-ten Annäherungen am Ende des Kalten Krieges. Bei der Presse-konferenz mit Margaret Thatcher in Moskau schien es zum Eklatzu kommen. Im Presseamt des sowjetischen Außenministersversagten für Frau Thatcher alle Mikrophone und die gesamteVerstärkeranlage. Fast zweihundert neugierige Journalisten feix-ten, wie sich die Dame wohl Gehör verschaffen werde. Sieschaffte es. Frau Thatcher bog alle Mikrophone zur Seite undzelebrierte ihren Stil aus dem britischen Unterhaus: „Wenn ichmeine Stimme erhebe, wer kann mich hören?“, rief sie den la-chenden Journalisten zu. Dann folgte ihr stimmgewaltigesStatement, das viele Skeptiker überraschte: „Dies war die faszi-nierendste und anregendste Reise, die ich jemals als Premiermi-nister im Ausland unternommen habe“, bekannte Frau Thatcherund schilderte Einzelheiten aus einem siebenstündigen Streitge-spräch mit Michail Gorbatschow. Man war sich - natürlich - inallen entscheidenden Fragen uneins. Größter Streitpunkt war dieRüstungskontrolle. Dennoch blieb es bei ihrer euphorischenEinschätzung: „Ich sagte, er sei jemand, mit dem ich gut insGeschäft kommen könnte. Wir haben hier nun eine Menge Bu-siness erledigt.“ Das inoffizielle Bild des Thatcher-Besucheslieferten mir russische Freunde. Die britische Premierministerinhatte sich im sowjetischen Fernsehen einer Debatte mit russi-schen Journalisten gestellt. Auf erste kritische Nachfragen überArbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit in Großbritanniendrehte die streitbare Politikerin den Spieß um. Sie bombardiertedie russischen Journalisten mit Fakten über sowjetische Men-schenrechtsverletzungen, wirtschaftliche Missstände und militäri-sches Drohpotential. Die Herren schwiegen betreten. Der Dol-metscher konnte bei dem Redefluss von Frau Thatcher kaummithalten. Noch am Abend riefen mich sowjetische Freunde an:
21
„Wot, ona maladjetz!“ - „Was für ein toller Kerl! Die sollte beiuns Generalsekretär werden.“ Nicht weniger spektakulär war derÜberraschungsbesuch von Franz-Josef Strauß in Moskau. Kurznach Weihnachten 1987 steuerte er eigenhändig sein FlugzeugRichtung Osten. Der denkwürdige Telefonbericht jenes Besu-ches mit den überraschenden Reaktionen von Franz-Josef Straußbefindet sich heute im Rundfunkarchiv. Strauß bekannte, unmit-telbar nachdem er den Kreml verlassen hatte: „Ich habe so et-was nicht erwartet und auch so etwas mir für Russland, für denFührer der Sowjetunion nicht so ohne weiteres als möglich vor-gestellt. Gorbatschow war ungezwungen, sehr, sehr selbstbe-wusst, sehr selbstsicher, ohne überheblich zu sein. Das Gesprächverlief ohne jede aggressive Formulierung, ohne jede Zuspitzung,auch mit deutlicher Betonung der Meinungsunterschiede, aberich muss sagen - ohne dass ich sehr sentimental, pathetisch be-einflussbar bin - dass ich mit den angenehmsten Gefühlen, indem Bewusstsein, dass man sich nicht zu viel erwarten darf,weggegangen bin.“ Strauß war beeindruckt, wie klar und realis-tisch Gorbatschow die Ziele der Perestrojka definiert hat, dieallerdings einen langjährigen Entwicklungsprozess voraussetzen.Die alten Zielsetzungen der Sowjetideologie im militärischen undpolitischen Bereich unterlagen einem Wandlungsprozess, derStrauß zu der Schlussfolgerung veranlasste: „Hier kann ich -ohne dass ich mich selber zu vergewaltigen brauche - sagen, dassHerr Gorbatschow so viele innere Probleme hat in der Sowjet-union selber und bei den Verbündeten der Sowjetunion, dass aufeine heute nicht absehbare Zeit hinaus an irgendeine militärischeKonfrontation meines Erachtens nicht gedacht werden kann.Und wenn die alten sowjetischen Zielsetzungen wegfallen, dannstehen wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters.“ Nach heuti-gem Standard würde man über die Tonqualität unserer Rund-funkberichte aus dem Jahr 1987 eher die Nase rümpfen. Inzwi-schen klingt alles voller, glatter, brillanter. Wir hätten damalsauch gerne für einen besseren Ton aus Moskau gesorgt, wennnicht trotz Glasnost und Perestrojka so viele Blockaden die Ar-beit der Ausländer eingeschränkt hätten. Zu diesen Einschrän-kungen gehörte das Telefonieren. Die Qualität unserer Leitungen
22
war oft jämmerlich. Um überhaupt in das Ausland telefonierenzu können, mussten wir eine besondere Nummer bei der Ver-mittlung anrufen. Als Korrespondenten wurden wir bevorzugtbehandelt - mit einer Wartezeit von 20 bis 30 Minuten. Die War-tezeit für Privatgespräche konnte dagegen Stunden dauern. ImLaufe der Jahre wurde dank Glasnost und dank technischer Hilfedie Wartezeit reduziert, bis endlich für viel Geld eine freieDurchwahl in das Ausland möglich war.
Weniger flexibel zeigte sich die Sowjetmacht nach innen. DieReisen von Ausländern, die außerhalb des Stadtringes von Mos-kau führten, mussten sogar bis zum Ende der Gorbatschow-Zeitzwei Werktage im voraus registriert und genehmigt werden.Sowjetbürger durften in einem ausländischen Wagen nicht mit-fahren. Ich habe mich nicht darangehalten und wurde prompterwischt. Meine Freunde wurden bestraft, ich erhielt eine Ver-warnung vom Außenministerium. Überdies hatte ich mit demAuto die Stadtgrenze überschritten und war in einem Vorortgelandet, der für Ausländer auf das strengste verboten war. Nochheute verfüge ich über die bis 1989 gültige Liste von Straßen,Brücken und Ortschaften im Bezirk Moskau, die namentlich fürAusländer gesperrt blieben. Tabus nach innen wurden zwar aufdem Papier der Tagespresse schnell infrage gestellt. Bei der Um-setzung im Alltag haperte es jedoch gewaltig. Reform und Kon-trolle - so wollten es viele Kader - sollten Hand in Hand gehen.
Szenenwechsel: eine Sporthalle am Stadtrand von Moskau.Im Inneren toben tausend Jugendliche. Sie haben eine Sportver-anstaltung zu einem verbotenen Rockkonzert umgemünzt. DieMiliz will eingreifen. Erstmals erlebte ich den Aufstand der Ju-gend gegen die Staatsgewalt. Und erstmals erlebte ich, wie dieMiliz nachgab. Auf der Bühne spielte die Rockband DDT, offi-ziell mit Auftrittsverbot belegt. Ein Freund hatte mich hierher-gebracht. Unter dem Mantel hielt ich ein Mikrophon versteckt.Eine akustische Orgie von Protest und Befreiung brach los.Spott und Hohn schüttete der Sänger über den Kommunismusaus. Die Fans waren nicht zu bremsen. Jahre später produziertedieselbe Rockgruppe dieselben Lieder auf CD. Aber trotzschlechter Qualität ist mir die authentische Aufnahme aus dem
23
Untergrund lieber. Bald jedoch drangen die Proteste aus demUntergrund an die Oberfläche des Landes. Der Rote Platz, jahr-zehntelang von KGB-Wachen rund um die Uhr kontrolliert,wurde zum Gegenstand einer der bis dahin größten Massende-monstrationen. Krimtataren, die unter Stalin wegen angeblicherKollaboration mit den Deutschen deportiert worden waren,kämpften für die Rückkehr in die Heimat. Ihre Hoffnung hießGorbatschow. Er hatte verkündet, die weißen Flecken in derGeschichte der Sowjetunion sollten ausgelöscht werden. DieVerbrechen der Stalin-Zeit würden aufgearbeitet. Zu UnrechtVerfolgte sollten rehabilitiert werden.
Eine Zerreißprobe zwischen der staatlichen Macht und denDemonstranten zeichnete sich ab. Noch wenige Jahre zuvorhatte ich miterleben müssen, wie eine kleine Gruppe von Russ-landdeutschen auf dem Roten Platz ein Bettlaken ausbreitete mitder Aufschrift „SOS - Wir wollen in unser Vaterland“. Nur Se-kunden später sprangen Passanten herbei, die sich als KGB-Schläger entpuppten. Sie prügelten die Russlanddeutschen zu-sammen, ein grauer Milizwagen raste über den Platz, die De-monstranten wurden hineingestoßen und abtransportiert. Nunwar alles anders: Erst achthundert, dann tausend, dann immermehr Krimtataren hielten Tag und Nacht den Roten Platz be-setzt, ohne dass die Miliz oder die KGB-Leute aktiv wurden. DieDemonstranten verlangten nach Gorbatschow. Mit einer schwe-dischen Rundfunkkollegin stand ich in einem Kessel von disku-tierenden Menschen, um Interviews aufzunehmen. In diesemMoment wollte die Miliz eingreifen. Als ausländischen Korres-pondenten war es uns verboten, an Demonstrationen teilzuneh-men, geschweige denn, Anlass für Demonstrationen zu sein.Plötzlich riefen die Krimtataren sich einander zu: „saditjess,saditjess“, „setzt euch“. Mit ihren Körpern bildeten sie einenSchutzwall um uns Journalisten, während wir verblüfft in derMitte stehen blieben. Zur eigenen Ablenkung habe ich in diesemMoment begonnen, die angespannte Situation auf Band zu spre-chen:
„Jetzt setzen sich alle Leute vor uns auf den Boden als Pro-testdemonstration, weil die Polizei uns hindern will, die Auf-
24
nahmen durchzuführen, und weil die Polizei entgegen den gel-tenden Regeln die akkreditierten Korrespondenten hier an derArbeit hindern will. Ich darf die Leute nicht ansprechen, umnicht in den Vorwurf zu kommen, dass ich hier einen öffentli-chen Aufruhr mache. Deshalb halte ich mich zurück und be-obachte nur die Leute, die uns mit großen, braunen Augen an-starren: Vor mir sitzen viele Frauen, Männer. Sie hocken auf demBoden. Ich habe so etwas in Moskau noch nie erlebt. Die Milizallerdings greift nicht weiter ein. Sie hält sich im Moment nochzurück. Sie versucht, mit beschwichtigenden Worten uns zurück-zuziehen. Sie sagen immer wieder ´Entschuldigen Sie´. Wir fol-gen jetzt dem Milizionär zunächst zur Seite...“
Erstmals spürte ich - geschützt von den auf der Erde ho-ckenden Menschen - eine Solidarität, wie ich sie als Korrespon-dent in der Sowjetunion bis dahin nie kennen gelernt hatte.Dann bestürmten mich die Krimtataren, warum ich der Milizfolge und wegginge. Ich erklärte ihnen auf Russisch, dass ichjetzt nicht mehr mit ihnen sprechen dürfe, es sei denn, sie, dieKrimtataren wollten von sich aus mit mir weiterreden und Fra-gen an mich richten. Das dürfe aber nicht hier am Ort der De-monstration stattfinden. Ich ging weiter - und Dutzende vonMenschen folgten mir. Die Aufweichung der starren Staatsgewaltwurde immer deutlicher. Die Miliz war verunsichert. Die Politikvon Gorbatschow hatte dazu geführt, dass die alten Werte derkommunistischen Ordnung zerbrachen. Doch etwas Neuesschien noch nicht nachzuwachsen. Diesen Zwiespalt bekamen alljene deutlich zu spüren, die von Gorbatschow mehr erwartetenals nur das Signal zu einer kritischen Auseinandersetzung mitVergangenheit und Gegenwart der Sowjetunion. Bestes Beispieldafür war das Schicksal von Andrej Sacharow, Bürgerrechtlerund Friedensnobelpreisträger. Kurz nach dem Einmarsch dersowjetischen Armee in Afghanistan war Sacharow im Januar1980 nach öffentlichen Protesten auf der Straße verhaftet undohne Gerichtsurteil nach Gorki verbannt worden. Wann immerwestliche Journalisten nach Sacharow fragten, wurden sie mitkaltschnäuzigen Lügen abgewiesen, bis im Winter 1986 das Ge-rücht verbreitet wurde, Gorbatschow wolle Sacharow aus der
25
Verbannung nach Moskau zurückholen.Das alte Spiel im Grenzbereich zwischen Information und
Desinformation funktionierte noch. Am 22. Dezember 1986erhielt ich spät abends - wie andere Korrespondenten auch – zuHause einen anonymen Anruf. Der Nachtzug aus Gorki werdeeine Überraschung nach Moskau bringen, hieß es. Mehr nicht,kein Hinweis, worum es sich handelte, keine Uhrzeit wurde ge-nannt. Aber mir war klar, es bestand die Chance, dass es sich umdie Rückkehr von Sacharow handeln könnte. Gegen fünf Uhrmorgens war ich bereits am Jaroslawer Bahnhof. Der Zug solltemehr als eine Stunde später eintreffen. Auf dem äußersten Gleisentdeckte ich den russischen Maler Boris Birger, der zum Freun-deskreis von Sacharow gehörte. In der Nähe warteten zahlreicheHerren in auffällig uniformer Zivilkleidung. Als der Nachtzugaus Gorki einfuhr, stand ich unmittelbar neben Boris Birger, deroffensichtlich genauer informiert war. Denn direkt vor uns öff-nete sich die Waggontür, und heraus drängte die kämpferischeEhefrau von Andrej Sacharow: „Es geht nicht um mich. Es gehtum Andrej Dmitrijewitsch“, beschwichtige Jelena Bonner dieMenschentraube der meist ausländischen Journalisten. Dannerschien Sacharow in der Waggontür - und blieb unmittelbarneben mir stehen. Ich war in diesem Moment innerlich mindes-tens so erregt, wie Sacharow selbst bei seinen ersten Worten.Alle Kollegen bestürmten den Bürgerrechtler mit Fragen, die ergeduldig beantwortete: Nein, eine Ausreise aus der Sowjetunionwerde er nicht beantragen. Er wolle wieder wissenschaftlicharbeiten. Zur Politik könne er wenig sagen. Die letzten siebenMonate habe er nur ein einziges Mal mit einem anderen Men-schen auf der Straße ein paar Worte wechseln können. Sonstseien er und seine Frau total isoliert gewesen. Das Ende derVerbannung sei für ihn überraschend gekommen. Sieben Jahrelang besaß er kein Telefon. Plötzlich hätten Techniker ihm einenApparat installiert, an dem sich kurz darauf Gorbatschow per-sönlich gemeldet habe, um ihm mitzuteilen, er, Sacharow könnenach Moskau zurückkehren. Dann kam der Bürgerrechtler zumThema Afghanistan, Ausgangspunkt für seine Verbannung: Af-ghanistan war für Sacharow die offene Wunde seines Heimatlan-
26
des, das brennendste außenpolitische Problem der Sowjetunion.Der Bürgerrechtler kehrte im Triumph an die Akademie der
Wissenschaften zurück. Politisch engagierte sich Sacharow imVolkskongress, wo er zunächst mit, dann aber gegen Gor-batschow für weitere Reformen kämpfte. Denn bald zeigte sich,dass Sacharow in seinen Demokratievorstellungen weiter ging alsMichail Gorbatschow. Das Leitthema von Sacharow, der Afgha-nistan-Krieg, ließ sich nun nicht länger aus der Öffentlichkeitverdrängen. Der Krieg war zu einem Trauma für die Bevölke-rung geworden. Immer wieder baten mich Freunde um Geldoder westliche Elektronikgeräte, um wichtige Leute im Militär zubestechen. Denn mit Bestechung, so glaubten sie jedenfalls,könnten sie ihre Söhne vor einem Kriegseinsatz in Afghanistanbewahren.
Ich erinnere mich an die bedrückende Geschichte einer gutenBekannten. Sie glaubte, ihr Sohn sei zu einem ungefährlichenAuslandseinsatz, vermutlich in Syrien, abkommandiert worden.Ein Foto aus dem Militärdienst ließ den Einsatzort nicht erken-nen. Im Brief durften die Soldaten über den Aufenthaltsort inden ersten drei Monaten nichts sagen. Dann kam die Todesnach-richt aus Afghanistan, „gestorben bei der Ausübung internatio-naler Pflichterfüllung“. So lautete die Standardformel. Dazuerfolgte eine Geldüberweisung für die Beerdigung. Es war jedochverboten, auf dem Grabstein zu vermerken, dass der junge Sol-dat in Afghanistan gefallen war. Beim Thema Afghanistan ver-suchte das Militär Glasnost, die neue Offenheit, immer wieder zuunterdrücken. Der Afghanistan-Krieg wurde sogar noch weiteridealisiert, obwohl die meisten ahnten, dass dieser Kampf bereitsverloren war:
In dieser Situation erlebte ich eine makabre Feier zum 70.Jahrestag der Sowjetarmee, bei der sogar junge Mädchen denEinsatz ihrer Freundin in Afghanistan bejubelten: „UnsereFreundin Leutnant Waronina dient in Afghanistan. Und wir sindstolz auf sie!“ Ein Dreikäsehoch lobte mit stolzgeschwellterBrust die Sowjetarmee als die stärkste Armee der Welt. Jung undAlt jubilierten gemeinsam, stimmstark, wenn auch musikalischnicht gerade sehr harmonisch. Das Bild des tapferen Sowjetmen-
27
schen, der allen Kriegen trotzt, gehörte zu den letzten Restenvon Selbstbewusstsein, die das zerberstende System seinen Bür-gern bieten konnte. Der „obyknowjennyj sowjetskij tschelow-jek“, der gewöhnliche Sowjetmensch, musste als letzte gemein-same Identität herhalten, nachdem die Ideale des Kommunismuszerbrachen und die nationale Frage sich zum Sprengstoff für denZusammenhalt des riesigen Vielvölkerstaates entwickelte.
Auch Glasnost und Perestrojka konnten nicht an dem My-thos der Oktoberrevolution kratzen. Das martialische Zeremoni-ell der Elitetruppen auf dem Roten Platz fand weiterhin Jahr umJahr statt, begleitet von den heroischen Reportagen im sowjeti-schen Fernsehen. Vor dem Leninmausoleum marschierten alsSymbol sowjetischer Unverwundbarkeit die Truppen der Armee,die Truppen des Innenministeriums, die Grenztruppen desKGB.
Wer den Roten Platz nur von Bildern kennt, wird erstauntsein, wie klein die Fläche in Wirklichkeit ist. Umso bedrückenderwird der ausländische Beobachter auf der Besuchergalerie nebendem Leninmausoleum von Marschmusik und Panzerketten akus-tisch überrollt. Ein Eindruck, der früher sicher gewollt war, umStärke und Abschreckung zu demonstrieren. Doch dann landeteauf eben diesem Roten Platz ein kleines Sportflugzeug mit demdeutschen Piloten Matthias Rust. Er hatte alle Radarkontrollenunterlaufen und wurde von den ersten Moskowitern Schulterklopfend begrüßt. Genau genommen landete er auf der anstei-genden Zufahrtstraße zum Roten Platz, die vom Fluss Moskwazur Basilius-Kathedrale führt. Fast neben dieser Kathedralebrachte er sein Sportflugzeug zum Stehen. Dies erfuhr die Öf-fentlichkeit erst später aus dem Amateurvideo eines britischenTouristen, der den Anflug und die Landung vom benachbartenHotel Rossija aus filmte. Zunächst aber war Katastrophenstim-mung angesagt. Gerüchte machten die Runde. Ein deutscherSpion habe mit seinem Flugzeug eine Bombe über dem Kremldirekt am Roten Platz abwerfen wollen. Was für den Westen wiedas Lausbubenstück eines übermütigen jungen Piloten aussah,war für die Sowjetunion weitaus tragischer. Das Symbol derUnverwundbarkeit, der Rote Platz mit dem Kreml, das Zentrum
28
der Sowjetmacht schlechthin, war beschädigt worden. Baldmussten sich die Sowjetbürger daran gewöhnen, dass auch dieArmee als militärisches Symbol der Unverwundbarkeit ihrenGlanz einzubüßen drohte. Die orthodoxe Kirche kehrte miteinem Requiem für die gefallenen Soldaten in Afghanistan erst-mals wieder in die Öffentlichkeit zurück, ausgestrahlt vom sow-jetischen Fernsehen. Zwei Tabus wurden dabei gebrochen: derAfghanistan-Krieg wurde nach Jahren bemühter Jubelorgien nunzu einem landesweiten Trauerfall erklärt; und die orthodoxeKirche übernahm dabei die Rolle des Trösters in nationaler Not.Kontrastreicher konnte für die Sowjetbürger der Wendepunkt inGorbatschows Afghanistan-Politik kaum eingeleitet werden. Baldhäuften sich in den Zeitungen Reportagen vom Schrecken diesesKrieges. Junge Veteranen klagten Staat und Gesellschaft an.Filmreportagen zeigten, wie der Krieg viele Soldaten in Drogen-abhängige verwandelt hatte. Schließlich bewilligte mir das sowje-tische Außenministerium einen langjährigen Antrag. Ich durfte,zusammen mit einigen Kollegen, in das Kriegsgebiet nach Kabulreisen. In Moskau hatte ich zuvor mehrfach Gelegenheit, dendamals starken Mann Afghanistans, Nadschibullah, zu treffen. Infließendem Russisch erläuterte er den angeblich bevorstehendenSieg seiner Armee. Dann änderte Nadschibullah seinen Namen.Er strich den Hinweis auf Allah, nannte sich nur noch Nadschibund erklärte seine Gegner zu fundamentalistischen Glaubens-kriegern, die auch dem Westen bedrohlich werden könnten. Umdies alles selbst in Augenschein zu nehmen, starteten wir Rich-tung Afghanistan. Doch als wir nach sechs Stunden den Hindu-kusch überquerten, wartete ich vergeblich auf den LandeanflugRichtung Kabul. In unverminderter Höhe glitt die Maschineweiter bis über den Talkessel der afghanischen Hauptstadt.Plötzlich erschienen an beiden Seiten der Bordfenster sowjeti-sche Jagdflieger.
In respektvollem Abstand nebelten sie den Luftraum mit ei-ner Magnesiummischung ein, um Wärme suchende Raketen derMudjaheddin von uns abzulenken. Dann begann der spiralförmi-ge Landeanflug auf Kabul. Der Flugkapitän hatte dabei keinenSpielraum zu verschenken und musste in engsten Kurven die
29
Maschine über dem Talkessel sinken lassen. Wer bis dahin alleAchterbahn-Fahrten gut überstanden hatte, erlebte hier eineneue Herausforderung. Als die Maschine sich noch gut hundert-fünfzig Meter über dem Boden befand und auf die Landebahnzuflog, tauchten Jagdhubschrauber auf. Auf den letzten Meternsicherten sie die Landung ab, indem sie die Randstreifen rechtsund links außerhalb der Landebahn beschossen. Ich konntezunächst nicht entscheiden, ob das alles nur eine gut inszenierteShow war, oder ob die Rebellen tatsächlich schon den Flughafenund den Stadtrand von Kabul kontrollierten. Bald sollte ich dieLage besser verstehen. Zunächst jedoch ging es zum Beten in diegroße Moschee von Kabul. Das heißt, wir Korrespondentenwurden auf eine Balustrade geführt, um in Bild und Ton festzu-halten, was nun die neue Lesart des Krieges war: Auf dem Bodender Moschee hockte die gesamte afghanische Führung auf denKnien, um das Gebet zu verrichten: Nadschib, der jetzt wiederNadschibullah hieß, dann sein Verteidigungsminister sowie wei-tere hohe Militärs, umgeben von Hunderten von Gläubigen. DieGegner der fundamentalistischen Glaubenskrieger waren plötz-lich selbst Glaubenskrieger geworden. Vor der Moschee kam esdann zu jenem Erlebnis, das von der erstaunlichen Wandlungs-fähigkeit des Herrn Nadschibullah zeugte. Wir Korrespondentenstanden bereits im Innenhof der Moschee, als Nadschibullahherauskam. Eine schaulustige Masse bedrängte uns. Ich zücktemein Mikrophon, marschierte direkt auf Nadschibullah zu undsprach ihn auf Russisch an:
„Sdrasdwujtje, towarischtsch Nadschib, wy konjetschnopomnite, ja jawljajuc korrespondentom is Moskwy“ - „HalloGenosse Nadschib, Sie erinnern sich wohl, ich bin Korrespon-dent aus Moskau.“
Doch weiter kam ich schon nicht. Nadschibullah wehrte ve-hement mit beiden Händen ab: „No Russian, English please, Idon‘t speak Russian.” Dann zog mich ein Sicherheitsmann zurSeite und flüsterte mir ins Ohr: „Bloß kein Wort Russisch in derÖffentlichkeit.“ Mehr brauchte ich nicht zu wissen, um zu ver-stehen, auf welch verlorenem Posten die sowjetische Armeeihren Afghanistan-Krieg betrieb. Der nächste Tag, als Nad-
30
schibullah von einer Art Volksversammlung zum neuen Staats-präsidenten gewählt werden sollte, bestärkte meinen Verdacht,dass Kabul militärisch kaum zu halten war. Meine alten Ton-bandaufzeichnungen dokumentieren jenen Tag: „Ich bin vordem Malimah-Pal-Hotel in Kabul, dem ehemaligen Interconti-nental-Hotel. Das Maschinengewehrfeuer kann nicht sehr weitvon uns entfernt sein. Vor mir erstreckt sich ein Berg, etwa sie-benhundert Meter von dem Hotel entfernt. Dort hinter wird wiewild geschossen. Zu meiner Rechten liegt die große Tiefebene, inder auch das Gebäude steht, in der die Volksversammlung heutedie Verfassung verabschieden wird und möglicherweise auch denneuen Staatspräsidenten wählen wird. Seitdem die Volksver-sammlung zusammengetreten ist, haben offensichtlich Mud-jaheddin das Feuer um Kabul herum eröffnet. Man hört leichteArtillerie bis spät in die Nacht hinein und nun seit dem frühenMorgen Maschinengewehrsalven in den Bergen rings um Ka-bul.“
Ich flog nach Moskau zurück und ahnte, dass der sowjetischeAbzug aus Afghanistan nur noch eine Frage der Zeit sein konn-te. Für Gorbatschow allerdings war damit ein großes Problemverbunden. Wie konnte er der sowjetischen Militärführung dieseNiederlage zumuten, ohne sich Feinde zu machen? Gorbatschowhat dieses Problem nie zu lösen vermocht. So konnte der letzteVerteidigungsminister der Sowjetunion, General Jazow, die Nie-derlage des Militärs in Afghanistan nicht verwinden und schlugsich später auf die Seite der Putschisten gegen Gorbatschow.
Doch nicht nur im Militär, auch in der politischen Führungrief Gorbatschow manche Konfrontation hervor. Je länger Gor-batschow im Amt blieb, desto widersprüchlicher wurde seinKurs von Reform und Gegenreform, desto kritischer wurde dieBevölkerung, deren Beschwerden er sich immer wieder auf Rei-sen im Land stellte. Im sibirischen Krasnojarsk schimpften dieLeute über leere Geschäfte und korrupte Parteibosse. Gor-batschow - und mit ihm das sowjetischen Fernsehen waren zurStelle. „So etwas muss geändert werden“, lautete die Standardpa-role von Gorbatschow. Doch der von ihm praktizierten Offen-heit folgte in der Bevölkerung selbst nur selten Eigeninitiative.
31
Die Menschen waren zu sehr daran gewöhnt, dass man ihnennicht nur das Denken, sondern auch das Handeln vorschrieb.Boltatj - schwatzen, plappern, mit dieser Vokabel belegte derVolksmund bald die endlosen Reden, Statements und Auftrittevon Gorbatschow. Auch unter vielen Parteikadern wurden Gor-batschows Reden von der Vertiefung, Erweiterung und demAusbau der Perestrojka, die Schlagworte vom menschlichenFaktor und der Demokratisierung weniger ernst genommen alsvom Ausland. Unter den angepassten oder überzeugten Anhä-ngern von Gorbatschow fiel schon sehr früh ein Mann wegenseiner ungewöhnlich robusten und unverfälschten Sprache auf:Boris Jelzin. Der Parteichef aus Swerdlowsk - heute wieder Jeka-terinburg - wurde von Gorbatschow nach Moskau geholt, umden dortigen Parteisumpf von Protektion und Mafiamethodentrockenzulegen. Die ersten Amtshandlungen brachten dem neu-en Stadtparteichef Jelzin jene Popularität, mit der er später seinenpolitischen Feldzug gegen Gorbatschow gewann. Wenige Tagenach seinem Dienstantritt ließ sich Jelzin früh morgens mit sei-nem Dienstauto in eine der großen Trabantensiedlungen amStadtrand von Moskau fahren. Anschließend versuchte er, mitöffentlichen Verkehrsmitteln sein Büro im Stadtzentrum zuerreichen. Bei den zahlreichen Pannen der stets überfüllten Bus-se und den unglaublichen Warteschlangen, brauchte Jelzin zweiStunden, ehe er in seinem Büro ankam. Seine öffentliche Reakti-on darauf: „Jetzt kann ich verstehen, warum die Leute lieberblaumachen, statt sich auf diese Art zur Arbeit zu quälen.“ Da-mit löste Jelzin Jubel bei der Bevölkerung aus. Er legalisierte denSchwarzhandel in Moskau, errichtete kleine Marktbuden fürprivate Verkäufer und strich Versorgungsprivilegien der No-menklatura. Für Gorbatschow, der eine kämpferische Anti-Alkohol-kampagne vertrat, hatte Jelzin aber einen entscheiden-den Fehler. Boris Jelzin, der populäre Stadtparteichef von Mos-kau, trank mehr als ihm gut tat. Der zweite Fehler Jelzins war - inAugen von Gorbatschow - noch schlimmer. Denn Jelzin kriti-sierte öffentlich den zögerlichen Reformwillen des Generalsekre-tärs - und er kritisierte den zunehmenden Einfluss von RaissaMaximowna Gorbatschowa, der Frau von Michail Gorbatschow,
32
innerhalb der Parteigremien. Die Abrechnung, die Gorbatschowmit Jelzin betrieb, war gnadenlos - und diese Abrechnung ist derSchlüssel für Gorbatschows endgültigen politischen Sturz in derSowjetunion. Im Zentralkomitee musste der damals kranke, mitMedikamenten aufgeputschte Jelzin im Stil der Stalinzeit beken-nen, dass er sich schuldig gemacht habe vor Michail Gor-batschow und vor der ganzen Kommunistischen Partei. Dannverlor Jelzin alle Parteiämter und wurde in das Bauministeriumverbannt. Wer damals mit dem gestürzten Politiker zusammen-traf, konnte dessen tiefe Verbitterung erleben. Aus dem Partei-mann wurde ein Parteirebell. Und er rebellierte mit Unterstüt-zung der Moskauer im März 1989 gegen Gorbatschow. Niemandkonnte ihm mehr seine Auftritte streitig machen. Massen kamenunter freiem Himmel zusammen, um Jelzin zu hören. Bei denersten halbwegs freien Wahlen erhielt er fast 90 Prozent allerStimmen in der sowjetischen Hauptstadt. Die üblichen Verleum-dungskampagnen des KGB gegen den Trunkenbold Jelzin be-wirkten das Gegenteil. „Endlich einer von uns“, sagten die Rus-sen und jubelten mit Jelzin, der sich über seinen Wodkakonsumöffentlich lustig machte. Kurzfristig lebte noch einmal auf, wo-für ich als Korrespondent in der Sowjetunion niemals Verständ-nis hatte: Andere ausländische Kollegen ließen sich von KGB-Halbleitern einspannen, dieses Mal für die Anti-Jelzin Kampag-ne: Der Mann sei schwer krank, hieß es. Er habe nur noch weni-ge Wochen zu leben. Wir sollten ihm nicht soviel Aufmerksam-keit schenken. Wir überforderten ihn mit unseren dauerndenInterviewwünschen. Und letztlich werde Jelzin den Sommer1989 nicht überleben. Dann hätten wir alle auf den falschenPolitiker gesetzt. Was aber wäre damals die richtige Lesart für dieweitere Entwicklung der Sowjetunion gewesen. Gorbatschowhatte ohne Zweifel das System reformieren, aber nicht abschaf-fen wollen. Seine Gegner kamen aus verschiedenen Lagern:
- Die Kommunisten alter Prägung, die keine Reform wollten.Die Militärs, die ihre einstige Größe beschmutzt sahen.
- Die Nationalisten, die den Vielvölkerstaat auflösen wollten.- Die Radikalreformer, die eine politische und wirtschaftliche
Schocktherapie anstrebten.
33
Was für die einen wie ein Wunder an Veränderung wirkte,war den anderen nicht genug und den Dritten wiederum zu vielReform. Über all die Jahre verfolgte ein Mann in Deutschlanddie Perestrojka mit größter innerer Bewegung: Wolfgang Leon-hard. Er war in Moskau aufgewachsen und politisch erzogen, umspäter die DDR mit aufzubauen. Dabei wurde Wolfgang Leon-hard zu einem der prominentesten Dissidenten. Sein Buch „DieRevolution entlässt ihre Kinder“ war eine der ersten Abrechnun-gen mit dem Stalinismus. Die Sowjetunion hatte Leonhard jahr-zehntelang nicht mehr betreten dürfen. Doch endlich war essoweit. Unter Gorbatschow durfte Wolfgang Leonhard, dem ichseit Beginn meiner Zeit als Osteuropakorrespondent viele wich-tige Gespräche verdanke, wieder nach Moskau. Wir trafen unsdamals zufällig in der Kantine vom staatlichen Presseamt undmehr nebenbei nahm ich auf, was dem zurückgekehrten Dissi-denten damals in Moskau durch den Kopf ging. Bemerkungenzum politischen Umbruch ebenso wie zu seiner Person: „Daserste und wichtigste ist, zwischen Glasnost, der öffentlichenTransparenz, der Vergangenheitsbewältigung, der Veränderungdes kulturellen und politischen Klimas auf der einen Seite undPerestrojka, der Umgestaltung des Systems, einer Wirtschaftsre-form, Justizreform, Nationalitätenpolitik und Auflockerung desStaatsapparates zu unterscheiden. Im Bereich der Glasnost hatsich Gewaltiges verändert. Die Tabus wurden Schritt um Schrittgebrochen. Zum ersten Mal berichtet die sowjetische Presse überKorruption, über Bestechung, über Kriminalität, über Drogen-handel, über den Alkoholismus mit genauen Angaben. Das hates noch nie in der sowjetischen Entwicklung gegeben. Bücher,von denen man jahrzehntelang nur träumen konnte, Anna Ach-matowa, Nadjeshda Mandelstam, Pasternaks Dr. Shiwago, dieGedichte von Gumiljow, die seit Jahrzehnten verboten waren,erscheinen heute in Massenauflagen. Und das allerwichtigste istdas Buch von Anatoli Rybakow „Die Kinder vom Arbat“, dieerste Schilderung der großen Säuberung von 1936-1938. In jenenzwei Jahren wurden sieben Millionen Menschen verhaftet, wasmich besonders bewegt hat. Denn das waren ja die Jahre, die ichselbst miterlebt habe. Und ich habe jetzt schon Verhandlungen,
34
dass Auszüge aus meinem Buch „Die Revolution entlässt ihreKinder“ in sowjetischen Zeitschriften erscheinen. Das heißt, imBereich der Vergangenheitsbewältigung, der Pressevielfalt, deroffenen und freien Diskussionen über Mängel und Missstände,über zukünftige Reformen, das alles hat sich sehr weitgehendverändert. Der zweite Bereich, die Perestrojka, vor allem auchdie große Wirtschaftsreform, die Justizreform, die Nationalitä-tenreform, das Mehrkandidaten-System im politischen Bereich,all das sind sehr schwierige Dinge.
Das Reformvorhaben ist notwendig und richtig. Die Ver-wirklichung ist viel schwieriger als man manchmal in der bundes-republikanischen Öffentlichkeit annimmt, schwieriger, weil essowohl Skepsis in Teilen der Bevölkerung gibt als auch einenhinhaltenden Widerstand in den Bürokratien. Glasnost ist schonsehr weit verwirklicht, Perestrojka steht erst in den Anfängen.Kritisch würde ich vermerken, dass sich die Versorgungslage derBevölkerung bedauerlicherweise nicht verbessert hat, sondern imGegenteil noch ernster geworden ist. Und meine sowjetischenGesprächspartner haben das ganz offen ausgesprochen unddamit die Überlegung verknüpft, dass wenn es nicht gelingensollte, in zwei bis drei Jahren die Versorgungslage der Bevölke-rung entscheidend zu verbessern, dass dann eine größere Skepsisin größeren Teilen der Bevölkerung sich ausdehnen wird.“
Die wirtschaftliche Lage hat sich für die Bevölkerung durchdie Gorbatschow-Reformen nicht verbessert. Die nationalenWidersprüche führten zu Konflikten und Kriegen. Gorbatschowstürzte und ist heute einer der am wenigsten angesehen Politikerin Russland. Viele Menschen haben meine Arbeit als Korres-pondent in diesen bewegten sechs Jahren zwischen 1983 und1989 begleitet. Von der politischen Öffnung über die Kritik ameigenen System bis hin zu den ersten halbwegs freien Wahlen. Indieser Zeit traf ich mich häufig mit Sascha. Er arbeitete beimstaatlichen Jugendverband, war Journalist und schrieb nebenherseine Lieder. Erziehung zum Atheismus war die publizistischeAufgabe, mit der er sich beschäftigen musste. Noch zu Beginnder Perestrojka wollte ich über das wachsende Interesse derJugend an Religion eine Sendung machen. „Sascha“, sagte ich,
35
„Du bist sicher der falsche Ansprechpartner. Aber kennst Dunicht irgendwelche Jugendliche, die sich für Religion interessie-ren.“ Sascha blickte mich verwundert an, dann knöpfte er seinHemd auf und zog eine kleine Kette mit einem Kreuz hervor.„Ich habe mich gerade taufen lassen“, meinte er. Jetzt erst ver-stand ich den Ernst einer Karikatur, die ich in einer sowjetischenZeitschrift entdeckt hatte. Ein Mädchen kniet inbrünstig betendvor der Ikonenecke der elterlichen Wohnung. Der Vater glaubt,seine lebenslustige Tochter nicht wieder zu erkennen. „Pst“,macht da die Mutter - und erklärt: „Unsere Natascha betet, damitsie ihre Prüfung in wissenschaftlichem Atheismus besteht.“ VieleMenschen in der Sowjetunion haben zwei Leben geführt, eininneres und ein äußeres. Ideologie und Wirklichkeit stimmtenselten überein. Die Politik von Glasnost und Perestrojka hatdiesen Widerspruch offenbart. Der Sozialismus ist daran geschei-tert. Der Vater dieses Reformprozesses, Michail Gorbatschow,ist dabei das prominenteste Opfer dieser Veränderungen gewor-den.
37
MENSCHEN UND MÄCHTIGE
NEUER MANN AUF ALTER LINIE?Konstantin Tschernenko löst Jurij Andropow ab6
Mit einem groben Strohbesen klopft die Putzfrau frischgefal-lenen Schnee von der Blumenpracht und glättet die roten Schär-pen mit den Goldlettern. Behutsam fegt sie danach eine kleineFläche vor ihren Füßen blank. Neugierig verfolgen Touristen ausder Ferne die Bewegung und tuscheln leise: „Dort muss es sein,da liegt er.“ Gemeint ist Moskaus neueste Sehenswürdigkeit, dasGrab des Staats- und Parteichefs Andropow am Roten Platz, dasauch eine Woche nach der Beerdigung durch seinen Blumen-schmuck deutlich an der Kreml-Mauer auszumachen ist. Wospäter einmal ein Gedenkstein aufgestellt werden soll, reflektiertvorerst ein metallblitzender Ährenring mit Hammer und Sicheldas fahle Winterlicht. Noch gibt die sowjetische Hauptstadt nichtzu erkennen, ob mit Andropows Tod eine Ära oder doch nureine Episode zu Ende gegangen ist. Die Trauerbeflaggung unddie schwarz-rotumrandeten Gedenkbilder sind schnell aus demStadtbild verschwunden. Der neue Mann im Amt ist den Men-schen noch nicht präsent. Die Verkäuferin im „Haus der Bü-cher“ am Kalinin-Prospekt schüttelt jedenfalls heftig den Kopf:„Nein, Tschernenko-Poster gibt es noch nicht. Da müssen Siewarten. Wir haben aber noch Andropow auf Lager.“
Nur in der Abteilung für politische Literatur macht sich derWachtwechsel bemerkbar. Es gibt Titel über die Parteiarbeit, und
6 Zunächst unterlag der Hoffnungsträger Gorbatschow beim Kampf um dieNachfolge von Andropow noch der alten Riege im Politbüro. Der bisherigeIdeologiechef Tschernenko setzt sich durch. Doch nach nur wenigen Wo-chen im Amt erwies er sich bereits als handlungsunfähig, um den Heraus-forderungen der Sowjetunion gerecht zu werden. Erstveröffentlichung:Neuer Mann auf alter Linie? Im winterlichen Moskau ist noch nicht vielvon Konstantin Tschernenko zu spüren. In: DIE ZEIT, Nr. 9, 24. Februar1984.
38
eine Neuauflage von Tschernenkos gesammelten Reden ist EndeJanuar, also gerade rechtzeitig, erschienen. Keines der imposan-ten Werke ist unter vierhundert Seiten stark. Dem Interessentenmöchte die Händlerin gleich alle Bücher verkaufen, „weil man sieja sowieso in der nächsten Zeit brauchen wird“. Die erste Über-raschung nach Tschernenkos Wahl zum Generalsekretär derKPdSU kostet nur zehn Kopeken: eine 32-seitige Broschüre mitden Materialien des außerordentlichen ZK-Plenums, auf dem dieNachfolge-Entscheidung gefallen war. Sie enthält nicht nur diebereits veröffentlichten Reden, sondern auch eine 29 Zeilenlange Ansprache des Politbüro-Mitgliedes Michail Gorbatschow.Von ihm war stets die Rede gewesen, wenn es um eine Alternati-ve zum 72-jährigen Tschernenko ging. Nicht wenige Beobachtersahen in der Wahl Tschernenkos eine Entscheidung gegen Gor-batschow, den erst 53-jährigen Landwirtschaftsfachmann, ZK-Sekretär und Repräsentanten der so genannten Junioren-Riege inder obersten Parteiführung.
Nun wird dieses Bild zurechtgerückt. Gorbatschow durftenicht nur die einmütige Wahl Tschernenkos vor dem Plenumfeststellen, er verschaffte sich mit den Worten: „Das Plenum istbeendet“ auch protokollarischen Respekt, der zukunftsträchtigsein kann. Offenbar hat Gorbatschow die Sondersitzung des ZKgeleitet, was seine Bedeutung im Politbüro belegt. So erklärt sichjetzt auch die Formation der Parteiführung bei der Trauerfeierfür Andropow. Da nämlich wurde der designierte Andropow-Nachfolger links flankiert von Regierungschef Tichonow und anseiner rechten, protokollarisch bedeutenderen Seite von Gor-batschow. Es besteht daher kaum noch ein Zweifel: Der relativjunge Gorbatschow ist von der Altherren-Riege im Kreml nichtausmanövriert worden, er hat seine Stellung im Politbüro viel-mehr ausgebaut und kann von dort aus gelassen das derzeitigeRegiment des Triumvirats - Tschernenko, Gromyko und Usti-now - überdauern. Anders hingegen ist es dem aserbaidschani-schen Saubermann Gejdar Alijew ergangen. Auch er galt als einerder Nachfolge-Favoriten, aber er wurde bei der Neuverteilungder Macht ganz an den Rand des Politbüros gedrängt. Verwir-rung lösen schließlich noch die Vermutungen um Witali Worot-
39
nikow aus. Dem Ministerpräsidenten der Russischen FöderativenSowjetrepublik war erst im vergangenen Dezember der Sprungins Politbüro gelangen. Er galt als anerkannter Andropow-Mannund als Symbol für die trotz Krankheit vorhandene Entschei-dungskraft und den Einfluss des Parteichefs, der sich monatelangnicht mehr öffentlich gezeigt hatte. Doch Worotnikow fehlte beider Abschiedszeremonie an Andropows Aufbahrungsstätte,obwohl das Protokoll getreu dem russischen Alphabet seineAnwesenheit ganz oben notierte. Unterdessen stellt sich dasSowjetvolk wieder auf vertraute, inzwischen längst überholtgeglaubte Sitten ein.
Lobenshymnen auf den Generalsekretär, die man in den letz-ten fünfzehn Monaten so angenehm vermisst hat, gehören er-neut zum politischen Alltag. So erscheint im Fernsehen der mol-dawische Kolchosleiter und der usbekische Maschinist, die beideimmer schon gespürt haben, welche hervorragende Führungs-persönlichkeit, welch wirklich Leninscher Typ der neue Mann ander Parteispitze ist. Die beiden sind anscheinend nicht allein. Dieabendliche Nachrichtensendung Wremja präsentiert jedenfallsimmer neue Beweise der Zuneigung, Hochachtung und Wert-schätzung für Tschernenko. So gerät der Einleitungssatz einerMeldung über Grußadressen an den neuen Generalsekretär imDruck neunzehn Zeilen lang, weil keine gesellschaftlich wichtigeGruppe fehlen darf: die Parteiorganisationen, die Komsomol-zenverbände, die Kulturschaffenden, die Arbeitskollektive, dasMilitär – alle wollen im selben Atemzug genannt werden, umnicht mit ihren Erfolgswünschen für den neuen Mann zurückzu-stehen. Der neue Stil prägt auch die Wahlreden, mit denen sichdie Kandidaten für die Abstimmung zum Obersten Sowjet am 4.März vorstellen.
Plötzlich wird Tschernenkos politischer Beitrag auf dem ZK-Plenum im Juni vergangenen Jahres vor der Leistung Andropowseingestuft. Diese Aufwertung ist zwar noch nicht durchgängig,aber erfahrene Apparatschiks wie der Breschnew-Mitstreiter undZK-Sekretär Michail Simjanin wissen die neue, alte Linie zudeuten. Simjanin hat bereits Tschernenkos altes Losungswortvom Kampf gegen die bürgerliche Ideologie wiederaufleben
40
lassen, das nun von einigen Künstlern wie ein Damoklesschwertüber ihrer Art von Kulturverständnis gefürchtet wird. Wo lässtsich unter diesen Umständen eine veränderte, beweglichere Poli-tik erwarten? Bisher gibt es darauf nur eine unbefriedigendeAntwort: Das Neue an Tschernenkos Regime besteht wohl inder Wiederholung des Alten, nicht nur dem Stil, auch dem Inhaltnach. Es ertönen die gewohnten Bekenntnisse zu friedlicherKoexistenz, zu Verhandlungen, aber unter den bekannten Vor-bedingungen.
Großherzige Gesten wie ein Angebot zur Verschrottungsowjetischer Raketen wird es in naher Zukunft nicht geben. Dieaußenpolitischen Erklärungen, die Tschernenko während derBeileidsbesuche westlicher Regierungschefs abgab, tragen ein-deutig die harte Handschrift Gromykos. So zeigte das sowjeti-sche Fernsehen einen Bundeskanzler Kohl, der vom neuenKremlchef wegen der Raketenaufstellung gemaßregelt wurde. Inden bundesdeutschen Medien hingegen wurde das dreißigminü-tige Treffen zu einem Beweis staatsmännischer Aktivitäten imdeutsch-sowjetischen Verhältnis stilisiert. Kein Wunder, dassMoskau rasch noch eine erneute Kritik an Kohl nachschob.Auch unter Tschernenko wird die Sowjetunion weiterhin glau-ben, sie sei in der Raketenfrage vom Westen - von der Bundes-republik besonders - hinters Licht geführt worden.
Im Augenblick scheint im Kreml nur Kanadas Regierungs-chef Trudeau gut gelitten zu sein. Seine Visite - eingereiht inTschernenkos Gespräche mit Fidel Castro, Ortega aus Nicaraguaund Karmal aus Afghanistan - zeigt nach außen Einmütigkeit.Allerdings kann sich die sowjetische Führung auf dem allgemei-nen Nenner einer „ernsten Bedrohung über die wachsendenSpannungen in der Welt“ auch mit anderen Regierungen treffen,vorausgesetzt sie will es. Gegenüber einigen Ländern will derKreml offenbar kühle Distanz demonstrieren. Das Beispiel Japanzeigt hier Kontinuität: Im Rahmen der Beerdigungsdiplomatiemusste der japanische Außenminister von seinem sowjetischenKollegen einen Rüffel hinnehmen. Bisher - so das Besucherbulle-tin ungeniert - fehle es in Japan an dem notwendigen Widerhallfür gutnachbarliche Beziehungen mit der Sowjetunion. Nur we-
41
nig später erklärten die Sowjets vor Ort in Tokio, sie würdenJapans Aufrüstung und die geplante Entsendung amerikanischerKampfflugzeuge nicht stillschweigend hinnehmen. Inzwischenhat Moskau einen zweiten Flugzeugträger losgeschickt, um seinePazifikflotte zu stärken. Doch das sind Schritte, die noch nichtsüber Moskaus neue Außenpolitik aussagen, weil sie gewiss nichterst mit der Wahl Tschernenkos zum Generalsekretär eingeleitetwurden.
42
DIKTATOR UND POET DAZUEin Film zum Andenken an Jurij Andropow ist die
Sensation von Moskau7
Die schwere SIL-Limousine gleitet über den Roten Platz,taucht unter dem Spaskij-Turm an der Kreml-Mauer hindurchund schwenkt vor dem Regierungsgebäude ein. Sanfter Stopp,heraus steigt der Parteichef. Die Kamera verfolgt seinen Weg indas Sitzungszimmer des Politbüros, er wird zackig gegrüßt vonder Kreml-Garde. - Das sind die ersten Szenen aus einem Filmüber Jurij Andropow, der in Moskau vor erlesenem PublikumPremiere feierte. Seine früheren Berater, hohe KGB-Leute undMoskaus Kulturschickeria waren ebenso in den kleinen Saal desKinotheaters Oktjabr am Kalinin-Prospekt gekommen wie SohnIgor, der die Sowjetunion in Griechenland als Botschafter ver-tritt. Was auf der Leinwand zu sehen war, verdient für sowjeti-sche Verhältnisse die Bezeichnung „sensationell“.
Zum 70. Geburtstag des im vergangenen Februar verstorbe-nen Parteichefs wurde kein Verschnitt aus öffentlichen Auftrit-ten und Reden geliefert, sondern das sehr intime Porträt einesMannes, der für seine Frau Liebeslyrik schrieb und sich per Ge-dicht mit dem nahenden Tod auseinandersetzte. Im Gegensatzzu dem sonst traditionell abgeschirmten Familienleben der Sow-jetführer wagte sich Tatjana Filipowna vor die Kamera,Andropows Witwe, über deren Existenz bis zu seinem Tod nurgerätselt wurde. Sie schildert schlicht, wie sie ihren Mann bei derJugendorganisation Komsomol kennen und lieben gelernt hat.Seine Stimme, sein Gesang haben sie bezaubert. Fotos aus denJahren der Familienidylle mit den Kindern geben ihrer Schilde-
7 Nachdem Tschernenko die Reformansätze von Andropow gestoppt hatte,wurden nun von engagierten Reformern im Staats- und Parteiapparat indi-rekt Erinnerungen an den Jurij Andropow gepflegt. Dies geschah stets inVerbindung mit Hinweisen auf Michail Gorbatschow, auf den die Reformerweiterhin als den späteren Hoffnungsträger der KPdSU setzten. Erstveröf-fentlichung: Diktator und Poet dazu. Ein Film über Jurij Andropow ist dieSensation von Moskau. In: DIE ZEIT, Nr. 25, 14. Juni 1984.
43
rung etwas rührend Alltägliches. In einer Rückblende fängt derFilm die dörfliche Umgebung von Andropows HeimatortNagutskaja ein. Das sowjetische Publikum wird bemerken, dassder viel gelobte Parteichef wie sein späterer Nachfolger Gor-batschow aus dem Gebiet von Stawropol stammt. Von dortführt der Film über die vielen Stationen der Karriere bis in dieMoskauer Stadtwohnung am Kutusowskij Prospekt 26. Im glei-chen Haus, in dem auch Breschnew als Mieter registriert war,lebte die Familie angeblich seit mehr als dreißig Jahren. Geblüm-te Stoffe, lackierte Holzmöbel zeugen von biederer Behaglich-keit. Am Tisch sitzen Mutter, Sohn und Tochter, für die Auf-nahmen in Sonntagsstaat gekleidet, doch nur Andropows Witweergreift das Wort; ihre erwachsenen Kinder lauschen artig. EinSchwenk - und die Leinwand ist übersät mit Büchern, die inAndropows Arbeitszimmer aufgestellt sind. Neben den Klassi-kern des Marxismus-Leninismus hat sich der Politiker auch mitDante und Kant befasst. Dann zeigt die Kamera Don Quichotteals Holzfigur, streift kurz ein impressionistisches Blumenaquarell.Noch im Nachhinein wird das Image des aufgeklärten, in westli-cher Literatur belesenen Parteiführers gepflegt. Selbst seinDeckname Magikas aus der Zeit der Partisanenkämpfe in Kare-lien ist eine Anleihe aus der russischsprachigen Fassung vonDavid Copperfields Buchtitel vom letzten Mohikaner. HinterGlas entdeckt der Zuschauer ein Foto Andropows mit demungarischen Parteichef János Kádár. Beide verband eine langeFreundschaft aus der Zeit als Andropow Botschafter in Ungarnwar.
Für das Publikum hält der Film einen Schock bereit: Der Un-garn-Aufstand 1956 wird in drastischen Zeitdokumenten vorge-führt. Straßenschlachten, zerschossene Sowjetsterne, brutal er-schlagene Opfer der Unruhen. Der Kommentar ist einseitig, aberauch vielsagend. Andropow – so erzählt János Kádár vor derKamera – habe sich in dieser Ausnahmesituation nicht schablo-nenhaft verhalten, sondern dem Land viel geholfen. Dass dieSowjetarmee den Aufstand niedergeschlagen hat, wird ver-schwiegen. Wer etwas zu sagen hat im Nach-Andropow-Russland, taucht im Bild auf. Zu Wort kommt jedoch keiner von
44
ihnen. Nur ein Mann fehlt ganz und gar: Andropows unmittelba-rer Nachfolger Tschernenko. „So etwas hat es noch nicht gege-ben“, urteilt ein etwas 35 Jahre alter Mann nach der Aufführung.Andere waren sichtlich ergriffen. Einige wischten sich Tränenaus den Augen. Das Erbe Andropows soll zu seinem Geburtstagam 15. Juni in der Öffentlichkeit propagiert werden. MichailGorbatschow versucht, von der Aufbruchsstimmung zu profitie-ren, die von Andropow erzeugt worden war. Gorbatschow, dasist die Botschaft, verwirklicht, was Andropow nur begann: Bür-gernähe und Reformen.
45
POLITISCHE NEUERUNGEN BEIM WECHSELGorbatschow verdrängt die Trauer um seinen
Vorgänger Tschernenko8
Mit Spitzhacke und Schaufel befreiten einige hundert Solda-ten um Mitternacht die Moskauer City von den Resten einerverdreckten Eiskruste. Am nächsten Tag waren die blank geputz-ten Plätze der Innenstadt von langen Reihen Uniformierter abge-riegelt. Tausende machten sich auf den Weg zum Säulensaal imhistorischen Gewerkschaftshaus, um sich von ihrem toten Par-teichef zu verabschieden.
„Schließen Sie auf, bilden Sie Dreierreihen“, lautete die mo-notone Anweisung der Milizionäre, die am Seiteneingang desGewerkschaftshauses den Besucherstrom in den ersten Stockdirigierten. Der hektische Auftrieb stand in peinlichem Gegen-satz zu der getragenen Musik, die zwei Orchester abwechselndim abgedunkelten Säulensaal spielten. Die Zeit reichte kaum füreinen flüchtigen Blick auf den Leichnam. Trauerstimmung wolltenicht aufkommen, weder am Sarg noch auf der Straße.
Viele Sowjetbürger registrierten mit Genugtuung, dass nunein Politiker der jüngeren Generation an die Parteispitze gerücktist. Das war auch die Botschaft der Führung. Wer am Dienstag-morgen die Parteizeitung Prawda oder die RegierungszeitungIswestija aus dem Briefkasten zog, suchte jedenfalls auf der Titel-seite vergeblich nach der Todesnachricht. Das vertraute Ritualwurde diesmal unterbrochen: Statt mit Trauerrand und großfor-matigem Porträt des Verstorbenen, machten die Blätter mit derWahl des neuen Parteichefs Gorbatschow auf. Zum ersten Malin der Geschichte der Sowjetunion wurde der neue Mann soschnell bestimmt, dass seine Wahl die Nachricht vom Tod des
8 Nachdem Gorbatschow gewissermaßen als zweiter Mann und Kronprinzmehr und mehr an Einfluss auch durch Auslandsreisen gewonnen hat,übernahm er nach dem Tod von Tschernenko die Führung der Sowjetuni-on und verdrängte sofort das Andenken an seinen Vorgänger. Erstveröf-fentlichung: Rasch zurück zum Alltag. In Moskau wollte keine rechte Trau-erstimmung aufkommen. In: DIE ZEIT, Nr. 12, 15. März 1985.
46
Vorgängers auf die zweite Seite verdrängte. Auch sprachlich gabes eine Neuerung: Gorbatschow wurde nicht - wie seine Vorgän-ger Andropow und Tschernenko - „einstimmig gewählt“, son-dern „mit einer Seele“, also einmütig. Die Abweichung von derüblichen Floskel ließ aufhorchen: Gab es im Zentralkomitee vorder Wahl noch eine Aussprache über den 54-jährigen Kandida-ten, die zu Stimmenthaltungen führte? Oder sollte der Bevölke-rung genau das Gegenteil signalisiert werden: die besondereGeschlossenheit, mit der die Kreml-Riege hinter dem neuenParteiführer steht? Der Öffentlichkeit präsentiert sich das Polit-büro in neuer Rangfolge. Auf dem ersten Foto nach der Wahldes Generalsekretärs fällt die Heraushebung Witalij Worotni-kows (58) auf. Der Ministerpräsident der Russischen Föderationerschien abweichend von der alphabetischen Namensfolge zurRechten Gorbatschows. Auch Worotnikow zählt zur jüngerenGeneration im Politbüro. Beide stehen für eine vorsichtige Re-formpolitik, wie sie zurzeit Andropows formuliert wurde.Worotnikow wird als möglicher Nachfolger des sowjetischenMinisterpräsidenten Nikolaj Tichonow (79) genannt.
Es wirkte nüchtern, fast routiniert, als die Mitglieder des Po-litbüros vor den Fernsehkameras den Angehörigen des verstor-benen Parteichefs Tschernenko ihr Beileid bekundeten. BeimTode Andropows hatten die Fernsehbilder noch minutenlangTränen, Umarmungen, Küsse und sichtlich bewegte Anteilnah-me der alten Herren gezeigt. Die politische Tagesroutine wurdevon dem Trauerfall nicht gestört. Der französische Außenminis-ter Dumas wurde noch am Tag der Todesmeldung von seinemAmtskollegen Gromyko und von Ministerpräsident Tichonowempfangen. Der Beginn der Genfer Abrüstungsverhandlungenzwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten wurdeauf ausdrückliche Anweisung des neuen Parteichefs nicht ver-schoben. Die Eile, mit der Gorbatschow zur Rückkehr in denpolitischen Alltag drängt, zeigte sich auch in einer protokollari-schen Feinheit: Die Staatstrauer für Tschernenko fiel um einenTag kürzer aus als für seine beiden Vorgänger.
47
HERZENSDIENST FÜR DIE MÄCHTIGENDer Kremlarzt Jewgenij Tschasow9
Ich bin nicht Politiker, ich bin Arzt“, lautet die Selbstein-schätzung von Jewgenij Iwanowitsch Tschasow, der hochrangigePosten in der sowjetischen Staats- und Parteibürokratie ein-nimmt, und als „Leibarzt des Kreml“ bezeichnet wird. Als medi-zinische Kapazität auf dem Gebiet der Herzforschung ist er inFachkreisen unumstritten. Sowjetbürger konnten seinen Namenmehrmals an prominenter Stelle entdecken: Tschasow unter-zeichnete neben anderen Ärzten die in allen Zeitungen veröf-fentlichten Krankenberichte der letzten drei gestorbenen Gene-ralsekretäre von Breschnjew über Andropow bis Tschernenko.
Doch als die von Tschasow mitbegründete Ärzteorganisationzur Verhinderung eines Atomkrieges mit dem Friedensnobel-preis ausgezeichnet wurde, hielt sich die Presse im eigenen Landerstaunlich zurück. Für die heimische Leserschaft kam Tschasowin keinem prominenten Interview zu Wort. Als dann im Westender Streit um seine Person begann, weil er in der Regierungszei-tung Iswestija eine Erklärung gegen Sacharow unterzeichnet hatte,polterte die amtliche Nachrichtenagentur Tass zwar: „Was HerrnGeißler nicht gefällt.“ Sie sah „Verleumder am Werk“. Dochworin der Angriff auf den Mit-Nobelpreisträger nun wirklichbestand, wurde nicht öffentlich erörtert.
Tschasow selbst mied vor allem die ausländische Presse. In-terviewwünschen wollte er zunächst überhaupt nicht nachgeben.Schließlich stimmte er einem „Medientag“ zu. Die beiden bun-desdeutschen Fernsehgesellschaften sowie ein norwegisches undein japanisches Team wurden in sein Kabinett gelassen und durf-
9 Die graue Eminenz des Kremls mit Zugang zur obersten Führungsschichttrat im Rahmen der neuen Offenheit national und international in denVordergrund und öffnete einen Blick auf die bislang wenig bekanntenStrukturen des Innenlebens der Parteikader. Erstveröffentlichung: DieKontroverse um den Friedensnobelpreis. Herzensdienste für die Mächtigen.Jewgenij Tschasow hat einen guten Ruf als Arzt, politisch hält er sich be-deckt. In: DIE ZEIT, Nr. 51, 13. Dezember 1985.
48
ten ihn in holzgetäfelter Umgebung befragen. Was dabei heraus-kam, war das sympathische Porträt eines selbstbewussten Fach-mannes, der sich wortgewandt und ohne Scheu vor der Kamerabewegte, aber allen das gleiche erzählte: Zum Privatleben wolleer sich nicht äußern, im Fall Sacharow habe er nur von seinerMeinungsfreiheit Gebrauch gemacht, weil er in einigen Punktenmit dem Akademiemitglied nicht übereinstimme - ohne ihn frei-lich, je gesehen oder gesprochen zu haben - und die Ärztebewe-gung sei eine völlig unpolitische Angelegenheit.
Würden Tschasows Äußerungen zu Sacharow im sowjeti-schen Fernsehen ausgestrahlt werden, dann könnten Durch-schnittsverdiener neidisch werden. Denn - so hat der Kreml-Arztund so auch die offizielle sowjetische Darstellung auf einer Pres-sekonferenz des Außenministeriums Anfang dieser Woche -Sacharow arbeite als Wissenschaftler, publiziere, verdiene umge-rechnet 1200 Dollar monatlich, habe seine eigene Wohnung undgute medizinische Betreuung. Und schließlich zitiert Tschasowviermal vor den Kameras den gleichen amerikanischen Wissen-schaftler, der davor warnt, Sacharow zu einer Schachfigur imKalten Krieg zu machen, um „pharisäerhaft Antikommunismuszu betreiben“. So also argumentiert der unpolitische Arzt.
Wer ist Jewgenij Iwanowitsch Tschasow wirklich? Geborenwurde er 1929 - Ironie der Geschichte - in Sacharows Verban-nungsort Gorkij. Die zentrale Leitfigur in seinem Leben warseine Mutter, ebenfalls Ärztin, die Tschasow in einer autobio-graphischen Erzählung als „eine der ersten Komsomolzinnen imUral“ bezeichnet. Während des nachrevolutionären Bürgerkrie-ges wurde sie von einem weißgardistischen Gericht zum Todeverurteilt und blieb laut dieser Erzählung „wie durch ein Wunderam Leben“. Das Schicksal seiner Mutter begleitete Tschasow biszu ihrem Tod, den er als Arzt, ohne helfen zu können, miterleb-te. Sie starb an einer Thromboembolie der Lungenschlagader,gegen die Tschasow mit seinem Forschungsteam ein Medika-ment entwickelte, wofür der damals knapp vierzigjährige Wissen-schaftler den Leninpreis erhielt.
Tschasow, der erst mit 35 Jahren Parteimitglied wurde, mach-te eine steile berufliche Karriere. Bereits nach dem Examen in
49
Kiew schaffte er im Todesjahr Stalins den Sprung als Assistenz-arzt in das angesehene „Erste Moskauer Medizinische Institut“.Dessen klinischer Leiter war W. N. Winogradow, der angeblicheinzige Arzt, dem der überängstliche und neurotische Stalin amLebensende noch vertraut hatte. Wegen seiner hervorragendenKenntnisse wechselte Tschasow 1957 für zehn Jahre an die Me-dizinische Akademie. In diese Zeit fallen auch seine ersten Ame-rikareisen - damals ein ungeheures Privileg. Gleichzeitig muss eraber auch Kontakte zu den Mächtigsten des Landes hergestellthaben. Denn bereits 1967, also schon mit 38 Jahren, wurde erChef der berühmten Vierten Hauptverwaltung des sowjetischenGesundheitsministeriums. Was sich so harmlos liest, hieß früher„Kur- und Sanitätsverwaltung des Kremls“. Dahinter verbirgtsich nichts Geringeres als die zuständige Organisation für denmedizinischen Spezialdienst der Nomenklatura, der OberenZehntausend, die sich mit eigenen, bestens ausgestatteten Klini-ken und Sanatorien vom gewöhnlichen Volk abgetrennt haben.Auch wenn Tschasows fachliche Qualitäten für diesen Postenmit ausschlaggebend gewesen waren, so blieb an ihm seither derRuf haften, er sei ein „Fragebogenarzt“. So wurden in der Sow-jetunion Mediziner bezeichnet, die ihre politische Zuverlässigkeitper Fragebogen auszuweisen hatten.
Kaum eineinhalb Jahre nach seinem großen Sprung erhieltTschasow den Titel eines Stellvertretenden Gesundheitsministersund ist mit beiden Funktionen bis heute einflussreicher als derMinister selbst. Ob seine persönliche Freundschaft mit Breschn-jew das Ergebnis oder die Vorbedingung eines solchen Aufstie-ges war, lässt sich nicht beantworten. In jenen Jahren bis zumEnde der Breschnjew-Zeit führte auch seine übrige Parteikarriereaufwärts, bis hin zur Mitgliedschaft im rund 300-köpfigen Zent-ralkomitee der Partei. Den Umgang mit den Großen der Weltwar Tschasow gewohnt. In seinem Empfangszimmer hängt einFoto, das ihn zusammen mit dem früheren amerikanischen Prä-sidenten Nixon zeigt. Seit 1961 bereiste er die USA zu wissen-schaftlichen Kontakten und inzwischen auch in Friedensmissio-nen. 1969/70 behandelte er den damaligen ägyptischen Präsiden-ten Nasser bis kurz vor dessen Tod.
50
Gerüchte über das Ende seiner Kreml-Karriere wurden inder Andropow-Zeit laut, als der erste Arzt des Landes eine Zeit-lang nicht mehr öffentlich auftrat. Inzwischen hat sich Tschasowinternational jedoch als Aushängeschild der sowjetischen Kardio-logie etabliert und ist heute Herr über das landesweit modernsteHerzforschungszentrum, das durchaus dem Standard amerikani-scher Spitzeninstitute entspricht. Die technische Ausstattung bishin zu einem eigenen Fernsehstudio, das Lehrkassetten für allegängigen Videosysteme der Welt herstellen kann, ist für vieleMillionen im Westen eingekauft worden. Unter seinen Mitarbei-tern gilt Tschasow als energischer selbstbewusster Chef, der auchzuhören kann, aber familiäre Themen meidet. An dem ArztTschasow ist kein Makel, so das übereinstimmende Urteil. Wasaber ist mit dem Politiker Tschasow? Im Rahmen der Ärzteorga-nisation gegen einen Atomkrieg formulierte er ganz allgemeinZiele der Sowjetunion, hält sich aber bei der Bewertung innenpo-litischer Vorgänge zurück. Doch ein Mann in seiner Funktion istkeine unbedeutende Figur. Wie weit sein Urteil Politik konkretbeeinflusst, ist schwer einzuschätzen. Aber seine vielen Ämtervom Obersten Sowjet über den Vizeministerposten bis hin zumZK geben ihm reichlich Gelegenheit, auch praktisch auf diePolitik einzuwirken.
51
NEUE LEHREN FÜR DIE GENOSSENPositionskämpfe im Zentralkomitee10
Auf dem Podium einer Moskauer Diskussionsveranstaltungsitzt ein gewichtiger Mittfünfziger, der nicht den Eindruck desgeschniegelten Parteiredners vermittelt: Sein Hemdkragen stehtoffen, die schwarzen Haarsträhnen reichen bis in den Nacken.Leise und nachdrücklich plädiert er für eine ungeschminkte Dar-stellung der Stalin-Zeit und setzt sich gegen anonyme Zettel-schreiber aus dem Publikum zur Wehr: Die brächten - trotz derneuen Offenheit der Sowjetgesellschaft - nicht den Mut auf, ihreschriftlichen Bemerkungen mit ihrem Namen zu unterzeichnen.
Alexander Bowin, Kommentator bei der RegierungszeitungIswestija, ist zu einer der wichtigsten publizistischen Stützen derGorbatschow-Politik geworden. Mit Beendigung des ZK-Plenums, auf dem Gorbatschow als Konsequenz mehr Demo-kratie forderte, die „wir brauchen wie die Luft zum Atmen“,ohne die „unsere Politik ersticken wird“, veröffentlichte Bowineine engagierte Anklage gegen die Widersacher dieser neuenPolitik. „Nein, sie haben nicht die Hoffnung aufgegeben, uns zubegraben“, klagte er und bezeichnete unter Berufung auf densowjetischen Schriftsteller Salygin den Hauptfeind als „den haus-eigenen bürokratischen, sowjetischen, sozialistischen Konserva-tivismus“. Doch die Bowin-Kritik reicht weiter zurück, bis in dasJahr 1956, als Chruschtschow auf dem XX. Parteitag die Entsta-linisierung einleitete. „Mit dem abscheulichen Gefühl persönli-cher Machtlosigkeit“, so beschrieb es Bowin jetzt, „habe ichbeobachtet, hat meine ganze Generation beobachtet, wie dieIdeen eines unserer historisch wichtigen Parteitage in den Müh-len der Bürokratie untergingen.“ Das sich hartnäckig haltende
10 Erste ernstzunehmende Versuche einer innerparteilichen Demokratisie-rung stießen auf Widerstand bei den altkommunistischen Kräften, ausdenen sich später die Putschisten gegen Gorbatschow rekrutierten. Erstver-öffentlichung: Tagung des sowjetischen Zentralkomitees. Aufbruch aus derAnonymität. Generalsekretär Gorbatschow konnte nicht alle seine Vorstel-lungen durchsetzen. In: DIE ZEIT, Nr. 7, 6. Februar 1987.
52
Gerücht, Bowin habe wegen der Brisanz dieses Beitrages auf dasWochenblatt Nowoje Wremja („Neue Zeit“) ausweichen müs-sen, zeigt, dass der Kampf der Argumente bis in die Redaktionenreicht. Das Plenum des Zentralkomitees selbst hatte in einerkritischen Schlussfolgerung bestätigt, dass der hemmende Me-chanismus erst „langsam seine Positionen aufgibt“ und „Kon-servativismus, Trägheit und überholte Denkweise noch nicht anKraft und Einfluss“ verloren haben. Angesichts eines Zentral-komitees, von dessen 307 Mitgliedern erst ein gutes Drittel mitdem letzten Parteitag neu ernannt wurde, hat der Generalsekretärmit dem jüngsten Plenum mehr erreicht, als zu hoffen stand.• In den Betrieben sollen künftig alle Funktionen, bis hin zumDirektor durch ein Auswahlverfahren und nicht länger durchVerfügung von oben besetzt werden.• Parteilose Fachleute bekommen bessere Aufstiegschancen inFührungspositionen.• Eine Wahlrechtsreform wird angestrebt mit dem Ziel, mehrereKandidaten zu nominieren.• Der Ausbau innerparteilicher Demokratie wird unter Umstän-den auch geheime Abstimmungsverfahren bei Personalentschei-dungen zur Folge haben.• Ein neues Kontrollorgan soll die Arbeit der Parteikader prüfen.• Eine Reform des Rechtswesens soll bislang übliche Missstände(Zulassung eines Rechtsanwalts erst bei der Hauptverhandlung;Staatsanwälte, die als Ermittlungsbeamte Beschwerden gegensich selbst prüfen müssen) abschaffen.• Glasnost, die bisher praktizierte kritische Offenheit in denMedien ist, sehr zum Unwillen vieler Betroffener, vom Plenumals notwendiger Bestandteil des wirtschaftlichen und gesellschaft-lichen Umbaus festgeschrieben worden.
Die Tatsache, dass Gorbatschow auf spektakuläre Personal-entscheidungen in der obersten Führung, dem Politbüro, ver-zichtet hat, zeigt jedoch zweierlei. Der Generalsekretär mussteeinen Kompromiss eingehen. Einerseits wurde nur der gestürztekasachische Parteichef Dinmuhamed Kunajew aus dem Politbü-ro ausgeschlossen, nicht aber der ebenfalls heftig kritisierte ukra-inische Parteichef Wladimir Schtscherbitzkij, ebenso wie
53
Kunajew noch ein Überbleibsel der Breschnew-Zeit. Anderer-seits mutete Gorbatschow dem Apparat keine Personalentschei-dung zu, die seine Widersacher herausgefordert hätte. Stattdes-sen setzte der Generalsekretär auf den Ausbau des Apparates.Hier haben die schrittweisen Veränderungen zu einem geschlos-senen Bild geführt.
Nach den jüngsten Entscheidungen verfügt das ZK-Sekretariat nun über neun (von elf) Sekretären, die seit derAmtszeit von Gorbatschow ihre Arbeit aufgenommen haben.Auffallend ist die jüngste Ernennung von Anatolij Lukjanow,der zeitgleich mit Gorbatschow 1953 sein juristisches Examen ander Universität Moskau abgelegt hat. Öffentlich hatte sich Luk-janow zuletzt im April vergangenen Jahres in einem Prawda-Artikel für die sozialistische Selbstverwaltung und eine Stärkungder Sowjets auf unterer Ebene eingesetzt, wie sie jetzt auch vomPlenum verabschiedet wurde. Als zweitem Juristen in einer wich-tigen Führungsposition dürfte ihm die Aufgabe zufallen, denUmbau für eine neue Rechtsstaatlichkeit voranzutreiben, wozuauch die angestrebte Reform im Justizwesen zählt. Lukjanow,Jahrgang 1930, gehört bereits seit 1956 dem Regierungs- undParteiapparat an und leitete zuletzt die einflussreiche „Allgemei-ne Abteilung“ im Zentralkomitee, die unter anderem für dieVorbereitungen der Politbürositzungen verantwortlich ist. DieBeförderung des bisherigen ZK-Sekretärs für Ideologie, Alexan-der Jakowlew, zum Kandidaten des Politbüros unterstreichtdessen Bedeutung bei der ideologischen Öffnung des Landes.Denn auf den Einfluss von Jakowlew gehen zahlreiche Maß-nahmen in der Kulturpolitik zurück, zu denen die Selbstverwal-tung der Theater, die Abschaffung der traditionellen Zensurbe-hörde bei der Filmproduktion und die Freigabe bislang zurück-gehaltener Filme gehören, die sich kritisch mit der sowjetischenGeschichte und dem Stalinismus auseinandersetzen. In diesemSinne soll auch eine „Schutzformel für Künstler“ wirken, wie siein der Resolution des Plenums festgehalten ist. Obwohl von denKulturschaffenden Ideologietreue verlangt wird, heißt es wört-lich weiter: „Inkompetente Einmischung in rein künstlerischeProzesse, geschmacksbedingte Sympathien und Antipathien sind
54
unzulässig.“Unter den zustimmenden Äußerungen der sozialistischen
Brüderländer zu den Ergebnissen des Plenums sucht der sowjeti-sche Leser vergeblich Zitate aus rumänischen Zeitungen. Hierscheint der Dissens in der weiteren Entwicklung der Wirt-schaftspolitik zu liegen. Besonders das sowjetische Gesetz überindividuelle Arbeit, das den privaten Betrieb eines Taxis ebensoermöglicht wie die Eröffnung eines privaten Restaurants, kannzu einem ideologischen Scheidepunkt zwischen Moskau undBukarest werden.
Entsprechend positive Reaktionen kommen aus Warschau.Und gleich nach der Aufsehen erregenden Gorbatschow-Rede,in der er nicht nur Demokratisierungsprozesse gefordert, son-dern auch eine vernichtende Bilanz der Breschnew-Zeit vorge-legt hatte, überraschte das sowjetische Fernsehen mit einer Re-portage aus Prag: Die dortige Parteizeitung Rude Pravo mit derRede Gorbatschows war in Windeseile ausverkauft - erstmals seitvielen Jahren, wie sich dortige Diplomaten erinnern.
Doch Moskau wirbt nicht nur um Zustimmung im eigenenLager, sondern bemüht sich auch um einen neuen Dialog mitdem politischen Gegner. Die Parteizeitung Prawda hat dafür nachdem Plenum eigens eine neue Rubrik eingeführt, in der westlichePolitiker und Kommentatoren zu Wort kommen, ergänzt freilichdurch eine Bewertung aus sowjetischer Sicht. Ausgerechnet derkonservative Führer der Republikaner im amerikanischen Senat,Robert Dole, machte den Anfang mit einem Beitrag über Salt II.Diesen Vertrag wieder zu beleben, meint er in einem Artikel-nachdruck aus der New York Times, sei ein sinnloses Unterfan-gen, weil die Sowjets die vereinbarten Rüstungsbeschränkungennicht eingehalten hätten:
Es ist das erste Mal, dass auf den Zeitungsspalten der Prawdaden Sowjets vorgehalten wird, sie betrieben skrupellose Aufrüs-tung und seien eine ernste Gefahr für die amerikanische Sicher-heit. So ungeschminkt wurden die Standpunkte der regierendenRepublikaner bislang bestenfalls durch die Voice of America indie Sowjetunion vermittelt.
55
PERESTROJKA DURCH KADERPOLITIKGorbatschow erweitert seine Machtbasis im Politbüro11
Mit der Besetzung von drei Sitzen im Politbüro hat Parteisek-retär Gorbatschow erneut bewiesen, dass er bereit ist, sich überKonventionen hinwegzusetzen, die in jahrzehntelanger Ein-übung Bestandteil regulärer Parteikarrieren waren. Konkret giltdies für die Entscheidung, auch Führungskräfte in das Politbüromit aufzunehmen, die nicht zuvor als Kandidaten dieses Gremi-ums eine längere Wartezeit abzusitzen hatten. Die rein quantita-tive Bestandsaufnahme zeigt, dass seit dem Amtsantritt vonGeneralsekretär Gorbatschow im März 1985 acht von vierzehnMitgliedern des Politbüros neu ernannt wurden, das sind immer-hin fast zwei Drittel. Von den jetzt sechs nicht stimmberechtig-ten Kandidaten des Politbüros stammen vier ebenfalls aus derGorbatschow-Zeit. Daneben gehören dem zwölfköpfigen ZK-Sekretariat, das den eigentlichen Machtapparat administrativ zulenken hat, außer dem Generalsekretär noch weitere fünf Polit-büromitglieder an.
Zur inhaltlichen Bewertung der Personalentscheidungen be-darf es einer kurzen Charakterisierung der neuen Politbüromit-glieder. Alexander Jakowlew, ein 63-jähriger Russe, ist ein Mann,der nach dem ursprünglichen Bruch seiner Karriere im Parteiap-parat einen erstaunlichen, wenn auch zeitraubenden Wiederauf-stieg verwirklichen konnte. Er hat das pädagogische Institut inJaroslawl absolviert und stieß zur Kommunistischen Partei,nachdem er während des Krieges einer Verletzung wegen vorzei-tig aus dem Militärdienst ausgeschieden war. Jakowlew studierte
11 Eine der wichtigsten Personalentscheidungen, deren Bedeutung erstspäter erkannt wurde, war die Berufung des international erfahrenen Ale-xander Jakowlew in das Politbüro. Er wurde zum Motor zahlreicher Verän-derungen („Architekt der Perestrojka“) und ist einer der Väter der Deut-schen Einheit geworden. Erstveröffentlichung: Unkonventionelle Personal-entscheidungen in Moskau. Erweiterung von Gorbatschews Machtbasis.Die neuen Mitglieder des Politbüros. In: Neue Zürcher Zeitung, Fernaus-gabe Nr. 147, 30. Juni 1987.
56
an der Parteiakademie Gesellschaftswissenschaften, promoviertemit einem historischen Thema und widmete sich fast 30 Jahrelang der Parteiarbeit, vornehmlich auf dem Gebiet der Ideologieund Propaganda. Welche Umstände ihn dann 1973 karrierewid-rig zum Botschafter in Kanada machten, lässt sich in Moskaunicht ganz schlüssig klären. Angeblich sollte Jakowlew mit dieserVerbannung aus dem ZK-Apparat für einen Artikel bestraftwerden, den er gegen großrussischen Nationalismus veröffent-licht hatte. Gemessen an den auch heute noch widerstreitendenKräften in der Partei zwischen russischnationaler Innensicht undeiner nach außen gerichteten „Westlertradition“ der so genann-ten Aufklärergruppe entspricht Jakowlew inhaltlich voll derDenkweise des jetzigen Parteichefs. Gelegenheit zur engerenBekanntschaft hatte sich geboten, als Gorbatschow 1983 Kanadabesuchte und dabei von Botschafter Jakowlew betreut wurde.Nur einen Monat nach diesem Besuch wurde Jakowlew nachMoskau zurückberufen und überraschend zum Direktor desangesehenen Instituts für Weltwirtschaft und internationale Be-ziehungen ernannt. Wenn man bedenkt, dass damals der krankeAndropow noch die Partei führte, wird klar, wie langfristig vonGorbatschow das Konzept der personellen und damit auch derpolitischen Erneuerung betrieben wurde.
Jakowlew hat sich nicht nur einen ausgezeichneten Ruf alsFachmann für die westliche Welt erworben. Er gilt auch als un-orthodox, wenn es darum geht, Sachentscheidungen von falscherideologischer Befangenheit zu trennen. Mit GorbatschowsAmtsantritt kehrte Jakowlew nun als Abteilungsleiter für Ideolo-gie in den ZK-Apparat zurück, den er fast genau zehn Jahrezuvor hatte verlassen müssen. Die restlichen Stationen bis zurendgültigen Vollmitgliedschaft im Politbüro waren damit vorge-zeichnet. Obwohl Jakowlew sich in jüngster Zeit mit spektakulä-ren Äußerungen zurückhält, soll ihm persönlich zu verdankensein, dass lange unterdrückte Filme und Bücher über die Schre-cken der Stalinzeit nun endlich gezeigt und publiziert werdendürfen. Weniger umfangreich ist die Kenntnis von Viktor Niko-now, 58-jährig, ebenfalls russischer Nationalität, der ohne vorhe-rigen Kandidatenstatus als Vollmitglied in das Politbüro aufge-
57
nommen wurde. Sein Lebenslauf weist ihn als Landwirtschafts-fachmann aus, der eine eher unspektakuläre Karriere in der Pro-vinz absolviert hat. Nach Jahren der praktischen Arbeit war auchnahezu seine gesamte Parteitätigkeit mit Agrarfragen verbunden,bis er 1983 zum Landwirtschaftsminister des Russischen Födera-tionsrepublik, also der flächengrößten Republik der Sowjetunion,aufstieg. Auch hier fällt das entscheidende Ernennungsjahr unterAndropow auf. Seither musste der neue Minister auch enge Kon-takte zum damaligen ZK-Sekretär für Landwirtschaft, Gor-batschow, halten, dessen Nachfolge als ZK-Sekretär er dann1985 antrat. Auch für den 58-jährigen Nikolaj Sljunkow war inder Andropow-Zeit die Grundlage für die heutige Karriere gelegtworden.
Der Weißrusse galt zunächst als Spezialist für Fragen der Me-chanisierung in der Landwirtschaft und hatte die größte Trak-torenfabrik der Sowjetunion in Minsk geleitet, ehe er dort 1972Stadtparteichef wurde, um dann - zwei Jahre später - als stellver-tretender Vorsitzender zur heute so gescholtenen staatlichenPlanungsbehörde nach Moskau zu wechseln. Sein Wechsel aufden Posten des weißrussischen Parteichefs 1983 fällt zeitlichzusammen mit den großen Wirtschaftsexperimenten, die unterAndropow in ausgewählten Bereichen begonnen wurden undeine größere Selbständigkeit und damit eine höhere Effektivitätder Betriebe zum Ziel hatten. Weißrussland gilt ohnehin alstechnologischer Schrittmacher in der Sowjetunion und bot sichfür solche Experimente geradezu an. Direkt von diesem Postenwechselte Sljunkow dann zurück nach Moskau, um im Zusam-menhang mit den angestrebten Wirtschaftsreformen unter Gor-batschow das Amt eines ZK-Sekretärs zu übernehmen, für daser sich im vergangenen Jahr vor dem ZK-Plenum mit einemanalytisch ausgezeichneten Referat empfohlen hatte, das auchvon der Prawda veröffentlicht worden war.
Neben diesen drei Neuernennungen im Politbüro signalisie-ren die beiden anderen, auf den ersten Blick weniger spektakulä-ren Personalentscheidungen ebenfalls eine wichtige Zäsur. Derneue Verteidigungsminister Jasow übernahm erwartungsgemäßden Posten eines Politbürokandidaten von seinem Vorgänger
58
Sokolow, der im Zusammenhang mit der Landung des westdeut-schen Sportflugzeuges unmittelbar beim Roten Platz entlassenworden war. Damit ist nun auch äußerlich die Übergangsphase inder militärisch-politischen Führung der Sowjetunion beendet, diemit dem Tod des früheren langjährigen und einflussreichen Ver-teidigungsministers Ustinow begonnen hatte. Darüber hinausgibt die krasse Entscheidung, den ehemaligen Parteichef vonKasachstan, Kunajew, nun auch noch unehrenhaft aus dem ZKauszuschließen, Spekulationen Auftrieb, dass man erstmals seitlanger Zeit möglicherweise auch noch rechtliche Schritte gegenein ehemaliges Politbüromitglied einleiten wird. Bei den jüngstenKommunalwahlen hatte Kasachstan mit 22 Stimmbezirken die(verhältnismäßig) höchste Zahl von Bezirken in der Sowjetunion,in denen - aus welchen Gründen auch immer - die Wahlen fürungültig erklärt wurden. So scheint die Sanktion gegen Kunajewauch gedacht als eine Maßnahme gegen seine immer noch akti-ven Gefolgsleute, die sich der neuen Politik verweigern. Trotzdieser so eindeutigen und langfristig angelegten Personalpolitikoperiert Gorbatschow immer noch mit zahlreichen Unbekann-ten. Denn im größten Flächenstaat der Welt mit etwa 19 Millio-nen Parteimitgliedern drücken diese Personalveränderungenzwar das Konzept des Generalsekretärs aus, nicht jedoch dieabsoluten Mehrheitsverhältnisse, wie sie im Mittelbau und an derBasis der Partei existieren. Deshalb sollte man die Warnungen,die Gorbatschow in eigener Sache immer wieder anbringt, auchaußerhalb der Sowjetunion ernst nehmen und nicht die Verände-rungen an der Spitze mit den noch vor Gorbatschow liegendenZielen verwechseln.
59
WACHTWECHSEL IM MILITÄRGorbatschows neuer Generalstabschef
Sergej Achromejew12
Als der siebzehnjährige Bauernjunge Sergej Achromejew sich1940 entschied, Berufssoldat zu werden, wütete der ZweiteWeltkrieg bereits in Europa; ein Jahr darauf wurde er auch in dieSowjetunion getragen. Fast ein halbes Jahrhundert später urteilteder junge Soldat von damals, inzwischen als Generalstabschefeiner der einflussreichsten Militärs in der Sowjetunion, über jeneJahre: Sie hätten die Völker gelehrt, dass „man den Krieg be-kämpfen muss, ehe er ausbrechen kann“. Wenn Achromejewheute in der internationalen Arena sowjetische Abrüstungspolitiknicht nur darstellt, sondern mitgestaltet, dann liegt in seinemJugenderlebnis des Großen Vaterländischen Krieges ganz gewisseiner der Beweggründe dafür.
Mit intellektueller Offenheit, die nicht durch doktrinäresSendungsbewusstsein, sondern durch einen klaren Willen zumDialog und die Fähigkeit zum Kompromiss geprägt ist, hatAchromejew bei seinen Gegnern viel Respekt erworben. Ameri-kanische Abrüstungsspezialisten sprechen mit Hochachtung voneinem Mann, den viele bis zum kleinen Zwischengipfel vonReykjavik offensichtlich unterschätzt hatten. Als Verhandlungs-führer einer Expertengruppe für Rüstungskontrolle in Reykjavikgehörte Achromejew zu den Vordenkern für weitere Schritte zurReduzierung strategischer Waffen, die für beide Seiten im Be-reich des Möglichen liegen. Achromejew ist für die politischeFührung der Sowjetunion der Garant dafür, dass von den eige-
12 Eine politische Rolle der Armee schien sich mit dem Personalwechselabzuzeichnen, um gleichzeitig frühere Hardliner unter dem neuen General-stabschef auszutauschen. Später bot sich Achromejew den Putschistengegen Gorbatschow an, um den Zerfall der Sowjetunion aufzuhalten. Nachdem Scheitern des Putsches erschoss sich Achromejew. Erstveröffentli-chung: Ein Soldat mit Augenmaß. Sergej Achromejew, der neue sowjetischeGeneralstabschef, ist kein Doktrinär. In: DIE ZEIT, Nr. 51, 11. Dezember1987.
60
nen Militärs kein Widerstand gegen einschneidende Abrüstungs-projekte vorgebracht wird. Deshalb konnte Moskau seinem Ge-neralstabschef auch die Bekanntgabe spektakulärer Entscheidun-gen überlassen, wie etwa das Einschwenken der Sowjetunion aufkurzfristige Kontrollen vor Ort im Rahmen der jüngsten Abrüs-tungsbeschlüsse. Als Achromejew im vergangenen Jahr dieseüberraschende Wende in Stockholm bekannt gab, hatte er sichbereits innenpolitisch als Befürworter eines neuen politischenDenkens profiliert. In seinem militärischen Glaubensbekenntnis,das er in der Ideologiezeitschrift Kommunist abgelegt hatte,demonstrierte Achromejew den Schulterschluss mit der gelten-den politischen Linie Gorbatschows: „Es ist völlig offensicht-lich“, so schreibt Achromejew, „dass ein weiteres Kernwaffen-Wettrüsten keinesfalls die Sicherheit des potentiellen Aggressorsgarantiert, sondern eher umgekehrt - sie vergrößert die Gefahr.“
Als der Generalstabschef jüngst in Genf, bei den letzten Au-ßenminister-Vorbereitungen für den INF-Vertrag, gefragt wurde,ob es den sowjetischen Militärs schwergefallen sei, auf eine sogroße Anzahl von Gefechtsköpfen zu verzichten, antwortete ererfrischend klar: „Wir hatten es schwer.“ Und er fügte hinzu:„Ich denke aber, dass auch unsere Partner es nicht leichter hat-ten, diesen Vertrag vorzubereiten.“ Selbst den schelmischenÜbertreibungen seines Außenministers Schewardnadse zeigtesich Achromejew gewachsen. „Die sowjetischen und die ameri-kanischen Militärs“, so hatte Schewardnadse seine Freude überdie gelungenen INF-Gespräche ausgedrückt, „erwartet bis Endedieses Jahrhunderts ein fröhliches Leben.“ Worauf Achromejewebenso schlagfertig wie doppeldeutig ergänzte: „Im Interesse desFriedens sind wir dazu bereit.“ Seine militärische Karriere ver-dankt Achromejew einer brillanten Mischung aus konzeptionel-lem Denken, organisatorischem Talent und strategischer Weit-sicht. Anfang der fünfziger Jahre durchlief er die Militärakademiefür Panzertruppen. 1967 schloss er die Generalstabsakademie inMoskau ab. Anschließend bewährte er sich auf verschiedenenPosten in der Truppenführung. 1974 wechselte er als Abteilungs-leiter in das sowjetische Verteidigungsministerium über. Seinemilitärpolitische Karriere verdankt Achromejew hingegen dem
61
Widerstand eines Vorgesetzten. Als der damalige ParteichefBreschnew seinen fordernden Militärs den Salt-II-Vertragschmackhaft machen musste, stieß er auf den erbitterten Wider-spruch des Ersten Stellvertretenden Generalstabschefs Koslow.
Der militärisch gebildete und politisch denkende Achrome-jew bot sich als Alternative an. Er löste 1979 Koslow ab undersetzte ihn auch zwei Jahre später als Kandidat des Zentralko-mitees. Während der damalige Generalstabschef Ogarkow nochmit phantastischen Ideen über die Führbarkeit des Krieges, auchdes begrenzten Nuklearkrieges spielte, blickte sein StellvertreterAchromejew offenbar schon in eine andere Richtung. Bereits imFrühjahr 1983 will die Washington Post von Achromejew erfah-ren haben, dass die sowjetische Militärführung nicht die Mög-lichkeit sehe, einen Nuklearkrieg zu gewinnen, dass sie keinestrategische Überlegenheit suche und einen begrenzten Nuklear-krieg ablehne. Damals führte der kranke Andropow die Partei.Die neuen Leute, die später unter Gorbatschow die Perestrojkaals psychologische Umorientierung anstreben sollten, hattenschon im Moskauer Apparat Stellung bezogen. Seinen damaligenVerteidigungsminister Ustinow stützte Achromejew gegen dieanhaltenden Material- und Technologieforderungen der vonBreschnew verwöhnten Militärs mit dem Hinweis, das sozialisti-sche Verteidigungsbündnis verfüge über alles Notwendige, umdie sozialistischen Errungenschaften zu schützen. Bis heute sinddie Gründe ungeklärt, die zur Ablösung des Achromejew-Vorgesetzten, des damaligen Generalstabschefs Ogarkow, ge-führt haben. Doch wurden schon früh bei öffentlichen Auftrit-ten Meinungsunterschiede zwischen Chef und Stellvertreterdeutlich. So vermittelte Achromejew vor der Presse 1983 sehrmaßvoll die sowjetischen Positionen bei den Mittelstreckenver-handlungen in Genf, die dann wegen der beginnenden Nachrüs-tung abgebrochen wurden. Sein Chef Ogarkow hingegen mussteden sowjetischen Auszug aus dem Verhandlungssaal hart vertei-digen; er verstärkte damit ein Negativ-Image, das er unter westli-chen Beobachtern schon mit einer anderen Hiobsbotschaft er-worben hatte: Im September 1983 musste Ogarkow nach mehr-tägigem Schweigen zugeben, dass die Sowjetunion den einge-
62
drungenen südkoreanischen Jumbo abgeschossen hatte. Fast aufden Tag genau ein Jahr später wurde er von seinem bisherigenErsten Stellvertreter als Generalstabschef abgelöst.
Inzwischen ist die sowjetische Militär-Enzyklopädie, die erst1983 unter der Redaktion von Ogarkow erarbeitet wurde, unterder Verantwortung von Achromejew noch einmal neu aufgelegtworden. Fachleute sehen in dieser Enzyklopädie kräftige Kontu-ren einer neuen außen- und militärpolitischen Linie, wie sieAchromejew selbst in seinem Bekenntnisartikel in der ZeitschriftKommunist vorgezeichnet hatte: „Obwohl der Imperialismus alsQuelle für das Entstehen eines Krieges weiterhin existiert, ist esobjektiv möglich und dringend notwendig, dass Staaten ver-schiedener Gesellschaftsordnung zur Abwendung eines Nuklear-krieges zusammenarbeiten.“ Auf diese Botschaft aus dem Mundseines führenden Militärs kann sich Michail Gorbatschow wäh-rend des Gipfels in Washington stützen.
63
DAS POLITISCHE SYSTEM HAT VERSAGTDie XIX. Parteikonferenz der KPdSU in Moskau13
Die Parteikonferenz in Moskau hat in der Sowjetunion einenProzess eingeleitet, an dessen Ende ein neues Verständnis vonMachtausübung stehen kann. Die angestrebten Verfassungsände-rungen sollen eine grundlegende Reform des politischen Systemsbewirken, das nach Einschätzung von Generalsekretär Gor-batschow „sich als unfähig erwiesen hat, uns vor dem An-schwellen von Stagnationserscheinungen im wirtschaftlichen undsozialen Bereich in den letzten Jahren zu bewahren und die da-mals eingeleiteten Reformen zum Misserfolg verurteilt hat”.14Mit dieser Konferenz ist die Zeit der einstimmigen Akzeptanzinnerhalb der Partei auch öffentlich beendet worden. Das Dog-ma des ausschließlich richtigen Weges hat in der Methodendis-kussion keinen Platz mehr.
Die vorgelegten Modelle für ein neues Präsidialamt, für dieparlamentarische Umstrukturierung und für die Demokratisie-rung der Partei sollen nicht als politische Erkenntnisse, sondernals politische Experimente betrachtet werden. Um den Fortgangder Perestrojka zu verstehen, muss man Denk- und Erfahrungs-fehler mit einkalkulieren. Dies hat die Parteikonferenz in allerWidersprüchlichkeit und emotionalen Aufwallung gezeigt. Denndie Perestrojka ist kein System, sondern ein Prozess, der im Lau-fe der Entwicklung seine Methoden selbst revidieren muss. Mitdieser Einschränkung muss man auch die vorläufigen Ergebnisseder Konferenz bewerten, die in ihren Resolutionen der ParteiVorschläge zur Diskussion unterbreitet hat, mit deren Hilfe der
13 Erstmals sprach Gorbatschow die „Unfähigkeit des politischen Systems“an, die anstehenden Probleme zu lösen. Damit gewann diese Parteikonfe-renz eine größere Bedeutung als die letzten Parteitage der KPdSU, nur nochzu vergleichen mit Chruschtschows Parteitag, der die Endstalinisierungeingeleitet hat. Erstveröffentlichung: Die XIX. Parteikonferenz der KPdSUin Moskau. In: Europa-Archiv 16, 1988, 459-464.14 XIX. Parteikonferenz der KPdSU, Dokumente und Materialien, Berichtdes Generalsekretärs, Moskau 1988, S. 40.
64
Umbau des politischen Systems weiterbetrieben werden soll. Zuden Ergebnissen der Konferenz zählen: die Funktionstrennungzwischen Partei- und Staatsaufgaben, eine Begrenzung derAmtsperioden in Partei und Staat sowie ein neues parlamentari-sches Verständnis auf der Grundlage eines Präsidialsystems miteinem ständig tagenden Parlament, dem Obersten Sowjet, undeiner Reform der Parlamente auf allen Ebenen. Nach dieserKonzeption würden die bisherigen Volksvertretungen, die Sow-jets, ihre Rolle als reine Abstimmungsmaschinerie für die Vor-entscheidungen der Partei verlieren und selbsttätige Parlamentewerden, deren Abgeordnete - anders als bisher - für die parla-mentarische Arbeit freigestellt werden. Schon in den Thesen zurKonferenz war festgehalten worden, dass die „materiellen undfinanziellen Möglichkeiten der örtlichen Sowjets wesentlich er-weitert” werden müssten und zu gewährleisten sei, „dass dieörtlichen Machtorgane eigenverantwortlich und selbständig überFragen der Entwicklung des jeweiligen Territoriums entschei-den”.15
Parallel dazu muss der Parteiapparat sich von solchen Aufga-ben trennen, die der Legislative (den Sowjets) und der Exekutive(dem Ministerrat und den Ministerien) vorbehalten sind. Analogzu einer Regierung verfügt bisher die Partei in hierarchischerGliederung bis zu den kleinsten regionalen Einheiten über Fach-abteilungen mit Abteilungsleiter für alle Bereiche des wirtschaft-lichen, sozialen und kulturellen Lebens. Am deutlichsten ist diesan den Abteilungen des Zentralkomitees der KPdSU abzulesen,dessen Apparat unter anderem auch einzelne Abteilungen für dieChemie-Industrie, für Baustoffe und Bauwesen oder das Ver-kehrs- und Fernmeldewesen unterhält. Nach dem jetzigen Kon-zept muss die Partei sich genau von solchen Aufgaben trennen,um sie ausschließlich den staatlichen Organen zu überlassen.Stattdessen soll sich die Partei auf konzeptionelle und ideologi-sche Arbeit beschränken. Innerhalb der Partei ist ein Demokrati-sierungsprozess festgeschrieben worden, wie er von Gor-
15 Thesen des ZK der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zur XIX.Unionsparteikonferenz, Moskau 1988, S. 19 f.
65
batschow bereits seit dem Januar-Plenum des Zentralkomitees1987 angestrebt wird. Die damalige ZK-Resolution folgte demParteichef nur zögernd. Inzwischen ist in den Resolutionen derXIX. Parteikonferenz die Demokratisierung vor allem des inner-parteilichen Wahlverfahrens festgeschrieben: „Bei der Wahl derMitglieder und Sekretäre aller Parteikomitees, bis hin zum ZKder KPdSU, sind den Kommunisten eingehende Erörterung derKandidaturen und geheime Abstimmung zu gewährleisten wieauch die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Kandidaten in dieStimmzettel einzutragen als die Zahl der zur Verfügung stehen-den Mandate.“16 Die Amtsperiode soll für alle Parteiposten auffünf Jahre festgelegt werden, gleichzeitig aber soll alle zwei bisdrei Jahre eine Parteikonferenz abgehalten werden mit demRecht, dabei die Zusammensetzung der Parteikomitees bis zu 20Prozent zu erneuern.
Dies gilt auch für die Unionskonferenz. Damit schafft sichdie Partei die Möglichkeit, auch innerhalb der Führungsgremienim Laufe der nächsten Jahre diejenigen Personalwechsel vorzu-nehmen, die bislang durch konservative Kräfte blockiert wurden.Allerdings beschränkt diese Resolution auch die Amtszeit derPolitbüro-Mitglieder und die des Generalsekretärs, die „höchs-tens zwei Amtsperioden hintereinander in die gleiche Funktiongewählt werden” dürfen.17 Daran gekoppelt ist eine Parlaments-reform, die bereits im kommenden Jahr wirksam werden soll.Bisher verfügt der Oberste Sowjet, der nur zweimal jährlich inMoskau tagt, über eine Nationalitäten- und eine Unionskammermit jeweils 750 Abgeordneten, also zusammen 1.500 Abgeordne-ten. Nach der Reform soll dieser Bestand an Abgeordneten zu-sätzlich durch 750 Deputierte erweitert werden und den Kon-gress der Volksabgeordneten bilden, der einmal jährlich tagenwird. Dieser Kongress wäre das Gremium, das in geheimer Ab-stimmung den Präsidenten wählt, der - mit weitreichenden Be-fugnissen ausgestattet - die Richtlinien der Politik bestimmt.Gleichzeitig soll aus diesem Kongress ein kleineres Parlament
16 XIX. Parteikonferenz der KPdSU, a.a.O., Entschließungen, S. 151.17 Ebenda, Entschließungen, S. 151.
66
nach dem alten Zwei-Kammern-System gewählt werden, dasständig tagt und nicht mehr als 450 Abgeordnete hat. Die Re-form soll aber auch die örtlichen Parlamente, die Sowjets, erfas-sen, die parallel zum Obersten Sowjet inhaltlich selbständigerarbeiten und entscheiden können, wobei auch hier die Abgeord-neten für eine gewisse Zeit als „Berufsparlamentarier” fungierenwerden. In seinem Bericht favorisierte Michail Gorbatschow dasspäter heftig diskutierte Modell, die jeweiligen Parteichefs, alsodie Ersten Sekretäre, gleichzeitig, aber in geheimer Abstimmung,zu den Vorsitzenden der Sowjets wählen zu lassen. Mit dieserVerzahnung glaubt Gorbatschow, auch das Amt des jeweiligenParteisekretärs einer Zustimmung oder eventuell auch Ableh-nung durch die Repräsentativorgane des Volkes auszusetzen.Überlegungen, dass Gorbatschow selbst für das Amt des vorge-sehenen Parlamentspräsidenten auf oberster Ebene kandidierenwürde, lassen die Schlussfolgerung plausibel erscheinen, er strebefür den Posten des Generalsekretärs auf diese Weise ebenfallseine Bestätigung durch die gesellschaftlichen Repräsentanten an.
Bei all diesen Vorschlägen ergibt sich jedoch wieder die oftbeobachtete Kluft zwischen konkreten Vorstellungen, die Gor-batschow in seinem umfangreichen Bericht vor der Parteikonfe-renz erörtert hat, und den Formulierungen in den Resolutionen,die sehr viel allgemeiner gehalten sind. Diese grundlegende Re-form des politischen Systems findet bei Gorbatschow eine Be-gründung, die auch die Notwendigkeit einer Vergangenheitsbe-wältigung mit einschließt: „Es geht, Genossen, - und wir allesollten dies heute zugeben - darum, dass das durch den Sieg derOktoberrevolution ins Leben gerufene politische System in derbekannten Etappe beträchtlichen Deformationen ausgesetztwurde. Im Ergebnis dessen wurden sowohl die uneingeschränkteMacht Stalins und seiner Umgebung als auch die Welle von Re-pressalien und Gesetzwidrigkeiten möglich. Die administrativenKommandomethoden in der Leitungstätigkeit, die sich in jenenJahren herausgebildet hatten, übten einen verderblichen Einflussauf verschiedene Entwicklungen unserer Gesellschaft aus. Indiesem System wurzeln viele Schwierigkeiten, die wir bis auf den
67
heutigen Tag miterleben.”18 Allerdings verzichtete die Parteikon-ferenz darauf, die Vergangenheitsbewältigung ebenfalls als Auf-gabe der Reform festzuschreiben. Die Aufgaben der Glasnostblieben auf die Forderung beschränkt: „Die KommunistischePartei und das Sowjetvolk brauchen die Wahrheit, vollständigeund objektive Informationen über alles, was in der Gesellschaftgeschieht.”19 Erst nach Abschluss der Konferenz sollte deutlichwerden, dass wesentliche Kräfte in der Partei im sowjetischenHistorikerstreit die konservative Variante verstärkt propagierenkonnten.
Dies wurde sichtbar an einem Schlagabtausch zwischen JurijAfanasjew, Rektor des Historisch-Archivarischen Instituts inMoskau, und der Parteizeitung Prawda.20 Dabei beharrte dasParteiblatt auf der Position, zu den Entscheidungen der ParteiEnde der 20er Jahre habe es keine Alternativen gegeben. Gleich-zeitig verurteilt das Blatt die Varianten-Forschung von Afanas-jew, der die Stalin-Zeit nicht als Konsequenz eines historischenDeterminismus akzeptiert. Zur Bewältigung dieser umstrittenenPhase in der sowjetischen Geschichte wurde auf der Parteikonfe-renz nur am Rande ein funktionalistischer Vorschlag von demukrainischen Schriftsteller Boris Olejnik unterbreitet; er fordertedie Veröffentlichung eines „Weißbuches über dunkle Zeiten”, indem die Opfer der Repressionen ebenso wie die Namen all der-jenigen veröffentlicht werden sollen, die an den Verbrechen aktivbeteiligt waren. Damit könne eine moralische Bestrafung dernoch lebenden Schuldigen erreicht werden.21 Allerdings wurdedie auf der Parteikonferenz formulierte Idee aufgegriffen, einDenkmal für die Opfer der Repressionen in Moskau zu errich-ten. Ein diesbezüglicher Beschluss des Politbüros wurde bereitsveröffentlicht und die Rehabilitierung verfolgter Parteimitgliederfortgesetzt. Ernüchternde Eingeständnisse musste Gorbatschowauf der Parteikonferenz angesichts der schleppenden wirtschaft-lichen Verbesserungen machen.
18 Ebenda, Bericht des Generalsekretärs, S. 39 f.19 Ebenda, Entschließungen, S. 169.20 Prawda, 26. Juli 1988, S. 3.21 Prawda, 2. Juli 1988, S. 8.
68
„Wir haben die Tiefe und Schwere der Deformationen undder Stagnation der vergangenen Jahre stark unterschätzt”,22 heißtes in der Bilanz. Zur Beschreibung der ernsthaften Finanzlagebenutzte Gorbatschow eine Begriffsgebung, die lange von sozia-listischen Finanzwirtschaftlern vermieden wurde: „Das Haus-haltsdefizit lastet auf dem Markt, untergräbt die Stabilität desRubels und der gesamten Geldzirkulation und verursacht Inflati-onsprozesse.”23 Der Zeitdruck, unter dem die angestrebtenWirtschaftsreformen stehen, wird aus der Resolution der Partei-konferenz deutlich, die eine politische Reform als Voraussetzungfür eine echte Wirtschaftsreform innerhalb des laufenden Plan-jahrfünfts, also bis 1990, für notwendig erachten. Einzelne Kon-ferenzdelegierte hatten auf drastische Weise dargelegt, dass ge-setzliche Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich ebenso wieder Reformwille selbst in großen Teilen des Landes noch keinepositiven Ergebnisse zeigen: „Schmerzen bereitet auch unserLebensalltag. Die Arbeiter stellen die Frage ganz direkt: Wo istdie Perestrojka? In den Lebensmittelgeschäften hat sich nichtsgeändert. Für Zucker wurden sogar Bezugsscheine eingeführt.Fleisch gibt es auch nicht, genauso, wie es früher war. Auch guteIndustriewaren sieht man gar nicht mehr.”24
In einer vernichtenden Analyse hatte das AkademiemitgliedLeonid Abalkin, ein führender Wirtschaftswissenschaftler in derPerestrojka, angemahnt, dass die Sowjetunion im wissenschaft-lich-technischen Bereich immer weiter hinter dem Weltniveauzurückbleibe und dieser Prozess einen immer gefährlicherenCharakter annehme.25 Deshalb wurde auch von der Parteikonfe-renz der Prozess der Perestrojka als „widerspruchsvoll, kompli-ziert und schwierig, im Widerstreit zwischen dem Alten und demNeuen”26 charakterisiert. Am deutlichsten wurde dieser Wider-
22 XIX. Parteikonferenz der KPdSU, a.a.O., Bericht des Generalsekretärs, S.7.23 Ebenda.24 Prawda, 1. Juli 1988, S. 6 (W. A. Jarin, Walzwerkarbeiter aus dem Hütten-kombinat W. I. Lenin, Gebiet Swerdlowsk).25 Prawda, 30. Juni 1988, S. 3.26 XIX. Parteikonferenz der KPdSU, a.a.O., Entschließungen, S. 130.
69
streit allerdings in einer personalpolitischen Debatte um dengestürzten Moskauer Stadtparteichef Boris Jelzin, die von denMassenmedien ausführlich dokumentiert wurde. Jelzin, der nachseiner Ablösung aus der politischen Führungsspitze in Minister-rang den Posten eines Ersten stellvertretenden Vorsitzenden desStaatlichen Komitees für Bauwesen bekleidet, wandte sich amEnde seiner eher sachlichen Rede mit einer Aufsehen erregendenBitte an die Delegation: „Genossen Delegierte, eine heikle Fra-ge: Ich möchte mich an Sie wenden in der Frage meiner persön-lichen Rehabilitierung nach dem Oktober-Plenum des ZK.” Umdann nach einer persönlichen Aufforderung durch Gorbatschowfortzufahren: „Eine Rehabilitierung nach 50 Jahren ist gang undgäbe geworden. Und das beeinflusst positiv die Gesundung derGesellschaft. Doch ich persönlich bitte um die politische Rehabi-litierung zu Lebzeiten. Ich meine, dass diese Frage grundsätzlichist im Sinne des sozialistischen Pluralismus der Meinungen, derKritikfreiheit, der Toleranz der Meinungsgegner, wie im Berichtund in Ansprachen der Konferenz verkündet worden ist.”27Damit war vor allem Politbüro-Mitglied Jegor Ligatschow her-ausgefordert, den Jelzin zuvor schon in Interviews namentlich alsPerestrojka-Gegner angegriffen hatte. Ligatschow nutzte seineReplik nicht nur zu einer heftigen Attacke gegen Jelzin, sondernauch zu einer Verurteilung der Praxis, über bürgerliche Massen-medien - wie Jelzin es tat - die Auseinandersetzung in SachenPerestrojka zu betreiben. Damit verband der Ideologie-Chef derSowjetunion scharfe Angriffe auf die sowjetische Presse, mitdenen er auf dieser Konferenz nicht alleine stand.
Ligatschow warf der Presse vor, im Rahmen der Glasnost dieSowjetmenschen als „Sklaven darzustellen, die angeblich nur mitLügen und Demagogie gefüttert und der schärfsten Ausbeutungunterworfen wurden”.28 Obwohl Ligatschow mit diesem zorni-gen Ausbruch sein Bekenntnis zur Perestrojka verband, wurdeder prinzipielle Unterschied zwischen den beiden wichtigstenGruppierungen in der Partei sichtbar. Gegenüber dem Konzept
27 Prawda, 2. Juli 1988, S. 10.28 Ebenda, S. 11.
70
von Gorbatschow, einen Rechtsstaat mit parlamentarischer Kon-trolle aufzubauen nach dem Grundsatz, „dass alles erlaubt ist,was das Gesetz nicht verbietet”,29 dem auch die Partei unterstelltist, favorisiert Ligatschow eine andere Variante, wonach die Par-tei als der Angelpunkt der richtigen gesellschaftlichen Interpreta-tion die Vorgänge im Staat bestimmen soll.
Das gesellschaftlich beherrschende Thema des innersowjeti-schen Nationalitätenkonflikts wurde zwar nicht unter aktuellemBezug auf Armenien diskutiert, fand jedoch in den Resolutionender Parteikonferenz Niederschlag. Nachdem schon die estnischeSowjetrepublik ein Papier vorgelegt hatte, das eine größere wirt-schaftliche und nationale Selbständigkeit forderte, schwenkte dieParteikonferenz wenigstens vorsichtig auf diesen neuen Kurs ein.An den beiden entscheidenden Stellen der Resolution heißt es:„Beachtenswert ist die Idee des Übergangs der Republiken undRegionen zu den Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungsfüh-rung mit exakter Festlegung ihres Beitrags zur Lösung von lan-desweit relevanten Programmen.”30 Und zur nationalen Identitätsoll beitragen „die freie Entwicklung und der gleichberechtigteGebrauch der Muttersprache durch alle Bürger der UdSSR unddas Erlernen der russischen Sprache, die von den sowjetischenMenschen freiwillig als Mittel zur Kommunikation zwischenNationalitäten angenommen wurde”.31
Hinter diesen Forderungen steckt mehr als die Wiederholungfrüherer Standpunkte. Denn nun soll eigens die Gesetzgebungüber die staatsrechtliche Gliederung des Landes verändert wer-den. „Dies macht entsprechende Abänderungen an der Verfas-sung der UdSSR und den Verfassungen der autonomen undUnionsrepubliken erforderlich.”32 Am weitesten sind bereits kurznach der Parteikonferenz die außenpolitischen Überlegungengediehen. Denn auf einer anschließenden Fachkonferenz wurdemit einem Referat von Außenminister Eduard Schewardnadsedie Plattform geschaffen, auf der die Prinzipien der neuen Au-
29 Thesen des ZK der KPdSU zur XIX. Unionsparteikonferenz, a.a.O., S. 6.30 XIX. Parteikonferenz der KPdSU, a.a.O., Entschließungen, S. 162.31 Ebenda, S. 163.32 Ebenda.
71
ßenpolitik zusammengefasst wurden. Schon im Vorfeld derKonferenz war in einem Thesenpapier die lange Zeit tabuisierteAußenpolitik in die Kritik mit einbezogen worden: „Eine kriti-sche Analyse der Vergangenheit zeigte, dass auch unsere Außen-politik von Dogmatismus und subjektivistischem Herangehengekennzeichnet war.”33 Auf der Folgekonferenz bestätigte Au-ßenminister Schewardnadse, dass im Atomzeitalter der Klassen-kampf nicht mehr Bestandteil der Außenbeziehungen zwischender Sowjetunion und den kapitalistischen Ländern sein kann:
„Der Kampf zweier entgegen gesetzter Systeme ist nichtmehr die bestimmende Tendenz der modernen Zeit.”34 Diebisherigen Fehler brachte Schewardnadse dabei in Verbindungmit innenpolitischen Fehlern: „Jede Abweichung von denLenin‘schen Prinzipien in der Innenpolitik erwies einen ernsthaf-ten, negativen Einfluss auf die sowjetische Diplomatie.”35 Alsdessen Folge kritisierte er auch, dass man „nicht immer alleMöglichkeiten genutzt habe, das Entstehen des ‚Eisernen Vor-hanges‘ zu verhindern sowie den Umfang und die Schärfe derKonfrontation und des Wettrüstens zu begrenzen”.36
Schon auf der Parteikonferenz hatte der Direktor des Insti-tuts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen in Mos-kau, Jewgenij Primakow, beklagt, dass in der sowjetischen Au-ßenpolitik gerade wegen ihres dogmatischen Charakters langeZeit Modelle ohne Alternativen entwickelt wurden. Auf diesenDogmatismus führte er auch den Fehler zurück, Truppen nachAfghanistan zu entsenden.37 Aus der Parteikonferenz leiteteAußenminister Schewardnadse die Notwendigkeit einer Offen-heit auch im Bereich der militärischen und militärisch-industriellen Tätigkeit „durch das höchste vom Volk gewählteOrgan” ab. Diese Offenheit soll auch „für die Nutzung dermilitärischen Kraft außerhalb der nationalen Grenzen des Lan-
33 Thesen des ZK der KPdSU zur XIX. Unionsparteikonferenz, a.a.O., S.27.34 Prawda, 26. Juli 1988, S. 4.35 Ebenda.36 Ebenda.37 Prawda, 2. Juli 1988, S. 8.
72
des” wie für den Verteidigungshaushalt gelten.38 In diesem Zu-sammenhang griff Schewardnadse auf ein Zitat von Gor-batschow zurück, als dieser im Mai 1986 auf einem Treffen allerBotschafter der Sowjetunion erstmals seine Überlegungen zueiner neuen Außenpolitik formulierte. Damals warnte Gor-batschow unter Hinweis auf die angespannte wirtschaftlicheLage: „Wir können uns nicht den Luxus leisten, die USA, dieNATO und Japan in allen militärtechnischen Novitäten nachzu-ahmen.”39
Zum Abschluss dieser Fachkonferenz wurde dann nichtmehr ausgeschlossen, dass künftige Korrekturen an den außen-politischen Prioritäten der Sowjetunion sogar Verfassungsände-rungen zur Folge haben könnten. Bislang heißt es in Artikel 28der sowjetischen Verfassung: „Die Außenpolitik der UdSSR istdarauf gerichtet, günstige internationale Bedingungen für denAufbau des Kommunismus in der UdSSR zu sichern, die staatli-chen Interessen der UdSSR zu schützen, die Position desWeltsozialismus zu stärken, den Kampf der Völker um nationaleBefreiung und sozialen Fortschritt zu stützen, Aggressionskriegezu verhindern, die allgemeine und vollständige Abrüstung durch-zusetzen und das Prinzip der friedlichen Koexistenz von Staatenunterschiedlicher Gesellschaftsordnungen konsequent zu ver-wirklichen.“
Gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit „einer vollen Rea-lisierung der friedlichen Koexistenz als höchstes universalesPrinzip der internationalen Beziehungen”40 wird möglicherweisedieser Verfassungsartikel zur Disposition stehen. Denn als Folgeder Parteikonferenz wurde besonders kritisch die bisherige Poli-tik gegenüber der Dritten Welt beleuchtet. Dabei ging es um die„Frage einer sozialistischen Orientierung im Zusammenhang mitder Konzeption einer freien Wahl”,41 hinter der sich das Problem
38 Prawda, 26. Juli 1988, S. 4.39 Ebenda; der Redetext ist bislang nur in einer Zusammenfassung ohnewörtliche Zitate veröffentlicht im Bulletin des Sowjetischen Außenministe-riums, Wjestnik MID, Nr. 1/5.August 1987, S. 4-6.40 Prawda, 28. Juli 1988, S. 4.41 Ebenda.
73
verbirgt, dass die Sowjetunion ihr Engagement auf solche Länderkonzentriert hat, die sich nominell zum Sozialismus bekannthaben, in Wirklichkeit aber weder den ideologischen noch denpolitischen Ansprüchen dieses Bekenntnisses gerecht gewordensind und im Grunde zu einer meist wirtschaftlichen Belastungfür die Sowjetunion geworden sind. Das Eingeständnis, „dassunsere Wissenschaft und Diplomatie nicht imstande war, invollem Ausmaß viele der heutigen Prozesse voraus zusagen”42zeugt von Fehlentscheidungen, für die ebenfalls der Dogmatis-mus verantwortlich gemacht werden muss. Denn bei manchemnationalen Unabhängigkeitskampf, der von der Sowjetunionunterstützt wurde, muss kritisch nachgefragt werden, ob nichtdas nationale Element und/oder die Unabhängigkeit zuweilenvernachlässigt wurden.
42 Ebenda
75
POSITIONSKÄMPFE
„DEMOKRATIEWIE DIE LUFT ZUM ATMEN!“
Gorbatschows „neuer Kurs“ stößt auch auf Widerstand43
Die 17-jährige Schülerin in der sibirischen Stadt Irkutsk be-kommt glänzende Augen: „Gorbatschow ist ein toller Typ.“ Undungefragt ergänzt sie: „Der geht wenigstens ran an die Leute undhört mal zu, was bei uns alles nicht klappt.“ Würden alle Sowjet-bürger diese Begeisterung teilen, dann wäre der rasche Umbauder Sowjetgesellschaft eine Leichtigkeit. Doch was Gorbatschowanstrebt, schafft auch Widerstand im Land. Der Generalsekretärwill die Wirtschaft reformieren, neue Technologien einführenund den behäbigen Apparat von Partei und Regierung auf Tou-ren bringen. Er möchte den Kommunismus von seiner erfolglo-sen und unterdrückenden Ideologie befreien. Schließlich soll dieSowjetunion als konkurrenzfähiges Gesellschaftsmodell gegenden Kapitalismus antreten.
Deshalb wirbt Gorbatschow um massive Abrüstung. Er willvermeiden, dass kriegerische Konflikte provoziert werden.Gleichzeitig braucht sein Land das Geld dringend für die eigeneWirtschaft. Denn der Weg zur Erneuerung in den Betrieben istweit und teuer. Gorbatschow hat jedoch bereits eine kleine Re-volution eingeleitet. Einer scharfen Kampagne gegen Korruptionund Vetternwirtschaft folgten Maßnahmen, mit denen die wirt-schaftliche Eigeninitiative gefördert werden soll. Private Taxisund Restaurants sind nun ebenso möglich wie privates Kleinge-werbe oder Familienbetriebe auf dem Land. Mit seinen Refor-men hat sich Gorbatschow freilich nicht nur Freunde im Land
43 Begeisterung und Skepsis sind die beiden Extreme, auf die Gorbatschowmit seiner Politik landesweit stieß. Erstveröffentlichung: „Wir brauchenDemokratie wie die Luft zum Atmen!“ Gorbatschows „neuer Kurs“ stößtauch auf Widerstand im eigenen Land. In: Abendzeitung München, 23.Februar 1987.
76
gemacht. Doch: „Wer unseren Weg nicht mitgehen will, vondem müssen wir uns trennen“, heißt seine Devise. Und danachwurde in der Partei aufgeräumt, wurden Tausende entlassen oderversetzt. Neue Gesetze lassen die Gründung von Gemein-schaftsunternehmen mit ausländischem Kapital zu. Ein deut-sches Unternehmen kann so mit westlichem Fachwissen undsowjetischem Personal seine Produkte billiger auf den Marktbringen. Den Nutzen haben beide Seiten: Die Sowjetunion bautdamit ihren technologischen Rückstand ab und erschließt sichneue Märkte, die auch noch Devisen in das Land bringen.
Für eine anständige Qualität der Produkte sollen unabhängigeKontrolleure sorgen. Seit Jahresbeginn passen sie in den Fabri-ken wie Schießhunde auf, damit nicht - wie früher häufig ge-schehen - zwar Autos geliefert werden, aber mal ohne Ersatzrei-fen, mal ohne Armaturen oder gleich gar ohne Lenkrad. Auch imalltäglichen Leben kann man die Auswirkungen der neuen Politikspüren:
Das Fernsehprogramm wurde völlig umgekrempelt. Vielelangweilige, aber ideologisch konforme Sendungen wurden aus-gewechselt. Filme, die lange Zeit verboten waren, auch solche,die den Stalinismus kritisieren, kommen auf den Bildschirm undin die Kinos. Selbst die Nachrichtensendungen wurden geändert.Früher berichteten sie nach Schwarz-Weiß-Klischees über dieguten Taten der sozialistischen Länder und die soziale Not imausbeuterischen Kapitalismus.
Jetzt wird über den Westen objektiver berichtet. Besondersbeliebt sind so genannte Fernsehbrücken etwa mit Amerika oderJapan. Dabei sitzen zwei Diskussionsgruppen jeweils im Fern-sehstudio Moskau und im anderen Land. Sie können sich überBildschirme sehen und diskutieren mit Hilfe von Dolmetschernmiteinander. Sogar die Parteizeitung Prawda hat jetzt eine Gast-kolumne für westliche Politiker und Journalisten eingerichtet.Diese Artikel, die natürlich oft nicht mit sowjetischen Positionenübereinstimmen, werden zwar von der Prawda noch einmalkommentiert. Aber die Leute erfahren aus erster Hand, wie manim Westen denkt. Auch Missstände im Inneren, früher als Tabusverschwiegen, werden offengelegt. Etwa, dass 48.000 Drogen-
77
süchtige registriert sind, oder dass in Kasachstan nur 30 Prozentdes Fleisches in die Geschäfte gelangt, während der Rest inschwarzen Kanälen der Oberen Zehntausend verschwindet.Diese Kampagne für mehr Offenheit, auf Russisch Glasnost, hatdas ganze Land erfasst.
In den Kinos sorgt ein Film für Aufsehen, in dem jugendli-che Aussteiger, Drogensüchtige und Rocker schlichtweg erklä-ren, Geld sei für sie das Wichtigste. Kein Wort davon, dass sie inden Idealen der Sowjet-Ideologie ihre Zukunft sehen. Zurückge-kehrte Soldaten aus Afghanistan klagen, sie sähen in ihrem Ein-satz kein Heldentum. Und Gorbatschow macht keinen Hehldaraus, dass Moskau seine Soldaten lieber heute als morgen ab-ziehen möchte. Als Gorbatschow auch noch eine Diskussion inSachen Justizreform begann, war klar, dass dabei die Frage derpolitischen Gefangenen eine Rolle spielt. Erst wurden berühmteDissidenten wie Schtscharanski freigelassen. Dann durfte Sach-arow aus der Verbannung zurückkehren. Und nun sind schonetwa 150 Gewissenshäftlinge in Freiheit. Fast noch einmal soviele sollen folgen. Damit schafft sich Gorbatschow neue Ver-bündete.
Auf dem Friedensforum in Moskau trat Andrej Sacharow auf.Er setzte sich wie immer für alle politischen Gefangenen ein,plädierte aber ebenso heftig gegen das geplante amerikanischeRaketensystem im Weltraum, SDI. „SDI ist völlig sinnlos undwird nie funktionieren.“ Im privaten Gespräch gibt Sacharowunumwunden zu: „Der Kurs von Gorbatschow verdient volleUnterstützung.“ Und diesen Kurs hat Gorbatschow klar festge-legt, als er forderte: „Wir brauchen Demokratie wie die Luft zumAtmen!“ Kein leichter Weg. Innerhalb der Partei blocken Alt-Apparatschiks das „neue Denken“ (zum Beispiel geheime Wah-len, Abschaffung der Einheitslisten) ab. Führer „befreundeter“Länder im sozialistischen Lager zeigen sich irritiert. Gefährlichwürde es für Gorbatschow, wenn die Militärs in Ost und Westseine weit reichenden Abrüstungsangebote als Zeichen einerSchwäche missverstehen würden. Das größte Hindernis für dieneue Politik aber liegt im eigenen Land - 280 Millionen Men-schen, die sich schnell an die neuen Freiheiten gewöhnt haben,
78
die aber, zu lange geübt, dass „die da oben“ alles regeln, lieberabwarten, als ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und aktivzu werden. Doch die Sowjetunion - so warnt Gorbatschow - hatkeine andere Wahl. Sie muss den neuen Weg gehen.
79
DIE GRENZEN DER BELASTBARKEITWie viel Reformpolitik kann die Sowjetunion vertragen?44
Mehr als zwei Jahre nach dem Amtsantritt von Michail Gor-batschow zählt es zu den schwierigsten Aufgaben, ein angemes-senes Urteil darüber zu fällen, wie die neue Politik des sowjeti-schen Parteichefs innerhalb der Sowjetunion aufgenommen und- vor allen Dingen - von den Sowjetbürgern in die Praxis umge-setzt wird. Die Sowjetunion als größter Flächenstaat der Erdebeherbergt mehr als 280 Millionen Menschen. Das Land ist infünfzehn Republiken gegliedert, die von der Nationalgeschichteihrer jeweiligen Völker stärker geprägt sind als von den 70 JahrenSowjetmacht.
Ich erinnere nur an die Hochkultur der Armenier, die als ers-te das Christentum zur Staatsreligion erklärt haben, noch vorRom. Auch heute noch gilt, dass die armenische Nationalität unddie Zugehörigkeit zur armenischen Nationalkirche für den größ-ten Teil der Bevölkerung eine Identität darstellen. Neben solchenVölkern, die in eigenen Sowjetrepubliken leben, gibt es nochzwanzig autonome Republiken, deren Existenz außerhalb derSowjetunion kaum bekannt ist. Dazu kommt eine Vielzahl vonautonomen Gebieten und Kreisen für insgesamt mehr als ein-hundert Völker und Völkerschaften mit eigenen Sprachen undKulturen.
Als Beispiele seien nur einige von ihnen erwähnt, über diesogar unsere westlichen Enzyklopädien wenig Auskunft geben
44 Je populärer die Gorbatschow-Politik im Westen wurde und je größerseine außenpolitischen Erfolge waren, desto kritischer schien sich die Lageim Inneren der Sowjetunion zu entwickeln. Trotz der Offenheit in Fragender Kultur und Geschichtsbetrachtung blieben die wirtschaftlichen und dienationalen Fragen die entscheidenden Herausforderungen, die auch von derPerestrojka nicht in wenigen Jahren bewältigt werden konnten. Erstveröf-fentlichung: Kann die Sowjetgesellschaft die Herausforderung einer Re-formpolitik unter Gorbatschow bestehen? In: Jahreshefte GymnasiumJosephinum, Hildesheim 1987/88 [Festvortrag 26.09.1987], 57-64. Nach-druck in: Europa im Wandel, Hildesheim 1993.
80
wie die Gagausen, ein christianisiertes Turkvolk an der südwest-lichen Grenze der Sowjetunion oder die Chakassen, ein mongoli-sches Volk in Südsibirien. Und wer kennt schon die Jakuten, dieim hohen Norden der Sowjetunion in einer autonomen Republikwohnen, die zwölf Mal größer ist als die Bundesrepublik? DieserExkurs soll zweierlei demonstrieren: Erstens ist die neue Re-formpolitik von Gorbatschow eine Herausforderung an die ver-schiedenartigsten Völkerschaften. Zweitens wird damit klar, dassdie Moskauer Verhältnisse, unter denen die meisten neuen Ge-danken formuliert und erstmals erprobt werden, keinesfalls ty-pisch oder vorbildlich für das ganze Land sein können. Danebenhat die Sowjetmacht ähnlich dem Zarismus - hier liegen wesent-liche machtpolitische Übereinstimmungen - stets auf den Zentra-lismus gesetzt. Das daraus entstandene obrigkeitliche Denkenhat sich nicht selten zum Nachteil Russlands und ebenso auchzum Nachteil der heutigen Sowjetunion ausgewirkt. Denn jedesZuwarten auf Entscheidungen von oben wie auch die Gewöh-nung daran, dass jeweils andere als man selbst die Verantwortungtragen, sind heute mehr denn je die wirkliche Gefahr für eineneue Politik.
Natürlich finden sich überall auf Reisen im Land Vertretervon Staat und Partei, die schnell die neuen Losungen im Mundeführen. Glasnost, die Öffentlichkeit, die in erstaunlichem Maßein der Zentralpresse hergestellt ist, spielt dabei eine wichtigeRolle. Aber auch die Perestrojka, der Umbau, mit dem Mittel derwirtschaftlichen Uskorenje, der Beschleunigung, und nicht zu-letzt die Demokratisazija, die Demokratisierung der Gesellschaft.Doch häufig richtet sich das Verhalten vieler Vertreter von Staatund Partei, von Management und Wirtschaft direkt oder indirektgegen diese neuen Gedanken. Viele beharren auf der so genann-ten erprobten Praxis der Vergangenheit.
Allerdings hat sich bei der Selbstdarstellung besonders ge-genüber dem Ausländer etwas entscheidend verändert. Bereitwil-lig erörtern jetzt Betriebsdirektoren Mängel in der Produktion,klagen offen über unerfüllte Pläne oder unrealistische Planvorga-ben. Doch gleichzeitig wissen viele Verantwortliche nicht zusagen, wie die Umstellung in einem Betrieb zu bewerkstelligen
81
sei. Aus all dem spricht oft genug eine gewisse Hilflosigkeit ge-genüber den noch nicht ausformulierten Forderungen der zent-ralen Führung. Indessen hat Moskau - man möchte fast sagennach einem offensiven Überraschungsprinzip - die Sowjetbürgerebenso wie das Ausland mit ungewöhnlichen Maßnahmen kon-frontiert, die sich nicht nur auf den Abrüstungsbereich be-schränken. Da ich berufsbedingt in Moskau gewissermaßen Bil-der in Worte umsetzen und vermitteln muss, erlauben Sie mirdazu nun eine Rückblende auf ein Ereignis, mit dem zwar nichtalles angefangen hat, das aber als Schlüsselerlebnis auch späternoch von Zeitgeschichtlern zitiert werden wird: Es war ein kalterDezembermorgen im vergangenen Jahr. Die graue Dämmerunglag noch über dem Jaroslawer Bahnhof in Moskau, als sich einestoßende Menschenmenge an den Nachtzug aus Gorki herand-rängte. Flammende Kamerascheinwerfer leuchteten grell in eineoffene Waggontür. Dutzende von Journalisten aus aller Weltwarteten auf den lebenden Beweis dafür, dass unter Gor-batschow eine neue Ara angebrochen war, die mehr umfasst alsnur kosmetische Korrekturen an der Oberfläche der sowjeti-schen Gesellschaft. Dann war es soweit:
Nach siebenjähriger Verbannung kehrte der Bürgerrechtlerund Wissenschaftler Andrej Sacharow nach Moskau und damitin die internationale Öffentlichkeit zurück. Seine Stimme zittertenoch, als er denjenigen dankte, die sich unermüdlich für ihneingesetzt hatten. Dieser Moment der ersten Begegnung gehörtefür alle Beteiligten zu den bewegendsten Erlebnissen der letztenJahre. Dann schilderte Sacharow die Ungeheuerlichkeit, die manbis dahin bestenfalls für ein Gerücht gehalten hatte: „Am 16.Dezember um drei Uhr nachmittags rief Michail SergejewitschGorbatschow bei mir an und sagte, dass eine Entscheidung übermeine Befreiung gefallen sei, also dass ich nach Moskau zurück-kehren kann. Und ich sagte ihm, dass ich dankbar für diese Ent-scheidung bin.“
Der Generalsekretär und der Dissident im gemeinsamen Te-lefongespräch - das war gewissermaßen ein symbolischer Akt derVersöhnung mit den Brüchen der Vergangenheit. Doch es bliebnicht bei dem symbolischen Schritt. Sacharow erhielt seinen
82
alten Arbeitsplatz in der Akademie der Wissenschaften wieder.Unter den Tränen seiner Kollegen feierte er eine triumphaleRückkehr in sein Büro, das seit seiner Verbannung für ihn frei-gehalten worden war. Bei einem internationalen Friedensforumtrat Sacharow dann als Redner auf. Und als im Kremlpalast Par-teichef Gorbatschow die Freilassung von 140 politischen Gefan-genen erwähnte, die kurz zuvor die sowjetischen Lager verlassenkonnten, da blendete das staatliche Fernsehen in abgezirkelterRegie Andrej Sacharow ein, der unter den Zuhörern saß. Ganzgleich, wie viel die Weltöffentlichkeit bis dahin von den Refor-mansätzen des dynamischen Parteichefs verstanden hatte, dieBotschaft war deutlich: Wir wollen unsere Gesellschaft vonGrund auf erneuern und scheuen nicht mehr den Disput mitunseren Gegnern. Ganz im Gegenteil - Kritik und Auseinander-setzung mit den Andersdenkenden ist nun Programm.
Alle Bereiche der Sowjetunion - so der Eindruck - sollen re-formiert, sollen umgebaut werden. Die Zauberformel dafür heißtPerestrojka, ein Begriff, den auch Politiker anderer Länder inzwi-schen - fast mit Respekt - anwenden wie etwa der amerikanischeAußenminister Shultz bei einem seiner Moskau-Besuche, als ervor Journalisten sagte: „Ich hatte einige gute Gespräche über diewirtschaftliche Lage und das Neue Denken - Perestrojka, glaubeich, ist die Bezeichnung dafür. Es ist ganz klar, dass in der Sow-jetunion einige wichtige Veränderungen um sich greifen. AlleVertreter, mit denen ich sprach, haben diesen Prozess erörtert.Und ich bin froh, dass ich diese direkten Auskünfte bekommenkonnte.“ Selbst die konservative britische PremierministerinMargaret Thatcher kam über diesen neuen Stil förmlich insSchwärmen und unterbreitete in Moskau trotz ihrer heftigenAttacken auf die Sowjetunion dem Parteichef Gorbatschow fastleidenschaftliche Komplimente, als sie auf einer internationalenPressekonferenz öffentlich eingestand:
„Dieses war der faszinierendste und belebendste Besuch,den ich als Premierministerin jemals im Ausland durchgeführthabe. Ich möchte Mr. Gorbatschow, der sowjetischen Regierungund dem russischen Volk für den warmen und herzlichen Emp-fang danken. Ich hätte ganz sicher zu keiner interessanteren und
83
entscheidenderen Zeit in die Sowjetunion kommen können. Mr.Gorbatschow hat mich während unserer ausführlichen Gesprä-che mit einem bemerkenswerten Blick in die inneren Verhältnis-se der Sowjetunion belohnt. Ich kann mich nicht erinnern, dassich jemals so viel Zeit für Diskussionen mit einem der Weltpoli-tiker verbracht habe. Mr. Gorbatschow gab mir einen vollständi-gen Überblick über die Umgestaltung in der Sowjetunion und ichbegrüße diesen Prozess ganz ausdrücklich.“
Was aber will Gorbatschow mit der Perestrojka, von der soviele schwärmen, in der Sowjetunion wirklich verändern? - Undwichtiger noch, was kann in absehbarer Zeit erreicht werden?Wie reagiert der normale Sowjetmensch darauf, dass plötzlichviele Werte nicht mehr stimmen sollen, an die er sich seit Jahr-zehnten gewöhnt hatte? Wer garantiert schließlich, dass diesesgewaltige Vorhaben einer zweiten Revolution nicht doch - wie soviele andere Reformansätze in der sowjetischen Geschichte -wieder einmal in den Mühlen der Bürokratie, Gleichgültigkeit,Korruption und Vetternwirtschaft untergeht? Die Antworten aufdiese Fragen können nur vorläufigen Charakter haben. Es gibtbislang nur eine endgültige Erkenntnis, die auch von MichailGorbatschow geteilt wird: Die Sowjetunion hat sich nach seinenWorten am Ende der Breschnew-Zeit im Vorstadium der Krisebefunden. Nun bleibt nur noch das Mittel der radikalen Refor-men. Einen Weg zurück gibt es nicht. Diese Bestandsaufnahmehatte Gorbatschow bereits kurz nach seinem Amtsantritt imFrühjahr 1985 mit einer heftigen Kritik an Ministern und Partei-kadern verbunden. Seine Schlussfolgerung lautete damals:
„Wer nicht bereit ist, unseren Weg mit uns zu gehen, vondem müssen wir uns trennen.“
Noch gibt es keine Statistik, die im Detail belegt, wie vieletausend oder gar zehntausend Funktionsträger versetzt, gerügt,abgelöst oder entmachtet wurden. Und dieser Prozess geht wei-ter. Gorbatschow sieht dabei seinen besten Verbündeten in derBevölkerung. Mit populistischem Geschick wirbt er gewisserma-ßen auf der Straße für seine Politik. Vor laufenden Fernsehkame-ras erläutert er im offenen Gespräch mit den Sowjetbürgern dieSchwierigkeiten, die zu bewältigen sind. Doch der Parteichef
84
bietet den Sowjetbürgern nicht nur die Genugtuung einer volks-tümlichen Nähe, in der viele ihre persönlichen Probleme gutaufgehoben sehen. Gorbatschow fordert auch. Und er fordertviel von den Sowjetmenschen. Zu allererst soll besser und mehrgearbeitet werden. Dabei geht es nicht um die unrealistischeParole, den Kapitalismus in seiner wirtschaftlichen Leistungsfä-higkeit zu schlagen. Dieses Ziel, in der Chruschtschow-Äravollmundig gefordert, wurde unter Gorbatschow sogar eigensaus dem Parteiprogramm gestrichen. In ihren wirtschaftlichenZielsetzungen wirkt die Perestrojka sehr viel buchhalterischer.Zunächst einmal müssen Grundmängel in der Planwirtschaftbeseitigt werden. Die Erkenntnis, dass auch in der sozialistischenWirtschaft Zwei mal Zwei Vier ist, wurde jahrelang nämlichnicht im Moskauer Planungszentrum, sondern im fernen Sibiriengepflegt. Eine Zweigstelle der Akademie der Wissenschaften inNowosibirsk beschäftigt Fachleute, die immer wieder wirt-schaftswissenschaftliche Vorstöße gewagt haben und nun unterGorbatschow endlich Gehör finden. Zu ihnen zählt auch AbelAganbegjan, der inzwischen nach Moskau umgesiedelt ist undsich in einem eigenen Institut Gedanken darüber macht, wie manmit Gewinn produziert. Seine Fragestellung, was durch diePerestrojka“ zunächst erreicht werden muss und seine Antwortklingen sachlich, aber ernüchternd. In einem Gespräch erläuterteer:
„Wir brauchen eine Erhöhung der Produktivität um das 1,3bis 1‚5-fache. Und zwar im laufenden Fünf-Jahr-Plan. Im nächs-ten und im übernächsten Fünf-Jahres-Plan müssen wir dannnoch eineinhalbmal besser arbeiten als im jetzigen Fünf-Jahres-Plan.“
Man muss sich einmal klarmachen, dass damit die notwendi-ge wirtschaftliche Basis für die Perestrojka erst bis zur Jahrtau-sendwende erreicht wäre, vorausgesetzt überhaupt, die sowjeti-schen Arbeiter schafften die konstante Steigerung der Produkti-vität. Dabei lässt Aganbegjan keinen Zweifel, dass solche an-spruchsvollen Ziele nur erreicht werden können, wenn die Sow-jetgesellschaft eine gewaltige Hürde überspringt. „Wir brauchenviel radikalere Maßnahmen“, lautet eine der Grundforderungen.
85
Demnach werden jetzt auch die staatliche Planungsbehörde unddie Ministerien, die Staatsbank, das Finanzwesen, das System derMaterialversorgung sowie das gesamte Lohn- und Preissystem indie Reform mit einbezogen.
Es ist schon viel geschehen. Mit neuen Gesetzen über dieLeitung der Betriebe, mit dem Ansporn größerer Selbständigkeitund dem Risiko, auf eigene Kosten zu arbeiten, sollen die Unter-nehmen stimuliert werden; sie sollen sich ihre Märkte förmlicherobern. Der Staat als Auftraggeber wird sich weiter zurückzie-hen. Angebot und Nachfrage sollen die Produktion bestimmen.Die neue Devise lautet: Soviel Initiative wie möglich und sowe-nig Plan wie nötig. Zusätzliche Hilfestellung erwartet sich derWissenschaftler dabei von flankierenden privatwirtschaftlichenUnternehmen nach dem Vorbild anderer sozialistischer Länderwie der DDR oder Ungarn. Doch die Praxis ist schwerfälliger alserwartet. Ein neues Gesetz über private Arbeit schafft nochnicht den erwünschten Freiraum. Betroffene behaupten gerne,damit sei lediglich die Schwarzarbeit legalisiert worden, undüberdies kassiere der Staat nun dafür auch noch Steuern.
Häufig legen die Behörden solchen Privatinitiativen Steine inden Weg. In anderen Bereichen wird der Umbau oft nicht ernstgenommen. So klagte Gorbatschow selbst, dass in der Sowjetre-publik Armenien eine ungerechtfertigte Gelassenheit gegenüberder Perestrojka herrsche. Und in einer anderen Kaukasusrepublikerklärte ein Vertreter der Schwerindustrie im Gespräch: „Jetztetwas ändern hieße doch, dass unser Betrieb bisher schlechtgearbeitet hat. Das ist nicht der Fall. Also mag die Perestrojkazwar für andere in Frage kommen, bei uns ist sie kein vordringli-ches Ziel.“ Auf diesen Vorfall angesprochen, meinte ein Journa-list in Zentralrussland im privaten Gespräch: „Die Perestrojka istvor allem ein psychologisches und erst danach ein wirtschaftli-ches Problem. Aber wir können nicht mit den wirtschaftlichenVeränderungen warten, bis sich alle Leute umorientiert haben.“Genau darin aber liegt das Dilemma, das auch im Gespräch miteinem Kombinatsdirektor am Kaspischen Meer zum Ausdruckkommt. Denn für ihn ist die Perestrojka kein gesellschaftspoliti-scher, sondern nur ein formal-technischer Vorgang, der für ihn
86
bereits abgeschlossen ist. Seine verblüffende Erklärung lautete:„Also was die Perestrojka betrifft, so haben wir uns schon längstumgebaut. Jetzt hat das nichts mehr zu tun mit der Perestrojka,weil ja hier alles, was mit der Perestrojka zusammenhängt - alsogute Qualität in der Produktion, Planerfüllung - getan wird. Umes kurz zu machen: Wir haben schon längst die Perestrojkadurchgeführt. Die Sache ist für uns abgeschlossen.“ Hinter einersolchen Aussage verbirgt sich zweierlei: Zunächst haben vieleMenschen in der Sowjetunion noch gar nicht verstanden, wasalles mit der Umgestaltung erreicht werden soll. Und zweitenslässt sich mit größerer Entfernung von Moskau auch eine größe-re Distanz zu den politischen Ideen der Zentralmacht beobach-ten. Schwieriger ist es mit den widerstrebenden Kräften, die sichgegen die Gorbatschow-Politik stellen.
Nach der Einschätzung von Valentin Falin, dem Chef dersowjetischen Nachrichtenagentur Nowosti und früherem Sow-jetbotschafter in Bonn, gehören dazu folgende Gruppen: Erstensjene Menschen, die früher zu oft enttäuscht wurden, um nunirgendwelchen Versprechungen zu glauben. Zweitens so genann-te Hüter der Instruktion, die als kleine Machthaber in den Mini-sterien komfortabel gelebt haben und nun aus Furcht vor Presti-ge- und Machtverlust gegen die Erneuerung sind. Drittens Dog-matiker, denen die Perestrojka prinzipiell nicht in den Kopf geht.Und viertens schließlich Kräfte in der sowjetischen Generalität,die mit dem neuen Denken nicht zurechtkommen.
Erlebnisse im sowjetischen Alltag ergänzen diese Mängellistenoch. Denn ein Teil der Bevölkerung entzieht sich durch passi-ves Verhalten völlig dem politischen Prozess; andere Gruppenwiederum haben - spiegelbildlich zur blockierenden Gruppe imApparat - kleine Machtgebilde von Schieberei und Schwarz-markttätigkeit aufgebaut und klagen nun darüber, dass unterBreschnew doch alles besser gewesen sei. Doch alle Spekulatio-nen über den tatsächlichen Anteil dieser Leute an der Bevölke-rung sind müßig. Solche Eindrücke lassen sich nicht quantifizie-ren, ein Problem, das auch den sowjetischen Behörden selbsterheblich zu schaffen macht. Denn immer noch funktioniert dasbekannte System der zwei Produktionswelten:
87
Geschäftstüchtige „Privathändler“ nehmen eine oft unterge-ordnete Stelle in einem Betrieb an, am besten nicht in der Pro-duktion, sondern in der Verwaltung oder inneren Dienstleistung.An ihrem Arbeitsplatz erscheinen sie nur einmal im Monat, amZahltag. Sie nehmen ihren Lohn in Empfang, um ihn gleichweiterzuleiten an den nächsten Vorgesetzten. Für diesesSchmiergeld ist der Vorgesetzte bereit, dem zahlungswilligenMitarbeiter einen ganzen Monat lang dessen angebliche Anwe-senheit am Arbeitsplatz zu attestieren. Strenge Arbeitsplatzkon-trollen sollen diesen Missbrauch abschaffen, doch die Zählebig-keit eingefahrener Gewohnheiten entpuppt sich als enorm wi-derstandsfähig. Dies ist nur ein Beispiel für die Schwierigkeitender Planungsbehörden, über Arbeitskräfte und Arbeitsprodukti-vität zuverlässige Aussagen zu erstellen. Wenn man Sowjetbürgerauf ihre zwar nicht negative, aber doch oft indifferente Haltungzur Perestrojka anspricht, wird ein Argument recht häufig ver-wendet: „Wir wollen erst einmal mehr Geld auf der Hand undbessere Waren im Laden sehen. Dann werden wir auch mehrarbeiten.“ Auch diese Gruppe von Menschen lässt sich nichtquantifizieren. Sie ist aber nach offiziellen Befürchtungen großgenug, um den Fortgang der Entwicklung erheblich abzubrem-sen. Schließlich trifft man auch viele zustimmende Meinungen.Das sind Sowjetbürger, die in dem Unternehmen der neuenPolitik eine erhebliche Investition in die Zukunft sehen. Vielekönnen sich dabei allerdings nicht konkret vorstellen, worauf diePerestrojka wirklich hinauslaufen soll.
In dieser Situation werden begierig Veröffentlichungen auf-gegriffen, die mögliche Perspektiven der neuen Politik ohnedogmatische Scheuklappen skizzieren. Bestes Beispiel dafür warein Aufsatz des Wirtschaftswissenschaftlers Nikolaj Schmeljow,der in einer populären und weit verbreiteten Zeitschrift veröf-fentlicht wurde. Darin plädierte er für die Einführung marktwirt-schaftlicher Elemente und legte dem Leser eine entlarvendeAnalyse der bisherigen wirtschaftlichen Verhältnisse vor, derenÜberwindung in Zukunft auch Arbeitslosigkeit und soziale Un-terschiede nicht ausschließe. Dieser Aufsatz gab in Moskau denAnstoß für eine anhaltende Diskussion darüber, ob die weitere
88
Entwicklung im Land überhaupt noch mit dem Etikett der sozia-listischen Planwirtschaft zu vereinbaren sei. Die Wellen schlugensogar so hoch, dass Gorbatschow in einem spontanen Gesprächmit der Bevölkerung beruhigend eingreifen musste. Die Analysedes Aufsatzes, so bescheinigte er darin die erschreckenden Fak-ten einer darbenden Wirtschaft, sei durchaus richtig. Nur dieSchlussfolgerungen, so beruhigte er seine Zuhörer, seien für denSozialismus unannehmbar. Denn Arbeitslosigkeit werde es nichtgeben. Dann wetterte Gorbatschow unter Zustimmung der Pas-santen gegen Gleichmacherei. Wenn die einen arbeiten und dieanderen nicht, aber alle das gleiche Geld bekommen, so derParteichef, dann habe das nichts mehr mit Sozialismus zu tun.Damit trifft Gorbatschow freilich eine Sorge der Sowjetbürger,dass möglicherweise die Perestrojka nicht nur Erfreuliches be-schert. Die Angst vor der Schmälerung des ererbten Besitzstan-des machte sich bemerkbar, seit Gorbatschow eine Perspektivevon zwei, in manchen Fällen sogar drei Planjahrfünften für denwirtschaftlichen Umbau und Aufstieg voraussagte. Im Klartexthieße das: mindestens die nächsten fünf Jahre, wenn nicht sogarlänger noch, muss man den Gürtel enger schnallen.
Tatsächlich bekommen viele Menschen zunächst die negati-ven Seiten der Perestrojka gewissermaßen am eigenen Leib zuspüren. Denn mit der Einführung einer strengen Qualitätskon-trolle in den Fabriken ist das Einkommen der Arbeiter nachoffiziellen Angaben zwischenzeitlich bis zu zwanzig Prozentgesunken. Der Chefredakteur einer Gebietszeitung in Zentral-russland schilderte mir einen konkreten Fall aus der Motorrad-fabrik Degtarjow in der Stadt Wladimir: Auch in dieser Fabrikwurde am 1. Januar 1987 die staatliche Qualitätskontrolle, zurussisch Gosprijomka, eingeführt. Werksleitung und Arbeiterwaren zuvor eigens geschult und mit den neuen Qualitätsanfor-derungen vertraut gemacht worden. Die neuen Maßnahmen, sohieß es, seien ein wichtiger Bestandteil der Perestrojka. NeueKonzepte sollten helfen, den Ausschuss bei der Produktion zubegrenzen. Doch die ganze Vorbereitung hat nichts gefruchtet.Auch nach dem ersten Januar blieb es bei den üblichen Schlam-pereien. Daraufhin stellten die staatlichen Kontrolleure kurzer-
89
hand das Fließband ab und für die nächsten Wochen erhieltendie Arbeiter nur noch ihren Mindestlohn, bis wesentliche Mängelin der Produktion behoben werden konnten.
In Einzelfällen, so berichten Betroffene aus anderen Fabri-ken, seien die Einkommen wegen der neuen Qualitätskontrollesogar bis zu vierzig Prozent gekürzt worden. Dahinter verbirgtsich eine Gefahr für die neue Politik. In der Sowjetunion bestehtimmer noch großer Arbeitskräftemangel. Aus Unzufriedenheitüber die strengen Sitten unter Gorbatschow neigen nun mancheSowjetbürger dazu, ihre Arbeitsplätze in der Produktion zu ver-lassen und in nicht-produktive Berufe auszuweichen. Gleichzei-tig macht sich im mittleren Management Verdrossenheit darüberbemerkbar, dass in dieser Umbruchphase Nachwuchskräfte esimmer wieder ablehnen, Verantwortung zu übernehmen.
Die Risikobereitschaft, an die Gorbatschow unablässig appel-liert, ist den Sowjetmenschen jahrzehntelang abgewöhnt worden.Deshalb kommt den Massenmedien nun eine entscheidendeRolle bei der Perestrojka, zu. Über Funk und Fernsehen, mitZeitungen und Zeitschriften wird praktisch jeder Haushalt imLand erreicht. Und hierbei erleben die Sowjetmenschen die an-dere Seite der Perestrojka. Gesellschaftliche Tabus stehen zurDiskussion, wie einige Beispiele zeigen: Der Innenminister ant-wortete auf eine Leseranfrage in der Prawda, dass 46.000 Rausch-giftsüchtige im Land registriert seien. Ein Moskauer Jugendblatteröffnete die Diskussion über die Aidsgefahr in der Sowjetunion,auf Russisch SPID (russ. ����) Eltern von gefallenen Afgha-nistankämpfern beklagen in der Presse ein unverständlichesVerbot: sie dürfen auf die Grabsteine nicht einmeißeln lassen,dass ihre Söhne als Soldaten in Afghanistan ihr Leben gelassenhaben. Doch was für Außenstehende als abrupter Wandel, alseine fast radikale Enttabuisierung anmutet, wird von manchenSowjetbürgern sehr viel leidenschaftsloser bewertet. Sie begrüßendie Vielfalt, sehen aber auch eine gewisse Kontinuität der The-men, die nun auch in der Presse stehen. Denn vieles, was jetztveröffentlicht wird, war bereits jahrelang hinter vorgehaltenerHand diskutiert worden, egal ob Drogenprobleme, Afghanistan-Gefallene oder die verheerenden Zustände der Wirtschaft. Wer
90
innerhalb der Sowjetunion aufgewachsen ist oder lange Zeit dortununterbrochen gelebt hat, mag auch in anderen Dimensionender Perestrojka mehr Kontinuität sehen als Außenstehende, dieteilweise etwas vorschnell allzu viel allzu ausschließlich mit demNamen Gorbatschow verbinden. Denn schon sein VorvorgängerAndropow hatte wesentliche Gedanken für eine neue Politikformuliert, die auf einer effizienteren Gesellschaftsanalyse basie-ren sollte. Nur wurden solche Überlegungen in der Zwischenzeitunter Parteichef Tschernenko wieder bewusst in den Hinter-grund gedrängt. Dabei zeigt sich, dass die heutige Perestrojka,sich nicht einfach auf wirtschaftliche Verbesserungen be-schränkt. Es geht auch darum, Erziehungs- und Denkrelikte zuüberwinden, unter denen die früheren Generationen aus der Zeitder stalinistischen Erziehung noch gelitten haben. Perestrojkaalso auch als ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Dies wurdein die Praxis umgesetzt, während jener denkwürdigen Demonst-ration am Roten Platz, bei denen - erstmals seit vielen Jahren -Hunderte ungestraft Verbrechen der Vergangenheit mahnendurften. Und im Moment der Zuspitzung galten GorbatschowsParolen als verbale Verteidigung gegen die Staatsmacht, als näm-lich Demonstranten auf dem Roten Platz skandierten: „Glasnost!Demokratie! Wo bleibt hier die Offenheit? Lasst das Volk spre-chen.“
Mit solcher Entrüstung setzten sich Krimtataren in der Mos-kauer Innenstadt gegen die Miliz zur Wehr, die ungewöhnlicherschreckt zurückwich. Auf Anordnung von oben durften überfünfhundert Sowjetbürger tagelang nahezu ungehindert gegenein Unrecht der Vergangenheit demonstrieren. Diese Krimtata-ren waren unter Stalin aus ihrer alten Heimat vertrieben undnach Zentralasien deportiert worden. Der Vorwurf: Sie hätten imZweiten Weltkrieg mit den Faschisten gemeinsame Sache ge-macht. Doch die neue Politik von Gorbatschow hat ihnen Mutgemacht. Sie wollten an höchster Stelle, bei Gromyko oder Gor-batschow, ihre Rechte einklagen, verlangten volle Rehabilitation,um wieder auf die Krim in ihre alte Heimat zurückkehren zudürfen. Bei ihrem Protest beriefen sie sich auf Losungen, die sievon Gorbatschow direkt übernommen haben. Denn der Partei-
91
chef hatte wörtlich gefordert: „Weder in der Literatur noch inder Geschichte darf es vergessene Namen und weiße Fleckengeben.“
Die Frage der Krimtataren ist zwar noch nicht geklärt. Aberallein die Tatsache, dass eine hochrangige Parteikommission sichmit ihren Forderungen beschäftigt, zeigt die Bereitschaft, histori-sche Fehler wieder zu korrigieren. Von dem Bemühen um einneues Verhältnis zur eigenen Geschichte profitierte als einer derersten der 1960 verstorbene Schriftsteller Boris Pasternak. Erwurde postum wieder in den Schriftstellerverband aufgenom-men. Sein bislang verbotener Roman Dr. Shiwago wird nunendlich in der Sowjetunion gedruckt. Auch der Lyriker NikolajGumiljow, 1921 als angeblicher Konterrevolutionär erschossen,wird nun - nach Jahrzehnten der staatlichen Missachtung - alsgroßer Sohn der russischen Literatur gefeiert. Inzwischen greiftdie Vergangenheitsbewältigung auf historische Personen derrevolutionären Jahre über, deren Namen sich kaum noch insowjetischen Geschichtsbüchern wieder finden, darunter Leninsengste Mitarbeiter Leo Trotzki und Nikolaj Bucharin. Noch fehltes an einer Neubewertung dieser Personen, aber sie werden zu-mindest wieder erwähnt, wenn auch vorerst nur auf der Bühne insensationellen Theaterstücken.
Ein streitbarer Historiker, der Rektor des Historisch-Archivarischen Instituts in Moskau, Jurij Afanasjew, hat seinenFachkollegen öffentlich den Fehdehandschuh hingeworfen. Erwendet sich gegen die beschönigte Sichtweise der Parteigeschich-te. Sein Ziel: Der Machtkampf um die Nachfolge Lenins und derStalinismus sollen neu thematisiert werden. Afanasjew beruftsich vor allem auf den Brief Lenins, in dem der kränkelndeStaatsgründer vor den diktatorischen Zügen Stalins gewarnthatte, eine Warnung, die von der Partei missachtet worden war.Daran anknüpfend verbindet er grundsätzliche Kritik an derfestgefahrenen marxistischen Geschichtswissenschaft. In einemInterview mit der Zeitung Sowjetskaja Kultura meinte Afanas-jew: „Die Logik der wissenschaftlichen Entwicklung besagt, dasses kein Problem gibt, das als endgültig erforscht gelten kann undin Zukunft keiner Berichtigung mehr bedarf. Meines Erachtens
92
müsste man die Erforschung der mit dem Personenkult Stalinszusammenhängenden Probleme in ihrem Komplex endlich aufeine sachliche Grundlage stellen. Bei uns ist keine einzige wissen-schaftliche Abhandlung über diese bedeutende Frage erschienen.Die nichtmarxistische Historiographie zählt dagegen hunderte, jatausende Veröffentlichungen. Von uns aber wird dieses Problemweiterhin missachtet.“ Dann griff Afanasjew ein Tabu heraus, diestalinistischen Verbrechen, die bis heute nur unzureichend auf-gearbeitet worden sind und sogar immer noch entschuldigendeErklärungen finden: „Mir will es beispielsweise nicht in denKopf, dass die Massenrepressalien gegen rechtschaffene Sowjet-bürger in den dreißiger Jahren auf so genannte ‘Fehler‘ oder‘Unzulänglichkeiten‘ bei der Befolgung der sozialistischen ‘Ge-setzlichkeit‘ oder sogar auf - wie es heißt - unvermeidliche Kos-ten des ‘Klassenkampfes‘ - zurückzuführen sein sollen.“
Genau an diesem Punkt jedoch scheiden sich die Geister derPerestrojka. Die etablierten Professoren der Parteigeschichteschlugen öffentlich zurück und bezichtigten den Wahrheit su-chenden Forscher einer ideologischen Untat: „Er ruft die Histo-riker zu einer Revision des geschichtlichen Weges unseres Sow-jetvolkes in den letzten siebzig Jahren auf“, so klagen seine Geg-ner, um an anderer Stelle fortzufahren: ”Afanasjew hat bis heutenicht den Unterschied zwischen marxistischer und bürgerlicherGeschichtswissenschaft verstanden.“ Das Erstaunliche an die-sem Streit sind nicht die unterschiedlichen Positionen, sonderndie Bereitschaft der Medien, ihn öffentlich auszutragen. Einanderer Historiker, Alexander Samsonow, hat zu einer neuenEntmystifizierung von Stalin aufgerufen. In der Zeitung Sozialis-tische Industrie schrieb er: „Es ist falsch, alle Erfolge der Parteiund des Volkes mit dem Namen Stalin zu verbinden, indem manihm die Qualität eines so genannten genialen Volksführers undgroßen Feldherrn zuschreibt.“ Und unter militärhistorischenGesichtspunkten wertet Samsonow: „Ohne Stalins Fehlkalkula-tionen wären die Truppen der deutschen Wehrmacht, obwohl siein sowjetisches Territorium eindrangen, nicht in der Lage gewe-sen, Leningrad und Moskau zu erreichen.“ Wer diese sowjeti-schen Schmerzpunkte in der Geschichte des Zweiten Weltkrie-
93
ges kennt, wird schnell erraten, dass Stalin nach dieser Interpre-tation gewissermaßen an allem die Schuld trägt, was bei der Lan-desverteidigung schiefgelaufen ist. Eine der publizistischen Stüt-zen im Kampf um dieses neue Geschichtsbild ist der Kommen-tator der Regierungszeitung Iswestija, Alexander Bowin. Als Vor-reiter der umstrittenen Thematik hatte er öffentlich beklagt, dassdie Bewältigung der Stalinzeit - eingeleitet unter Chruschtschowauf dem XX. Parteitag - ein Opfer der Parteibürokratie gewordenist.
In engagiertem Ton schrieb er: „Mit Befremden undSchmerz, im abscheulichen Gefühl der eigenen Ohnmacht sahich, sah meine Generation, wie sich die Ideen eines der wirklichhistorischen Parteitage der KPDSU im bürokratischen Sandverliefen.” Immer noch ist die so genannte GeheimredeChruschtschows, in der er auf dem XX. Parteitag die VerbrechenStalins anprangerte, in keinem sowjetischen Schulbuch abge-druckt oder frei erhältlich. Jetzt sollen jedoch andere Mittel dafürsorgen, dass die Vergangenheit eindrucksvoll dokumentiert undbewältigt wird. Jahre- und jahrzehntelang hatten wichtige Filmein den Archiven der Behörden gelegen, die sich mit den Tabusder Vergangenheit beschäftigen. Darunter auch ein Streifen desgeorgischen Regisseurs Tengis Abuladse mit dem Titel „”Poka-janije”“ („Die Buße“ oder „Die Reue“). Dieser Film schildert dieSchrecken der Stalindiktatur, die unberechenbare VerfolgungUnschuldiger, allegorisch verfremdet, aber doch so eindringlich,dass bei den ersten Aufführungen ältere Sowjetbürger hem-mungslos zu weinen begannen. Manche Jugendliche dagegenverließen achselzuckend das Kino. Sie konnten mit der Stalinzeiteinfach nichts anfangen. Ihnen fehlt nicht nur die Erfahrung.Ihnen fehlt - und das ist die wirkliche Tragödie, um die es in derHistorikerdiskussion geht - das geschichtliche Wissen um dieStalinzeit.
Doch die sowjetische Jugend nutzt die Freiräume der Perest-rojka zur Bewältigung ihrer Gegenwartsprobleme. „Legko li bytjmolodym?“ („Ist es leicht, jung zu sein?“), ist der Titel einesFilmes, der wochenlang in einer Moskauer Sportarena mit acht-tausend Plätzen vor ausverkauftem Haus lief. Der lettische Re-
94
gisseur Juris Podnijeks hatte einen Kultfilm geschaffen, der na-hezu alle Problembereiche der sowjetischen Jugend berührt:Vom reinen Aussteigertum über die Rock-Kultur und Drogen-szene bis hin zum Afghanistankrieg. Ein Dokumentarstreifen, indem ausschließlich die betroffenen Jugendlichen selbst zu Wortkommen. Was hier gezeigt wird, mag freilich nur diejenigen er-schrecken, die den jahrelangen Beteuerungen der Parteipresseüber die tatkräftige Unterstützung der Sowjetjugend beim ziel-strebigen Aufbau des Sozialismus geglaubt hatten.
Das eindrucksvollste Bild, mit dem sich die veraltete Lesartkonterkarieren lässt, stammt von Gorbatschow selbst. Denn vordem 20. Komsomol-Kongress sprach er davon, dass der staatli-che Jugendverband und die sowjetische Jugend auf zwei ver-schiedenen Straßenseiten gehen und sich dabei auch noch inverschiedenen Richtungen bewegen. Durch Freiräume in derprivaten Sphäre, durch eine kritische Jugendpresse und durchneue gesellschaftliche Perspektiven könnte es Gorbatschowgelingen, in der Sowjetjugend seinen Hauptverbündeten für diePerestrojka zu finden. Bei diesem ideologischen Annäherungs-versuch spielt die Musikszene in der Sowjetunion eine erstaun-lich große Rolle. Denn Rockmusik in allen Varianten hat einengroßen Teil der Sowjet-Jugend erobert.
Unter Gorbatschow kommen vermehrt auch westlicheKünstler in das Land. Die heimische Musikszene blüht förmlichauf. Jetzt kann es sich die Sowjetunion auch leisten, andere Ein-schränkungen aufzuheben. So kommt die beliebteste Rock-Sendung der Sowjetunion seit fast zehn Jahren aus London,ausgestrahlt im russischsprachigen Dienst der BBC. Der Modera-tor Sewa Nowgorodzew ist einer der populärsten Rundfunk-plauderer in der Sowjetunion. Sein Einfluss über den Äther istso groß, dass die Zeitungen sogar Leseranfragen zu den Sendun-gen und zur Person des emigrierten Rock-Spezialisten beantwor-ten. Stets freilich mit erhobenem Zeigefinger, dass man bitte derpolitischen Infiltration nicht aufsitzen möge.
Im Rahmen der Perestrojka geschahen nun zwei Ungeheuer-lichkeiten: Erstens wurden die Störungen gegen den Auslands-dienst der BBC eingestellt. Und zweitens durften sowjetische
95
Rockgruppen nach London fahren und in der früher bekämpftenSendung selbst mit Musik und Interviews auftreten. Diese Öff-nung nach außen ist ein behutsamer Prozess, der nicht auf dieKultur beschränkt bleiben soll. Denn durch die Perestrojka sollauch die Selbstisolierung der Sowjetunion gegenüber anderensozialistischen wie nicht-sozialistischen Ländern überwundenwerden. Dass dabei die Sowjetunion ein Gefangener ihrer teil-weise selbstverschuldeten Klischees ist, zwingt zu neuen Einsich-ten auf beiden Seiten. Deshalb wohl versuchte Michael Gor-batschow mit einer Reihe von Initiativen dem Koloss Sowjetuni-on neue Beweglichkeit in den Außenbeziehungen zu verleihen.Inzwischen hat sich die Sowjetunion zu einer neuen Philosophieder Außenpolitik bekannt.
Ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften, JewgenijPrimakow, schrieb in der Parteizeitung Prawda unter Bezug aufden letzten Parteitag darüber: „Im politischen Bericht des Zent-ralkomitees wurde die Verzerrung beseitigt, wonach der Wider-streit zwischen zwei Weltsystemen - dem sozialistischen und demkapitalistischen - ohne deren wechselseitige Abhängigkeitenbetrachtet wurde.“ Damit wurde das Dogma des gesetzmäßigenWiderspruchs und der Überlegenheit eines politischen Systemsüber das andere aufgegeben. Jetzt sieht die Sowjetunion zuneh-mende Wechselbeziehungen auch bei der Existenz und der Ent-wicklung der Weltwirtschaft.
Nach dieser neuen außenpolitischen Philosophie sollen nati-onale Interessen - so Primakow – „nicht einander entgegenge-stellt werden. Es gilt vielmehr, mühselig nach Feldern zu suchen,auf denen diese Interessen in Übereinstimmung gebracht werdenkönnen.“ Zur Untermauerung, dass es in Zukunft der Sowjet-union um diese Wechselbeziehungen und nicht um einseitigeÜberlegenheit geht, griff der Autor auf eine alte, aber oft verges-sene Aussage über die Revolution zurück: „Bereits in den An-fängen der Sowjetmacht trat Lenin gegen die Verwandlung desersten Staates des siegreichen Sozialismus in einen Exporteur derRevolution nach anderen Ländern entschieden ein und be-schränkte seinen Einfluss auf den Rahmen eines Beispiels. DerAusschluss des Exports der Revolution stellt ein Gebot des nuk-
96
learen Zeitalters dar.“ Trotz aller inneren Schwierigkeiten odergerade wegen dieser Schwierigkeiten hat sich also die Sowjetuni-on angeschickt, dem Sozialismus ein neues Gewand anzupassen.Doch noch ist nicht entschieden, welche Entwicklung die Perest-rojka nimmt. Denn der Widerstand gegen die neue Politik findetüberall im öffentlichen und politischen Leben Eingang.
In Leserbriefen oder Privatschreiben an Parteikomitees wur-den schon regelrechte Drohungen gegen die Perestrojka und ihreBefürworter ausgesprochen. Hinzu kommt, dass die Wirtschafts-entwicklung des Landes bei dem technologischen Vorsprung desWestens nicht mehr aus eigener Kraft zu bewerkstelligen ist.West-Technologie, West-Kontakte scheinen für die Sowjetuniondaher ebenso lebensnotwendig zu sein wie Abrüstung und Ent-spannungspolitik. Gleichzeitig muss Gorbatschow wesentlicheTeile des Sowjetvolkes aus einer schier unglaublichen Lethargiewachrütteln. Dabei kann er nicht einmal eine Perspektive anbie-ten, dass schon in Kürze der Lebensstandard nachhaltig verbes-sert sein wird. Eine solche Herausforderung kann die Sowjetge-sellschaft nur unter großen Mühen und vor allem nicht ohneinnere Widersprüche bestehen. Sollte sich nicht noch ein starkerWandel im Inneren durchsetzen lassen, vor allem bei der antrai-nierten Mentalität des Abwartens statt des Handelns, dann läuftGorbatschow Gefahr, dass seine Politik im Ausland größereZustimmung erfährt als innerhalb der eigenen Reihen. Dies wärefür das politische Schicksal des ersten Mannes in der Kommunis-tischen Partei der Sowjetunion verhängnisvoll.
97
ANHÄNGER UND GEGNERSchwierigkeiten bei der Umsetzung der Perestrojka45
Zwei Umstände sind dafür verantwortlich, dass man bislangnur mit großer Zurückhaltung die Binnenwirkung Gorbatschowsbeurteilen kann. Erstens sind die wichtigsten Vorgänge auf dieHauptstadt Moskau konzentriert. Reisen in die Provinz oder inandere Republik-Hauptstädte zeigen, dass die Moskauer Verhält-nisse weder vorbildlich, noch typisch für das ganze Land seinkönnen. Daneben spielt eine Fixierung auf das obrigkeitlicheDenken eine wesentliche Rolle mit dem Ergebnis, dass zentraleEntscheidungen nur zögernd nach unten weitervermittelt wer-den. Die Heftigkeit, mit der Parteichef Gorbatschow selbst beinahezu allen seinen Inlandsreisen gegen solches Verhalten pole-misiert, zeigt, dass hier ein wesentliches Hemmnis überwundenwerden muss.
Zweitens gibt es genügend offizielle Gesprächspartner, dieverbal zwar von den neuen Schlagworten wie Umbau (perest-rojka), Beschleunigung (uskorenije), und Demokratisierung (de-mokratisazija) Gebrauch machen, aber das Verhalten vieler die-ser Vertreter von Staat, Partei und Wirtschaft richten sich nichtzwangsläufig nach den neuen Losungen, sondern sie beharrenoft auf der für sie „erprobten“ Praxis der Vergangenheit. Ange-sprochen auf die Notwendigkeit einer landesweiten Perestrojkameinte ein Vertreter der Schwerindustrie in einer Kaukasusre-publik: „Jetzt etwas ändern hieße doch, dass unser Betrieb bisherschlecht gearbeitet hat. Das ist nicht der Fall. Also mag die
45 Es meldeten sich immer mehr Gegner zu Wort, die sich der Perestrojkain den Weg stellten. Vor allem bei den Kadern außerhalb der Metropolenwar die Zustimmung zu dem Reformkurs nicht gerade groß, währendGorbatschow bei der Jugend zunehmende Glaubwürdigkeit gewinnenkonnte. Erstveröffentlichung: Zur Akzeptanz und Umsetzung der Gor-batschow-Politik in der Sowjetunion. In: Osteuropa 9, 1987, 666-674.Nachdruck in: Perestrojka und Ideologie. Grundsatzfragen von Systemer-haltung und Systemwandel in der Sowjetunion. Hrg. von Arnold Buchholz.Stuttgart: Steiner 1988.
98
Perestrojka zwar für andere infrage kommen, bei uns ist sie keinvordringliches Ziel.“
Dieser Argumentation kann man als Außenstehender nur dieGesamtlage der Sowjetwirtschaft entgegenhalten, nicht aber dieeigene Anschauung oder Erfahrung. Denn bisher wurden denAusländern hauptsächlich die florierenden Betriebe und Kolcho-sen vorgeführt, während man die darbenden Industriezweigeverständlicherweise nicht zum Aushängeschild machen wollte.Allerdings hat sich in der Selbstdarstellung einiges erheblichgeändert. Bereitwillig erörtern jetzt Betriebsdirektoren Mängel inder Produktion, klagen über unerfüllte Pläne, wissen aber gleich-zeitig nicht zu sagen, wie denn nun die Umstellung in einemBetrieb administrativ und produktionstechnisch zu bewerkstelli-gen sei. Aus alldem spricht oft genug eine gewisse Hilflosigkeitgegenüber den noch nicht ausformulierten Forderungen derzentralen Führung. Solche Verunsicherung kommt auch in Le-serbriefen zum Ausdruck, die von der Presse publiziert werden.
Als genereller Eindruck nach mehr als zwei Jahren Gor-batschow ist folgendes fest zu halten: Zustimmung findet dieneue Linie vornehmlich bei der jüngeren und mittleren Genera-tion der verantwortlichen Kader (bis etwa Ende 40 - Anfang 50Jahre). Dort wiederum scheint eher die technische und kulturelleIntelligenz mehr Engagement zu zeigen, als Leiter im Bereichreiner Produktionsabläufe. Diese Beobachtung legt den Schlussnahe, dass die Akzeptanz der neuen Politik auf abstraktem Ni-veau leichter zu vollziehen ist, als unmittelbar am Arbeitsplatz.Eine Sonderrolle spielen dabei die bislang unterbewerteten Beru-fe im pädagogischen und medizinischen Bereich.
Allzu großer Unmut der vergangenen Jahre soll durch geziel-te Lohnerhöhungen zunächst abgebaut werden. Unter den rei-nen Parteikadern gibt es - so weit erkennbar - auf oberster undmittlerer Führungsebene breite Zustimmung, vermischt jedochmit vereinzelt hartnäckiger Skepsis darüber, ob man die derzeiti-ge Entwicklung noch wesentlich werde vorantreiben können.Zuverlässige Hinweise auf widerstrebende Kräfte gab der Vorsit-zende der Nachrichtenagentur APN Nowosti, Valentin Falin in
99
einem Zeitungsinterview.46 Demnach muss sich Gorbatschowmit drei gegnerischen Gruppierungen auseinandersetzen:
- mit jenen Menschen, die früher zu oft enttäuscht wordensind, um nun irgendwelchen Versprechungen zu glauben;
- mit so genannten „Hütern der Instruktion“, die als kleineMachthaber in den Ministerien komfortabel gelebt haben undnun aus Furcht vor Prestige- und Machtverlust gegen die Erneu-erung sind; dies ist laut Falin zwar eine kleine Gruppe, die aber„nicht zu unterschätzen“ sei;
- mit Dogmatikern, denen die Erneuerung prinzipiell nicht inden Kopf geht; außerdem nennt Falin Kräfte in der sowjetischenGeneralität, die mit dem neuen Denken nicht zu Recht kommen.
Erlebnisse im sowjetischen Alltag ergänzen diese „Mängellis-te“ noch im Hinblick auf denjenigen Teil der Bevölkerung, dersich durch passives Hinhalten dem politischen Prozess der Ver-änderung völlig entzieht oder aber - spiegelbildlich zur blockie-renden Gruppe im Apparat - seinerseits kleine Machtgebilde vonSchieberei im Schwarzmarktätigkeit aufgebaut hat. Diese Gruppeder Bevölkerung führt nun Klage darüber, dass unter Breschnewdoch alles besser gewesen sei, wobei man freilich nur die priva-ten Interessen im Auge hat.
Doch alle Spekulationen über den tatsächlichen Mengenanteildieser Leute an der Sowjetbevölkerung sind müßig. Solche Ein-drücke lassen sich nicht quantifizieren, ein Problem, das auchden sowjetischen Behörden selbst erheblich zu schaffen macht.Denn immer noch funktioniert das bekannte System der zweiProduktionswelten: geschäftstüchtige „Privathändler“ nehmeneine oft untergeordnete Stelle in einem Betrieb an, am bestennicht in der Produktion, sondern in der Verwaltung oder innerenDienstleistung. An ihrem Arbeitsplatz erscheinen sie nur einmalim Monat, nehmen den Lohn in Empfang, um ihn gleich weiter-zuleiten an den nächsten Vorgesetzten. Für dieses „Handgeld“ist der Vorgesetzte bereit, den Zahlungswilligen einen ganzenMonat dessen angebliche Anwesenheit am Arbeitsplatz zu attes-tieren. Diesem Verhalten wird nun durch strengere Kontrollen
46 Süddeutsche Zeitung 19.06.1987.
100
begegnet, es ist aber bei weitem noch nicht verschwunden. Diesist nur ein Beispiel für die Schwierigkeit der Planungsbehörden,über Arbeitskräfte und Arbeitsproduktivität zuverlässige Aussa-gen zu erstellen.
Angesprochen auf eine zwar nicht negative, aber doch indif-ferente Haltung geben manche Sowjetbürger zu erkennen: manwolle erst einmal mehr Geld auf der Hand und bessere Waren imLaden sehen, ehe man bereit sei, mehr zu arbeiten. Auch dieseGruppe lässt sich nicht quantifizieren, ist aber nach offiziellenBefürchtungen groß genug, um den Fortgang der Entwicklungmerklich abzubremsen.
Schließlich trifft man auch viele zustimmende Meinungen -bei Sowjetbürgern, die in dem „Unternehmen neue Politik“ eineerhebliche Investition in die Zukunft sehen, sich allerdings nochnicht vorstellen können, worauf alles hinauslaufen soll. Umsobegieriger werden Veröffentlichungen aufgegriffen, die möglichePerspektiven der neuen Politik ohne dogmatische Scheuklappenskizzieren. Bestes Beispiel dafür ist der Aufsatz des Wirtschafts-wissenschaftlers Nikolai Schmeljow47, der für die Einführungmarktwirtschaftlicher Elemente plädiert und dabei dem Lesereine entlarvende Analyse der bisherigen wirtschaftlichen Ver-hältnisse vorlegt, deren Überwindung in Zukunft auch Arbeitslo-sigkeit und soziale Unterschiede nicht ausschließe. Dieser Auf-satz gab in Moskau den Anstoß für eine anhaltende Diskussiondarüber, ob denn die weiteren, notwendigen Entwicklungenüberhaupt noch mit dem Etikett der sozialistischen Planwirt-schaft zu vereinbaren seien. Die Wellen schlugen sogar so hoch,dass Parteichef Gorbatschow am Tag der Kommunalwahlen aufspontane Zurufe hin aus einer Menschenmenge beschwichtigendStellung nehmen musste, ohne dabei freilich die Analyse desAufsatzes in Frage zu stellen48. Diese Episode scheint charakte-ristisch zu sein für eine beginnende Übergangsperiode der Ver-unsicherung, von der nicht zu sagen ist, wie lange sie anhält.
47 Avancy i dolgi, in: Novyj Mir, 6/1987, 142-158.48 Fernsehnachrichten Wremja, 21.06. 1987.
101
Positiv daran ist auf jeden Fall die, wenn auch heftige, so dochengagierte Diskussion um die eigene Zukunft.
Die Auseinandersetzung mit der neuen Politik spiegelt sichfür wohl die meisten Sowjetbürger jedoch eher im Atmosphäri-schen wider. Trotz weitreichender außenpolitischer und abrüs-tungspolitischer Aktivitäten hat in dieser Phase die Innensichtfür Sowjetbürger eine etwas größere Bedeutung als die Weltpoli-tik. Dabei kommt noch ein besonderer Aspekt zum Vorschein:Gesprächspartner, die in Rüstungsfragen unerfahren sind, zeig-ten sich erschreckt darüber, dass Gorbatschow nun plötzlich soviele Zugeständnisse zur Abschaffung von Raketen mit atomarenSprengköpfen machte. Diese Reaktion entsprang aber nicht derSorge um die eigene Sicherheit, sondern dem Erstaunen darüber,dass die Sowjetunion selbst über zahlreiche Raketen- und Waf-fensysteme verfügt, die nun nach den Gorbatschow-Vorschlägeneigentlich für das Land gar nicht mehr wichtig sein sollen.
Was die Innensicht betrifft, so beeinflussen zwei weitere Fak-toren die Akzeptanz der neuen Politik: neben der Versorgungsla-ge, die immer noch nicht zur Zufriedenheit verbessert werdenkonnte, üben die Massenmedien den derzeit stärksten Einflussauf das Meinungsbild und das Lebensgefühl der Sowjetbürgeraus. Der verblüffende Umschwung in den zentralen Zeitungensowie in Funk und Fernsehen lässt sich für die Sparte Informati-on auf den Nenner bringen: man liest und hört nicht mehr, wasman bereits zu kennen glaubt oder zu erwarten hat, sondern manwird von Neuigkeiten überrascht.
Dieses Konzept hat natürlich mehr mit Politik zu tun, als vie-len Sowjetbürgern zunächst bewusst ist. Denn das neue Medien-angebot mit einem besseren Informationsanteil, einer aufgeklär-ten Sichtweise auch in Sachen kapitalistische Länder sowie dielebendigeren Formen der Fernsehunterhaltung, von denen auchetablierte Fernsehstationen westlicher Länder inzwischen etwaslernen können, sind gewissermaßen sichtbarer Ausdruck derPerestrojka, die zumindest auf diese Weise jeden Haushalt er-reicht. Den Bürgern wird damit das Gefühl gegeben, sie nehmenan den negativen wie positiven Erscheinungen im Leben der
102
Sowjetunion mehr Anteil als früher; sie sollen sich ein eigenesUrteil bilden und sind zu mehr Zivilcourage herausgefordert.
Ein Beispiel für die Auswirkungen solcher Politik war eineBegegnung in der Rayonsstadt Sudogda, 200 Kilometer östlichvon Moskau. Eine Gruppe von älteren Frauen stand mit Korres-pondenten zusammen, die sie für sowjetische Journalisten hiel-ten. Wie nun aus dem Fernsehen gewohnt, antworteten sie aufFragen durch Zurufe: es gäbe nicht genügend Wohnungen, undauch an anderen Dingen mangele es in der Stadt. Solche Szenensind ihnen in den letzten Monaten oft genug von BegegnungenGorbatschows mit der Bevölkerung vorgestellt worden. Alsihnen jedoch klar wurde, dass es sich hier um Ausländer handel-te, bestätigten sie unverzüglich, wie vorbildlich sich doch in denletzten Jahren alles entwickelt habe. Dieses Beispiel zeigt gleich-zeitig, wie vorsichtig Außenstehende mit dem spontanen Urteilsowjetischer Zufallsbekanntschaften auf der Straße umzugehenhaben. Das gilt für Äußerungen aller Art, für Lob ebenso wie fürKritik. Dennoch soll im Folgenden versucht werden, Verhal-tensmerkmale und Bewertungskriterien für die Einstellung be-stimmter sozialer Gruppierungen gegenüber der neuen Politik imEinzelnen zu benennen, wobei es bei einer solchen Kategorisie-rung natürlich zu Überlappungen kommt.
Freiräume in der privaten Sphäre, kritische Worte des Partei-chefs an den staatlichen Jugendverband Komsomol und dieMöglichkeit, Problembewusstsein nicht nur zu bilden, sondernauch umzusetzen - das alles hat der neuen Politik unter der Ju-gend viele Pluspunkte eingebracht. Ausdruck dieser Situation istein Kultfilm des lettischen Regisseurs Juris Podnijeks mit demTitel „Ist es leicht, jung zu sein?“ („Legko li byt´molodym?“),der nahezu alle Problembereiche junger Menschen - vom reinenAussteigertum über die Rockkultur und Drogenszene bis hinzum Afghanistan-Krieg - berührt. Dabei berichtet der Film nichtaus der Perspektive lehrhafter Besserwisserei, sondern lässt alsDokumentarstreifen ausschließlich betroffene Jugendliche selbstzu Wort kommen. Unter den Abertausenden von Besuchernschafft der Film ein Identitätsgefühl, dass besonders aus derungeschminkten Schilderung einer eigenen, dem übergeordneten
103
Gesellschaftsinteresse fernen Welt resultiert. Staatsverdrossen-heit im allgemeinen, mangelnde Akzeptanz „bürgerlicher Werte“,eine gleichgültige bis ablehnende Einschätzung des Afghanistan-Krieges, die Sucht nach Drogen als Ablenkung - das alles magnur diejenigen erschrecken, die den jahrelangen Beteuerungender Parteipresse und des Komsomol über die Zielstrebigkeit derSowjetjugend beim Aufbau des Sozialismus geglaubt hatten. Daseindrucksvollste Bild, mit dem sich die veraltete Lesart konterka-rieren lässt, stammt aus einer Rede von Gorbatschow vor dem20. Komsomol-Kongress, auf dem er davon sprach, dass derstaatliche Jugendverband und die sowjetische Jugend auf zweiverschiedenen Straßenseiten gehen, und sich dabei auch noch inverschiedene Richtungen bewegen.49
Neuerungen in der Jugendpresse haben dazu geführt, dassman diese Entwicklung wieder „einzuholen“ versucht. So ver-zichtet eine der wichtigsten Jugendzeitungen, der MoskowskijKomsomolez, bereits seit einem halben Jahr auf Zensurmaß-nahmen. Während etwa früher Lehnbegriffe aus der englischenSprache bezüglich der Rock-Kultur verboten waren, gibt es heu-te keine solchen Beschränkungen mehr - ein „unumkehrbarerProzess“ nach Aussagen engagierter Redakteure, die sich selbstzur Aufgabe gestellt haben, im Rahmen der neuen Politik „widerden Stachel zu löcken“. So entpuppte sich das Blatt in den letz-ten Monaten als Vorreiter für das Anpacken so genannter „hei-ßer Eisen“. Vom Tabuthema Prostitution über Drogenkonsumbis zur Szene der martialisch auftretenden Metallisti, wie dieAnhänger von Heavy Metall sich selbst nennen, findet dort allesseinen Platz.
Zumindest für die Hauptstadtjugend ist mit dieser Zeitungnoch eine andere wichtige Entwicklung verbunden. Von demBlatt werden nämlich Rock-Konzerte organisiert, auf denen nunnicht mehr wie früher Milizionäre in Uniform jede Stuhlreiheüberwachen, um jegliche emotionale Äußerung nieder zu pfeifen.Jetzt darf geschrien und getobt werden. Einige Städte in derSowjetunion haben angesichts der Zerstörungswut der Metallisti
49 Komsomolskaja Prawda, 17.4.1987.
104
zwar eine Verordnung erlassen, wonach solche Konzerte nurnoch in leeren Hallen stattfinden - aber sie dürfen stattfindenund werden nicht verboten. Solche Entwicklungen haben natür-lich nicht das ganze Land gleichermaßen erfasst. Auf Reisendurch Sibirien beispielsweise war ein sehr viel zurückhaltenderesjugendliches Publikum anzutreffen. Doch waren diese Vertreterder jungen Generation politisch interessierter und mehr auf diewirtschaftliche Entwicklung ihrer Region bedacht als mancherHauptstadtjugendliche. Dort im Osten des Landes hat Gor-batschow vor allem deshalb Pluspunkte gesammelt, weil er durchReisen in die Provinz immer wieder den Menschen das Gefühlvermittelt hat, dass er sich persönlich um ihre Lage kümmert.Damit ist auch einer der wichtigsten Züge des Parteichefs ge-nannt, der unabhängig von konkreten Maßnahmen Eindruck aufdie Menschen macht. Gorbatschow gilt für viele als ein Mannder es endlich einmal ernst meint mit dem, was er sagt. Außerden ganz Verdrossenen akzeptieren Befürworter wie Gegner vonGorbatschow, dass er seine Politik aufrichtig und gezielt betreibt- gleichzeitig Hoffnung für die einen und Sorge für die anderen.Seit Beginn des Jahres 1987 macht in der Sowjetunion ein Witzin verschiedenen Versionen die Runde, von denen eine lautet:„Hast du schon gehört? Heute Morgen sind alle Brote im Brot-laden angebissen!“
„Wieso denn das?“ Antwort: „Gosprijomka hat zugeschla-gen“.
Der bissige Humor trifft die ungeliebte Begleiterscheinung,die der arbeitenden Bevölkerung mit der neuen Politik beschie-den worden ist: die staatliche Qualitätskontrolle durch die Ab-nahmebehörde Gosprijomka, die nun landesweit Einzug in dieBetriebe gehalten hat, führt zunächst subjektiv zu einer Ver-schlechterung für die Arbeiter. Ein Beispiel aus der Motorrad-fabrik Degtjarew in der Gebietshauptstadt Wladimir steht stell-vertretend für viele ähnliche Vorkommnisse: auch hier wurde am1. Januar 1987 die staatliche Qualitätskontrolle eingeführt. Werk-leitung und Arbeiter waren zuvor geschult und mit den neuenQualitätsanforderungen vertraut gemacht worden. In der Theo-rie wurde ihnen die neue Maßnahme als wesentlicher Bestandteil
105
der Perestrojka erläutert. Konzepte wurden ausgearbeitet, dochnichts hat gefruchtet. Es wurde - wie so oft bisher - Ausschussproduziert, auch nach dem 1. Januar. Die staatlichen Kontrolleu-re stoppten daraufhin die Fließbänder, und 14 Tage lang musstendie Arbeiter auf ihre Leistungsprämien verzichten. Solange dau-erte es offensichtlich, bis die gewünschte Qualität garantiert unddie Mängel behoben waren. Außer dem normalen Produktions-ausfall und der Lücke bei der Planerfüllung spielt seither für dieArbeiter etwas anderes eine bedeutende Rolle: sie bekommen inder Lohntüte zu spüren, wenn sie schlechte Arbeit abliefern. ImLandesdurchschnitt sollen offiziellen Angaben zufolge durch diestrengen Qualitätskontrollen die Einkommen bis zu 20 Prozentgekürzt worden sein. In Einzelfällen wird sogar von 40 ProzentEinkommensverlust berichtet. Dahinter verbirgt sich eine neueGefahr. Da es immer noch in der Sowjetunion einen Überhangan freien Arbeitsplätzen gibt, neigen offensichtlich jetzt Arbeiterdazu, die Produktion zu verlassen, um an nicht-produktive Ar-beitsplätze zu wechseln, die der staatlichen Qualitätskontrollenicht mit derselben Konsequenz unterliegen. Gleichzeitig scheintsich bei dem mittleren Management eine gewisse Verdrossenheitdarüber bemerkbar zu machen, dass Nachwuchskräfte es immerwieder ablehnen, in der jetzigen Situation Verantwortung zuübernehmen. Stattdessen geben sie sich mit untergeordnetenStellen im Betrieb zufrieden. Gorbatschow vertröstete schonmehrfach die Arbeiter mit dem Hinweis, man müsse zwei bisdrei schwere Jahre durchstehen. Bei guter Leistung gäbe es infol-ge der wirtschaftlichen Rechnungsführung auch die Möglichkeit,Lohnzuschläge zu erwirtschaften. Doch diese Lohnerhöhungenhalten sich noch im bescheidenen Rahmen. Die Verlockung,durch Schwarzarbeit mehr Rubel nebenher zu verdienen alsdurch vermehrten Einsatz an der Werkbank, ist immer nochnicht gebannt. Auch das Gesetz über individuelle Tätigkeit, gültigseit 1. Mai 1987, bietet noch keine ausreichende Kompensationfür den privaten Tätigkeitsdrang vieler Sowjetbürger. BisherigeMaßnahmen, privatwirtschaftliche Initiative in einem gesetzli-chen Rahmen zuzulassen, werden von vielen Interessierten alshalbherzig kritisiert. Deshalb steht zu befürchten, dass dem Un-
106
mut innerhalb der Arbeiterschaft nur durch Maßnahmen entge-gengewirkt werden kann, die mit dem traditionellen Verständnisder alles organisierenden Planwirtschaft nicht zu vereinbarensind.
„Die Produkte sind zwar noch nicht deutlich besser undmehr geworden, aber den Klagen der Käufer wird bereits nach-gegangen.“ Auf diese Formel brachte es ein Moskauer, der stell-vertretend für viele seine tägliche Situation beschrieb. Man wirdals Verbraucher im Geschäft oder Restaurant ernster genommenals früher. Das eher zufällige Auf und Ab in der Versorgungslagemag den Beobachter ebenso ungerechtfertigt positiv überraschenwie negativ erschrecken. Zumindest in der sowjetischen Haupt-stadt bleibt es dabei, dass dem unausgeglichenen staatlichenVersorgungsmarkt mit einem Netz privater Informanten begeg-net werden muss, die aus den einzelnen Stadtteilen berichten,was wann wo zu erwerben ist.
Diese Jagd nach Konsumgütern, teilweise auch nach Nah-rungsmitteln, ist noch ebenso aktuell wie die Faustregel: „Es gibtnichts, was es nicht doch irgendwo gibt; man muss es nur fin-den.“ Hausfrauen, die sich vorrangig auf die Versorgung derFamilie beschränken - und das sind meist die Großmütter imRentenalter - neigen dazu, von den vielen Worten um die neuePolitik nicht zu viel zu erwarten. Für sie zählt die tägliche Er-leichterung beim Einkauf, die bislang eben nur sporadisch zuspüren ist. Die Tatsache, dass das Defizit-Denken der Sowjet-bürger die Regel statt die Ausnahme ist, konnte von der neuenPolitik der Perestrojka noch nicht dauerhaft widerlegt werden.
Die engagiertesten Fürsprecher und Widersacher der PolitikGorbatschows scheinen sich unter den Angehörigen der Intelli-genz zu befinden, für die am meisten aus den kulturellen Ereig-nissen des Landes herauszulesen ist. Nicht die Situation am Ar-beitsplatz, sondern die geistige Sphäre gilt als Gradmesser fürpolitische Veränderungen. Die Veröffentlichung verborgeneroder verbotener literarischer Schätze, die Rehabilitierung vonNikolai Gumiljow (1921 als Konterrevolutionär erschossen), dieDiskussion um das Erbe von Boris Pasternak, der antistalinisti-sche Film “Pokajanije” des georgischen Regisseurs Tengis Abu-
107
ladse - das alles sind nur wenige Beispiele für eine Aufbruchs-stimmung, welche die Intelligenz namentlich mit Gorbatschowverbindet. Der Befriedigung darüber, dass die eigene Geistesge-schichte nicht mehr dem klassifizierenden Urteil parteipolitischerEngstirnigkeit ausgesetzt sein soll, stehen warnende Stimmenorthodoxer Slawophiler gegenüber, die - wie die Gruppe Pamjat– versuchen, unter dem Deckmantel kulturschützender Ambiti-onen Stimmung gegen „kulturelle und völkisch Überfremdung“mit deutlich antisemitische Untertönen zu betreiben.
Gegensätze brechen auch bei der rein historischen Bewer-tung der jüngeren Sowjetgeschichte auf. Noch stehen einzelneGeschichtswissenschaftler wie etwa Jurij Afanasjew (Rektor desHistorisch-Archivarischen Instituts, Moskau), unterstützt voneinzelnen Publizisten wie etwa Alexander Bowin, Kommentatorbei der Regierungszeitung Iswestija, gegen eine Vielzahl von Aka-demie-Historikern, die ihre Glaubwürdigkeit untergraben sehen,sollte sich die Sowjetunion anschicken, insbesondere die Bewer-tung des Stalinismus auf breiter Ebene zur Diskussion zu stellenund die jüngste Geschichte umzuschreiben.
Selbst aus den Reihen der Militärhistoriker melden sich je-doch schon gelegentlich Stimmen, die darauf hinweisen, dassman „so nicht mehr weitermachen könne“, dass der „Glorien-schein um den angeblich hervorragenden Feldherrn Stalin“ end-lich beseitigt werden müsse. Das mangelnde Verständnis desjüngsten akademischen Nachwuchses für diese Fragen und auchdie eher gelassenen bis sogar gleichgültigen Reaktionen sowjeti-scher Jugendlicher auf den antistalinistischen Film “Pokajanije”zeigen deutlich, welche Lücken in der eigenen Geschichtsschrei-bung aufgearbeitet werden müssen. Es war immer ein verhäng-nisvoller Irrtum, die Anzahl der Parteimitglieder mit den poten-ziellen Anhängern der jeweils gültigen politischen Linie in derSowjetunion gleichzusetzen. Das Bild ist heute - wie eingangskurz skizziert - differenzierte denn je. Die Herausforderung derneuen Politik zu selbstständigem Denken und Handeln aktiviertund lähmt gleichermaßen. Die Ergebnisse bisheriger ZK-Plenarsitzungen und Konferenzen zeigen deutlich, was auch impersönlichen Kontakt mit Vertretern der Partei zum Ausdruck
108
kommt: Die neue Politik wird in vielen Bereichen auf die Liniedes Kompromisses gedrängt. Das Erstaunlichste sind warnendeStimmen aus der Partei selbst, die sich nicht scheuen, sogar Au-ßenstehenden gegenüber Minuspunkte für Gorbatschow geltendzu machen.
Dieses Spiel ist nicht neu und wurde bereits bei den letztenGorbatschow-Vorgängern praktiziert - sozusagen ein routinierterKunstgriff, der auch gesteuert sein kann. Warum aber wird nundieses Spiel fortgesetzt? Steckt dahinter vielleicht doch mehrÜberzeugung als Verunsicherungstaktik? Auf jeden Fall wird esdadurch noch schwieriger, die Gruppen von Befürwortern undWidersachern ihrer Menge und ihrem Einfluss nach zu gewich-ten. Auffallend ist jedoch, dass eine Reihe von Parteimitgliedern,die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, vor drei bis vierJahren kaum Anstalten machten, über die Möglichkeit oderNotwendigkeit einer neuen Politik zu reflektieren; jetzt abertreten dieselben Leute als Vorhut des Umschwungs auf. Hier istdie Frage der Glaubwürdigkeit eng gekoppelt mit der Frage, obnun Überzeugung oder auch Sachzwänge zu dieser neuen Hal-tung geführt haben. Es besteht kein Zweifel: Gorbatschow alsPerson erfreut sich in der Sowjetunion großer Beliebtheit. Seineinnenpolitischen Absichten jedoch sind der Bevölkerung offen-sichtlich noch nicht klar genug vermittelt. Das liegt wesentlichdaran, dass der Generalsekretär selbst oft in allgemeinen, auf-munternden oder kritisierenden Phrasen spricht. Die Ausarbei-tung der Konzeption liegt ohnehin in den Händen von Fachleu-ten, die zunächst einmal den Parteiapparat selbst für die Umset-zung neuer Ideen gewinnen müssen.
Der Chefredakteur einer Gebietszeitung in Zentralrusslandbeschrieb den jetzigen Zustand mit den Worten: „Die Perest-rojka ist vor allem ein psychologisches und erst danach ein wirt-schaftliches Problem. Aber wir können mit den wirtschaftlichenVeränderungen nicht erwarten, bis sich alle Leute umorientierthaben.“ Genau darin liegt das Dilemma der neuen Politik. Den-noch sind viele Gesprächspartner über den offensichtlich beste-henden Zeitdruck nicht besorgt. Wenn es mit der neuen politi-schen Linie nicht funktioniert, so trösten sich zahlreiche Sowjet-
109
bürger, dann werden sie eben etwas Anderes probieren. DieZuversicht in die soziale und wirtschaftliche Absicherung durchden Staat ist so groß, dass dadurch der neuen Politik Gor-batschows erhebliche Hemmnisse erwachsen. Sollte sich diePolitik der Erneuerung besonders auf wirtschaftlichem Gebietzugunsten der Sowjetbürger durchsetzen, dann wird man sichdadurch ebenso wenig aus der Ruhe bringen lassen wie vomGegenteil. Schwieriger ist die Situation für diejenigen, die ihreMacht zeitlich begrenzt und unter den argwöhnischen Augenmancher Parteimitglieder ausüben. Für sie scheint der Zeitdruckgrößer zu sein. Sie drängen deshalb auch auf parallele binnen-wie außenwirtschaftliche Veränderungen.
Die zögernde Reaktion beispielsweise der kapitalistischenLänder auf das Angebot für Joint ventures, also Gemeinschafts-unternehmen, ist durch einschränkende Halbherzigkeiten dersowjetischen Seite bestimmt. Hier muss die Administration unterGorbatschow noch erhebliche Schritte tun, um greifbare Ergeb-nisse zu ermöglichen. So wie Gorbatschow dem Westen vor-wirft, nur verbale, aber wenig reale Zugeständnisse in der Abrüs-tungspolitik zu machen, so fordern umgekehrt die westlichenAußenhandelspartner der Sowjetunion von Moskau mehr als nurallgemeine Rahmenbedingungen. Dies alles zeigt, dass sich Gor-batschow Forderungen und Erwartungen von innen und vonaußen gegenübersieht. Ob er in gleichem Maße wenigstens in-nenpolitisch auch die dringend notwendige, praktische Unter-stützung für seine Politik erhält, scheint nach der vorläufigenBilanz noch nicht schlüssig bewiesen.
110
DEMOKRATISIERUNGAuf dem Weg zu freien Wahlen?50
Michail Gorbatschow sorgte zu Beginn der Plenarsitzung sei-nes Zentralkomitees für Überraschungen: Er kritisierte in allerDeutlichkeit die Versäumnisse der Ära Breschnew und fordertemehr Demokratie bei der Besetzung von Führungspositionen inder Sowjetunion. Der sowjetische Parteichef möchte eine De-mokratisierung einleiten, zu der zwei wichtige Elemente gehörensollen: Zum einen soll das Wahlsystem verändert werden, damitin Zukunft mehrere Kandidaten konkurrierend antreten. Zwei-tens soll innerparteilich über Führungskräfte auf mittlerer undunterer Ebene geheim abgestimmt werden und nicht mehr durchoffenes Aufheben der Hände. Dabei können ebenfalls verschie-dene Kandidaten vorgeschlagen werden.
Diese neuen Ideen will Gorbatschow nun in der Kommunis-tischen Partei landesweit diskutieren lassen. Mit einer weit rei-chenden Negativbilanz über die politische Erblast der Bre-schnew-Zeit hatte Gorbatschow vor dem Zentralkomitee seinFesthalten an dem geplanten wirtschaftlichen und gesellschaftli-chen Umbau der Sowjetunion begründet. Es habe besorgte An-fragen aus der Bevölkerung gegeben, ob diese Politik nicht einezu scharfe Kehrtwendung sei, gab Gorbatschow zu. Er antwortetdarauf mit dem Argument, die Sowjetunion habe „einfach keineandere Wahl“. Ausdrücklich machte der Parteichef das Zentral-komitee und die politische Führung der Breschnew-Zeit fürwirtschaftlichen Stillstand verantwortlich, durch den auch dieMoral der Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen worden sei.Gorbatschow beklagte Kriminalität und Drogenkonsum bei derJugend ebenso wie frühere, unverantwortliche Beschränkungenbei „individuellen Unternehmungen“, womit er privatwirtschaft-
50 Spekulationen tauchten auf um Hinweise, dass eine Reform des politi-schen Systems möglicherweise freie Wahlen in begrenztem Umfang zulas-sen könnten. Erstveröffentlichung: Moskau: Demnächst geheime Wahlen?In: DIE ZEIT, Nr. 6, 30. Januar 1987.
111
liche Initiativen meinte, die in ersten Ansätzen bereits durch einneues Gesetz in der Sowjetunion erlaubt werden. Erstmals gabGorbatschow zu erkennen, dass sich seine neue Mannschaft beider Analyse der wirtschaftlichen Missstände gehörig getäuschthat. Denn diese Probleme seien „tiefer verwurzelt, als man er-wartet habe“. Vor allem hätten „schwerwiegende Fehlkonzepti-onen“ dem Land größere wirtschaftliche und soziale Schädenzugefügt. Diese Fehler seien aus „subjektiven“ Gründen gemachtworden. Gorbatschow lässt also nicht zu, dass die alte GardeZeitumstände oder Sachzwänge für die Fehlentwicklungen in derSowjetunion verantwortlich macht. In Zukunft möchte Gor-batschow mehr parteilose Sowjetbürger in Führungsgremiensehen. Die Leiter von Wirtschaftsbetrieben sollen in offenemWettbewerb gefunden werden. Damit würde die sowjetischeWirtschaft von einer belastenden Hypothek befreit: Allzu oft gabbisher das Parteibuch und nicht die Qualifikation den Ausschlagbei der Neubesetzung wichtiger Posten. Für das kommende Jahrschlug Gorbatschow die Einberufung einer Allunions-Parteikonferenz vor, wie sie zuletzt 1941 zur Vorbereitung derRüstungswirtschaft im Krieg getagt hatte. Dadurch will der KP-Chef offenbar für eine politische Aufbruchsstimmung sorgen -gemeinsam mit den neuen Leuten, die nach den Entscheidungendieses ZK-Plenums die politische Führung der Partei bilden.
112
ERSTMALS FREIE WAHLENTestlauf im Dorf Wjatkin51
Erstmals durften sich Sowjetbürger bei Kommunalwahlen in140 ausgewählten Verwaltungsgebieten zwischen verschiedenenKandidaten entscheiden. Für die 690 Wahlberechtigten im DorfWjatkin, 200 Kilometer östlich von Moskau, hat die Zukunft derGorbatschow-Reformen bereits begonnen. Im Gegensatz zurbisherigen Sowjet-Tradition durften sie bei den Kommunalwah-len genau das tun, was mit dem Begriff „Wahl“ auch gemeint ist:Sie konnten sich erstmals zwischen verschiedenen Kandidatenentscheiden. Früher galt derjenige als suspekt, der sich in dieeinzige geschlossene Kabine eines Wahllokals schlich, um mög-licherweise den Kommunisten sein Misstrauen auszusprechen.
In Wjatkin dagegen durfte jeder Wahlberechtigte in eine derKabinen zur geheimen Abstimmung gehen. Zur Feier des Tageswurden keine Mühen gescheut: Die Taftvorhänge der Kabinenleuchteten in revolutionärem Rot; ein bequemer Polsterstuhlsollte die Entscheidung zwischen den vielen Kandidaten erleich-tern; frische Blumen und ein musikalisches Arrangement derDorfjugend verliehen dem Wahlvorgang eine fast sakrale Atmo-sphäre. Sechs Wochen lang waren die wenigen Auserwähltenunter dem Sowjetvolk auf diesen Moment vorbereitet worden.Denn die erste Wahl mit mehreren Kandidaten ist bislang nurein Experiment, verstreut auf 140 Verwaltungsgebiete im Land.Mit Handzetteln und guten Worten versuchten die Agitatorendes Parteikomitees den Leuten klarzumachen, warum dieserSchritt zur Demokratisierung notwendig ist.
Entsprechend selbstbewusst machten einige Bürger von ih-rem neuen Recht Gebrauch. Als Jurij Alexandrowitsch, einMann, der kurz vor seiner Pensionierung steht, mit stolzge-
51 Mit Stolz führte die Sowjetunion ausgewählten westlichen Journalistenden ersten Wahlgang auf kommunaler Ebene vor, bei dem die Benutzungeiner Wahlkabine verpflichtend war und dabei zwischen verschiedenenKandidaten entschieden werden konnte. Erstveröffentlichung: Sowjetunion:Stolz auf freie Wahlen. In: DIE ZEIT, Nr. 28, 3. Juli 1987.
113
schwellter Brust aus der Wahlkabine tritt, um seinen Zettel in dieUrne zu werfen, weist er neugierige Fragesteller zurecht: „Ichhabe gewählt, wie es sich gehört. Und ich habe auch einen Kan-didaten ausgestrichen. Aber wen, das ist mein Geheimnis, dasgeht keinen was an.“ In einem anderen Wahllokal berichtet eineFrau stolz, dass sie von vier Kandidaten sogar drei abgelehnt hat.Doch durch solche Entscheidungen würden Dorf- und Stadträtenicht vollständig besetzt werden: Bei diesem Experiment, dasvorerst nur im Kommunalbereich erprobt wird, gibt es nur 30Prozent mehr Kandidaten als Plätze in den lokalen Parlamenten.
Das neue Verfahren kann allerdings zu Problemen führen.Bei Stimmengleichheit für alle Kandidaten muss zwei Wochenspäter neu gewählt werden. Politische Konkurrenz wird dabeiaber nicht aufkommen, denn wer auf der gleichen Liste antritt,wirbt auch für die gleichen Ziele. Dennoch ist im kleinen DorfWjatkin jetzt alles anders als früher. „Im ganzen Land“ - someinte eine Bäuerin - „wird immer noch von mehr Demokrati-sierung geredet. Wir haben damit bereits begonnen.“
114
DIE SUCHE NACH DEM DIALOGMoskauer Friedensforum
mit Dissidenten und Ausländern52
Nur wenige Wochen nach seiner Befreiung aus dem Ver-bannungsort Gorki hielt Andrej Sacharow in Moskau ein deutli-ches Plädoyer für den ABM-Vertrag zur Begrenzung von Rake-tenabwehrsystemen. Ungefragt unterbrach er sich selbst undirritierte dann all jene seiner Anhänger, die in ihm nur den politi-schen Dissidenten, nicht aber den konsequentem Wissenschaft-ler sahen: „Ich möchte noch einmal betonen“, so ergänzte Sach-arow seinen Referatstext, „wie sehr ich für Atomenergie eintrete.Sie muss ausgebaut werden, am besten in Form unterirdischerKernkraftwerke.“ Technische Fragen und Sicherheitsproblemewollte Sacharow nicht gelten lassen. Dann folgte seine Bewer-tung des amerikanischen Verteidigungssystems, das im Weltraumstationiert werden soll. „SDI ist völlig sinnlos“, lautete das ent-schiedene Urteil des Bürgerrechtlers, „und es wird nie funktio-nieren.“ Deshalb bedauere er auch, dass man so viele Ressourcenfür eine falsche Sache aufwende und negative politische Auswir-kungen in Kauf nähme.
Sacharow ist sich selber nicht untreu geworden. Er nutzte dasMoskauer Forum Für eine atomwaffenfreie Welt und für dasÜberleben der Menschheit, um zweierlei zu übermitteln: Erstensbeharrte er unnachgiebig auf der Freilassung aller Gewissenshäft-linge in der Sowjetunion, zweitens aber wiederholte er seinebekannten Positionen als Wissenschaftler, die im Eifer westli-chen Engagements für ihn oft übersehen oder gar vergessenworden waren. Die Tatsache, dass der ehemalige Dissident nunin Moskau auf einer staatlich organisierten Veranstaltung auftrittund im privaten Gespräch bekräftigt, der Kurs von Parteichef
52 Gorbatschow begann, um einen offenen Dialog mit dem Klassengegnerzu werben, um damit die Entideologisierung der internationalen Beziehun-gen einzuleiten. Erstveröffentlichung: Moskauer Friedensforum. „DasErgebnis einer neuen Denkweise“. Gorbatschow beeindruckt die Teilneh-mer aus dem Westen. In: DIE ZEIT, Nr. 9, 1987.
115
Gorbatschow verdiene volle Unterstützung, lässt um so deutli-cher Widersprüche zutage treten, die vor Beginn des Friedensfo-rums weltweit Aufsehen erregt hatten. Demonstranten wurdenverprügelt, Korrespondenten an ihrer Arbeit gehindert, als nachdrei Tagen des stummen Protests gegen die anhaltende Inhaftie-rung des Bürgerrechtlers Josef Begun Schlägertrupps das Kom-mando in der Moskauer Fußgängerzone am Arbat übernommenhatten. Zwar meldete die Regierung die Freilassung von 140politischen Gefangenen und kündigte weitere Schritte in dieserRichtung an. Doch zur gleichen Zeit bekamen die Demonstran-ten die Folgen organisierter Gewalt, und zwar mit politischerDuldung, zu spüren. Ob hier Quertreiber gegen die neue Gor-batschow-Linie ihr Unwesen trieben, ob lokale KGB-Behördendie trotz aller Lockerungsübungen noch immer kraftvolle Prä-senz der staatlichen Ordnung demonstrieren wollten - das alleslässt sich nicht schlüssig beantworten. Die Freilassung von Ana-tolij Korjagin und die gleichzeitigen, widersprüchlichen Meldun-gen über das Schicksal von Josef Begun offenbaren Ungereimt-heiten im Verhalten der zuständigen Behörden. So verkündeteder Leiter des sowjetischen Nordamerika-Instituts, Georgij Ar-batow, vor einer amerikanischen Fernsehkamera zum Fall Be-gun: „Ich kann Ihnen sagen, dass er frei ist, ich bin sicher, dassder Fall gelöst ist.“ Doch Beguns Frau konnte diese angeblicheFreilassung nicht bestätigen. Und noch zwei Tage später orakelteein Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, der Fall wer-de weiter geprüft, wahrscheinlich aber positiv entschieden. Ge-rade in dieser Umbruchphase hatten sich in Moskau neunhun-dert Teilnehmer des Friedensforums versammelt, die auf Einla-dung der Sowjetunion aus aller Welt angereist waren. Moskaubezahlte nicht nur Flug und Verpflegung, sondern zahlte auchnoch ein stattliches Taschengeld von umgerechnet 350 Mark.
Das anfängliche Zögern vieler Teilnehmer artikulierte zumAbschluss der britische Schriftsteller Graham Green: „Ich mussgestehen, ich bin mit einer gewissen Skepsis zu diesem Forumgekommen.“ Doch dann war der fast dreiundachtzigjährige Ka-tholik voll des Lobes über die freimütige Diskussion und dieZusammenarbeit mit den Kommunisten. An Gorbatschow ge-
116
wandt meinte der Schriftsteller abschließend, er träume davon,dass noch zu seinen Lebzeiten ein sowjetischer Botschafter imVatikan vertreten sei. Diese beinahe euphorische Wendung warkennzeichnend für westliche Teilnehmer, die zunächst einenkanalisierten Austausch der Argumente statt eines freien Rede-stroms erwartet hatten. Erst die Versicherung, man strebe keinegemeinsame Resolution an, hat manche Vorbehalte gegen eineTeilnahme an diesem Treffen abgebaut. „Moskau bemüht sich“,so das Urteil eines kanadischen Wissenschaftlers, „erst einmaluns anzuhören, um unsere Argumente zu verstehen.“ Doch wasdas offizielle Moskau zu hören bekam, wurde nicht immer naht-los in den sowjetischen Massenmedien wiedergegeben. Ob Über-setzungsfehler oder gezielte Flüchtigkeit der Grund dafür waren,bleibt dahingestellt: Fest steht beispielsweise, dass Egon Bahr ineiner Abschlusserklärung für die Sektion der Politikwissenschaft-ler eine Auflösung des sowjetischen Abrüstungspaketes favori-sierte, ihm in der Regierungszeitung Iswestija jedoch die gegentei-lige Meinung unterstellt wurde. Auch der Ausschluss der Journa-listen von den Foren legte einen Schleier des Geheimnisses überdie Diskussionen; sie hatten in der Erwartung stattgefunden,Parteichef Gorbatschow werde die Weltöffentlichkeit zum Ab-schluss der Mammutsitzungen mit neuen Abrüstungsvorschlägenüberraschen. Der Auftritt des Generalsekretärs im großenKreml-Palast erfüllte diese Hoffnung nicht. Stattdessen plädierteGorbatschow unter Berufung auf bisherige sowjetische Vor-schläge dafür, auf die Doktrin der atomaren Abschreckung ganzzu verzichten und das Prinzip der gleichen Sicherheit zwischenden Völkern zu beachten. Scheinbare Nebensächlichkeiten dieservom Fernsehen landesweit übertragenen Rede entpuppten sichjedoch als charakteristisch für das neue Selbstverständnis dersowjetischen Führung: Unter Anspielung auf die jüngsten Frei-lassungen politischer Dissidenten sagte Gorbatschow: „Schließ-lich sind unsere neuen Zugänge zu humanitären Problemen, diezum ‚Dritten Korb von Helsinki‘ gehören vor aller Augen. Ichmuss diejenigen enttäuschen, die annehmen, dieses sei das Er-gebnis des Drucks seitens des Westens, wir wollten jemandemgefallen und verfolgten irgendwelche geheimen Ziele. Nein. Das
117
ist ebenfalls das Ergebnis einer neuen Denkweise.“ In vorberei-teter Regie erfasste die sowjetische Kamera dabei das Gesichtvon Andrej Sacharow. Wem Sacharow im Fernsehen entgangenwar, der konnte der staatlichen Presse einen Aufruf des Bürger-rechtlers für mehr Demokratie und Offenheit in der Gesellschaftentnehmen. Seine neue öffentliche Rolle als Vertreter der Men-schenrechte und zugleich Förderer eines Umbaus der Sowjetge-sellschaft verlangt von Sacharow ein abwägendes Urteil. Ent-sprechend zurückhaltend reagierte er auch auf die Demonstrati-onen in Moskau. Gegenüber ausländischen Gesprächspartnernmeinte Sacharow, man müsse sehr überlegt Schritt für Schrittvorgehen, um nicht unangemessene Reaktionen eines Systems zuprovozieren, das noch nicht weit genug sei. Dabei sprach ermehrfach von einer „bedrängten Nation“, deren neuer Weg auchdurch außenpolitische Erfolge für Gorbatschow stabilisiert wer-den müsse. Mit seinem überzeugenden Plädoyer für Gor-batschow steht Sacharow nicht allein. Auch westliche Teilneh-mer am Friedensforum unterstellten dem Generalsekretär eineGlaubwürdigkeit, wie man sie zuvor kaum einem sowjetischenParteiführer zugestanden hatte. Auf einem Empfang im Kremlkam es zu einer längeren Begegnung Gorbatschows mit PetraKelly und Gerd Bastian. Gorbatschow ließ sich nicht davonirritieren, dass Petra Kelly einen Bericht von Amnesty Internati-onal zur Lage der politischen Gefangenen in der Sowjetunionüberreichte mit der Aufforderung, alle noch Betroffenen freizu-lassen. Stattdessen verwickelte Gorbatschow die beiden Bundes-deutschen in einen längeren Dialog über die Beziehungen zwi-schen Bonn und Moskau, deren Verbesserung ihm „sehr wich-tig“ sei. Schließlich nahm Gorbatschow auch noch einen Buttonmit dem Bild „Schwerter zu Pflugscharen“ entgegen und erzeug-te bei der eher kämpferischen Petra Kelly die Reaktion: „Ich binja wirklich nicht leicht umzuhauen, aber das hat mich umgehau-en.“ Auf die gleiche zufällige Weise kam auch der bundesdeut-sche Schriftsteller Josef Reding mit Gorbatschow ins Gespräch.Die Faszination, die von dem ersten Mann im Kreml auf dieForumsteilnehmer ausging, brachte Reding. auf die Formel: „Ichwürde mich ihm anvertrauen, wenn ich in Schwierigkeiten wäre.“
118
DIE GUTEN UND DIE BÖSENDie Prawda richtet über politische Aktivisten53
Die sowjetische Parteizeitung Prawda hat am Montag in ei-nem Grundsatzartikel auf die Grenze hingewiesen zwischenwünschenswerten Initiativgruppen, die sich für soziale und kul-turelle Belange einsetzen, und solchen Gruppierungen, die nachsowjetischem Verständnis unerlaubte politische Aktivitäten ent-falten. Positiv dargestellt wird im Artikel zunächst die Arbeit vonetwa dreißigtausend Vereinigungen im ganzen Land, die sichbesonders im Denkmal- und Umweltschutz oder bei der Antial-kohol-Kampagne engagieren. Demgegenüber klagt die Prawdaüber eine Reihe von anderen Gruppierungen, die jetzt im Mittel-punkt stünden, weil sie „der Sowjetmacht und der Arbeit derPartei unfreundlich gestimmt“ seien.
Die ausführlichste Auseinandersetzung führt das Parteiblattdabei mit der Organisation Pamjat („Das Gedächtnis“), einerVereinigung, die sich traditionell dem Schutz des kulturellenErbes gewidmet hatte, bis Teile ihrer Anhänger vor zwei Jahrenmit antisemitischen und großrussisch-chauvinistischen Tönenauf sich aufmerksam machten. In einem Manifest an das russi-sche Volk hatte diese Gruppierung zu Beginn der Perestroika-Politik öffentlich gewarnt: „Die Heimat ist in Gefahr.“ NochEnde vergangenen Jahres forderten Anhänger der Bewegung aufeiner Versammlung in Leningrad eine „Gesellschaft zum Schutzrussischer Talente, die jetzt der Verfolgung oder Vernichtungausgesetzt“ seien.
Auf die Frage nach der Rolle der Juden in der „Verschwö-rung“ gegen das russische Volk antwortete bei derselben Veran-staltung ein Akademiemitglied wörtlich: „Sie hinterlassen ihre
53 Unter Berufung auf Glasnost und Perestrojka meldeten sich immer neueBürgerinitiativen und Gruppen politischer Aktivisten zu Wort, deren Wir-ken von der Prawda als oberstem „Glaubenshüter“ einer kritischen Würdi-gung unterzogen wurde. Erstveröffentlichung: Die Prawda gegen informelleGruppen Kritik an unerlaubten politischen Aktivitäten. In: Neue ZürcherZeitung, Fernausgabe Nr. 26, 3. Februar 1988.
119
Spuren nicht.“ Auch die Prawda beklagt jetzt die absurden Vor-würfe der Pamjat-Anhänger, die, wie es im Parteiblatt heißt,„beinahe offen zum Extremismus aufrufen“. Diese rechtsgerich-tete Vereinigung ist zwar im Parteiorgan inhaltlich und umfang-mäßig das Ziel der Kritik; ins Gericht geht das Blatt aber auchmit der Gruppe Glasnost des Bürgerrechtlers Sergej Grigorjanz,der ein gleichnamiges Bulletin Glasnost herausgibt.
Die Beiträge in dieser hektographierten Aufsatzsammlungmit einer Auflage von selten mehr als siebzig Exemplaren kriti-siert die Prawda mit den Worten, sie sähen aus, als seien sie vonder westlichen Presse abgeschrieben. Negativ bewertet wird alsweitere Gruppierung das Seminar Demokratie und Humanismus,weil deren Anhänger mit Handzetteln zu Kundgebungen aufrie-fen und nach der Prawda die völlige Entideologisierung der Sow-jetunion anstreben. In diesem Zusammenhang wirft das Partei-blatt dem Westen vor, diese informellen Gruppen zu einem -freilich misslungenen - Zusammenschluss ermuntert zu haben,damit sie von einer gemeinsamen politischen Plattform aus agie-ren könnten. Namentlich erwähnt die Prawda kritisch westlicheDiplomaten und Korrespondenten wegen ihres Kontaktes zusolchen Gruppen.
Diese Gruppierungen haben sich im Übrigen mehrheitlichum eine offizielle Registrierung - bisher vergeblich - bemüht. DasParteiorgan schreibt nun, die informellen Gruppen hielten „ihreFreunde jenseits des Ozeans zum Narren, indem sie selbst vor-geben, eine politische Kraft zu sein“. Angesichts der Resonanzdieser Gruppierungen im Westen befürchtet die Prawda, derEindruck könnte entstehen, dass es „viele Gegner unserer Le-bensweise“ gebe und dass die Reihen dieser Gegner immer stär-ker würden.
Abschließend fordert die Prawda eine „prinzipiengerechte“Unterscheidung, wo wahre soziale Aktivitäten der Sowjetbürgervorhanden seien und wo es nur um politischen Extremismusgehe. Um sich gegen unerwünschte politische Aktivitäten derverschiedenen Gruppen zur Wehr zu setzen, droht das Partei-blatt mit Konsequenzen. In der Schlussfolgerung des Beitragsheißt es wörtlich: „Die Hauptsache ist die patriotische internati-
120
onalistische Erziehung, die Überzeugung von der Richtigkeitunserer sozialistischen Ideale, wobei die Kraft der öffentlichenMeinung und - falls nötig - die Kraft des Gesetzes angewandtwerden.“
121
HERAUSFORDERUNGEN IM INNERN
UNHEILE UMWELTDas Gewissen regt sich54
Wochenlang geisterte im Herbst 1983 durch Moskau das Ge-rücht, in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am SchwarzenMeer und in der moldauischen Hauptstadt Kischinjow (Chi�in�u)sei das Trinkwasser verseucht. Westliche Journalisten, die solcheGerüchte prüfen wollten, erhielten keine Gelegenheit, die beidenStädte zu besuchen. Ende Oktober veröffentlichte dann dieRegierungszeitung Iswestija einen Bericht55 über eine Umweltka-tastrophe am Dnjestr, in dessen Einzugsgebiet die besagten Städ-te liegen. Viereinhalb Millionen Kubikmeter Salzlauge waren inden Fluss eingedrungen und bildeten meterdicke Ablagerungenin einem Stausee nördlich des Schwarzen Meeres. Dort sollen dieGiftstoffe zurzeit abgepumpt werden.
Allerdings hat die sowjetische Presse weder Augenzeugenbe-richte noch Reportagen aus dem Unglücksgebiet veröffentlicht.Die Informationen über die Katastrophe stammen vom Vorsit-zenden einer Kommission, die zur Beseitigung der Schäden ein-gesetzt wurde und dessen Aussagen erst knapp sechs Wochennach dem Unglück von der Regierungszeitung publiziert wurden.In diesem Interview wird auch eingeräumt, dass die Städte Odes-sa und Kischinjow - immerhin noch so lange nach dem Unglück- zwar sauberes Wasser erhalten, jedoch „weniger als früher”.Die ökologischen Schäden der Salzlaugenwelle sind immer nochnicht absehbar. Kurzfristig wurden zwar rund zweihundert Hek-tar landwirtschaftliche Anbaufläche regelrecht ausgebrannt und
54 Erste kritische Bestandsaufnahmen von Mangelerscheinungen erlaubtedie kurze Amtszeit von Andropow. Dazu gehörten auch Diskussionen undVeröffentlichungen zu gravierenden Umweltschäden, unter denen das Landbis heute leidet. Erstveröffentlichung: Umweltschutz und Umweltschädenin der jüngsten sowjetischen Diskussion. In: Osteuropa 7, 1984, 511-514.55 Iswestija, 26.10.1983.
122
mehr als zweitausend Tonnen Fisch vernichtet. Doch um dieFolgeschäden zu beheben, werden Jahre vergehen. Katastro-phenmeldungen von diesem Ausmaß werden in der Sowjetunionnicht sehr häufig veröffentlicht. Dennoch machen Wasser- undLuftverschmutzung seit geraumer Zeit Schlagzeilen. Seit Jahrenschon wird die Diskussion um den Baikalsee geführt, der unterindustriellen Abfällen litt und dabei einen Großteil seines selte-nen Fischbestandes einbüßte. Inzwischen wurde eine Reihe vongesetzlichen Maßnahmen zum Schutz des Sees getroffen, undausländischen Korrespondenten führt man das Gewässer alsMusterbeispiel einer gelungenen ökologischen Gesundung vor.Immerhin hat die Verschmutzung des Baikalsees so viel Aufse-hen erregt, dass darüber sogar Bücher56 publiziert wurden. Underst im vergangenen Jahr wandte sich der kasachische Schriftstel-ler Abdishamil Nurpeisow an die Öffentlichkeit, um auf dasAustrocknen des Aral-Sees hinzuweisen. Sein Fazit über diesowjetische Öffentlichkeit: „Unser ökologisches Gewissen istzwar geweckt, aber zugestandenermaßen nicht so schnell, wieman es sich gewünscht hätte.”57
Solche Klagen sind kein Wunder. Denn allzu lange und allzuoft wurde das Problem von Umweltschäden als ein typischesZeichen des gesellschaftlichen Gegners angesehen. So meinteJurij Israel, Vorsitzender des Staatskomitees der UdSSR für Hyd-rometeorologie und Umweltkontrolle, wörtlich: „In vielen kapi-talistischen Staaten hat die Weigerung der Monopole, die ele-mentarsten Forderungen des Umweltschutzes zu berücksichti-gen, schwer wiegende Folgen.”58 Die Lage im eigenen sozialisti-schen Vaterland wurde oft positiver eingeschätzt, auch wenndabei in vorsichtiger Form Zugeständnisse der eigenen Schwie-rigkeiten sichtbar wurden. So sagte Jurij Israel in demselbenInterview: „Es gibt natürlich beim Umweltschutz auch Proble-me, und nicht wenig ist noch zu tun. Sehr viel hängt von denIndustrieministerien ab und von den örtlichen Sowjets der
56 vgl. Boris Komarow: Das große Sterben am Baikalsee, Reinbek 1979.57 Moscow News Weekly, Nr. 34, 1983, S. 12.58 Nowoje Wremja, Nr. 51, 1981, S. 18.
123
Volksdeputierten. Insbesondere sind abfallfreie technologischeProzesse umfassender zu erarbeiten und aktiver einzuführen.”59Um sich von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, muss mannicht einmal die sowjetische Hauptstadt verlassen. Selbst in dereigenen Moskauer Wohnung kann man die Anhäufung vonschwarzen Ruß- und Staubspuren beobachten, die innerhalbweniger Wochen von außen zwischen die für den Winter ver-klebten Doppelfenster dringen und sich als dunkler Film aufdem weißen Holzlack absetzen. Und unweit des Zuckerbäcker-hotels Ukraina im Moskauer Zentrum kann man Kanalöffnun-gen sehen, aus denen eine Brauerei Abwässer direkt in die Mos-kwa leitet. Der Gestank lässt erahnen, dass es sich dabei nichtnur um geklärte Industrieflüssigkeit handelt. Aber auch außer-halb der Stadt gibt es reichlich Beobachtungsmaterial: Wenn mannur hundert Kilometer auf der Landstraße Richtung Gorkij fährt,häufen sich Industrieabfälle, halbfertige, verlassene Baustellen,unbereinigtes Brechholz und verrostete Stahlröhren in der freienNatur. Kein Zweifel: Es gibt in der Sowjetunion noch vieles imtäglichen Umweltschutz zu tun. Der verstorbene Staats- undParteichef Andropow, dessen Beraterkreis eine Reihe von entlar-venden Analysen vorgelegt hatte, ließ noch auf dem ZK-Plenumim Dezember 1983 unter seinem Namen eine Rede verlesen, inder von den Sowjetbürgern „eine Änderung des Verhältnisses zuFragen des Umweltschutzes und der rationellen Nutzung natürli-cher Ressourcen” gefordert wird.60 Seiner Ansicht nach warendie bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend, denn „es mussunterstrichen werden, dass ungeachtet der von uns unternom-menen ernsthaften Anstrengungen dieses Problem in seinerSchärfe auf der Tagesordnung bleibt”.61 Während laut Agentur-Meldung der Andropow-Text noch die „kleinlichen und büro-kratischen Maßnahmen” geißelte, mit denen der Umweltschutzin der Sowjetunion unterlaufen werde62, hieß es in der späterenFassung lediglich, „entschieden zu verbessern ist das gesamte
59 ebd. S. 19.60 Abdruck der Rede in: Kommunist 1, 1984, 4-11, hier S. 861 ebd.62 TASS, 13.12.1983.
124
System der Leitung und Kontrolle über den Zustand der Um-welt”.63 Gleichzeitig bewies Politbüro-Kandidat Kusnezow, dasses mit Absichtserklärungen allein noch nicht getan ist. Denn alskürzlich das Präsidium des Obersten Sowjet sich mit Umwelt-schutz besonders im Bereich des Buntmetall-Hüttenwesens be-schäftigte, schrieb der ranghohe Politiker: „Es stellte sich heraus,dass insbesondere in einigen Städten - Norilsk, Ust-Kamenogorsk und anderen -‚ wo Unternehmen dieses Industrie-zweiges liegen, der Ausstoß schädlicher Stoffe in die Atmosphärenicht nur nicht gesenkt wurde, sondern sogar noch anstieg.“64
Nur wenige Tage nach dem Andropow-Aufruf waren - we-nigstens formal - die ersten Konsequenzen zu verzeichnen. Inder Meldung über eine Politbüro-Sitzung hieß es: „Im Zusam-menhang damit, dass dem ZK der KPdSU die Verunreinigungder Luft in der Stadt Kemerowo [einem Zentrum für Chemie-Industrie in Westsibirien, J. G.] signalisiert wurde, wies das Polit-büro die leitenden Vertreter einer Reihe von Ministerien auf dieUndiszipliniertheit bei der Durchführung von Maßnahmen zumNaturschutz durch ihnen unterstellte Betriebe hin und verlangtedie Behebung dieser Unzulänglichkeiten in dieser Angelegen-heit.“65 Im Verhältnis zur veröffentlichten Kritik, die sicher nurdie Spitze der Umweltschäden benennt, muss deren wirklichesAusmaß nicht gerade unbedeutend sein. So forderte das Plenumdes Obersten Gerichts der Sowjetunion von den nachgeordnetenInstanzen „weitere Vervollkommnung der Tätigkeit zur Erörte-rung der Fälle über die Verletzung der Naturschutzvorschrif-ten”.66 Und nach einer Tagung der Regierungskommission fürUmweltschutz hieß es über die Arbeit des Energieministeriumsder UdSSR, des Ministeriums für Holz- und Papierindustrie, desInnenministeriums, der Staatsforstwirtschaft und des Minister-rats der RSFSR lakonisch: „Es wurde hervorgehoben, dass dieoben genannten Ministerien und der Ministerrat der RSFSR die
63 Kommunist 1, 1984 a.a.0.64 V. Kuznecov: Nekotorye voprosy raboty sovetov narodnych deputatovna sovremennom etape, in: Kommunist 1, 1984, 15-28, hier S. 21.65 TASS (Telegrafnoje Agenstwo Sowjetskogo Sojusa), 20.01.1984.66 ebd. 08.07.1983.
125
rechtzeitige Erfüllung der Maßnahmen zum Umweltschutz imStauseegebiet des Bogutschansker Wasserkraftwerkes, die imtechnischen Projekt für seine Errichtung vorgesehen waren,nicht gewährleistet haben.”67
Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, mit denen auf demGebiet des Umweltschutzes Fortschritt bewiesen werden soll. Sowird zum Beispiel in Leningrad ein zwölf Kilometer langer Ent-sorgungskanal erprobt, der unterirdisch Abfälle großer Wohnsi-los abtransportieren soll. An solche Müllentsorgung wird inLeningrad und in Moskau seit geraumer Zeit die Wärmegewin-nung gekoppelt. Die Abfälle werden verbrannt, und mit derdamit gewonnenen Energie wird Wasser für die Fernheizungerhitzt - ein Modell, das auch in westlichen Städten üblich ist.
Inzwischen wurde noch von einem interessanten Versuch be-richtet. In Puschtschino, einem kleinen Ort nahe Moskau an derOka, will eine Gruppe sowjetischer Forscher versuchen, „dasModell einer ökologisch harmonischen Stadt zu schaffen”. IhrZiel ist dabei, eine „schmerzlose Koexistenz von städtischemMilieu und natürlicher Umwelt zu entwickeln”.68 An dem Projektsind Vertreter verschiedener Disziplinen beteiligt: Biologen,Juristen, Ärzte, Architekten, Soziologen und Pädagogen. Aller-dings befindet sich das Projekt noch im Aufbaustadium. Es gehtzunächst um die notwendige Datenerhebung, bevor praktischeMaßnahmen für eine Errichtung einer solchen Ökopolis erfolgenkönnen. Als erste konkrete Ergebnisse werden bisher genannt:die Einrichtung mehrerer stadtnaher Schonreviere und der Auf-bau einer ökologischen Station für die „Erziehung der Kinder inAchtung gegenüber der Natur”.69
Neben solchen singulären Projekten gibt es auch in der Ge-samtstruktur der Sowjetwirtschaft einen Anspruch, der bis zumEnde des laufenden Fünfjahrplans erfüllt werden soll. Bis 1985nämlich „wird in der Sowjetunion grundsätzlich keine Umwelt-verschmutzung durch industrielle Abwässer erfolgen”, so Dmitrij
67 Iswestija, 29.04.1983.68 TASS, 16.09.1983.69 ebd.
126
Bontschowskij, stellvertretender Leiter der Hauptverwaltung fürGewässerschutz im sowjetischen Wasserwirtschaftsministerium.Was davon zu halten ist, kann man erst im kommenden Jahrbeurteilen. Doch seine weiteren Bemerkungen lassen Schlüssezu, welche Gewässer unter einer beängstigend hohen Ver-schmutzung litten - und auch noch leiden. Denn „dank der ge-troffenen Maßnahmen” sei „das Wasser in der Wolga und inihrem Einzugsgebiet merklich sauberer geworden”. Außerdemwerde viel getan, „um das Wasser im Baikal-, im Peipus-, imOnega- und im Ladogasee vor Verunreinigung zu schützen”; dieVerschmutzung der Binnengewässer liege „nicht über denNormwerten”.70 Oft ist auch von Geld die Rede, das in dieUmweltprogramme investiert wird: Als in der Ukraine das Koks-Chemie-Werk Awdejewka vergrößert wurde, mussten fünftau-send Menschen umgesiedelt werden. Für das ökologischeSchutzprogramm, das die Neusiedler vor den Schadstoffen desWerkes schützen sollte, sind im noch laufenden Fünfjahrplan300 Millionen Rubel vorgesehen.71
Allerdings gibt es kaum Gelegenheit, die sachgerechte Ver-wendung solcher Summen zu überprüfen. So wird auch landes-weit immer wieder ein Posten von 8,5 Milliarden Rubel genannt,der für den Natur- und Umweltschutz zur Verfügung steht. Da-mit sollen jährlich (!) Reinigungsanlagen genauso finanziert wer-den wie die Rekultivierung von Böden und die Neuanpflanzungvon Grünflächen.72
An einzelnen Projekten arbeiten auch internationale Firmenmit. So wird nicht ohne Stolz von sowjetischer Seite betont, dassauch Unternehmen aus der Bundesrepublik an einem Projekt fürWasserbelüftung in Leningrad beteiligt sind.73 Es geht - gemäßder 1974 in Helsinki unterzeichneten Konvention zum Schutzder Ostsee - darum, keine unaufbereiteten Abwässer mehr in dieOstsee abzulassen. Diese Konvention war seinerzeit von allen
70 ebd. 02.09.1983.71 ebd. 08.07.1983. Nach offiziellem Wechselkurs war der Rubel damalsetwa 3,50 DM (= 1,78 Euro) wert72 ebd. 03.01.1984.73 ebd. 11.01.1984.
127
Anliegerstaaten, also auch von der Bundesrepublik, unterzeich-net worden. Nun will die Sowjetunion nicht nur solche Abwässerreinigen, sondern für den industriellen Kreislauf die Wasserver-sorgung geschlossen kanalisieren und von der Trinkwasserver-sorgung weitgehend abkoppeln. Fast zeitgleich zu diesen Projek-ten wurde aber noch ein anderer Umweltschaden größerenAusmaßes bekannt: Im Gebiet der sowjetischen Autostadt Togli-atti hat der Ausstoß einer Stickstoff-Fabrik zur Entnadelung vonumliegenden Kiefernwäldern geführt.74 Auch die Luftver-schmutzung selbst soll in Togliatti besorgniserregend sein.Schließlich sei die Mülldeponie der Stadt nur für 90.000 Men-schen angelegt. In Wirklichkeit zählt Togliatti bereits mehr als600.000 Einwohner.75 Als Reaktion auf diese Schreckensmel-dung verbreiteten die sowjetischen Medien kurz darauf dieNachricht, dass in Togliatti ein Institut der Akademie der Wis-senschaften für Ökologie errichtet worden sei. Und in einerFormulierung, die über den tatsächlichen Stand der Dinge man-ches offen lässt, heißt es: „In den Industriegebieten Togliattiswerden zahlreiche Umweltschutzmaßnahmen getroffen.”76
Bedauerlicherweise, so Stanislaw Konowalow, Direktor desInstituts, seien noch nicht alle Umweltschutzprobleme gelöst.77So etwas bedarf wohl auch einiger Zeit - und es ist nicht alleineine Frage der Industrie, sondern auch des privaten Umweltbe-wusstseins. Denn zur Frühjahrszeit, wenn die Sowjetbürger ihreüber den Winter stillgelegten Autos wieder fahrtüchtig machen,kann man beobachten, wie sehr es zuweilen an diesem Umwelt-bewusstsein mangelt. Viele der Autofahrer nämlich lassen - wiejährlich in der Presse beklagt wird - einfach ihr altes Motoröl aufdie Erde fließen und in den Boden versickern. Und ein paarTropfen Autoöle können sich auf das Grundwasser oft schlim-mer auswirken als Zelluloseabfälle im Baikalsee.
74 Prawda, 05.01.1984.75 ebd.76 TASS, 19.01.1984.77 ebd.
128
EIN ROCKSTAR BETET UM ERRETTUNGTschernobyl hat die Sowjetbürger verändert78
Im goldenen Flittergewand tritt Alla Pugatschowa auf dieBühne, schüttelt ihren roten Haarschopf, breitet dabei die Armeaus und ruft in den Saal der Moskauer Olympiahalle: „Geld istGeld. Aber wir wollen heute unsere Herzen geben, unseren Op-timismus nach Tschernobyl schicken.” Was bei anderen Starsnach theatralischem Kitsch klingen würde, wirkt bei der 35-jährigen Rock-Königin der Sowjetunion überzeugend. Mit 150Millionen verkauften Schallplatten als populärem Verstärkererledigte sie Unmögliches sofort: Innerhalb von zwei Wochenstellte sie das erste privat initiierte Rockkonzert für die Opfervon Tschernobyl auf die Beine. Ihr gelang damit ein Durchbruchin einem Land, dessen bürokratische Hürden selbst hohe Partei-funktionäre oft genug zur Verzweiflung treiben.
Alla Pugatschowa ist spontan. Bei den ersten Filmberichtenaus Tschernobyl, so erzählte sie vor dem Konzert einigen Jour-nalisten, habe es sie „gepackt, ich musste einfach etwas tun”. IhrWeg führte direkt in das Zentralkomitee der Partei, wo sie sichGenehmigung und Unterstützung holte. So ganz nebenbei ge-lang es ihr auch noch, vor den dreißigtausend Besuchern eineneue Musikgruppe auf das Podium zu bringen, deren Liederbislang nur als heimliche Raubkopien aus dem Untergrund derMoskauer Jugendszene kursierten. Die Not und die Solidaritätmit Tschernobyl erwiesen sich in den vergangenen Wochen
78 Die Selbstsicherheit technologischer Errungenschaften wurde durch dasKernkraftunglück von Tschernobyl schwer erschüttert. Nach kurzem Be-harren darauf, dass man das Problem allein bewältigen könne, musste dieMoskauer Führung Schwächen beim Umgang mit der Katastrophe vor derganzen Welt eingestehen. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel zum Ver-ständnis der Öffnung nach außen, die Gorbatschow - auch in diesem Punkt- nach kurzem Zögern betrieben hat. Erstveröffentlichung: Allas Rockkon-zert – ein Gebet um Errettung. Tschernobyl hat die Sowjetbürger verän-dert. In: DIE ZEIT, Nr. 24, 6. Juni 1986.
129
stärker als die sowjetische Bürokratie. Tschernobyl hat auch dieSowjetbürger verändert. Mit erstaunlicher Gelassenheit hatten siezunächst die abstrakten Meldungen über den Reaktorunfall hin-genommen. Mangelnde Aufklärung über die Gefahren von Ra-dioaktivität verhinderten eine Panik. Es folgte eine kurze Phasedes verbitterten, sarkastischen Humors, eine Antwort auf unge-naue Informationen nach dem Motto: „Eine Radioaktivität gibtes nicht - und außerdem sinkt sie beständig.” Als jedoch diestaatlichen Massenmedien ihre Informationspolitik änderten,menschliches Leid nicht mehr verbargen, als die Zahl der To-desopfer stieg und die „neuen Heroen im Kampf gegen denvierten Reaktorblock” geboren und in vielen Fällen zugleichpostum gerühmt wurden, schlug die Stimmung im Lande um.
Die Bilder der Feuerwehrmänner, Mittzwanziger zumeist, mitbubenhaften Zügen im Gesicht, die sich in die Radioaktivitätstürzten, um Schlimmeres zu verhüten - sie haben mehr bewirktals jede politische Propaganda. Sie haben Gefühle geweckt, Mit-leid erzeugt. Diese entschlossenen Männer wurden zu positivenHelden in einem Kampf, der für viele Sowjetbürger durch dieReaktion in manchen westlichen Ländern noch einsamer, aberauch eindeutiger wurde. „Wie könnt ihr über Entschädigung fürdie Bundesrepublik reden, wenn unsere Leute zu ZehntausendenHab und Gut verloren haben, zu Hunderten im Krankenhausliegen und zu Dutzenden sterben”, meinte eher enttäuscht alsvorwurfsvoll ein 30-jähriger sowjetischer Freund. „Seht ihr dennnicht, dass eine Tragödie von katastrophalem Ausmaße allenvoran unsere Menschen getroffen hat?”
Seit Gorbatschow im Fernsehen zu Tschernobyl Stellung ge-nommen hat, ist diese Sicht nach innen noch verstärkt worden.Das Ausland, so der Tenor, will uns nichts Gutes, abgesehen voneinfachen Menschen und einzelnen Persönlichkeiten wie demamerikanischen Großindustriellen Armand Hammer. Als diesergroße Gönner der Sowjetunion, der noch mit Lenin befreundetwar, vor der Presse erklärte, die von ihm vermittelten medizini-schen Hilfslieferungen seien sein Geschenk an das sowjetischeVolk, da applaudierten russische Journalisten mit Tränen in denAugen. Doch auf Besorgnis jenseits der Grenzen reagierten die
130
sowjetischen Medien zumeist zurückweisend. Die außenpoliti-sche Hauszeitschrift des Kremls, die Neue Zeit, wiegelte eineLeseranfrage aus England ab: Der Austritt der Radioaktivität sei„von kurzer Dauer, unwesentlich und gering” gewesen. Auchhabe man „Erdichtungen in Umlauf gebracht, wonach sowjeti-sche Exportwaren und Verkehrsmittel gefährlich seien”.
Der Kampf gegen Gerüchte und „widersprüchliches Ge-schwätz” - so die Literaturzeitung - wird allerdings auch inner-halb der Sowjetunion geführt. Ein stellvertretender Gesund-heitsminister bemühte sich den Sowjetbürgern auszureden,Wodka und Rotwein seien Allheilmittel gegen Radioaktivität. Erbemängelte und deckte damit auf, dass Hunderte Kilometerentfernt von Tschernobyl Menschen in Moskau, Leningrad oderRiga in die Krankenhäuser kämen, weil sie sich gefährdet fühlten.Sogar die Haltung vieler Wissenschaftler lässt nach Meinung desGesundheitspolitikers viel zu wünschen übrig. Denn sie hättenihre eigene Verantwortung vergessen, weil sie sich nicht mitihrem Wissen gegen Gerüchte zur Wehr gesetzt hätten.
Im Klartext: Auch unter der sowjetischen Intelligenz herrsch-te vielerorts mehr Angst als Aufklärung. Die RegierungszeitungIswestija versuchte, ihren Lesern mit einer Briefaktion alle Furchtvor den traditionellen Feriengebieten am Schwarzen Meer, inden Karpaten und an der Ostsee zu nehmen, die unter der Be-völkerung als „verstrahlt” gelten. Nicht ungern haben deshalbviele Sowjetbürger ihre Putjowka, ihre Reisebestätigung, für einesder Feriengebiete zurückgegeben, um Platz für die Evakuiertenaus der Ukraine zu machen. Denn trotz des Einsatzes von Wis-senschaft und Technik, trotz ferngelenkter Bulldozer, die in derstärksten Strahlenzone aufräumen und trotz heroischer Hub-schrauberpiloten, die laut Gewerkschaftszeitung Trud „afghanis-tangestählt” sind, fehlen zur Beruhigung noch immer genaueDaten über Art und Umfang der ausgetretenen Strahlen.
Wenn die Wachmannschaften von Tschernobyl ohne Mund-schutz vor der Kamera des sowjetischen Fernsehreporters agie-ren, gleichzeitig aber die Armeezeitung Roter Sturm vermummteGestalten bei der Entseuchung des Bodens im Kernkraftgebietzeigt, dann bleiben für den Sowjetbürger Widersprüche. Wie
131
schlimm ist es wirklich? Wenn alles Vieh aus der „Zone”, wie dieneue Vokabel nun heißt, evakuiert werden musste, aber nunfriedlich mit unverseuchten Kühen grast und gemolken wird -was ist dann mit der Milch, was mit dem Fleisch? Die Vor-sichtsmaßnahmen in der Ukraine und Weißrussland sind streng:In einigen Gebieten sollen sogar nur Teigwaren und Reis abge-geben werden. Auch wenn das Fernsehen eine blühende Land-wirtschaft zeigt und dabei suggeriert, dass mit der neuen Zonen-grenze von Tschernobyl auch die Verseuchung gebannt wordenist, werden jetzt Ängste laut. Gegen das „friedliche Atom” wen-den sich inoffizielle Protestgruppen. Sie sammeln Unterschriftenfür Petitionen, um das sowjetische Kernenergieprogramm über-prüfen zu lassen. Die Polizei reagierte jüngst zwiespältig: Zu-nächst nahm sie Mitglieder einer solchen Gruppe im MoskauerGorki-Park fest, ließ die Beteiligten dann aber wieder laufen undgab sogar die Unterschriftenliste für die Petition heraus
Das alte Mütterchen, das am Sparkassenschalter fünf Rubelauf das Spendenkonto 904 einzahlt, hat mit Politik nichts imSinn. Sie ist weder für noch gegen Kernenergie. Nur eines ist ihrwichtig: „Seit dem Großen Vaterländischen Krieg hat es so einUnglück für die Menschen bei uns nicht mehr gegeben. Und damuss man zusammenhalten wie damals.” Diesen Zusammenhaltwill auch Michail Uljanow demonstrieren. Er ist ein Muster-schauspieler, vor allem für Kriegsfilme. Nach eigenem Einge-ständnis kann er mit Rockmusik nichts anfangen. Doch auchUljanow ist zu dem Benefizkonzert von Alla Pugatschowa ge-kommen, hat sich zum ersten Mal in seinem Leben den elektro-nischen Klängen ausgesetzt, um dann vor dem Publikum zubekennen: Diese Musik sei ein Aufschrei, ja ein Gebet um Erret-tung vor solchen Katastrophen. Tschernobyl hat die sowjeti-schen Menschen in Bewegung gebracht. In Allas Rockkonzertebenso wie im Betrieb, auf der Straße, in der Schule. Tschernobylhat aber auch Zweifel geweckt am sicheren Fortschritt. „Das 20.Jahrhundert hat den Verstand verloren”, skandiert ein Rocksän-ger zum Applaus des Publikums. Eine Feststellung, die immerhindie Sowjetunion miteinschloss.
132
FEHDEHANDSCHUH FÜR DIE GENOSSENGorbatschows Abrechnung umgeht Tschernobyl79
Michail Gorbatschow hat seinen Gegnern in der Parteibüro-kratie offen den Fehdehandschuh hingeworfen. Doch vonTschernobyl spricht der Generalsekretär nur ungern.
Auf dem Plenum des Zentralkomitees der sowjetischenKommunisten fand Gorbatschow zu einer verbalen Schärfezurück, die seit dem Parteitag Anfang des Jahres verloren schien.Der Grund seines Zorns: Die Bemühungen, die Sowjetwirtschaftvon Masse auf Qualität und intensive Nutzung moderner Tech-nologie umzustellen, stoßen landesweit noch auf Widerstände.Das zeigen haarsträubende Fälle, die Gorbatschow seinen Ge-nossen zur Abschreckung vorführte. So hatte der Leiter eineselektrotechnischen Betriebes gegen das Votum der örtlichenPartei-Instanzen und ohne vorliegende Billigung eines Ministeri-ums die Firma binnen kurzer Zeit umorganisiert und mit Ge-winn auf Vordermann gebracht. Obwohl das Projekt erfolgreichlief, bemühten seine Gegner den Staatsanwalt. Die Ermittlungengaben zwar keinen Anlass zur Beschuldigung, dennoch wurdeder engagierte Betriebsdirektor aus der Partei ausgeschlossen.Ein Brief zu seiner Verteidigung, von wohlwollenden Genossenverfasst, wurde Gorbatschow zufolge von den örtlichen Orga-nen, also dem KGB, auf der Post abgefangen und erreichteMoskau nie. Eigeninitiative, von den neuen Machthabern gefor-dert, ist nicht nur den Bürokraten, sondern auch dem Geheim-dienst verdächtig.
Mit warnendem Unterton wandte sich Gorbatschow vor demPlenum an diejenigen, „die versuchen, uns aufzuhalten“. DerPartei drohte er an, „alle Bestrebungen zu unterbinden, um alteMethoden und Fehler zu kopieren“. Gorbatschow kämpft je-
79 Gorbatschow stand vor dem Dilemma, mit den alten Kader abzurechnenund gleichzeitig keine Schuldeingeständnisse in Sachen Tschernobyl nachaußen dringen zu lassen. Eine Gradwanderung, die den Parteichef vorüber-gehend einige Glaubwürdigkeit im Ausland gekostet hat. Erstveröffentli-chung: Moskau: Gorbatschow rechnet ab. In: DIE ZEIT, Nr. 26, 20. Juni1986.
133
doch nicht nur gegen den „blinden Glauben an die Allmacht desApparates“. Er kämpft auch gegen überalterte Maschinenparksin den Fabriken, gegen 20 Prozent Ernteverlust durch mangeln-de Transport und Lagerbedingungen, gegen das nutzlose Ab-brennen von jährlich 13 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und erkämpft auch gegen Produktionssteigerungen, die sich als volks-wirtschaftlicher Schaden entpuppten. So wurden Zuwachsratenbeim Maschinenbau stets nach Gewicht gemessen. Wer alsomöglichst schwere Werkstoffe und Materialien verwendete, hattedie besten Resultate, egal, wie leistungsfähig eine Maschine wirk-lich war. Derlei Unsinn soll mit dem kommenden Fünfjahrplanabgestellt werden, der von den Partei-Instanzen nun zur Verab-schiedung an den Obersten Sowjet, das Parlament, weitergeleitetwurde. Doch das Lenin-Zitat „Fürchterlich sind Illusionen undSelbstbetrug, vernichtend die Angst vor der Wahrheit“, vonGorbatschow als Leitlinie für dieses Plenum bemüht, hat denGeneralsekretär nicht dazu bewogen, auch die Katastrophe vonTschernobyl einer kritischen Erörterung zu unterziehen.
Von drei Zeitungsseiten, die Gorbatschow mit seiner Redefüllte, sind lediglich spärliche zehn Zeilen dem größten Atom-kraftunfall der Menschheit gewidmet. Auch da findet er nurWorte des Beileids für die betroffenen Familien und Worte derAnerkennung für das ganze Land, das bei dieser „harten Prü-fung“ aufgestanden sei, um die Folgen zu beseitigen. Um welcheArt Folgen es sich dabei handelt, konnten die Sowjetbürger in-zwischen der Moskauer Presse entnehmen. Seither lässt sich dieKatastrophe nicht mehr auf das Konto eines tragischen Be-triebsunfalls abbuchen. Mit der Entlassung des Betriebsdirektorsund des leitenden Ingenieurs von Tschernobyl sind Fachleutedingfest gemacht worden, die eigentlich wissen mussten, wie derSchaden zu begrenzen gewesen wäre. Zuvor schon waren Mit-glieder der Kommunistischen Partei ausgeschlossen worden, weilsie - wie es hieß - in der Not nur an sich selbst und nicht an dieanderen gedacht hatten.
Die Kritik an diesen Verantwortlichen, die versagten odersich aus dem Staub machten, als ihr Einsatz gefordert war, kannnicht die Verbitterung mancher Evakuierter dämpfen, die sich
134
nun mit offenen Protestbriefen über ihre Behandlung beschwe-ren. Bürokratische Hemmnisse, Ablehnung und mangelndeHilfsbereitschaft werden nun angeprangert und sogar vom Par-teiblatt Prawda an die Öffentlichkeit getragen. Inzwischen istauch klar, welche neuen Probleme auftauchen: Die Menschenaus den verseuchten Gebieten lassen sich nicht wie erforderlichevakuieren. In Weißrussland gab es keinen Unterschlupf mehrfür 7.000 Bewohner des Ortes Bragin.
Obwohl nach dem Eingeständnis der Regierungszeitung Iswe-stija niemand Monate oder gar Jahre hier unbeschädigt weiterle-ben könnte, blieben die Einwohner zurück und müssen sichdamit begnügen, dass nun in ihrer Gegenwart Haus für Haus,Straße für Straße entseucht werden. Wohin aber das radioaktiveMaterial gebracht werden soll, bleibt unklar. Auch die Lagerungder abgeschabten radioaktiven Bodenkrume von mehreren Zen-timetern Dicke löst nach Darstellung der Zeitung immer nochRätselraten aus. Diese äußerst kritischen Berichte erschienen justzur Sitzung des Obersten Sowjets.
135
ERSTE WAHRHEITEN ÜBER DIE TRAGÖDIEMenschliches Versagen verursachte die Katastrophe
von Tschernobyl80
Der offizielle Untersuchungsbericht über Ursache und Aus-maß der Katastrophe von Tschernobyl hat die sowjetische Öf-fentlichkeit schockiert. Was im Moskauer Politbüro, dem obers-ten Führungsgremium der Partei, besprochen und auszugsweisein den sowjetischen Zeitungen veröffentlicht wurde, reicht aus,um an der Funktionsfähigkeit des Staatsapparates zweifeln zulassen. Zuständige Ministerien haben versagt, gegen eine Vielzahlhochrangiger Regierungsmitglieder ermittelt die Staatsanwalt-schaft. Parteirügen und Parteiausschlüsse häufen sich. „Eineganze Reihe grober Verletzungen der Betriebsregeln für Kern-kraftwerke“ war dem Bericht zufolge an dem Unglück schuld:„Es wurde festgestellt, dass sich die Havarie durch eine ganzeReihe von groben Verstößen gegen die Betriebsvorschriften derReaktoranlagen ereignet hat, die Beschäftigte dieses Werkeszuließen.“
„Verantwortungslosigkeit“ und „Schlamperei“ sind dieSchlagworte der Kritik, mit der jetzt auch die sowjetische Öffent-lichkeit konfrontiert wird. Neben dem Tod von bisher offiziell28 Menschen (ein israelischer Arzt, der in einem MoskauerKrankenhaus Opfer der Katastrophe behandelt hat, berichtetevon mindestens 30 Toten) wurde auch erstmals - annähernd -das Ausmaß der notwendigen Massenuntersuchungen von „eini-gen hunderttausend Betroffenen“ zugegeben. Das verseuchteGebiet soll 1.000 Quadratkilometer umfassen. Die unmittelbarenSchäden an Hab und Gut, an Ernte und Produktion, ohne dieFolgekosten, werden auf jetzt schon umgerechnet 6,5 MilliardenMark beziffert. Die Maßnahmen zur Eindämmung der immer
80 Erst allmählich wurden die Sowjetbürger an die Wahrheit der Kernkraft-katastrophe herangeführt, um viele absurde Spekulationen einzudämmen.Erstveröffentlichung: Tschernobyl - „Menschliches Versagen“. In: DIEZEIT, Nr. 31, 25. Juli 1986.
136
noch bestehenden Gefahr nehmen sich gigantisch aus: Um dasGrundwasser rings um Tschernobyl zu schützen, muss ein Sys-tem zum Auffangen und Ableiten des Regenwassers geschaffenwerden, mit dem immer noch Radioaktivität aus der Luft, vonBäumen und Sträuchern auf die Erde geschwemmt wird. Dernahe bei Tschernobyl gelegene Fluss Pripjat ist durch einenzwanzig Kilometer langen Erdwall geschützt. Inoffiziell ist inMoskau zu erfahren, dass der havarierte Reaktorblock von einerhundert Meter tiefen Betonmauer ummantelt werden soll, umGefahren für das Grundwasser abzuwehren. Derweil wird dieevakuierte Bevölkerung darauf vorbereitet, dass sie zu einemgroßen Teil nicht mehr in ihre alten Wohnorte zurückkehrenkann.
In der an die Ukraine angrenzenden Republik Weißrusslandhaben die Ministerien bereits erste Neuansiedlungen der Evaku-ierten nördlich der Gefahrenzone verfügt. Im Sperrgebiet selbstmüssen immer weitere Bereiche des Erdbodens abgetragen wer-den. Für alle Kernkraftwerke der Sowjetunion sollen dem Be-richt zufolge neue Sicherheitsbestimmungen erarbeitet werden.Außerdem will die Partei mit einer ungewöhnlichen Maßnahmeihre Kontrolle in den Atomkraftwerken durch entsandte Partei-aufseher stärken, die nicht der Betriebsleitung und den örtlichenSekretären, sondern nur dem Zentralkomitee in Moskau unter-stellt sind. Inzwischen überraschte der neu ernannte Direktor desKernkraftwerkes Tschernobyl mit der Nachricht, dass bereits imOktober dieses Jahres der erste und der zweite Reaktorblock(verunglückt war der vierte Block) wieder in Betrieb genommenwerden sollen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass „nochoffene“ technische Fragen gelöst werden. Der besondere Ar-beitsrhythmus in Tschernobyl zeigt allerdings, dass dort die Ge-fahr für die Menschen noch keinesfalls gebannt ist. Die Fachleu-te dürfen sich nur zwei Wochen ununterbrochen im Sperrgebietum den Reaktor aufhalten und verbringen dann weitere zweiWochen zur Erholung und medizinischen Untersuchung aneinem anderen Ort, bevor sie wieder an ihren riskanten Arbeits-platz zurückkehren können. Darüber hinaus sind in TschernobylPsychologen tätig, welche die Arbeiter am Ort des Unglücks
137
betreuen. Das scheint nötig zu sein. So klagte die Prawda, dassmehr als 3.000 Arbeiter aus Tschernobyl sich anderswo einenneuen Arbeitsplatz gesucht hätten. Weitere tausend Fachkräfteseien „auf Urlaub geschickt“ worden. Der Mangel an Arbeits-kräften und unwirksame Maßnahmen der örtlichen KP-Führunggelten dem Parteiblatt als die schwerwiegendsten Hindernissebeim Kampf gegen die Folgen der Katastrophe.
138
EIN LAND LÄHMENDER WIDERSPRÜCHEDie Sowjetunion – von innen gesehen81
Die Sowjetunion unter Gorbatschow erscheint nicht nur fürAußenstehende widersprüchlich. Politik heißt für Partei undBevölkerung in der UdSSR derzeit: Erstens - Kompromissefinden, mit denen die Ziele des XXVII. Parteitages wie des an-spruchsvollen Komplexprogrammes bis zum Jahr 2000 weiter-verfolgt werden können, ohne dabei die wirkliche Lage vonWirtschaft und Landwirtschaft zu beschönigen. Zweitens - Wer-ben um politische Zustimmung, und zwar innerhalb wie außer-halb der Partei. Glasnost, die Offenheit, eine der Forderungenvon Parteichef Gorbatschow, die zum politischen Schlagwortgemünzt und dabei verschieden interpretiert wird, führte zu einerGesprächs- und Kritikbereitschaft, wie sie in den vergangenenJahren in der Sowjetunion selten zu beobachten war.
Während in der Regel dem Ausländer mit Leistungsbilanzenimponiert werden sollte, steht nun bei vielen Kolchosvorsitzen-den oder Werksdirektoren die Sorgenliste um mangelnde Quali-tät, schleppenden Materialnachschub und fehlende Koordinationganz oben auf der Tagesordnung für ein Informationsgespräch.Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die staatlich gelenkten Medi-en - nicht immer zur Freude der Partei - den Unmut des ge-wöhnlichen Sowjetbürgers in höchst eigenwilliger Diktion ver-breiten. So wurde eine Arbeiterin während einer Fernsehsendungmit der Frage konfrontiert, wie sie zu einem neuen System vonLeistungsprämien stehe, mit dem eine bessere und schnellereProduktion erreicht werden soll. Ihre erstaunliche Antwort liefauf die Gegenfrage hinaus: „Warum soll ich mich für 220 Rubelim Monat abplagen, wenn ich sowieso schon 200 Rubel einste-
81 Erste Beobachtungen zeigen die Widersprüche der Perestrojka. Zahlrei-che Funktionäre und Institutionen verweigern sich den Reformen. DieProbleme, die zu bewältigen waren, erschienen allzu groß. Das Beharrungs-vermögen der alten Garde erwies sich schon bald als übermächtig. Erstver-öffentlichung: Sowjetunion 1986 - von innen gesehen. In: Osteuropa 8-9,1986, 813-821.
139
cke, auch bei schlechter und schlampiger Arbeit?” Der normalesowjetische Zuschauer wird solche Reaktionen kaum mit demAufschrei der moralischen Empörung von sich weisen, sondernvielmehr zustimmend nicken.
Was als Aufbruchsstimmung in der Sowjetunion erzeugtwurde oder erzeugt werden sollte, lässt sich derzeit noch nichterkennbar in wirtschaftliche oder gesellschaftliche Erfolge nachden Parteierwartungen umsetzen. Die Bevölkerung scheint zu-nächst mit vorsichtiger Kontrolle einem Nachholbedürfnis zufrönen, das man etwa als Prozess der Selbstfindung bezeichnenkönnte. Dieser Prozess, der entlarvt und erläutert, der Hoffnun-gen weckt, die oft schnell wieder gedämpft werden, um sie fürsowjetische Machtverhältnisse nicht ins Kraut schießen zu las-sen, ist sicher nicht als Blendwerk für die Auslandspropagandainszeniert worden. Dafür ist eine zu große und kritische Offen-heit entstanden, die sich nicht kurzerhand wieder zurücknehmenlässt. Dennoch sind auch hierbei Widersprüche auszumachen,die von Skeptikern als Argument für den nur eingeschränktenCharakter einer offenen Diskussion angeführt werden.
Am deutlichsten wird das Auf und Ab zwischen Erwartungenund Enttäuschungen im kulturellen Bereich spürbar. Als aufMoskaus Bühnen Parteifunktionäre gescholten wurden und sichzunächst Gorbatschow selbst, dann nur noch rangniedrigereProminenz im Theater sehen ließ, wie im Stück „Silberhochzeit”im Moskauer Künstlertheater (Moskovskij ChudoshestvennyjTeatr), galt es sogar für konservative Hauptstadtbürger als nor-mal, Versäumnisse der Partei mit dem Ausländer zu diskutieren.Als jedoch der politisierende Schriftsteller Jewgenij Jewtu-schenko auf dem Verbandstreffen russischer Schriftsteller esmoralisch unzulässig nannte, „dass vierzig Jahre nach dem Kriegin einer ganzen Reihe von Städten noch Bezugsscheine für But-ter und Fleisch existieren”, wurde seine brisante Rede nur inAuszügen veröffentlicht.
Der Autor selbst musste dafür sorgen, dass eine autorisierteMitschrift seines Vortrages als Vervielfältigung unter die Leutegebracht wurde. Dass Jewtuschenko dabei auch die Privilegiender Nomenklatura angriff, schien zunächst nur auf der aktuellen
140
Linie zu liegen. Gleiches taten auch hohe Parteifunktionäre wieder Moskauer Stadtparteichef Jelzin, gleiches tat sogar - indirektals Leserbrief - die Parteizeitung Prawda. Einen Schlussstrichunter diese Debatte zog jedoch Jegor Ligatschow, der offensicht-lich zweite starke Mann im Politbüro. Die da oben, so der Ein-druck für den politisch interessierten normalen Sowjetbürger,wollen doch nicht so recht wahrmachen, womit so vehementbegonnen wurde.
Enttäuschend war auch für viele, dass einer der wichtigstenLiteraturpolitiker, Chefredakteur der Literaturnaja Gasjeta, Ale-xander Tschakowskij, in dieser Phase der Aufbruchsstimmungmit verblüffend dreisten Ausreden aufwartete, ja überhaupt füreinen entsprechenden Auftritt Gelegenheit erhielt: Es ging da-rum, ob nach dem Parteitag in Zukunft bislang nicht gedruckte,aber in der Bevölkerung viel diskutierte Autoren ihre Werkeveröffentlichen dürften - alles im Rahmen der neuen Offenheitselbstverständlich.
Diese Frage reduzierte Tschakowskij auf ein Problem desForstministeriums, von dem die Papierproduktion und -zuteilungabhängig sei. Unwillkürlich stellt man solchen Ausflüchten dieJewtuschenko-Anklage über das „verbrecherische Defizit” inder Sowjetunion gegenüber, nämlich „Mangel an Papier fürdiejenigen Bücher, die unser Volk normalerweise liest, währendfür langweilige Politbroschüren die Hälfte der Taiga abgeholztwird”. Dabei wird deutlich, wie verschieden doch die Standpunk-te der Leute sind, die sich allesamt anschicken, das sowjetischeSystem gemeinsam weiterzuentwickeln. Für den normalen Sow-jetbürger sind viele Feinheiten solcher Auseinandersetzungen aufden ersten Blick zwar nicht zu erkennen. Aber der XXVII. Par-teitag hat zumindest deutlich gemacht, dass die forsche Art, mitder Gorbatschow zu Beginn seiner Amtszeit innenpolitischeThemen aufgegriffen hat, einem eher gedämpften Auftretengewichen ist.
Viele hatten von ihrem Parteichef mehr erwartet, schärfereWorte der Verurteilung von innerparteilichen Missständen wieder Korruption und der Privilegien und weiterreichende Zuge-ständnisse an eine - wenn dieser Ausdruck in einem solchen
141
Zusammenhang erlaubt ist - Liberalität auf kulturpolitischemSektor. Gerade hier auch waren entschiedenere personelle Ver-änderungen erwartet worden. Auch die Tatsache, dass sich einigezuvor herb kritisierte Parteikader wie die Politbüro-MitgliederDinmuhamed Kunajew oder Schtscherbizkij in ihren Positionenhalten konnten, wurde vereinzelt dahingehend interpretiert, dasses für einen personellen Verjüngungsprozess innerhalb der Parteinoch hinreichend Widerstände gäbe. Gorbatschow also schlüpftefür viele aus der Rolle des erklärten Erneuerers in die Rolle desKompromisslers.
Dabei wird oft übersehen, dass der neue Parteichef viele jenerForderungen vorgebracht hatte, die auch zum politischen Credoseiner Vorgänger gehörten. Nur das vehementere Auftreten, diebessere Beherrschung des Instrumentes Massenmedien, ein wirk-samer Populismus haben dazu beigetragen, dass Erwartungeninnerhalb wie außerhalb der Sowjetunion ein Ausmaß ange-nommen haben, das vielleicht allein durch die Inhalte des Gesag-ten gar nicht einmal bedingt war. Natürlich verbreiteten sichunter der Bevölkerung rasch nach Gorbatschows Wahl einigeseiner Sentenzen, mit denen er sich anschickte, einen Loslö-sungsprozess von den alten Kadern einzuleiten. „Wer nichtbereit ist, unseren Weg mitzugehen, von dem müssen wir unstrennen”, lautete eine solche Devise, die der Parteichef mit einerheftigen und namentlichen Kritik an einzelnen Ministern ver-band.
In der Tat registrierte die Bevölkerung den enormen Perso-nalwechsel gerade auf mittlerer und unterer Funktionärsebene.Und in manchen Behörden kam das Bonmot auf, sich beimVerabschieden nicht mehr „Auf Wiedersehen” zu wünschen,weil keiner mehr sicher sein konnte, ob er bei der nächsten Ge-legenheit noch seinen Gesprächspartner am alten Platz vorfindenwürde. Doch fühlten sich auch viele Menschen - leger ausge-drückt - an der Nase herumgeführt, als sich künstlich erzeugteDiskussionen wie Luftblasen in Nichts auflösten.
Als das Thema Geldreform und Preiserhöhungen die Rundemachte, wusste zunächst keiner, woran er war. Hatte hier viel-leicht wirklich in die staatliche Presse eine Auseinandersetzung
142
zwischen Wirtschaftswissenschaftlern und Parteipolitikern Ein-zug gehalten? Oder sollte bewusst eine Stimmung erzeugt wer-den, damit die Bevölkerung ihre schwarz verdienten Rubel aufden Markt wirft, um in Panikstimmung nutzlose Ladenhüteraufzukaufen? Wie weit geht überhaupt das Spiel mit der öffentli-chen und veröffentlichten Meinung - möglicherweise um heraus-zubekommen, wie die Stimmungslage unter der Bevölkerung ist?Denn wenn beispielsweise die Parteizeitung Prawda allein denBegriff „Geldreform” in eine Überschrift mit aufnimmt und miteinem Fragezeichen versieht, dann können die verantwortlichenHerausgeber sicher sein, dass auf dem Weg zur morgendlichenArbeit dieses Thema von der Bevölkerung in Bus und Bahnaufgegriffen wird, auch wenn eine genauere Lektüre der Prawdasonst nicht gerade zum Lebensinhalt der meisten Sowjetbürgergehört.
Zumindest aber lassen sich Tendenzen in der pressepoliti-schen Linie ausmachen, wonach auch tabuisierte Themen zu-nehmend Gegenstand der Berichterstattung werden. Dazu ge-hört das Thema Preiserhöhung bei Brot und Mieten. Doch gingees wirklich an diese Vergünstigungen des kleinen Mannes, dannkäme der Staat nicht ohne irgendwelche Kompensationen aus.Denn zu viele Menschen leben mit der Mindestrente von fünfzigRubel oder verdienen weit weniger als das statistische Monats-gehalt von derzeit knapp 190 Rubel. Ihnen kann man keine wei-teren Belastungen zumuten, zumal ihre Einkünfte bei jetzigemPreisniveau zwar ein knappes Überleben, kaum aber Konsumoder gar Vermögensbildung erlauben.
Gerade darum aber geht es für die meisten Sowjetbürger, diesich von der Ära der Erneuerung etwas erwarten. Die Zahlen desKomplexprogrammes, nach denen bis zum Jahr 2000 die derzei-tige Industrieproduktion und das Nationaleinkommen verdop-pelt werden sollen, sind zu abstrakt für den Durchschnittsbürger,und Aufrufe zu besserer Arbeit hat er zur Genüge gehört. Esgeht für die Sowjetführung eigentlich darum, wie man die Men-schen zu besserer Leistung motivieren kann. Und ein solcherWeg führt nur über den persönlichen Profit. Diese Erkenntnisscheint sich auch der Wirtschaftswissenschaftler Abel Aganbeg-
143
jan zu Eigen gemacht zu haben. Er ist aus der Zweigstelle derAkademie der Wissenschaften in Nowosibirsk nach Moskau indie Zentrale übergewechselt, um gewissermaßen Vordenker fürneue Wirtschaftskonzepte zu sein. Aganbegjan befürwortet bei-spielsweise einschneidende Preiserhöhungen gerade bei Grund-nahrungsmitteln, um eine realistische Kalkulation mit Rückwir-kung auf die landwirtschaftliche Produktion zu erzielen. Er plä-diert ebenso für eine gemäßigte Privatisierung, die sich als Er-gänzung zu staatlichen Unternehmen verstehen soll, also nichtkonkurrierend in den Produktionsprozess eingreifen darf. Konk-ret nannte Aganbegjan im Gespräch mit Journalisten, das freilichnicht in dieser Form von sowjetischen Medien publiziert wurde,zwei Möglichkeiten der Privatisierung. Entweder zahlt der Klein-gewerbetreibende eine Lizenzgebühr, oder er beteiligt nach ei-nem prozentualen Satz den Staat an seinem Gewinn. Als mögli-che Bereiche nannte der Wirtschaftswissenschaftler etwa dasTaxigewerbe, Dienstleistung im Reparaturbereich. So wird be-reits in Tallin, der Hauptstadt der Estnischen SSR, mit einerprivaten Reparaturwerkstatt für Fernseher experimentiert. Auchdie Renovierbrigaden für Wohnungen könnten durch privateAnbieter ergänzt werden. Nur - alle diese Beispiele würden defacto bestehende Modelle legalisieren. Denn in den meistenDienstleistungsbereichen wird, wenn auch schwarz, aber docherfolgreich privatisiert.
Freilich muss es für die Parteianalytiker oft enttäuschendsein, wenn sie feststellen, dass das private Profitdenken vielerSowjetbürger ihr politisches Engagement weit übersteigt. Dochgerade davon lebt die Sowjetwirtschaft in einzelnen Bereichennicht schlecht. Ein Schabaschnik, ein so genannter freier Briga-dearbeiter, der dort einspringt, wo es gilt, den Plan zu retten, istein angesehener Arbeiter. Und seine Tätigkeit ist ganz legal. ImHauptberuf arbeitet er für vielleicht 120 oder 130 Rubel (alsoweit unter dem offiziellen Durchschnittsgehalt) als Lehrer oderArzt. Seinen Urlaub nutzt er, um als Akkordarbeiter in sibiri-schen Wäldern oder auf kasachischen Kolchosen in einem Mo-nat das zehn- bis fünfzehnfache seines Monatsgehalts zu verdie-nen. Woher das Geld dann kommt, aus welcher Quelle das Ma-
144
terial für die Wohnhäuser und Stallungen fließt, mit dem dieSchabaschniki für Kolchosen die Gebäude errichten, die normaleBaubrigaden nicht oder nur unzureichend schaffen - all dasbleibt im illegalen Halbdunkel. Auch solche Fälle wurden ver-mehrt in die Presse gebracht, doch mit einer erstaunlichen Ten-denz: Es galt nicht, sich über Korruption und sozialistische Un-moral des Schabaschniki-Gewerbes zu empören; sondern manwollte zeigen, dass für gutes Geld auch gute Arbeit geleistet wird.Damit wird auch eine wichtige Erwartungshaltung der meistenSowjetbürger angesprochen. Es dürfte nur wenige Familien ge-ben, die ausschließlich von einem einzigen und dann auch nochdurchschnittlichen Monatsgehalt existieren können. Doppelver-diener sind die Regel, und meist wird noch durch zusätzlicheGeschäfte Geld in die Haushaltskasse gebracht.
Für Außenstehende ist oft schwer zu verstehen, dass derEmanzipationswunsch vieler sowjetischer Frauen im Vergleichzu dem von Frauen im Westen ein ganz anderes Ziel verfolgt:Sowjetische Frauen mit Familie wollen oft weniger arbeiten, ummehr Zeit für Mann und Kinder zu haben. Dieses Bedürfnis istbereits Gegenstand parteiinterner Erörterungen. Um hier sozialeBefriedung zu erreichen, soll ein an sich davon völlig unabhängi-ger Prozess genutzt werden, nämlich der angestrebte wissen-schaftlich-technische Fortschritt, der eine umfangreiche Automa-tisation in der Herstellung zur Folge haben soll. Mit dieser Ent-wicklung, so sagen Hochrechnungen sowjetischer Wissenschaft-ler, können mindestens zwölf Millionen Menschen von ihrerbisherigen manuellen Arbeit freigesetzt werden. Ein Teil davonwird durch die Alterspyramide und die sinkenden Geburtenratenkompensiert.
Doch gerade den Frauen, die überwiegend mit diesen einfa-chen Arbeiten beschäftigt sind, wird eine solche Entwicklung alssozialer Fortschritt angeboten. Denn ihre Arbeitszeit könnteerheblich verkürzt werden zugunsten der familiären Aufgaben.Solche Zukunftsprojekte werden freilich diskutiert, ohne diefinanzielle Seite hinreichend zu berücksichtigen. Der Begriff„voller Lohnausgleich” kommt nicht vor. Allerdings wird miteinem weiterentwickelten Sozialprogramm für kinderreiche Fa-
145
milien manche Härte aufzufangen sein. Eine solche Regelungwürde von vielen betroffenen Frauen befürwortet. Doch auchdie Tatsache, dass die Versorgung mit garantierten Arbeitsplät-zen unter Gorbatschow perspektivisch in Frage gestellt wird,zeugt von mehr als nur einer routinemäßigen Wirtschaftsanalyse.Die Taktik scheint zu sein, die Sowjetbürger nicht in einem Zu-stand sorgenfreier Sicherheit verharren zu lassen. Natürlich wirdnicht dem persönlichen Existenzkampf das Wort geredet.
Aber Leistung, so die Signalwirkung, soll in Zukunft einegrößere Rolle spielen für den Lebensstandard des Einzelnen. Eswird nicht mehr genügen, nur das verfassungsmäßige Recht aufArbeit einzufordern, ohne sich künftig um die Lage auf demArbeitsmarkt, die Bedürfnisse neuer Technologien zu kümmern,ja sich konkurrierend um die attraktivsten Stellen zu bemühen.Bei solch einer Entwicklung spielt die wirtschaftliche Rech-nungsführung eine wichtige Rolle. Als Fernziel tauchte der Be-griff schon in der bisherigen, jetzt revidierten Fassung des Par-teiprogramms auf, doch erst seit Andropow scheint diese Forde-rung in die Tat umgesetzt zu werden. Gorbatschow machte es zuseinem erklärten Ziel, diese chosrastschot vollends zu verwirkli-chen. Im Grunde handelt es sich dabei um das Bemühen, fürAusgaben und Einnahmen eines Betriebes und für die Planungdie Betriebsleitung selbst verantwortlich zu machen. Für dieProduktion in sozialistischen Ländern ist dies eine Herausforde-rung an die Führungskader, die bislang ihre Verantwortung im-mer weiter delegieren konnten und den Schwarzen Peter schließ-lich gerne den Fachministerien oder Planungsbehörden zuscho-ben.
Mit der allmählichen Umstrukturierung der Wirtschaft schei-nen aber auch manche Führungskräfte überfordert. Interessantist jedoch, dass aus dieser Grundforderung nach mehr Selbstän-digkeit der Unternehmen, die ab nächstem Jahr alle diese wirt-schaftliche Rechnungsführung übernommen haben sollen, Wün-sche in völlig neuen Bereichen abgeleitet werden. Ob in derZeitungsredaktion, dem Buchverlag oder dem Theaterensemble -die Forderung nach größerer Selbständigkeit wird meist unterBerufung auf den wirtschaftlichen Umbau erhoben. Im Klartext
146
heißt dies: auch die Intelligenz wünscht eine Befreiung von denbevormundenden Behörden. Solche Themen wurden nicht hin-ter vorgehaltener Hand diskutiert, sondern öffentlich angespro-chen. Angriffe auf den Apparat der Zensur gehörten dazu eben-so wie die Forderung von Filmregisseuren, Filme, die teilweisejahrzehntelang wegen ihrer Tabuthemen in den Archiven lagern,endlich aufzuführen. Viele dieser bislang geschilderten Eindrü-cke entstammen zwar dem Hauptstadtleben in Moskau, das mannatürlich nicht mit dem in der Sowjetunion insgesamt gleichset-zen darf. Dennoch gibt es durch die Massenmedien, allen vorandurch das Fernsehen, nivellierende Tendenzen, die landesweit zuähnlichen Reaktionen führen.
Das galt besonders für eine Aufsehen erregende Fernsehpro-duktion, die noch Wochen nach ihrer Ausstrahlung bis in diesibirische Provinz als Gesprächsstoff diente. Unter einem un-scheinbaren Titel („Byvschie. Sudebnyj otscherk“ - Die ewigGestrigen. Ein Prozessbericht) wurden die Zuschauer mit einerDokumentationssendung überrascht, die sozusagen Korruptionauf Kosten der Bevölkerung sichtbar machte. Es ging um Vor-kommnisse im Gebiet von Rostow, das schon lange unterFleisch- und Buttermangel litt. Das Bemerkenswerte an dieserDokumentation war die „Entlarvung” von Führungskräften bishinauf in das Handelsministerium der RSFSR in Moskau - vorden Kameras. Zwar hatten die Zeitungen schon zuvor über die-sen Skandal berichtet, in den insgesamt etwa 200 Beteiligte ver-wickelt sein sollen und dessen Prozesswelle noch lange nichtabgeebbt ist. Doch als die Fernsehkamera den Zuschauer optischin die Todeszelle des Gefängnisses führte, wo einer der Haupt-schuldigen auf die Vollstreckung des Urteils wartete, schaudertees selbst solche Sowjetbürger, die Korruption für einen unum-gänglichen Tatbestand des alltäglichen Lebens hielten.
Die Höchststrafe in diesem Prozess erging unter anderem anArkadij Urkin, der im fabrikeigenen Laden dem gewöhnlichenSowjetarbeiter Knochenreste verkaufte, das eigentliche Fleischaber an bessere Kreise gegen Höchstpreise lieferte. Sein Gewinn:umgerechnet etwa dreieinhalb Millionen D-Mark, eine Villa,Schmuck, den er im Garten vergrub, und - was besonders viel
147
Neid erregte - viele Importwaren aus dem westlichen Ausland.Mit verlegenem Lachen gestand dieser Arkadij Urkin vor derKamera, er habe zwar die Leute betrogen, nie aber deren Wider-spruch hervorgerufen. Ein anderer Häftling durfte im Fernsehenaussagen, er sei durch die Verhältnisse überhaupt erst zur Krimi-nalität getrieben worden - und er fügte hinzu, genau diese Aussa-ge werde man wohl wieder herausschneiden, da sie nicht in dasGesellschaftsbild passe und man ihn lieber als den geborenenVerbrecher abstempeln wolle.
Der Häftling irrte: Die Dokumentarfilmer und Zensoren lie-ßen just diese Aussage im Film, der in seiner ersten Fassung zweiStunden lang war, dann aber um mehr als zwei Drittel für dieAusstrahlung im Fernsehen gekürzt wurde. Der Vorwurf diesesVerurteilten, die Verhältnisse hätten ihn zum Verbrecher ge-macht, wurde sogar in abgemilderter Form von der Regierungs-zeitung Iswestija aufgegriffen, die bescheinigte, dass die Mangel-wirtschaft in der Sowjetunion ebenso wie die Allmacht der Funk-tionäre mitschuldig an solchen Verbrechen seien.
Neu und verblüffend für alle Beobachter in Moskau war auchdie Tatsache, dass sogar ein Politbüromitglied, Gejdar Alijew,bereit war, in einer öffentlichen Pressekonferenz unbefangenFragen nach den korrupten Verhältnissen im eigenen Land zubeantworten. Zunächst reagierte er zwar noch mit locker-humorvollem Unterton, wie die wörtliche Mitschrift eines Ge-spräches zeigt: „Nehmen wir einmal das ganze Korruptionswe-sen, eine der schmerzlichsten Fragen bei uns. Wer Bestechungs-gelder nimmt und wie viel - das ist schwer zu sagen. Im Westenzum Beispiel weiß man zuweilen, wie viel Bestechungsgeld einMinisterpräsident genommen hat. Man klagt ihn an, aber nachzwei, drei Jahren liegt noch kein Urteil gegen ihn vor. Na ja, undbei uns nehmen die Leute schon auf unterer Ebene Beste-chungsgelder, und deshalb ist es eben schwer zu sagen, wer undwie viel Summen da eine Rolle spielen.“
Natürlich wissen die Sowjetbürger selbst am besten, auf wel-cher Ebene die alltägliche Bestechung beginnt: Da ist der Milizi-onär, der dem Verkehrssünder gegen eine kleine Extrazahlungdas Strafmandat erlässt. Oder der Zehn-Rubel-Schein im Pass
148
verschafft an der Rezeption eines Hotels Zugang zu einem derbegehrten Zimmer. Selbst Studienplätze und Ministerposten sindin südlichen Sowjetrepubliken schon gegen Barzahlung „ver-kauft” worden. Die regionalen Plenarsitzungen der Zentralkomi-tees und die Parteitage der Republiken haben bereits seit der ÄraAndropow reichlich Beweis- und Anschauungsmaterial für sol-che Enthüllungen geliefert.
Doch die Liste der Verstöße gegen die kommunistische Mo-ral ist noch länger: Aussteiger, die keiner geregelten Arbeit nach-gehen und kurz Schmarotzer genannt werden, stehen ebensodarauf wie Gelegenheitsdiebe, die sich in ihrer Fabrik mit not-wendigen Ersatzteilen eindecken, weil auf dem normalen Marktnichts aufzutreiben ist. Es ist müßig, darüber zu schreiben odersich gar beschweren zu wollen. Was der Markt nicht ermöglicht,wird oft genug auf die linke Tour besorgt: Scheibenwischer,Radkappen und Seitenspiegel der parkenden Autos bleiben da-von ebenso wenig verschont wie Fotodrucke und Landkarten,die in sowjetischen Bibliotheken ohne viel Skrupel von den Be-nützern aus den Büchern gerissen werden. Schlimmer freilich istfür den Staat der Schwarzhandel mit begehrten westlichen Gü-tern, von Jeans bis zum Videorecorder. Doch ein Politbüromit-glied würde sich solch brisanten Themen nicht stellen, gäbe esnicht auch etwas Positives zu berichten, was gewissermaßen derstrengen Hand Gorbatschows und seinem politischen Einflussgutgeschrieben werden könnte. So argumentierte Gejdar Alijewweiter:
„Sehen Sie, diesem Schmarotzertum, dieser Betrügerei, die-ser Korruption und auch den Leuten, die ihre Stellung dafürmissbrauchen, wird es schon schwerer gemacht, weil sich dieGesellschaft gegen solche Erscheinungen erhebt. Dass die ganzeGesellschaft so aktiv den Kurs des Zentralkomitees gegen solcheungesetzlichen Erscheinungen unterstützt, zeigt, dass die absolu-te Mehrheit unserer Gesellschaft gesund ist und frei von unmo-ralischen und ungesetzlichen Erscheinungen.” Doch die Über-zeugungskraft der kommunistischen Moral soll unter Gor-batschow nicht nur verstärkt nach innen angewandt werden.Auch die vielen sowjetischen Initiativen, die sich gegen die ato-
149
mare Rüstung wenden, werden reichlich eingesetzt, um Populari-tät nach außen hin zu gewinnen. Dabei ist erstaunlich, dass beivielen Sowjetbürgern genau diese politische Aktivität keinenbesonderen Stellenwert einnimmt. Offizielle Gesprächspartnerebenso wie die Zeitungs- und Straßenparolen lassen zwar aufden ersten Blick ein Bild entstehen, demzufolge alle Sowjetbür-ger aktiv diese Politik unterstützen. Doch hier lässt sich vielmehr eine Art innere Emigration beobachten.
Die Aufbruchsstimmung, von der bereits die Rede war,scheint sich eher auf die unmittelbaren Lebenserwartungen derMenschen zu beziehen als auf die Weltpolitik. Es wäre sicherfalsch, von einer Verweigerungshaltung zu sprechen. Aber eineauffallende Indifferenz ist durchaus nachweisbar. Desinteressean wirklichen politisch-ideologischen Fragen ist auch bei derJugend stark verbreitet. Fast hat es den Anschein, als wirke dieideologische Parole an der Häuserwand ähnlich einschläferndwie die Reklametafeln in einem westlichen Land.
Gorbatschow selbst war es sogar, der in einem Interview mitdem französischen KP-Organ L‘Humanité neben freilich positi-ven Aspekten so über die sowjetische Jugend urteilte: „Es hatuns beispielsweise ernsthaft beunruhigt, dass sich unter einemTeil der jungen Leute der Alkoholismus breit machte. Schmarot-zerhafte und raffgierige Einstellung, ein schlechter Geschmack,begrenzte geistige Interessen, eine ungenügende Aneignung deskulturellen Erbes - auch solche Erscheinungen kommen vor.“Zumindest kann man Gorbatschow nicht vorwerfen, er verken-ne die Lage im eigenen Land.
Umso erstaunlicher war für die sowjetische Öffentlichkeit daslange Schweigen des Generalsekretärs nach dem Reaktorunfallvon Tschernobyl. Für viele hatte in diesem Moment nicht dasSystem versagt, sondern Gorbatschow selbst hat die erste wirkli-che Bewährungsprobe im Hinblick auf die von ihm propagierteGlasnost, die Offenheit, nicht bestanden. Auch die Tatsache,dass aus Kreisen des ZK-Apparates verbreitet wurde, Gor-batschow habe bereits in der ersten Politbürositzung nach demUnglück die volle Offenlegung der Ereignisse in den eigenenMedien verlangt, sei damit aber mehrheitlich von den übrigen
150
Politbüromitgliedern abgeblockt worden, wirkte wie der verun-glückte Versuch einer verspäteten Ehrenrettung.
Trotz des allmählich einsetzenden Informationsflusses undder regelmäßigen Fernsehreportagen aus dem Unglücksgebiet istdie Sowjetunion ihren Bürgern eine wirkliche Aufklärung überdie Menge der ausgetretenen Giftstoffe und den Grad der Bo-denverseuchung zunächst schuldig geblieben. So zeigen bereitswenige Erlebnisse und Reflexionen aus dem „Innenleben” derSowjetunion, soweit es dem Ausländer überhaupt zugänglich ist,dass eine wirklich neue Politik nicht nur innerparteiliche Wider-stände, sondern auch ein gewisses Maß an Vertrauensverlustunter der Bevölkerung zu überwinden hat.
151
„MIT WELCHEM RECHT KÄMPFEN WIR DORT?”Die offenen Wunden des Afghanistan-Feldzuges82
Igor Illin blickt dem Besucher mit fragenden Augen entge-gen. Eine Haarsträhne hängt keck über der Stirn des bubenhaf-ten Gesichts. Der Hemdskragen steht offen. Über den Lippenzeichnet sich der zarte Ansatz eines Bartes ab. Illin ist als Sow-jetsoldat in Afghanistan gefallen. Er war gerade 19 Jahre alt. SeinGrab befindet sich in Peredelkino, einem kleinen Erholungsort,nur wenige Kilometer von Moskau entfernt. Ein übermannsho-her, roter Granitstein, mit finanzieller Hilfe des Verteidigungs-ministeriums errichtet, steht über der letzten Ruhestätte.
In den Stein sind das Porträt von Igor und seine Lebensdatengraviert: 8.4.1966 bis 19.10.1985. Der Afghanistan-Kämpfer hateinen Sonderplatz auf dem Friedhof erhalten, abgezäunt von denanderen Toten; ringsum liegen nur Gräber von Parteimitgliedern,die sonst üblichen orthodoxen Kreuze fehlen. Hinter Igors Gra-nitstein steht seit mehr als einem Jahr eine hölzerne Tafel. Sieweist den Besucher darauf hin, dass hier ein Obelisk errichtetwerden soll zum Gedenken an die Soldaten, die bei der Aus-übung ihrer internationalen Pflicht gefallen sind.
Szenenwechsel zu einer Totenfeier im Krematorium desDonskoj-Friedhofs in Moskau. Eine Angestellte klärt die Hinter-bliebenen darüber auf, dass die mitgebrachten Blumen an dieserStätte nicht aufbewahrt werden können. Man möge die Gebindedoch deshalb bitte auf den Gräbern der gefallenen Afghanistan-Soldaten niederlegen. Die Opfer, die der sowjetische Einmarschin Afghanistan vor mehr als sieben Jahren inzwischen das Land
82 Ein möglicher Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan wurdeinnerhalb des Landes wie auch international zum Testfall für Glaubwürdig-keit der neuen Politik gemacht. Die Enttabuisierung des Krieges in densowjetischen Medien als sinnloses Kämpfen und Sterben der eigenen Solda-ten leitete die spätere politische Entscheidung zum Rückzug ein. Erstveröf-fentlichung: “Mit welchem Recht kämpfen wir dort?” Moskaus Bemühun-gen um einen Rückzug aus Afghanistan. In: DIE ZEIT, Nr. 5, 23. Januar1987.
152
gekostet hat, sind längst kein Tabuthema mehr. Der Tod in Af-ghanistan ist auch für die Sowjetgesellschaft bedrückende Ge-genwart. Alle Argumente, mit denen der - wie es offiziell heißt -unerklärte Krieg begründet wird, finden in der Bevölkerungimmer weniger Verständnis. Noch vor zwei Jahren wurde dasheroische Angebot eines Vaters in der Presse gefeiert, der anstel-le seines gefallenen Sohnes selbst weiterkämpfen wollte. Dochseit dem Amtsantritt von Parteichef Gorbatschow kommt esimmer häufiger zu kritischen Bestandsaufnahmen und Reflexio-nen über die gesellschaftlichen Rückwirkungen dieses schieraussichtslosen Kampfes. So durften die staatlichen Massenmedi-en die Geschichte eines Kriegsinvaliden zur Diskussion stellen,der bei seiner Rückkehr aus Afghanistan von seinen ehemaligenFreunden gemieden und von den Behörden schikaniert wurde.Ziel dieser Kampagne war die Aussage, man müsse auch denAfghanistan-Soldaten die gleiche Anerkennung zuteil werdenlassen wie den Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges,also des Zweiten Weltkrieges.
Doch eben an diesem Punkt endet das Verständnis vielerSowjetbürger, die nicht einsehen können, dass ihre Heimat auffremdem Territorium verteidigt werden soll. Selbst ehemaligeBefürworter des Krieges geben inzwischen zu bedenken, dassfinanzielle Belastung und Menschenopfer nur dann zu rechtferti-gen gewesen wären, wenn die Aktion einen schnellen Erfolgerbracht hätte.
Jugendliche kehren in Gesprächen immer wieder zu der zwei-felnden Frage zurück: „Mit welchem Recht kämpfen wir dort?”Berichte über Eltern, die nichts unversucht lassen, um ihre Jun-gen vor dem Einsatz in Afghanistan zu bewahren, die selbst vorfinanziellen Bestechungen nicht zurückschrecken, zeugen vondem verzweifelten Bemühen, sich wenigstens privat aus derSache herauszuhalten. Lange Zeit war die sowjetische Gesell-schaft über das wirkliche Ausmaß dessen, was in Afghanistanpassiert, erstaunlich uninformiert. Trotz zahlreicher Reportagenaus dem Kriegsgebiet, trotz anschaulicher Filmberichte überKämpfe und Scharmützel, ist selbst bis heute den wenigsten klar,dass dieser Krieg Millionen Flüchtlinge aus dem Land getrieben
153
hat. Zu lange hatten sich die Medien auf die Darstellung be-schränkt, dass da gut gemeinte Versuche einer gesellschaftlichenEntwicklungshilfe mit den Waffen gegen Volksfeinde verteidigtwürden. Bilder von sowjetischen „Befreiern”, die in afghanischenDörfern mit Salz und Brot begrüßt wurden, von Soldaten, diestatt Waffen nur Medikamente in ihren Händen hielten, gehörtenzur bevorzugten Selbstdarstellung.
Das Bild vom geschlossenen Volkswillen wurde in dem Au-genblick zerstört, da die Parteizeitung Prawda davon sprach, dassdie afghanische Revolution bei weitem nicht von der ganzenBevölkerung angenommen worden sei. Und in jüngerer Zeitmachten die sowjetischen Medien immer häufiger deutlich, dassdie religiösen Fragen in diesem Krieg eine entscheidende Rollespielen - und nicht allein die Waffenlieferungen des „imperialisti-schen“ Westens. Die Tatsache, dass die Prawda unter Berufungauf den neuen afghanischen Parteichef Nadschibullah inzwi-schen zugesteht, die muslimische Geistlichkeit und die Volkstra-ditionen, einschließlich der islamischen Religion, seien berufen,zu einer gemeinsamen Plattform für die nationale Versöhnungbeizutragen, hat unter vielen sowjetischen Lesern Erstaunenausgelöst. Dies gilt umso mehr, als die Partei im eigenen Landoft genug vor den falschen Mullahs warnt, die sie in den zentral-asiatischen Republiken der Sowjetunion immer wieder attackiert.Emotional aber geradezu bewegend wirkte jüngst die Feststel-lung von Außenminister Schewardnadse bei seinem überra-schenden Besuch in Kabul, dass Mütter, Väter, Frauen, Bräuteund Kollegen mit Ungeduld, Unruhe und Hoffnungen auf dieRückkehr „aller unserer Burschen” warteten. Damit sind Hoff-nungen geweckt worden auf ein Ende ohne Schrecken. Inzwi-schen setzt sich die sowjetische Gesellschaft auch mit den Fol-gen des Krieges für die jungen Veteranen auseinander. Der Krieghat bei den Soldaten, die nach Hause zurückgekehrt sind, Nach-wirkungen hinterlassen, die von moralischem Rigorismus bis zurexistenziellen Enttäuschung reichen.
In den Kinos ist gerade ein Film mit dem Titel angelaufen:„Ist es denn leicht, jung zu sein?“, in dem Jugendliche ihre All-tagsprobleme erörtern. Die Klagen ehemaliger Afghanistan-
154
Soldaten zeigen, dass diese sich völlig falsch verstanden fühlen.Sie meinen, dass ihre Erfahrungen abschätzig betrachtet werden,dass sie selbst immer wieder und immer noch als unreife Jugend-liche gelten. Und das sind diese jungen Menschen in der Tatnicht mehr.
„Man hat Angst, man will ja noch leben”, sagt einer in diesemFilm, dessen Freund als Krüppel aus Kabul zurückkam. „Auchdie Orden sind dann kein Trost. Ich tat nur, was sie forderten,ich bin kein Held.” Ein anderer Heimkehrer sinniert düster:„Damals, vorher, habe ich gelebt, jetzt muss ich weiterleben. Inder ersten Zeit habe ich Tag für Tag getrunken, um zu vergessen.Dann wurde ich Feuerwehrmann, da kann man auch nie wissen,wie es ausgeht.”
Das Thema der Veränderung junger Sowjetbürger durch die-sen Krieg hatte schon einmal Schlagzeilen gemacht, als sich einAfghanistan-Rückkehrer zu einer Art Selbstjustiz bekannte -angesichts der gesellschaftlichen Mängel, die er nach demKriegserlebnis in seiner Heimat nicht mehr hinzunehmen gewilltwar. Das Echo der Leser auf diesen Standpunkt zeigte, wie be-sorgt die Bevölkerung über solche Folgen des Afghanistan-Abenteuers ist. „Die Bereitschaft getötet zu werden und, fallsnötig, selbst zu töten, ändert viel”, schrieb der 24-jährige GeorgijDerojan in einem Brief an die Komsomolskaja Prawda und fuhrfort: „Deshalb muss man darüber nachdenken, wie man diejungen Veteranen wieder vernünftig in die Gesellschaft integrie-ren kann.”
Die Leserin Lena Rinejskaja stellte die rhetorisch-provozierende Frage, mit der sie den Sinn des ganzen Afghanis-tan-Abenteuers in Zweifel zog: „Sich zwischen Leben und Todbewegen - ist das nicht ein zu hoher Preis, um sich selbst vonallem Überholten zu befreien? Es muss dafür doch noch einenanderen Ausweg geben...”
155
MEDIEN UND KULTUR
DIE HEIMLICHEN VERFÜHRERVerbotene Früchte als Zeichen des Wandels83
Die heimlichen Verführer der sowjetischen Gesellschaft ka-men auf Videokassetten in das Land. Innerhalb weniger Jahre hatsich die Sucht nach Filmen aus dem Westen den ersten Platzunter den „verbotenen Früchten” erobert. Dabei spielt nichteinmal die Qualität der gewünschten Filme eine hervorragendeRolle. Es geht oft schlicht darum, dass man ausländische Pro-duktionen, die in den heimischen Kinos nicht gezeigt werden,einfach gesehen haben muss. Am harmlosesten sind die norma-len Kinofilme, die auch nach westlichen Maßstäben ohne Be-schränkung der Öffentlichkeit zugänglich sind. So kann manbeispielsweise amerikanische Filme auf dem Schwarzmarkt kau-fen, die in der sowjetischen Grenzrepublik Estland direkt ausdem finnischen Fernsehen aufgenommen und mit russischenUntertiteln versehen wurden. Andere Kopien stammen vonVideokassetten, die Auslandsreisende auf irgendeine Weise mitin das Land gebracht haben.
Die Preise klingen zunächst horrend. Die Leerkassette wird jenach Länge mit 50-80 Rubel gehandelt. Eine bespielte Kassettekann im Extremfall bis zu 300 Rubel kosten. Und wer bereitseine bespielte und eine leere Kassette in einem der inzwischenzahlreichen, aber illegalen Videostudios abgibt, muss für dieErstellung einer Zweitkopie immerhin noch 40-50 Rubel zahlen.Und dies bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 220Rubel. Der Staat versucht, diesem Geschäft entgegenzuwirken,indem seit geraumer Zeit Videotheken eröffnet wurden. Liebha-ber können sich freilich nur eine geringe Auswahl von nicht-
83 Die Verwestlichung auf dem Markt der Konsumgüter griff um sich undbereitete den Boden für den Wunsch nach mehr wirtschaftlichen Verände-rungen. Erstveröffentlichung: Die verbotenen Früchte. In: Das Parlament,5./12. September 1987.
156
sowjetischen Produktionen ausleihen. Gleichwohl hat sich nuneine indirekte Konkurrenz mit dem sowjetischen Filmverbandentwickelt, der nach den jüngsten Reformen darum bemüht ist,möglichst viele ausländische Filme in die Kinos zu bringen, diefrüher teilweise auch aus Geldmangel nicht angekauft wordenwaren. Daneben spielt sich jedoch eine andere Entwicklung ab,die von den sowjetischen Behörden bis zu den ideologischenWächtern der Partei mit großem Missbehagen verfolgt wird.Wenn nämlich ein Taxichauffeur in Moskau dem nächtlichenFahrgast eine besondere Attraktion anbietet, die zehn RubelEintritt kostet, dann handelt es sich mit großer Wahrscheinlich-keit um eines der privaten Video-Kinos, in denen nicht geradeKulturfilme mit dem Prädikat „wertvoll” gezeigt werden. VonPornos bis Horrorfilmen ist inzwischen zumindest in der sowje-tischen Hauptstadt alles auf dem Video-Untergrundmarkt vertre-ten, was gegen die Ideale der Sowjetgesellschaft verstößt. Abernicht nur die zentralen Städte sind davon betroffen. Denn jüngstwurde in der turkmenischen Republikhauptstadt Aschchabad einMann verurteilt, weil er Sadismus und Gewalt propagiert hatte.Gegen Eintrittsgeld nämlich zeigte der Mann einen Videofilmwestdeutscher Herkunft, in dem es um kannibalistische Sittenunter „zivilisierten” Menschen ging.
Solche Filme sind offensichtliche Verstöße gegen die sowjeti-sche Zensur, die Aufrufe zur Gewalt, aber auch Kriegspropa-ganda und antisowjetische Propaganda verbietet. HeimlicheRenner sind aber auch Streifen wie „White Nights“ oder „Mos-kau am Hudson“, in denen mit einem lachenden und einemweinenden Auge das Schicksal sowjetischer Emigranten in Ame-rika behandelt wird. Der ausländische Video-Markt hat derweil inder Sowjetunion ein solches Ausmaß angenommen, dass sogarPolitbüro-Mitglied Ligatschow inzwischen gefordert hat, manmüsse aus ideologischen Gründen den eigenen Videomarkt aus-bauen. Denn obwohl die Rekorder der eigenen Produktion fürsowjetische Verhältnisse mit umgerechnet rund fünftausendMark fast unbezahlbar sind, lässt sich der Videoboom nichtmehr eindämmen. Wenn es um „verbotene Früchte” geht, so derEindruck, dann spielt das Geld auch gar keine Rolle mehr.
157
Eine weitere Sucht ist ebenfalls mit hohem finanziellem Ein-satz verbunden: Der Wunsch, sich möglichst westlich zu kleiden.Unter Sachkundigen gibt es sogar den Fachausdruck, jemand sei„firmeni“ gekleidet, oder aber ein Mädchen sei eine wandelnde„firma“, dann nämlich, wenn ihre modische Ausstattung über-wiegend aus westlichen Textilien besteht. Das höchste Prestigescheinen dabei Schuhe zu genießen, gefolgt von der Oberbeklei-dung. Vor allem aber die kleinen Accessoires, vom Halstuch biszur Swatch-Uhr gelten als Beweis einer Anbindung an den „wirk-lichen” Fortschritt.
Nächster Renner ist - offensichtlich ohne Unterschied vonAlter und Ansehen - die westliche Rock- und Popmusik. Wasfrüher meist durch ausländische Rundfunksender stimuliert wur-de, erhält nun jedoch immer mehr offiziellen Zutritt zur sowjeti-schen Musikszene. Natürlich herrschen auf dem Schwarzmarktfür Originalschallplatten beispielsweise der amerikanischen Sän-gerin Whitney Houston oder der Sänger Michael Jackson undPrince immer noch Schwindel erregende Preise bis zur Höheeines halben Monatsgehaltes. Andererseits hat hier die Musikkas-sette vieles kompensiert. So lässt sich nun die begehrte Musik umein Vielfaches billiger vervielfältigen und verkaufen. Die sowjeti-schen Offiziellen haben jedoch schon seit längerem eine Gegen-offensive gestartet. Von besonders beliebten Gruppen wie derdeutschen Musikgruppe Modern Talking werden im Lizenzver-fahren Schallplatten mit Millionenauflage gepresst und erfolg-reich verkauft. Daneben hat die Öffnung der Kulturpolitik auchviele bisher nicht-offizielle sowjetische Rockgruppen zutagegefördert, so dass die Jugendlichen mehr und mehr dazu überge-hen, ihre eigene Musikszene zu entdecken.
Nur für einen eingeweihten und sprachkundigen Kreis vonSowjetbürgern ist es weiterhin attraktiv, sich Literatur aus demwestlichen Ausland zu besorgen. Hier gibt es, je nach Alter undBildung, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Es kann durchaussein, dass jemand sich tatsächlich aus rein belletristischen Grün-den für Bücher in Originalsprachen interessiert, die in der Sow-jetunion schlicht nicht zu kaufen sind, aber auch nicht auf einerVerbotsliste zu finden wären. Andererseits gibt es immer wieder
158
Nachfrage nach Literatur über die Geschehnisse der eigenensowjetischen Geschichte, die weithin tabuisiert und nur im Aus-land aufgearbeitet wird. Doch auch hier bahnt sich ein Wechselan, der für das Selbstverständnis solcher Sowjetbürger ein ent-scheidender Durchbruch sein kann: Mit der Publizierung wichti-ger Romane und Schilderungen über die Schrecken des Stalinis-mus entsteht jetzt eine Gelegenheit, dieses Informationsbedürf-nis teilweise zu stillen. Aber auch eine andere Thematik hat unterder eingeweihten Leserschaft nicht an Attraktivität verloren,nämlich Spionageromane vom Autorentyp eines John le Carré.Dessen Buch „A perfect spy“ gehört unter den so genannteninformierten Kreisen gewissermaßen zur Pflichtlektüre, ohnederen Kenntnis man bei den hitzigen Diskussionen im gleichgesinnten Freundeskreis heillos verblasst.
Als letztes bleiben dann noch die kleinen Äußerlichkeiten zunennen, die den Sowjetbürger mit Auslandsbeziehungen vondem einfachen Menschen auf der Straße unterscheiden. Daskann ein Stereo-Walkman japanischer Herkunft oder eine Halo-gen-Taschenlampe sein. Gelegentlich reicht auch das Firmen-schild eines westlichen Herstellers. Und sowjetische Frauen ver-mögen auf den ersten Blick zu erkennen, welche Geschlechtsge-nossin sich über Beziehungen das Makeup eines westlichen Pro-duzenten besorgt hat, oder sie verstehen es wissend zu schnup-pern, wenn sie an der Konkurrentin ein Parfüm entdecken, dasschwerlich in einer heimischen Fabrik abgefüllt worden seinkann.
159
DAS THEATER ALS POLITISCHE BÜHNEPerestrojka in der Kultur (I)84
Der kulturelle Aufbruch in der Sowjetunion ist ein Ereignis,das in seinen Ursprüngen zweifellos auf Moskau konzentriert ist.Dies gilt nicht nur, weil hier die meisten Film- und Theaterpre-mieren stattfinden und weil der Redaktionssitz der wichtigstenZeitungen fast ausnahmslos in der sowjetischen Hauptstadt ist.
Entscheidend für die Durchsetzung neuer Ideen ist vielmehrdie Überwindung bürokratischer und ideologischer Hemmnisseim ministeriellen und parteilichen Verwaltungsapparat der Kulturwie auch in den entsprechenden Berufsverbänden der Schriftstel-ler, Filmemacher, Künstler und Theaterleute. Bevor in der PraxisVeränderungen begonnen werden konnten, mussten zunächstradikale Personalentscheidungen, gerade in diesen Verbänden,durchgesetzt werden. Die Bücher, Filme oder Theaterstücke, dieheute soviel Aufsehen erregen, sind nicht erst in der Zeit Gor-batschows entstanden. Das Verdienst der Perestrojka bestehtzunächst einmal darin, dass endlich verborgene Schätze gehobenwerden können. Es ist außerhalb des sowjetischen Kulturbe-triebs schwer vorstellbar, warum hervorragende Filme jahrzehn-telang im Archiv lagen, ehe sie jetzt öffentlich gezeigt werden.Oder warum Theaterstücke jahrelang geprobt, aber nicht öffent-lich aufgeführt werden durften. Gemessen am heutigen Standder kulturpolitischen und gesellschaftlichen Diskussion erschei-nen Theaterstücke oder Filme, in denen etwa der jüdischeWunsch nach Auswanderung erörtert wird, vergleichsweiseharmlos. Auch Streifen, die das lange tabuisierte Problem dersowjetischen Kriegsfreiwilligen, die für die Deutschen gearbeitet
84 Als wichtigstes Merkmal für die neue Offenheit galt der Zugang zu der sogenannten Schubladenliteratur, also der bislang verborgenen oder verbote-nen Manuskripte, nun für die Publizierung oder die Inszenierung auf denzahlreichen Theaterbühnen des Landes zugänglich gemacht wurde. Erst-veröffentlichung: Perestrojka in der Kultur. In: Moskauer Theatertage inMünchen. München 1988, 4-5.
160
haben, aufgreifen, besitzen heute keine besondere Sprengkraftmehr. Die Zeit hat manche Tabuthemen längst überholt. Sowirkt die nachträgliche Freigabe bislang verbotener Bücher oderFilme weniger dramatisch als es auf den ersten Blick den An-schein hat. Der Prozess der kulturellen Perestrojka drückt zu-nächst einmal das Bedürfnis aus, in den Taten dem tatsächlichenEntwicklungsstand der kulturellen Szene gleichzuziehen oderoffensichtliche Fehler und Rückschritte wieder auszugleichen.Ein gutes Beispiel hierfür ist der 1960 gestorbene SchriftstellerBoris Pasternak. Seit seinem Tod vergeht kein Jahrestag, an demsich seine Verehrer nicht zu Lesungen an seinem Grab treffen.Trotz der Hetzkampagne gegen diesen Autor, trotz seines Aus-schlusses aus dem Schriftstellerverband konnte sein Ruf als Lite-rat nicht geschmälert werden. Nun ist Pasternak postum wiederin den Schriftstellerverband aufgenommen worden. Seine Dat-scha soll endlich zu einem Museum umgestaltet werden. Derbislang verbotene Roman „Doktor Schiwago“ wird für denDruck in der Sowjetunion vorbereitet. Diese Veröffentlichungwird für den anspruchsvollen russischen Leser freilich wenigerein literarisches Erlebnis vermitteln als vielmehr die Genugtuung,nicht länger von den eigenen Quellen abgeschnitten zu sein.
Das Theater spielt zweifellos eine wichtige Rolle in der Sow-jetunion. Wer dort die kritische Aufarbeitung der eigenen Ver-gangenheit oder die Angriffe auf den unmoralischen Herr-schaftsanspruch saturierter Parteibürokraten erlebt, der weiß,dass solche Aufführungen erst von offizieller Seite ihren Segenbekommen mussten. Neue Namen in der politischen Führungstehen beispielhaft für den engagierten Versuch, den Aufbruchin der kulturellen Szene als Motivationsträger für die gesellschaft-liche und wirtschaftliche Perestrojka einzusetzen. Doch dernormale Sowjetbürger bekommt solche spektakulären Ereignisseauf der Bühne oft nur aus zweiter Hand vermittelt. Theaterkar-ten sind für die begehrtesten Stücke schwer zu erhalten, undnicht selten bleiben interessante Inszenierungen auf die Groß-stadtbühnen in Moskau beschränkt.
Die Kluft zwischen dem Zentrum der Perestrojka und derPeripherie wird oft schmerzhaft spürbar. Deswegen kommt den
161
Massenmedien eine entscheidende Übermittlungsfunktion zu. Soüberraschte der Moderator einer populären Mitternachtssendungdes sowjetischen Fernsehens seine Zuschauer mit einem offenenGespräch über Unwahrheiten in der eigenen Geschichtsschrei-bung. Sein Gesprächspartner war der streitbare Historiker JurijAfanasjew, der sich in der kritischen Betrachtung bisherigerFehler am weitesten vorwagt. Auch das Verschweigen von Tat-sachen, so lautete die Schlussfolgerung der beiden Gesprächs-partner, sei eine Form von Lüge. Dann fuhr der Moderator fort,seit fast siebzig Jahren habe man in der Sowjetunion die kir-chenmusikalische Komposition „Die Liturgie des HeiligenChrysostomos“ von Sergej Rachmaninow nicht mehr öffentlichaufgeführt. Es folgte ein Szenenwechsel, und das Fernsehenzeigte Aufnahmen von der ersten sowjetischen Schallplattenein-spielung dieser Liturgie in einer Moskauer Kirche. Die Rückbe-sinnung auf das kulturelle Erbe in der Sowjetunion spielt wohldie größte Rolle bei der Rehabilitierung der Exilliteratur wie auchder verfemten Literatur der nachrevolutionären Zeit. Ein russi-scher Durchschnittsbürger kannte bislang kaum den NamenNikolaj Gumiljow. Man hatte Gumiljow, einen der begabtestenrussischen Lyriker, geächtet, seit er 1921 als angeblicher Konter-revolutionär erschossen worden war. Jetzt feiert die sowjetischePresse seinen Namen als Symbol für die Größe der russischenDichtkunst. Auch Josef Brodskij, Nobelpreisträger für Literatur,war seit seiner Exilierung 1972 in der Sowjetunion nicht mehrgedruckt worden. Nun bereitet die angesehene Literaturzeit-schrift Nowyj Mir eine Veröffentlichung seiner wichtigsten Werkevor. Im Zuge der Perestrojka soll das kulturelle Erbe aus deminneren wie äußeren Exil in die gesellschaftliche Gegenwart zu-rückgeholt werden. Dazu dienen auch Versuche, Malern undBildhauern, die nicht offiziell anerkannt sind, Ausstellungsmög-lichkeiten einzuräumen. Doch dieser Weg ist nicht geradlinig.Einige Künstler dürfen ausreisen und im Ausland ihre Werkezeigen, doch die sowjetischen Museen bleiben ihnen vorerstnoch verschlossen. Wer sich jetzt engagiert, beruft sich gerne aufdas Gorbatschow-Zitat, es dürfe in der Geschichte und in derLiteratur weder vergessene Namen noch weiße Flecken geben.
162
Die schon erwähnte Rehabilitierung von Pasternak war nur einerster Schritt. In einem Leserbrief an die Zeitschrift Ogonjokwurde sogar gefordert, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen,die vor 25 Jahren den Schriftsteller Wassilij Grossmann verfolgtund sämtliche Exemplare seines Romans über die Stalin-Zeitbeschlagnahmt haben.
Über andere Autoren, die im Exil gestorben sind, soll nun einSammelband herausgegeben werden. Schriftsteller wie WladimirNabokow oder Jewgenij Samjatin werden damit geehrt. Samjatinhatte schon 1927 einen Roman mit dem Titel „My“ („Wir“)geschrieben, der erschreckend die Vision eines totalitären Staatesaufzeigt, wie er dann in der Stalin-Zeit verwirklicht wurde. Weni-ge Jahre später musste Samjatin nach Paris emigrieren, wo erauch starb. Kultureller Aufbruch bedeutet also auch die Neube-wertung der eigenen Vergangenheit. Ein antistalinistischer Filmwie “Pokajanije” von Tengis Abuladse, der die Methoden derDiktatur so allegorisch verfremdet zeigt, dass Jugendliche achsel-zuckend das Kino verlassen, ist eben nur dann zu verstehen,wenn die historischen Daten von der eigenen Geschichtsschrei-bung nicht unterschlagen werden. Genau darauf zielt ein Histo-rikerstreit in der Sowjetunion, der in seiner Polarisierung zweiAnsätze gegenüberstellt.
Auf der einen Seite plädieren engagierte Historiker dafür, diegesamte Geschichte der Sowjetunion unter Heranziehung bislangunveröffentlichter Quellen und Ereignisse neu zu bewerten. Aufder anderen Seite stehen jene Historiker, die mit scharfen Wor-ten das bestehende Geschichtsbild der Sowjetunion verteidigenund ihre eigene „höfische“ Geschichtsbetrachtung nicht durchso genannte Enthüllungen in den Schmutz ziehen lassen wollen.
Noch befinden sich viele Bereiche in einer Phase des vorsich-tigen Experimentierens in eine Richtung, die es erlaubt, die Ge-sellschaft nicht mehr weitgehend mit einem administrativenKulturverständnis zu betrachten. Die Kulturpolitik der Sowjet-union krankt an ihrer ideologischen Einengung. Diese Stufe sollnun überwunden werden, ohne dass damit schon klar wäre, wel-che Rolle die Ideologie in der weiteren Entwicklung der kulturel-len Perestrojka spielen wird.
163
VERBORGENE KRÄFTE DER IDENTITÄTPerestrojka in der Kultur (II)85
Die Aufbruchsstimmung in der Sowjetunion hat sich amschnellsten und am deutlichsten in den kulturellen Bereichen desLandes bemerkbar gemacht. Auf den Theaterbühnen wurdenStücke inszeniert, die lange verboten waren. Filme, die Jahrzehn-te lang in den Archiven vergeblich auf eine Aufführungsgeneh-migung warteten, kamen auf die Leinwand. Bücher in- und aus-ländischer Autoren, die auf dem Index standen, wurden ge-druckt. Maler und Bildhauer, die aus dem Künstlerverband aus-geschlossen waren, konnten ihre Werke mit staatlicher Geneh-migung auf Ausstellungen in westlichen Ländern präsentieren.Der Umschwung kam für viele überwältigend schnell und er-zeugte Hoffnungen auf eine freiere Gestaltungsmöglichkeit in-nerhalb der sowjetischen Gesellschaft. Deshalb wurde die Intelli-genz zu einem der tatkräftigsten Befürworter der neuen Politikund dadurch zu einer der wichtigsten Stützen für Gorbatschow.
Dabei nahm die kulturelle Revolution zunächst einen eherzögernden Verlauf. Unvermittelt berichtete die WochenzeitungMoskowskije Nowosti über einen der hervorragendsten Lyrikerder russischen Sprache, Nikolaj Gumiljow. Nur Fachleute wuss-ten sofort die Ungeheuerlichkeit des Vorganges einzuschätzen.Denn Gumiljow war 1921 als Konterrevolutionär erschossenworden und seine Werke wurden seit seinem Tod in der Sowjet-union nicht mehr publiziert. Für die Öffentlichkeit spektakulärerwar dagegen die Rehabilitierung von Boris Pasternak. Der ver-femte Autor des revolutionskritischen Romans Dr. Shiwagowurde postum wieder in den Schriftstellerverband aufgenom-men. Die engagierte Literaturzeitschrift Nowyj Mir druckte denRoman Anfang dieses Jahres in der Fassung der russischsprachi-
85 Die Rückkehr der verfemten Dichter und Regisseure sowie die Enttabui-sierung der Geschichte schaffte unter der russischen Intelligenzija die Iden-tität einer Rückkehr zu alten Werten. Erstveröffentlichung: Perestrojka inder Kultur. Noch ist kein Ende für weitere Entwicklungen in der Sowjet-union in Sicht. In: Academia 5, 1988, 233-234.
164
gen Exilausgaben von 1957 nach. Auch das Requiem von derLyrikerin Anna Achmatowa, eine eindringliche Mahnung an dieUnmenschlichkeiten der Stalin-Zeit, verdankt seine Publizierungder neuen Politik. Diese Liste ließe sich weiter fortsetzen mitSchriftstellern, die nach ihrem Tod erst jetzt die verdiente Aner-kennung in der sowjetischen Öffentlichkeit erhalten, obwohl dieLiteraturkenner diesen verfemten Dichtern nie ihren Respektversagt hatten. Aber auch unter den lebenden Schriftstellern hatdie Perestrojka Veränderungen bewirkt.
Der Roman Kinder des Arbat von Anatoli Rybakow, derebenfalls die Schrecken der Stalin-Zeit anprangert, ist nach jahr-zehntelangem Verbot nun publiziert worden. Exilschriftstellerwerden zur Rückkehr eingeladen und ihre Werke dem sowjeti-schen Publikum vorgestellt. Eine Aufsehen erregende Rückkehr- wenigstens auf Zeit - feierte der Theaterregisseur Jurij Ljubi-mow. Durch sein kritisches Engagement in Ungnade gefallen,wurde er 1984 ausgebürgert, konnte aber vier Jahre später miteinem israelischen Pass zurückkehren und feiert an seinem altenTheater an der Taganka großartige Erfolge. Auch die kritischeBeschreibung von der missglückten Erschaffung des neuenMenschen unter dem Titel Hundeherz von Michail Bulgakowwurde auf der Bühne in Moskau ein riesiger Erfolg. Erst mehrals vier Jahrzehnte, nachdem der Autor 1944 im Pariser Exilgestorben war, konnte dieses Stück inszeniert und auch als Er-zählung gedruckt werden.
Neben solchen bewegenden Ereignissen, die mehr eine Artkultureller Vergangenheitsbewältigung sind, dient das Theater inder Perestrojka auch dazu, die Bevölkerung gegen Parteibürokra-tie und gesellschaftliche Missstände zu sensibilisieren. Unter demTitel „Liebe Jelena Sergejewna“ von Ludmila Rasumowskajawird ein erschütterndes Bild einer verrohten Jugend gezeigt.Schüler treiben ihre Lehrerin in den Tod, weil diese aus Ehrge-fühl nicht bereit ist, den Jugendlichen der Abschlussklasse beimFälschen der Examensarbeiten zu helfen. In anderen Theater-stücken wird zum Widerstand gegen Parteifunktionäre aufgeru-fen, die ihre Positionen missbräuchlich als Erbhof zum eigenenNutzen ansehen. Doch die meisten solcher Theaterstücke wer-
165
den in der Hauptstadt Moskau aufgeführt. Die Karten dafür sindbegehrt und können nie die Nachfrage decken. In der Provinzbesteht gegenüber dieser kulturellen Perestrojka zuweilen abernoch manches Hemmnis. Deshalb wäre es falsch, die Auf-bruchsstimmung des Moskauer Theaterlebens auf alle Städte derSowjetunion zu übertragen.
Anders dagegen ist die Situation beim sowjetischen Film. AlsMassenmedium ist der Film zugleich wichtiger Kulturträger fürdie Erneuerung. Auch hier sorgten zunächst ältere Streifen, diebis zu zwanzig Jahren verboten waren, für Aufsehen. Im Westenist der Film „Der Kommissar“ von Arkadi Askoldow bekanntgeworden, der die Revolution nicht als glorreichen Feldzug,sondern als menschliche Tragödie schildert. An diesem Filmzeigt sich, wie schleppend oft der Prozess der Perestrojka verlau-fen kann. Obwohl der Streifen im Ausland als offizieller sowjeti-scher Wettbewerbsbeitrag in verschiedenen Ländern lief und mitPreisen überhäuft wurde, darf er in der Sowjetunion noch nichtöffentlich gezeigt werden. Auch andere, weitaus jüngere Filme,die eine sozialkritische Bestandsaufnahme liefern, wie „Die klei-ne Wera“, sind bislang nur einem ausgewählten Spezialpublikumzugänglich. Gerade dieser Film zeigt die ausweglose Situation ineiner sibirischen Industriestadt, in der die Erwachsenen sich demAlkohol und der Verzweiflung überlassen und die Jugend ihreIdole aus der westlichen Rockszene bezieht.
In der Tat kommt gerade dem westlichen Musikeinfluss imkulturellen Verständnis eine große Bedeutung zu. Lange Zeitwaren die sowjetischen Imitatoren solcher Musik aus den Kon-zertsälen verbannt. Schließlich gestanden die Vertreter derPerestrojka ein, dass man gegen kulturellen Einfluss keine Gren-zen errichten könne. Inzwischen ist die Rockszene in der Sow-jetunion nicht nur integriert. Deren neue Freiräume führen sogarzu einer Entwicklung, die früher vom Staat eher krampfhaftprovoziert werden sollte. Denn in den neuen Freiräumen entwi-ckelt sich eine eigenständige sowjetische Musikszene, die sichinzwischen von ihren westlichen Vorbildern wieder loslöst. Mitdieser Grunderkenntnis lässt sich die Bedeutung der Perestrojkafür die Kultur ganz generell charakterisieren: Je mehr Verbote
166
und Tabus gebrochen werden, umso mehr Zutrauen wird zu dereigenen gesellschaftlichen Fähigkeit entwickelt. Je mehr Exillite-ratur offiziell auf den sowjetischen Markt kommt, umso wenigerwerden die Interessenten in die Grauzone von Schwarzhandelmit westlichen Editionen gezwungen. Und je offener die eigenenMassenmedien über frühere Tabuthemen berichten, umso gerin-ger ist die Attraktivität ausländischer Rundfunksender.
Doch die Perestrojka in der Kultur führt über die eigenenLandesgrenzen hinaus. Maler, die man früher nicht öffentlichgezeigt hat, können nun in das Ausland fahren, dürfen ihre Bil-der präsentieren, um anschließend problemlos in die Heimatzurückzukehren. Schließlich hat als eine Werbeaktion in Sachenkultureller Perestrojka das berühmte britische AuktionshausSotheby die erste Versteigerung sowjetischer Gegenwartsmalereiin Moskau praktiziert. Noch ist kein Ende für weitere Entwick-lungen auf diesem Sektor abzusehen. Doch eine Warnung mussschon jetzt mit bedacht werden. Die für die Bevölkerung ebensowichtige wirtschaftliche Perestrojka kann mit den stürmischenEreignissen auf dem kulturellen Sektor nicht mithalten. Hier giltes für die kommenden Jahre, dass die Kluft zwischen Absichts-erklärung und Verwirklichung nicht zu groß wird. Denn darunterwürden die gesamte Politik des Umbaus und damit auch die neueFreiheit in der Kultur erheblich leiden.
167
GLASNOST AUF DEM BILDSCHIRMPerestrojka im Fernsehen86
Glasnost auf dem Bildschirm hat das Fernsehverhalten derSowjetbürger entscheidend beeinflusst. Wer noch vor wenigenJahren gegen neun Uhr abends in Moskau seine Freunde besuch-te, konnte sich zu einem ungestörten Schwätzchen niederlassen.Die Tatsache, dass auf drei Kanälen gleichzeitig die routiniertenund oft nichts sagende Texte der aktuellen Nachrichtensendung„Wremja“ („Die Zeit“) liefen, konnte niemanden beeindrucken.Dieses Bild hat sich geändert.
Jetzt schalten die Sowjetbürger den Fernseher nicht mehr inder Erwartung an, dass sie hören und sehen werden, was siebereits zu wissen glauben, sondern Fernsehen hat einen Überra-schungseffekt, der gleichzeitig auch eine politisierende Wirkungzeigt. Die Anteilnahme an den Auftritten von Parteichef Gor-batschow ist enorm. Seine Wirkung hängt mit zweierlei zusam-men: erstens redet er - artikulatorisch und grammatisch - nicht inder unverständlichen Sprache eines Parteichinesisch. Zweitensneigt er zu spontanen Gesprächen mit der Bevölkerung, beidenen die wirkliche Stimmung im Land wiedergegeben wird.
Bei einem heftigen Wortwechsel mit der Bevölkerung vonKrasnojarsk in Sibirien musste sich Gorbatschow Vorwürfe überdie schlechte Versorgungslage anhören mit der Nachfrage:„Werden Sie das auch im Fernsehen zeigen oder herausschnei-den?“ Die Kritik der Bevölkerung wurde gesendet, samt dieserbesorgten Nachfrage. Abgeschafft wurde unter Gorbatschowdagegen das alte Ritual, in den Nachrichtensendungen regelmä-ßig die gesamten Texte im Wortlaut verlesen zu lassen, die unterdem Namen des Parteichefs verbreitet werden. Der neue Stil
86 Die sichtbarsten Erfolge erzielte die Reformpolitik auf dem Buchmarkt,der Theaterbühne und in den Medien. Das Fernsehen trug mit seinen Di-rektübertragungen politischer Diskussionen und den Erörterungen zureignen Geschichte als Massenmedium maßgeblich zur Enttabuisierung bei.Erstveröffentlichung: Glasnost auf dem Bildschirm. Perestrojka im Sow-jet-TV. In: Weiterbildung und Medien 6, 1988, 6-9.
168
beschränkt sich darauf, nachrichtlich zu erfassen, dass beispiels-weise Gorbatschow ein Schreiben an diese oder jene Organisati-on gerichtet hat oder mit einer Rede aufgetreten ist. Dann folgtder Hinweis: „Der gesamte Wortlaut wird in der Presse veröf-fentlicht“. Zwar ist „Wremja“ auch heute noch nicht ganz freivon dem Verlautbarungsjournalismus, der über die Null-Nachricht von Abflug, Ankunft und Begrüßung politischer Be-sucher ausführliches Filmmaterial verbreitet.
Doch gleichzeitig bietet die Sendung Bilder von politischenDemonstrationen, Eisenbahnunglücken oder Erdbeben, die imeigenen Land stattfinden. Früher hatte es den Anschein, als seienalle Katastrophen dieser Welt nur einseitig auf die kapitalisti-schen Länder verteilt. So eigenartig es klingt: Auch durch dieSchreckensmeldungen über das eigene Land hat das Fernsehenan Glaubwürdigkeit gewonnen. In der Redaktion von „Wremja“bemüht man sich um kritische Distanz gegenüber den oft betuli-chen Korrespondentenberichten aus der Provinz. Doch überlan-ge Sequenzen von Mähdreschern und schwebenden Fertigbautei-len sowie vor gestanzte Antworten lokaler Parteigrößen zeigen,dass der Wandel in der Berichterstattung noch nicht landesweitverwirklicht ist.
Im Inland arbeiten für die Nachrichtenredaktion 150 Korres-pondenten; dazu kommen 22 Auslandsbüros. Gerade die Be-richterstattung aus kapitalistischen Ländern hat sich dabei amdeutlichsten verändert. Nach einer heftigen Kritik in der Partei-zeitung Prawda an der klischeehaften Sichtweise mancher Kor-respondenten begann das sowjetische Fernsehen verstärkt, übervermeintlich positive Seiten im Kapitalismus zu berichten. Meisthandelt es sich dabei um Filme, die den höheren Konsumstan-dard oder den Dienstleistungsbereich als vorbildlich darstellen.Ein besonderer Glücksgriff ist dem sowjetischen Fernsehen mitseinem Korrespondenten in der Bundesrepublik, Wladimir Kon-dratjew, gelungen, der es versteht, in sachlicher Distanz eineobjektive Darstellung vom Leben in seinem Gastland zu geben,ohne in Klischees zu verfallen. Damit weckt er positive Neugier-de bei den Sowjetbürgern, die ohnehin großes Interesse an derBundesrepublik haben. Für einen Betrachter von außen ist es
169
zuweilen allerdings schon merkwürdig, wenn man auf dem sow-jetischen Bildschirm mit dem Lobgesang auf westliche Schnell-imbissketten, funktionierende Postdienste oder den hervorra-genden Reparaturservice für Autos konfrontiert wird. Eine wich-tige Sendung, die sich auch bemüht, das Leben im Ausland poli-tisch einzuordnen, ist „Meshdunarodnaja Panorama“ („Interna-tionales Panorama“), ähnlich dem Weltspiegel der ARD oderdem Auslandsjournal des ZDF. Hier macht sich die neue Sichtauf die kapitalistischen Länder besonders wohltuend bemerkbar.
Aufregender jedoch sind für Sowjetbürger solche Sendun-gen, die in der Zeit der Perestrojka völlig neu gegründet wurden.Etwa einmal monatlich wird „Do i posle polunotschi“ („Vor undnach Mitternacht“) ausgestrahlt, ein Fernsehmagazin, das ausgebauten Beiträgen, Live-Schaltungen und Interviews besteht.Die Sendung beginnt kurz vor Mitternacht und dauert etwa zweiStunden. Das ist bereits die erste Ungewöhnlichkeit. Denn frü-her endete das sowjetische Fernsehprogramm nach den Spät-nachrichten meist gegen 23 Uhr. Die zweite Ungewöhnlichkeitist die Brisanz der Themen, die in dieser Sendung behandeltwerden. Das Hauptverdienst liegt bei Moderator Wladimir Molt-schanow, der als einer der unbestechlichsten Interviewer seinenGesprächspartnern keine Ausflüchte durchgehen lässt.
Einen hochrangigen Vertreter der sowjetischen Zensurbe-hörde lässt er berichten, warum jetzt verbotene Bücher freigege-ben werden. Doch gleichzeitig zwingt er denselben Mann zueiner Stellungnahme, wie er seine jahrelange Arbeit, nämlich dasVerbot von Büchern zu prüfen und zu befürworten, mit seinemGewissen vereinbaren konnte. In dieser Sendung kommen His-toriker zu Wort, die sich im Gegensatz zu vielen Kollegen füreine radikale Vergangenheitsbewältigung aussprechen und sichauch nicht scheuen, die Millionen Todesopfer der Stalinzeit zunennen, über die immer noch von vielen so schamhaft geschwie-gen wird. Dem Moderator Moltschanow kommt auch das Ver-dienst zu, AIDS sachlich thematisiert zu haben. Einen Arzt ließer über die erste Initiative für Reihenuntersuchungen in Moskauberichten, und dies zu einem Zeitpunkt, als man in der Sowjet-union die Krankheit noch tabuisierte und eine mögliche Gefähr-
170
dung durch AIDS leugnete.Eine weitere Nachtsendung namens „Wsgljad“ („Der Blick“)
hat viele ähnliche Elemente, richtet sich aber vornehmlich an diejunge Generation. Per Telefon kann sich der Zuschauer an dieModeratoren oder Studiogäste wenden. Brisante Themen sinddie Regel, von sozialer Ungerechtigkeit bis zum Umweltschutz.Als unterhaltende Einlage dienen Videoclips - häufig von westli-chen Rockgruppen; Reportagen über Alltagskriminalität werdenergänzt durch eigene Recherchen im Bereich der landesweitenKorruption. Eine eher zweifelhafte Premiere war ein Filmberichtmit drastischem Fotomaterial von der Ermordung einer Mitar-beiterin der Staatsanwaltschaft, die in Zentralasien im Auftrageines herrschenden Familienclans umgebracht worden war.
Obwohl „Wsgljad“ alle zwei Wochen zwischen 23 Uhr undEin Uhr nachts ausgestrahlt wird, muss die Zuschauerbeteiligungenorm hoch sein. Denn „Wsgljad“ ist regelmäßig Gesprächs-thema des nächsten Tages. Als Experiment ist eine weitereNachtsendung unter dem Titel „Montash“ („Montage“) gestartetworden, ebenfalls ein Fernsehmagazin eher für die junge Genera-tion, das mit Satire und Rock die eigene Gesellschaft glossiert.
Die neuen Nachtprogramme werden durch ein zusätzlichesFrühprogramm unter dem Titel „120 Minuten“ ergänzt, das ab6.30 Uhr früh als Fernsehmagazin aktuelle Reportagen, Nach-richten und eine Aerobic-Show anbietet. Damit bleibt besondersam Wochenende nur noch eine Programmpause von knapp fünfStunden übrig - gegenüber etwa zehn Stunden vor der Perest-rojka. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Unzulänglichkeiteninnerhalb der Sowjetunion betreibt die Sendung „Problemy,Poiski, Reschenija“ („Probleme, Nachforschungen, Lösungen“)mit dem Moderator Wosnessenski, der sich bei Vortragsreisenim Westen auch schon als Mr. Glasnost vorstellen ließ.
Die Sendung ist stets einem bestimmten Thema gewidmet,das in der Zeit der Perestrojka eine besondere Rolle spielt. Dasist zum Beispiel die Reform des politischen Systems oder dieneue Rolle der Soziologie, die nun mit dem bislang ungewohntenKonzept von wissenschaftlich betreuten Meinungsumfragenarbeiten soll. Fachleute aus der Regierung, Wissenschaftler und
171
Betroffene diskutieren live am runden Tisch, während die Zu-schauer über mehrere Telefonleitungen ebenfalls live ihre Fragenstellen können. Mit dieser bewusst gewählten Zuschauerbeteili-gung ist ein Prozess in Gang gesetzt, der den Sowjetbürgern,auch wenn sie selbst nicht zum Telefon greifen, das Gefühl ver-mittelt, man kann den Verlauf in den Medien mitgestalten. Derfrüheren Ohnmacht, jeden Schwachsinn ohne Einspruchsmög-lichkeit über sich ergehen lassen zu müssen, steht nun das Mo-dell von Zuschauerbeteiligung gegenüber.
Neben der zahlreichen Hörer- und Zuschauerpost hatte dassowjetische Fernsehen auch über die wöchentliche Programm-zeitung „Goworit i Pokasywajet Moskwa“ („Moskau spricht undzeigt“) versuchsweise Meinungsforschung betrieben. Es gingdabei um die Bewertung eines ungewöhnlichen Experimentes. Inder Silvesternacht vor zwei Jahren nämlich hatte das staatlicheFernsehen auf zwei Fernsehkanälen musikalische Unterhaltungangeboten, wahlweise Klassik oder Rock und Pop. Dabei wurdeerstmals der Versuch unternommen, etwa die Hälfte der Sen-dungen mit westlichen Interpreten zu gestalten.
Im Bereich der klassischen Musik wurde das von den Zu-schauern noch akzeptiert. Im Bereich der leichten Musik dagegenlehnte die Mehrheit der sowjetischen Zuschauer diesen Proporzab. Man fühlte sich plötzlich von einer „Westlerwelle“ überrolltund forderte mehr einheimische Folklore. Im Jahr danach wurdeauf diesen Proporz verzichtet und wieder überwiegend einheimi-sche Musik in das Silvesterprogramm aufgenommen. DieserVorgang zeigt, dass Publikumsreaktionen - und zwar nicht nurdie positiven - im Fernsehprogramm aufgefangen werden müs-sen. Leonid Krawtschenko, Erster stellvertretender Rundfunk-und Fernsehchef der Sowjetunion, bekam gerade zu Beginn derTV-Perestrojka den Unmut nicht nur von Seiten des Publikums,sondern auch von Seiten der Behörden und Ministerien zu spü-ren.
Eine kritische Jugendsendung, „Dwenadzatjy etash“ („Diezwölfte Etage“), war mehrfach Anlass für direkte Interventionen,die der engagierte Fernsehmann abzuwehren wusste. In dieserSendung führen Jugendliche in der 12. Etage des Funkhauses
172
Ostankino in Moskau einen freimütigen Dialog über Drogen undAussteigertum, über den sinnlosen Tod gleichaltriger Freunde inAfghanistan oder über das ungeliebte Engagement bei den Kom-somolzen. Auch hier spielt das Live-Element eine große Rolle,so dass Regisseur und Aufnahmeleiter schon oft ihre liebe Mühehatten, den ungestümen Verlauf der Diskussion einigermaßensicher im Bild festzuhalten. Diese Sendung konnte sich stets desProtestes der älteren Generation sicher sein. LeonidKrawtschenko, der als Perestrojka-Mann aus der Chefredaktionder Gewerkschaftszeitung Trud zum staatlichen Komitee fürRundfunk und Fernsehen überwechselte, war dafür mitverant-wortlich, dass vor drei Jahren innerhalb weniger Monate einViertel des Programms völlig umgekrempelt wurde.
Zwei Drittel des Programms wurden zusätzlich mit neuenElementen belebt. Die Technik der Computergraphik, eingekauftbei den Japanern, gibt jetzt dem vormals eher betulichen Bild-schirmlayout einen modernen Anstrich. Die inhaltliche Proble-matik neuer Sendungen wurde gezielt auf Zuschauerbedürfnisseabgestimmt, die sich aus dem alltäglichen Leben der Sowjetunionergeben, aber bislang mehrheitlich von den Massenmedien un-terschlagen worden waren. Das Ziel dieser Reform hieß, diesowjetische Gesellschaft so darzustellen, wie sie wirklich ist undnicht, wie sie einem Idealtyp entspricht. In einer Zwischenbilanzantwortete Leonid Krawtschenko nach den ersten erfolgreichenUmbauten auf die Frage, was denn nach Ansicht der Fernseh-macher die Leute am meisten bewegt:
„Wir haben jetzt eine Skala von Prioritäten. Auf dem erstenPlatz steht das Wohnungsproblem. An zweiter Stelle folgenFragen von Arbeitsorganisation mit dem Lohn- und Prämiensys-tem. Dann folgt - was einem Außenstehenden etwas merkwürdigvorkommen mag - die Rentenfrage und schließlich die medizini-sche Versorgung und die Lage des Gesundheitswesens sowie dieFragen des öffentlichen Verkehrs in den Städten“. Damit sindgleichzeitig die sozial brisantesten Probleme genannt, die für einewirksame Zuschauerbindung an die einschlägigen Programmesorgen. Nachdem die Sowjetbürger einen Reflex ihrer eigenenProbleme im Fernsehen und auch im Radio wiedererkannten,
173
schwoll die Flut der Hörer- und Zuschauerpost enorm an - auffast eine halbe Million im vergangenen Jahr. In einer regelmäßi-gen Sendung geht das Fernsehen jetzt vielen Einzelproblemennach.
Unmittelbar im Anschluss an die abendliche Nachrichten-sendung „Wremja“ folgt zehn Minuten lang die Sendung „Pros-hektor Perestrojki“ („Brennpunkt der Perestrojka“), die sich mitjeweils einem Missstand beschäftigt: Käuferschlangen vor einemGeschäft werden über unnötige Versorgungsmängel interviewt,die zuständige Handelsorganisation um Stellungnahme gebeten.Oder es geht um das Problem, dass es kaum Bücher zu kaufengibt: die Kamera entdeckt tausende von verschimmelten Exemp-laren in einem feuchten Keller, während die Menschen in denBuchhandlungen seit Monaten vergeblich auf den Verkauf dieserersehnten Literatur warten. Auch Missstände im Umweltschutz,schon früh Gegenstand sehr kritischer Betrachtung, werdenimmer wieder angemahnt. Doch der Kontakt zum Zuschauerbleibt nicht auf die innergesellschaftliche Sicht beschränkt. Neueingeführt wurde die Teilnahme von ausländischen Politikern,Wissenschaftlern, Korrespondenten oder Managern - meist auskapitalistischen Ländern - an Fernsehdiskussionen.
Mit so genannten Telebrücken beteiligt das Fernsehen dieSowjetbürger auch direkt am Geschehen im Ausland. Diese sehrpopulären Sendungen bauen auf dem einfachen Prinzip auf, dassMenschen verschiedener Länder in ihrer üblichen Umgebungund in ihrer jeweiligen Muttersprache mit Sowjetbürgern disku-tieren können.
Damit wird ein größtmögliches Maß an Selbstvertrauen inder Diskussion erreicht. Japaner in Tokio mit einem japanischenModerator sehen auf einem großen Bildschirm ihre sowjetischenGesprächspartner und kommunizieren mit Hilfe eines Simultan-dolmetschers. Auch Amerikaner, Westdeutsche und Briten ha-ben an solchen Telebrücken teilgenommen. Ergänzt werdendiese Sendungen durch Filmeinspielungen, in denen das jeweiligeGastland aus der Sicht eines sowjetischen und eines einheimi-schen Journalisten vorgestellt wird. Tabuthemen gibt es nicht.Die Konfrontation mit Vorurteilen ist erwünscht, um innerhalb
174
der Sendung dagegen argumentieren zu könne. Auf diese Weiseerleben Millionen von Sowjetbürgern, dass Perestrojka auf demBildschirm auch eine Öffnung gegenüber dem Ausland bedeutet.
175
RÜCKKEHR DER GESCHICHTE
“DER FASCHIST FLOG VORÜBER”Der 40. Jahrestag vom Ende des Großen
Vaterländischen Krieges87
Im alten Moskauer Zirkus verkünden schallende Fanfaren-stöße den Beginn der Vorstellung. Erwartungsvolles Raunengeht durch das Publikum, zur Hälfte Kinder im Grundschulalterund noch jünger. Doch statt des gewohnten Aufmarsches vonArtisten und Akrobaten, von Clowns und Muskelmännerndröhnt eine Lautsprecherstimme durch den Raum:
„Dem 40. Jahrestag des großen Sieges, dem sowjetischenVolk, das seine Freiheit und Unabhängigkeit behauptet hat,widmen wir diese Vorstellung. Es lebe der Frieden, der im Gro-ßen Vaterländischen Krieg erkämpft wurde!“ Währenddessenflattern rote Fahnen unter der Zirkuskuppel. Es folgt ein Film,der als Drei-Minuten-Spot eine schnell wechselnde Bildfolgezeigt: den Rauchpilz einer Atomexplosion, weinende Kinder,Straßendemonstrationen in Westeuropa, klagende Palästinense-rinnen, Raketen, Kampfflugzeuge, Moskauer Friedensmarschie-rer, eine Unterwasserexplosion, die weiße Friedenstaube auf derWeltkugel, schließlich strahlende Augen in einem lachendenMädchengesicht.
Ob eine Theateraufführung in Kiew oder eine Ausstellungvon Laienkünstlern in Nowosibirsk, ob ein Jugendsportfest inAlma Ata oder ein Filmfestival in Moskau - alles ist der Erinne-rung an jenen Tag gewidmet, der - nach der Oktoberrevolution -
87 Der Krieg gegen den deutschen Faschismus spielt bis heute – auch nachdem Zusammenbruch der Sowjetunion - eine Sonderrolle im Geschichts-bild und dem Selbstverständnis des Landes. Kein anderes historischesEreignis wird so ausführlich in der Öffentlichkeit gefeiert wie das Ende desZweiten Weltkrieges. Erstveröffentlichung: “Der Faschist flog vorüber”. WieRussland den 40. Jahrestag vom Ende des Großen Vaterländischen Krieg feierte. In:DIE ZEIT, Nr. 16, 12. April 1985.
176
als zweitwichtigstes Ereignis in der Geschichtsschreibung derSowjetmacht gilt. Wer jedoch unter dem Datum 8. Mai auf demKalenderblatt sucht, findet dort nur die Abbildung einer Kolcho-se und im Kleindruck den Hinweis, dass vor vierzig Jahren dasdeutsche Volk und die Tschechoslowakei vom Faschismus be-freit wurden, mehr nicht.
Erst einen Tag später, am 9. Mai, feiert die Sowjetunion denSieg. In revolutionärem Rot strahlt die ordensgeschmückte Brusteines Sowjetarmisten vom Abreißkalender. Hinter ihm leuchtetdas Freudenfeuerwerk. Davor brennt die ewige Flamme amGrabmal des Unbekannten Soldaten. Die heldenhafte Pose desSieges wird millionenfach kopiert. Die historische Kriegsbericht-erstattung der Regierungszeitung Iswestija ist markiert von demBildnis jenes Sowjetsoldaten, der die Rote Fahne auf dem Berli-ner Reichstag hisste. Dazu die Serienüberschrift: „Wie wir zumSieg schritten.” In der deutschsprachigen Tageszeitung Freund-schaft berichtet der Sowjetsoldat Adolf Streicher über seineKampferlebnisse, und das Moskauer Abendblatt nutzt das Port-rät eines das Gewehr schwenkenden Soldaten als Erkennungs-zeichen für die Wettbewerbsserie „40 Jahre großer Sieg - 40aktive Arbeitswochen“. Gefordert werden Bestleistungen zumGedenken an den Sieg.
Schon fast ein Jahr vor dem wichtigen Datum hatte das Zent-ralkomitee der Partei den Startschuss gegeben. Rundfunk, Fern-sehen, Film, Plakat- und Buchverlage, Kultur- und Sportministe-rien, Veteranenverbände und Jugendorganisationen bekamenihre Aufgaben zugewiesen. Auf diese Weise ist auch eine deut-sche Kopie des zweiteiligen Filmes „Pobjeda“ („Der Sieg“) her-gestellt worden, der in 1.300 sowjetischen Kinos Premiere feier-te. Fast drei Stunden müssen die Zuschauer dieses Spektakel ausDokumentar- und Spielszenen aushalten. Der Film, nach einemRoman von Alexander Tschakowskij, soll beweisen, dass schonauf der Potsdamer Konferenz die Westmächte mit der Verfäl-schung der Geschichte und mit einer Politik der Stärke begon-nen haben, die zum Kalten Krieg führte. In einer Rahmenhand-lung treten ein sowjetischer und ein amerikanischer Reporter auf,die sich bei Kriegsende in Deutschland kennen lernen und auf
177
der Helsinki-Konferenz 1975 wieder treffen. Die Entwicklungzwischen den beiden Ereignissen hat dem sowjetischen Kolle-gen, der stets mit Schlips und Kragen und mit akkurat gebürste-tem Haar auftritt, Recht gegeben. Er und sein System sind demAmerikaner überlegen, der als Gegenstück natürlich einen schiefsitzenden Jeansanzug trägt, ungekämmte Haare hat und in derSchlussszene mit flehentlich weinendem Blick seinen morali-schen Tiefstand beklagt: Arbeitslosigkeit und soziale Verzweif-lung haben ihn zu einem Handlanger der Kalten Krieger ge-macht. Interessanter als solche Klischees sind die historischenBezüge in eigener Sache. Stalin spielt nämlich eine Hauptrolle indieser Feierpropaganda.
Der Diktator tritt als listiger Verhandlungspartner auf, derdem „schlangenhaften Widerling“ Churchill und dem „machtbe-sessenen“ Truman in Potsdam mit Humor und Härte begegnetund dabei als Hauptziel das Wohlergehen vor allem Polens imAuge hat. Die Darstellung des britischen Premiers und des ame-rikanischen Präsidenten bewegt sich dagegen in verdächtigerNähe zur Verunglimpfung. Das Erstaunliche an diesem Film: dieDeutschen existieren nur als gute Nachkriegskommunisten oderals Opfer amerikanischer Besatzer, die zwei Besucher im erober-ten Berlin durch ihre Militärpolizei aus einem Restaurant werfenlassen. Kommentar des sowjetischen Kriegsjournalisten: „Wäh-rend ihr so mit den Deutschen umgeht, hat Marschall Shukowbereits antifaschistische Parteien und Gewerkschaften in derSowjetzone zugelassen.“
Bewegung kam in das ausgewählte Publikum bei einer Pro-bevorführung, als neben Stalin noch sein damaliger Außenminis-ters Molotow und der junge Berater und heutige AußenministerGromyko auftauchten. Jewgenij Matwjejew, der Regisseur desFilms, hatte vorher an sämtliche Theater Briefe mit historischenFotos der Betroffenen verschickt, um geeignete Schauspieler fürseine Rollen zu finden. Für Gromyko konnte er einen verblüf-fend ähnlichen Doppelgänger präsentieren, der auch noch Be-merkenswertes zu sagen hat. Im Vorspann und gegen Ende desFilms bekam auch Altbundeskanzler Schmidt eine kleine Rollezugewiesen. Originalaufnahmen zeigen ihn bei der Helsinki-
178
Konferenz zusammen mit dem SED-Chef Honecker. Kriegs-schuldfrage, Naziverbrechen oder gar Revanchismusvorwürfegegen die Bundesrepublik sind ausgespart.
Selbst die große Kunstausstellung zum Siegestag in Moskauszentraler Ausstellungshalle, der Manege, unweit vom Roten Platzverzichtet auf martialische Kriegsszenen. Der Oberbefehlshaber,wie Stalin heute meist in der Öffentlichkeit genannt wird, bekamnur einen bescheidenen Seitenplatz: eine beinahe unauffälligeGipsbüste, die nur einen vereinsamten Stern auf der Brust trägt,der Stalin als Held der Sowjetunion kennzeichnet. Schulkinder,die mit ihrer Lehrerin gekommen sind, toben durch den Saal. Siesind von einer Nebensächlichkeit fasziniert: einem Automodell,das von Revolutionären besetzt ist.
Das ergreifendste Bild kennen sie längst aus ihrem Schul-buch: Ein kleiner Junge, von einer Bombe getötet, liest mit bluti-gem Kopf im Gras. Daneben bellt sein erschreckter Hund. Frü-her hieß dieses Plastow-Gemälde „Der Deutsche flog vorüber“.Es ist inzwischen umbenannt. Jetzt steht auf dem Bilderrahmen:„Der Faschist flog vorüber“.
Es hängen dort aber noch andere aktuelle Bilder. Unvermutetsieht man afghanische Mudschaheddin, die ihre Waffen vor demsowjetischen Besatzer niederlegen. Porträts würdigen die Afgha-nistan-Kämpfer der Sowjetarmee. Ein Buch mit historischenKriegsplakaten, das gerade in den Buchläden zum Verkauf aus-gelegt wurde, findet ebenfalls Anschluss an die Gegenwart. NachAufrufen zur Verteidigung der Heimat und Karikaturen vonHitler und der Deutschen Wehrmacht schließt eine ausgemergel-te Figur mit Texaner Hut den Bildband ab. In den Händen hältder Mann eine Atombombe, mit der er die Weltkugel bedroht.Ein Dokument mit der Aufschrift Entspannungspolitik ist in derMitte zerrissen. Doch der zornentbrannte Globus schleudertdem Bedroher in Form eines Blitzes das Wort „Frieden“ entge-gen. Mit ihrer Propaganda zum Siegestag will die Sowjetunionden Zusammenhang zu einem anderen Ereignis herstellen: ImSommer findet in Moskau das zwölfte Weltjugendfestival statt,das für Schüler und Studenten attraktiver ist als Kriegserzählun-gen alter Veteranen. In Kindergärten und Schulen werden zwar
179
in diesen Tagen auch Leistungs- und Liederwettbewerbe abge-halten; für den 9. Mai ist sogar eine besondere Unterrichtsstundedem heldenhaften Gedenken gewidmet. Doch wirkliche Betrof-fenheit lässt sich unter der Jugend kaum ausmachen.
Die Kriegsereignisse liegen auch für die jungen Menschen inder Sowjetunion zu weit zurück. Eher noch sind die Souve-nirsammler von der neuen Abzeichenkollektion fasziniert, diezum 40. Jahrestag aufgelegt wurde. Diese „snatschki“ sind eineBesonderheit in der Sowjetunion. Sie werden ebenso gerne ge-sammelt und getragen wie richtige Orden. Für umgerechnet etwafünfzehn Mark halten die Kaufhäuser eine neue Serie bereit, dieden Ruhm aller Waffengattungen, des sowjetischen Siegervolkes,der Eisenbahner und der KGB Grenztruppen verherrlichen.Andere „snatschki“ zeigen phantasievolle Gebilde, wehendeFahnen, Spruchbänder, Sowjetsterne und Kriegsdenkmäler imKleinformat mit den denkwürdigen Jahreszahlen „1945-1985“.Neuerungen auf dem beliebten Postkartenmarkt halten sichdagegen in Grenzen.
Wer will, kann auf die alljährlichen Bildkarten zum 9. Mai zu-rückgreifen. Zur Ergänzung ist gerade ein Klappgemälde imKleinformat erschienen. In kantigen Zügen ist darauf das kämp-fende und arbeitende Sowjetvolk abgebildet, dem ein Soldatvoranschreitet, Auflage: 1,3 Millionen. Schließlich wird noch einsingender Kartengruß vertrieben. In dem Kuvert liegt eine pa-pierdünne Schallplatte mit dem populärsten Siegeslied des Text-dichters Tuchmanow und des Komponisten Charitonow.
Für die Veteranen und kriegsgeschädigten Familien zählenjedoch vierzig Jahre nach dem Sieg neben ideeller Anerkennungauch handfeste Privilegien. Erstmals in der Nachkriegsgeschichtewerden ehemaligen Soldaten nicht nur Gedächtnismedaillen,sondern Kriegsorden verliehen. Je nach militärischem Rang stei-gen nun wieder die Renten, Höchstzahlung monatlich umge-rechnet etwa 550 Mark88. Das ist für die Sowjetunion ein gerade-zu fürstliches Ruhegeld. Das Recht auf mehr Wohnraum, verbil-ligte oder gar kostenfreie Medikamente führte in den Leser-
88 Das wären heute ca. 280 Euro
180
briefspalten bereits zu besorgten Anfragen, wer denn nun wirk-lich noch zu den Kriegsteilnehmern zähle und also in den Ge-nuss dieser Privilegien komme. Die Regierungszeitung Iswestijakonnte aufgebrachte Leser beruhigen: Selbst wer nur einen Tagals Soldat an der Front im Einsatz war, darf sich als Veteranbezeichnen.
181
STALINISMUS UND FASCHISMUSEin allegorischer Film zieht einen gewagten Vergleich89
Immer wieder drehen sowjetische Regisseure Filme, die dannnur einem Kreis von Eingeweihten zugänglich gemacht werden.Der neueste Fall ist “Pokajanije” (Die Buße), ein künstlerischungewöhnliches und politisch brisantes Werk des mit vieleninternationalen Preisen ausgezeichneten Regisseurs Tengis Abu-ladse. “Pokajanije” konnte bislang nicht öffentlich in der Sowjet-union gezeigt werden, weil der Film sich auf sehr unkonventio-nelle Weise mit dem Stalinismus auseinandersetzt und stalinisti-sche Verbrechen mit den Schrecken des Faschismus gleichsetzt.Damit verletzt der Film ein jahrzehntelang gepflegtes Tabu: Einverdientes Parteimitglied in der sowjetischen KaukasusrepublikGeorgien stirbt im Alter von 78 Jahren.
Die Zeitung veröffentlicht den üblichen, formelhaften Nach-ruf auf den vorbildlichen Sohn des Volkes. Eine Frau mittlerenAlters entdeckt das Foto des Toten im Parteiblatt und scheintsich nur beiläufig für sein Ableben zu interessieren. Doch nachder Beerdigung wird der Leichnam von Unbekannten wiederausgegraben und im Garten der Hinterbliebenen aufgestellt.Hundegebell verrät den makabren Fund. Trotz Sicherheitsmaß-nahmen auf dem Friedhof wiederholt sich das erschreckendeSchauspiel noch zweimal. Daraufhin halten bewaffnete Freundeund Verwandte des Toten Wache an seinem Grab und entlarvenden Täter. Es ist jene Frau, die zufällig die Todesnachricht in derZeitung gelesen hatte. Im Getümmel ihrer Festnahme wird sieauf dem nächtlichen Friedhof vom empörten Enkel des Verstor-
89 In der Sowjetunion wurde jede Gleichsetzung zwischen Stalinismus undFaschismus vermieden. Der Film des georgischen Regisseurs Tengis Abula-dse, der sich an dieses Tabu wagte, lag jahrelang unter Verschluss in denFilmarchiven, bis er im Rahmen der Perestrojka zunächst gezielt einigenwestlichen Journalisten vorgeführt wurde, bevor er dann in den sowjeti-schen Kinos gezeigt werden konnte. Erstveröffentlichung: Die Buße einesToten. Erstmals zieht ein sowjetischer Film Parallelen zwischen Stalinismusund Faschismus. In: DIE ZEIT, Nr. 43, 17. Oktober 1986.
182
benen angeschossen. Vor Gericht gestellt, erzählt sie ihre Le-bensgeschichte, um damit die Tat zu begründen: Der Verstorbe-ne, so stellt sich in einer filmischen Rückblende heraus, hat alsBürgermeister des georgischen Städtchens Einwohner mit men-schenverachtendem Zynismus verfolgen und in Lagern ver-schwinden lassen. Zu seinen Opfern gehörten auch die Elternder Angeklagten, deren Vater sich, nach Auffassung der damalsHerrschenden, als Maler des „Individualismus“ schuldig gemachthat.
Der georgische Regisseur Tengis Abuladse, 62 Jahre alt, ziehtzwei bedrückende Parallelen in seinem Film: Erstens erinnertsein negativer Held mit kurz geschorenem Haar und Zwicker aufder Nase an den Geheimdienstchef der Stalin-Zeit, LawrentijBerija, der seine politische Karriere mit der Unterdrückung derKaukasus-Völker begann und stellvertretend für den GeorgierStalin dessen grausame Herrschaft repräsentiert. Zweitens ist derSchreibtischtäter im Dienst der Partei mit den Attributen damali-ger faschistischer Führer ausgestattet: schwarzes Hemd, schwar-ze Hose, Stiefel und Lederhalfter in Anspielung auf Mussolini,im Gesicht ein sauber rasiertes Hitlerbärtchen. Der blutrünstigeParteigenosse weiß sich gegenüber seinen späteren Opfern alsBiedermann zu geben, singt italienische Arien und rezitiertShakespeare. Auf dem Höhepunkt seiner Macht preist im Vor-zimmer seine Sekretärin die neue Zeit mit der deutsch gesunge-nen Ode „Freude schöner Götterfunken“.
Tengis Abuladse verzichtet auf realistische Schreckensdarstel-lungen der stalinistischen Arbeitslager. Stattdessen zeigt er ver-zweifelte Frauen, die zwischen frisch geschlagenen Baumstäm-men umherirren, um auf den Schnittseiten nach eingeritztenLebenszeichen ihrer verschwundenen Männer aus den Arbeitsla-gern zu suchen. Mit bedrückender Deutlichkeit lässt der Regis-seur als Zeichen der Hoffnungslosigkeit die Baumstämme voneiner Sägemaschine zu Kleinholz verarbeiten. Die Angeklagteerlebt als kleines Mädchen Schrecken und Unterdrückung jenerZeit bewusst mit. Schließlich wird sie nach der Verhaftung ihresVaters auch noch gewaltsam von ihrer Mutter getrennt und spä-ter bekennt sie den Richtern: „In diesem Moment habe ich auf-
183
gehört, ich selbst zu sein.“ Eine Metapher für die Entmenschli-chung im Stalinismus. Nach dieser historischen Rückblendefordert die Angeklagte im Gerichtssaal im Namen aller unschul-dig Verurteilten, dass der verstorbene Parteigänger wieder ausge-graben werde soll. Im allegorischen Bezug zur Entfernung Sta-lins aus dem Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau gibt derRegisseur zu verstehen, dass auch heute noch viele seiner Hand-langer zumindest postum vor der Geschichte zur Rechenschaftgezogen werden sollten.
Doch Abuladse lässt es dabei nicht bewenden. Sein Filmführt weiter in die Gegenwart. Zwischen dem Sohn und demEnkel des stalinistischen Schächers entsteht ein Generationskon-flikt, denn erst im Gerichtssaal, wo die Leichenschändung ver-handelt wird, erfährt der Enkel von den Verbrechen seinesGroßvaters - symbolisch für die immer noch große Unwissenheitder sowjetischen Jugend in Sachen Stalinismus. Als der Enkelmit moralischen Vorwürfen gegenüber seinen Eltern nicht spart,hält ihm sein Vater in hilfloser Verteidigung entgegen: „Opa hatniemals jemanden mit eigener Hand umgebracht, aber du hastschon einmal einen Menschen mit deinem Gewehr angeschos-sen. Von welcher Moral sprichst du eigentlich?“ In einer An-wandlung von moralischem Rigorismus und Enttäuschungbegeht der Enkelsohn Selbstmord. Der verzweifelte Vater gräbtdaraufhin den verstorbenen Großvater eigenhändig wieder ausund stürzt ihn in eine Schlucht. Doch die bedrückendste Schluss-folgerung für den Zuschauer steht noch aus. Am Ende des Filmskehrt die Kamera zur Eingangsszene zurück. Die Frau, die alsLeichenschänderin vor Gericht stand und mit der Offenlegungihrer Motive der historischen Wahrheit zum Durchbruch verhel-fen wollte, starrt weiterhin nur auf die Todesanzeige. Sich andem Schreibtischtäter zu rächen, ihn auszugraben und der Öf-fentlichkeit zum Aburteilen zu übergeben, das alles hat sich nurin ihrem Wunschdenken abgespielt. In Wirklichkeit, so die Kon-sequenz des Films, hat eine Bewältigung des Stalinismus in derSowjetunion bis heute noch nicht stattgefunden.
Tengis Abuladse hat diesen Film als Auftragsproduktion fürdas georgische Fernsehen gedreht. Er ist ein mehr künstlerisch
184
als politisch orientierter Regisseur. Erst im Alter von 52 Jahrentrat er der Kommunistischen Partei bei. Seine Spielfilme basierenfast ausnahmslos auf literarischen Vorlagen aus seiner georgi-schen Heimat. Auch der jüngste Film “Pokajanije” ist von derVielschichtigkeit kaukasischer Erzählungen durchdrungen, mitBildern und Assoziationen besetzt, die nicht auf den ersten Blickverständlich werden. Gerade darin aber liegt die Brisanz desFilms, der wegen seiner Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiteneine besondere Herausforderung an die sowjetischen Zulas-sungsbehörden stellt.
Doch die vorsichtige Öffnung in der sowjetischen Filmszeneunter der im Frühjahr neu gewählten Leitung des sowjetischenFilmverbandes lässt nun eine öffentliche Aufführung möglicherscheinen, denn bereits seit einigen Monaten sind in der Sow-jetunion bewegende Filme zu sehen, die bis zu fünfzehn Jahre inden Archiven zurückgehalten worden waren.
185
KEIN VERSTECKSPIEL VOR DER GESCHICHTEDie Wiederentdeckung von Nikita Chruschtschow90
Als im Herbst 1987 das sowjetische Fernsehen den 90-minütigen Dokumentarfilm „Risk“ („Das Risiko“) ausstrahlte,wurden zwei Tabus gleichzeitig gebrochen: Erstens konnten dieSowjetbürger nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder NikitaChruschtschow ausführlich auf dem Bildschirm erleben. Undzum zweiten stellte der Film eine inhaltliche Parallele derChruschtschow-Ära zur Perestrojka unter Gorbatschow her. Vorden Vereinten Nationen in New York hatte Chruschtschow 1959- erstmals in diesem Jahrhundert, wie der Kommentator sagt -zur Abrüstung aufgerufen. Mit angespannter Stimme warChruschtschow vor das internationale Publikum der UNO getre-ten und hatte einen Vorschlag gewagt, den erst 1986 MichailGorbatschow wieder aufgriff und weiterdachte: die Vernichtungaller Atomwaffen bis zum Jahr 2000. Nicht zufällig hatte Doku-mentarfilmer Dimitrij Barschewskij Chruschtschow im O-Tonsprechen lassen: „Im Laufe von vier Jahren sollten alle Staateneine vollständige Abrüstung durchführen, damit sie über keineMittel der Kriegsführung mehr verfügten... Lasst uns vollständigabrüsten, lasst uns lieber darin wetteifern, wer für sein Volkmehr Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser baut, wer mehrBrot, Milch, Fleisch, Kleidung und andere Konsumgüter her-stellt.“ Dieser Film bedeutet in der öffentlichen Auseinanderset-zung um Chruschtschow zwar nicht dessen Rehabilitierung. Erleitet aber zu einer engagierten Diskussion über, die heute aufden Seiten der Zeitschriften und Zeitungen - allen voran Ogon-jok - fortgesetzt wird. Die Enttabuisierung der weißen Flecken in
90 Die Zeitgeschichtler rehabilitierten - mit politischer Billigung - den geäch-teten früheren Partei- und Staatschef Nikita Chruschtschow; mehr noch: siestellen die Gorbatschow-Reformen in eine Reihe mit der Entstalinisierungund der Tauwetterperiode unter Chruschtschow. Erstveröffentlichung: DieSamen treiben Keime. In der Sowjetunion lebt die Chruschtschow-Ärawieder auf. In: DIE ZEIT, Nr. 47, 18. November 1988.
186
der sowjetischen Geschichte führt über die Stalinzeit zwangsläu-fig zu dem Mann, der als erster den Personenkult um Stalin an-geprangert und die Stalin-Opfer namentlich genannt hat. Derstreitbare Historiker Jurij Afanasjew machte als einer der erstenin der Zeitung Sowjetskaja Kultura auf die ParalleleChruschtschow - Gorbatschow aufmerksam. In einem Interviewvom vergangenen Frühjahr erinnert er an eine Filmszene: Daschreitet der junge Jurij Gagarin nach seinem ersten Weltraum-flug über einen langen roten Teppich auf ein Podium zu. „Manmöchte gern wissen“, so Afanasjew, „wem er da Meldung erstat-tet und wer ihn durch Handschlag begrüßen wird. Die jungenLeute wissen es nicht, die älteren wechseln vielsagende Blicke.War es nun notwendig, Chruschtschow herauszuschneiden? Wielange wollen wir so tun, als habe es ihn überhaupt nicht gegeben?Wie lange wollen wir Gagarin noch zwingen, irgendwohin in dieFerne, aus der Leere in die Leere zu schreiten?“
Seit der Ausstrahlung von „Risk“ ist Chruschtschow wiedersichtbar: Mit einer begeisterten Umarmung küsst er Gagarinrechts und links, wiederholt und heftig. Und schließlich erlebendie Zuschauer einen Chruschtschow, der über den Weltraumer-folg vor Rührung weint und sich die Tränen mit einem Taschen-tuch trocknet. Als Gorbatschow in seiner Rede zum 70. Jahres-tag der Revolution im vergangenen Jahr über die Zeit nach Stalinurteilte, wusste jeder, an wen er dachte: „Man begann, der Ent-wicklung der Landwirtschaft, dem Wohnungsbau, der Leichtin-dustrie, der Konsumsphäre und all dem, was mit der Befriedi-gung der Bedürfnisse des Menschen zusammenhängt, mehrAufmerksamkeit zu schenken. Mit einem Wort, es vollzogen sichWandlungen zum Besseren - sowohl in der sowjetischen Gesell-schaft als auch in den internationalen Beziehungen.“ Mit seinerErklärung, woran die Reformen unter Chruschtschow gescheitertsind, verblüffte Gorbatschow gar die Eingeweihten. Die Haupt-ursache sah er darin, „dass sie sich nicht auf eine breite Entfal-tung von Demokratisierungsprozessen stützte“. Nur einen Mo-nat später publizierte die Wochenzeitung Moskowskije Nowostiein Gespräch mit dem 88-jährigen Drehbuchautor JewgenijGabrilowitsch, der Chruschtschow als einen außerordentlich
187
interessanten Menschen für die künstlerische Aufarbeitung be-zeichnet. Chruschtschow habe „Millionen Gefangene befreit,während das Volk ihm seine Mais-Ideen nicht vergeben kann“.Fjodor Burlatzki, ein Mitarbeiter aus Chruschtschows Stab, hatbegonnen, seine Memoiren über jene Jahre in der ZeitschriftNowyi Mir zu veröffentlichen. Eine Kurzfassung davon ist alsBuch auf Deutsch erschienen unter dem Titel: „Es gibt keineAlternative zur Perestrojka“. Burlatzki beobachtete etwa, wieChruschtschow verträumt mit einem amerikanischen Transistor-radio auf dem Bauch spazieren ging oder bei einem Gesprächmit Tito unter dem Tisch mit einer Armbanduhr in Form einesFotoapparates spielte. Sympathie für den früheren Parteichefklingt in Entschuldigungen an: „Der Erste war leider von Ratge-bern umgeben, die ihm viel Unsinniges erzählt haben.“ Aller-dings wirft auch Burlatzki Chruschtschow vor, er sei ein Vertre-ter des autoritär-patriarchalischen Kultes gewesen, der sich inalles mit einem Unfehlbarkeitsanspruch einmischen wollte. Der-lei Kritik stößt in der Sowjetunion bei Millionen auf offene Oh-ren, ebenso wie die teilweise sehr subjektiven Darstellungen„jener zehn Jahre“ von Chruschtschows Schwiegersohn AlexejAdschubej, die im Sommer dieses Jahres von der ZeitschriftSnamja veröffentlicht wurden.
Erstaunliche Bekenntnisse enthielt ein groß angelegter zwei-seitiger, bebilderter Bericht, der im Mai dieses Jahres in der Wo-chenzeitung Moskowskije Nowosti erschien. In der Einleitungwird deutlich, wo man heute Anknüpfungspunkte sucht. Dennmit der Absetzung des damaligen Parteichefs und mit dem Vor-wurf des „Voluntarismus und Subjektivismus“, so argumentierendie Autoren, „wurde der Versuch verurteilt, die sowjetische Ge-sellschaft zu dezentralisieren.“ Doch auch hier wirdChruschtschow und sein Unvermögen, den notwendigen zweitenSchritt zu tun, kritisiert: „Die Verurteilung von Stalins Vergehenwurde konterkariert mit der Absage, das politische Regime unddie Ideologie des Stalinismus eingehend zu analysieren.“ DerApparat habe es wegen seiner Eigeninteressen zwar geschafft,Chruschtschow zu Fall zu bringen, aber die wichtigste Lehre ausjener Zeit entnahmen die Autoren der Tatsache, „dass das Volk,
188
das gerade dabei war, aus seinem Dämmerzustand aufzuwachen,noch nicht für Veränderungen bereit war“. Warum man sichheute mit der Chruschtschow-Zeit auseinandersetzen muss,begründet die Zeitschrift mit der Verzahnung von damaligenund heutigen politischen Absichten: „Schon in jener Zeit wurdedas Saatgut für das neue soziale und politische Denken in dieErde gelegt... Nach zwei Jahrzehnten treiben diese Samen Kei-me.“
Für die innerparteiliche Diskussion um Chruschtschow sorg-te das frühere Agitationsblatt Argumenty i Fakty, das sich mehrund mehr zu einem aufklärerischen Blatt entwickelte, mit Zeug-nissen des Historikers Roy Medwedjew, der lange Zeit in Un-gnade gelebt hatte. Das Blatt druckte bereits zwei wichtige Kapi-tel aus seiner in Amerika erschienenen Chruschtschow-Biographie. Gleichzeitig bemüht sich ein Moskauer Verlag, dasBuch auch in der Sowjetunion herauszugeben. Schon zuvor hatteeine Zeitung in Weißrussland Medwedjews Biographie in einerzweimonatigen Serie nachgedruckt. Die Zeitung konnte ihreAuflage in dieser Zeit spürbar steigern.
Angesichts dieser neuen Publizität erhält Medwedjew eineFlut von Leserbriefen. Die gesamte Diskussion wird nach Med-wedjews Eindruck „ohne bestimmten Plan und ziemlich durch-einander“ geführt. Doch sei sie unumgänglich, weil die gesamteLiteratur, die jetzt über Stalin produziert wird, ihren Ausgangs-punkt in der von Chruschtschow eingeleiteten Entstalinisierunghabe. Die Umsetzung dieser Diskussion in der Geschichts-schreibung macht noch große Schwierigkeiten. Für die Neufas-sung der Parteigeschichte sind bislang noch keine Thesen verab-schiedet worden, und das Autorenkollektiv ist noch nicht voll-ständig. In der Praxis bekommen das die Schüler zu spüren. Sowurde im vergangenen Jahr ein Geschichtsbuch mit einer Aufla-ge von drei Millionen Exemplaren ausgeliefert, in dem NikolajBucharin noch als Volksfeind bezeichnet wird, obwohl er bereitsrehabilitiert war. Als Folge der verwirrenden Zustände sind dieGeschichtsprüfungen an den sowjetischen Schulen derzeit ausge-setzt.
189
HÄFTLING IN DER STALINZEITEin Film bricht ein Tabu91
Die Auseinandersetzung mit der Zeit des Stalinismus undden Folgen des Terrors gehört zu den wichtigsten Bestandteilender Glasnost-Politik in der Sowjetunion. In Kürze soll ein neuerFilm in die Kinos kommen, der bereits probeweise gezeigt wirdund der die moralische Rehabilitierung politischer Gefangeneraus der Zeit Stalins zum Thema hat. Gleichzeitig wird in diesemFilm indirekt die Partei bezichtigt, in einer kritischen Phase derHerausforderung versagt zu haben.
Unter dem Titel „Kalter Sommer 1953“ führt der Film desRegisseurs Alexander Proschkina zurück in die Zeit kurz nachStalins Tod. Die ersten Straflager im Norden der Sowjetunionwerden geöffnet, kriminelle Häftlinge entlassen, während diepolitischen Gefangenen von der Amnestie noch nicht erfasstsind. Plündernd und mordend fällt ein Trupp von sechs ehemali-gen Kriminellen über ein kleines Dorf her. Der Parteichef beugtsich der rohen Gewalt und wagt keinen Widerstand, obwohl erselbst über Waffen verfügt. Auch die übrigen Vertreter derStaatsmacht haben dem Terror nichts entgegenzusetzen. Statt-dessen folgen sie aus Angst um ihre eigene Sicherheit bereitwilligden Befehlen der ehemaligen Häftlinge.
In diesem Dorf leben aber auch zwei Männer, die unter Stalinals politische Gefangene hierher verbannt wurden. Sie kennensich nicht einmal mit richtigem Namen, führen ein verachtetesAußenseiterdasein und gelten als gesellschaftlicher Abschaum.Mit verzweifeltem Mut gelingt es ihnen jedoch, das Dorf vondem Terror der kriminellen Bande zu befreien. In der Stunde dergrößten Not, in der nicht einmal klar ist, ob sie den Kampf mit
91 Die „weißen Flecken“ der Geschichte wurden in kleinen, aber brisantenDosierungen getilgt. Die „strahlende Vergangenheit des Kommunismus“,getrübt durch das Erbe Stalins, erscheint als langer Schatten auf der Ge-schichte. Erstveröffentlichung: Die Last der Vergangenheit in der Sowjet-union. Ein Film über Häftlingsschicksale in der Stalin-Zeit. In: Neue Zür-cher Zeitung, Nr. 27, 4. Februar 1988.
190
den Verbrechern überleben, entdecken die politisch Entrechte-ten wieder ihre Identität, indem sie sich einander mit vollemNamen vorstellen.
Die erschütternde Aussage des Filmes: Menschen, die wäh-rend der Stalin-Zeit im Namen ungerechter Anklagen verurteiltund ihrer Menschenwürde beraubt wurden, zählen zu den eigent-lichen Befreiern einer unterdrückten Gesellschaft. Die Absurditätder politischen Prozesse jener Zeit wird deutlich gemacht, indemdie Kriminellen in Anlehnung an die stalinistische Terminologiedie politischen Gefangenen unter brutalen Schlägen als Trotzkis-ten, Menschewiken, Utopisten und Abweichler beschimpfen.Der Film entlarvt damit die Methoden der stalinistischen Be-schuldigungen selber als kriminell.
Vernichtend ist aber auch die Abrechnung mit den Vertreternder Staats- und Parteimacht, die sich dem Terror gebeugt haben.Von dem Held des Filmes, einem politischen Gefangenen, ver-langen sie, er solle gegenüber den Behörden behaupten, er habenur auf Anweisung der Parteileute so mutig gehandelt. SeinemMitstreiter, der umgekommen ist, wollen sie dagegen die Beerdi-gung auf dem Dorffriedhof verweigern, weil er kein vollwertigerZeitgenosse gewesen sei. Dieser Schauspieler, der im Film denTod erleidet, Anatoli Popanow, ist kurz nach den Dreharbeitengestorben. Im Nachspann des Filmes lässt der Regisseur ihn inschwarzer Bildumrandung noch einmal den Schlüsselsatz wie-derholen, der bis heute wie eine aus der Zeit Stalins stammendeBelastung der sowjetischen Gesellschaft wirkt: „Um eines tut esmir leid, um die Jahre, in denen man doch nur hatte menschlichleben wollen.“
191
STREIT UM DEN STALINISMUSEin Konflikt zwischen Geschichtswissenschaft und Ideologie92
Die Auseinandersetzung um die Neubewertung der sowjeti-schen Geschichte hat zu einem heftigen Schlagabtausch zwi-schen dem streitbaren Historiker Jurij Afanasjew, Rektor desHistorisch-Archivarischen Instituts in Moskau, und der Parteizei-tung Prawda geführt. Dabei beharrt das Parteiblatt auf demStandpunkt, es habe trotz Massenrepressionen und Verbrechenkeine Alternative gegeben zu den politischen Zielsetzungen, dievon der Partei Ende der zwanziger Jahre, also unter Stalin, ge-troffen wurden. Der Historiker Afanasjew hatte schon im ver-gangenen Jahr in der Zeitung Sowjetskaja Kultura eine Aufarbei-tung der Stalin-Ara gefordert, über die in der Sowjetunion „keineeinzige wissenschaftliche Abhandlung“ erschienen sei. Vor eini-gen Wochen klagte er dann in der Zeitung Literaturnaja Rossijadarüber, dass die Verbrechen Stalins und sein völliges Abwei-chen von der Linie Lenins unterschlagen würden. Wörtlich ver-wies er auf die verheerenden Vorgänge: „Im Verlauf der Kollek-tivierung wurden erstmals Massenrepressionen angewandt. Der1932-1933 organisierte Hunger kostete Millionen von Menschen-leben.“
Die Sowjetunion, so folgerte der Autor, sei wohl das einzigeLand der Welt, in welchem es in der Geschichtsschreibung nurso von Fälschungen wimmelte, was sich verheerend auf die all-gemeine Geschichtskenntnis auswirke. Im Kern jedoch zielte derHistoriker auf die ikonenhaft idealisierte Figur des StaatsgründersLenin mit der Aussage: „Lenin hat doch überhaupt nicht imSozialismus gelebt, er hat nur geträumt und gedacht, dass ausdem Russland der Neuen Ökonomischen Politik das Russlanddes Sozialismus entstehen wird.“ Dann folgte die Forderung,
92 Mit der Stalinismusdebatte verknüpften kritische Historiker, allen vorander Rektor des Historisch-Archivarischen Instituts in Moskau, Jurij Afanas-jew, heftige Angriffe auf die Gegner der Perestrojka. Erstveröffentlichung:Streit um den Stalinismus. Fragen nach der Notwendigkeit in Geschichteund Gegenwart. In: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 174, 29. Juli 1988.
192
Lenin zu entmythologisieren: „Lenin würde noch erhabener voruns stehen, wenn er als Mensch gezeigt würde, der suchte undnicht immer die Antwort auf entstehende Fragen fand.“ Zurweiteren Behandlung empfahl Afanasjew die „fruchtbare Diskus-sion“ vor allem mit westlichen Marxisten.
Die heutige Identitätskrise in der Sowjetunion beschrieb erwörtlich so: „Wir sehen in den Spiegel und können uns nichterkennen.“ Gleichzeitig polemisierte der Historiker gegen denVersuch, ein offizielles Lehrbuch der Parteigeschichte zu schrei-ben, mit der Forderung, man müsse sich von jeglichen Ansprü-chen auf das Monopol von historischem Wissen trennen. Kurzvor der Parteikonferenz Ende Juni 1988 antwortete die Prawdadas erste Mal auf diese Vorwürfe mit einer grobschlächtigenReplik und folgender Schlussfolgerung: „Wir sind nicht vomWeg abgebogen, den der Oktober eröffnet hat, ... sonst gäbe esin der Welt keinen Sozialismus. Aber natürlich sind wir diesenWeg bei weitem nicht so gegangen, wie sich Lenin das vorgestellthat.“ Damit provozierte die Prawda eine emotional verfasste undvoller Ironie triefende Antwort von Afanasjew, die nun zusam-men mit einer erneuten Replik der Prawda publiziert wurde.
Darin vermochte der Historiker den vom Parteiblatt vertei-digten Sozialismus nicht zu erkennen und polemisierte überdies:„Ich halte die bei uns geschaffene Gesellschaft nicht für sozialis-tisch, nicht einmal für einen ´deformierten´ Sozialismus.“ Fernerwandte sich Afanasjew gegen historische Determinanten in derEntwicklung der Sowjetgeschichte: „Der konterrevolutionäreWeg Stalins und seines riesigen Apparates war nicht historischzwingend und deshalb auch nicht gerechtfertigt.“ Daraus leitet erdie Schlussfolgerung ab, dass die Perestrojka nun die Chancehaben müsse, sich auf solche Alternativen zu stützen, die früher,also konkurrierend zu Stalin, in der Partei bestanden hätten.
Auch jetzt steht das Schicksal der Sowjetunion für den Histo-riker auf Messers Schneide. Wenn man nur mit Halbwahrheitenoperiere, so Afanasjew, werde man auch nur halbe Maßnahmenergreifen - mit der Gefahr des „Zusammenbruchs unseres letztenhistorischen Versuches, aus dieser schrecklichen Situation her-auszukommen.“ Dann wiederholte Afanasjew - dieses Mal auf
193
den Seiten der Prawda - seine Forderung nach einem neuen ideo-logischen Verhältnis zu Lenin: „Die moderne Theorie des Sozia-lismus ... muss man von Anfang an neu mit Hilfe von Leninschaffen, sie aber nicht einfach in seinen Werken suchen. Damitwürde der Staatsgründer Lenin reduziert auf das Mittel einesideologischen Werkzeuges, statt wie bisher den Rang eines ideo-logischen Maßstabes einzunehmen.“
Mit ironischem Unterton attackierte Afanasjew das Politbü-ro-Mitglied Ligatschow. Ohne ihn wörtlich zu nennen, zitierteder Historiker Ausdrücke und Redewendungen des eher konser-vativen Politikers, dessen Ablösung er sogar zur Diskussionstellt. Unter sarkastischer Anspielung auf die Folge von Rücktrit-ten in der Stalin-Zeit schreibt Afanasjew: „Sollte jetzt jemandzurücktreten und eine staatliche Pension beziehen, würde dasetwa die Rückkehr zum stalinistischen Terror gegen die lenin-schen Parteikader bedeuten? Oder ließe sich dieser Rücktritt - imUnterschied zu Zwangsarbeit und Erschießungen - doch verein-baren mit der Volksmacht und einem normalen politischenKampf?“
Hernach stellte Afanasjew zur Debatte, ob die von Li-gatschow angegriffene Form des Markt-Sozialismus sich wirklichselbst entwickelt habe oder von den „subversiven Feinden“ derSowjetunion stamme. Man könne mit der Erhöhung von Pro-zentzahlen argumentieren, meinte der Historiker zur wirtschaftli-chen Lage, und er fuhr mit der Bemerkung fort, dass man auchvor fünf und zehn Jahren „uns keine schlechten Prozente mitge-teilt“ habe. Daran knüpfte er mit einem vernichtenden Bild derVersorgungslage an, das sich in ähnlicher Beschreibung auch beidem gestürzten Moskauer Stadtparteichef Boris Jelzin wiederfindet. „Wollen wir doch ganz einfach antworten: Ist es auchnur etwas besser geworden mit Lebensmitteln, Konsumgütern?Kann das Volk leichter leben als vor drei Jahren? Aus den Pro-zenten bei der Erhöhung der ‘Arbeitsproduktivität‘, die uns vonder heimischen Statistik mitgeteilt wird, lässt sich keineBorschtsch-Suppe kochen, damit kann man keine Schuhe kau-fen, sonst wären wir schon lange eine florierende Gesellschaft.“
194
Unter Anspielung auf eine allgemeine Redewendung, „wennLenin das sähe“, verwies Afanasjew auf die Bezugsscheine fürLebensmittel im Jahre 1988 und auf die russischen Träume vonMillionen von Menschen in der Provinz, die sich nach einerkünstlich gestreckten Koch-Wurst sehnten. Diesem Missstandstellte er gegenüber, dass „wir 35 Jahre nach Stalins Tod erstanfangen, Demokratie zu lernen wie 15-jährige Sitzenbleiber inder ersten Schulklasse“. Dennoch verband Afanasjew mit seinerKritik die Hoffnung, die in den vergangenen drei Jahren derPerestrojka entstanden sei. Doch in seiner Schlussfolgerungkonnte sich Afanasjew nicht zur Antwort durchringen, welcheForm von Sozialismus in der Sowjetunion letztlich eine Chanceerhält.
Den Wortlaut dieser Polemik hat die Prawda veröffentlichtund damit einem Leserkreis zugänglich gemacht, der sich an eineneue Form des Pluralismus gewöhnt hat, wenngleich das Forumdafür ziemlich prominent erscheint. Ebenso prominent wirkt dieReplik, in der die Prawda den Historiker der unwissenschaftlichenMethode beschuldigte und sich darüber aufregte, dass LeninsRolle geschmälert werden soll, In Anlehnung an die Parteiliniebehauptete die Prawda, dass es keine Alternativen zum Verlaufder Sowjetgeschichte gegeben habe. Die Prawda berief sich aufeine Bewertung Gorbatschows vom November letzten Jahres,als dieser bei den Feiern zum 70. Jahrestag der Oktoberrevoluti-on eigens die Industrialisierung und Kollektivierung verteidigthat. Unter Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg setzte diePrawda in traditioneller Weise diese Bewertung in Zusammen-hang mit der damaligen Notwendigkeit, „die Heimat vor dertödlichen Gefahr zu retten“. Gleichzeitig aber machte das Par-teiblatt geltend, dass es „auf unserem Weg enorme Verluste,schwere Fehler und Fehlkalkulationen, massenhafte Repressio-nen und Verbrechen“ gegeben habe.
In Verteidigung eines weit verbreiteten Geschichtsbildesweist die Prawda darauf hin, dass „Millionen von Menschen wirk-lich mit Enthusiasmus” sich beim Aufbau der sowjetischen In-dustrie engagiert hätten. Aber auch hierbei wurden „grausameVerluste, die das Volk erlitten hat” erwähnt. Trotz dieser konser-
195
vativen Replik erfolgte abschließend eine Überraschung: DiePrawda übernahm die Frage Afanasjews nach den Antiperestroi-ka-Kräften, die er unter Anspielung auf Ligatschow gestellt hat,mit dem Hinweis, gegen sie müsse man „energisch kämpfen“.Und auch die Ware-Geld-Beziehung, von Ligatschow in einerRede vor Arbeitern in Togliatti bestritten, ist laut Prawda einorganischer Bestandteil des Sozialismus, den es zu nutzen gelte.
196
ZUR ZARENZEIT WAR ALLES BESSEREin historischer Leistungsvergleich mit den USA93
In den gut siebzig Jahren seit der Revolution ist es der Sow-jetunion nicht gelungen, es den Vereinigten Staaten auf wirt-schaftlicher Ebene gleichzutun. Ganz im Gegenteil sind die sozi-alen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Ländernzum Nachteil der Sowjetunion immer größer geworden. DenBeleg dafür lieferte eine sowjetische Fachzeitschrift für Amerika-fragen. In der Zeitschrift „USA - Wirtschaft, Politik, Ideologie“vermittelt der Autor Nikolaj Sajtschenko den Sowjetbürgernerstmals anhand von konkreten Daten ein erschütterndes Bildder Lage im eigenen Land. Verweise auf Angaben aus der vorre-volutionären Zeit belegen außerdem, dass die Menschen imGebiet der heutigen Sowjetunion zu den viel geschmähten zaris-tischen Zeiten mehr und besser zu essen hatten als heute.
Vor Beginn des Ersten Weltkrieges und vor der Oktoberre-volution lag der jährliche Fleischverbrauch in Russland demnachim Durchschnitt bei 88 Kilogramm pro Person. In Städten, indenen heute, also Ende 1988, der Fleischverkauf rationiert ist,standen den Einwohnern vor der Revolution weit über einhun-dert Kilogramm im Jahr zur Verfügung. Der heutige Fleischver-brauch liegt dagegen offiziell bei 62 Kilogramm. Im Vergleich zuden USA mit 120 Kilogramm ist das nur knapp die Hälfte vondem, was Amerikaner auf dem Tisch haben. Als soziale Unge-rechtigkeit wird in dieser Analyse bewertet, dass die Sowjetbürgeraus dem gesamten Nationaleinkommen nur 36,6 Prozent alsLohnanteil erhalten. In den USA dagegen partizipiert die Bevöl-kerung mit 64 Prozent am Nationaleinkommen. Das bedeutet,dass den Amerikanern ein sehr viel größerer Teil des gesamtenGeldvolumens für ihre privaten Bedürfnisse zur Verfügung steht
93 Der ständige Wettbewerb mit den USA erwies sich als Traumtänzerei,nachdem historische Vergleiche zeigten, wie sehr der Sozialismus die Sow-jetunion heruntergewirtschaftet hat. Erstveröffentlichung: Sowjetunion undUSA im Leistungsvergleich. Zur Zarenzeit ging es den Russen besser. NeueZürcher Zeitung, Nr. 305, 31. Dezember 1988.
197
als den Sowjetbürgern. Die Kluft wird noch größer, wenn manPreise und Arbeitsleistungen miteinander vergleicht. Demnachmüssen Sowjetbürger für Fleischprodukte zehn- bis zwölf Mallänger arbeiten als die Amerikaner. Selbst Grundnahrungsmittelsind trotz aller Propaganda unvergleichlich teurer: Für Milcharbeitet ein Sowjetbürger 18- bis 20-mal länger, und für daskünstlich verbilligte Brot je nach Sorte zwei- bis achtmal längerals ein Amerikaner — ganz zu schweigen von schier uner-schwinglichen Köstlichkeiten wie Orangen und Bananen, für dieein Sowjetmensch bis zu 25-mal länger arbeiten muss als einAmerikaner. Vernichtend fällt auch der Vergleich im Konsumgü-terbereich aus:
Die Kosten für Elektrogeräte, Autos, selbst für Schuhe undKleidung liegen teilweise absurd hoch. Das Warenangebot selbstist im Vergleich zu den USA sehr bescheiden. Nach diesen sow-jetischen Angaben verfügt der sozialistische Markt lediglich über14 Prozent des amerikanischen Warenangebotes für Gegenstän-de des täglichen Bedarfes, die langfristig benutzt werden wieKühlschränke oder Waschmaschinen. Besonders klein ist dasAngebot an Autos, die nur fünf Prozent des amerikanischenVergleichsmarktes ausmachen. In der Sowjetunion, so lautet dieSchlussfolgerung der Studie, sind die Preise für Lebensmittel undKonsumgüter mit die höchsten in der ganzen Welt. WeiterePreiserhöhungen als Mittel einer Wirtschaftsreform, wie sie zur-zeit diskutiert werden, dürfen daher nach Meinung dieser Fach-zeitschrift auf keinen Fall angewandt werden.
199
NATIONALE KONFLIKTE
PROTESTE AUF DEM ROTEN PLATZDie Krimtataren kämpfen für die Rückkehr in ihre Heimat94
Vier alte Männer erheben sich kurz nach Mitternacht vomKopfsteinpflaster zwischen der Kremlmauer und der Basilius-Kathedrale am Roten Platz. Die Bewegung strengt sie sichtlichan. Dann schlurfen sie auf die weiträumigen Polizeiabsperrungenzu und gelangen durch die verwinkelte Fußgängerunterführungauf die andere Straßenseite am Hotelkomplex Rossija, wo seitStunden schon neugierige Passanten das Schauspiel beobachten:Erst aus der Nähe wird die Ungeheuerlichkeit des Vorgangesklar: Die alten Männer sind hoch dekorierte Kriegsveteranen, dieseit den Mittagsstunden im vollen Ordensschmuck am Zentrumder Sowjetmacht demonstriert haben. Zusammen mit über 500anderen Krimtataren ist ihnen gelungen, was seit Jahren in dersowjetischen Hauptstadt nicht mehr möglich war: öffentlich zuprotestieren, ohne ein Eingreifen der Staatsmacht zu provozie-ren.
Die Milizionäre im Dienst zeigten ungewöhnliche Zurückhal-tung, ja sogar Langmut mit den Demonstranten, die ungehindertdie Absperrungen passieren konnten, um sich für ihren stunden-langen Protest mit Essen und Trinken zu versorgen. Ihre Forde-rung lautete: Wir wollen Gorbatschow sprechen. Mit der Zusage,man werde ihre Vertreter am nächsten Tag im Zentralkomiteeempfangen, begann der disziplinierte Abzug der Demonstrantenin eng geschlossener Formation: Frauen mit schlafenden Kin-dern auf dem Arm, lachende Burschen und Mädchen, stolze,
94 Nach Jahrzehnten der Verbannung wagte ein ganzes Volk - vom Kriegs-veteranen bis zur Mutter mit Kind - tagelang auf dem Roten Platz denersten großen Massenprotest gegen die nationalen Säuberungen unter Sta-lin. Erstveröffentlichung: Protest auf dem Roten Platz. „Nur einer kann unshelfen“. Die Krimtataren erhoffen von Gorbatschow die Rückkehr in ihreHeimat. In: DIE ZEIT, Nr. 32, 31. Juli 1987.
200
medaillengeschmückte Männer und Frauen. Sie alle betrachtensich als Delegierte der Krimtataren, als eine Art außerparlamen-tarische Volksvertretung, die in keinem sowjetischen Gesetzverankert ist, aber in Wirklichkeit existiert. Dem geschundenenVolk der Krimtataren erscheint der Generalsekretär der KPdSUals einziger Hoffnungsträger, dem sie vertrauen können. SeineParolen vom neuen politischen Denken, von Glasnost und Ge-setzlichkeit, seine Forderung, es dürfe keine vergessenen Namenund keine weißen Flecken in der eigenen Geschichte mehr ge-ben, sind für die Krimtataren erklärtermaßen der Anstoß für ihrverzweifeltes wie geduldiges Ausharren gewesen. Schon seitdreißig Jahren bemühen sie sich - ausgehend vom XX. Parteitag1956, auf dem Chruschtschow seine Genossen mit den Verbre-chen Stalins konfrontierte - um ihre historische und politischeRehabilitierung. Von Stalin wurden sie pauschal der Kollaborati-on mit dem faschistischen Besatzer beschuldigt und in einererniedrigenden Aktion zusammen mit anderen Kaukasusvölkernnach Zentralasien deportiert. Doch allein den Krimtataren ist -neben den Russlanddeutschen - eine Rückkehr in ihre Heimatversagt geblieben.
Noch während hinter der Kremlmauer angesichts der seltsamruhigen und doch Aufsehen erregenden Demonstration verhan-delt wurde, hatten die sowjetischen Massenmedien bereits einStück Wiedergutmachung geleistet. Im Nachrichtenprogrammdes Fernsehens wurde eine TASS-Erklärung verlesen, die klar-stellte, dass den Krimtataren trotz vereinzelter Zusammenarbeitmit dem Feind Unrecht geschehen ist. Damit erhielt eine Teilre-habilitierung der Krimtataren fast auf den Tag genau nach zwan-zig Jahren erstmals landesweite Publizität. Unter wesentlicherBeteiligung des damaligen KGB-Chefs und späteren Generalsek-retärs Andropow war nämlich am 21. Juli 1967 den Krimtataren- ebenfalls nach einer größeren Demonstration auf dem RotenPlatz - bescheinigt worden, dass es keinen Anlass für eine kollek-tive Beschuldigung gegeben hätte. Doch nur die regionalen Zei-tungen im Siedlungsgebiet der deponierten Krimtataren veröf-fentlichten damals diesen Erlass. Der Weg zum Kompromissschien mit der jüngsten TASS-Erklärung geebnet. Denn erstmals
201
war auch die Rede von einer Kommission, die unter dem Vorsitzvon Staatschef Gromyko eigens für die Belange der Krimtatareneingesetzt wurde. Damit sollten die Demonstranten nicht alsGesetzesbrecher abgedrängt, sondern als legitime Gesprächs-partner gewonnen werden. Selbst so prominente Fürsprecher wiedie Schriftsteller Bulat Okudshawa und Jewgenij Jewtuschenko,die eine „Wiederherstellung der Rechte“ für die Krimtatarengefordert hatten, wurden in der sowjetischen Presse zitiert. Beiden bisher erhobenen Ansprüchen an die eigene sozialistischeHausordnung kommt es fast einem Sündenbekenntnis gleich,wenn nun öffentlich eingestanden wird, dass sich die Sowjetuni-on immer noch mit einem unbewältigten Nationalitätenproblemauseinandersetzen muss.
Dennoch war die TASS-Erklärung zwiespältig und dieKrimtataren reagierten empört. Ihr Vorwurf: Man hätte nichtwieder die alten Wunden aufreißen dürfen, die tatarischen Regi-menter im Dienst der Faschisten nennen oder gar von Men-schenverbrennungen berichten dürfen, die nach Aussagen derKrimtataren in ihrer Heimat niemals vorgekommen sein sollen.„Nach dieser verlogenen TASS-Erklärung“, so klagte ein Spre-cher in der Gruppe am nächsten Tag, „werden wieder die Men-schen mit den Fingern auf uns zeigen. Eine Protestnote gegendie TASS-Erklärung wollten sie in allen Zeitungen veröffentlichtsehen, die auch den Text der amtlichen sowjetischen Agenturabgedruckt hatten. In einem Anflug von Wut verzichteten sieauch auf ein angebotenes Gespräch mit dem stellvertretendenStaatsoberhaupt Demitschew „Zweimal“, so erklärten sie aufge-bracht, „haben wir ergebnislos mit ihm gesprochen. Für unszählt nur noch Gorbatschow.“
In einem Hinterhof unweit des Zentralkomitees lagerten tagsdarauf einige hundert Demonstranten und praktizierten stum-men Protest. Als ausländische Journalisten sich für die Szenerieinteressierten, versuchte die Miliz zum ersten Mal, die Kontaktemit der Presse zu unterbinden. Die Krimtataren reagierten fürdie Milizionäre daraufhin unerwartet: „Glasnost, Demokratie,Gorbatschow“, skandierten sie, gingen dabei blitzartig in dieHocke und bildeten einen engen Schutzwall um die Journalisten.
202
Die verblüfften Vertreter der Sicherheit mussten sich erfolgloszurückziehen, um später zu erfahren, dass die Protestler einenweiteren Erfolg verbuchen konnten. Während sich die sowjeti-schen Massenmedien allmählich auf einen Schlagabtausch mitder „kleinen Gruppe von Krimtataren“ und ihren „extremisti-schen Aktionen“ einstimmten, erklärte sich Staatschef AndrejGromyko selbst bereit, mit einer Delegation der Dauerdemonst-ranten zu sprechen.
Eine neuerliche TASS-Meldung griff allerdings den Ton auf,der auch unter Passanten der Moskauer Innenstadt zu verneh-men war: „Geht doch wieder in die Wüste“, war noch einer derharmlosesten Sätze, die erregt gegen die dunkelhäutigen Protest-ler vorgebracht wurden. Die Stimmung schien aufgebracht, einHandgemenge unweit des Roten Platzes verleitete schließlicheine westliche Agentur zu der falschen Annahme, nun endlichhabe die Miliz fast einhundert demonstrierende Krimtatarenfestgenommen. Doch die Anweisungen von oben waren strikt.Die Miliz hielt sich weiter zurück. Staatschef Gromyko wolltejetzt jeden einzelnen der zwanzig Abgesandten ausführlich anhö-ren. „Er war freundlich und ließ uns ausreden“, bescheinigte imAnschluss an das Treffen Fabrie Seutowa, eine Journalistin unterden Demonstranten, die mit minutiösem Detailwissen über dieGeschichte der Krimtataren ihre Gesprächspartner zu verblüffenverstand - eine blitzgescheite Frau von erdrückender Rigorosität.„Ein Kompromiss kommt für uns nicht in Frage“, bescheinigtesie dem Staatsoberhaupt ebenso wie der Presse. „Wir begnügenuns nicht mit einem autonomen Gebiet, wir bestehen auf einerautonomen Republik in unserer alten Heimat. Solange wird auchunsere einzige Zeitung in Taschkent nicht mehr erscheinen.“
Einwürfe, die zu bedenken gaben, dass seit Kriegsende aufder Krim eine völlig neue Bevölkerung angesiedelt und nachge-wachsen ist, lässt die streitbare Tatarin nicht gelten. Mit Hoch-rechnungen über eine durchaus vertretbare Besiedlungsdichtenach der Rückkehr von etwa dreihunderttausend Krimtatarenund mit historischen Forderungen bestritt sie ihr Argumentati-onsfeuer. Der Weg zum Kompromiss scheint nun durch Maxi-malforderungen solcher Krimtataren verbaut, obwohl die hoch-
203
rangig besetzte Kommission - neben Gromyko gehören vonsieben weiteren Mitgliedern noch vier zum Politbüro - lediglichVorschläge für eine Lösung erarbeiten möchte, ohne denKrimtataren eine Lösung aufzuzwingen. Plötzlich erhalten Ne-bensächlichkeiten ein neues Gewicht. Während der provisori-schen Pressekonferenz der Protestler in einer Moskauer Woh-nung fiel eine alte Postkarte mit dem Bild von Zar Nikolaus II.am Buchregal auf, daneben die Forderung „Für ein freies Russ-land“. Die hilfreichen Hände, die sich den Krimtataren in Mos-kau anbieten, deuten auf eine andere Bewegung, deren Mitgliedersich selbst als „russische Nationalisten“ bezeichnen.
Die Forderungen, die nach der ersten Woche des geduldigbeharrlichen Protestes nun auftauchen, klingen resoluter. Hun-gerstreik wird in Erwägung gezogen, möglichst viele Krimtatarenwollen zu weiteren Aktionen nach Moskau kommen, und dieDelegierten des kleinen Volkes haben teilweise schon ihre Arbeitniedergelegt, um so lange in der sowjetischen Hauptstadt auszu-harren, bis ihre nationale Frage gelöst ist. „Nur einer kann unsvor der Radikalisierung bewahren“, meinte ein eher schweigsa-mer Demonstrant. „Und das ist Gorbatschow. Er muss mit unssprechen“, sagte er fast flehentlich. Selbst die engagierte Spre-cherin schien bei der Nennung Gorbatschows zu einem Kom-promiss bereit. „Wir vertrauen ihm, wir glauben ihm“, wieder-holte sie nachdrücklich und zog damit ihre so ausgiebig demons-trierte Rigorosität selbst in Zweifel.
204
EIN VOLK ERHEBT SICHDer Vorbildcharakter der Unruhen in Armenien95
Eine alte Dame, weit über sechzig Jahre alt, streckt ihre Handzum Siegeszeichen empor. Dann reiht sie sich ein in eine schierendlose Menschenmenge und skandiert zusammen mit den an-deren das Wort „Karabach“. Hunderttausende von Armeniernaller Altersstufen belagerten tagelang den zentralen Opernplatzin Eriwan. Sie lauschten nationalen Liedern und applaudiertenden Parolen, die „eine Nation in einer Republik“ forderten. Pla-kate mit russischen und armenischen Aufschriften versprachen„Karabach - die Armenier sind mit euch“. Andere Losungensetzten auf die Politik Gorbatschows: „Karabach ist ein Prüfsteinfür die Perestrojka“, hieß es oder „Selbstbestimmung ist keinExtremismus“.
Der Protest der Armenier hätte jeder staatlich verordnetenDemonstration zur Ehre gereicht; er verlief diszipliniert, ohneAusschreitungen oder Zusammenstöße mit der Polizei. Dennochkonnten die sowjetischen Medien in dieser Bewegung nichtsVorbildliches für ihr Land erblicken. Die spärlichen, aber au-thentischen Eindrücke aus Eriwan stammen von einem Video-film, der teilweise mit versteckter Kamera vor Ort gedreht unddann dem Moskauer Büro der amerikanischen Fernsehgesell-schaft ABC zugespielt wurde. Über den sowjetischen Bildschirmflimmerten hingegen Aufnahmen aus armenischen Betrieben, woarbeitsame Sowjetbürger die Worte Gorbatschows von bürgerli-cher Reife, Freundschaft zwischen den Völkern und notwendigerDisziplin würdigten. Die Ansprache selbst, die Gorbatschow im
95 Ganz Armenien schien auf den Beinen, um gegen die Benachteiligungihrer Landsleute in einer Enklave der Nachbarrepublik Aserbaidschan zudemonstrieren. Dies Demonstrationen dienten bald als Vorbild für andereNationen innerhalb der Sowjetunion, ihre nationalen Rechte einzufordern?Erstveröffentlichung: Die Minderheiten melden sich zu Wort. Unruhen inArmenien: Löst Gorbatschows Perestrojka im Vielvölkerstaat Sowjetunioneine Kettenreaktion aus? In: DIE ZEIT, Nr. 10, 4. März 1988.
205
armenisch-aserbaidschanischen Krisengebiet in Funk und Fern-sehen hatte verlesen lassen, blieb den meisten Sowjetbürgernjedoch unbekannt. Trotz mangelnder Glasnost in diesem Fall hatsich der Umgang mit den nationalen Problemen im Land erheb-lich verändert:
- Vor fast fünf Jahren versammelten sich auf dem RotenPlatz zwei Dutzend Menschen, Sowjetdeutsche, die für ihreAusreise demonstrieren wollten. Ihre Plakate konnten sie nurwenige Sekunden in die Höhe halten, dann wurden sie unterharten Schlägen der Miliz abgeführt.
- Vor gut einem halben Jahr demonstrierten am Roten Platzfünfhundert Krim-Tataren für die Rückkehr in ihre alte Heimat,aus der sie von Stalin vertrieben worden waren. Die Milizschirmte die Demonstranten ab, griff aber tagelang nicht ein.Stattdessen wurden die Vertreter der Krimtataren zur Diskussionin das Zentralkomitee der Partei gebeten. Seither ermittelt eineKommission, wie historisches Unrecht wiedergutzumachen ist.
Die unterschiedliche Behandlung signalisiert den Wandel impolitischen Programm. Auch die Armenier hoffen, davon zuprofitieren. Der schwierige und zuweilen qualvolle Prozess derPerestrojka soll nicht an den schwelenden nationalen Problemenin der Sowjetunion vorbeisteuern. Gorbatschow hat bereitszweimal deutlich gemacht, dass Veränderungen notwendig sind:
Erstens hatten die erlaubten Demonstrationen der Krim-Tataren am Roten Platz neue Maßstäbe gesetzt. Sie durften un-gestraft die stalinistischen Verbrechen an kleinen Nationen ein-klagen. Zweitens rollte Gorbatschow die nationale Frage auf, alser jüngst ankündigte, das Zentralkomitee solle der Nationalitä-tenpolitik ein eigenes Plenum widmen. Damit wurde ein Dogmader vergangenen Jahrzehnte außer Kraft gesetzt, wonach in derSowjetunion die nationale Frage bereits vorbildlich gelöst war.
Die Vorfälle im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebietsind die Fortsetzung dessen, was anderswo begonnen hatte. DieAblösung des kasachischen Parteichefs Kunajew im Dezember1986 hatte noch zu blutigen Straßenkämpfen geführt. Denn dieAbsetzung des korrupten Parteichefs war verbunden mit derErnennung des russischen Nachfolgers Kolbin. Danach folgte
206
die politisch weitsichtigere, bislang aber folgenlose Reaktion aufdie Krimtataren. In der Zwischenzeit hatten sich auch die Sow-jetdeutschen zu Wort gemeldet. Sie hatten, ebenso wie die Krim-Tataren, trotz staatlicher Rehabilitierung nicht mehr in ihr ange-stammtes Siedlungsgebiet an der Wolga zurückkehren dürfen,aus dem sie 1942 deportiert worden waren. Unter Gorbatschowblieben die zahlreichen Petitionen der fast zwei Millionen Sow-jetdeutschen nicht mehr ohne Resonanz. Einer Delegation sagtedas Zentralkomitee kulturelle Einrichtungen an einem zentralenOrt zu.
Die Redaktion der deutschsprachigen Tageszeitung „Freund-schaft“ wurde daraufhin im vergangenen Jahr nach Alma Ata inKasachstan verlegt, wo der größte Teil der Sowjetdeutschenwohnt. Wenige Monate später folgte ein weiterer Schritt. EineVerordnung des Präsidiums des Obersten Sowjets von Kasachs-tan legte fest, dass der muttersprachliche Unterricht der Deut-schen entscheidend zu verbessern sei; noch bis zur Mitte dersechziger Jahre war er ganz verboten. Doch im Gegensatz zuvielen anderen Völkern können die Deutschen bis heute nochkeine Schule in eigener Sprache betreiben. Der heikelste Punktberührt aber die Frage ihrer nationalen Autonomie. Offensicht-lich nicht ohne politische Rückendeckung hat der Chefredakteurder deutschsprachigen Wochenzeitung Neues Leben diesenAspekt öffentlich zur Diskussion gestellt.
Anders gelagert sind die Probleme in den baltischen Republi-ken. Eine Protestnote des sowjetischen Außenministeriums andie US-Botschaft in Moskau zeigt die Grenzen bei der Frage umdie nationale Debatte. Moskau beschwert sich über eine Einmi-schung von außen durch den Regierungssender „Voice of Ame-rica“, der zu den Nationalfeiertagen der Republiken Estland,Lettland und Litauen zu Demonstrationen aufruft. Wenn TASSin den letzten Wochen zugeben musste, dass es „Rowdys“ ge-lungen sei, in den litauischen Städten Wilnius und Kaunas nachdem Kirchgang „antisowjetische Demonstrationen“ zu organisie-ren, so liegt die Vermutung nahe, dass auch nationale Unzufrie-denheit bei solchen Manifestationen mitschwingt. Die amerikani-schen Parolen aus dem Äther machen, sehr zum Ärger der offi-
207
ziellen Sowjetführung, deutlich, dass die USA das Baltikumstaatsrechtlich immer noch nicht als Teil der Sowjetunion aner-kennen. Daher darf auch der US-Botschafter in Moskau dieseRegion nicht bereisen. Eine fast kuriose Folge: Die Bundesre-publik als Verbündete fällt unter dasselbe Edikt, und der derzei-tige bundesdeutsche Botschafter, Andreas Meyer-Landrut gebür-tig aus Tallin, früher Reval, darf daher seine eigene Heimatstadtnicht besuchen.
Neue Verordnungen sollen dem ausgeprägten Nationalgefühlin den baltischen Gebieten Rechnung tragen. Russen, die inwichtige Führungsfunktionen von Staat, Wirtschaft und Parteiaufsteigen, werden angehalten, die jeweilige Nationalsprache zuerlernen.
Umgekehrt gilt als landesweite Praxis, dass ein Sowjetbürgerohne ausbaufähige Russischkenntnisse ebenfalls keine Karriere-möglichkeiten hat. Noch 1984 hatte die Partei ein ehrgeizigesReformprojekt verabschiedet, wonach alle Schulabgänger dierussische Sprache beherrschen müssen. Während des letztenZK-Plenums kritisierte Politbüromitglied Ligatschow jene Re-form als undemokratisch und sprach von der Notwendigkeiteiner „national-russischen Zweisprachigkeit“ bei der Schulerzie-hung. Die zwangsläufige Russifizierung, die oft mehr wirtschaft-lich als ethnisch bedingt ist, hat bereits zu gravierenden Verände-rungen geführt. So gibt es in Weißrussland kaum noch mutter-sprachliche Schulen. In der Ukraine studiert man auf Russisch.Der Unterricht in kasachischen oder armenischen Schulen richtetsich nach den zentralisierten Lehrplänen Moskauer Ministerienund wird den nationalen Belangen oft nicht gerecht. Gegen diesePraxis führte eine armenische Schriftstellerin schon vor Jahres-frist in der Parteizeitung Prawda heftige Klage und zierte ihreAttacke auf die Russifizierung der Schulen mit den Worten desdagestanischen Dichters Rassul Gamsatow: „Wenn meine Spra-che stirbt, sterbe ich mit ihr.“
Die Sprache ist das wichtigste nationale Identitätsmerkmal inder Sowjetunion. So kann man sich bei der Festlegung der Nati-onalität in gemischten Familien für die Volkszugehörigkeit einesder beiden Elternteile entscheiden oder aber aufgrund der Mut-
208
tersprache seine Nationalität bestimmen. Ein junges Mädchenaus Pawlodar mit einem deutschen Vater und einer polnischenMutter hat sich allein aufgrund ihrer schulischen Erziehung ent-schieden und sich mit sechzehn Jahren bei der Aushändigungdes Passes als Russin registrieren lassen.
Gleichwohl ist vor wenigen Monaten die Diskussion überden zahlenmäßigen Bestand an Russen aufgebrochen. In fünfJahrzehnten, so befürchten sowjetische Fachleute, wird bei derjetzigen Geburtenrate die russische Nation halbiert sein, währenddie asiatischen Nationen und die Kaukasusvölker überproportio-nal weiter anwachsen. So gilt es bereits jetzt zu bedenken, welcheAuswirkungen der nationale Proporz in der Partei, aber auch inWirtschaft und Militär haben könnte, in Bereichen also, die inden Führungspositionen überwiegend von Russen verantwortetwerden.
Dies mag ein wichtiger Faktor für Gorbatschow bei seinenBemühungen um eine Diskussion der nationalen Frage sein. Esist deshalb auch verständlich, wenn Gorbatschow sich gegenüberAbgesandten der armenischen Demonstranten beklagt hat, dassman ihm mit den Unruhen im Kaukasus in den Rücken gefallensei und die Perestrojka gefährde. Erstens nämlich ist Armeniendie Republik mit der größten Fluktuation in beide Richtungenund gleichzeitig die Republik mit der größten nationalen Ge-schlossenheit. Allein über zweihundertfünfzigtausend Auslands-armenier sind seit den zwanziger Jahren in ihre alte Heimat zu-rückgekehrt, weil eben das zerstreute Volk mit seiner schre-ckensvollen Geschichte keinen anderen gesicherten Platz in derWelt hat. Zweitens wurde mit den Ereignissen in Nagornyj Ka-rabach eine von Gorbatschow neu propagierte Losung „AlleMacht den Sowjets“ verwirklicht‚ die ihm jetzt Schwierigkeitenbereitet. Denn die überwältigende Mehrheit eines Sowjets (=Rates) traf die Entscheidung, die nun soviel Unruhe hervorgeru-fen hat. Hundertzehn Abgeordnete stimmten in Nagornyj Kara-bach für den Anschluss an Armenien, dreizehn stimmten dage-gen und siebzehn enthielten sich der Stimme. Das Wahlergebnisbringt Gorbatschow in Verlegenheit, weil es Kräfte freisetzte, diesich auch gegen die Zentralmacht richten. Die Gefahr einer Ket-
209
tenreaktion ist noch nicht gebannt. Die Unruhen in der StadtSumgait in Aserbaidschan konterkarieren den Beginn einerAtempause, die zwischen der Moskauer Zentrale und den de-monstrierenden Armeniern bis zum 26. März 1988 vereinbartwurde. Wie aber kann der von Gorbatschow erstrebte gerechteLösungsversuch aussehen in einem Land, in dem zwar fünfzigder über hundert Nationen in Republiken und autonomen Ge-bieten eine bedingte Selbständigkeit haben, in dem aber lautPrawda mit der nationalen Frage „nicht alles zum Besten“ bestelltist? Bei einer ehrlichen Lösung kann die Frage der nationalenIdentität auch nach siebzig Jahren Sowjetmacht nicht von derFrage der Glaubenszugehörigkeit getrennt werden. Die Religionspielt zwischen den christlich geprägten Armeniern und denmoslemisch orientierten Aserbaidschanern ebenso eine Rolle,wie bei dem Regionalismus-Denken der zentralasiatischen Re-publiken, die seit geraumer Zeit wegen ungeheuerlicher Rück-stände - in Usbekistan verbrannten sich im Laufe der letztenzwei Jahre 270 Frauen selbst aus Verzweiflung über ihr Schicksalals versklavte Schwiegertöchter - öffentlich kritisiert werden.Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion ist eben mehr als nurein gerechter territorialer Ausgleich zwischen den Völkern.
210
GLASNOST IN KLEINEN DOSENKreml und Partei räumen Fehlerbei Unruhen im Kaukasus ein96
Ein Jungakademiker ließ seinem Unmut freien Lauf: „Lange,viel zu lange haben wir hochnäsig behauptet, dass eine nationaleFrage in der Sowjetunion nicht existiert.“ Seine Empörung istnicht ungewöhnlich, sie wird von vielen Sowjetbürgern geteilt.Doch in diesem Fall sorgte das publizistische Umfeld für dieBrisanz einer solchen Äußerung. Denn in selbstkritischer Ab-sicht druckte die Regierungszeitung Iswestija den Brief eines ge-wissen A. Garibow nach, der aus Erfahrung spricht. Garibow istein aserbaidschanischer Russischlehrer, der zurzeit seinen Wehr-dienst in Turkmenistan absolviert. Offen klagt er an, was von dersatirischen Literatur bis zum Unterhaltungsfilm in der Sowjet-union gepflegt wird, nämlich das Negativ-Image des vermeintlichtypischen Südländers, des Kaukasiers, der als Schwarzhändlerund Schieber, als Schwindler und Betrüger das Land verunsiche-re. Nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, sodie vehemente Klage, habe man die Probleme zwischen denNationalitäten mit schönen, aber leeren Worten von der Völker-freundschaft bemäntelt.
Wochen nach den tragischen Zusammenstößen zwischenArmeniern und Aserbaidschanern suchen die sowjetischen Me-dien krampfhaft nach einem Weg, wie man die Ereignisse öffent-lich behandeln kann, ohne die bestehenden Tabus zu verletzen.Denn Schilderungen von Mord und Totschlag wurden bislangebenso von der Zensur verhindert wie eine mögliche Aufrech-nung, welche Nation in dem jüngsten Streit mit wie vielen Op-fern am meisten gelitten hat. Aber auch die schlichte Wahrheit
96 Noch hatte Moskau nicht verlernt, die Wahrheit zu verschweigen undInformationen über die blutigen Zusammenstöße im Kaukasus zu manipu-lieren. Doch Glasnost begann, sich auch hier durchzusetzen. Erstveröffent-lichung: Glasnost in kleinen Dosen. Unruhen in Aserbaidschan und Arme-nien. Kreml-Führung und Parteipresse räumen Fehler und Versäumnisse.In: DIE ZEIT, Nr. 14, 1. April 1988.
211
über den hunderttausendfachen Protest der Armenier und derenBegehren wurde wegen des verordneten Informationsvakuumsdurch wuchernde Gerüchte ersetzt.
Unter sowjetischen Fernsehzuschauern machte sich Sarkas-mus breit: „Das einzig Zuverlässige, was wir aus Armenien er-fahren“, so eine Stimme, „ist die Wetterprognose am Ende derNachrichtensendung.“ Korrespondenten fühlten sich in die Zeitvor Glasnost zurückversetzt und bemühten sich verzweifelt, ausInformationen aus zweiter und dritter Hand herauszufiltern, wasgeschehen sein könnte. Die wenigen authentischen Fernsehbilderwurden mangels anderer Informationen zum Ursprung farbigerReportagen, die weltweite Verbreitung fanden. Drei Bürgerrecht-ler dienten fast der gesamten westlichen Presse, allen voran denführenden Nachrichtenagenturen, als Gewährsmänner.
Die staatlichen Restriktionen leisteten den inoffiziellen Nach-richten Vorschub. Die Lage wurde undurchschaubar, als weitereStreikdaten genannt, aber nicht eingehalten wurden. Die Quellenaus Armenien versiegten durch einen beliebten Kunstgriff derStaatsmacht.
Telefonate mit Mitgliedern des Komitees Karabach in Eriwandauerten nur noch Sekunden, bis ein kurzes Klicken die Leitungunterbrach. Umso mehr war die sowjetische Öffentlichkeit aufein Datum fixiert, das als „armenisches Ultimatum“ sogar vonden staatlichen Massenmedien registriert worden war. Vier Wo-chen nach einer Begegnung von Parteichef Gorbatschow mitarmenischen Schriftstellern erwarteten die Demonstranten einenpositiven Bescheid über ihre Forderung, Nagornyj-Karabach anArmenien anzuschließen. Andernfalls sollte ein dreitägiger Gene-ralstreik die Republik lähmen. Das Politbüro lehnte eine Grenz-verschiebung ab, erkannte jedoch die missliche Lage der Arme-nier in der Enklave mit einer Reihe von sozialen, kulturellen undwirtschaftlichen Verbesserungen an. Für die kommenden siebenJahre werden umgerechnet 1,1 Milliarden Mark für den Bau vonSchulen, Krankenhäusern, Wohnungen und Straßen inNagornyj-Karabach investiert. Eine Fernsehstation soll den Ar-meniern in Karabach endlich die Programme aus Eriwan in derMuttersprache vermitteln. Der muttersprachliche Unterricht in
212
den Schulen bis hin zum Druck neuer Bücher soll verbessertwerden. Mit diesen Maßnahmen wollte das Politbüro den An-schlussforderungen seine Schärfe nehmen. In einer konzertiertenAktion schaltete sich just zum Ultimatum die Presse ein. EineGruppe sowjetischer Korrespondenten wurde mit Sonderauftragin die Krisengebiete entsandt und teilte den Lesern dreierlei mit:
Erstens längst überfällige Informationen über Beginn undAblauf der Unruhen und zweitens die Erkenntnis, dass die politi-sche Inkompetenz der verantwortlichen Kader in Armenien undAserbaidschan nicht zufällig zustande gekommen ist. Drittensschloss sich die Warnung an, dass eine Häufung solcher Proble-me der Perestrojka schaden muss. Als Kronzeugen dafür dienenArmenier wie der Vizedirektor Karabekow aus Eriwan, der sichnach anfänglicher Sympathie von der protestierenden Massen-bewegung losgesagt hat. „Es kam der Moment“, so schildert erden Gesinnungswandel, „wo wir uns fragen mussten, auf wel-cher Seite wir stehen - auf der Seite der Perestrojka oder auf derSeite derjenigen Kräfte, die Entwicklung bremsen.“
Inzwischen entdeckten die sowjetischen Medien, dass es so-gar den Wissenschaftlern in beiden Republiken „an selbstkriti-scher Fähigkeit zur Analyse“ mangele. Der inzwischen abgelösteParteichef von Sumgait, dem Ort des brutalsten Terrors, soll alsVerhinderer der Perestrojka schon zuvor von seinem Posten alserster Komsomolsekretär abgelöst worden sein. Immerhinsprach dieser Parteichef im nach hinein „von der gezielten Vor-bereitung zum Pogrom“ und die Regierungszeitung Iswestija, dieals erste den Unruhen publizistisch nachging, scheute sich nichtlänger, diesen Begriff zu verbreiten.
In einer ersten Aufwallung von Staatsräson hatte die Prawdamit konservativer Drohgebärde versucht, die armenische Pro-testbewegung als ferngesteuerte Attacke gegen die Einheit derSowjetmacht zu verunglimpfen. „Was ist“, so sorgte sich dasParteiblatt, „wenn auf Kosten unserer Völker nun die übrigenRegionen beginnen, ihre eigenen Interessen zu befriedigen? Wasbleibt dann von der Union der Bruderländer übrig?“ Gleichzeitigaber räumte die Prawda ein, dass die Gesetze für autonome Ge-biete wie Nagornyj-Karabach, die vor zehn Jahren erlassen wur-
213
den, „nicht in vollem Umfang wirken und von manchen überge-ordneten Republiken ignoriert werden“.
Nicht alle Blätter waren zu solcher Ehrlichkeit fähig oder be-reit. Eine Zeitung vermutete dreist, der amerikanische Geheim-dienst CIA lasse über Agenten den Aufstand in Eriwan vorberei-ten. Dagegen versuchte die Regierungszeitung Iswestija eine Er-klärung, warum es überhaupt im Sowjetreich zu solchen Unru-hen kommen konnte. Sie wies auf „Fehlentwicklungen in dernationalen Frage“ hin, bei denen auch die mangelnde Sensibilitätder Russen gegenüber anderen Sowjetvölkern eine Rolle gespielthabe.
Die Regierungszeitung mahnt bei den Russen eine „psycho-logische Perestrojka“ an, da die Russen ihre frühere „Rolle desHelfers“ inzwischen mit der eines gleichberechtigten Partnersanderer Sowjetvölker getauscht hätten. Die Iswestija lässt keineAusreden zu, sondern fordert: „Jetzt müssen wir offen zur Dis-kussion unserer nationalen Probleme bereit sein.“ Doch vordieser Debatte wird die Staatsanwaltschaft die Bilanz vonNagornyj-Karabach und Sumgait ziehen. Danach sind 34 Men-schen getötet und 197 Menschen verletzt worden. Die zwölfregistrierten Vergewaltigungen kommen bei dem kaukasischenEhrenkodex einer Schändung der ganzen Nation gleich. DerSachschaden mit 26 zerstörten öffentlichen Gebäuden und überzwanzig demolierten Autos verliert dagegen an Bedeutung. Ob-wohl 42 Täter verhaftet und 400 Personen bereits zu Ordnungs-strafen verurteilt wurden, konnten nicht alle Schuldigen gefasstwerden.
Die sowjetischen Medien stellen nun die neuen Helden derKatastrophe heraus. Nicht den Funktionären von Partei undKomsomol gebührt solches Lob. Es sind vielmehr die „informel-len Lideri“ (Iswestija), jene entschlossenen Bürger, die in einerNotlage, instinktiv richtig handelnd, Schlimmes vermeiden hal-fen. Es passt aber auch in das Wunschbild einer schockiertenLeserschaft, wenn zwischen den streitbaren Nationen eine Frauauftritt, die ihr Kopftuch als Symbol der Mutterwürde vor dietobende Masse wirft und nach einem alten Ritual zur Verhinde-rung der Blutrache fordert: „Erst mordet mich und zertrampelt
214
mein Tuch, ehe ihr miteinander kämpft.“ Die neue Heldin heißtChuranan Chanum und soll bereits die ersten Kämpfe zwischenArmeniern und Aserbaidschanern in den Bergregionen vor mehrals einem Monat auf diese mutige Weise verhindert haben.
Doch den Ausbruch der Feindseligkeiten - so die Schlussfol-gerung - hätten nur die Parteikader verhindern können. Sie aberkonnten es nicht. Denn wenn man den Schilderungen einesVertreters der sowjetischen Nachrichtenagentur Nowosti folgt,war der Konflikt über Jahrzehnte hin programmiert. Nach sei-nem Besuch in dem Ort Stepanakerk schildert Karen Chatscha-turow, stellvertretender Chef der Agentur: „Die autonomenRechte sind geschmälert, und manchmal bestehen sie überhauptnur zum Schein.
Sogar die Anstellung eines Arztes oder Lehrers muss vomaserbaidschanischen Republikministerium genehmigt werden.Zwischen Nagornyj-Karabach und Armenien ließ man einenschier undurchdringlichen Vorhang herunter, so dass von dortnicht einmal mehr Lehrbücher in der Muttersprache bezogenwerden konnten. Selbst in den Lehrplänen der geisteswissen-schaftlichen Fakultät des pädagogischen Instituts Stepanakerk,der einzigen Hochschule im autonomen Gebiet, fehlt der Lehr-gang der Geschichte und Geographie Armeniens.“ In Stepana-kerk ist nun auch das Vertrauen in Glasnost verschwunden.„Presse und Fernsehen entstellen die Ereignisse in Nagornyj-Karabach, sie verbreiten im Land einen falschen Eindruck“, warhäufig die Antwort, mit der den angereisten sowjetischen Kor-respondenten ein Gespräch verweigert wurde. Journalisten sindnach dem Urteil der Iswestija in Stepanakerk zurzeit schlechtangesehen. Der Grund, den die Iswestija dafür nennt, kommteiner öffentlichen Abbitte gleich: „Zweifellos sind wir selbstschuld daran, nämlich durch die verstümmelten Mitteilungen inder ersten Zeit.“
215
„MIT DER GANZEN MACHT DES STAATES“Streit um die armenische Enklave Nagornyj-Karabach97
Der schmächtige Facharbeiter Manuel Oganessjan aus Stepa-nakert starrte auf einen kleinen Metallgegenstand, der vor ihmauf dem Tisch lag. Zu seiner Rechten thronten zwei greise Ver-wandte, mit Kriegsorden geschmückt. An der Kopfseite desTisches wartete ein Ermittler der Staatsanwaltschaft auf das Ge-ständnis. „Ja“, meinte der Armenier vor der laufenden Kameraeines Reporters, „ich habe diese Waffe selbst angefertigt. Meinebeiden Onkel haben mich überzeugt, dass ich mich stellenmuss.“
Dann folgt im Bild füllenden Format die Primitivausführungeiner Kleinkaliberpistole, die der Beschuldigte an seinem Ar-beitsplatz angefertigt hatte, als der Streik bereits das öffentlicheLeben in Nagornyj-Karabach zu lähmen begann. Nach den Aus-schreitungen im aserbaidschanischen Sumgait habe man als Ar-menier nicht gewusst, was einem drohe. Trotz des verbotenenWaffenbesitzes war Oganessjan der positive Held in einem Me-diendrama, das tagelang von immer neuen Waffenfunden unterden demonstrierenden und streikenden Armeniern berichtete.Berge von Brot- und Fleischmessern, selbstgebaute Granatenund Handfeuerwaffen sollten die drohende Kriminalisierung desWiderstandes im Kaukasus belegen.
Der zweite Akt des Dramas spielte tausend Kilometer nörd-lich von Armenien. Der Brigadier S.G.Pawlow klagte vor derKamera, es gäbe keinen Lohn mehr, man schäme sich bereits,ohne Geld nach Hause zu gehen. Wegen der Streiks in den ar-menischen Zulieferbetrieben fehlten in seinem Betrieb inTscherboksary elftausend Elektromotoren. Der Schaden über-trage weit über vierhunderttausend Rubel. Die Selbstfinanzie-
97 Die Enklave in Aserbaidschan war inzwischen Gegenstand blutiger Aus-einandersetzungen, anhaltender Demonstrationen und Kernpunkt einesersten nationalen Konfliktes im Kaukasus. Erstveröffentlichung: Streit umNagornyj-Karabach. „Mit der ganzen Macht des Staates“. In: DIE ZEIT,Nr. 30, 22. Juli 1988.
216
rung, eine Errungenschaft der Perestrojka, lasse jeden Arbeiterdiese Verluste schmerzhaft spüren. Die Prawda beklagte, wegender armenischen Streiks habe es im ganzen Land Einbußen inHöhe von Hunderten von Millionen Rubel gegeben. Als dannnoch Soldaten berichteten, wie sie in den Strudel der Auseinan-dersetzung am Flughafen von Eriwan gezogen worden seien,und als das Fernsehen zerstörte Mannschaftswagen, zerstocheneReifen und verletzte Soldaten zeigte, fiel es vielen schwer, sichnoch mit den streikenden Armeniern zu solidarisieren. Allerdingskonterkarierte solche Bilder eine Aussage der armenischen Par-teizeitung Kommunist, die von dem Schwesterblatt Prawda wei-terverbreitet wurde. Der sowjetische Soldat sei stets ein will-kommener Gast in jeder armenischen Familie, hieß es dort.„Armenier haben mich verfolgt, Armenier haben mich wiedergerettet“, berichtete ein Soldat, der die widersprüchliche Situati-on am eigenen Leib erfahren hatte. Ein zorniger Offizier ginghingegen mit den Demonstranten scharf ins Gericht: „Warum“,so klagte er, „wird in Eriwan nicht berichtet, dass wir schon inSumgait Menschenleben geschützt haben?“
Spätestens mit dieser Medienkampagne schlug die Stimmungin der Sowjetunion um. Die öffentliche Meinung wäre empörtgewesen, wenn das Präsidium des Obersten Sowjets dem An-schluss von Nagornyj-Karabach an Armenien zugestimmt hätte.Der Kompromiss, der jetzt als Resolution formuliert wurde, lässtaber noch Veränderungsmöglichkeiten offen. Vize-Staatspräsident Demitschew sah durchaus die Möglichkeit, dassüber die konstitutionelle Grundlage von Nagornyj-Karabachnoch verhandelt werden könne. Ausgangspunkt dafür wäre derVorschlag von Jewgenij Primakow, dem Akademiedirektor desInstituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen, derfür die umstrittene Region den Status einer autonomen Republikin den Grenzen der Sowjetrepublik Aserbaidschan anvisierte.Dies würde mehr Unabhängigkeit trotz territorialer IntegritätAserbaidschans bedeuten. Nicht alle 32 Redner, die sich in derhitzigen Debatte des Parlamentspräsidiums in Moskau zumThema Nagornyj-Karach äußerten, bemühten sich um solchekonstruktiven Lösungsversuche. In einer langen Fernsehnacht
217
konnten sich die Sowjetbürger selbst von den Argumenten derstreitbaren Redner überzeugen.
„Die wirkliche Macht in Nagornyj-Karabach liegt jetzt in denHänden staatsfeindlicher Elemente“, klagte der aserbaidschani-sche Parlamentspräsident Tatlijew und forderte den Schutz fürseine Republik. Der Parteichef des umstrittenen Gebietes, Po-gosja, konterte: „Wir können uns nicht mit dem im Frühjahrbeschlossenen Programm zur Verbesserung der nationalen Lagezufriedengeben.“ Mit dem fast unverhüllten Ruf nach hartemVorgehen reagierte der Moskauer Stadtparteichef Saikow: „DieRechtsschutzorgane müssen beauftragt werden, Klarheit über dieunansehnliche Rolle der korrupten Clans zu schaffen, welche dieSituation um Nagornyj-Karabach zuspitzen. Mit der ganzenMacht des Staates, mit allen wirtschaftlichen, politischen undpropagandistischen Mitteln, über die wir verfügen, müssen wirdieser Situation ein Ende setzen.“
Mäßigung mahnte dagegen ein Vertreter eines anderen klei-nen Volkes an, der estnische Parlamentspräsident Arnold Rüütel:„Wir müssen die Emotionen zügeln und Weisheit und Ausdaueran den Tag legen. Die Reaktionen auf diesen Konflikt kommeninsgesamt zu spät und sind nicht angemessen.“ Eine Kommissi-on aus Abgeordneten der Nationalitätenkammer im OberstenSowjet soll die Lage noch einmal analysieren. Vertreter des sow-jetischen Parlamentspräsidiums sollen zusammen mit armeni-schen und aserbaidschanischen Repräsentanten den Prozess derBefriedung in Nagorny-Karabach überwachen. Doch wie dieserProzess ablaufen soll, darüber sagt auch nach dem Aufwall vonEmotionen und Meinungsstreitereien die jüngste Resolution ausMoskau nichts.
218
„GEFÄNGNIS DER VÖLKER“Die litauische Volksfront gegen die Sowjetmacht wächst98
Aufgeregt debattieren Passanten im Hauseingang am Lenin-prospekt Nr. 1 in Vilnius die jüngste Resolution der litauischenFreiheitsliga, die im Bestand der Sowjetunion keine Zukunft fürdie Litauische Republik sieht. Ein junges Mädchen fordert inflammenden Worten die Abschaffung des Einparteiensystemsund geißelt die Perestrojka als „Augenwischerei“. In dem Hausselbst hat eine andere Gruppierung, die gemäßigtere Volksfront-bewegung Sajudis, ihren Sitz. Sie fordert nur mehr Unabhängig-keit Litauens innerhalb der Sowjetunion. Artikel 72 der sowjeti-schen Verfassung schreibt das Recht auf Austritt aus der Sowjet-union fest.
Für Professor Vytautas Landsbergis von der Volksfront istdieser Artikel gewissermaßen der Garant für die Souveränitätnach innen. Als Vertreter der Volksfront formulierte er auch imObersten Sowjet Litauens die Vorbehalte gegen Moskaus Verfas-sungsreform, die den Zusammenhalt der Sowjetrepubliken neudefinieren soll. Doch die litauischen Abgeordneten wählten ei-nen vorsichtigen Weg. Sie wollten nicht provozieren und vertag-ten die Debatte über ein mögliches Vetorecht gegen MoskauerEntscheidungen.
Die Konkurrenz zwischen der Volksfront Sajudis und der li-tauischen Freiheitsliga tritt am zentralen Gediminas-Platz offenzutage. Zur Mittagszeit versammeln sich Tausende von Litauern,die einem Aufruf der Sajudis gefolgt sind. Sie strecken ihre Hän-de empor und stimmen für eine Deklaration über die Souveräni-tät der Republik; eine symbolische Abstimmung, die ihnen dasParlament verwehrt hat. Eigentlich sollten bei diesem Anlass dielitauischen Abgeordneten des Obersten Sowjet in Moskau gewis-
98 Die spätere Abtrennung der baltischen Staaten aus der Sowjetunion hatteihre Wurzeln in der Gründung der Volksfrontbewegungen, die zunächst aufinnere Souveränität und später auf staatliche Selbständigkeit drängten.Erstveröffentlichung: „Gefängnis der Völker“. In: DIE ZEIT, Nr. 49, 2.Dezember 1988.
219
sermaßen unter Kontrolle der Bevölkerung auf eine Ablehnungdes Moskauer Verfassungsprojektes eingeschworen werden.Doch nur zwei Abgeordnete sind erschienen, von denen sich nureiner gegen die Verfassungsreform ausspricht. Voller Begeiste-rung skandieren die Demonstranten immer wieder den NamenEstlands, der Republik, die den Verfassungskonflikt mit Moskaunicht gescheut hat. Am Nachmittag dann versammelt die Frei-heitsliga mit radikaleren Parolen ihre Anhänger. Die Aufschriftenauf den Plakaten schwanken zwischen Forderungen nach mehrPerestrojka bis hin zu der Anklage: „Die Sowjetunion ist einGefängnis der Völker“. Ein Plakat zeigt vier Polizisten von hin-ten in Kampfanzügen und Helmen. In ihren Händen halten sieSchlagstöcke.
Die Angst einflößende Geste wird überschrieben mit derAufforderung, gegen Moskaus Verfassungsreform zu stimmen;1,8 Millionen Unterschriften sind in Litauen dagegen gesammeltworden. Als ein Sprecher von Sajudis diese Zahl auf der Massen-kundgebung nennt, brandet Jubel auf. Im Hintergrund, auf demTurm des oberen Bergschlosses von Vilnius, weht die Fahne mitden Nationalfarben gelb, grün und rot. Hammer und Sichel ha-ben hier ausgedient. Sogar die Abgeordneten des Obersten Sow-jets von Vilnius haben Hymne, Nationalfahne und die Staats-sprache Litauisch anerkannt. Im Republikfernsehen wird vorge-führt, was gleichberechtigte Zweisprachigkeit bedeutet. DerReporter wendet sich an einen Gesprächspartner auf Russischund erhält die Antwort auf Litauisch. Sowjetische Generäle litau-ischer Nationalität stellen sich einer Diskussion, in der ernsthafterörtert wird, unter welchen Bedingungen in der sowjetischenArmee wieder eine national-litauische Division aufgebaut werdenkönnte.
Ehemalige Häftlinge und Deportierte ergreifen im Fernsehendas Wort. Eine Million Litauer sollen nach dem gewaltsamenAnschluss an die Sowjetunion im Jahr 1940 deportiert wordensein. Wie in der Nachbarrepublik Lettland kehren jetzt auch nachLitauen Menschen zurück, denen der Aufenthalt auch nach Ab-lauf einer Verbannungsstrafe in ihrer Heimat bislang verbotenwar. „Als die deutschen Okkupanten kamen“, schildert ein Be-
220
troffener vor der Kamera sein Schicksal, „habe ich ein Schildhochgehalten: Litauen den Litauern. Ich wurde zum Tode verur-teilt und konnte fliehen. Als dann die sowjetischen Truppenkamen, habe ich wieder das Schild hochgehalten. Man war mitmir gnädig und schickte mich nur für zehn Jahre nach Sibirien.“
221
UNRUHEN IN GEORGIENHerausforderung für Eduard Schewardnadse99
Der georgische Parteichef Dschumber Patiaschwili demons-trierte Fassungslosigkeit: „Der Schmerz, den uns dieser Vorfallzugefügt hat, wird für immer bleiben.“ Die blutigen Zusammen-stöße von Tiflis sind nach seinen Worten „unser gemeinsamesLeid, für das wir verantwortlich sind“.
Vor den Arbeitern der Dmitrow-Fabrik in der georgischenHauptstadt sprach er die Toten von Tiflis vom Vorwurf extre-mistischer Aktivitäten frei: „Ich kann hier offen sagen, dass lei-der unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind, die nichtzu den aktivsten Teilnehmern an diesem Treffen gehörten.“ DieMoskauer Zentrale wehrte sich heftig gegen Unterstellungen derwestlichen Presse: Nicht mehrere Dutzend oder gar hundert,sondern nur achtzehn Opfer haben die Zusammenstöße zwi-schen Demonstranten und Sicherheitskräften gefordert, über-wiegend Frauen. Jetzt soll mit Untersuchungskommissionen undStraffverfahren rechtsstaatliche Ordnung praktiziert werden, eheeine klare Schuldzuweisung ausgesprochen werden kann. Bislanghat die sowjetische Presse ihre Leser nur unzureichend darüberaufgeklärt, dass nicht ein plötzlicher Aufwall von politischemRadikalismus, sondern lang schwelender nationaler Zorn derAnlass für die jüngste Tragödie war.
Es gab versteckte Hinweise, wonach bereits Ende März inder kleinen Autonomen Sowjetrepublik Abchasien auf dem Ter-ritorium Georgiens die neue Welle des Widerstandes gegen ver-meintliche Bevormundung durch größere Völker aufgebrochenwar. Der dortige Parteichef musste seinen Posten räumen, nach-dem er sich mit der Forderung solidarisiert hatte, Abchasien ausGeorgien herauszulösen. Die Reaktion darauf glich den Ereignis-
99 Der Kaukasus brannte weiter und der sowjetische Außenminister Sche-wardnadse übernahm eine beruhigende Rolle in seinem Heimatland, das erspäter als Präsident in die Unabhängigkeit führen sollte. Erstveröffentli-chung: „Gemeinsames Leid“. Schewardnadse soll das Feuer in Georgienlöschen. In: DIE ZEIT, Nr. 16, 14. April 1989.
222
sen vom März 1981. Auch damals entwickelte sich aus ähnli-chem Anlass zwischen den Georgiern, die einer der ältestenchristlichen Nationalkirchen angehören, und den Abchasiern, diemehrheitlich sunnitische Moslems sind, ein Schlagabtausch.Auch damals mündete der Protest in Parolen, die einen AustrittGeorgiens aus der Sowjetunion forderten.
Doch zwei erstaunliche Unterschiede kennzeichnen denjüngsten Konflikt: Erstens scheuten sich die sowjetischen Medi-en diesmal nicht mehr, die Parolen zur Abschaffung der Sowjet-macht und zur Bildung einer provisorischen Übergangsregierungweiterzugeben, wenn auch mit dem Etikett „antisowjetisch“.Zweitens bemühte man sich - wenn auch erfolglos - die aufge-brachte Menge in Tiflis mit Hilfe des georgischen Kirchenober-hauptes zu beruhigen und die Gefahr einer Schießerei beim Ein-satz von Armee und Polizei abzuwenden.
Die Taktik beim Vorgehen gegen die Demonstranten wurdeaber nicht mehr von den Politikern bestimmt. Parteichef Patia-schwili bezeugte selber, wie das Einsatzkommando der Sicher-heitskräfte argumentierte: „Wie man uns vor Beginn der Opera-tion jedenfalls erklärt hat, sollte es keine Todesfälle geben. Es istdennoch passiert.“ Schließlich setzten die Verantwortlichen aufAußenminister Schewardnadse. Als ehemaliger georgischer Par-teichef war es ihm einst gelungen, eine der größten Massende-monstrationen zu kanalisieren. 1978 sollte durch eine Verfas-sungsordnung Georgisch als Staatssprache abgeschafft werden.Schewardnadse setzte sich an die Spitze der Kritiker. Er konnteMoskau zur Rücknahme des Projektes bewegen und gleichzeitigsein Volk ruhigstellen. Zunächst als bedrückter und ernster Zu-hörer, dann als Gesprächspartner im teilweisen scharfen Stra-ßendialog ist Schewardnadse jetzt in seiner Heimat politischstärker herausgefordert worden als bisher in seinem MoskauerMinisterium.
223
NATIONALE SPRENGKRAFTDer Vielvölkerstaat driftet auseinander100
Die Welle der Unabhängigkeitserklärungen, die das Ende derbisherigen sowjetischen Staatsform beschleunigte, erinnert aneinen nahezu identischen Prozess, in dessen Verlauf die Ukraineund Georgien (1917) sowie Litauen, Estland, Aserbaidschan,Armenien und Lettland (1918) ihre staatliche Unabhängigkeitverkündeten. Tataren, Kosaken, Baschkiren beanspruchten imgleichen Zeitraum ihr Selbstbestimmungsrecht in eigenen verfas-sungsgebenden Versammlungen. In der Sowjetunion führten ab1988 nationale Massendemonstrationen in Estland, Lettland,Litauen und in Armenien zur Bildung von Unabhängigkeitsbe-wegungen. Die Möglichkeit einer Abspaltung peripherer Gebietevon der Sowjetunion rückte mit der Souveränitätserklärung vonEstland am 16. November 1988 in greifbare Nähe. Die vor-schnelle Unabhängigkeitserklärung von Litauen am 11. März1990 und die Wahl des antikommunistischen PräsidentenVytautas Landsbergis an die Spitze der Republik führten dann zujenem Verfassungsstreit, der letztlich mit der Auflösung derbestehenden sowjetischen Verfassungsgewalt endete.
Der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow glaub-te damals noch, er könne mit Wirtschaftssanktionen die abtrün-nigen Litauer gefügig machen. Doch dann reagierten auch Est-land und Lettland mit Unabhängigkeitserklärungen, die über denAnspruch der Souveränität hinaus die Eigenstaatlichkeit derbaltischen Republiken bedeuten sollte. Am 14. Mai 1990 verfügteder Präsident der UdSSR in einem persönlichen Dekret, dass dieUnabhängigkeitserklärung Estlands vom März 1990 „als gesetz-
100 Die wirkliche Herausforderung für die Sowjetunion war die Illusion vom„freiwilligen Zusammenschluss“ der Völker. Die nationale Frage war allesandere als gelöst. Der Zerfallsprozess war nicht mehr aufzuhalten undhatte Auswirkungen auf den Gesamtbestand der Sowjetunion. Erstveröf-fentlichung: Der zweite Zerfall des Imperiums. Die nationale Frage aberauch innerhalb in der Sowjetunion, Russlands. In: Die Presse, Wien 7./8.September 1991.
224
widrig zu betrachten“ sei. Mit ähnlichen Präsidialdekreten be-kämpfte Gorbatschow die Unabhängigkeitsbewegungen auch inden übrigen baltischen Republiken. Im Gegensatz zu Gor-batschow erkannte der damalige russische Parlamentspräsidentund heutige direkt gewählte russische Präsident Boris Jelzin dasSelbstbestimmungsrecht der baltischen Republiken sofort an. Erunterlief die Wirtschaftssanktionen Gorbatschows und bot denbaltischen Republiken Kooperationsverträge an.
Damit sicherte sich Jelzin seine erste politische Basis außer-halb der Russischen Föderation. In ähnlicher Weise bereiteteJelzin auch weitere „horizontale Beziehungen“ zwischen Russ-land und den übrigen Republiken vor, um mit diesem flächende-ckenden Netzwerk von Beziehungen einen strukturpolitischenKontrapunkt zur Moskauer Zentralmacht zu setzen. Diese Tak-tik hat sich bei seinem Kampf gegen das Zentrum letztlich aus-gezahlt. Mit dem Zerfall und der Neuordnung der Sowjetunionstellt sich für Jelzin aber nun die Frage, was man unter Russlandeigentlich zu verstehen hat. Hier eröffnet sich eine Perspektivevon enormer politischer Sprengkraft. Denn die Identität Russ-lands ist mit einer doppelten Abgrenzung verknüpft, die sichnach außen wie nach innen richtet. „Die Russen sterben aus!“Das war der Schlachtruf einer russisch-patriotischen Bewegung,die in den letzten Jahren mit dramatischer Geste auf den Gebur-tenrückgang bei den Russen hinweisen wollte. Bis zur Jahrtau-sendhälfte werde sich die Zahl der Russen halbieren, verkünde-ten die Anhänger einer These Anfang der achtziger Jahre. Siefürchteten den überproportionalen Zuwachs der asiatischenVölker in der Sowjetunion.Der Bevölkerungsanteil der Russen an der Gesamtbevölkerungder Sowjetunion ist tatsächlich gefallen und lag zuletzt bei nurnoch 50 Prozent. Durch die Abtrennung nicht-russischer Repub-liken werden sich die Proportionen wieder zugunsten der Russenverschieben. Doch auch die Tatsache, dass die Russen bereits imzaristischen Vielvölkerstaat in der Minderheit waren, hat derenführende Rolle gewissermaßen als Staatsvolk nicht in Frage ge-stellt.
225
Bei einer Volkszählung vor fast genau hundert Jahrenherrschte der Zar in Russland über 56 Prozent Nicht-Russen inseinem Reich. Das Spannungsverhältnis der Nationen im Viel-völkerstaat hat besonders in der Zeit der Sowjetunion das Ringenum die russische Identität geprägt. Russland gehe in der Sowjet-union auf, befürchteten die Patrioten, die nun in einer Welle desEnthusiasmus den Russlandbegriff einem Unionsgedankenüberordnen. Die Umkehrung dessen bemängelten die nicht-russischen Völker, nämlich: Die Sowjetunion gehe in Russlandauf. Zwischen Russen und den nicht-russischen Völkern herr-schen kulturhistorisch bedingte Unterschiede in den nationalenBeziehungen, die sich nun wieder politisch äußern: Der Jubel umeinen Vertrag, der jetzt die Ukraine und Russland in einem neuenStaatenbund vereinen soll, stärkt auch jene russisch-nationalenKräfte, die in der Ukraine Kleinrussland sehen, aus dem dasspätere Großrussische Reich hervorgegangen ist.
Denn in der heutigen Ukraine liegt die Stammheimat dereinstigen Kiewer Rus’ und des späteren Russischen Reiches. DerFürst von Kiew Wladimir (ukrainisch: Wolodimir; belorussisch:Ulazdimir) übernahm 988 das Christentum als Staatsreligion undlegte damit den Grundstein für die orthodoxe Kirche, derenPatriarch ab 1325 in Moskau residierte. Mit dem Erstarken derMoskauer Fürsten sank die Bedeutung von Kiew, der Hauptstadtder heutigen Ukraine. Allerdings sind diese Beziehungen nichtfrei von Spannungen. Zahlreiche Ukrainer, darunter vor allemdie mit Rom unierten Gläubigen der Westukraine, ziehen einenscharfen Trennungsstrich zwischen der national-ukrainischenund der russischen Geschichte.
Eine zweite Abgrenzung der Russen gegen eine andere slawi-sche Nation hat auch erst in den letzten Jahren an Schärfe ge-wonnen. Gemeint ist das Verhältnis von Russen zu Weißrussen.Weißrussland war eine Provinz des Zaren, der ähnlich wie in derUkraine auch den Weißrussen die Benutzung ihrer eigenen Spra-che verbot. Der Zar akzeptierte auch keine weißrussische Nati-on. Obwohl die Sowjetunion diese Völker mit eigenen Republi-ken anerkannte, hat Stalins Russifizierungspolitik versucht, dienationale Identität dieser Völker weitgehend zu zerschlagen, um
226
sie dem künstlichen Gebilde eines so genannten sowjetischenVolkes unterzuordnen. In einem Pendelschlag zurück vom Zent-ralismus wird jetzt nicht nur bei den Russen, sondern bei allenVölkern der bisherigen Sowjetunion der Nationalgedanke bis hinzu nationalistischen und chauvinistischen Attitüden neu belebt.Jelzin wird sich auf der Woge des patriotischen Enthusiasmuskaum Forderungen entziehen können, die eine ZuständigkeitRusslands für die 25 Millionen Russen verlangen, die zwar inner-halb der bisherigen Sowjetunion, aber außerhalb der RussischenFöderation leben. So liegt in der Republik Kasachstan mit 16,6Millionen Einwohnern der Anteil der Russen bei 41 Prozent.Selbst in der zentralasiatischen Republik Kirgisien an der Grenzezu China sind von 4,3 Millionen Einwohner 26 Prozent Russen.Auch die Ukraine, die nach der Unabhängigkeit der zweitgrößteStaat Europas sein wird, beherbergt unter 51,7 Millionen Ein-wohner 21 Prozent Russen. Dagegen ist der russische Siedlungs-einfluss im Transkaukasus und im Baltikum mit Ausnahme Lett-lands (33 Prozent Russen) relativ gering geblieben.
Innerhalb der RSFSR mit 148 Millionen Einwohnern stellendie Russen mit 80 Prozent der Bevölkerung den beherrschendenAnteil. Gleichzeitig liegen innerhalb Russlands 16 AutonomeRepubliken, fünf Autonome Gebiete sowie zehn Autonome(Nationale) Kreise. Trotz dieser Vielfalt und der scheinbarenRücksichtnahme auf nationale Minderheiten decken sich dieadministrativen und die ethnischen Grenzen nicht miteinander.Deshalb war die Russische Föderation bereits seit Jahren mit denForderungen eines erwachenden Nationalgefühls anderer Völkerauf ihrem Territorium konfrontiert. Diese Entwicklung führte inder Zeit der Perestrojka zu vorsichtigen Veränderungen. ImHerbst 1989 waren in Sibirien wieder tatarische Schulen einge-richtet worden für jene Muttersprachler, die außerhalb der Tata-rischen Autonomen Republik leben. Denn von den sechseinhalbMillionen Tataren wohnen nur ein Sechstel in der bis dahin Tata-rischen Autonomen Republik, während der Rest weit verstreut inder Russischen Föderation siedelt. Im Zuge dieser Entwicklungwurde für die islamisch geprägten Tataren im sibirischen Tjumenwieder eine Moschee errichtet. Nur wenig später, im Dezember
227
1989, meldeten sich die Dolganen, Nenzen, Ngasanen und En-zen, also die arktischen Völker der Russischen Föderation, zuWort. Von der Öffentlichkeit weitgehend vergessen, litten sieunter der industriellen Entwicklung und der Ausbeutung derBodenschätze, wodurch ihre Existenzgrundlage für Rentierzuchtund Fischfang gefährdet war. Ethnologen befürchten sogar dasbaldige Aussterben von Sprache und Kultur dieser Völker. ImApril 1990 schlossen sich die kleinen Völker des russischen Nor-dens in einer Assoziation zusammen. Im selben Jahr beganneneinzelne Völker innerhalb der Russischen Föderation bereits ihreSouveränitätsansprüche zu formulieren. Sie wollten einer Neu-ordnung der Sowjetunion unter russischem Einfluss zuvorkom-men.
Im Frühjahr 1990 brach der Nationalitätenkonflikt in der Au-tonomen Republik der Tschetschenen und Inguschen aus, die imNordkauskasus liegt und ebenfalls zur Russischen Föderationgehört. Die Inguschen forderten eine eigene Autonomie als Wie-dergutmachung für die Stalinzeit, während der sie zwischenzeit-lich deportiert worden waren. Nach ihrer Rückkehr 1957 warenjedoch zahlreiche Dörfer der Inguschen der NordossetischenAutonomen Republik zugeordnet. Die Südosseten hingegen,deren Region der Georgischen Republik untersteht, wollen dieVereinigung mit den Nordosseten und somit eine administrativeAngliederung an die Russische Föderation. Deutlich antirussi-sche Tendenzen wies ein Konflikt im August 1990 innerhalb derRussischen Föderation auf, der im Ausland jedoch fast über-haupt nicht beachtet wurde. In der Autonomen Republik Tuwain Südwestsibirien an der Grenze zur Mongolei mussten Tausen-de von Russen die Flucht ergreifen, weil sich die Titularnationder Tuwinen, die in buddhistisch-lamaistischer Tradition stehen,in Pogromstimmung gegen die angesiedelten Russen erhobenhatten.
Nur wenige Tage nach diesen Unruhen beanspruchte Kare-lien als erste Autonome Republik innerhalb der Russischen Fö-deration den Status eines „souveränen, demokratischen Rechst-staates“. Die Autonome Republik Komi im Einzugsgebiet desWestural ging entschieden weiter. Die Republik strich den Be-
228
griff „Autonom“ mit der Begründung, dieser Zusatz „schränktdie Rechte des auf ihrem Territorium lebenden Volkes ein undversetzt es - im Vergleich zu anderen Staatsgebilden - in einenicht gleichberechtigte Lage“. Bei der Welle von Souveränitäts-erklärungen, die bereits 1990 die Sowjetunion überrollte, verlang-ten die Unionsrepubliken wie Estland oder die Ukraine den Vor-rang ihrer Gesetze vor denen der Sowjetunion. Innerhalb Russ-lands aber wurde es noch komplizierter, weil nun die nicht-russischen Völker Gesetzesvorrang sowohl vor den Gesetzen derRussischen Föderation als auch vor den Gesetzen der gesamtenSowjetunion beanspruchten. Die Tatarische Autonome Republikging sogar in ihrer Erklärung noch einen Schritt weiter. Im Au-gust 1990 trennte sie sich nominell von der Russischen Föderati-on, um bei künftigen Verhandlungen mit den übrigen Sowjetre-publiken staatsrechtlich auf einer Stufe zu stehen.
Die nationale Vielfalt der größten und zentralsten Republik,der Russischen Föderation, - mit 17 Millionen Quadratkilome-tern im Ausmaß von Südamerika - illustrierte mit den Souveräni-tätsansprüchen der kleineren Völker die besondere Herausforde-rung Russlands für eine Neuordnung der Sowjetunion. Hierinliegt auch der Grund, weshalb Boris Jelzin entgegen seiner politi-schen Überzeugung dem bereits angeschlagenen sowjetischenPräsidenten Gorbatschow im November 1990 eine „Koalitions-regierung der nationalen Einheit“ angeboten hatte. Damals hätteGorbatschow eine Chance ergreifen können, um die Perestrojkaebenso wie die Sowjetunion zu erhalten. Stattdessen schwenkteGorbatschow in das Lager der konservativen Kräfte in derKPdSU über und legte den Grundstein für den späteren Putschmit seinen unerwarteten Folgen. Noch einmal im April 1991hatte Jelzin einen Kompromiss mit Gorbatschow gesucht, umeinen Unionsvertrag zu realisieren. Denn der russische Präsidentwar an einer Befriedung der nationalen Lage ebenso interessiertwie Gorbatschow, um die Russische Föderation vor innerenAuseinandersetzungen zu bewahren.
Es ist bemerkenswert, dass Konflikte der nicht-russischenVölker untereinander im Ausland mehr Aufsehen erregten alsder Protest nicht-russischer Völker gegen die Russen. Die Ursa-
229
che dafür mag in der historischen Entwicklung des Vielvölker-staates liegen. Die Russen als historisch expansive und kolonisa-torische Kraft leiden bis heute unter dem unionsweiten Klischeeder Fremdherrscher. Die Russifizierungspolitik der Stalinzeitverstärkte die Ablehnung der nicht-russischen Völker. Eine anti-russische Haltung im Kampf um die nationale Identität galt da-her zwangsläufig als legitim. Dabei wurde aber übersehen, dassauch die Russen in der Sowjetunion ihren Weg aus der Sowjeti-sierung heraus zu einem neuen nationalen Selbstwertgefühl su-chen.
Diese Entwicklung verläuft nicht ohne nationalistische Ext-reme wie die Herausbildung der Pamjat-Bewegung, die den Anti-semitismus und die Fremdenfeindlichkeit wiederbelebte. AuchPanslawisten orthodoxer Prägung und Monarchisten werben fürihre Sichtweise einer nationalen Wiedergeburt. Für sie alle giltder Satz, Russland sei in der Sowjetunion aufgegangen. Im Über-schwang patriotischer Gefühle bekennen sich aber auch immergrößere Teile der jungen Generation zu dieser nationalen Wie-dergeburt. Noch problematischer kann die Auseinandersetzungin den bisherigen zentralasiatischen Republiken der Sowjetunionwerden. Denn die Grenzziehungen entsprechen hier dem kolo-nialen Interesse der Stalinzeit, in der versucht wurde, möglichepantürkische Bewegungen durch Zergliederung kulturhistorischgewachsener Regionen zu verhindern. So wurde das alte KhanatChiwa 1920 zunächst in die Volksrepublik Choresm umgewan-delt, blieb jedoch in seinem Bestand weitgehend erhalten. VierJahre später wurde Choresm zerschlagen und auf die RepublikenUsbekistan, Turkmenien sowie die Autonome Republik Karakal-pakien aufgeteilt.
Inzwischen lässt sich auf dem Territorium der früheren Kha-nate und Emirate Zentralasiens eine Renaissance alter Zugehö-rigkeitsgefühle beobachten, die bald in politische Aktion um-schlagen können. Auch die Propagierung der Wiedereinführungder arabischen Schrift, die von der Sowjetmacht erst durch dielateinische (1926) und dann durch die kyrillische Schrift (1937)abgelöst worden war, ist ein Signal für die Suche nach der altenIdentität. Von radikaler Abgrenzung scheint die augenblickliche
230
Politik Georgiens bestimmt zu sein. Die Demokratisierung hatzu einem national-autoritären Umgang mit der Macht verführt,die zurzeit kaum noch mit einem neu geformten Staatenbund inEinklang zu bringen ist. Problematisch erscheint auch die Lageder - nach Armenien - zweitkleinsten Republik, Moldawien. DieRückbesinnung auf das rumänische Erbe, die Übernahme derrumänischen Staatsfahne und die Anschlussforderungen desehemaligen Bessarabien an Rumänien missachten andere Min-derheiten wie die Gagausen.
Das christianisierte Turkvolk der Gagausen, deren Schrift-sprache erst seit dreieinhalb Jahrzehnten systematisch entwickeltwurde, will sich nicht der moldawischen Titularnation unterord-nen. Bei der künftigen Neuordnung der bisherigen Sowjetunionwird daher ein altes, bisher ungelöstes Problem erneut belebt: dieFrage nach dem Verhältnis zwischen den so genannten nationa-len Minderheiten und den Titularnationen der neuen Einzelstaa-ten. „Bestimmt die Größe eines Volkes das Ausmaß seiner Rech-te?“ lautete eine Frage, die in den letzten Jahren theoretisch vomKongress der Volksdeputierten der Sowjetunion erörtert wurde.Jetzt muss die Praxis beweisen, dass das Selbstbestimmungsrechtunteilbar ist. Sonst würde nach dem zweiten Zerfall des Imperi-ums wieder der Zugriff des Stärkeren auf den Schwächeren dro-hen.
231
SIGNALE NACH AUSSEN
DAS ENDE EINES TABUSDie deutsche Nation wird als Einheit anerkannt101
In einem umfangreichen Artikel hat die Literaturnaja Gasjetaim Juli 1988 in Abrede gestellt, dass sich in der DDR und in derBundesrepublik jeweils eine selbständige deutsche Nation entwi-ckelt habe. Unter dem Titel „Die Deutschen und wir“ spürt derVerfasser, Leonid Potschiwalow, zunächst den historischen Ge-meinsamkeiten beider Völker, der Russen und der Deutschen,nach, ehe er die klare Schlussfolgerung trifft, dass in der DDR,der Bundesrepublik und Westberlin keine jeweils eigenen Natio-nalitäten lebten. „Es gibt ja nur Deutsche“, meint der Autor, derauch für die Entwicklung eines staatenspezifischen Nationalitä-tenbegriffes wegen der kurzen historischen Frist seit der TeilungDeutschlands keinen Raum sieht. Dann wird in dem Beitrag dieForderung erhoben, nicht vor der Benutzung des Begriffes„deutsch“ zurückzuschrecken, nur weil man mit diesem „verei-nigenden Wort“ glaube, irgendwelchen Revanchisten entgegen-zukommen, die von einem einheitlichen Deutschland träumten.
Der Autor kritisiert den Konservativismus auf eigener Seite,der „uns fesselt und daran hindert, die Welt mit offenen Augenzu sehen“. Schließlich seien die Deutschen gleicher Herkunft,hätten eine Jahrhunderte lange Vergangenheit und auch einegemeinsame Verantwortung für den letzten Krieg. Die Existenzvon zwei deutschen Staaten mit einer unterschiedlichen sozialpo-litischen Ordnung ist für den Verfasser eine Tatsache, welche die
101 Dies war offiziell eine Minderheitenstimme, die eine künftige EinheitDeutschlands offenließ. Immer wieder wurde ich in Diskussionen verwi-ckelt u. a. von Vertreten des Außenministeriums und Deutschlandexpertendes KGB, die mich „mahnten“, als Deutscher niemals das Ziel der Deut-schen Einheit aufzugeben! Erstveröffentlichung: Ein Sowjetkommentatorüber die deutsche Nation. Anerkennung der Einheit. In: Neue ZürcherZeitung, Nr. 175, 30. Juli 1988.
232
Stabilität des „gemeinsamen europäischen Hauses“ gewährleistet.Gleichzeitig aber mahnt er, dass „ohne das Ansehen der
Bundesrepublik und ohne Verbesserung der Beziehungen zwi-schen der Bundesrepublik und der Sowjetunion der Frieden inEuropa undenkbar“ sei. Aus diesem Grund fordert er seineLandsleute auf, „alles Deutsche zu berücksichtigen“, Vergangen-heit und Gegenwart wie auch die spezifisch deutsche Psycholo-gie, „zum Beispiel das krankhafte Verantwortungsgefühl und diebittere Erinnerung an die verloren gegangene Einheit der Terri-torien, die Jahrhunderte lang als deutsch gegolten haben“. DieseAspekte bezeichnet der Autor selbst als „delikat“. Schon Monatevor diesem Beitrag hatte eine andere Wochenzeitung, die sichstärker an das Ausland richtet, die Moskowskije Nowosti, einenausführlichen Beitrag über das deutsche Kulturerbe in Kali-ningrad, dem früheren Königsberg, veröffentlicht. Ferner hattenDeutschland-Experten in ihren Kommentaren vermehrt daraufhingewiesen, dass die Frage nach der deutschen Nation undderen äußerer Form erst von der Geschichte endgültig beantwor-tet werden könne.
233
POLITIK DER NADELSTICHEDiplomatenkrieg Moskau und Washington102
Die Sowjetregierung hat im west-östlichen Diplomatenkriegden Nerv des Gegners getroffen. Durch den erzwungenen Ab-zug von über zweihundert sowjetischen Mitarbeitern aus ameri-kanischen Diplomatenfamilien ist nicht nur die Arbeit der US-Vertretung in Moskau in arge Bedrängnis geraten. Auch „TheAmerican way of life“ der westlichen Diplomaten in der sowjeti-schen Hauptstadt ist in Gefahr. Denn mit Hilfe von Sowjetbür-gern war es den meisten amerikanischen Botschaftsfamiliengelungen, sich in insularer Abschottung den Widrigkeiten desMoskauer Alltags zu entziehen.
So ist nun das stadtweite amerikanische Dienstleistungsnetzzusammengebrochen, die „General Service Organisation“. MitHilfe von GSO ließen sich durchschmorte Stromkabel, hinfälligeKühlschränke oder marode Autos reparieren. Die dienstbarenRussen, die solches mit flinker Hand bewerkstelligten, sind nunentschwunden.
So amüsant auf den ersten Blick natürlich das Bild der Besenschwingenden Diplomatengattin auch sein mag, die tragikomi-sche Seite dieses Diplomatenkrieges spielt sich in den häuslichenWänden der betroffenen Familien ab. Die wenigen Kontakte zuSowjetbürgern, die zum Beispiel als viel begehrte Kindermäd-chen zu den Amerikanern ins Haus kamen, sind abgerissen.
Damit wird es für viele Amerikaner wieder leichter werden,mitten in der Sowjetunion die Russen schlechthin für bedrohli-che Wesen zu halten.
Traurig machen auch die angstvollen Klagen derjenigen Dip-lomatengattinnen, die sich zum ersten Mal gezwungen sehen,sowjetische Milch zu trinken und sowjetische Eier zu braten.
102 Der Diplomatenkrieg, dem auch noch eine britisch-sowjetische Variantefolgt, wurde als Störmanöver des „Apparates“ verstanden, um die Glaub-würdigkeit des Neuen Denkens in der Außenpolitik zu diskreditieren. Erst-veröffentlichung: Ohne helfenden Hände. In: DIE ZEIT, Nr. 45, 31. Ok-tober 1986.
234
Bislang nämlich wurden die Botschaftsangehörigen über Eisen-bahncontainer mit frischer Ware aus Finnland versorgt. Und fürAbwicklung, Transport und Verteilung dieser Aufträge warenebenfalls die entlassenen Russen zuständig.
235
„DER REAGAN IST DOCH GEKAUFT“Enttäuschung der Russen
über das Gipfeltreffen in Reykjavik103
Mit verhaltenem Zorn empörte sich in der Moskauer Innen-stadt eine etwa fünfzigjährige Frau. Bis tief in die Nacht hat siedie Live-Übertragung der Pressekonferenz von Parteichef Gor-batschow aus Reykjavik verfolgt: „Der erste Eindruck zeigtedoch schon“, meinte sie mit fast bebender Stimme, „wie aufge-regt Gorbatschow war, dass er sich kaum beruhigen konnte, wieReagan mit ihm umgesprungen ist. Wir waren doch alle über-zeugt, die würden wenigstens einen Vertrag schließen. Aberschauen Sie selbst, wie die andere Seite mit Gorbatschow um-geht.“ Ein alter Mann hörte angespannt zu, dann platzt er her-aus: „Ich glaube, dass der Reagan völlig gekauft ist. Der arbeitetdoch nur noch für die Monopole und will uns nicht hochkom-men lassen. Solange der nicht von der Bühne abtritt, gibt eskeine Verbesserungen.“
Auch sowjetische Jugendliche zeigten sich engagiert. EinNeunzehnjähriger mit dem Anflug einer Punkerfrisur und einemgoldenen Ring im linken Ohr gibt sich entschieden: „Jetzt hatReagan überzogen.“
Die Menschen auf der Straße gingen nach dem gescheitertenGipfel noch einen Schritt weiter, als es die Sprachregelung in densowjetischen Medien vorsah. Für das offizielle Moskau sind diemilitärindustriellen Kreise der USA das entscheidende Hindernisauf dem Weg zu einem Abrüstungsabkommen großen Stils;persönlichen Attacken auf Präsident Reagan wurde kein Vor-schub geleistet. Deshalb nahm sich auch die Volksstimmung, die
103 Die Gipfelpolitik zwischen Moskau und Washington wurde zunächstvon Enttäuschung begleitet, bis es zu einer „politischen Freundschaft“zwischen Reagan und Gorbatschow kam, die in einer nachhaltigen Unter-stützung der USA für den sowjetischen Reformkurs mündete. Erstveröf-fentlichung: „Reagan ist doch gekauft" Wie die Menschen in der Sowjetuni-on auf Reykjavik reagierten. In: DIE ZEIT, Nr. 43, 17. Oktober 1987.
236
vom sowjetischen Fernsehen verbreitet wurde, deutlich gemäßig-ter aus, als es die Leute im Gespräch mit dem Ausländer waren.
Obwohl die Sowjetunion bereits vor dem Treffen von Reyk-javik im eigenen Land keine allzu großen Hoffnungen schürenwollte, war klar, dass es um mehr als nur um Abrüstungsab-kommen ging. Wie ein roter Faden zog sich durch die Vorweg-und Begleitkommentare das Argument, Moskau brauche einenRüstungsstopp, um dringend benötigte Gelder für die ehrgeizi-gen Pläne einer wirtschaftlichen Neugestaltung freizusetzen.Natürlich ist der Wunsch der Sowjetmenschen nach einem fried-lichen Zusammenleben so groß, wie die Propaganda behauptet.Diese Hoffnungen sind vorerst zerstoben.
Dass selbst von offizieller Seite nicht ein Scheitern der Ge-spräche erwartet worden war, zeigten die sowjetischen Zeitungenam Tag nach dem Island-Gipfel. Zum Abschluss der Gesprächehatten alle überregionalen Blätter die Anweisung, das Bild derbeiden freundlich lächelnden Gesprächspartner auf den Titelsei-ten zu veröffentlichen. Der frühe Redaktionsschluss ließ keineKorrektur mehr zu. Nach dem abrupten Ende der vierten Ge-sprächsrunde gelang es nur noch dem Parteiblatt Prawda dasHoffnung verheißende Bild wieder aus dem Druck herauszu-nehmen, um in dürren Worten die Beendigung der Gespräche zumelden.
Die allgemeine Sprachlosigkeit der sowjetischen Kommenta-toren nach Reykjavik wurde von den Medien dann auf wirkungs-volle Weise überwunden. Sie wiederholten schlicht die diploma-tisch geschickte Pressekonferenz von Gorbatschow in Funk undFernsehen und die Zeitungen druckten sie nach.
237
DIE ASIATISCHE KARTEGorbatschows symbolischer Besuch in Wladiwostok104
Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat einen Besuch inWladiwostok, der fernöstlichen Hafenstadt der Sowjetunion,zum Anlass genommen, um neue Initiativen in der sowjetischenAsienpolitik zu ergreifen. Dabei geht es ihm kurzfristig um eineVerbesserung der bilateralen Beziehungen vor allem zu China.
Langfristig strebt die Sowjetunion, so ist aus GorbatschowsRede in Wladiwostok zu schließen, eine Konferenz der Anrai-nerstaaten des Stillen Ozeans an, die, ähnlich der KSZE-Konferenz von Helsinki, den regionalen Fragen der Sicherheitund Zusammenarbeit gewidmet sein soll. Als möglichen Ta-gungsort schlug Gorbatschow die japanische Stadt Hiroshimavor. Als eindeutige Geste gegenüber China, einem der schärfstenKritiker der sowjetischen Afghanistanpolitik unter den kommu-nistischen Ländern, ist das Angebot für einen Teilabzug sowjeti-scher Truppen aus Afghanistan zu sehen. Insgesamt sechs Regi-menter - ein Panzerregiment, zwei Schützenpanzer- und dreiLuftabwehrregimenter - sollen bis Jahresende den Kriegsschau-platz verlassen und in ihre ursprünglichen Stationierungsorteinnerhalb der Sowjetunion zurückverlegt werden.
Gleichzeitig will Gorbatschow, wie er weiter ausführte, mitdieser Maßnahme eine politische Lösung der Afghanistanfragebeschleunigen. Nach traditioneller Moskauer Lesart würde einesolche Idee eine Nichteinmischungsgarantie durch mehrere Sig-natarmächte, darunter die USA, sowie die internationale Aner-
104 Gorbatschow bereitete die Stadt und die Region des Fernen Osten, aberauch die internationale Öffentlichkeit auf die Öffnung der bislang „verbo-tenen“ Stadt Wladiwostok vor. Dabei wirbt für eine politische OffensiveRichtung China. Jahre später - nämlich 1989 - mündete diese Politik in derersten Chinareise eines sowjetischen Staats- und Parteichefs seit dem Bruchzwischen Moskau und Peking unter Chruschtschow. Erstveröffentlichung:Sowjetische Avancen gegenüber China. Gorbatschew für Pazifik-Anrainer-Konferenz Teilabzug aus Afghanistan angekündigt. In: Neue ZürcherZeitung, Fernausgabe Nr. 173, 30. Juli 1986.
238
kennung des bestehenden politischen Regimes in Kabul bedeu-ten. Sobald eine politische Lösung erarbeitet worden sei, könne,so sagte Gorbatschow, „die Rückführung aller sowjetischenTruppen aus Afghanistan entsprechend beschleunigt werden“.Ferner erklärte der Generalsekretär, mit der afghanischen Seiteseien bereits „Termine für eine schrittweise Rückführung derTruppen vereinbart“ worden. Gleichzeitig warnte Gorbatschowjedoch die Weltöffentlichkeit vor den Folgen „fortdauernderIntervention“.
Die Sowjetunion werde ihren Nachbarn nicht im Stich lassen.Für das Verhältnis zur Volksrepublik China sind jedoch nochweitere Einzelheiten aus der Rede in Wladiwostok von besonde-rer Wichtigkeit: So signalisierte Gorbatschow auch Verhandlun-gen mit der zwischen den beiden Ländern liegenden Mongoleiüber die „Frage des Abzugs eines bedeutenden Teils“ der dortstationierten sowjetischen Truppen. Die Präsenz dieser Kontin-gente war von Peking stets als Bedrohung der eigenen Sicherheitbezeichnet worden. Hinsichtlich des dritten Punktes ständigwiederholter Kritik Chinas an der sowjetischen Außenpolitik -nämlich des vietnamesischen Engagements in Kambodscha mitfinanzieller und militärischer Unterstützung Moskaus - verwiesGorbatschow lediglich darauf, dass China und Vietnam ihreKonfliktpunkte im Rahmen bilateraler Beziehungen regeln müss-ten.
Gorbatschow bot der Volksrepublik China außerdem ver-stärkte Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und wissenschaft-lich-technischen Bereich an. Er nannte dabei die Weltraumfor-schung und die Bildung. Derzeit werde, so sagt der Parteichef, aneinem Abkommen über die gemeinsame Nutzung des Amurgearbeitet.
Die Grenzziehung auf diesem Fluss war wiederholt Anlassfür heftige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ländern.Ferner sprach Gorbatschow vom Bau einer Eisenbahnverbin-dung zwischen den Grenzregionen der Sowjetunion und Chinas.Die Grenze, die beiden Länder laut Gorbatschow trennt, solle inZukunft zum Gürtel der Freundschaft werden. Neben eindeuti-gen Avancen gegenüber dem kommunistischen Nachbarland
239
legte Gorbatschow ein Fünf-Punkte-Programm vor, das seinerMeinung nach der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raumdienlich sein könne. Dazu zählt der Generalsekretär zunächsteinmal die Lösung von Problemen in der Beziehung zwischenden ASEAN-Staaten und Indochina.
Zweitens plädiert er für ein Verbot von Atomwaffen in dieserRegion. Drittens befürwortet er Verhandlungen über den Abbauvon Flottenverbänden, insbesondere von Schiffen mit Atomwaf-fen. Viertens plädiert Gorbatschow auch im asiatischen Raumparallel zu den Vorschlägen für Europa für eine radikale Redu-zierung der Bestände an konventionellen Waffen, und fünftensschlägt er eine Regionalkonferenz vor, die „sicherheitsbildendeMaßnahmen für die Seewege im Pazifik“ sowie die „Unterbin-dung des internationalen Terrorismus“ zum Gegenstand habensoll. Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag für eine begrenz-te Regionalkonferenz machte Gorbatschow die von seinen Zu-hörern in Wladiwostok am meisten beklatschte Äußerung.Da nach seiner Ansicht eine solche Regionalkonferenz in einersowjetischen Küstenstadt abgehalten werden könne, sei im Laufeder Zeit auch die Frage der Freigabe von Wladiwostok für denBesuch durch Ausländer zu lösen. Bisher ist diese Hafenstadt fürfremde Besucher geschlossen. Beinahe symbolisch für die neuenAsien-Initiativen des Generalsekretärs ist es daher zu verstehen,wenn er sagt, er möchte Wladiwostok „als unser zum Osten weitgeöffnetes Fenster“ sehen.
Nur am Rande bezog Gorbatschow Stellung zum sowjetisch-amerikanischen Verhältnis. Er sparte nicht mit Angriffen auf„den Imperialismus“. Während seines Aufenthaltes in Wladiwos-tok war Gorbatschow mit dem Inhalt des jüngsten Briefes vonPräsident Reagan vertraut gemacht worden. Er sagte eine Prü-fung „mit Verantwortung und Aufmerksamkeit“ zu. Eine Ant-wort machte Gorbatschow jedoch davon abhängig, wieweit dieUSA mit ihren jüngsten Vorschlägen dem „Prinzip der gleichenSicherheit“ entsprächen und gemeinsame Lösungen zuließen fürdie „Einstellung des Wettrüstens und die Verhinderung seinerAusdehnung auf den Weltraum“. Erneut sprach sich der Gene-ralsekretär dabei für ein weiteres Gipfeltreffen mit dem amerika-
240
nischen Präsidenten aus. Er sagte, ein solches Treffen müssedazu dienen, „auf eine Gesundung der internationalen Lagehinzuarbeiten“ sowie den „Verlauf der Verhandlungen über dieReduzierung der Rüstung zu beschleunigen“.
241
AFGHANISTANWann ziehen die Sowjets ab?105
In der Steinbrücken-Moschee von Kabul unterwirft sich derstarke Mann Afghanistans, Nadschibullah, vor den Augen derÖffentlichkeit den Gesetzen der Religion. Es ist Freitagnachmit-tag, der Muezzin hat zum Gebet gerufen. In einem gepanzertenMercedes ist Nadschibullah dem Ruf Allahs gefolgt. Mit Hilfe -und auf Druck - Moskaus muss Nadschibullah zunächst nocheinen Zweifrontenkampf führen, um dem Land und seiner Parteiwenigstens eine Überlebenschance zu verschaffen. In der erstenReihe der Gläubigen beugt er seinen massigen Körper demütigauf den Boden hinunter, erhebt die Hände zum Gebet, korres-pondiert im Wechselgesang mit dem Imam und empfiehlt sich soTausenden von Zeugen als wahrer, nämlich gläubiger Afghane.
Politisch wirbt Nadschibullah dagegen um nationale Aussöh-nung, um Kompromisse und Koalitionen. Er beschwört dieUnabhängigkeit und das Ansehen der islamischen Geistlichkeit,beginnt seine Reden stets im Namen des allmächtigen Gottes. Erweiß wohl, dass es für einen Kompromiss mit den Regimegeg-nern fast schon zu spät ist. Wie sein Vorbild Gorbatschow über-nimmt Nadschibullah nicht nur dessen Forderung nach einemneuen politischen Denken. Ähnlich dem Prozess der Perestrojkahat er den verzweifelten Versuch einer totalen Wende unter-nommen, um im Lager der unzufriedenen, kriegsmüden undsozialismusfeindlichen Afghanen neue Verbündete zu finden.Eine Volksversammlung, die Loya Jirga, deren repräsentativerCharakter für Außenstehende kaum zu durchschauen ist, hat eineneue Verfassung verabschiedet, mit der die VolksdemokratenNadschibullahs ihre Alleinherrschaft aufgeben und sich von allen
105 Die ersten Anzeichen für eine bevorstehende Entscheidung zum Abzugaus Afghanistan lösten große Hoffnungen aus, nachdem der Krieg jahrelangdas soziale Gefüge des Landes und seine außenpolitischen Beziehungenschwer belastet hat. Erstveröffentlichung: Afghanistan: Wann ziehen dieSowjets ab? Neue Ankündigungen des neuen Präsidenten. In: DIE ZEIT,Nr. 50, 4. Dezember 1987.
242
Symbolen trennen, die mit der April-Revolution 1978 als Zei-chen eines „afghanischen Sozialismus“ geschaffen wurden: DasEinparteien-System ist wieder abgeschafft, vier neue Parteien,darunter eine islamische, sind gegründet worden. Der Islam wirdin Artikel zwei der Verfassung als Grundlage des afghanischenVolkes definiert. Hammer und Sichel wie der rote Stern werdenaus dem Staatswappen verbannt. Die bislang „demokratischeRepublik“ erhält den unverfänglicheren Namen „Republik Af-ghanistan“. Privatwirtschaft und Landbesitz der Bauern undanderer Landeigner stehen unter dem besonderen Schutz derVerfassung.
Schließlich erklärte Nadschibullah nach seiner Wahl zumneuen Staatspräsidenten den fast zweitausend Abgeordneten inblumiger Sprache, er verzichte auf die Anrede „Genosse, weil„unser Volk andere Wörter benutzen kann, die der Kultur undunserem Land eigen sind“. Nadschibullah wird mit seiner volks-demokratischen Partei die führende Rolle im Land nicht aufge-ben. Trotz seines Werbens um die Opposition und einer Gene-ralamnestie als erster Amtshandlung muss sich Nadschibullaherst noch als Präsident „aller Afghanen“ bewähren. Doch Mos-kaus Handschrift wird auch jetzt bereits deutlich. Denn ohneden Auftrag des Kremls hätte Nadschibullah in seiner erstenRede als Präsident nicht Vorschläge zum sowjetischen Truppen-abzug unterbreiten können, die eigentlich beim Gipfel inWashington entschieden werden müssten: Nach einer politischenEinigung sollen die sowjetischen Truppen innerhalb von zwölfMonaten (bisheriger Vorschlag: sechzehn Monate) aus Afghanis-tan abziehen. Kabul verlängert den Mitte Januar auslaufendeneinseitigen Waffenstillstand um weitere sechs Monate. Bei einemsofortigen Waffenstillstand der Mudschaheddin kann der Zeit-raum für den sowjetischen Truppenabzug noch einmal verkürztwerden. Die kämpfenden Führer der 17 (von 29) afghanischenProvinzen, in denen sowjetische Truppen stehen, werden „unge-achtet ihrer politischen Zukunftsvorstellungen“ zur Teilnahmean der Macht eingeladen. Nadschibullah garantiert den soforti-gen Abzug der Truppen aus jenen Provinzen, die den Wider-stand einstellen.
243
TRUPPENABZUG IN ZWÖLF MONATENEin Ende des Afghanistaneinsatzes ist in Sicht106
Der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse leite-te mit seinem ersten Auslandsbesuch in diesem Jahr in Kabuleine neue Phase der Beziehungen zwischen beiden Ländern ein.Die militärische Unterstützung der Regierung in Kabul solldurch ein breit angelegtes wirtschaftliches Hilfsprogramm abge-löst werden. Sowjetbürger werden von den Massenmedien da-rauf vorbereitet, dass man nun Sorge tragen müsse für einigeMillionen heimkehrender Flüchtlinge. Ein sowjetischer Kom-mentator stellte die rhetorische Frage: „Warum sollten wir nichteinem Land unsere helfende Hand reichen, dessen Erde getränktist von dem Blut sowjetischer Soldaten?“ Nach den jüngstenVorstellungen Moskaus sollte „1988 das letzte Jahr sein, in demsich sowjetische Truppen in Afghanistan aufhalten“. Nach sei-nem Besuch in Kabul nannte Außenminister Schewardnadse eine„realistische Analyse der Lage in und um Afghanistan“ als Aus-gangspunkt der jüngsten Betrachtungen. Beim afghanischenStaatspräsidenten Nadschibullah hat er konkrete Ergebnisse derPolitik der nationalen Versöhnung angemahnt. Kabul soll sicherfolgreicher um den Dialog mit den oppositionellen Gruppenbemühen.
Bevor Moskau einen Truppenabzug beginnen kann, muss diejetzige Regierung nicht nur militärisch durch den Aufbau einereigenen Armee, sondern auch politisch durch eine breitere Un-terstützung der Bevölkerung stabilisiert werden. Nach sowjeti-scher Lesart darf in Zukunft niemand ein Machtmonopol inAfghanistan beanspruchen. Mit dieser Festschreibung wird be-reits Vorarbeit geleistet für die Stunde X. Moskau hat erkennenmüssen, dass die jetzige Regierung nach einem möglichen Trup-
106 Erstmals wurden konkrete Daten genannt, mit denen sich Moskau aufden Beginn des Abzugs aus Afghanistan festlegte. Erstveröffentlichung:Afghanistan: Sowjetischer Truppenabzug in Sicht. In: DIE ZEIT, Nr. 3, 15.Januar 1988.
244
penabzug gefährdet ist. Daher will man nun Wege ebnen, dieihre Beteiligung an der Macht nach dem Truppenabzug sicher-stellen. Aus diesem Grunde verbreitete Schewardnadse vor dernächsten Verhandlungsrunde in Genf Zweckoptimismus: Erdeutete an, dass sich die USA und die Sowjetunion über ihreRolle als Garantiemächte einig seien, folglich werden die USAeine Einmischung von außen unterbinden. Nach Moskauer Ver-ständnis bedeutet dies: Washington muss seine Waffenlieferun-gen an die Regimegegner unmittelbar nach Unterzeichnung einesAbkommens beenden. Die Parteizeitung Prawda erläuterte bereitseinen möglichen Zeitplan: Sollte in Genf am 1. März eine Ver-einbarung über Afghanistan zustande kommen, dann beginnesechzig Tage später, also am 1. Mai 1988, der Abzug der sowjeti-schen Truppen. Als Antwort auf amerikanische Vorbehalte ar-gumentierte die Prawda: „Die Schwierigkeit ist also nicht dasDatum für einen Truppenabzug, sondern das Datum für denStopp der amerikanischen Hilfe an die Duschmanen.“
Die im Februar in Genf beginnende Runde der indirektenGespräche zwischen Afghanistan und Pakistan kann nach An-sicht Moskaus die Entscheidung bringen.
Nach Aussage eines hohen Beamten im sowjetischen Au-ßenministerium sind die Dokumente „im wesentlichen fertig“.Moskau beharrt allerdings darauf, dass in der sechzigtägigen Fristzwischen Unterschrift und Beginn des Abzuges die militärischenOperationsbasen der Regimegegner in Pakistan beseitigt werdenmüssen.
Als zeitliches Limit für den Truppenabzug wurden zwölfMonate genannt. Es könnte bei einem dauerhaften Waffenstill-stand aber erheblich verkürzt werden. Mit dieser Regelung kannnach Darstellung amtlicher Sprecher „ein Grundmodell zur Bei-legung von Konflikten in anderen Regionen“ geschaffen werden.Die Tatsache, dass der amerikanische Außenminister Shultz dieEinstellung der Militärhilfe erst dann in Aussicht stellte, wennder Truppenabzug unwiderruflich feststeht, konnte den Opti-mismus in Moskau nicht dämpfen.
245
DAS ENDE DES SYSTEMS
ERNEUERER UND ZAUDERERDas politische Ende von Michail Gorbatschow107
Die Bedeutung der Reformpolitik, die Michail Gorbatschoweingeleitet hat, ist nur aus dem Rückblick heraus zu verstehen.Als Breschnew 1982 starb, so zeigen die Analysen, war die Sow-jetunion bereits wirtschaftlich und sozial ruiniert. Die Interims-phase unter den Partei- und Staatschefs Jurij Andropow, gestor-ben 1984, und Konstantin Tschernenko, gestorben 1985, hatnoch einmal den Streit zwischen zwei - freilich erfolglosen -Konzeptionen für die weitere Entwicklung der Sowjetuniondemonstriert. Andropow sah im Marxismus eine entwicklungs-fähige Grundlage zur Veränderung innergesellschaftlicher Ver-hältnisse und begründete damit seine Forderungen nach einerReformpolitik. Sein Nachfolger Tschernenko versteifte sichdagegen noch einmal auf den Standpunkt der Breschnew-Zeit,dass die Sowjetunion mit dem Marxismus-Leninismus bereits allenotwendigen Mittel und Methoden zum Aufbau des Sozialismusbesitze und sie nur weiter aktivieren müsse. Doch beide Konzep-te wurden von den Ereignissen überholt. Michail Gorbatschowdefinierte zwar als Ausgangspunkt seiner Reformpolitik eineBeschleunigung und Intensivierung der wirtschaftlichen Ent-wicklung. Aber diese Politik mündete in einer Reform des politi-schen Systems, die das Ende des kommunistischen Machtmono-
107 Der Putsch gegen Gorbatschow zeigte sich für die konservativen Kreiseals konsequente Folge seiner inkonsequenten Politik. Obwohl Gorbatschownoch einmal kurz in sein Amt zurückkehren konnte, wurde er von seinemfrüheren Parteigänger und späteren politischen Gegner Jelzin verdrängt.Erstveröffentlichung: Erneuerer und Zauderer. Der sowjetische Staatsprä-sident Gorbatschow macht einen großen Fehler: Er lehnte das Alte ab,ohne das Neue richtig zu wagen. Und er verließ sich zulange auf seinentaktischen Instinkt – der den Putschversuch nicht verhindern konnte. In:Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nr. 34, 23. August 1991.
246
pols herbeiführte. Als Michail Gorbatschow im Dezember 1984,wenige Monate vor seiner Wahl zum Generalsekretär, auf einemIdeologie-Plenum eine Rede hielt, zeigten sich alt gediente Par-teikader unangenehm überrascht. Diese Rede enthielt nicht mehrdie traditionelle Rhetorik des Klassenkampfes. Er forderte denanalytischen Sachverstand der Wirtschaftswissenschaftler undSoziologen an. Damals ahnte die sowjetische Öffentlichkeit be-reits, dass sich der künftige Generalsekretär auf Reformkräftestützen würde, die in Akademgorodok, der sibirischen Zweigstel-le der Akademie der Wissenschaften, den Stillstand während derBreschnew-Zeit genutzt hatten, um Konzepte gegen den Nie-dergang der Sowjetunion zu entwickeln. Den Vorrang pragmati-scher Ideen vor der Ideologie des Kommunismus formulierteGorbatschow bereits im April 1985, einen Monat nachdem erdas Amt des Generalsekretärs übernommen hatte: „Die poli-tisch-ideologische Erziehung muss in allen Formen der Haupt-aufgabe unserer Tage, der Beschleunigung der sozialökonomi-schen Entwicklung unseres Landes, untergeordnet sein.“ DieIdeologie also muss der Gesellschaft untergeordnet werden undnicht umgekehrt. Damit, so argumentierten damals Reformkräfteder Partei, habe sich Gorbatschow angeschickt, Lenin vom Kopfauf die Füße zu stellen. Doch sie prophezeiten gleichzeitig, dassGorbatschow sich an dem schweren Erbe Lenins verheben wer-de.
Gorbatschow war von Anfang an bis zu seinem Sturz einerMacht verpflichtet: der Partei. Er bekämpfte innerparteilicheGegner, er kämpfte aber nicht gegen die Partei. Er bekämpfteden ererbten Machtanspruch der Kommunisten, von dem erglaubte, eine erneuerte Partei könne ihn auf legalem, sprich de-mokratischem Weg neu erwerben. Gorbatschow wechselte inden folgenden vier Jahren fast 60 Prozent der Parteikader wegenUnfähigkeit aus. Das erregte zwar im Westen Aufmerksamkeit,konnte aber nicht wirklich die ideologischen Grundfesten er-schüttern, auf denen die Partei bisher stand.
Den Schritt von der innerparteilichen Evolution zur außer-parteilichen Revolution vollzog Gorbatschow 1988 auf der 19.Parteikonferenz. Man habe die Tiefe der Deformation bisher
247
unterschätzt, gestand der Parteichef und zog die vernichtendsteSchlussfolgerung, die jemals aus dem Mund eines sowjetischenGeneralsekretärs zu hören war: „Das bestehende politische Sys-tem hat sich in den letzten Jahrzehnten als unfähig erwiesen.“Die Trennung von Staat und Partei, die Errichtung einer Präsidi-aldemokratie, freie und geheime Wahlen wurden nun Bestandteileines neuen Konzepts. Genau hier setzte aber jene Phase desMachtkampfes ein, die schließlich zum Putsch gegen Gor-batschow führte. Der Parteiapparat musste zusehen, wie in ers-ten freien Wahlen die Kommunisten verloren, wie Macht undPrivilegien entschwanden. Die Militärs mussten sich dem Diktatder Abrüstung beugen.
Der Westen bezog dabei seine Sicht der Dinge vornehmlichaus den Federn der Erneuerer. Hier liegt einer der verhängnis-vollen Fehler des Westens. Denn niemand wollte die konservati-ve Basis der Perestrojka-Gegner wahrnehmen, obwohl derenAnhängerschar letztlich auch noch um jenen Teil der Sowjetbür-ger vergrößert wurde, die nach den gescheiterten Wirtschaftsre-formen in Gorbatschow den Verantwortlichen sahen, der ihrewirtschaftliche Basis zerstört hat. So wurde der Reformer amEnde verantwortlich gemacht für die katastrophalen Spätfolgenjener Breschnew-Periode, die er selbst bekämpfen wollte.
Der Parteirebell Boris Jelzin, gnadenlos von Gorbatschowgestürzt, dann als dessen Intimfeind wiederauferstanden, bezogseine Popularität aus eben jener Gegnerschaft zu Gorbatschow.Der reformerische Parteichef dagegen verfolgte einen kurvenrei-chen, oftmals widersprüchlichen Weg, an dessen Ende oft ver-hängnisvolle Kompromisse und Koalitionen standen. Praktischseit mehr als eineinhalb Jahren hat Gorbatschow seinen innenpo-litischen Gegnern immer wieder neue und zum Teil waghalsigeZugeständnisse gemacht. Seine Kontrahenten konnten ihn unterDruck setzen - unter anderem deshalb, weil die Wirtschaftsre-formen ergebnislos blieben.
Das fatale Bündnis mit den konservativen Parteikadern gingGorbatschow im Dezember 1990 ein. Zeitgleich trat Außenmi-nister Eduard Schewardnadse zurück. Er warnte vor einer dro-henden Diktatur - und er wusste, wovon er sprach. Denn einer
248
der Männer in dem gescheiterten so genannten Notstandskomi-tee, Oleg Baklanow, gehörte zu den Intimfeinden der Außen-und Abrüstungspolitik, für die Schewardnadse stand. Im De-zember 1990 half Gorbatschow nach einem ersten, erfolglosenAnlauf auch Gennadi Janaew auf den Stuhl des Vizepräsidenten,der während des Putsches die Sondervollmachten von Gor-batschow beanspruchte, die ursprünglich dazu dienen sollten, diePerestrojka zu retten.
Vor zwei Jahren schon, so mahnten kritische Sowjetologenimmer wieder an, hätte Gorbatschow durch einen demokratischlegitimierten Präsidenten abgelöst werden sollen. Das weitereBeharren im Amt bedeutete praktisch, dass Gorbatschow entwe-der auf die Seite der Konservativen hätte überwechseln oderihnen hätte weichen müssen. Sein zwischenzeitlicher Versuchvom April 1991, sich wieder den Reformern anzuschließen undmit Unterstützung von Boris Jelzin einen Unionsvertrag durch-zusetzen, kam zu spät. Gorbatschow war innenpolitisch nichtpopulär - seine Popularitätsrate lag vor seinem Sturz bei 20 Pro-zent und ist jetzt wieder auf 53 Prozent gestiegen. Und in derWirtschaft konnte er keine Erfolge verbuchen. Der Mann, dersich anschickte, den Sozialismus lebensfähig zu machen, hat sichübernommen. Er wollte eine Demokratisierung, aber keine volleDemokratie. Er wollte eine freiere Wirtschaft, aber keine freieMarktwirtschaft. Er wollte die Souveränität der sowjetischenVölker, aber er wollte keine Bildung souveräner Einzelstaaten.Die historisch größte Rolle hat Gorbatschow in der Außenpolitikgespielt. Europa verdankt ihm, dass keine sowjetischen Panzergegen die Demokratisierung in Osteuropa gerollt sind.
Doch innenpolitisch war Gorbatschow ein Zauderer. DasBündnis mit den dogmatischen Kräften und der Rücktritt vonAußenminister Schewardnadse waren erste Warnzeichen, derParteiaustritt von Alexander Jakowlew das letzte. Leider hat diedemonstrative Geste dieses Chefregisseurs der Perestrojka dreiTage vor dem Putsch nicht für die notwendigen Schlagzeilen imAusland gesorgt. Niemand nahm die Warnung vor einer Diktaturwirklich ernst, solange es Gorbatschow als vermeintlichen Ga-ranten der Perestroika gab. Der Westen saß damit wieder einmal
249
dem alten historischen Fehler auf, die Sowjetunion, wie früherauch Russland, politisch zu personifizieren. Die Wirkungskräftedes Systems wurden zwar analysiert, aber verdrängt. Gor-batschow ist seiner politischen Biographie nach kein Demokrat,aber er ist auch kein Diktator. Er war bislang ein politischerZwitter, der das Alte nicht mehr wollte, ohne das Neue, die plu-ralistische Demokratie, voll zu wagen. Gorbatschow hat sich inden vergangenen sechs Jahren zu sehr auf seinen taktischenInstinkt verlassen und dabei mehrfach die Gesetze der Machtvernachlässigt.
250
DER GROSSE GEWINNER JELZINBoris Jelzin ist die neue Integrationsfigur108
Streitbar, von rustikaler Burschikosität, lernfähig und ausge-stattet mit einem populistischen Instinkt für die Macht – das sinddie unverwechselbaren Eigenschaften des Boris Jelzin. Der Zög-ling des Parteiapparates, dessen Jugend charakterisiert war vonAufsässigkeit gegen Autoritäten und bravem Mitläufertum in derPartei, hat sich als Gegenspieler von Michail Gorbatschow einegroße Popularität verschafft – während der UnionspräsidentGorbatschow beim Volk immer tiefer in Ungnade fiel.
Jelzin vertrat als sibirischer Lokalpolitiker in Swerdlowsk zu-weilen hemdsärmelig die Linie der Partei, fiel dabei jedoch nichtdurch besondere Progressivität auf. Er selbst gestand in seinerAutobiographie ein, damals habe auch er den berüchtigten auto-ritär-bürokratischen Stil angewendet. Seine Schlussfolgerung:„Was sollten wir tun? Damals wirkt es.“ Diese unbekümmerteHaltung kennzeichnete seinen Arbeitsstil, als Jelzin in den euro-päischen Teil der Sowjetunion und dort in das Herz Russlands,in die Hauptstadt Moskau, überwechselte. Von Gorbatschowwar Jelzin auserwählt, um als Parteichef von Moskau den Kor-ruptionssumpf der Stadt trockenzulegen – ein Unterfangen, andem auch heute noch jeder scheitern muss. Jelzin erkannte bald,dass man den Teufel nicht mit dem Belzebub austreiben konnte,und feuerte deshalb – teilweise in der Manier eines frühkapitalis-tischen Unternehmers - etablierte Parteikader aus ihren Ämtern.Jelzin präsentierte sich als Populist, stellte sich schon mal in dieMenschenschlange am Fleischtresen. Der Direktor des Landes,
108 Von Gorbatschow tief gedemütigt und politisch gestürzt, sicherte sichBoris Jelzin als Kritiker der Kommunistischen Partei die Unterstützung derBevölkerung. Mit deren Hilfe konnte er den Putschisten erfolgreich Wider-stand leisten und nach dem gescheiterten Putsch letztlich Gorbatschow zurAbdankung zwingen. Erstveröffentlichung: Der große Gewinner. WährendGorbatschow auf der Krim festsaß, rief Boris Jelzin in Moskau zum Wider-stand auf. Der russische Präsident ist die neue Integrationsfigur der Sowjet-union. In: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nr. 34, 23. August 1991.
251
in dem Jelzin – noch unerkannt - mit den üblichen Knochen-und Fettresten abgespeist werden sollte, obwohl gerade Frisch-fleisch geliefert war, erlebte das, was ihm die Moskauer Konsu-menten schon längst wünschten: eine vernichtende Bloßstellungdurch den Stadtparteichef persönlich. Moskau jubelte, die nor-male Bevölkerung jedenfalls. Der Parteiapparat sann auf Rache.Je mehr Jelzin in der Rolle des kommunistischen Nestbeschmut-zers agierte, desto beliebter wurde er beim Volk. Auf dem ent-täuschenden XXVII. Parteitag 1986 gehörte Jelzin zu den weni-gen Delegierten, die selbstkritisch die Privilegien der Nomenkla-tura anprangerten. Schließlich vergriff er sich an der Macht desMächtigsten, indem er nicht nur Gorbatschow selbst, sondernauch dessen Frau Raissa, deren aufwendigen Lebensstil und ihreständigen Versuche der Einflussnahme in der Politik öffentlichkritisierte. Was daraufhin Gorbatschow im November 1987 aufeinem Plenum des Zentralkomitees an Selbstanklage von Jelzinabverlangte, erinnerte an die schauerlichen Selbstbekenntnisseeiner längst überwunden geglaubten Parteidiktatur: „Ich habemich schuldig gemacht vor Dir, Michail Sergejewitsch, und vorder Partei“, bekannte Jelzin und leitete damit seinen parteiinter-nen Sturz ein.
Die damalige Demütigung kompensierte Jelzin in seiner dreiJahre später erschienenen Autobiographie mit seinem Urteil überGorbatschow: „Man sah, dass die Macht von ihm Besitz ergriffund er das Gefühl für Realität verlor.“ Jelzin, abgeschoben aufden Posten eines Vizebauministers, konnte sich der Fallstrickeder KGB-Informationen kaum erwehren. Im Zeichen von„Glasnost“ wurden westliche Korrespondenten im „offenenHintergrundgespräch“ nach dem Sturz Jelzins instrumentalisiert,man möge nicht allzu hart – und damit also nicht allzu aufsehen-erregend über die Ereignisse um Jelzin urteilen. Infolge schwererKrankheit sei Jelzin praktisch in nicht weniger als drei Monatenein toter Mann. Jelzin sollte auf diese Weise totgeschwiegenwerden. Schließlich hatte Gorbatschow ihm wörtlich angedroht:Vizebauminister sollte er werden. „Aber denke dran, in die Poli-tik lasse ich dich nicht wieder hinein.“
252
Das denkwürdige Demokratieverständnis von Gorbatschowunterschätzte die Wirkungsweise seiner eigenen Reformen. Jelzintrotze dem Apparat und gewann die Massen. Als unabhängigerKandidat für den Volkskongress feierte er die wohl spektakulärs-te politische Wiederauferstehung, die es in der Sowjetunion bis-her gab. Am 26. März 1989 gewann er den Moskauer Wahlkreismit 89,4 Prozent der Stimmen. Doch damit war Jelzin erst in dergroßen Volksversammlung vertreten, aber noch nicht im eigent-lichen Parlament, dem Obersten Sowjet. Denn dieses Parlamentwurde vom erst Volkskongress gewählt.
Jelzin und Gorbatschow hielten sich gegenseitig für die Hin-dernisse der Perestrojka. Nur attackierte Jelzin Gorbatschowöffentlich, während der versuchte, im Hintergrund die Fäden zuziehen. Jelzins Marsch durch die Institutionen war begleitet vonseinen Tiraden auf Gorbatschow, ohne dass er zunächst einepolitische Alternative erkennen ließ. Zum politisch verantwortli-chen Staatsmann wandelte sich Jelzin mit seinem Einzug in dasParlament, den Obersten Sowjet. Dort setzte er sich an die Spit-ze einer Art Opposition unter dem Namen „Interregionale Ab-geordnetengruppe“. Jetzt verlegte er sich aufs Analysieren.Doch sein Bild war auch noch bei seinem ersten Amerikabesuchim gleichen Jahr geprägt von seiner Gegnerschaft zu Gor-batschow. Der Westen, immer noch vernarrt in Gorbatschow,den vermeintlich einzigen Garanten für Stabilität, gestand demParteirebellen Jelzin keinen ernsthaften Willen zum Wandel zu.Lächerliche Kampagnen des KGB, Jelzin als Alkoholiker zudiffamieren, taten zwar im Westen ihre Wirkung. Innerhalb derSowjetunion lösten solche Vorwürfe eher das Gefühl der Ver-brüderung aus. Als Jelzin im Mai 1990 zum Parlamentspräsiden-ten der Russischen Föderation gewählt wurde, hatte er sich ge-gen die letzten Versuche Gorbatschows durchgesetzt, den weite-ren Aufstieg seines Rivalen zu bremsen. Jelzin quittierte die letz-ten Behinderungsversuche seines Generalsekretärs kurzerhandmit dem Austritt aus der Kommunistischen Partei.
Jelzin war vom Widersacher in die Rolle des Herausforderersgewachsen. Und als er die ersten wirklich freien Wahlen gewannund zum Präsidenten der Russischen Föderation aufstieg, war er
253
Gorbatschow machtpolitisch ebenbürtig. Jelzin entwickelte Initi-ativen, mit denen er mehr Stabilität für die Sowjetunion erreichteals der umtriebige, aber sprunghafte Gorbatschow. Er baute aufKontakte mit den verfemten baltischen Republiken, währendGorbatschow deren Politik verurteilen ließ. Jelzin initiierte Ko-operationsverträge zwischen den auseinanderfallenden Republi-ken, während Gorbatschow immer noch die Zentralmacht be-mühte und dazu auch das Militär einsetzte. Der russische Präsi-dent Jelzin setzte auch auf Demokraten außerhalb der Kommu-nistischen Partei. Nach den Massakern von Vilnius und RigaAnfang 1991 konnte Gorbatschow nur noch mit Hilfe von Jelzinregieren. Der Operettenputsch vom August 1991 verschob dieMachtverhältnisse noch weiter zugunsten von Jelzin. Die Mas-sen, die als lebende Barrikaden gegen die Putschisten und derenPanzer in die Moskauer Straßenschlacht zur Retten der Demo-kratie zogen, skandierten nicht den Namen des gestürzten Gor-batschow, sondern den Namen von Boris Jelzin.
254
EINE REVOLUTION DES ZERFALLSRückblick auf die Ära Gorbatschow109
Es war an einem kalten Tag im März 1985. Da stand er nunauf dem Leninmausoleum, der neue starke Mann der Sowjetuni-on, Michail Gorbatschow. Vor ihm auf dem Roten Platz ruhteder offene Sarg mit seinem verstorbenen Vorgänger KonstantinTschernenko. Nur mit wenigen Sätzen betrauerte Gorbatschowden Tod von Tschernenko. Was dann folgte, waren massiveVerstöße gegen das Protokoll der kommunistischen Rituale, einSchock für die Nomenklatura. Gorbatschow wetterte in seinerersten öffentlichen Rede als Generalsekretär plötzlich über dieverlogene, heuchlerische Gesellschaft im Land. Er schwang diePeitsche weitreichender Drohungen: Lügner müssen bestraft undNichtstuer zur Arbeit angehalten werden. Glasnost und Perest-rojka deuteten sich an.
So etwas hatte die Welt bei der Beerdigung eines sowjeti-schen Parteichefs noch nicht zu hören bekommen. Ein Vorge-schmack auf die Ungeduld, mit der Gorbatschow sein Land zuReformen drängte. Der neue Stil brachte noch eine weitereÜberraschung. Gorbatschow verweigerte dem Sarg vonTschernenko die letzte Ehre, wie sie seit Lenins Zeiten üblichwar. Nicht mehr die Mitglieder des Politbüros, sondern nur nochOffiziere der Armee trugen den Sarg zur Kremlmauer. Dazwi-schen lag eine Beobachtung, die man als junger Korrespondentnicht mehr vergisst: Die Ehefrau des toten Tschernenko stürztesich tränenüberströmt auf den offenen Sarg und schlug mehrfachdas Kreuz über den Toten, der bis zuletzt im Namen der Parteiden Atheismus zu propagieren hatte. In der Zwischenzeit ergötz-te sich ein feixender Gorbatschow im Gespräch mit anderen
109 Der Rückblick auf die Zeit von Michail Gorbatschow zeigte, dass derVater von Glasnost und Perestrojka zehn Jahre nach Amtsantritt und be-reits vier Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion für die Öffentlichkeit zurpolitischen Unperson geworden war. Erstveröffentlichung: Eine Revolutiondes Zerfalls. Vor zehn Jahren übernahm Michail Gorbatschow die Führungder Sowjetunion. In: Gehört Gelesen 6, 1995, S. 20-24.
255
Politgrößen auf der Balustrade des Leninmausoleums. Gor-batschow war für den Westen kein Überraschungskandidat imAmt des Generalsekretärs der KPdSU, wie Peter Bauer 1985 fürdie ARD-Tagesschau aus Moskau berichtete: „Im Ausland istGorbatschow, der gelernter Jurist und Landwirtschaftsfachmannist, durch eine Reihe von Reisen bekannt geworden. Zuletzterregte er im Dezember in London Aufsehen durch seineSchlagfertigkeit und gewandten Umgangsformen. Die Engländerzeigten sich entzückt von Gorbatschow, der damals schon alszweiter Mann der Parteihierarchie und Kronprinz des Kremlsgalt. Wie er seine Außenpolitik gestalten wird, können erst dienächsten Wochen zeigen. Doch an seiner Seite steht weiter derdienstälteste Außenminister der Welt, Andrej Gromyko, selbstMitglied des Politbüros.”
Gorbatschow war nach Lenin der erste Generalsekretär, derein juristisches Studium abgeschlossen hatte. Bei seiner Wahl warer mit 54 Jahren der Benjamin des Politbüros. und Gorbatschowzeichnete sich durch eine Gabe aus, die ihn von seinen Vorgän-gern Breschnew, Andropow und Tschernenko wesentlich unter-schied. Gorbatschow konnte frei sprechen, ohne jeden Satz voneinem Zettel ablesen zu müssen. Dies ermöglichte ihm auch diefreie Aussprache mit Politikern aus aller Welt, die zur Beerdigungvon Tschernenko nach Moskau gekommen waren, darunterBundeskanzler Kohl. Im Rückblick wirken die Ergebnisse vonKohls Pressegespräch mit Moskauer Korrespondenten in jenemhistorischen Jahr des sowjetischen Machtwechsels 1985 fastprophetisch. Endlich, so meinte Kohl, sei er einem Gesprächs-partner gegenüber gesessen, der zuhören und auch reagierenkönne und der auf das Gesagte einginge. Gorbatschow sei zwarin der Sache hart, aber doch sehr charmant, verbindlich, und erwisse, wovon er rede. Gorbatschow hatte bei seiner ersten Be-gegnung mit dem deutschen Bundeskanzler keine vorbereitetenStatements abgehalten; der dabeisitzende Außenminister Gro-myko hielt sich auffallend zurück. Gorbatschow begnügte sichnur mit einigen kleinen Notizen, um dann sehr sachlich über diewichtigsten Weltprobleme, aber auch über die bundesdeutsch-sowjetischen Beziehungen mit dem Bundeskanzler zu reden.
256
„Natürlich kann niemand erwarten“, so bewertete Kohl damalsseine ersten Eindrücke, „dass mit der Zeit von Gorbatschowbereits eine Zäsur sichtbar wird. Doch der Mann ist keine tibeta-nische Gebetsmühle, und es ist zu hoffen, dass man in Zukunftnoch weitere und nützliche Gespräche miteinander führenkann.“
Für seine unverkrampfte außenpolitische Orientierung erhieltGorbatschow viel Zustimmung. Er signalisierte das Gegenteilder Breschnew-Doktrin, die ehedem den sozialistischen Bruder-staaten nur begrenzte Souveränität zugestand. Unter Gor-batschow suchten die Nachbarstaaten in Mittel- und Osteuropaimmer stärker ihre eigenen Wege. Das eigene Land, die Sowjet-union, befreite Gorbatschow vom Trauma des Afghanistan-Krieges. Die sowjetischen Truppen kehrten zurück. Endlichdurfte offen diskutiert werden, worüber lange Zeit geschwiegenworden war: Über die Opfer des Krieges. Bis zum Ende desAfghanistan-Krieges hatten sowjetische Soldaten-Eltern auf demGrabstein ihrer Söhne nicht schreiben dürfen, dass ihr Junge inAfghanistan gefallen war. In einer solchen Situation wirkte dasEnde des Krieges wie ein innerer Befreiungsschlag für die sowje-tische Gesellschaft.
Doch die sozialistischen Strukturen waren trotz Glasnost undPerestrojka kaum aufzubrechen. Man muss nur einmal daranerinnern, dass bis zur Gorbatschow-Zeit eine staatliche BäckereiTausende Kilometer weit weg von Moskau nicht einmal einTortenrezept verwenden durfte, ohne dass es von der zentralenPlanungsbehörde genehmigt worden war. Ganz zu schweigenvon den Belastungen für Wirtschaft und Verwaltung, die vomMisstrauen des KGB durchsetzt war. So war bis zur Gor-batschow-Zeit der private Besitz und Betrieb von Fotokopierernund Computer-Druckern bei Strafe verboten. Kein Wunder also,dass Gorbatschow immer und immer wieder für die selbstver-ständlichen Reformen, für einen neuen Eigentumsbegriff dieWerbetrommel rühren musste, zunächst in der Hoffnung, dassdadurch der Sozialismus reformiert werden könnte. Vor seinenParteigenossen plädierte der Kremlchef:
257
„Das Leben hat überzeugend gezeigt, dass die Wirtschaftsre-form ohne eine radikale Erneuerung der Verhältnisse zum sozia-listischen Eigentum einfach unmöglich ist. Wir sind für dieSchaffung von flexiblen und effektiven Verhältnissen zur Nut-zung des gesellschaftlichen Gemeingutes, damit jede Form desEigentums in einem gerechten Wettbewerb ihre Lebensform,ihre Recht auf Existenz behauptet. Als einzige Bedingung gilt:Keine Ausbeutung und auch keine Entfremdung des Arbeiten-den von den Produktionsmitteln zuzulassen. Mit der Eigentums-frage ist untrennbar eine andere entscheidende Richtung derWirtschaftsreform verbunden und zwar die Bildung eines leben-digen, sozialistischen Marktes. Natürlich ist der Markt nichtallmächtig. Aber die Menschheit hat keinen demokratischerenund effektiveren Mechanismus der wirtschaftlichen Tätigkeitausgearbeitet.“
Ein Tabu war gebrochen. Eigentum und Markt waren nun imSozialismus keine Schimpfwörter mehr. Bald zeigte sich, dasseine Reform des sozialistischen Systems ohne freie Meinungsbil-dung unmöglich ist. Doch das bedeutete: freie Wahlen. Gor-batschow suchte einen Mittelweg voller Kompromisse. Er wolltedie alten Eliten nicht zu schroff vor den Kopf stoßen undgleichzeitig neue Reformkräfte gewinnen. Mit einem Wort: Gor-batschow suchte die Vereinigung von Feuer und Wasser. Seinradikalster Anhänger, Boris Jelzin, wurde deswegen zu Gor-batschows radikalstem Gegner. Jelzin kritisierte die Halbherzig-keit des Generalsekretärs vor dem Zentralkomitee und wurde zurStrafe degradiert. Damit begann Jelzins Kampf für eine radikaleVeränderung des gesamten Systems, beginnend mit der Forde-rung nach echten freien Wahlen, die Jelzin - nun bereits in Geg-nerschaft zum kommunistischen Parteiapparat - vorbrachte:„Das existierende Wahlgesetz ist nicht demokratisch genug. ImZusammenhang damit muss man grundsätzliche Änderungen amWahlsystem vornehmen. Man muss sich von den erfundenenWahlen durch die so genannten gesellschaftlichen Organisatio-nen abwenden. Man muss allgemeine, direkte, gleiche und ge-heime Wahlen von unten bis oben mit alternativen Kandidatenbis hin zu den Wahlen des Vorsitzenden des Obersten Sowjets
258
einführen.“ Auch wenn die ersten Wahlen zum neu gegründetenVolkskongress nicht ganz frei waren und zahlreiche Nomenkla-tura-Vertreter ihre politischen Erbhöfe durch Entsendung in dasParlament verteidigen konnten, entbrannte die politische Debat-te in einem bis dahin unbekannten Ausmaß. Der frühere Dissi-dent Andrej Sacharow, von Gorbatschow nach siebenjährigerVerbannung befreit, begleitete als Deputierter im Volkskongressden Reformweg mit kritischer Distanz. Auch Sacharow plädiertedafür, dass bei Wahlen mehrere Kandidaten antreten sollten, weiler damit Gorbatschows Führungsanspruch demokratisch legiti-mieren wollte. Andrej Sacharow 1989 im Volkskongress derSowjetunion: „Ich habe mehrmals in meinen Auftritten meineUnterstützung für die Kandidatur von Michail SergejewitschGorbatschow zum Ausdruck gebracht, weil ich keinen anderenMenschen sehe, der unser Land leiten könnte. Einen solchenMenschen sehe ich im gegebenen Augenblick nicht. Meine Un-terstützung ist an eine Bedingung gebunden. Ich halte eine Aus-sprache für notwendig und wir müssen bei allen Wahlen Alterna-tivkandidaten im Auge haben. Das betrifft auch die Wahlen zumObersten Sowjet und die Wahl des Präsidenten.“
Schließlich kam es am Tag vor Sacharows Tod zu einemZerwürfnis mit Gorbatschow, weil Sacharow dem Parteichef undkünftigen Präsidenten der Sowjetunion eine zu große Machtfüllevorwarf. An der Seite von Sacharow stritt ein Mann, der im Wes-ten wenig bekannt ist, der aber außerordentlich viel zum innerenZusammenbruch des morschen Systems beigetragen hat, derHistoriker Jurij Afanasjew. Er nutzte Glasnost, um der Vergan-genheitsbewältigung eine Zukunft zu verschaffen. Für Afanasjewwar bereits unter Gorbatschow der Sozialismus zu Ende gegan-gen, als der Historiker im Sommer 1989 formulierte: „Ich glaube,die Perestrojka, so wie sie im April 1985 geplant wurde, wirdheute beendet - oder sie ist schon zu Ende. Das heißt, dass diePerestrojka als eine Generalüberholung des Gebäudes, welcheswir im Laufe von 72 Jahren errichtet haben, unter Beibehaltungalter Fundamente zu Ende ist. Die viereinhalb Jahre haben ge-zeigt, dass diese Aufgabe nicht realisierbar ist. Der Typ des So-zialismus, den wir im Endeffekt aufgebaut haben, ist irreparabel.
259
Eine neue Grundsteinlegung für unsere Lebensordnung stehtbevor. Die Aufgabe ist komplizierter, als man es sich in jenemFrühjahr 1985 vorgestellt hat. Wir dachten, es wird schwierigsein, eine Generalüberholung des Gebäudes durchzuführen,ohne die Einwohner umzusiedeln. Jetzt, wo wir uns vergewisserthaben, dass sogar das Fundament auszuwechseln ist, scheint dieAufgabe noch viel komplizierter zu sein. Was wird darunterverstanden? Was meine ich mit diesem Fundament? Der Typ desSozialismus, welcher bei uns in der Sowjetunion entstanden ist -und nicht nur bei uns - alle Sozialismen haben alle einen gemein-samen Urtypus, und zwar einen Urtypus, der den Sozialismus zurweiteren Entwicklung unfähig macht.“
Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschlandund Gorbatschow war stets widersprüchlich. Trotz Begeisterungüber den Reformer herrschte Skepsis in Fragen der Deutsch-landpolitik und West-Berlins. Gorbatschow schien lange Zeit alteStandpunkte zu verteidigen, als er noch vier Jahre nach Beginnseiner Amtszeit in einer politischen Grundsatzrede erklärte: „Eswäre unfair von mir, die Frage West-Berlins unerwähnt zu lassen.Es ist so, dass wir ab und zu Stimmen aus der BundesrepublikDeutschland hören, diese Frage sei beinahe ein Prüfstein in un-seren Beziehungen. Sollte die UdSSR hierbei nicht nachgeben, sosoll auch die Entwicklung sowjetisch-westdeutscher Beziehungenmindestens gebremst werden. Eine solche Fragestellung - wieimmer sie verpackt sei - steht nicht nur im Widerspruch zumvierseitigen Abkommen von 1971, sie ist auch mit dem Wesendes Helsinki-Prozesses unvereinbar. Wir sind nicht gegen dieTeilnahme West-Berlins am europäischen oder internationalenVerkehr, und wir sind bereit, spezifische Interessen in der Wirt-schaft und im Kulturleben zu berücksichtigen - aber so verstan-den, dass der besondere Status der Stadt unerschüttert bleibt.Über die so genannte deutsche Frage habe ich in der letzten Zeitmehrmals gesprochen. Die heutige Situation ist das Ergebnis derGeschichte. Die Versuche, das von ihr Geschaffene umzustür-zen oder die Lage durch eine unrealistische Politik anzuheizen,stellt eine unkalkulierbare oder sogar gefährliche Beschäftigungdar.“ Der erstaunlichste Wandel liegt darin, dass Gorbatschow
260
letztlich doch der deutschen Wiedervereinigung zugestimmt hat.Ein weiteres Verdienst ist die Tatsache, dass Gorbatschow sichdem Zusammenbruch des Kommunismus im eigenen Land nachdem August-Putsch 1991 wie schon zuvor im übrigen Ostblock,nicht entgegengestellt hat, weder politisch noch militärisch. Da-gegen fällt die innenpolitische Resonanz auf die Gorbatschow-Jahre eher bescheiden aus. Über das Urteil der Russen heuteurteilt der Moskauer Autor Werner Tzschoppe, der den Aufstiegund Fall von Gorbatschow miterlebt hat:
„Michail Gorbatschow wird heute in seinem eigenen Landnicht mehr ernst genommen und von vielen seiner ehemaligenAnhänger belächelt. Für die Kommunisten und die nationalisti-sche Rechte ist Gorbatschow der verachtenswerteste Verräter,den man sich denken kann. Gerade ihm lastet man die Haupt-verantwortung für den Zusammenbruch der Sowjetunion an.Gorbatschow hat als Initiator der Perestrojka beispiellosen Mutund Findigkeit bewiesen sowie eine Meisterleistung an Taktikvollbracht - in bolschewistischer Tradition aber auch gepaart mitLüge, Treuebruch und Verrat gegenüber seinen Parteigenossen.Gorbatschow stellte mit seiner Brillanz alle Generalsekretäre derKPdSU in den Schatten. Aber er war und blieb ein Kind derunreformierbaren Partei. Bis zu seiner Abdankung als Präsidentkämpfte Gorbatschow für einen besseren Sozialismus. Selbstnach dem Zusammenbruch des Sozialismus ist Gorbatschow einbekennender Kommunist geblieben: ‚Ich schäme mich nirgends,vor keinem Auditorium, zu sagen, dass ich Kommunist bin undan der sozialistischen Idee festhalte. Damit werde ich, wie manso sagt, bis an mein seliges Ende leben. Ich werde mich nichtändern. Meine Wahl ist endgültig’, schreibt Gorbatschow inseinen Erinnerungen an den August-Putsch 1991, der das Endedes kommunistischen Regimes einleitete. Gorbatschow musstescheitern, weil er selbst nicht erkannt hat, welche historischenVeränderungen er - gewissermaßen als ein Werkzeug der Ge-schichte - eingeleitet hat. Er konnte jeweils nur wenige Schritteseines Handelns voraussehen, selbst ein bescheidener histori-scher Weitblick blieb ihm stets versagt. Das gilt leider bis zumheutigen Tag. Hätte Gorbatschow sich mit seinem historischen
261
Werk zufrieden gegeben, nämlich einer letztlich nicht rückgängigzu machenden Entwicklung weg vom Totalitarismus und hin zurDemokratie, dann würden ihm Ehrerbietung und Hochachtungin Russland ungeschmälert erhalten geblieben sein. Doch Gor-batschow versucht unablässig, in der aktiven Politik mitzumi-schen und auf die politische Bühne zurückzukehren. Immerwieder spielt er sich als Oberlehrer oder gar als Richter gegen-über Präsident Jelzin auf. Gorbatschows entsprechende Redenund Artikel sind durchwegs flach, zu wortreich und meist nichts-sagend. Das gilt auch für Gorbatschows Bücher. Von welchemRealitätssinn kann bei Gorbatschow die Rede sein, wenn er im-mer wieder darauf anspielt, er würde sich unter Umständen fürdas Amt des russischen Präsidenten zur Verfügung stellen? Jelzinwird häufig für das kleinere Übel gehalten. Viele Menschen sindaber der Meinung, auch Jelzin sei ausgezehrt und seine Zeit gehepolitisch zu Ende. Im Zusammenhang mit der schweren wirt-schaftlichen und politischen Lage in Russland und besonders seitdem Krieg in Tschetschenien, forderte Gorbatschow die soforti-ge Ablösung der russischen Führung. Doch Neuwahlen, die Halsüber Kopf angesetzt worden wären, hätten das gegenwärtigeChaos in Russland nur noch vergrößert. Aller Wahrscheinlichkeitnach wären dabei die extremen Verfechter einer aggressivenGroßmachtpolitik und die Anhänger eines antiwestlichen Isolati-onismus an die Macht gekommen, die überdies keine Sachkennt-nis in der Führung eines Staates haben. Solche Folgen seinerpolitischen Forderungen scheint Gorbatschow überhaupt nichtzu bedenken. Die große Zahl seiner Kritiker sieht darin einepolitische Inkompetenz, die umso stärker ins Gewicht fällt alsGorbatschow immer wieder eine schier unstillbare Gier nachdem höchsten politischen Amt im Staat zeigt. Dies ist es vorallem, was ihn unter der heutigen Generation in Russland voll-ständig um seinen Ruf bringen kann.“
Das Jahrzehnt seit dem Amtsantritt und dem Sturz vonGorbatschow hat die Welt verändert. Seine Revolution vonGlasnost und Perestrojka hat zum Zerfall des Systems geführt,das er verändern wollte. Gorbatschow selbst ist dabei das pro-minenteste Opfer seiner eigenen Reformen geworden.
262
NEUORIENTIERUNGKonsequenzen aus dem Zerfall der Sowjetunion110
Die Sowjetunion war in Osteuropa kein stabilisierendes, son-dern ein repressives Instrument zur Aufrechterhaltung einerautoritären Ordnung. Gegenüber den Staaten des zerfallenenOstblocks handhabte die Sowjetunion ihren Führungsanspruchin nahezu derselben Machtausübung wie nach innen. ZentraleBefehlsgewalt galt in politischen, wirtschaftlichen und militäri-schen Frage. Die Befehlsgewalt beruhte auf einer ideologischbegründeten Gleichschaltung von Partei- und Staatsapparat.
Der Westen fand sich zu einem modus vivendi im Umgangmit der Sowjetunion bereit. Der Westen akzeptierte in der Praxis,dass Moskau als politisches Zentrum nicht nur den Vielvölker-staat Sowjetunion mit dem Beutegut aus Bürgerkrieg (praktischalle Republiken außerhalb Russlands) und Hitler-Stalin-Pakt(Baltikum, polnische Ostgebiete, Nordbukowina, Bessarabien),sondern auch die umgebenden Staaten in Ost- und Südosteuropadominierte.
Am Ende der sowjetischen Epoche waren, fast in historischerParallelität zum Zerfall des Zarenreiches, Geheimdienst undArmee als Instrumente der inneren Stabilität, nicht mehr in derLage, den nationalen Aufbruch, den politischen Umbruch undden wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Reform-versuche unter Gorbatschow kamen zu spät, waren halbherzigund offenbarten Widersprüche, statt sie zu beseitigen. Bürokrati-sche Unfähigkeit und die Beharrungskraft der Nomenklatura
110 In den Zwischenbilanzen nach dem Zusammenbruch des sowjetischenSystems werden die Auswirken analysiert, die zunächst als katastrophal undspäter als chaotisch befürchtet wurden, andererseits jedoch erheblicheChancen für die Entwicklung nicht nur innerhalb Russlands und seinerfrüheren benachbarten Sowjetrepubliken, sondern auch in ganz Ost- undSüdosteuropa beinhalteten. Erstveröffentlichung: Chaos oder Chance? DerZusammenbruch der Sowjetunion und die Auswirkungen auf Osteuropa.In: Ende der Sowjetunion - Impulse für Europa. Hrsg. von B. Ränsch-Trillund E. Wagner. Wissenschaft Transparent 4, Hildesheim 1994, 210-223.
263
sind - neben der ungelösten nationalen Frage - zwei wesentlicheKomponenten, die - ideologiefern - mehr zum Scheitern derReformen unter Gorbatschow beigetragen haben als gezielterpolitischer Widerstand konservativ-kommunistischer Parteizirkel.
Das Ende der Sowjetunion hat nur für eine Übergangsphasedie Gemeinschaft Unabhängiger Staaten GUS hervorgebracht.Denn die GUS ist mit dem Dilemma behaftet, zugleich Erbe alsauch Testamentsvollstrecker der Sowjetunion zu sein. Konfliktebei der Aufteilung der Sowjetunion waren unvermeidlich. Bei-spiele sind der immer wieder verzögerte Rückzug der russischenTruppen aus den baltischen Republiken, die sich der GUS garnicht erst angeschlossen haben, die Streitereien zwischen derUkraine und Russland um die Krim sowie der blutige Konfliktum die Dnjestr-Region in Moldawien. Andere Konflikte wie derKampf zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach - und daran später anschließend um Nachitschewan -sind dagegen nicht das Ergebnis, sondern nur Begleiterscheinun-gen des Zerfallsprozesses.
In der ersten Euphorie des Wandels wurden im Osten undim Westen dem Etikettenwechsel politischer Begriffe bereitsinhaltliche Wirkung zugeschrieben: Demokratie, Marktwirtschaft,freie Wahlen.
Doch Russland hat es auch nach dem Schock des missglück-ten August-Putsches 1991 zunächst nicht fertiggebracht, einefunktionierende Demokratie aufzubauen. Parteienpluralismus,frei gewählte Parlamente und marktwirtschaftliche Mechanismenblieben auch weiterhin Zielvorstellung und nicht realisierte Poli-tik. Das Experiment der Demokratie wurde begleitet von dembeinahe totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Dieser wirt-schaftliche Niedergang wurde durch den Zerfall des RGW (Ratfür gegenseitige Wirtschaftshilfe) beschleunigt. Die osteuropäi-schen Blockpartner beeilten sich gewachsene, oftmals freilichauch vergewaltigende Strukturen gegen einen Wettlauf freierWirtschaftskräfte Richtung Westeuropa einzutauschen. Eine alteGrenzziehung wurde neu belebt: Jene zwischen Mittelost - undOsteuropa. Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei, bald auchRumänien und Bulgarien begaben sich überraschend schnell auf
264
den Weg einer Assoziierung mit der Europäischen Gemein-schaft, während Weißrussland, die Ukraine, Russland, Moldawi-en, die Kaukasusrepubliken Armenien, Georgien, Aserbaidschansowie die mittelasiatischen Republiken Turkmenistan, Kyrgystan,Usbekistan, Tadschikistan und Kasachstan durch einen neu be-lebten Regionalismus in einen komplizierten Prozess der politi-schen Selbstfindung verwickelt wurden.
Das Ringen um neue Identitäten begann. Ethnische und reli-giöse Merkmale wurden wiederbelebt, aus denen sich derzeitneue Regionalstrukturen zu entwickeln beginnen. Daraus er-wächst als Zukunftsprognose, dass die Welt vor allem im südli-chen und südöstlichen Teil der früheren Sowjetunion neu aufge-teilt wird: Die Türkei übt wachsenden Einfluss als neue Regio-nalmacht aus. Diese Rolle ergibt sich zunächst aus der Tatsache,dass neben Aserbaidschan im Kaukasus die angrenzenden mit-telasiatischen Republiken mit Ausnahme von Tadschikistan Tur-kvölker beherbergen. Aserbaidschan hat nach dem Zerfall derSowjetunion bereits die Türkei zu seiner Schutzmacht erklärt.Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und Kyrgystan werdensich ebenfalls in enger Anlehnung an die Türkei weiterentwi-ckeln. Dabei haben praktische Erwägungen erheblichen Einflussauf dieses Verhalten. Mit der Türkei verbinden diese Republikeneine weitgehend gleiche Sprache und dieselbe islamisch-sunnitische Glaubensrichtung. Nur die Aseris in Aserbaidschanals engste Verwandte der Türken gehören zur islamisch-schiitischen Glaubensrichtung. Deshalb wurde am Beispiel vonAserbaidschan auch die erwachende Konkurrenz zwischen derTürkei und Persien besonders deutlich. Denn auch Persien be-müht sich um die südlichen Staaten der ehemaligen Sowjetunionmit dem Ziel, eine Bastion islamischer Staaten zu errichten. Al-lerdings ist die Entwicklung relativ rasch zugunsten der Türkeiverlaufen. Der Iran konnte trotz seines diplomatischen Engage-ments im Konflikt um Berg-Karabach seine schiitischen Glau-bensbrüder in Aserbaidschan nicht politisch vereinnahmen.Nächster Anknüpfungspunkt wäre Tadschikistan gewesen. Denndie Tadschiken gehören zur persischen Sprachfamilie. Doch inTadschikistan scheinen altkommunistische Machtstrukturen
265
zunächst noch die weitere Entwicklung zu bestimmen. Die zu-nehmende Bedeutung der Türkei als regionale Führungsmachtsollte den Blick auf die letzte Volkszählung der Sowjetunionlenken. Danach waren 25 Turkvölker in der Sowjetunion regis-triert mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 47 MillionenMenschen. Für die meisten dieser Völker, deren Angehörigeteilweise auch in Russland leben, ist die Türkei zu einem neuenHoffnungsträger geworden.
Die Türkei wiederum orientiert sich nicht ausschließlich nachOsten und Südosten, sondern auch nach Westen und Nordwes-ten. Im Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres sucht die Türkeinach einer wirtschaftlichen Handelsbasis bei den Anrainer-Staaten Bulgarien, Rumänien, Ukraine und Russland. Überdieshatte die Türkei mit der zügigen Anerkennung von Bosnien-Herzegowina und dem Abschluss von Militärabkommen mitAlbanien nach dem Machtwechsel seine Interessen an den„Glaubensbrüdern“ auf dem Balkan signalisiert. Nicht zuletztleben in Bulgarien fast zwei Millionen Türken, darüber hinausnoch Pomaken (islamisierte Bulgaren), die ebenfalls in der Türkeieine neue Orientierungskraft angesichts widersprüchlicher Re-formen im eigenen Land sehen. Russland dagegen wird es nachdem Zerfall der Sowjetunion nicht schaffen, politische und eth-nische Gruppen außerhalb Russlands an sich zu binden. Mindes-tens zwei Faktoren sprechen gegen die Rolle einer regionalenOrdnungsmacht Russland: Erstens hat die geschichtliche Erfah-rung gezeigt, dass Russland für angrenzende Staaten keine Ord-nungsmacht war, sondern sich diese Staaten untergeordnet hat.Zweitens bietet der wirtschaftliche Niedergang Russlands erneutdas erschütternde Bild eines Kolosses auf tönernen Beinen. DieZahlungsunfähigkeit Russlands ist trotz der enormen Erdöl- undGoldvorräte der beste Beweis für diesen Niedergang.
Überdies entwickelt sich ein Spannungsverhältnis zwischenden slawischen Brüdern Russland und Ukraine. Alexander Sol-schenizyn hatte in seiner Streitschrift „Russlands Weg aus derKrise“ (deutsch 1990 im Piper-Verlag, München) als einen Zu-sammenschluss der slawischen Völker gesehen. Der PanslawistSolschenizyn schwelgte in der Idee, man könne nicht nur die
266
Ukraine (bei ihm „Kleinrussland“!) und Weißrussland, sondernauch die russisch besiedelten Gebiete Kasachstans für das neueRussland vereinnahmen. Während also unter den Turkvölkernder ehemaligen Sowjetunion Tendenzen zur Neuorientierung umein neues Zentrum entstehen, demonstrieren die slawischenVölker der alten Sowjetunion jedoch das Gegenteil. Überdieswird Präsident Jelzin innerhalb Russlands nun strukturell mit dengleichen Problemen der nationalen Frage konfrontiert wie sei-nerzeit Gorbatschow auf dem Territorium der ganzen Sowjet-union. Denn Russland sieht sich Forderungen eines erwachen-den Nationalismus anderer Völker auf seinem Territorium ge-genüber: Von den sechseinhalb Millionen Tataren wohnt nur einSechstel in der bisherigen Tatarischen Autonomen Republik,während der Rest verstreut in Russland siedelt. Die Tataren for-dern den staatlichen Zusammenschluss ihres Volkes.
Auch Dolganen, Nenzen, Nganasanen und Enzen, also diearktischen Völker des früheren Autonomen Kreises Timyr mel-deten sich zu Wort. In der Öffentlichkeit weitgehend vergessen,litten sie unter der industriellen Entwicklung und der Ausbeu-tung der Bodenschätze in ihrem Siedlungsgebiet, wodurch ihreExistenzgrundlage für Rentierzucht und Fischfang gefährdetwurde. Ethnologen befürchten das baldige Aussterben von Spra-che und Kultur dieser Völker, die sich inzwischen organisierten,um den Aufbruch in der nationalen Frage für ihre Interessen zunutzen. In der Republik der Tschetschenen und Inguschen imNordkaukasus, also ebenfalls noch zu Russland gehörend, bra-chen Nationalitätenkonflikte aus. Die Inguschen forderten ihreeigene Autonomie als Wiedergutmachung für die Verbrechen derStalinzeit. Ihre territoriale Selbständigkeit, nach der Revolution1919 geschaffen, ging 1943 in einer gemeinsamen AutonomenRepublik mit den Tschetschenen auf. Während des ZweitenWeltkrieges wurden sie nach Kasachstan und Zentralasien de-portiert. Nach ihrer Rehabilitierung und Rückkehr waren jedochzahlreiche Siedlungsgebiete der Inguschen bereits der Nordosse-tischen Autonomen Republik zugeschlagen worden. Die Südos-seten wiederum, deren Region administrativ zu Georgien gehört,kämpfen mit Waffengewalt für eine Vereinigung mit Nord-
267
Ossetien unter der Administration von Russland. Deutlich anti-russische Tendenzen zeigte erstmals ein anderer Konflikt, als imAugust 1990 Tausende von Russen in der Republik Tuwa, dieebenfalls innerhalb Russlands liegt, die Flucht ergreifen mussten.Vor ihrer Eingliederung in die Russische Föderation war dieRepublik Tuwa im sowjetisch-mongolischen Grenzgebiet von1926 bis 1944 als Volksrepublik ein Satellit der Sowjetunion. DieAusschreitungen gegen die Russen haben damals internationalkeine Schlagzeilen gemacht, obwohl der russischen Bevölkerungdie Häuser angezündet wurden und Flugblätter zum Mord anden Russen aufriefen.
Es ist bemerkenswert, dass Konflikte der nicht-russischenVölker untereinander zunächst mehr Aufsehen erregt haben alsder Protest nicht-russischer Völker gegen Russen. Die Ursachendafür mögen in der Entwicklung des Vielvölkerstaates liegen.Die Russen als historisch expansive und kolonisatorische Kraftleiden bis heute unter dem Klischee der Fremdherrscher. DieRussifizierungspolitik der Stalin-Zeit verstärkte diese Ablehnungdurch die nicht-russischen Völker. Eine antirussische Haltung imKampf um die nationale Identität galt daher zwangsläufig alslegitim, ohne zu berücksichtigen, dass auch die Russen in derzerfallenden Sowjetunion ihren Weg aus der Sowjetisierung her-aus zu einem neuen nationalen Selbstwertgefühl suchten. DieseEntwicklung verlief nicht ohne nationalistische Begleiterschei-nungen wie der Bildung der russischen Pamjat-Bewegung, dieden Antisemitismus wiederbelebte. Auch Panslawisten orthodo-xer Prägung und Monarchisten warben ungehindert für ihreSichtweise der Wiedergeburt Russlands.
Der auch von Solschenizyn geforderte slawische Bund zwi-schen Russland, der Ukraine und Weißrussland war in der Tatvordergründig eine Neubelebung der slawischen Allianz, dieinhaltlich jedoch an Streitfragen der jeweils nationalen Kompe-tenzen in Sachen Wirtschaft, Armee und Grenzziehungen zer-brach. Noch im Dezember 1984, also kurz vor seinem Amtsan-tritt als Generalsekretär der KPdSU, hatte Michail Gorbatschowden Sowjetpatriotismus als „eine der größten Errungenschaftenunserer Gesellschaft“ gepriesen. Nur fünf Jahre später waren
268
zunächst diese gemeinsame Klammer der sowjetischen Identitätund schon kurz danach die Klammer gemeinsamer Problemstel-lungen im Reformprozess verloren gegangen. In einer rückbli-ckenden Bilanz sind mindestens vier Bereiche ursächlich andiesem Zerfallsprozess beteiligt, der dem zweiten Versuch einerRevolution unter dem Namen Perestrojka folgte: Der planwirt-schaftliche Zentralismus hatte sich nicht bewährt. Experimentemit größerer wirtschaftlicher Selbständigkeit einzelner Republi-ken - in begrenztem Umfang bereits seit 1983 unter Andropowbegonnen - mussten misslingen, weil die Republiken weiterhinvon der zentralen Rohstoff- und Ersatzteillieferung und demzentral gesteuerten Markt abhängig waren. Der Schritt zur vollenwirtschaftlichen Unabhängigkeit mit Besitzrecht an den Natur-schätzen sowie an Grund und Boden, von Estland einseitig 1988eingeleitet, stieß auf energischen Widerstand von Michail Gor-batschow, weil seiner Meinung nach Grund und Boden, dieBodenschätze, die Gewässer und Wälder Allgemeingut des sow-jetischen Volkes und ausschließliches Eigentum des Staates sei-en. Trotz der Vorbehalte Gorbatschows taten die RussischeFöderation und alle übrigen Republiken denselben Schritt wieEstland. Das von Gorbatschow bemühte „sowjetische Volk“erwies sich als eine Fiktion. Als „besonders besorgniserregend“bezeichnete es Gorbatschow im November 1988 bei seinemAngriff auf die Esten, dass auch Privateigentum an Grund undBoden sowie an Produktionsmitteln zugelassen werden sollte.Nichts konnte deutlicher die Diskrepanz zwischen der Notwen-digkeit einer Wirtschaftsreform und den ideologischen Hemm-nissen illustrieren, denen Gorbatschow selbst unterlag.
Der Zerfall des planwirtschaftlichen Zentralismus war flan-kiert von dem Unvermögen einer gemeinsamen Wirtschaftsre-form, als deren Folge der innersowjetische Verbraucher- undIndustriemarkt zerfiel. Die Reformansätze mussten scheitern,weil sie den Republiken nur begrenzte Freiheiten ließen. Bedeu-tende Industriezweige unterstanden jedoch weiterhin den Fach-ministerien der Zentralregierung in Moskau, die in die wirtschaft-liche Struktur der Republiken entscheidend und Reform verhin-dernd eingreifen konnten. Die Sondervollmachten von Präsident
269
Gorbatschow, mit denen er im September 1990 die Aufrechter-haltung der zentralen Wirtschaftsbeziehungen per Dekret anord-nete, erschienen angesichts dieses Zerfalls bereits als anachronis-tisch. Die einzelnen Republiken konterkarierten das vergeblicheBemühen der Zentralregierung, indem Wirtschafts- und Preisbil-dungsgesetze Moskaus von den Republiken nicht anerkanntwurden.
Die nationalen Konflikte innerhalb der Armee waren jahre-lang verschwiegen worden. Dem Übergewicht der Russen imOffizierskorps stand die zunehmende Zahl von Rekruten ausden geburtenstarken zentralasiatischen Republiken gegenüber.Die nationale Abgrenzung einzelner Republiken gegenüber Mos-kau, hier wiederum ausgehend vom Baltikum, hatte zur Folge,dass die Idee nationaler Streitkräfte wiederbelebt wurde. MitUnterstützung der national orientierten Volksfronten verweiger-ten Jugendliche den Dienst außerhalb ihrer Heimatrepublik.
Im Mai 1990 beklagte der stellvertretende Generalstabschefder Sowjetunion, Generaloberst Bronislaw Omelitschew „koor-dinierte Boykottversuche gegen die Einberufung“ junger Rekru-ten namentlich in den drei baltischen Republiken sowie in derUkraine, in Moldawien und in den drei transkaukasischen Re-publiken. Gerade im Transkaukasus bildeten sich unter den Bür-gerkrieg ähnlichen Verhältnissen nationale Verteidigungsgrup-pen, die sich teilweise durch Überläufer, teilweise durch Überfäl-le auf reguläre Truppen Waffen besorgten. Ein Präsidialerlassvon Michail Gorbatschow im Juli 1990, der die Gründung be-waffneter Gruppierungen verbot und die Auflösung bisherigerbewaffneter Formationen verlangte, wurde nicht befolgt. Gor-batschow musste sein ultimatives Dekret verlängern und politi-sche Zugeständnisse signalisieren, ehe sich bewaffnete National-verbände in Armenien zur Aufgabe bereit erklärten.
Die Truppen des Innenministeriums, die landesweit zur Be-friedung an den zahlreichen Konfliktherden eingesetzt wurden,erhielten selten die notwendige Unterstützung der örtlichen Be-völkerung. Aus dieser Erfahrung heraus schlug der zwischenzeit-lich entmachtete, Reform orientierte Innenminister Wadim Baka-tin im Oktober 1990 vor, für den lokalen Gebrauch den Repub-
270
liken das Recht auf eigene Truppeneinheiten einzuräumen. Da-mit hätte die Entscheidung einzelner Republiken berücksichtigtwerden können, die in eigenen Gesetzen die Ableistung desMilitärdienstes auf die Heimatrepublik beschränkten. In einemDekret im November 1990 wandte sich Gorbatschow gegensolche Beschlüsse, „die praktisch Wehrdienstverweigerung undFahnenflucht aus den Streitkräften der UdSSR, den Grenztrup-pen, den Truppen des Innenministeriums und anderen von derGesetzgebung der UdSSR vorgesehenen bewaffneten Gruppie-rungen fördern“. Gleichzeitig verfügte Gorbatschow die straf-rechtliche Verfolgung von „Amtsträgern und Bürgern“, die sichder Unionsgesetzgebung in den Fragen der Verteidigung nichtunterwerfen. Im Klartext stellte Gorbatschow mit diesem Dekretden beginnenden Zerfall der sowjetischen Streitkräfte fest. Dievon ihm verfügte Strafverfolgung richtete sich nicht nur gegenRekruten, sondern auch gegen Abgeordnete der Parlamente inden Republiken, die solche von Gorbatschow kritisierten Geset-ze verabschiedet haben.
Dieses Dekret wurde in den betroffenen Republiken nichtbeachtet. Der Prestigeverlust von Gorbatschow bedeutete fürihn Machtverlust. Als Reaktion griff das Militär selbst ein. Ver-teidigungsminister Jasow erließ eine Reihe von Befehlen, ausdenen der Überdruss der Bevölkerung gegenüber der eigenenArmee und der Autoritätszerfall besonders deutlich wurde. Unteranderem hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministersvom 27. November 1990: „Bei rechtwidrigen Handlungen gegenKasernen und Soldatensiedlungen (Abstellen von elektrischemStrom, Wasser usw.) erhielten die Befehlshaber der Truppen derMilitärbezirke und der Flotte den Auftrag, die Objekte und Sys-teme zur Lebensversorgung unter die Bewachung und denSchutz der Militäreinheiten zu stellen. Die Befehlshaber derTruppen der Militärbezirke und der Flotte erhielten Befehl, Aktevon Vandalismus gegenüber Denkmälern und Gräbern vonsowjetischen Soldaten nicht zuzulassen sowie entschieden derErrichtung von Denkmälern und anderen Formen der Verherrli-chung von Faschisten und ihren Söldlingen entgegenzuwirkenund bereits vorhandene derartige Symbole zu liquidieren.”
271
Mit diesen Befehlen war ein von Ausland kaum bemerkterEinschnitt im politischen Leben der Sowjetunion erfolgt. Diemilitärische Führung stellte die Machtlosigkeit der politischenFührung bloß. Der spektakuläre Rücktritt von AußenministerSchewardnadse im Dezember 1990 und seine Warnungen vorder Errichtung einer Diktatur hingen mit dieser Entwicklungunmittelbar zusammen. Fast eine Million Sowjetbürger waren biszum Ende 1990 aus der Kommunistischen Partei ausgetreten.Gorbatschow selbst hatte mit seiner Reform des politischenSystems versucht, das Ansehen der parlamentarischen Vertre-tungen auf Kosten des Parteiapparates zu stärken. Deshalb wur-de er später von seinen konservativen Gegnern für den Prestige-verlust der Kommunistischen Partei verantwortlich gemacht. Inder Tat haben Politbüro und Zentralkomitee gegenüber dengewählten Parlamenten und dem Präsidentenamt ihre Vormacht-stellung verloren. Gorbatschow, der seine Reformen aus gesamt-sowjetischer Sicht begonnen hatte, unterschätzte jedoch dieFolgen dieses Schrittes. Denn auch in den Republiken verlorendie Kommunisten an Prestige. Die regionalen Parteiverbändestanden in Konkurrenz zu nationalen Unabhängigkeitsbewegun-gen oder sie kamen unter deren direkten Einfluss. DeutlichstesBeispiel sind auch hierbei die baltischen Republiken gewesen,deren kommunistische Parteien sich als erste von der KPdSUabgespalten haben, um als selbständige Parteien für eine größereUnabhängigkeit der Republiken einzutreten. Der Zerfall derzentralen Parteiorganisation beschleunigte den Zerfall der Zent-ralmacht. Über das Beispiel Litauen war die KPdSU besondersempört, weil ein Parteiengesetz anderen Staatsbürgern außerhalbLitauens aktive Parteipolitik verbot. Dieses Verbot richtete sichpraktisch gegen alle Mitglieder der alten KPdSU, die von Moskaunach Litauen entsandt worden waren, um dort zeitweilige Kader-arbeit im Sinne des kommunistischen Parteienzentralismus zubetreiben. Mit dem Putsch vom August 1991 versetzte sich derParteiapparat dann selbst den Todesstoß. Ende Mai 1990 wurdedie Zahl der internen Flüchtlinge in der Sowjetunion auf mehrals eine halbe Million geschätzt. Diese Zahl ist ständig weiterge-wachsen. Genaue Statistiken für die nachfolgende Zeit fehlen.
272
Ganze Völkergruppen sind aus ihren Siedlungsgebieten aufge-brochen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten, weil wirtschaftli-che und soziale Strukturen für ihre Existenz zusammenbrachen.Diese Entwicklung illustrierte den Zerfall der Staatsordnung ambedrückendsten. Eine weitere Flüchtlings- und Emigrationswellewird über die Landesgrenzen hinweg das Ausland erreichen,sobald Millionen von ehemaligen Sowjetbürgern die im Westenübliche Reisefreiheit erhalten. Schon jetzt ist die Emigration fürzwei Völker der erstrebenswerte Weg, die zerfallende Sowjetuni-on zu überwinden: Von den zwei Millionen Deutschen und denverbliebenen 1,8 Millionen Juden stellen jährlich Hunderttausen-de einen Ausreiseantrag. Wenn diese Emigrationswelle anhält,dann werden in einigen Jahren wahrscheinlich nur noch jeweilsein Fünftel der Deutschen und der Juden auf dem Territoriumder alten Sowjetunion zurückbleiben. Wichtiges Argument fürdie Auswanderung der Deutschen ist die Tatsache, dass sie einhalbes Jahrhundert nach Zerschlagung ihrer Republik immernoch nicht mit der Wiederherstellung ihrer Autonomie rechnenkönnen. Die Juden, denen eine entlegene Region in Fernost alsAutonomes Gebiet zugewiesen wurde, obwohl sie zu 95 Prozentim europäischen Teil der Sowjetunion siedelten, werden durcheinen zunehmend aggressiven Antisemitismus außer Landesgetrieben. Doch das erstaunlichste am Zerfall der Sowjetunionist die Tatsache, dass in der Folge nur lokal begrenzte Kriegeentflammt sind. Weder das Militär, das in Russland ohnehin nieeine direkte politische Rolle gespielt hat, noch der Parteiapparatund auch nicht die explosive nationale Frage haben den Zerfallin einen Steppenbrand verwandelt. Die lokalen Kriege entstan-den und entstehen weiter an den Schnittpunkten jener Periphe-rie, die nicht mehr von einer Zentralmacht integriert werden, dieaber auch noch nicht neuen Machtzentren zugerechnet werden.
Eines der bedrückenden Beispiele dafür ist Moldawien unddie Dnjestr-Region. Der Konflikt belegt exemplarisch, dass nachdem Zerfall der Sowjetunion die gesamte Westgrenze des ehema-ligen UdSSR zur Disposition steht. Denn durch die russischeund später durch die sowjetische Expansion nach Westen wur-den Staatsgrenzen ungeachtet der ethnischen Siedlungsgrenzen
273
gezogen. Dies galt zuletzt für den Hitler-Stalin-Pakt, mit dem diebeiden Diktatoren 1940 Europa aufgeteilt haben. Das Baltikum,Ostpolen und die östlichen Gebiete Rumäniens waren davonbetroffen. Insofern ist der Moldawienkonflikt ein Erbe des Hit-ler-Stalin-Paktes. Bessarabien und die Nordbukowina als östlicheTeile Rumäniens fielen an die Sowjetunion. Deren nördliche undsüdliche Gebiete wurden wiederum der Ukraine zugeschlagen.Aus dem Rest entstand die damalige sozialistische MoldawischeSowjetrepublik. Verwirrend an der territorialen Gliederung ist dieTatsache, dass Moskau schon zuvor eine moldawische autonomeRepublik innerhalb der Ukraine geschaffen hatte, um den An-spruch auf Bessarabien begründen zu können. Der Großteildieser ersten autonomen Republik fiel wieder an die Ukrainezurück. Ein kleiner Landstreifen jenseits des Dnjestr verblieb inder neuen Moldawischen Sowjetrepublik. Es ist jenes Gebiet, indem nun Russen in der selbst ausgerufenen Dnjestr-Republik zuden Waffen greifen, weil sie fürchten, Opfer einer moldawischenEigenstaatlichkeit oder gar Opfer einer Wiedervereinigung mitRumänien zu werden.
Neben den Russen und den Moldawiern, von denen sich letz-tere inzwischen teilweise wieder als Rumänen betrachten, werdennoch zwei weitere Nationen in diesen Konflikt mit hineingezo-gen. Die Ukrainer und die Gagausen: Rumänien, das sich aufeinen nationalen Wiedervereinigungstaumel zu bewegt, will nichtnur den Zusammenschluss mit Moldawien, sondern fordert vonder Ukraine auch jene Gebiete der Nordbukowina und Bessara-biens zurück, die von Stalin der Ukraine zugeschlagen wurden.
Die Gagausen wiederum sind ein christianisiertes Turkvolk,das erst in der Sowjetzeit seine Identität zu definieren begannund ebenso wie die Russen in Moldawien eine eigene Republikausgerufen hat. Überlagert wird dieser Konflikt von kirchlichenAuseinandersetzungen, die zusätzlich emotionale Unberechen-barkeiten in sich bergen. Moskau hatte historisch eine Schutz-machtrolle gegenüber den anderen orthodoxen Nationen bean-sprucht. Auch der frühere Zugriff auf das Donau-Delta und aufBessarabien unter den Zaren wurde mit diesem Argument ge-rechtfertigt. Stalin setzte trotz seiner scharfen Atheismuskam-
274
pagnen dieselbe Linie fort und erzwang, dass die Ukraine, aberauch Moldawien dem Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche unterstellt wurden.
Damit beging Stalin einen zweifachen Fehler, der sich in derGegenwart bitter rächt: Erstens verbot Stalin die jeweils mit Romunierten Kirchen im byzantinischen Ritus und zwang derenGeistlichen zur Orthodoxie russischer Prägung. Zweitens miss-achtete Stalin die nationalkirchliche autokephale Identität derUkrainer, aber auch Moldawier, die wiederum sich zur rumä-nisch-orthodoxen Kirche bekannten. Allerdings konnte manJahrzehnte nach der Zwangsvereinigung in den Kirchen dermoldawischen Hauptstadt Chi�in�u (Kischinjow) dennoch ru-mänische Psalter auf dem Altar entdecken.
Jetzt kommt der Pendelschlag zurück. Das heißt: nicht nurnationale, sondern auch nationalkirchliche Selbständigkeit richtetsich mit emotionaler Wucht gegen alles Russische. Das gilt fürdie Ukraine ebenso wie für Moldawien. Für die nicht-rumänischen Völker in Moldawien ist diese Entwicklung gewis-sermaßen der Aufruf zu einem Selbstbehauptungskampf, derwiederum nur die gegenwärtigen Strukturen, nicht aber die histo-rische Entwicklung dieser Region berücksichtigt.
In dieser Lage erscheint es nahezu ausgeschlossen, die wider-streitenden Nationen davon zu überzeugen, dass nationaleSelbstbestimmung und staatliche Souveränität in einem vereintenEuropa keine Konkurrenten sein müssen. Doch der Zerfall derSowjetunion hat nicht nur neues zwischenstaatliches Konfliktpo-tential freigesetzt. Auch innerstaatlich lässt sich eine Revitalisie-rung verdrängter Konflikte beobachten. Das gilt für den Dissenszwischen der Tschechei und der Slowakei oder für den Aufbruchethnischer und religiöser Minderheiten wie die Türken undPomaken in Bulgarien.
Russland ist durch den Zerfall der alten Zentralmacht derma-ßen geschwächt, dass Moskau auch nicht mehr historische Be-ziehungen nutzen kann, um seinen Einfluss auf andere Krisen-herde in Ost- und Südosteuropa geltend zu machen. Dies zeigtesich in bedrückender Weise im Jugoslawien-Krieg, der letztlichauch eine Folge des Zusammenbruchs der sozialistischen Staa-
275
tenwelt ist. Mit dem Kriegsverlauf im zerfallenen Jugoslawienleben in den Köpfen der Menschen auf dem Balkan regionaleGrenzziehungen wieder auf, die mit den heutigen Staatsgrenzennicht übereinstimmen. Deshalb musste der Zerfall Jugoslawienseine Vielzahl von Begehrlichkeiten innerhalb der neu gegründe-ten Nachfolgestaaten ebenso wie bei den Nachbarn wecken mitdem Ziel, bei einer Neuordnung möglichst viele nationalpoliti-sche Interessen durchzusetzen. Dadurch wurde eine Vielzahl vonRegionalproblemen wiederbelebt, die man glaubte, durch politi-sche Disziplinierung innerhalb der sozialistischen Länder zumin-dest verdrängt zu haben. Politiker müssen sich nun Begriffe neuaneignen, die bereits den Geschichtsbüchern zugedacht waren.
Die Muslime im Sandschak, einem Gebiet zwischen Serbienund Montenegro, wollen sich keinem serbisch dominiertenRumpf-Jugoslawien unterwerfen.
Die Albaner im Kosovo drängen auf Eigenstaatlichkeit. Na-tionalistische Zirkel in Griechenland deklarieren Südalbanienzum „besetzen Gebiet Nordepirus“.
Die Dreiteilung Makedoniens in Agäis-Makedonien (Grie-chenland), Vardar-Makedonien (die bisherige jugoslawische Teil-republik) und Pirin-Makedonien (Bulgarien) wird von jedem derbetroffenen Staaten zum Ausgangspunkt politischer Forderun-gen an die übrigen Nachbarn genommen.
Die Dobrudscha, zwischen Bulgarien und Rumänien geteilt,gewinnt für Nationalisten auf beiden Seiten plötzlich wieder anBedeutung.
Die Nordbukowina und Südbessarabien, heute zur Ukrainegehörig, wird von Rumänien als genuines rumänisches Landebenso zurückgefordert wie Moldawien.
Selbst in Weißrussland haben sich Stimmen erhoben, die ei-nen Teil Litauens zurückfordern.
Ungelöst ist die Rolle vom Oblast Kaliningrad, dem alten öst-lichen Ostpreußen, das administrativ nun zu Russland gehört,von diesem jedoch durch Litauen abgetrennt ist.
Noch komplizierter sind die Verhältnisse im Kaukasus, woVölker administrativ ebenso geteilt wurden wie im ehemaligenSowjet-Zentralasien. Ein kompliziertes Beispiel aus Zentralasien:
276
Die alte Oase Choresm ist zwischen Turkmenistan, Karakalpa-kien und Usbekistan aufgegliedert. Es entsteht jedoch bei seinenBewohnern über die drei Republikgrenzen hinweg das alte Zu-sammengehörigkeitsgefühl. Eine solche Bestandsaufnahme nährtden Eindruck, der Zerfall der Sowjetunion habe nur Chaos hin-terlassen, ohne den Völkern eine echte Chance auf Selbstbe-stimmung in wirtschaftlicher Unabhängigkeit einzuräumen. Mankann die verspielten Rechte dieser Völker nicht mehr beimHauptschuldigen, der Sowjetunion, einklagen. Die Sowjetunionexistiert nicht mehr. Aber es existieren noch die Völker und ihreRegionen. Sie werden sich regionalpolitisch neu orientieren undauf Jahrzehnte hinaus Kostgänger westlicher Wirtschaftshilfebleiben. Weitere Kriege sind wahrscheinlich angesichts der Aus-einandersetzungen um alte und neue Grenzziehungen. Nur diewestliche Peripherie des riesigen Imperiums, die mittelosteuropä-ischen Staaten, hat eine ehrliche Chance zur schnellen Assoziie-rung an Europa mit der Konsequenz eines freien Waren- undPersonenverkehrs. Für alle anderen Gebiete der zerfallenen Staa-tenwelt des Sozialismus sind die politischen Optionen noch nichtdefiniert.
277
ZEITTAFEL
1984Staats- und Parteichef Jurij Andropow, politischer Ziehvater von
Michail Gorbatschow, stirbt (9. Februar).Nachfolger als Parteichef wird Konstantin Tschernenko. Unter
dessen schwacher Führung werden begonnene Reformen vomParteiapparat abgeblockt.
1985Nach dem Tod von Konstantin Tschernenko (10. März) wird
Michail Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees derKPdSU (11. März). Er kündigte einen radikalen Umbau (Perest-rojka) von Wirtschaft und Gesellschaft an und fordert mehr Trans-parenz (Glasnost) im Umgang mit Vergangenheit und Gegenwart.
Gesetz zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs beschlossen(16. Mai), in dessen Folge die Alkoholproduktion gedrosselt, diePreise drastisch erhöht und hohe Strafen für Alkoholmissbrauch beider Arbeit eingeführt werden.
Gipfeltreffen zwischen Michail Gorbatschow und US-PräsidentRonald Reagan in Genf. (19. November)
1986XXVII. Parteitag (26. Februar bis 6. März), Einleitung der Wirt-
schaftsreform, Fortsetzung der personellen Veränderungen. Ausdem Parteiprogramm wird die Zielsetzung gestrichen, dass „dieheutige Generation im Kommunismus leben“ werde.
Kernkraftkatastrophe in Tschernobyl (26. April).Nationale Unruhen in Kasachstan, Parteichef Dinmuhamed
Kunajew wird abgelöst, bleibt jedoch noch im Politbüro (Dezem-ber).
Gorbatschow ruft den Bürgrechtler Andrej Sacharow in derVerbannung an und infromiert ihn über seine Befreiung (16. De-zember).
Sacharow kehrt aus siebenjähriger Verbannung nach Moskau zu-rück (23. Dezember).
278
1987Gorbatschow schlägt auf dem ZK-Plenum eine neue Wahlord-
nung für Parteifunktionäre vor: Zulassung von mehreren Kandida-ten, geheime Abstimmung (27. Januar).
Kunajew muss das Politbüro verlassen (28. Januar)Entlassung politischer Häftlinge (Februar).Privatwirtschaftliche Organisationsformen (Kooperativen) wer-
den legalisiert (Gesetz ab 1. Mai).Der 19-jährige Deutsche Mathias Rust landet nahe dem Roten
Platz (28. Mai).Der Verteidigungsminister Sergej Sokolow und der Chef der
Luftabwehrtruppe Alexander Koldunow werden entlassen. Rustwird zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt, jedoch vierzehn Monatspäter nach Deutschland ausgewiesen.
Erstmals geheime Abstimmung und Aufstellung von mehrerenKandidaten bei Teilwahlen auf Kommunalebene (21. Juni).
Gorbatschow verschärft seine Kritik an der Wirtschaftslage(„Vorkrisenstadium“) auf einem ZK-Plenum (25. Juni) und veröf-fentlicht seinen Weltbeststeller „Perestrojka“, in dem er auf dendrohenden Nationalismus in der Sowjetunion hinweist.
Erste ungehinderte Demonstrationen der Krimtataren am RotenPlatz (Juli/August)
Sowjetbürger erhalten Beschwerderecht gegen Übergriffe derBehörden (Gesetz 19. Oktober).
Nach heftiger Kritik am schleppnden Verlauf der Perestrojkawird Jelzi als Stadtparteichef von Moskau abgesetzt (11. November)und verliert im Februar 1988 seinen Sitz im Politbüro.
Beim Gipfeltreffen in Washington unterzeichnen Gorbatschowund US-Präsident Reagan den INF-Vertrag über die Vernichtungaller in Europa stationierten nuklearen Mittelstreckenraketen (8.Dezember).
1988Neues Unternehmensgesetz ermöglicht den Konkurs staatlicher
Betriebe (Gesetz ab 1. Januar).Sowjetunion geht erstmals mit öffentlicher Anleihe (100 Mio
CHF) auf internationalen Kapitalmarkt (Januar).
279
Parteichef von Usbekistan wird wegen Korruption abgesetzt (12.Januar).
In Estland, Litauen, Lettland und in Armenien beginnen natio-nale Massendemonstrationen, die zur Bildung von Unabhängig-keitsbewegungen führen (ab Februar).
Pogrom gegen Armenier in Sumgait/Aserbaidschan wegen Streitum Berg-Karabach (28. Februar).
Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und Mi-chail Gorbatschow in Moskau (25. Mai - 2. Juni)
Krimtataren, die unter Stalin nach Zentralasien deportiert wur-den, erhalten das Recht auf die Rückkehr in ihre Heimat (1. Juni)
Sowjetische Truppen kontrollieren das Autonome Gebiet Berg-Karabach /Nagornyj-Karabach) in Aserbaidschan (ab 22. Juni).
19. Parteikonferenz leitet die Reform des politischen Systemsein, das sich laut Gorbatschow „als unfähig erwiesen hat“. Ziel isteine Präsidialdemokratie mit einem frei gewählten Parlament (26.Juni bis 1. Juli).
Massendemonstrationen in den baltischen Republiken Estland,Lettland und Litauen für mehr Unabhängigkeit (23. August).
Gorbatschow übernimmt von Andrej Gromyko das Amt desVorsitzenden des Obersten Sowjets (Staatspräsident) (1. Oktober).
Das Parlament von Estland (Oberster Sowjet) verabschiedet ei-ne Souveränitätserklärung (16. November).
Nationale Demonstrationen greifen auf Georgien über (No-vember).
Gorbatschow kündigt vor der UNO einseitigen Truppenabbauum 500.000 Mann und Teilabzug sowjetischer Waffensysteme ausOsteuropa an (7. Dezember).
Am selben Tag verwüstet ein katastrophales Erdbeben Armeni-en; mindestens 25.000 Tote, eine Million Obdachlose.
1989Volkszählung in der Sowjetunion ergibt 285,76 Mio. Einwohner.Erdbeben in Tadschikistan, 227 Tote (23. Januar).Die Wochenzeitschrift Argumenty i Fakty veröffentlicht erst-
mals Zahlenangaben über die Stalin-Opfer: 15 Millionen Tote, neunbis elf Millionen Bauern vertrieben und nach Sibirien verbannt (5.Februar).
Sowjetunion zieht alle Truppen aus Afghanistan ab (15. Febru-
280
ar).In Weißrussland wird die Bewegung „Wiedergeburt“ (Adrad-
schenje) gegründet (21. Februar).Nach nationalen Demonstrationen wird in Tadschikistan die
bisherige Amtssprache Russisch durch Tadschikisch abgelöst (25.Februar).
Nationale Demonstrationen in Moldawien (ab 12. März).Erste Wahlen zum neu gegründeten Kongress der Volksdepu-
tierten mit unabhängigen Kandidaten. Dabei erhält „Parteirebell“und Gorbatschow-Gegner Boris Jelzin in Moskau 89 Prozent derStimmen (26. März).
Gründung der „Gesellschaft für die sowjetdeutsche Wiederge-burt“ (31. März).
Bei Truppeneinsatz gegen georgische Nationalisten in Tifliswerden 19 Menschen getötet (9. April).
110 ZK-Mitglieder der Breschnew-Zeit werden zwangspensio-niert und teilweise durch Reformkräfte ersetzt (25. April).
Das Parlament Litauens (Oberster Sowjet) verabschiedet eineSouveränitätserklärung (18. Mai).
Blutige Unruhen zwischen Usbeken und Mezcheten in Usbekis-tan. Über 100 Tote, 1.000 Verletzte. 15.000 Mezcheten werdenevakuiert (Juni).
Michail Gorbatschow besucht die Bundesrepublik Deutschland(12. -15. Juni).
Nationale Unruhen in Kasachstan, fünf Tote (ab 17. Juni).Michail Gorbatschow besucht Frankreich (5. Juli).Streiks in den sibirischen und ukrainischen Kohlerevieren
(ab 11. Juli).Nationale Unruhen zwischen Georgiern und Abchasen, zwanzig
Tote (15. Juli).Gorbatschow spricht als erster Ostblockführer vor dem Europa-
rat (6. Juli).Im Parlament (Oberster Sowjet) der Sowjetunion schließen sich
Radikalreformer zu einer Fraktion zusammen (30. Juli).Zwei Millionen Balten bilden eine 600 Kilometer lange Men-
schenkette. Sie fordern, das Geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes, dessen Existenz von der Sowjetunion jahrzehntelangbestritten wurde, für nichtig zu erklären (23. August).
281
In Moldawien demonstrieren 300.000 Menschen (27. August)und setzen Moldawisch als Amtssprache durch (31. August).
In Kiew wird die ukrainische Nationalbewegung „Ruch“ ge-gründet (10. September).
Kasachstan (22. September), Kirgisien (23. September) und dieUkraine (28. Oktober) ersetzen Russisch durch nationale Amtsspra-chen.
Der Oberste Sowjet verkündet die „volle Rehabilitierung derSowjetdeutschen und anderer deportierter Völker“ (14. November).
Michail Gorbatschow wird als erster Staats- und Parteichef derUdSSR in Rom vom Papst empfangen (1. Dezember).
Gipfeltreffen von US-Präsident George Bush und Michail Gor-batschow vor der Insel Malta „Der Kalte Krieg ist zu Ende“. (2./3.Dezember).
Andrej Sacharow stirbt in Moskau (15. Dezember).Litauische Kommunisten trennen sich von der KPdSU (20. De-
zember).Volkskongress verurteilt den Hitler-Stalin (Molotow-
Ribbentrop)-Pakt (Annullierung des Geheimes Zusatzprotokolls)und die Invasion der Sowjetunion in Afghanistan (26. Dezember).
1990Pogrome gegen Armenier in Baku, 22 Tote (13. Januar).Sowjetarmee geht gegen aserbaidschanische Nationalisten vor
(142 Tote) (21. Januar).Sowjetischer Truppenabzug aus der Tschechoslowakei verein-
bart (9. Februar).Gorbatschow stimmt der deutschen Einheit bei einem Besuch
von Bundeskanzler Kohl zu (11./12. Februar).Sowjetischer Truppenabzug aus Ungarn vereinbart (10. März).Litauen erklärt seine Unabhängigkeit und wählt einen nicht-
kommunistischen Präsidenten (11. März).Volkskongress streicht das Machtmonopol der Kommunisti-
schen Partei aus der Verfassung (13. März), neue Parteien bildensich.
Gorbatschow wird in das neu geschaffene, mächtige Amt desPräsidenten gewählt (15. März).
Gorbatschow fordert vor dem neu geschaffenen Präsidialrat ei-nen „kontrollierten Übergang zur Marktwirtschaft“. (28. März).
282
Estland beschließt Unabhängigkeit, jedoch mit Übergangsperio-de und Verhandlungen mit Moskau (30. März).
Nach erfolglosem Ultimatum zur Rücknahme der Unabhängig-keitserklärung verhängt Gorbatschow Sanktionen gegen Litauen;Ölversorgung wird eingestellt, Erdgaslieferung um 80 Prozent ge-drosselt (17. April).
Protest gegen Gorbatschow bei der Maiparade auf dem RotenPlatz (1. Mai)
Lettland beschließt seine Unabhängigkeit nach einer nicht näherbezeichneten Übergangszeit (4. Mai).
Gorbatschow annulliert die Unabhängigkeitserklärungen vonEstland und Lettland (14. Mai).
Parteirebell Boris Jelzin wird zum Präsidenten der RussischenFöderation (RSFSR) gewählt (25. Mai).
Bei Zusammenstößen mit der Armee sterben in Eriwan 24 Men-schen (27. Mai).
Nationale Unruhen in Kirgisien mit 139 Toten (4. Juni).Die Russische Föderation verkündet ihre Souveränität und er-
klärt ihr Recht auf Austritt aus der Sowjetunion (12. Juni).Der Oberste Sowjet Usbekistans beschließt die Souveränität der
Usbekischen Sowjetrepublik (12. Juni).Mit Moldawien (24. Juni) und Weißrussland (27. Juli) folgen wei-
tere Sowjetrepubliken. Dieser Entwicklung schließen sich immermehr Sowjetrepubliken an, bis mit Karelien (10. August) erstmalseine Autonome Republik innerhalb der Russischen Föderation sichfür souverän erklärt. Ziel dieser Souveränitätserklärungen ist es,Republikrecht über Unionsrecht zu stellen und Anspruch auf dieeigenen Bodenschätze zu erheben. Die Bildung eigener Armeen undWährungen ist angestrebt. Damit wird die Umwandlung der Sowjet-union von einem föderativen Staat zu einer Konföderation vonsouveränen Staaten eingeleitet.
USA-Reise von Michail Gorbatschow. Er vereinbart mit Präsi-dent George Bush eine weitere Reduzierung strategischer Atomwaf-fen und die Produktionseinstellung für chemische Waffen (31. Juni).
28. Parteitag für Fortsetzung der Reformen (4. Juli)Boris Jelzin und seine Anhänger in der „Demokratischen Platt-
form“ treten aus der KPdSU aus (12. Juli).Kaukasus-Treffen von Gorbatschow und Kohl besiegelt deut-
sche Einheit (14.-16. Juli)
283
Ein neues Mediengesetz führt die Pressefreiheit ein (1. August).Gorbatschow rehabilitiert Millionen Opfer der Stalin-Zeit (13.
August) und annulliert die Ausbürgerung von Solschenizyn,Brodskij und anderen Dissidenten (14. August).
Massenproteste von geschätzen 200.000 Demonstranten gegendie Regierung und für die Einführung der Marktwirtschaft (16.September).
Alexander Solschenizyn veröffentliche in 20 Millionen Exempla-ren sein Manifest, in dem er die Auflösung der Sowjetunion und denZusammenschluss der slawischen Völker verlangt (18. September).
Angesichts katastrophaler wirtschaftlicher Verhältnisse und poli-tischer Unruhen erteilt das Parlament Gorbatschow befristet biszum 31. März 1992 Sondervollmachten, um die Reform zu be-schleunigen und „die Rechtsordnung zu festigen“ (24. September).
Per Gesetz wird allgemeine Religionsfreiheit eingeführt (1. Ok-tober).
Die Gleichstellung aller Parteien wird beschlossen, die Sonder-rolle der KPdSU beendet (9. Oktober).
Michail Gorbatschow erhält den Friedensnobelpreis (15. Okto-ber).
Oberster Sowjet billigt die Einführung der Marktwirtschaft underweitert die Befugnisse von Präsident Gorbatschow (19. Oktober).
Außenminister Schewardnadse tritt zurück und warnt vor einemPutsch (20. Dezember).
Ein neuer Unionsvertrag soll die auseinanderstrebenden Repub-liken wieder zusammenführen (27. Dezember).
1991Gorbatschow verordnet eine Landreform, klammert jedoch die
Frage der Privatisierung aus (5. Januar).Gorbatschow entsendet Truppen in das Baltikum (8. Januar)
und stellt Litauen ein Ultimatum, auf die Unabhängigkeit zu ver-zichten (10. Januar).
Blutige Zusammenstöße in der litauischen Hauptstadt Vilnius 15Tote, hunderte Verletzte (13. Januar).
Gorbatschow und Verteidigungsminister Jasow leugnen Ver-antwortung für das militärische Vorgehen (14. Januar).
Sondertruppen stürmen das lettische Innenministerium in Riga,vier Tote, elf Verletzte. Ein von Moskau gestütztes „Komitees zur
284
nationalen Rettung“ erklärt die demokratisch gewählten Regierun-gen in Litauen und Lettland für abgesetzt (20. Januar).
Massenproteste in Moskau gegen Gorbatschow und die drohen-de Abkehr vom Reformkurs (20. Januar).
Per Dekret verfügt Gorbatschow eine Währungsreform, um denSchwarzmarkt einzudämmen (22. Januar).
Gorbatschow ermächtigt Armee, Polizei und KGB notfalls ge-waltsam gegen die Wirtschaftskriminalität vorzugehen (26. Januar).
Trotz starker Bedenken gegen Gorbatschows Nationalitätenpoli-tik gewährt die Europäische Gemeinschaft weitere Wirtschaftshilfefür die Sowjetunion (28. Januar).
Gorbatschow erklärt sich öffentlich mit einem „Rechtsruck“einverstanden, um den Zerfall des Staates aufzuhalten (7. Februar).
76 Prozent der Bevölkerung votieren in einem Referendum fürden Erhalt der UdSSR (17. März).
Gorbatschow verfügt teilweise drastische Preiserhöhungen (19.März).
Gorbatschow lässt Militärsperren gegen Demonstranten errich-ten, die in Moskau für Jelzin auf die Straße gehen (29. März).
Wochenlange Streiks in den russischen Bergwerken lähmen dieWirtschaft (ab Anfang April).
Einigung auf einen Unionsvetrag zwischen Gorbatschow undVertretern der 15 Unionsrepubliken 24. April).
Gorbatschow bietet im Zentralkomitee seinen Rücktritt als Par-teichef der KPdSU an (25. April).
Gorbatschow verbietet per Dekret Streiks in Schlüsselbereichender Wirtschaft und des Energiesektors (16. Mai).
Die „Union Sozialistischer Sowjetrepubliken“ wird in die „Uni-on Souveräner Sowjetrepubliken“ umbenannt (11. Juni).
Massenarbeitslosigkeit greift um sich.Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW, COMECON)
und der Warschauer Pakt werden aufgelöst (27. Juni und 1. Juli).Der ehemalige Außenminister Schewardnadse tritt aus der
Kommunistischen Partei aus (4. Juni).Gorbatschow wirbt in London bei den Vertretern der sieben
wichtigsten Industriestaaten vergeblich um konkrete Wirtschaftshil-fe für die Sowjetunion 17. Juli).
Der sowjetische Präsident Gorbatschow und der amerikanischePräsident Bush unterzeichnen den START-Vertrag (Strategic Arms
285
Reduction Talks) über den Abbau der strategischen Atomwaffen(31. Juli).
Alexander Jakowlew, einer der „Chefarchitekt“ der Perestrojka,tritt aus der Kommunistischen Partei aus (16. August).
Putsch einer kommunistischen Junta gegen Gorbatschow, der inseiner Ferienresidenz gefangen genommen wird (19. August).
Die für den 20. August geplante Unterzeichnung eines neuenkonföderalen Staatssystems (ohne Lettland, Litauen, Estland, Geor-gien, Moldawien und Armenien) entfällt. Die Junta („Notstandsko-mitee“) mit Gennadij Janajew an der Spitze erlässt ein Demonstrati-ons-, Streik- und Presseverbot und beauftragt KGB-Soldaten mitder Verhaftung von Boris Jelzin und der Erstürmung des Parla-ments in Moskau. Demonstranten beschützen das Parlament(„Weiße Haus“), die Armee verweigert der Junta den Gehorsam.Der Staatsstreich bricht nach drei Tagen zusammen.
Jelzin widersetzt sich den Putschisten und ermöglicht die Rück-kehr Gorbatschows nach Moskau (22. August).
Jelzin verbietet innerhalb Russlands jede politische Tätigkeit fürdie Kommunistische Partei, bis deren Rolle beim Putsch geklärt ist(23. August).
Gorbatschow tritt als Parteichef der KPdSU zurück (24. Au-gust), blieb aber bis zum 25. Dezember 1991 Staatspräsident derSowjetunion.
Am selben Tag (24. August) erklärt die Ukraine ihre Souveräni-tät. Alle anderen Republiken folgen in den kommenden Wochen.
Der Oberste Sowjet verbietet landesweit die KommunistischePartei und hebt die Sondervollmachten für Präsident Gorbatschowauf (29. August).
Der Kongress der Volksdeputierten beschließt mit 1682 Ja-Stimmen, 43 Nein-Stimmen und 63 Enthaltungen das Ende derSowjetunion und deren Umwandlung in einen Bund unabhängigerRepubliken (5. September).
In der Deklaration von Alma-Ata bestätigen elf der fünfzehnSowjetrepubliken (außer Estland, Lettland, Litauen und Georgien)die Auflösung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (21.Dezember)
Gorbatschow übergibt die Amtsgeschäfte als Staatspräsident anBoris Jelzin, den Präsidenten der Russischen (eigentlich: Russländi-
286
schen111) Föderation (25. Dezember).Die Ratifikationsurkunden zum Beschluss von Alma-Ata werden
hinterlegt (26. Dezember).Die Sowjetunion hört am 31. Dezember 1991 auf zu existieren.
Die Russländische Föderation ist Rechtsnachfolger der UdSSR. Dierote Flagge der Sowjetunion mit Hammer und Sichel wird gegen dieweiß-blau-rote Fahne der Russländischen Föderation ausgetauscht.
111 Vgl. die Ausführungen S. 14 zum unterschiedlichen Sprachgebrauch derBezeichnung auf Russisch und Deutsch.
287
SCHRIFTEN VON M. S. GORBATSCHOWAUF DEUTSCH112
1986• Aufbruch ins Jahr 2000. Der sowjetische Abrüstungsplan, die
inneren Reformen der Sowjetunion und Westeuropa. Pahl-Rugenstein: Köln.
• Ausgewählte Reden und Schriften. (1967-1986) Dietz: Berlin.• Das Moratorium. Der Generalsekretär des ZK der KPdSU zum
Problem der Einstellung der Nukleartest (Januar–September1986). APN: Moskau.
• Ergebnisse und Lehren von Reykjavik. Gipfeltreffen in derHauptstadt Islands, 11-12. Oktober 1986. APN: Moskau.
• Neue Dimensionen sowjetischer Politik. 3 Reden. Pahl-Rugenstein: Köln.
• Noch einmal Reykjavik: Die Völker müssen die Wahrheit wis-sen. Ansprache des Generalsekretärs des ZK der KPdSU imSowjetischen Fernsehen, 22. Oktober 1987. APN: Moskau.
• Politischer Bericht des Zentralkomitees der KPdSU an denXXVII. Parteitag 1986. Bericht des Generalsekretärs des ZK derKPdSU 25. Februar 1987. APN: Moskau.
1987• Ausgewählte Reden und Aufsätze. Band 1-3. Dietz: Berlin.• Ausgewählte Reden und Aufsätze. Progress: Moskau.• Das neue Europa. Christians: Hamburg.• Der Schöpfer der Umgestaltung ist das Volk. Ansprachen des
Generalsekretärs des ZK der KPdSU bei seinem Aufenthalt inLettland und Estland. APN: Moskau.
112 Die Liste kann Doppelungen enthalten, weil deutsche Verlage zuweilendeutschsprachige Ausgaben von APN Moskau unter anderem Titel nachge-druckt haben. Außerdem gibt es zahlreiche erweiterte Neuauflagen, dienicht alle erfasst werden konnten.
288
• Die Jugend als schöpferische Kraft der revolutionären Erneue-rung. APN: Moskau.
• Die Rede: „Wir brauchen die Demokratie wie die Luft zumAtmen.“ Referat vor dem ZK der KPdSU am 27. Januar 1987.Rowohlt: Reinbeck.
• Die Rede zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution. Mit einemVorwort von Lutz Lehmann. Bastei Lübbe: Bergisch Gladbach.
• Die Umgestaltung ist das ureigenste Anliegen des Volkes. Redenauf dem XVIII. Kongreß der Gewerkschaften der UdSSR. APN:Moskau.
• Frieden durch Abrüstung. Reden, Interviews, Stellungnahmen.Friedensliste: Bonn.
• Für die Unsterblichkeit der menschlichen Zivilisation.Darmstädter Blätter: Darmstadt.
• Für eine kernwaffenfreie Welt. Der Generalsekretär des ZK derKPdSU zu Problemen der nuklearen Abrüstung. Januar 1986 –Januar 1987.
• Grußansprache an die Teilnehmerinnen des Weltfrauenkongres-ses. Moskau, 23. Juni 1987. APN: Moskau.
• Oktober und Umgestaltung. Die Revolution geht weiter. APN:Moskau
• Perestroika. Die zweite russische Revolution. Eine neue Politikfür Europa und die Welt. Droemer Knaur: München.
• Perestrojka. Der revolutionäre Weg der Umgestaltung. Die Redezum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution – mit einem Kommen-tar von Hans-Peter Riese. Heyne: München.
• Über die Aufgaben der Partei bei der grundlegenden Umgestal-tung der Leitung der Wirtschaft. Bericht und Schlußwort desGeneralsekretärs des ZK der KPdSU auf dem Plenum des ZKder KPdSU am 25.-26. Juni 1987. APN: Moskau.
• Über die Umgestaltung und die Kaderpolitik der Partei. Berichtund Schlußwort des Generalsekretärs des ZK der KPdSU aufdem Plenum des ZK der KPdSU am 27.-28. Januar 1987. APN:Moskau.
• Umgestaltung und das neue Denken für unser Land und für dieganze Welt. Dietz: Berlin.
289
• Was ich wirklich will. Antworten auf die Fragen der Welt. Orac:Wien.
• „Zurück dürfen wir nicht. ‚perestrojka’ und ‚glasnost’ einekommentierte Auswahl der wichtigsten Reden von 1984-1987.Hrsg. Von Horst Temmen. Goldmann: München.
1988• Ausgewählte Reden und Aufsätze Band 4. Dietz: Berlin.• Die revolutionäre Umgestaltung – eine Ideologie der Erneue-
rung. Rede des Generalsekretärs des ZK der KPdSU auf demPlenum des ZK der KPdSU am 18. Februar 1988.
• Durch Demokratisierung zum neuen Antlitz des Sozialismus.Treffen der KPdSU mit den Leitern der Massenmedien, der ide-ologischen Einrichtungen und der Berufsverbände der Kultur-schaffenden, 7. Mai 1988. APN: Moskau.
• Perestroika. Die zweite Etappe hat begonnen. Eine Debatteüber die Zukunft der Reformpolitik. Pahl-Rugenstein: Köln.
• Was ich wirklich will. Erweiterte Neuausgabe. Ullstein: Frank-furt/M.
• XIX. Unionskonferenz der KPdSU. Dokumente und Materia-lien. Bericht des Generalsekretärs des ZK der KPdSU, MichailGorbatschow. Entschließungen. APN: Moskau.
1989• Die Uno-Rede vom 7. Dezember 1988 sowie ein Beitrag aus der
Prawda vom 27. September 1987. Dreisam: Freiburg im Breis-gau.
• Glasnost. Das neue Denken. Mit einem Vorwort an meine deut-schen Leser. Ullstein: Berlin.
• Gorbatschow in Bonn. Die Zukunft der deutsch-sowjetischenBeziehungen. Reden und Dokumente. Pahl-Rugenstein: Köln.
• Gorbatschow. Die wichtigsten Reden. (Politik und Zeitgeschich-te). Pahl-Rugenstein: Köln.
• Reden und Aufsätze zu Glasnost und Perestroika. Progreß:Moskau.
290
1990• Ausgewählte Reden und Aufsätze Band 5. Dietz: Berlin.• Das gemeinsame Haus Europa und die Zukunft der Deutschen.
Erweiterte Neuausgabe. Econ: Düsseldorf.• Das Volk braucht die ganze Wahrheit. Dietz: Berlin.• Der außerordentliche III. Kongress der Volksdeputierten der
UdSSR. Rede des Präsidenten der UdSSR, Michail Gor-batschow. Moskau, Kreml, 15. März 1990. APN: Moskau.
• Meine Vision. Die Perestrojka in den neunziger Jahren. So gehtes weiter. Erweiterte Auflage. Horizonte: Rosenheim.
• Neue Dimensionen sowjetischer Politik. Drei Reden. Pahl-Rugenstein: Köln.
• Perestrojka oder düstere Zeiten für unser Land. Politischer Be-richt des ZK der KPdSU an den 28. Parteitag der KPdSU. 2. Juli1990. Dietz: Berlin.
1991• Der Staatsstreich. Bertelsmann: München.
1992• Auf dem Weg zu einer europäischen Architektur. Reden des
Deutschlandbesuches vom 4. Bis 11. März 1992. Bertelsmann-Stiftung: Gütersloh.
• Der Zerfall der Sowjetunion. Bertelsmann: München.
1993• Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit.
Rowohlt: Berlin.
1995• Erinnerungen. Siedler: Berlin.
1998• Die wichtigsten Reden. Pahl-Rugenstein: Köln• Unsere Wege treffen sich am Horizont (mit Daisaku Ikeda).
Goldmann: München.
291
1999• Wie es war. Die deutsche Wiedervereinigung. Ullstein: Berlin.
2000• Über mein Land. Rußlands Weg ins 21. Jahrhundert. Beck:
München.
2003• Mein Manifest für die Erde. Jetzt handeln für Frieden, globale
Gerechtigkeit und ökologische Zukunft. Campus: Frankfurt amMain.
2013• Alles zu seiner Zeit. Mein Leben. Hoffmann und Campe: Ham-
burg.
2015• Das neue Russland. Umbruch und das System Putin. Quadriga:
Köln• Triumpf der moralischen Revolution (mit Daisaku Ikeda). Her-
der: Freiburg iim Breisgau.
2017• Kommt endlich zur Vernunft. Nie wieder Krieg (mit Franz Alt).
Benevento: Salzburg.
292
NAMENSREGISTER
A
Abalkin, Leonid, 68Abuladse, Tengis, 93, 107, 162,
181, 182, 183Achmatowa, Anna, 33, 164Achromejew, Sergej, 59, 60,
61, 62Adschubej, Alexej, 187Afanasjew, Juri, 91Afanasjew, Jurij, 67, 91, 92,
107, 161, 186, 191, 192,193, 194, 258
Aganbegjan, Abel, 84, 143Alijew, Gejdar, 38, 147, 148Andropow, Jurij, 17, 18, 37,
38, 39, 42, 43, 44, 46, 56,57, 61, 90, 123, 124, 145,148, 199, 245, 255, 268, 277
Arbatow, Georgij, 115Askoldow, Arkadi, 165
B
Bahr, Egon, 116Bakatin, Wadim, 269Baklanow, Oleg, 248Barschewskij, Dmitrij, 185Bastian, Gerd, 117Bauer, Peter, 255Begun, Josef, 115Berija, Lawrentij, 182Bonner, Jelena, 25Bontschowskij, Dmitrij, 126Bowin, Alexander, 51, 52, 93,
107
Breschnew, Leonid, 39, 43, 53,54, 61, 83, 110, 255, 256,280
Brodskij, Josef, 161, 283Bucharin, Nikolaj, 91, 188
Bulgakow, Michail, 164Burlatzki, Fjodor, 187Bush, George, 281, 282, 284
C
Castro, Fidel, 40Chanum, Churanan, 213Charitonow, Nikolaj, 179Chatschaturow, Karen, 213Chruschtschow, Nikita, 51, 84,
93, 185, 186, 187, 188, 199,236
Churchill, Winston, 177
D
Demitschew, Pjotr, 200Derojan, Georgij, 154Dole, Robert, 54
F
Falin, Valentin, 86, 99Filipowna, Tatjana, 42
G
Gabrilowitsch, Jewgenij, 186Gagarin, Jurij, 186
293
Gamsatow, Rassul, 206Garibow, A., 209Gorbatschow, Michail S., 10,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 30, 31, 32, 33, 34, 35,37, 38, 42, 43, 44, 45, 46,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 61, 62, 63, 64, 66,67, 68, 69, 72, 75, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, 88, 89, 90, 94, 95, 96,97, 98, 99, 100, 101,103,104, 105, 108, 109, 110,111, 112, 114, 115, 116,117, 128, 129, 132, 133,138, 139, 140, 141, 145,148, 149, 152, 161, 163,167, 168, 185, 186, 194,198, 200, 202, 203, 204,205, 207, 208, 210, 222,223, 227, 234, 235, 240,245, 246, 247, 248, 249,250, 251, 252, 253, 254,255, 256, 257, 258, 259,260, 261, 262, 263, 266,267, 268, 269, 270, 271,277, 278, 279, 280, 281,282, 283, 284, 285
Gorbatschowa, R.M., 31Green, Graham, 115Gromyko, Andrej, 38, 46, 90,
177, 200, 201, 202, 255, 279Gumiljow, Nikolaj, 33, 91,
106, 161, 163
H
Hitler, Adolf, 178, 262, 273,280, 281
Honecker, Erich, 178Houston, Whitney, 157
I
Illin, Igor, 151Israel, Jurij, 122
J
Jackson, Michael, 157Jakowlew, Alexander, 53, 55,
56, 248Janaew, Gennadi, 248Jasow, Dmitrij, 57, 270, 283Jelzin, Boris, 9, 31, 32, 69, 140,
193, 223, 225, 227, 245,247, 248, 250, 251, 252,253, 257, 261, 266, 280,282, 284, 285
Jewtuschenko, Jewgenij, 139,140, 200
K
Karmal, Babrak, 40Kelly, Petra, 117Kohl, Helmut, 40, 255, 256,
281Kolbin, Gennadij, 204Koldunow, Alexander, 278Komarow, Boris, 122Kondratjew, Wladimir, 168Konowalow, Stanislaw, 127Korjagin, Anatol, 115Krawtschenko, Leonid, 171,
172Kunajew, Dinmuhammed, 52,
53, 58, 141, 204, 277, 278
L
Landsbergis, Vytautas, 217,222
le Carré, John, 158
294
Lenin, Wladimir I., 68, 71, 95,129, 133, 191, 192, 193,194, 246, 255
Leonhard, Wolfgang, 33Ligatschow, Jegor, 69, 70, 140,
156, 193, 206Ljubimow, Jurij, 164
M
Mandelstam, Nadjeshda, 33Matwjejew, Jewgenij, 177Medwedew, Dmitri, 9Medwedjew, Roy, 188Meyer-Landrut, A., 206Moltschanow, Wladimir, 169
N
Nabokow, Wladimir, 162Nadschibullah, Muhammed,
28, 29, 30, 153, 240, 241,242
Nikolaus II., Zar, 202Nikonow, Viktor, 56Nowgorodzew, Sewa, 94Nurpeisow, Abdishmail, 122
O
Oganessjan, 214Oganessjan, Manuel, 214Ogarkow, Nikolai, 61, 62Okudshawa, Bulat, 200Olejnik, Boris, 67Omelitschew, Bronislaw, 269Ortega, Daniel, 40
P
Pasternak, Boris, 91, 106, 160,162, 163
Patiaschwili, Dschumber, 220,221
Podnijeks, Juris, 93, 102Popanow, Anatol, 190Potschiwalow, Leonid, 230Primakow, Jewgeni, 71, 95Proschkina, 189Proschkina, Alexander, 189Pugatschowa, Alla, 128, 131Putin, Wladimir, 9, 10
R
Rachmaninow, Sergej, 161Rasumowskaja, Ludmila, 164Reagan, Ronald, 234, 277, 278,
279Reding, Josef, 117Rinejskaja, Lena, 154
Rüütel, Arnold, 216Rybakow, Anatoli, 33, 164
S
Sacharow, Andrej, 24, 25, 26,77, 81, 82, 114, 117, 258,277, 281
Sajtschenko, Nikolaj, 196Salygin, Sergej, 51Samjatin, Jewgenij, 17, 162Samsonow, Alexander, 92Schewardnadse, Eduard, 60,
70, 71, 72, 153, 220, 221,242, 243, 247, 248, 271,283, 284
Schmeljow, Nikolaj, 87, 100Schtscharanski, Anatoli, 77Schtscherbizkij, Wladimir, 141Seutowa, Fabrie, 201Shukow, Georgij, 177
295
Simjanin, Michail, 39Sljunkow, Nikolaj, 57Sokolow, Sergej, 58, 278Solschenizyn, Aexander, 265,
267, 283Strauß, Franz-Josef, 20, 21
T
Thatcher, Margret, 20, 82Tito, Jossip Broz, 187Trotzki, Leo, 91Truman, Harry, 177Tschakowskij, Alexander, 140,
176Tschasow, Jewgenij, 47, 48, 49,
50Tschernenko, Konstantin, 245,
254, 255, 277
Tuchmanow, David, 179Tzschoppe, Werner, 260
U
Uljanow, Michail, 131Urkin, Arkadij, 146, 147Ustinow, Konstantin, 38, 58,
61
W
Wladimir, Fürst von Kiew, 9,88, 104, 162, 168, 169
Worotnikow, Witalij, 38, 39,46
Wosnessenski, Andrej, 170
296
Von demselben Autor bei BoD erschienen:
TSCHERNOBYLDie Katastrophe
Heute wissen wir fast alles über die Katastrophe von Tschernobyl. Dochunmittelbar nach der Katastrophe gab es eine Berichterstattung, diegekennzeichnet war von Nicht-Wissen, von Informationsdefiziten undInformationsunterschlagungen, von Spekulationen, Ängsten undGerüchten. Von dieser journalistischen Herausforderung in einer Zeit vorInternet, Handy, E-Mail, Facebook und Satelliten-TV handelt dieses Buch,das mit einem Rückblick 30 Jahre nach der Katastrophe endet.
FREMDE NACHBARNDer Osten und Südosten Europas Ende des 20. Jahrhunderts
Die Nachbarstaaten in Ost- und Südosteuropa blieben bis zur politischenWende ab 1989 vielen von uns fremd. Das letzte Viertel des 20. Jahrhun-derts war geprägt von einer vorsichtigen Annäherung, die den politischenWandel mit beförderte. Aus dieser Zeit stammen die Beiträge über die„Fremden Nachbarn“ östlich unserer Grenzen, die dann mehrheitlichunerwartet schnell Mitglieder der NATO und EU werden sollten.
LENINS ENKELReportagen aus einer vergangenen Welt
„Lenins Enkel“ bezeichnet eine Generation von Sowjetbürgern, die nichtmehr an den Kommunismus glaubte und unter den Einschränkungen imtäglichen Leben litt. „Der Staat tut so, als würde er uns bezahlen. Dafür tunwir so, als würden wir arbeiten.“ Eine absurde Losung, mit der sich dieMenschen im Sowjetreich ihre kleinen Freiheiten ergatterten. Die Jugendtauschte die Pionier-Kluft gegen Jeans und Lederjacke. Viele suchten ihreZuflucht im Alkohol. Ein amüsant-nachdenklicher Rückblick.