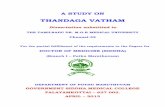Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er Jahre
Transcript of Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er Jahre
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre
Urve Lippus
Die Zeit von 1948 bis hinein in die Mitte der 1950er-Jahre stellt das schwärzeste Kapitel in
der Geschichte des Konservatoriums in Tallinn dar. Als Folge der sowjetischen Besetzung,
die aus dem Molotov-Ribbentrop-Pakt vom August 1939 resultierte, hatte es schon 1940
erste Reformen im Musikleben Estlands gegeben. Der Ausbruch des Krieges im Juni 1941
bereitete dieser Entwicklung jedoch abrupt ein Ende. Erst als 1944 die Sowjets erneut die
Macht in den baltischen Republiken ergriffen, wurden die Reformen weitergeführt. Dabei
verlief das kulturelle Leben in den ersten Nachkriegsjahren relativ unbeschwert. In den
führenden Positionen des neuen Machtgefüges saßen zunächst viele estnische Intellektuelle
aus der Vorkriegszeit, die noch die alten humanistischen und nationalen Werte und Tradi-
tionen vertraten (manchmal verdeckt).
1948 allerdings kam es zu einer radikalen Änderung, bedingt durch einen Beschluss des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in Moskau, der eine Oper von Vano Muradeli
mit dem Titel »Die große Freundschaft« betraf. In Russland wurde dadurch eine Welle neu-
er Repressionen gegen berühmte Komponisten wie Prokof ’ev, Šostakovič und viele andere
ausgelöst. Hatte man bisher in Russland zur Stigmatisierung andersartiger, unerwünschter
Musik den allgemeinen Begriff des »(bourgeoisen) Formalismus« verwandt, so wurde die-
ser Begriff nun auf die neuerlich annektierten baltischen Republiken übertragen und lokal
im Kampf gegen den »Formalismus und bourgeoisen Nationalismus« eingesetzt. Hauptziel
der politischen und kulturellen Reformen in dieser Zeit war es, alles zu vernichten und aus
dem Leben und Bewusstsein der Menschen zu verbannen, was das (positive) Bild von der
Estnischen Republik aus der Vorkriegszeit weiter aufrechterhalten konnte. Den Höhepunkt
dieser Bestrebungen markierte das 8. Plenum des Zentralkomitees der Estnischen Kommu-
nistischen Partei im März 1950, in dessen Folge viele Menschen ihre Arbeit verloren und
etliche inhaftiert wurden.
Mein Beitrag stellt die strukturellen Reformen am Konservatorium in Tallinn dar und zeigt
die Eingriffe in den Lehrplan des Konservatoriums in den 1940er-Jahren auf.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 1 12.09.13 20:25
2 Urve Lippus
Eine der düstersten Perioden in der Geschichte des Tallinner Konservatoriums war jene vom Jahr 1948 bis ungefähr zur Mitte der 1950er-Jahre. Die Reformierung des Tallinner Musiklebens nach den sowjetischen Modellen hatte zwar bereits im Jahr 1940 begonnen, als Estland infolge des im Vorjahr geschlossenen Molotov-Ribben-trop-Paktes von der Sowjetunion einverleibt worden war. Zunächst hatte der Krieg die Änderungen zwar unterbrochen, doch nach 1944 wurden diese fortgesetzt. Di-rekt nach dem Krieg war zwar die Aufmerksamkeit der Machthaber mehr auf die Brechung des militärischen Widerstandes und auch auf den wirtschaftlichen Wieder-aufbau gerichtet, doch auch der geistige Druck begann im Winter 1947/48 wesentlich zuzunehmen. Es gab auch internationale Gründe dafür, warum die Sowjetmacht im ganzen Baltikum aggressiver wurde – 1948 hatte sich Jugoslawien, geführt durch sei-nen damaligen Staatschef Josip Broz Tito, von der Einflusssphäre Moskaus und Sta-lins losgelöst. Die Reaktion Moskaus darauf umfasste auch verstärkte Angriffe gegen Nationalkulturen und besonders gegen die Machthaber, die lokalen Kommunisten in den neuen Sowjetrepubliken.
Das Tallinner Konservatorium war 1919 gegründet worden, ein Jahr nachdem Estland die Unabhängigkeit erlangt hatte. Früher studierten estnische Musiker hauptsächlich am Petersburger Konservatorium. Die Idee zur Gründung einer ei-genen höheren Musikschule war bereits am Anfang des Jahrzehnts geboren worden, am konkretesten sprach man davon in Tallinn in der Musikabteilung des Estonia-Vereins, und als die bolschewistische Revolution und der anschließende Bürgerkrieg die russischen Grenzen schloss, wurden sowohl in Tallinn als auch in Tartu höhere Musikschulen gegründet. Ungeachtet des Kriegszustandes wurde die Gründung in diesem Moment einfacher durch die Tatsache, dass aus dem post-revolutionären, in den Bürgerkrieg verwickelten Russland viele dort – meist in Petersburg – wirkende estnische und deutschbaltische Musiker nach Estland zurückkehrten und in der Hei-mat aktiv nach Betätigungsmöglichkeiten zu suchen anfingen. Auch unter den ande-ren russischen Kriegsflüchtlingen gab es anerkannte Musiker und obwohl westliche Musikmetropolen ihr Ziel waren, blieben manche für die ganze Zwischenkriegszeit in Estland. Die Stifter der estnischen höheren Musikschulen waren zwar eindeutig nationale estnische Gesellschaften – der Verein Estonia in Tallinn und der Estnische Verein für Tonkunst in Tartu, doch die Lehrerschaft war der Nationalität nach recht bunt zusammengesetzt, und in der Lehre wurden zunächst neben Estnisch auch Deutsch und Russisch gesprochen. Das kulturelle Umfeld vereinheitlichte sich nach
Lippus_2.1_aw_130911.indd 2 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 3
und nach, offizielle Lehrsprache in estnischen Schulen, auch an der Universität Tartu, wurde bereits durch das Sprachgesetz des Jahres 1918 Estnisch. Seit dem Ende der 1920er-Jahre spielten die in Estland musikalisch hochgebildeten Menschen eine im-mer größere Rolle im dortigen Musikleben.
Das Tallinner Konservatorium wurde nach dem im 19. Jahrhundert verbreiteten Konservatoriumstypus aufgebaut. Sein unmittelbares Vorbild war das Petersburger Konservatorium, wo die meisten Dozenten ausgebildet worden waren. Am Kon-servatorium wurde Musik von den Anfängen an gelehrt, vom Kindesalter bis zum Künstlerdiplom. Meist begannen Kinder Musikstudien bei einem Privatlehrer; den Grundkurs am Konservatorium nahm man mit ungefähr zehn Jahren oder etwas später auf. Die höhere Stufe des Konservatoriums entsprach der Universität und zum Abschluss mit einem Diplom war auch der Gymnasial- oder Oberschulabschluss er-forderlich. Daher sind Diplome von mehreren recht bekannten Musikern wesentlich später herausgegeben worden, Jahre nach dem eigentlichen Studienabschluss – in jungen Jahren konzentrierte man sich auf die Musikstudien und der Abschluss des Abiturs musste warten. Das Konservatorium wurde als eine Privatschule gegründet und obwohl es bereits in der Mitte der 1920er-Jahre staatliche Förderung bekam, lag der Schwerpunkt der Finanzierung auf den Studiengebühren. Daher fanden sich un-ter den Schülern erwachsene Liebhaber neben Kindern, insbesondere in der Klavier- und Gesangsklasse. Im Jahr 1935 wurde das Konservatorium verstaatlicht, die Do-zentenzahl verringert und die Lehrpläne durchgesehen, gleichzeitig bedeutete dies für die Schule eine wesentlich höhere finanzielle Stabilität und mehr Möglichkeiten, talentierte Jugendliche von den Studiengebühren zu befreien.
In der Sowjetunion waren die Schulen selbstverständlich staatlich, Studieren war kostenlos, allerdings galt in den Berufs- und höheren Schulen staatliche Zuweisung bzw. die Verpflichtung, nach dem Abschluss eine zugeteilte Stelle anzunehmen. Die Konservatorien waren in rein universitäre Institutionen umgewandelt und die frühe-re Musikausbildung zwischen der Kindermusikschule und der Musikoberschule vom Typus einer Berufsschule aufgeteilt worden. Letztere war eine professionelle Musik-lehranstalt, an der man sowohl ein Reifediplom als auch den Musikerberuf erlangte. Die Absolventen einer solchen Musikoberschule konnten ihre Studien am Konserva-torium fortsetzen, doch bekamen sie auch als Lehrer und ausübende Musiker Zuwei-sungen für Arbeitsstellen. Diese Reformen standen der estnischen Musikausbildung
Lippus_2.1_aw_130911.indd 3 12.09.13 20:25
4 Urve Lippus
noch bevor. Sie wurden im Sommer 1941 beim Ausbruch des Krieges in einem recht frühen Stadium unterbrochen.
In den 1930er-Jahren gab es keinen großen Unterschied zwischen dem Tallinner Konservatorium und der Höheren Musikschule von Tartu hinsichtlich der Studien-pläne und der Struktur, beide folgten im Großen und Ganzen dem Vorbild des Pe-tersburger Konservatoriums, obgleich nur das Tallinner Konservatorium das Recht auf die Vergabe des Diploms einer höheren Bildung besaß. Herausragende Musiker als Dozenten, insbesondere in den Instrumentalklassen, gab es in Tallinn mehr, aber Tartuer, die ein Diplom erwerben wollten, machten mit nur wenig Zusatzvorberei-tung extern das Examen, was die prinzipielle Gleichwertigkeit der Schulen bestätigt. Im Laufe der im Jahr 1944 fortgesetzten Reform wurde das Tallinner Konservatori-um (zunächst immer noch größtenteils auf dem Papier) in zwei Schulen aufgeteilt, der Name Konservatorium blieb nur bei der höchsten Stufe bestehen. In Tartu wurde die höhere Stufe der Musikschule ganz aufgelöst. Tatsächlich dauerte es bis zur Selb-ständigkeit der Schulen aber nahezu zehn Jahre.
Politische Änderungen haben gleich nach der Schließung des Molotov-Ribben-trop-Paktes das estnische Musikleben beeinflusst. In Estland wurden sowjetische Militärstützpunkte eingerichtet, und Deutschbalten wurden zum Fortgehen gezwun-gen. Diese sogenannte Umsiedlung hat das Konservatorium sowohl Dozenten als auch Studierende gekostet. Es folgte die Annexion Estlands im Juni 1940. Menschen wurden verhaftet oder verschwanden spurlos. Doch die größte Repressalie vor der eigentlichen Kriegstätigkeit auf estnischem Boden war die Massendeportation am 14. Juni 1941.1 Dieser fiel gerade die geistige und wirtschaftliche Elite Estlands zum
1 Avo Hirvesoo hat versucht, die Verluste des estnischen Musiklebens in den 1940er-
Jahren zu berechnen. Er hat geschätzt, dass im Musikleben hauptsächlich von Tallinn
und Tartu, aber auch von kleineren Zentren am Ende der 1930er-Jahre ungefähr 440
bedeutende Musiker tätig waren – professionelle Interpreten, deren Namen in An-
zeigen und Zeitungen zu finden waren, Komponisten, Orchestermusiker, Lehrer u.a.
Im Laufe der Umsiedlung gingen 26 Musiker fort, und vom Sommer 1940 bis zum
Sommer 1941 verschwanden durch Verhaftungen und Deportationen noch 15 weitere
aktive Musiker. Am Anfang des Krieges wurden 80 Musiker mit den zurückziehenden
sowjetischen Truppen sowohl als Evakuierte als auch als Mobilisierte mitgenommen,
65 von ihnen kehrten nach dem Krieg jedoch zurück. Verluste gab es auch während
der deutschen Okkupation, die größten von ihnen bei der Vernichtung der dort ge-
Lippus_2.1_aw_130911.indd 4 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 5
Opfer, ebenso diejenigen Deutschbalten und Russen, die den Mut hatten zu bleiben (viele der dortigen Russen waren post-revolutionäre Flüchtlinge und aktiv mit dem Kirchen- und Kulturleben der russischen Emigranten verbunden). Diese Massenge-walt der Deportation schreckte die Menschen so ab, dass, als sowjetische Truppen im Spätsommer 1944 erneut gegen Estland marschierten, man auf häufig verzweifelte Art und Weise versuchte, aus Estland in Richtung Westen zu flüchten.2
In den ersten Sowjetjahren besetzten estnische Intellektuelle aus der Vorkriegszeit mehrere wesentliche Stellen der neuen Machtstruktur. In den 1930er-Jahren waren unter dem dortigen Bildungsbürgertum mehr oder weniger linke Ansichten sowie eine kritische Einstellung dem herrschenden Regime gegenüber recht verbreitet. Ungeachtet dessen, dass sie mit der neuen Macht kooperierten und in den Jahren 1940/41 oder in den Kriegsjahren im russischen Hinterland auch in die Kommu-nistische Partei eingetreten waren, unterstützten sie humanistische und nationale Werte, und wohl so mancher hielt diese für vereinbar mit den neuen Idealen. Bei der Zusammenstellung des Kabinetts für das Sowjetische Estland im Jahr 1940 hatten der Vertreter Moskaus Andrej Ždanov und der Anführer der estnischen Kommunisten Karl Säre, der aus dem Exil kam und dem der illegale Kommunistenkreis in Estland nicht vertraute, versucht, prominente Stellen mit bekannten estnischen Intellektu-ellen zu besetzen, die – zumindest in diesem Moment – keine Parteimitglieder wa-ren. Unter ihnen war auch der Geiger Vladimir Alumäe (1917–1979), der im Winter 1941 und erneut im Jahr 1944 zum Direktor des Konservatoriums bestimmt wurde. Alumäe hatte am Ende der 1930er-Jahre in London bei Carl Flesh studiert, am Ysaÿe-Wettbewerb in Brüssel teilgenommen, und er besaß zusätzlich eine breite Allgemein-bildung. Obwohl Vladimir Alumäe erst 1944 in die Kommunistische Partei eintrat, war sein Vater Aleksander Janson (1935 in Alumäe estnisiert) eine bekannte Figur der estnischen Arbeiterbewegung. Vladimir Alumäe hatte keine früheren Verbin-
bliebenen jüdischen Gemeinde, in der es ca. 25 Musiker gegeben hat; Avo Hirvesoo,
Kõik ilmalaanen laiali, Tallinn 1996, S. 11–13.
2 Um die Zusammenfassung von Avo Hirvesoo fortzusetzen: Lediglich 36,5 % der im
Jahr 1944 in Estland tätig gewesenen Musiker blieb dort, ungefähr 60 Musikern gelang
es nach Schweden zu fliehen und 113 Musiker flohen nach Deutschland; Hirvesoo,
Kõik ilmalaanen laiali, S. 14. Es gab viele, die eine Flucht zwar planten, diese jedoch
aus irgendeinem Grund nicht realisierten. Dann musste dieser Versuch in den folgen-
den Jahren sorgfältig geheim gehalten werden.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 5 12.09.13 20:25
6 Urve Lippus
dungen zum illegalen Kampf, aber dieser familiäre Hintergrund steigerte seine Ver-trauenswürdigkeit in den Augen der neuen Machthaber, und natürlich beherrschte er die marxistisch-leninistische Rhetorik.
Im Herbst 1944 war das Gebäude des Konservatoriums zerstört, viele führende Musikerpersönlichkeiten waren geflüchtet, der neue Anfang bedeutete eine große Anstrengung. Vom Winter 1945 stammt der Jahresbericht von Alumäe,3 in welchem er das erste Studienjahr nach dem Krieg zusammenfasst: Es nahmen 79 Lehrer ihre Arbeit am Konservatorium auf und es wurden, der Vorbereitungskurs4 mitgerechnet, in fünf Studienjahre eingestuft ungefähr 100 Studierende immatrikuliert. Die Zahl der Studierenden war auch das wesentliche Hindernis, warum jüngere Stufen nicht gleich getrennt werden konnten – selbst in den 1950er-Jahren mussten einige recht bekannte Professoren ihre Klasse aus Studierenden mehrerer Altersstufen zusam-mensetzen, um eine ganze Stelle zu erreichen.5 Aus dem Bericht von Alumäe ist auch zu ersehen, dass es bis zum Anfang des Jahres 1945 einen Kommunisten und einen
3 Estnisches Theater- und Musikmuseum (weiter unten abgekürzt mit TMM), Bestand
MO251, Verzeichnis 1, Archivale 5, Bl. 7–11.
4 Der Vorbereitungskurs war nicht genau dasselbe wie die niederen Stufen bzw. zukünf-
tige Musikschulen. Aus der Erzählung des damals im Vorbereitungskurs studierenden,
späteren Geigenprofessors Endel Lippus stellte sich heraus, dass eine solche Einstu-
fung auch zur Ausdehnung der Rechte der Studierenden auf diejenigen verwendet
wurde, die nach dem Studienplan noch nicht in ein höheres Studienjahr eingestuft
und immatrikuliert hätten werden können. Der Krieg war noch nicht zu Ende, doch
die Studenten wurden vom Wehrdienst befreit (auch wurde der Wehrdienst durch
eine noch nicht abgeschlossene Oberschul- bzw. Gymnasialausbildung verschoben).
Am 30. März 2002 aufgezeichnete Erinnerungen, Privatarchiv der Autorin.
5 Zum Beispiel erzählte Liida Selberg, später langjährige Orchestermusikerin in Estland,
die im Jahr 1947 in der Musikschule Flötenstudien angefangen hatte, dass der Flöten-
professor Elmar Peäske den Anfängern das Instrument angesetzt hat und sie bis zum
Abschluss lehrte. Mehr Flötenlehrer waren nicht nötig. Liida Selberg, »Algaja flötist
konservatooriumis ja Estonia orkestris«, in: Urve Lippus, Muutuste kümnend. EV
Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK algus (»Das Jahrzehnt der Veränderung. Vom
Konservatorium der Estnischen Republik zum Staatlichen Konservatorium Tallinn«),
Tallinn 2011, S. 199–216.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 6 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 7
Parteimitgliedskandidat sowie fünf Mitglieder des Komsomol am Konservatorium gab.
Unter den Menschen, die für unterschiedliche Stellen – Dekane, Lehrstuhlinha-ber und ihre Stellvertreter (die Leitungsstruktur der Schule entsprach bereits den Bedürfnissen einer viel größeren Schule und war wohl dem sowjetischen Konser-vatorium als dem allgemeinen Muster der Hochschule nachgebildet worden) – be-stimmt waren, findet man viele bekannte Namen. Viele von ihnen waren auch im Musikleben während der deutschen Okkupation aktiv, und dies wurde später gegen sie angewandt, als die Säuberungskampagne begann.
Alumäe kommentierte die Wahl der Dozenten in seinem Bericht folgenderma-ßen: »Es ist zu früh, endgültig über ihre politische Ansichten zu entscheiden. Auf alle Fälle scheinen sie loyal genug zu sein.«6 Mehrere Abschnitte des Berichts sind der Politbildung gewidmet – regelmäßige Vorlesungen für die Dozenten wurden einge-führt, der Lehrstuhl für Marxismus wurde geschaffen, doch im ersten Jahr arbeitete dort niemand. Vorübergehende Studienpläne wurden verabschiedet, in denen man versuchte, alte Studienpläne mit neuen Elementen aus den Studienplänen der sowje-tischen Konservatorien zu verschmelzen. Die Ausarbeitung der Studienpläne war ein langer Prozess – grundsätzlich mussten gesamtsowjetische Studienpläne eingesetzt werden, doch ihre Anpassung an estnische Verhältnisse und an das Lehren auf Est-nisch, ebenfalls das Lehren der estnischen Musik, zog viele Probleme mit sich.
Wichtige Musikereignisse im Nachkriegsestland waren die Eröffnung des bei ei-ner Bombardierung ausgebrannten und nun wiederhergestellten Gebäudes des The-ater- und Konzertsaals Estonia im Jahre 1946 und das zwölfte Allestnische Sängerfest im Sommer 1947. Beide Ereignisse fanden zwar mit Plakaten von Stalin und anderen Dekorationen mit Sowjetsymbolik im Hintergrund statt, doch mit einem traditionel-len estnischen Repertoire. In einem der Eröffnungskonzerte im Konzertsaal spielte Vladimir Alumäe das Violinkonzert von Eduard Tubin, ungeachtet dessen, dass Tu-bin geflüchtet war und seit dem Herbst 1944 in Stockholm lebte. Das war noch zu der Zeit, als die sowjetischen Machthaber versuchten, Flüchtlinge sehr aktiv zurück-zurufen, gleichzeitig Druck auf die Regierung Schwedens ausübend, damit diese die Bürger der ehemaligen Baltischen Republiken auslieferte. Der Druck und die Angst unter den Flüchtlingen waren so stark, dass sie versuchten, aus Europa gänzlich zu fliehen.
6 TMM, Bestand MO251, Verzeichnis 1, Archivale 5, Bl. 7.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 7 12.09.13 20:25
8 Urve Lippus
Das Sängerfest von 1947 wurde einerseits von Seiten der Machthaber organisiert, um das glückliche Leben der Esten unter dem neuen Regime zu demonstrieren, an-dererseits aber war es die Wiederherstellung der alten allgemeinen Chortradition un-ter den Bedingungen des neuen Regimes, und auf dem Programm standen überwie-gend alte estnische Lieder. Die Machthaber haben die Kraft der Sängerfesttradition bei der Unterstützung nationaler Gefühle deutlich gespürt und insbesondere ihre Effektivität bei der Mobilisierung großer Massen. Einerseits versuchte man diese Tra-dition zu übernehmen, was aber während der ganzen 50 Jahre der Sowjetmacht nicht vollständig gelang, andererseits waren die Machthaber misstrauisch und hatten stets Angst, die Kontrolle über die Volksmenge zu verlieren. Man fürchtete jede Art von Spontaneität und Abweichung von vorgesehenen und bestätigten Szenarien. Dies er-klärt vielleicht teils auch, warum im Laufe der politischen Säuberung der folgenden Jahre unter den Musikern viele Chorleiter und Komponisten zum besonderen Ziel wurden, die Leiter dieser allgemeinen Volksbewegung waren. Von den vier Haupt-veranstaltern des Sängerfestes von 1947 wurden drei 1948 als »bürgerliche Nationa-listen« abgestempelt und 1950 verhaftet.
Die Verhältnisse veränderten sich plötzlich, als das Zentralkomitee der KPdSU in Moskau im Februar 1948 den berüchtigten Erlass »Über die Oper Die große Freund-schaft von Vano Muradeli« verabschiedete. In Russland löste er eine neue Repressi-onswelle gegen herausragende Musiker wie Sergej Prokof ’ev, Dmitrij Šostakovič und viele andere aus. Der allgemein zum Brandmarken der Musik verwendete Ausdruck in diesem Text war »(bürgerlicher) Formalismus«, und er ging einher mit der Be-schuldigung des Kosmopolitismus. In den jüngst der Sowjetunion angeschlossenen baltischen Republiken musste dieselbe Rhetorik verwendet werden, doch dort wurde die Beschuldigung des Formalismus mit dem vor Ort viel wichtigeren Begriff »bür-gerlicher Nationalismus« zusammen verwendet. Die estnische Musik der Vorkriegs-zeit war recht konservativ gewesen, selbst deren im Rahmen der estnischen Musik als modernistisch empfundener Teil war recht bescheiden im Vergleich beispiels-weise zur russischen Avantgarde, dem Schaffen von Arnold Schönberg oder selbst Béla Bartók. Es war schwierig, hier genuine »kosmopolitische und formalistische« Musik zu finden. Die Beschuldigung des »bürgerlichen Nationalismus« passte aber zum Hauptziel der dortigen politischen und kulturellen Reformen: im Leben und Bewusstsein der Menschen alles Positive zu zerstören, was mit der unabhängigen Estnischen Republik verbunden war. Gleichzeitig, obwohl der allgemeine politische
Lippus_2.1_aw_130911.indd 8 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 9
Kampf gegen das nationale Bewusstsein und den Wunsch nach Eigenständigkeit gerichtet war und Kosmopolitismus vor diesem Hintergrund gleichsam nichts zur Sache tat, musste diese Rhetorik doch übernommen werden, und so versuchte man auch, in der Tätigkeit der »bürgerlichen Nationalisten« bzw. dann als fremd, »uns nicht zugehörig« eingeordneten Künstler sowohl Kosmopolitismus als Formalismus aufzufinden. Das hauptsächliche Etikett des Feindes in kleinen Nationalrepubliken blieb allerdings »bürgerlicher Nationalist«.
Die massive Säuberungskampagne erreichte Estland im März–April 1948, und sie kulminierte im achten Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Estlands (Bolschewiki) (KPE [B]) im März 1950. Dieses Ereignis beendete eigentlich den heftigen Machtkampf in den dortigen Parteiorganen. Die große Säuberungswelle unter den Künstlern war lediglich seine Begleiterscheinung. Aus den bislang veröf-fentlichten Stenogrammen der Ansprachen des Plenums7 lässt sich entnehmen, dass ein kleiner Teil von ihnen den Kulturschaffenden gewidmet war, der größte Teil drehte sich um Beschuldigungen mehrerer Machthaber unterschiedlicher Ränge und Figu-ren, die in der verstaatlichten Wirtschaft und dem Finanzwesen wichtige Stellen inne hatten. Das Ziel war es, die sogenannten Junikommunisten bzw. die im Juni 1940 mit dem Umsturz mitgegangenen, aber generell in Estland verwurzelten Menschen, die früher illegal tätig gewesenen und im Gefängnis eingesessenen Kommunisten mit eingerechnet, durch gehorsamere Untergebene mit einem russischen Hintergrund zu ersetzen. Häufig und absurderweise wurden mehrere Taten der früheren Haupt-machthaber als Verteidigung der estnisch-gesinnten Oasen gedeutet, als Widerstand gegen die Errichtung allsowjetischer Bergwerke und gegen die massenweise Arbei-terumsiedlung, als Behinderung der Kolchoisierung, als Versuch, Menschen vor der Deportation zu retten oder als Sabotage der Deportationsvorbereitungen. Obwohl die Ansprachen äußerst schwammig und voll von einer in fertiger Gestalt übernom-menen Rhetorik waren, waren die neuen von Moskau unterstützten Anführer bereit, diese Politik schnell und gehorsam umzusetzen. Wahrscheinlich waren diese Be-schuldigungen in manchen Fällen, obwohl in einer absurden Weise angebracht, gar nicht ganz unbegründet. Neben der Anschuldigung des bürgerlichen Nationalismus
7 Mart Arold / Jaan Isotamm (Hrsg.), »EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi steno-
gramm. I–XI«, in: Akadeemia, 1998, Nr. 12, lk. 2655–2690, 1999, Nr. 1–10, lk. 191–
223, 415–446, 639–670, 863–894, 1087–1118, 1311–1342, 1535–1566, 1759–1790,
2017–2048, 2221–2256.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 9 12.09.13 20:25
10 Urve Lippus
ist in einigen Ansprachen auch die des »Titoismus« zu finden – gerade die Ereignisse in Jugoslawien dürfen nicht unterschätzt werden, die dieser Kampagne in den neuen Nationalrepubliken etwas andere Zielsetzungen verlieh als der »Hexenjagd« in der gleichen Periode in den russischen Zentren. Einige der Junikommunisten wurden verhaftet, einige entlassen, viele einfach auf niedrigere Amtsposten versetzt.
Die Komponistin Ester Mägi, die im Jahr 1951 ihren Abschluss machte, erzählte in ihren Erinnerungen:
Als sehr wichtig wurde die offizielle Erklärung des ideologischen Erlasses der Partei aus
dem Jahr 1948 erachtet, die im Saal der Schule unter Teilnahme von uns allen stattfand.
Dort traten hitzig sowohl eigene als auch Genossen von außen auf. Auch einige Studierende
meldeten sich zu Wort, denen es vermutlich zur Aufgabe gemacht worden war. Später gab
es im Komponistenverband sogar Extrasitzungen, so dass zum Beispiel alle Schüler von
Mart Saar eines Tages dorthin befohlen wurden. Da waren meiner Meinung nach Moskauer
Leute und es wurde arg kontrolliert, was in der Klasse gemacht wurde. Nichts Besonderes
wurde gefunden.8
Bald nach den Moskauer Ereignissen verabschiedete das Zentralkomitee der KP (B) Estlands den Erlass über die Fehler und Mängel in der estnischen Musik, der den Titel »Von den Maßnahmen zur Ausführung des im Zentralkomitee der KPdSU (B) verabschiedeten Erlasses »Von der Oper Die große Freundschaft von V. Muradeli« vom 10. Februar 1948 bekam.9 Ein wesentlicher Teil des Textes war dem Konserva-torium gewidmet. Die Lehre der Musikgeschichte und Musiktheorie wurde kritisiert und formalistisch genannt:
In den Vorlesungen der Musikgeschichte wird der Einfluss der gesellschaftlich-wirtschaft-
lichen Bedingungen auf die Entwicklung der Musik schwach erläutert, die Vorlesungen
werden nicht hinreichend durch Musik illustriert, die Gehörbildungslehre hat jeglichen
Kontakt mit der eigentlichen Musik verloren.10
8 Am 19. Mai 2009 aufgezeichnete Erinnerungen von Ester Mägi im Privatarchiv der
Autorin. Das Interview wurde geführt für: Urve Lippus, Muutuste kümnend, Tallinn
2011.
9 Eesti nõukoguliku heliloomingu dekaad, hrsg. von A. Stepanov, Tallinn 1949, S. 24–29.
10 Ebd., S. 26.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 10 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 11
Im März fand die Sitzung (das Plenum) der estnischen Komponisten statt, und es kamen auch Leiter der Estnischen KP und der Regierung, auch waren Vertreter aus Moskau anwesend – der Musikwissenschaftler Cukkerman11 und der Komponist Vlasov.12 Im Mai erschien im Kulturwochenblatt Sirp ja Vasar ins Estnische übersetzt der Artikel von Tichon Chrennikov13 »Formalismus und seine Wurzeln«.14
Im August 1948 wurde der Direktor des Konservatoriums ausgetauscht. Der offi-zielle Grund für die Absetzung von Alumäe von der Stelle des Direktors war der Ver-stoß gegen die Finanzdisziplin.15 Dies wurde aber nicht mit der vor der Öffentlichkeit laufenden Kampagne verbunden, weswegen er die Arbeit als Geigenprofessor fort-setzte. Als neuer Direktor wurde Bruno Lukk (1909–1991) eingesetzt – ein Mensch, dessen Hintergrund tatsächlich wirklich kosmopolitisch war, wenn man dieses Wort
11 Aus irgendeinem Grund sind in der Zeitung nicht einmal die Initialen aufgeführt
worden. Daher kann man nur vermuten, dass man es mit damals sehr bekannten
Menschen zu tun hatte – Viktor Abramovič Cukkerman(n) war seit 1926 Dozent am
Moskauer Konservatorium, seit 1939 Professor und er hatte mehrere einflussreiche
Bücher im Bereich der Musiktheorie veröffentlicht; der Komponist und Geiger Vla-
dimir Aleksandrovič Vlasov war Direktor und künstlerischer Leiter der Moskauer
Philharmonie von 1943 bis 1949. Besonders hatte er sich um die Entwicklung der kir-
gisischen Musik verdient gemacht (von 1936 bis 1942 war er Leiter des Opern- und
Balletttheaters in Frunse, heute Bischkek). Daher konnte er eine passende Person für
die Beobachtung der Sowjetisierung des Musiklebens in einer neuen Nationalrepublik
sein.
12 Zur Widerspiegelung des Kulturlebens wurde gleich im ersten Jahr der sowjetischen
Macht 1940 die Wochenzeitung Sirp ja Vasar (»Sichel und Hammer«) gegründet; Sirp
ja Vasar, 26. März 1948.
13 Tichon Chrennikov (1913–2007), damals in seinen Dreißigern, wurde im Jahr 1948
Leiter des Sowjetischen Komponistenverbands und behielt diese Stelle für 43 Jahre
bzw. bis zur Auflösung der Sowjetunion.
14 Sirp ja Vasar, 29. Mai 1948.
15 Nach Erinnerungen von Endel Lippus hatte Alumäe in jener sehr chaotischen Zeit der
Trennung und Zusammenstellung der Schulen mit den Vorgesetzten die Vereinba-
rung getroffen, dass die Dozenten nach dem Hochschultarif bezahlt werden durften,
obwohl die Klasse sich je nach Möglichkeiten zusammensetzte. Später wurde ihm dies
zur Last gelegt. Solche Vereinbarungen wurden natürlich nicht dokumentiert.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 11 12.09.13 20:25
12 Urve Lippus
im vorliegenden Text in seiner üblichen Bedeutung verwenden kann. Bruno Lukk war in Perm geboren, hatte Klavierstudien in Tartu begonnen, war jedoch bald von dort weiter nach Riga umgezogen, hatte in Deutschland studiert, einige Zeit auch bei Paul Hindemith (als Komponist war er allerdings nie tätig), war als aktiver Pianist und Klavierbegleiter durch die Welt gereist und erst ein Jahr vor dem Krieg nach Estland zurückgekehrt, als die Lage in der Welt unruhig wurde. Bei seiner Vergan-genheit und Person gab es Momente, die er anhand der damaligen Sowjetrhetorik sicherlich hätte nicht diskutieren wollen. Vermutlich zwang ihn die Angst dazu, sich in vielen Momenten als Direktor nicht nur gehorsam zu verhalten, sondern sogar vorgreifend und eifrig.
Bald nach dem Beginn des neuen Studienjahrs 1948/49 schrieb Bruno Lukk im Artikel »Tallinner Staatliches Konservatorium im neuen Studienjahr«,16 wie man die jüngsten Parteibeschlüsse auszuführen gedachte: Neue Studienpläne werden ausge-arbeitet, alle Dozenten müssen neben dem Lehren ihrer eigenen Fächer Sowjetpat-rioten erziehen und stets auch das Niveau ihres eigenen ideologischen Bewusstseins steigern, die Direktion und die Parteiorganisation werden für die Dozenten wöchent-lich theoretische Seminare veranstalten, in denen Referate über aktuelle Themen ge-halten werden, ein bis zwei Mal im Monat wird auch von der Musik gesprochen, für Studierende wird Politunterricht eingeführt. In den Mittelpunkt der kritischen Aufmerksamkeit gerieten die Lehrstühle für Komposition sowie für Musiktheorie und Musikgeschichte, insbesondere wurde die Ausarbeitung der marxistischen est-nischen Musikgeschichte verlangt und dafür als Beraterin die Moskauer Professo-rin Tamara Livanova eingeholt.17 Die Lehre von Musikgeschichte wurde zu einem so großen Problem, dass ihre Mängel selbst im Ministerrat der ESSR diskutiert wur-
16 Sirp ja Vasar, 2. Oktober 1948.
17 Tamara Nikolaevna Livanova war seit 1939 Professorin für Musikgeschichte am Mos-
kauer Konservatorium, später Forscherin am Institut für Geschichte der Künste des
Kultusministeriums der UdSSR und Expertin in verschiedenen bedeutenden Kom-
missionen (wie zum Beispiel der VAK bzw. Vysšaja Attestacionnaja Komissija [Höhere
Attestierungskommission], die alle in den Hochschulen der Sowjetunion verteidigten
Dissertationen und die den Dozenten vergebenen Dozent- und Professortitel durch-
sehen und bestätigen sollte). Ihr im Jahr 1940 geschriebenes Lehrbuch der Geschichte
der westlichen Musik, das Musik bis zum Jahr 1789 behandelte, war in den Konserva-
torien der Sowjetunion noch in den 1980er-Jahren in Gebrauch.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 12 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 13
den.18 Man fand, dass das ideell-politische Niveau der Dozenten der Musikgeschichte nicht ausreichend wäre und traf die Anordnung, ein den marxistischen Prinzipien entsprechendes Programm und ein Lehrbuch der estnischen Musikgeschichte auszu-arbeiten. Erhalten ist die undatierte Skizze dieses Programms,19 wahrscheinlich vom Herbst 1948, denn unter den mit dem Bleistift bei den Themen notierten zukünftigen Autoren sind der bereits am Ende des Jahres unter Beschuss geratene und 1949 ent-lassene Karl Leichter sowie die 1950 entlassene Aurora Semper verzeichnet. Das Pro-gramm ist auf Russisch verfasst (unter den Autoren ist auch Livanova erwähnt), und seine großen Abschnitte tragen Titel eines typischen Geschichtsbuches der Sowjetz-eit: 1. Thema – vorzeitliche Quellen der estnischen Musik (d.h. Volksmusik, Autor sollte der Volkskundler Herbert Tampere20 sein), 2. Thema – musikalische Kultur in der Periode des Feudalismus, und so bis zur estnischen sowjetischen Musik (wovon es im Jahr 1948 zwar noch nicht viel gab, aber sie wurde umso wichtiger gemacht).
Vom 15. bis 17. Dezember 1948 fand am Konservatorium eine dreitägige Kon-ferenz statt, die wissenschaftliche Session genannt wurde. Alle Vorträge waren der estnischen Musik gewidmet, und das Ziel der Veranstaltung war es, neue Standpunk-te zur Entwicklung der estnischen Musik einzunehmen. Wichtiger als die Vorträge selbst gestaltete sich die Diskussion, und nach der Gewohnheit der damaligen Zeit wurden die Referenten hauptsächlich kritisiert. Einen Überblick über die Session schrieb Aron Tamarkin,21 der sogar dem Vortrag von Bruno Lukk Überhäufung mit
18 Sirp ja Vasar, 16. Oktober 1948
19 TMM Bestand MO251, Verzeichnis 1, Archivale 5, Bl. 30–43.
20 Herbert Tampere (1909–1975) war ein bekannter estnischer Volkskundler, dessen
Forschungsschwerpunkt auf der Volksmusik lag. Er lebte in Tartu und arbeitete im
Estnischen Folklore-Archiv (während der sowjetischen Periode der Abteilung für
Folkloristik des Friedrich Kreutzwald-Literaturmuseums der Akademie der Wissen-
schaften der ESSR), doch der im Jahr 1944 zum Dekan gewordene Karl Leichter berief
ihn zum Leiter des Lehrstuhls für Musikgeschichte an das Tallinner Konservatorium.
Nach dem damaligen allgemein verbreiteten Muster der Musikgeschichtsschreibung
bildete die Volksmusik den Anfang der Musikgeschichte, wie auch die Texte der Volks-
lieder, die Volkslyrik, den Beginn der Literaturgeschichte bzw. ungeschriebene oder
mündliche Literatur darstellten.
21 Sirp ja Vasar, 25. Dezember 1948. Aron Tamarkin (1915–1969) hatte Klavier studiert
und war in den 1940er-Jahren auch als Pianist tätig, doch in der estnischen Musik-
Lippus_2.1_aw_130911.indd 13 12.09.13 20:25
14 Urve Lippus
faktischem Material vorwarf. Die beste Beurteilung wurde dem Vortrag von Anna Klas über estnische Musik im sowjetischen Hinterland zu Teil – dieser sei »mit einer großen Gründlichkeit, Parteilichkeit und Prinzipienfestigkeit«22 verfasst worden. Be-reits früher waren Karl Leichter und Aurora Semper von den Musikwissenschaftlern zu zentralen Angriffsobjekten geworden. Es war wohl gleichgültig, was sie in ihren Vorträgen gesprochen haben, die Beschuldigungen waren vorher fertig: Leichter kannte die marxistische Ästhetik nicht und war in bürgerlichen Überbleibseln ver-fangen, Semper habe zwar »einige umwertende Thesen über das Werk einer Reihe von Komponisten [aufgestellt] […], doch leider wurde im Verlauf des Vortrags die eigentliche Aufgabe des gegebenen Themas nicht deutlich.«23 Vermutlich versuchte Semper die neue Rhetorik einzusetzen, war aber bereits zum Opfer ausgewählt wor-den. Die eigentliche ›Schuld‹ Leichters war aktives Auftreten sowohl als Lektor im Radio als auch als Rezensent in den Zeitungen während der deutschen Okkupation und natürlich eine deutlich estnisch-gesinnte sowie möglichst unabhängige Einstel-lung selbst unter diesen harten Bedingungen.
Der Fall von Aurora Semper ist besonders interessant. In ihrem Vortrag über die in Petersburg estnischen Komponisten, die in Petersburg studiert haben, versuchte sie durchweg eine Verbindung zur russischen Schule aufzuzeigen, ebenfalls formalis-tische Züge im Werk mehrerer Komponisten zu suchen, um bisherige Standpunkte den Anforderungen entsprechend »umzuwerten«.24 Der Grund, sie anzugreifen, lag aber ganz woanders. Der Ehemann von Aurora Semper, der Schriftsteller Johannes Semper, hatte sich mit den Junikommunisten zusammengetan und war im ersten Sowjetjahr Bildungsminister gewesen, später Leiter der Verwaltung der Künste der ESSR bzw. Kultusminister bis zur im Jahr 1948 begonnenen Kampagne, als man an-fing, ihn sowohl des Kosmopolitismus als auch des bürgerlichen Nationalismus zu
geschichte kennt man ihn hauptsächlich als Anführer des Musiklebens während der
Sowjetzeit – im Jahr 1948 war er Leiter der Musikabteilung der Zeitung Sirp ja Vasar,
später Direktor des TMM, Mitglied des Kunstrates der Staatlichen Philharmonie der
ESSR sowie mehrerer im Musikleben wichtiger Kommissionen.
22 Ebd.
23 Ebd.
24 Aurora Semper, Peterburi eesti heliloojad ja nende osatähtsus eesti muusikaelus. Tea-
duslik töö, Tallinna Riiklik Konservatoorium, käsikiri Eesti Muusika- ja Teatriakade-
emia raamatukogu arhiivis, 1948.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 14 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 15
beschuldigen. Zusätzlich bekam auch der Bruder von Aurora Semper, der anerkann-te Künstler Adamson-Eric, der in Tallinn Direktor und Professor der höheren Kunst-schule, des späteren Kunstinstituts der ESSR war, den Stempel des Formalisten und Nationalisten aufgedrückt. Betrachtet man seine Gemälde Seite an Seite mit ande-ren estnischen Werken der 1930er- und 1940er-Jahre, könnte man sicherlich bessere Kandidaten für den Titel des »Formalisten« finden, aber es kam gar nicht auf die Kunst selbst an. Sowohl Johannes Semper als auch Adamson-Eric waren Leitfiguren des sowjetischen Kunst- und Kulturlebens zu Beginn der 1940er-Jahre und gehörten zu den hauptsächlichen Feinden der neuen, Moskau bedingungslos ergebenen Par-teispitze.
Eine ebenso chaotische Situation herrschte im Musikleben. Der heute sehr be-kannte Komponist Veljo Tormis studierte 1948 am Konservatorium Orgel. Die Or-gelklasse wurde geschlossen, da der Beruf des Organisten allzu sehr mit der Kirche verbunden war, und er musste seine Studien im Fach der Komposition fortsetzen. Später hat er erläutert:
Diese Formalismussache war irgendwie komisch, das konnte man nicht ernst nehmen. Die
Symbole des Formalismus waren bei uns Symphonien von Šostakovič wie die Achte oder
eine andere, die Matsov25 hier spielte und dafür auch gerügt wurde. Aber worin dieser For-
malismus bestand, davon kann ich mich nicht erinnern, dass ich etwas verstanden hätte.
Bürgerlicher Nationalismus ist eine andere Sache, das verstehe ich wohl, das ist das, was
jetzt gut ist. Aber weshalb bloß musste er bürgerlich sein?26
Ester Mägi beschrieb die Sitzungen, auf denen kritisiert wurde:
Die Verwendung der Volksweisen war gut, sie rettete viele Situationen, sie war ein Ret-
tungsring. Aber was dieser sozialistische Realismus ist, danach zu fragen hatte man nicht
mal richtig den Mut. Das musste uns schon klar sein. In der Ästhetik wurde überhaupt
nicht von solchen Dingen gesprochen. […] Daher bekamen wir natürlich eine Vorstellung,
25 Roman Matsov (1917–2001) war von 1944 bis 1989 Dirigent, von 1950 bis 1963 Chef-
dirigent des ERSO bzw. des Nationalen Symphonieorchesters Estlands (damals Ra-
dioorchesters, später Staatlichen Symphonieorchesters).
26 Am 19. Mai 2009 aufgezeichnete Erinnerungen von Ester Mägi im Privatarchiv der
Autorin.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 15 12.09.13 20:25
16 Urve Lippus
dass dieser sozialistische Realismus doch gar nicht das Aller-Allerwichtigste ist. Es waren
einige Leute, die sich zu allem zu Wort meldeten und alles genau wussten. […] Anschei-
nend war es gewissen wichtigen Personen zur Aufgabe gemacht worden, die Kollegen in die
richtige Richtung zu lenken. Ob es ihre Überzeugung war oder aus Angst kam, wer weiß
das schon.27
Der Frühling 1949 brachte einen neuen Schock – im März fand eine neue große De-portation von Esten nach Sibirien statt. Diesmal war die Aktion gegen die Kulaken gerichtet, doch neben wohlhabenderen Dorfbewohnern gerieten auch Tausende an-dere früher wohlhabendere oder politisch aktiv gewesene Menschen darunter. Wenn es unter ihnen Musiker gab, dann noch nicht wegen der laufenden Beschuldigungs-kampagne, eher gerieten sie als Familienmitglieder oder auch zufällig unter die De-portierten. Doch dies vertiefte die Angst und ebnete den Weg für die Säuberung – am Konservatorium begannen die Entlassungen direkt vor dem Beginn des Studienjahrs 1949/50. Neben den in früheren Sitzungen Kritisierten entließ man auch mit der Kir-che verbundene Menschen, doch nicht alle und nicht sofort. Nach dem im März 1950 stattgefundenen VIII. Plenum der KPE (B) wurden mehrere Kritisierte verhaftet und auch ihre Familienmitglieder vom Konservatorium entlassen. Zum Beispiel musste der Musikwissenschaftler Karl Leichter einige Zeit in einer Autowerkstatt arbeiten. Doch er wurde weder verhaftet noch deportiert. Nach einiger Zeit bekam er die Stelle eines Bibliothekars in der Bibliothek.28
Die Erinnerung der damaligen Studentin Liida Selberg soll diese Darstellung be-schließen:
Als Karl Leichter gezwungen wurde das Konservatorium zu verlassen, wurde dazu im Saal
in der Kaarli Allee29 eine Sitzung einberufen. Dort las man aus seinen Texten willkürlich
herausgenommene Sätze vor. Anhand dessen versuchte man zu beweisen, dass dies ja eine
27 Am 19. Mai 2009 aufgezeichnete Erinnerungen von Ester Mägi im Privatarchiv der
Autorin.
28 Maris Männik-Kirme, Karl Leichter. Eesti muusikateaduse suurmees, Tallinn 2002, S.
116f.
29 Das Gebäude, das dem Konservatorium zur Benutzung übergeben worden war, be-
fand sich in der Kaarli Allee, die in der Sowjetzeit den Namen Suvorov-Allee trug.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 16 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 17
Absurdität sei und Eugen Kapp30 hat Karl Leichter beiseite geholt und gesagt, na versteh
doch, wir müssen ja auch jemanden haben! Musste wirklich einer der Besten deshalb ge-
feuert werden, weil »wir müssen ja auch jemanden haben«?31
Das heißt, dass dieses Spiel gespielt werden musste und diesmal Leichter das Opfer war. Bei der Lektüre der Protokolle dieser Sitzungen im Archiv ist es am erschre-ckendsten zu sehen, wie Menschen, die erst einige Jahre zuvor vollkommen vernünf-tige Dinge geschrieben hatten, dieses grausame Spiel erlernten und anfingen, Worte zu sagen und sich zu verhalten, wie es von ihnen erwartet wurde.
Советизация Таллинской Консерватории и кампания против «формализма и буржуазного национализма» в эстонской музыкальной жизни 1948–1950 гг.
Урве Липпус
Период с 1948 до середины 1950-х гг. был самым темным временем в истории Тал-
линской консерватории. Реформирование эстонской музыкальной жизни началось
уже в 1940 г., после того как Эстония была оккупирована Советским Союзом в ре-
зультате пакта Моло-това-Риббентропа, подписанного в августе 1939 г. Впрочем,
начавшаяся в июне 1941 г. война приостановила осуществление соответствующих
мероприятий, которые были воз-обновлены лишь после восстановления советской
власти в Прибалтийских республиках в 1944 г. В первые послевоенные годы культур-
30 Der Komponist Eugen Kapp (1908–1996) war, nachdem er als Mitglied der Estnischen
Staatlichen Kunstensembles von Jaroslavl᾽ nach Estland zurückkehrte, eine zentrale
Figur im Musikleben. Als Vorsitzender des Komponistenverbands war er Mitglied von
verschiedenen über die Fragen des Musiklebens entscheidenden Kommissionen und
Räten, von 1952 bis 1964 war er auch Rektor des Tallinner Staatlichen Konservatori-
ums.
31 Selberg, »Algaja flötist konservatooriumis ja Estonia orkestris«, S. 214.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 17 12.09.13 20:25
18 Urve Lippus
ная жизнь оставалась, тем не менее, относи-тельно спокойной, и многие из довоен-
ных эстонских интеллектуалов, продолжавших раз-делять (порой втайне) прежние
гуманистические и национальные ценности и идеалы, за-нимали ответственные по-
сты в новых властных структурах. Положение изменилось ко-ренным образом после
принятия постановления ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” Вано Мурадели»
в 1948 г. В России с этого момента возобновилась волна гонений на из-вестных му-
зыкантов, таких как Прокофьев, Шостакович и многие другие. Общее обвине-ние
в «(буржуазном) формализме», служившее в России для стигматизации неугодных
музыкальных направлений, сопрягалось при этом в условиях недавно инкорпори-
рован-ных Прибалтийских республик с местной кампанией против «буржуазного
национализ-ма». В этом сочетании отразилась основная цель политических и куль-
турных реформ данного периода: разрушить в жизни и головах людей все то, что со-
относилось со сколь бы то ни было положительным образом Эстонской республики
довоенной поры. Кампа-ния эта достигла своего апогея в месяцы, последовавшие за
VIII пленумом ЦК Коммуни-стической партии ЭССР в марте 1950 г., когда немало
людей лишилось работы, а некото-рые были даже арестованы.
The Sovietization of the Tallinn Conservatoire at the end of the 1940s
Urve Lippus
The years from 1948 up to the mid-1950s were the darkest period in the history of the
Tallinn Conservatoire. The reforms in Estonian musical life started already in 1940,
when Estonia was occupied by the Soviets as the result of the Molotov-Ribbentrop treaty
in August 1939, but they were soon stopped by the outburst of war in June 1941. They
continued in 1944, when the Soviet power in the Baltic republics was restored. However,
in the first years after the war cultural life continued relatively easily and many pre-war
Estonian intellectuals supporting (sometimes covertly) old humanistic and national values
held responsible posts in the new power-structures. Things changed radically after the 1948
decision of the Central Committee of the Communist Party in Moscow about the opera of
Vano Muradeli The Great Friendship. In Russia, that started a new wave of repercussions
Lippus_2.1_aw_130911.indd 18 12.09.13 20:25
Die Sowjetisierung des Tallinner Konservatoriums am Ende der 1940er-Jahre 19
against prominent musicians like Prokoffiev, Shostakovitch, and many others. In the newly
annexed Baltic Republics, the general label of »(bourgeois) formalism« used in Russia for
stigmatizing different music attacked, was paired with a specific target of the local campaign
– »bourgeois nationalism«. That reflected the main goal of the political and cultural reforms
of this period: to destroy everything in the life and minds of people referring to the (positive)
image of the pre-war Estonian Republic. The peak of this campaign was the 8th meeting of
the Central Committee of the Estonian Communist Party in March 1950 and the following
months when many people lost their jobs and several were imprisoned.
Lippus_2.1_aw_130911.indd 19 12.09.13 20:25