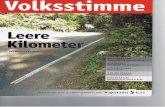Die SED am Ende
Transcript of Die SED am Ende
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
2
Analysen und Dokumente
Band 34
Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik (BStU)
Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
3
Das Revolutionsjahr 1989
Die demokratische Revolution in Osteuropa
als transnationale Zäsur
Herausgegeben von Bernd Florath
Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-525-35045-4
ISBN 978-3-647-35045 5 (E-Book)
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/
Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A.
www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen
schriftlichen Einwilligung des Verlages. Printed in Germany.
Druck und Bindung: e Hubert & Co, Göttingen
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Umschlagabbildung:
Kundgebung von Teilnehmern der Menschenkette, mit der am 23. August 1989
Bürgerinnen und Bürger der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen an
den Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes vom 23. August 1939 erinnerten und die
Wiederherstellung ihrer nationalen Unabhängigkeit einforderten.
© dpa Picture-Alliance GmbH
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Inhalt
Einleitung ......................................................................................................... 7
Ágnes Heller Nach zwanzig Jahren .................................................................................. 17
Alexander von Plato Internationale Bedingungen der Wiedervereinigung ................................... 29
Victor Zaslavsky Čornobyl’, Katyń und Gorbačev................................................................. 43
Ilko-Sascha Kowalczuk Revolution in der DDR.............................................................................. 57
Bernd Florath Die SED im Untergang .............................................................................. 63
Tomáš Vilímek Die Ursachen des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes in der ČSSR im Jahre 1989 ........................................................................ 105
Raluca Grosescu Interpretationen der rumänischen Dezemberereignisse von 1989 ............... 123
Matthias Braun Rolle der Künstler/Schriftsteller im Herbst 1989 und die obsolete Stellung der Zensur in der DDR ............................................. 137
Christian Halbrock Kirche und Kirchen im Vorfeld sowie in den Revolutionen........................ 149
Svitlana Hurkina Der Prozess der Legalisierung der Ukrainischen Griechisch- Katholischen Kirche und die Unabhängigkeit der Ukraine ......................... 165
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
6 Inhalt
Reinhard Weißhuhn Die ungarische demokratische Opposition und ihre Kontakte zur DDR-Opposition ................................................................................. 187
William Totok Zwanzig Jahre lang im Visier der Securitate................................................ 197
Jerzy Holzer Der Runde Tisch........................................................................................ 225
János Rainer Bewältigung und Kenntnis der Vergangenheit in Ungarn seit 1989 – ein vielfältiges Erbe................................................................... 233
Anhang ............................................................................................................. 247
Abkürzungen..................................................................................................... 249
Zu den Autoren ................................................................................................ 251
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Einleitung
Die Umbrüche, die sich in den Jahren 1989 bis 1991 im kommunistischen Teil Europas vollzogen, veränderten nicht nur das Angesicht dieser Gesell-schaften grundlegend. Sie beendeten nicht allein die europäische Nachkriegs-zeit. Sie ließen eine ganze Weltordnung hinter sich, die sich mit den Resulta-ten des Ersten Weltkriegs etabliert hatte. Das Jahr 1989 steht als Zäsur am Ende des kurzen 20. Jahrhunderts wie Eric Hobsbawm das Zeitalter der politi-schen Bipolarität von 1917 bis 1989 genannt hat.
Für die Völker des östlichen Europa erfüllte sich der jahrzehntealte Traum der Zugehörigkeit zur westlichen Welt, d. h. zu dem Raum, in dem die politi-schen Werte der amerikanischen und französischen Revolutionen sich in lang-wierigen, opferreichen, von Irritationen und Rückschlägen nicht freien Kämp-fen durchgesetzt hatten.
Diese Beschreibung des Umbruchs von 1989, die aus dem allgemeinen Vergleich der politischen Verhältnisse, die zuvor herrschten, mit den Resulta-ten der Entwicklung gewonnen werden kann, ist so allgemein, aus einer äu-ßerst abstrakten welthistorischen Perspektive gewonnen, dass sie zugleich unhistorisch wird, so sie als Erklärungsmodul für die demokratischen Revolu-tionen und umwälzenden Reformen in den Staaten sowjetischen Typs dienen sollte.
Gemeinhin operieren historiographische Darstellungen kleinteiliger: Je nachdem, ob sie einen internationalen, außenpolitischen oder einen nationa-len, innergesellschaftlichen Fokus ins Auge fassten, kommen sie zu mitunter kontroversen Erklärungen derselben Vorgänge und heben auf einander wider-sprechende Ursachen und Kernentwicklungen ab. Der Zusammenbruch des sowjetischen Blocks erscheint auf der einen Seite als das Resultat des westli-chen Erfolges im Kalten Krieg über ein ökonomisch und politisch letzten Endes unterlegenes Gesellschaftsmodell. Dieser These wird unter Verweis auf das seit 1990 deutlicher werdende Unvermögen zur Lösung globaler Fragen mitunter entgegengehalten, dass der Westen nicht gesiegt habe, sondern nur übrig geblieben sei. Doch ist diese, zumeist aus der Perspektive alter Eliten des Ostens vorgebrachte These nicht in der Lage, die außenpolitische, internatio-nale Richtigkeit der heftig umstrittenen Gegenthese Fukuyamas vom »Ende der Geschichte«1 im Sinne des Endes der bipolar alternativen Wege in die und durch die Industriegesellschaft schlüssig zu widerlegen.
1 Vgl. Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 1992.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
8 Einleitung
In der Tat erwies sich keine dieser Vereinfachungen als geeignet, der Kom-plexität auch nur nahe zu kommen, die sich aus der wechselseitigen Überlage-rung und Beeinflussung der sich in globalen, nationalen, regionalen oder gar innerhalb kleinerer Gruppen der Gesellschaft vollziehenden Prozessen auf internationaler und transnationaler Ebene ergab und die erst in ihrer Totalität das ergeben, was wir als die Umbrüche der Jahre 1989 bis 1991 ansehen.
20 Jahre nach den Ereignissen fand ebenso weltweit eine Reihe von öffentli-chen Diskussionen und erinnerungspolitischen Events statt, die sie auf unter-schiedlichen Ebenen zu vergegenwärtigen trachteten. Der Fall der Berliner Mauer – die Ikone des Epochenwechsels – wurde an Orten problematisiert, die im Jahre 1989 noch kaum eine präzise Vorstellung von diesem monströsen Bauwerk hatten.2
In Berlin trafen sich Ende Mai 2009 Tausende Teilnehmer auf dem »Ge-schichtsforum 1989/2009. Europa zwischen Teilung und Aufbruch«3, wo auf verschiedenen methodischen Ebenen die unterschiedlichsten Aspekte der Revolutionen von 1989 diskutiert und erinnert wurden. Im Rahmen dieses Geschichtsforums veranstaltete die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR eine internationale wissen-schaftliche Konferenz unter dem Titel »Das Revolutionsjahr 1989 – Die de-mokratische Revolution in Osteuropa als Zäsur der europäischen Geschichte«, die sich dem Thema in multiperspektivischer Weise näherte.
Die Beiträge der Tagung, von denen in diesem Band einige wiedergegeben werden,4 näherten sich der Problematik sowohl aus weltgeschichtlicher Per-spektive wie aus regionalhistorischer. Die Spannweite dieser Annäherungen unterscheidet sich insofern deutlich, als es in der Intention der Diskussion stand, sowohl in der Streuung der nationalen und regionalen Zugänge die
2 Vgl. Heidenreich, Ronny: Die Berliner Mauer in der Welt, hg. v. d. Bundesstiftung Aufar-beitung. Berlin 2009; Ders.: Eine Mauer für die Welt. Inszenierungen außerhalb Deutschlands nach 1989. In: Henke, Klaus-Dietmar: Die Mauer. Errichtung, Überwindung, Erinnerung. München 2011, S. 440–455.
3 Internationales Forum für Wissenschaftler, Kulturschaffende, Politik, Medien und Öffent-lichkeit zum 20. Jahrestag der friedlichen Revolution, veranstaltet unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten von der Bundeszentrale für Politische Bildung, der Kulturstiftung des Bundes und der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem Institut für Zeitgeschichte Berlin/München, dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und Gegen Vergessen, für Demokratie e. V., 28.–31.5.2009.
4 Die Beiträge sind zum Teil überarbeitete Vorträge dieser Tagung, zum Teil folgen sie dem Duktus des auf der Tagung gesprochenen Wortes. Soweit sie in englischer Sprache gehalten wurden, sind sie vom Herausgeber übersetzt worden. Die Transkription russischer und ukrainischer Texte folgt den Regeln der wissenschaftlichen Transliteration, aus der sich eine Reihe von Abweichungen zu den gebräuchlichen unterschiedlichen Schreibweisen westeuropäischer Sprachen ergeben. Bei den Ortsbe-zeichnungen wird dabei versucht, der Schreibweise des jeweiligen Landes zu folgen. Hieraus ergibt sich u. a. dass der ukrainische Ort Čornobyl’, der gewöhnlich unter seinem russischen Namen genannt wird, gewissermaßen repatriiert wird, was freilich nicht bedeuten soll, dass die sowjetische Verantwor-tung für die Reaktorkatastrophe nunmehr auch der Ukraine zugerechnet werden sollte.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Einleitung 9
Weite der möglichen Fragestellungen anzudeuten als auch die einander überla-gernden Kontexte hervortreten zu lassen, indem den unterschiedlichen politi-schen Ebenen, auf denen sich die zur Revolution summierenden Umwälzun-gen vollzogen, Raum gegeben wird.
Ágnes Heller befragte den Durchbruch der ost- und ostmitteleuropäischen Staaten zur freiheitlichen Demokratie als einen Akt bürgerschaftlicher Selbst-ermächtigung, der keineswegs im Sinne einer historischen Logik von Weltge-schichte den »Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit« (Hegel) als einen Pro-zess darstellt, der sich jenseits der Aktivität politisch handelnder Individuen vollzieht. So bleibt dieser Durchbruch nicht ungefährdet, kann nicht stabil verlaufen jenseits der beständigen Teilnahme der Bürger an ihm. Diesem welthistorischen Herangehen, das auf eine Deutung der Epoche im Sinne europäischer Freiheitsentfaltung zielt, steht als gleichermaßen mikrohistori-scher Ansatz die Studie Svitlana Hurkinas gegenüber. Sie untersuchte die Rückgewinnung religiöser Selbstbestimmung der griechisch-orthodoxen Ukra-iner als eine konkrete Form, in der sich diese Anteilnahme von Bürgern an der Rekonstruktion eines Gemeinwesens vollzog, die sich in der Ukraine mit der Unabhängigkeit der Nation gegen äußere Fremdbestimmung auch als die Durchsetzung einer verfassten Gesellschaft auf der Basis der Pluralität der sie fundierenden Gemeinschaften im Inneren durchsetzte. Obzwar diese, beson-ders in den westlichen Teilen der Ukraine das Gesicht der demokratischen Selbstermächtigung prägenden Auseinandersetzungen kaum einen Weg bis ins öffentliche Bewusstsein West-, ja nicht einmal Mitteleuropas fanden, bildeten sie einen wesentlichen Teil der sich so unprätentiös »Ruch« (Bewegung) nen-nenden Bürgerbewegung, die sowohl die demokratische als auch die nationale Neudefinition der Ukraine vorantrieb. Ist es eine Ironie der Geschichte, dass sich die bürgerliche Emanzipation in diesem konkreten Falle in der Rekonsti-tution einer nationalen Religionsgemeinschaft vollzieht? Oder steht die Wie-derherstellung der griechisch-katholischen Kirche im pluralen Konzert diffe-renter Vergemeinschaftungen in der sich entfaltenden modernen Gesellschaft-lichkeit nun da als die Aufforderung, das in der französischen Aufklärung gewachsene Verständnis des laizistischen Staates aus der quasireligiösen Eng-führung zu lösen, die selbst zu schnell in die neuen Kulte der jeweils »Höchs-ten Wesen« lockte? Die freie, d. h. multikultische und multikulturelle Gesell-schaft kann vielmehr die Unterdrückung religiöser Gemeinschaften weder durch den Staat noch durch einzelne Gemeinschaften ertragen. Diese Verbin-dung von gesellschaftlicher Emanzipation und Wiedergewinnung moderner Freiheiten für in der Vormoderne wurzelnde Gemeinschaften – zweifelsohne ein Prozess mit nicht immer leicht beherrschbaren Risiken – zeigte sich auch in durchaus vergleichbarer Weise in den Staaten des Baltikums, in denen die katholische wie die protestantischen Kirchen Wesentliches zur demokratischen Revolution beitrugen. Kein Beitrag, der nicht zugleich in sich widersprüchlich gewesen wäre.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
10 Einleitung
Für die DDR kann dies Christian Halbrock belegen. Insbesondere die pro-testantischen Kirchen erwiesen sich als wirkungsmächtige Faktoren: Sie stellten den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der Diktatur den am ehesten gesi-cherten Raum zur Verfügung, in dem sich diese als politische Gegenmacht formieren konnten. Doch zugleich blieben sie religiöse Gemeinschaft. Als Körperschaft zögerten sie eher, unmittelbar als politischer Akteur aufzutreten. Als verfasste Gemeinschaft verfolgten sie zwischen Staat und revoltierenden Bürgern gegebenenfalls Eigeninteressen, die im günstigen Falle nach beiden Seiten moderierend wirkten.
Die von den verblühenden Diktaturen als Moderatoren des Machterhalts angedachten Institutionen der Runden Tische konnten, wo von den noch herrschenden Kommunisten Gewalt gescheut wurde, die sich ändernden Kräf-teverhältnisse nicht mehr verschieben.
Das sich in der Alltagskommunikation auf eine mediale Metapher reduzie-rende Phänomen der Runden Tische erweist sich in der näheren Betrachtung Jerzy Holzers aber gleichermaßen als Indikator der jeweiligen Verschiedenheit revolutionärer Umbrüche ostmitteleuropäischer Staaten wie als eine kommu-nizierende Röhre, durch die Erfahrungen anderer Nationen in die eigenen politischen und kulturellen Bedingungen übersetzt wurden.
Dabei fallen Intention der Akteure und Resultate ihre Handlungen mitun-ter signifikant auseinander. Der wenige Monate nach der Konferenz so uner-wartet verstorbene5 Soziologe Victor Zaslavsky – als ins Exil gezwungener sowjetischer Dissident ebenso wie Ágnes Heller und William Totok zugleich Personifizierung der historischen Prozesse, die zur Debatte standen – betrach-tet die Wurzeln der folgenreichen Politik Michail Gorbačevs. Der Umbau der versteinerten Verhältnisse im Sowjetreich, der Epoche des Stillstandes,6 eine Politik, die unter der russischen Bezeichnung Perestrojka in die Sprachen der Welt eingegangen ist, war verbunden mit Glasnost’, Transparenz, Offenheit. Zaslavsky rekonstruiert die konkreten Zwänge, die diese Politik initiierten wie deren Schranken, die die politische Offenheit sehr wohl mit kommunistischer Wahrheitspolitik, d. h. gelenkter und eingeschränkter Öffentlichkeit verband. Doch Glasnost’ erwies sich in ihrer Eigendynamik als mehr als es in der redu-zierten deutschen Übersetzung des Wortes zu sein schien: Das russische Wort
steht etymologisch nicht, wie in Deutschland häufig angenommen wird, in irgendeinem Zusammenhang mit Glas, woraus eine Deutung im Sinne von Durchsichtigkeit hergeleitet werden könnte, auch nicht mit dem
5 Vgl. Corradi, Juan E.: Victor Zaslavsky (1937–2009). In: Telos, http://www.telos press.com/main/index.php?main_page=news_article&article_id=345 (letzter Zugriff: 15.5.2011).
6 » .« – Auf diese knappe Formel brachte Michail Gorbačev die Beschreibung des Zustandes der UdSSR vor 1986. –
XXVII . Moskva 1986, S. 4.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Einleitung 11
russischen (Auge). Es enthält den Stamm (Stimme), dessen Form i. e. S. die (äußere) Fähigkeit zu sprechen beschreibt, Stimmhaftigkeit
( – Selbstlaute, Vokale), hieraus entspringt die Bedeutung von Glasnost’ als Redefreiheit, und die aus diesem Kontext geborene Bedeutung der Öffentlichkeit.7
So verwandelte sich das Anliegen Gorbačevs, die Folgen der der bürokrati-schen Geheimhaltung und Undurchsichtigkeit zuzuschreibenden Katastrophe von Čornobyl’ durch Transparenz besser bewältigen zu können, in einen Durchbruch zu einer der elementaren bürgerlichen Freiheiten: der Freiheit der Rede mit ihren nur noch gewaltsam abweisbaren Konsequenzen.
Der Einfluss dieser Politik des mächtigen Generalsekretärs auf die von der UdSSR abhängigen Staaten war essenziell, doch anders als die Durchsetzung des Kommunismus unter Stalin nicht in der Art und Weise, dass ihnen eine neue Politik oktroyiert wurde, sondern gerade durch den gegenteiligen Weg. Gorbačev, der die sowjetischen Satrapen dadurch zu beruhigen versuchte, dass er ihnen die Souveränität zur Fortsetzung stalinistischer Gewaltpolitik zubillig-te, eröffnete den abhängigen Nationen damit zugleich auch die Freiheit, die-selben Satrapen zu stürzen. Die Paradoxie dieser Situation hat György Dalos beschrieben:
»Ein direkter Export der Perestrojka oder eine Umsetzung der Glasnost in den kleineren mittel- und osteuropäischen Ländern stand niemals zur Debatte. Der Wandel im Zen-trum übte ohnehin eine magische Wirkung auf die Peripherie aus, eine tödliche Parodie auf das Wunschbild der Sowjetunion als Leuchtturm der Hoffnung für alle Unterdrück-ten und Ausgebeuteten der Welt.«8
Tatsächlich agierten in den Jahren des Umbruchs auf internationaler Ebene eine Reihe von Akteuren, die ihre politischen, ja im Sinne ihres epochalen Charakters, historischen Ziele verfolgten. Diesen ist Alexander von Plato nachgegangen. Deutlich wird, folgt man den Intentionen, Planungen, Strategien, kleinen und größeren taktischen Finten der Akteure des weltpolitischen Machtspieles, wie sehr sie zugleich davon abhängen, dass ihnen einerseits die Brüche, Bewegungen und Drücke innerhalb der jeweiligen Gesellschaften in die Hände spielen, und sie andererseits an deren Eigensinnigkeiten immer wieder dort scheitern, wo sie
7 Vgl. Vasmer, Max: Ėtimologičeskij slovar’ russkogo jazyka (Russisches Etymologisches
Wörterbuch). Perevod s nemeckogo i dopolnenija člena-korrespondenta AN SSSR O. N. Trubčeva, hg. v. B. A. Larin. Bd. 1, 2. Aufl., Moskva 1986, S. 410 u. 431. Das Stichwort in Vladimir I. Dal’: Tolkovyj slovar’ živago velikorusskago jazyka (Erklärungswörterbuch der lebenden großrussischen Sprache). Bd. 1, 2. Aufl., S.-Petersburg, Moskva 1870, S. 355, enthält die Ableitung =
(Bekanntheit), (Allgemeinbekanntheit), i , (etwas bekannt machen, verkünden) sowie auf , ein in der russisch-orthodoxen Kirche verwendetes Gesangbuch, mit Vorgabe der Noten und Texte für den Gottesdienst.
8 Dalos, György: Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa. München 2009, S. 31.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
12 Einleitung
sie als bloße Figuren eines globalen Schachspiels zu benutzen gedenken. Viel-leicht liegt es, um einen Vergleich von Henry Kissinger hier verfremdend auf-zugreifen,9 daran, dass, während die Politiker Schach spielten, sie von den Völ-kern als Knöpfe eines undurchschaubaren Go-Spiels gesetzt wurden.
Helmut Kohl ist häufig vorgeworfen worden, er habe die deutsche Einheit künstlich forciert. Folgt man aber den Protokollen seiner je nach Notwendig-keit drängenden, subtil nachfragenden, ermunternden wie einschüchternden Telefonate, so zeigt sich, dass er ohne Zweifel dem Impuls folgend, in der Unübersichtlichkeit der politischen Gemengelage des Ost-West-Konflikts, Möglichkeiten wahrzunehmen, die der Teilung Deutschlands ein Ende setzen können, sehr bewusst nicht jenseits der Chancen operierte, die sich internatio-nal wie innerhalb der beiden deutschen Staaten erst eröffneten. Es hieße seine politische Intelligenz zu unterschätzen, unterstellte man ihm, dass er sich des Risikos nicht bewusst gewesen wäre, das tagespolitische Thematisierung seiner Intentionen zum falschen Zeitpunkt aufgeworfen hätte. Zurückhaltend zeigte er sich daher auch, als sowohl seine westlichen Verbündeten wie neue Partner im Osten zunächst irritiert auf die sich bahnbrechende Volksbewegung in der DDR mit den erwachenden gesamtdeutschen Sehnsüchten reagierten. Als sich Lech Wałęsa bei ihm am 9. November 1989 über die unübersichtliche Lage in der DDR beklagte und sich fragte, »was geschehen werde, wenn die DDR ihre Grenzen voll öffne und die Mauer abreiße – müsse dann die Bundesrepublik Deutschland sie wieder aufbauen«,10 verwies er auf die in der DDR notwendi-gen Entwicklungen, die einem Eingreifen der Bundesrepublik vorausgesetzt seien.
Dennoch war das internationale Gleichgewicht zu keinem Augenblick in solch hohem Maße gefährdet wie im Augenblick seiner Auflösung. Die über Jahre, ja Jahrzehnte geradezu äquilibristisch ausgehandelten internationalen Regelwerke entsprachen in ihrer Unbeweglichkeit so sehr der inneren Ver-fasstheit des Ostblocks der Brežnev-Ära, dass sie zwangsläufig in Erschütterung gerieten, als der neue Generalsekretär der KPdSU sein Land wieder in Bewe-gung zu setzen versuchte. Tastend, wie in einem zwar ausbalancierten, aber vollkommen instabilen Gebäude, konnte jeder falsche Schritt ganze Wände zum Einsturz bringen. Am Ende ist nicht mehr klar, welche maroden Teile absichtsvoll eingerissen wurden und welche eher versehentlich einstürzten.
Die Staatsangehörigen der Diktaturen sowjetischen Typs usurpierten ohne behördliche Genehmigung ihre Rolle als Bürgerinnen und Bürger, verweiger-
9 Vgl. Kissinger, Henry: China. Zwischen Tradition und Herausforderung. München 2011, S. 36 f.
10 Küsters, Hanns Jürgen; Hofmann Daniel (Hg.): Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deut-sche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. München 1998 (Do-kumente zur Deutschlandpolitik. Sonderedition). Dok. 76, Gespräch Kohl mit Walesa, 9. November 1989, S. 493.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Einleitung 13
ten sich in wachsendem Maße, als Illustration parteiamtlicher Deklarationen Beifall zu zollen und Volk von Staaten zu sein, die Volkssouveränität als Sou-veränität des Staates über seine Bürger verstanden. Am Anfang des stürmischen Jahres 1989 vermerkten die beiden engagierten Beobachter der osteuropäi-schen politischen Szene, Frank Herterich und Christian Semler, dass Protest und Opposition in Osteuropa spätestens seit Gründung von Solidarność auf-gehört hatten, das Werk weniger Dissidenten zu sein: »Mit der polnischen Krise 1980/81 wandelte sich im Laufe weniger Monate eine scheinbar atomi-sierte und amorphe ›Masse‹ in eine Zivilgesellschaft.«11
Der ungarische Philosoph Ferenc Fehér entwarf angesichts dieses Aufbruchs am Anfang des achten Jahrzehnts ein Szenarium für die Entwicklung des Ostblocks, das mit frappierender Genauigkeit all jene Entwicklungen antizipierte, die sich mit der Etablierung Michail Gorbačevs als Generalsekretär der KPdSU durch-setzten.12
Keine Umwälzung glich der anderen. Doch alle griffen ineinander. Die asynchrone Weise, in der Impulse aufgegriffen wurden, die aus anderen Staa-ten kamen, erscheint mitunter zufällig, ja sogar auf Missverständnissen – wenn auch sehr produktiven – zu beruhen. Ironische Selbstreflexion dieser Revoluti-onen ist möglicherweise eine der historischen Premieren, die die Zäsur von 1989 präsentierte: Das bekannte und unterdessen oft reproduzierte Graffitto »Polen – 10 Jahre; Ungarn – 10 Monate; DDR – 10 Wochen; ČSSR – 10 Tage«13 war von vorn wie von hinten zu lesen: Als Reverenz vor dem langen Kampf der polnischen Gesellschaft mit ihrem Staat ebenso wie als eine vor der Geschwindigkeit des Erfolges der Tschechen und Slowaken. Indes lag auch der tschecholslowakischen Geschwindigkeit der lange Weg von beharrlichen Bür-gerinnen und Bürgern im Streit mit der Diktatur zugrunde, wie Tomáš Vilí-mek deutlich werden lässt. Vilímek widmet sich hier zugleich einem Sektor der Auseiandersetzungen, der sich wiederum in einer Reihe anderer Ostblockstaa-ten wiederfindet. Die Auswirkungen kommunistischer Industriepolitik auf die Umwelt hatten sich keineswegs als denen kapitalistischer Marktwirtschaften überlegen erwiesen. Vielmehr schienen sie technologischen Entwicklungskon-zepten des 19. Jahrhunderts anzuhängen, deren Konsequenzen für die ökologi-schen Lebensbedingungen nicht nur in der ČSSR zu einem weiteren Konflikt-herd wurden, der die Gesellschaft zur Auflehnung gegen die Diktatur drängte.
11 Herterich, Frank; Semler, Christian: Vorwort. In: Dies. (Hg.): Dazwischen. Ostmitteleuro-
päische Reflexionen. Frankfurt/M. 1989 (edition suhrkamp; 1560), S. 8. 12 Vgl. Fehér, Ferenc: Die sozialistischen Länder Osteuropas am Beginn der 80er Jahre. In:
Brus, Włodzimierz; Fehér, Ferenc; Michnik, Adam: Gruppe Erfahrung und Zukunft [Grupa Dos-wizdczenie i Przyszlość]: Polen – Symptome und Ursachen der politischen Krise. Hamburg 1981, S. 188–222.
13 U. a. abgebildet als Umschlag von: Osteuropa 59(2009)2–3.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
14 Einleitung
Am Beispiel der DDR wird sichtbar, wie diese verschiedenen Spannungen 1989 in der Friedlichen Revolution kumulieren, deren Vielfältigkeit Ilko-Sascha Kowalczuk in einem knappen Überblick nur anreißen kann. Matthias Braun beleuchtet das Gewicht der künstlerischen Intelligenz, die sich aus einem Teil der staatssozialistischen Halböffentlichkeit einerseits selbst emanzi-piert, andererseits aber ihre privilegierte Stellung als stellvertretender Träger öffentlicher Debatten verliert. Schließlich widmet sich der Beitrag des Heraus-gebers dem inneren Zerfall der Staatspartei: Durch die Selbstermächtigung ihrer Mitglieder, die in der Selbstentmachtung der SED endete, trugen sie mit dazu bei, die friedlichen Rahmenbedingungen der Umwälzung nicht infrage zu stellen.
Bemerkenswert, trotz aller Verschiedenheit, war für die Umbrüche der Jahre 1989 bis 1991 aber auch der in der Regel geringe Widerstand der alten Eliten: Bis an die Zähne bewaffnet, in nach militärischer Logik strukturierten Parteien organisiert, wichen sie zurück, verschwanden ihre Protagonisten in den ver-schiedensten Teilen einer sich auffächernden Gesellschaft, als seien sie nie Kommunisten gewesen. Sollte der eine Teil der Formel Lenins, wonach revo-lutionäre Situationen voraussetzten, dass die Herrschenden in alter Form ihre Herrschaft nicht mehr fortzusetzen in der Lage seien, sich in den durch jahre-lange ideologische Schulung traktierten Köpfen der Genossen niedergeschla-gen haben, so schritten sie zwar diskret, aber mit einiger Konsequenz zur Selbstauflösung der stotternden Herrschaftsstrukturen, indem sich das kom-munistische Fußvolk klammheimlich aus ihnen davonstahl, während den Herren der Nomenklatura Kader ebenso wie Kadergehorsam abhanden ka-men. Wo sie den Griff ins alte Terrorarsenal wagten, scheiterten sie kläglich. Der russische Augustputsch 1991 wirkt angesichts der blutigen Geschichte des russischen Kommunismus eher als Farce. Dagegen zwangen die rumänischen Kommunisten ihrem Volk noch tagelange opferreiche Kämpfe auf, deren Zielrichtung ebenso schwer durchschaubar blieb, wie ihre Protagonisten. Sie sind, wie Raluca Grosescu betont, noch immer Gegenstand von gegensätzli-chen, bis ins Absurde reichenden Interpretationen. Ist der so jämmerliche Abgang der einstigen Avantgarde der Weltgeschichte – abhängig von der je-weiligen Position der Betrachter – nun ein Indiz für uneingelöste Vorteile der alten Regime oder nur seiner inneren Ausgehöhltheit? Der Schein des großen Konsenses im Umbruch ist ebenso sehr eine Wurzel der Verklärung wie der Dämonisierung geworden.
Der Erfolg der Revolutionen ist, soweit er im Sturz der kommunistischen Regime bestand, keineswegs zwangsläufig verbunden mit Akzeptanz freiheitli-cher Demokratie. Sie erscheint zugleich als etwas Fremdes, konfrontiert mit ungewohnten Gefahren und Herausforderungen. János Rainer skizziert einen signifikanten Aspekt dieser Problematik am Gegenstand der ungarischen De-batten über das Erbe der kommunistischen Vergangenheit. Die teilweise ana-
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Einleitung 15
chronistische Vernutzung vergangenheitspolitischer Debatten für aktuelle politische Kontroversen scheint begründet in der Spannung zwischen dem Selbstbewusstsein der Selbstbefreiung und den Folgen der wirtschaftlichen Schwäche, in der diese stattfand, die Rainers Kollege Attlia Ágh als Paradoxie des Übergangs beschrieb:
»Paradoxically, although countries such as Poland and Hungary mostly ›liberated‹ them-selves, their liberation from the Soviet empire was, at the same time, a ›defeat‹ for them. Because of their structural and conjunctural weakness, they have had to accept the model of Western democracy that has been the fundamental precondition for their acceptance in the international system. We can therefore consider these emerging new democracies as ›forced‹ or ›imposed‹ ones. They were, in fact, ›forced to be free‹.«14
Die litauische Soziologin Rasa Baločkaitė hat im Rückblick auf die beiden Jahr-zehnte des Postkommunismus festgestellt, dass auf dem Weg in die Europäische Union unter den Litauern einerseits große Skepsis gegenüber der anscheinend wurzellosen freiheitlichen Kultur des Westens existiere. Andererseits herrsche ein Minderwertigkeitsgefühl, seitdem die enorme Aufmerksamkeit der Weltöffent-lichkeit, die die Umbrüche von 1989 begleitet hatte, geschwunden sei. Schließ-lich sei man nunmehr eine »ganz normale europäische Nation geworden, nicht besonders gesegnet, aber auch nicht verdammt«.15
Der Weg der befreiten Völker in die Gemeinschaft der europäischen De-mokratie erwies und erweist sich so durchaus nicht als bloß folgerichtige Selbstverständlichkeit. Er führt über fremdes Gelände, bedarf vielfacher An-stöße und allenthalben immer wieder aufs Neue begonnener Vergewisserung über die selbst gesetzten Ziele. Seine internationalen, diplomatischen Rah-menbedingungen sind nur die eine Seite der Medaille. Die Gesellschaften, die über Jahrzehnte abgeschottet blieben, müssen ihre Begegnung ebenso erlernen wie die eigene Demokratie.
Dennoch war die transnationale Verknüpfung bereits von sehr bewussten Voraussetzungen begleitet: Oppositionelle der Ostblockstaaten standen schon seit Jahren im intensiven Austausch. Reinhard Weißhuhn reflektiert in seinem Beitrag die Auseinandersetzungen in der ungarischen Opposition und deren Einfluss auf die in der DDR. William Totok widmet sich der Untergrundlite-ratur der deutschen Minderheit in Rumänien. Beide waren wichtige Akteure
14 Ágh, Attila: The Paradoxes of Transition: The External and Internal Overload of the Transi-
tion Process. In: Cox, Terry; Furlong, Andy (Hg.): Hungary, the politics of transition. London, Portland 1995, S. 15.
15 Baločkaitė, Rasa: Demystifying social reality: European Integration processes in Lithuania. In: Voicu, Bogdan (Hg.): Globalization, European integration and social development in European postcommunist societies [a round table for young social scientists from CEE, Sibiu, 5–9 Septem-ber 2003]. Sibiu 2003. http://stiinte.ulbsibiu.ro/sociologie/NYESS/Papers_Sibiu_2003/02.rasa%20balockaite.pdf (letzter Zu-griff: 5.8.2011).
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
16 Einleitung
dieser Opposition und zugleich Mittler zwischen den Ländern. Nicht zuletzt waren es die Völker der baltischen Staaten, die schon im August 1988 ihr Freiheitsstreben in den ganz Ostmitteleuropa betreffenden historischen Zu-sammenhang stellten. Dieser ergab sich aus den Vereinbarungen sehr unter-schiedlicher Regierungen, die aber in einem entscheidenden Punkt in der gleichen Logik operierten: internationale politische Interessen jenseits des Willens jener Menschen zu definieren, die in den Resultaten dieser Pakte ausharren mussten. Schon zum 48. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes gingen deshalb am 23. August 1987 in den baltischen Staaten Bürgerinnen und Bür-ger auf die Straße.16 Die Folgen des Paktes der beiden Diktatoren am Vor-abend des Zweiten Weltkrieges lasteten ebenso auf dem Leben der Menschen wie die Folgen des Paktes der Alliierten am Ende desselben Krieges, den diese im Kampf gegen den vom Nationalsozialismus vollzogenen Zivilisationsbruch 1945 in Jalta geschlossen hatten. Es ist die Logik der elementaren Erfahrung der menschlichen Objekte dieser gegensätzlich intendierten Großmachtpolitik, die ihre Emanzipation unter die Symbole beider sie heimsuchenden Diktatu-ren stellt – selbst wenn deren historische und politische Verortung weitaus präzisere Analyse heischt.
Wie das Foto der Demonstration vom 23. August 1988 an der lettisch-estnischen Grenze, das 2009 der Einladung zur Konferenz und nunmehr die-sem Buch als Titel dient, sinnfällig macht, stand die Selbstbefreiung vom Joch kommunistischer Diktaturen von Anbeginn unter der selbstverständlichen Voraussetzung des Antifaschismus. Eine Voraussetzung, die, weil sie beständig gegensätzlichen Anfechtungen unterworfen bleibt, immer wieder neu herzu-stellen ist.
Am Ende offenbart gerade die grenzüberschreitende Perspektive auf die Re-volutionen von 1989 bis 1991 trotz der Fülle bisheriger Forschungen zugleich die Vielfalt der offenen Probleme, die sich ergeben, wenn nach der wechselsei-tigen Abhängigkeit der Einzelvorgänge gefragt wird. Wie der Schmetterling im brasilianischen Urwald das europäische Wetter antreibt, erweisen sich die heimlichen griechisch-katholischen Nonnen in der Westukraine als »wackerer Maulwurf«17 der Weltgeschichte.
Bernd Florath
16 Vgl. Beissinger, Mark R.: Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State. Cam-
bridge, New York 2002 (Cambridge studies in comparative politics), S. 63. 17 Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 3. Bd., Leipzig 1971,
S. 622.
ISBN Print: 9783525350454 — ISBN E-Book: 9783647350455© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
Bernd Florath, Das Revolutionsjahr 1989
Bernd Florath
Die SED im Untergang
Zweifelsohne hing der erfolgreiche Verlauf der demokratischen Revolution im Herbst und Winter 1989 in erster Linie von der Stärke jener ab, die sie voran-trieben: die Bürgerinnen und Bürger, die die Politik zu ihrer Angelegenheit machten; sowohl jene, die, indem sie das Land verließen, die unerträgliche Situation und die zahllosen Probleme durch ihre Emigration nicht nur mar-kierten, sondern sie zugleich auch verschärften; wie auch die Oppositionellen, die den sich bewegenden Bürgerinnen und Bürgern Gesicht, Stimme und das Problembewusstsein gaben, das erst ein Überwinden des bis dahin bloß amor-phen Protestes und Unwillens ermöglichte; und nicht zuletzt die Unterstüt-zung und den Druck, der von Außen aus West und Ost auf die Handelnden ermunternd oder warnend ausgeübt wurde.1
Doch der Verlauf der Revolution wäre nicht zu erklären, ohne die Untersu-chung des raschen Zerfalls der Seele des kommunistischen Systems – der kommunistischen Partei, die sich in der DDR, weil sie 1946 die Sozialdemo-kratie in sich hineingezwungen hatte, Sozialistische Einheitspartei nannte.
Die Auflösung der Staatssicherheit, der Selbstbeschränkung der Volkspolizei auf polizeiliche Aufgaben wie die Regelung des Verkehrs, das Verbleiben der Armee in den Kasernen, kurz: die Tatsache, dass nach den brutalen Versuchen, das politische System mit unmittelbarer Gewalt gegen in die Öffentlichkeit tretende Massen aufrechtzuerhalten, der Terrorapparat nicht wieder eingriff, ist durchaus auch detaillierter Untersuchung wert, doch sie findet ihre ent-scheidende Begründung im Zerfall der Staatspartei.
Es soll im Folgenden versucht werden, einige Eckpunkte zu markieren, die sowohl die Interessen handelnder Gruppen als auch Phasen respektive Stufen des Auflösungs- und Umwandlungsprozesses der kommunistischen Staatspar-tei SED in die Klientelpartei PDS verdeutlichen.
1 Zum Verhältnis von oppositionellen Wortführern, deren medialer Unterstützung und Inter-
pretation im Westen und den Massen, die durch ihre Bewegung den notwendigen politischen Druck herstellten, vgl. Timmer, Karsten: Vom Aufbruch zum Umbruch. Die Bürgerbewegung in der DDR 1989. Göttingen 2000; zum Verlauf der Revolution insgesamt vgl. Kowalczuk, Ilko-Sascha: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR. München 2009.
64 SED im Untergang
Mitglied der SED waren Anfang 1989 ca. 2,3 Mio. Menschen.2 Eine große Partei, der nahezu jeder sechste Erwachsene des Landes angehörte. Am 8. Januar 1990 vermeldete das Neue Deutschland immerhin noch optimistisch geschätzte 1,463 Mio. Mitglieder. Der Rest war auf dem Wege von der SED zur PDS verloren gegangen, davon allein 250 000 in den wenigen Tagen seit dem Außerordentlichen Dezemberparteitag, der die SED zur SED/PDS ver-wandelt haben sollte.3
Die Politik der SED wird bislang im Wesentlichen gespiegelt in den Hand-lungen der Parteiführung oder aber von dieser unterscheidbarer Einzelpersonen.4 Differierende Intentionen innerhalb des Parteikaders scheinen allenfalls als Gegenstand gegensätzlicher Interpretationen auf, nicht aber als tatsächlich gegen-sätzliche. Zu sehr ist das Selbstbild der monolithischen Partei auch zum Fremd-bild geworden, ist es von Protagonisten wie Gegnern angenommen worden.
Die Fiktion der monolithischen Partei wurde zwar immer wieder von west-lichen Beobachtern auf ihren Bestand abgeklopft, doch stand diese Beobach-tung vor einem Dilemma, das gleichermaßen reziprok dem der Kernphysiker glich: Entweder sie betrachteten die Partei als Ganzes, dann waren innere Differenzierungen nicht auszumachen, oder sie widmeten sich abweichenden Positionen. Indes waren diese, wenn sie von außen sichtbar wurden, in aller Regel schon keine Positionen innerhalb der Partei mehr; ihre Träger waren zumeist bereits ausgeschlossen, ausgetreten, standen außerhalb des Monolithen und reflektierten das Parteiinnere nun selbst nur mehr von außen.
Es gleicht dies allerdings auch dem tatsächlichen Dilemma, in dem sich Querdenker innerhalb der Partei befanden. Die Selbstfesselung der SED in ihrer Einheit und Reinheit machte kontroverse Konzepte unmöglich, ohne zugleich das einzelne Mitglied auszugrenzen und zum Träger eines Angriffs auf die Partei zu definieren. Ein Monolith verträgt keinen Einstein.
Drei Bemerkungen über die SED und ihre Mitglieder sind vorab festzuhal-ten, um den Bedingungen ihres raschen Zerfalls näherzukommen:
1. Die Masse der Mitglieder hatte keinen Anteil an der Formierung und Ausrichtung der Politik der Partei. Sie war deren Exekutor, und ihre Mitgliedschaft hing nicht nur an der formellen Zugehörigkeit und Über-einstimmung mit dem Programm, sondern wurde – freilich über die Zei-
2 Vgl. Priess, Lutz: Parteimitglieder und Funktionäre. In: Herbst, Andreas; Stephan, Gerd-
Rüdiger; Winkler, Jürgen (Hg.): Die SED. Geschichte. Organisation. Politik. Ein Handbuch. Berlin 1997, S. 147.
3 Für Erneuerung und Wahlen brauchen wir jede Genossin, jeden Genossen. Aus dem Referat von Wolfgang Pohl, Stellvertreter des Parteivorsitzenden. In: Neues Deutschland v. 8.1.1990; vgl. Süß, Walter: SED–PDS: Sorge über Parteiaustritte. In: die tageszeitung v. 9.1.1990.
4 Wesentlich geht über diese Perspektive auch nicht die jüngste Gesamtdarstellung der Partei-geschichte hinaus: Malycha, Andreas; Winters Peter Jochen: Die SED. Geschichte einer deutschen Partei. München 2009.
Bernd Florath 65
ten unterschiedlich intensiv – am Grade ihrer aktiven persönlichen und von einer Parteizelle organisierten Beteiligung an der Umsetzung der SED-Politik gemessen.5 Zweifelhafte Mitglieder wurden deshalb immer wieder gezielt in sogenannte Bewährungs- oder Entscheidungssituationen manövriert, in denen sie zwischen Parteidisziplin und (übergeordneten Gremien mehr oder minder bekannten) persönlichen Überzeugungen und Bindungen zu wählen hatten.
Der für 1989 eingeleitete Umtausch der Parteidokumente war mit dieser Zielsetzung geplant und in Gang gesetzt worden.6 Ähnlich breit angelegte Verfahren zur Säuberung der Partei von der Führung unlieb-samen Mitgliedern waren seit 1970 nicht mehr durchgeführt worden. Al-lein nachdem sich im Spätherbst erstmals offener Protest innerhalb der SED geäußert hatte, konnte die atomisierte Kontrolle des Wohlverhal-tens jedes einzelnen Mitglieds nur als Signal an die Leitungen verschie-dener Ebenen verstanden werden, zweifelhafte Kandidaten vor die Alter-native zu stellen, sich der herrschenden Linie der SED zu unterwerfen oder aber ausgeworfen zu werden. Auch wenn in den veröffentlichten In-struktionen zur Parteikontrolle weniger scharfe Töne angeschlagen wur-den, auf den Ebenen der Kreise war die Linie deutlich:
»Wer Argumente des Gegners, seine Angriffe, Verleumdungen wiedergibt, zum Sprachrohr seiner Ideologie wird, sozusagen knieweich wird, und nicht gewillt ist, als Kommunist Farbe zu bekennen, hat in unserer Partei nichts zu suchen.«7
2. Der Kitt, der das korrekte Funktionieren des Systems im Sinne der Füh-rungselite garantierte, war nicht wie in Rechtsstaaten die Gesetzestreue der Funktionärsbürokratie, sondern ihre persönliche Zuverlässigkeit, ihre Vasallentreue – ein im Grunde vormodernes Organisationsprinzip. Die Mehrheit der SED-Mitglieder diente der Parteiführung als Hebel zur Durchsetzung ihrer Politik im Land. Hierzu gab es verschiedene, hierar-chisch aufeinander bezogene Methoden.
5 Dem liegt ein häufig vergessenes Prinzip zugrunde, das bolschewistische von sozialdemokrati-
scher Parteiorganisation unterscheidet, aber bereits 1903, auf dem 2. Parteitag der RSDRP durch die damalige Leninsche Mehrheit (daher Bolschewiki) in das Parteistatut geschrieben wurde: Während Vladimir Lenin als Mitglied definierte, wer »das Parteiprogramm anerkennt und sie [die Partei – Anm. d. Verf.] durch materielle Mittel und durch persönliche Beteiligung an einer der Parteiorganisationen unterstützt«, beschränkte sich Julij Martov darauf, dass das Mitglied »das Parteiprogramm anerkennt und sie durch materielle Mittel und durch regelmäßige persönliche Zusammenarbeit unter der Lei-tung einer der Parteiorganisationen unterstützt«. – Vtoroj s"ezd RSDRP, Moskva 1959, S. 169.
6 Vgl. Kommuniqué der 7. Tagung des ZK der SED. In: Neues Deutschland v. 3./4.12.1988. 7 Ralf Werner, 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Mühlhausen: Schlusswort auf der Sitzung der
Kreisleitung, 29.9.1989, Thüringisches Hauptstaatsarchiv, BPA SED Erfurt, KL Mühlhausen, AR 1225, zit. nach: Mestrup, Heinz: Die SED. Ideologischer Anspruch, Herrschaftspraxis und Konflikte im Bezirk Erfurt (1971–1989). Rudolstadt, Jena 2000, S. 512.
66 SED im Untergang
Das Nomenklatursystem sorgte dafür, dass alle wesentlichen Entschei-dungspositionen von Personen besetzt wurden, deren politische Zuverläs-sigkeit von übergeordneten Gremien der SED geprüft worden waren.8
Nomenklaturkader war allerdings nur ein kleiner Teil der Parteimit-glieder. Die Aufnahme in einer der verschiedenen Nomenklaturen war gleichzeitig für die Mehrheit der nicht ihr angehörenden Parteimitglieder zumindest eine Option des sozialen Aufstiegs. Eine Hoffnung auf per-sönlichen Karriereerfolg, der durch Konflikte mit der gegebenen politi-schen Linie und mit den diese definierenden übergeordneten Leitungen nur gefährdet werden konnte. In der Regel konnten sie nicht an den Pri-vilegien der Nomenklatura partizipieren, was nicht verhinderte, dass sie von ihren parteilosen Nachbarn hierfür in Mithaftung genommen wur-den. Im Gegenteil:
»Nicht die Apparatschiks, sondern die kleinen Parteimitglieder sind es, die bei freiwilligen Arbeitseinsätzen immer als erste die Schippe schwingen müssen, die immer und überall, weil sie ja Genossen sind, für alles verantwortlich gemacht werden, die ständig die Erfolge der Parteileitung rühmen und ihre Misserfolge schönen oder wenigstens erklären müssen, die, ob sie wollen oder nicht, zur Partei-schulung berufen werden.«9
In den letzten Jahren der DDR mussten sie sogar auf Rechte verzichten, die von nicht parteigebundenen Einwohnern der DDR wahrgenommen werden konnten: Der von Parteiinstanzen argwöhnisch beobachtete Umgang mit der westdeutschen Zweitwährung, angewiesene Kontakt-verbote zu westdeutschen Verwandten, für Genossen nicht statthafte Westreisen in dringenden Familienangelegenheiten u. ä. stellten Bereiche dar, in denen sich einfache SED-Mitglieder nunmehr Parteilosen gegen-über zurückgesetzt fühlten, was potenzielle Risiken für die Bewahrung des Rufes parteipolitischer Untadeligkeit und von ihr abhängiger Auf-stiegschancen in sich barg. Explizit galten sie allerdings für eine Reihe von Partei- und Staatsangestellten minderen Ranges, die zugleich ihre politische Bedeutungslosigkeit, ja Ohnmacht umso stärker spürten, wie die Aussichten auf den erhofften Sprung in die privilegierte Schicht der Nomenklatura schwand. Letztlich stellten diese Einschränkungen keine realen, sondern nur potenzielle Einschnitte dar, die die Betreffenden be-reit waren hinzunehmen, wenn sie denn in absehbarer Zukunft mit Pri-vilegierungen vergolten werden würden. Mit dem Schwinden der Aus-sicht auf Aufstieg jedoch erwiesen sie sich als brisanter Sprengstoff. Und dieser Sprengstoff sollte sich in besonders emotionaler Weise entzünden,
8 Vgl. zum Nomenklatursystem Wagner, Matthias: Ab morgen bist du Direktor. Das System der
Nomenklaturkader in der DDR. Berlin 1998. 9 Gehrmann, Wolfgang u. a.: Der Staat der Sekretäre. In: Die Zeit (1989)43, S. 17–21.
Bernd Florath 67
als im November 1989 neben das Gefühl des Verzichts die Kenntnis der schamlosen Selbstbedienung und Selbstprivilegierung der Führungskaste trat.
Das wechselseitige Interesse zwischen der SED als Organisation und den tatsächlichen Nomenklaturkadern bestand darin, dass die Partei da-für sorgte, dass einflussreiche Positionen in Verwaltung, Wirtschaft und allen Bereichen des öffentlichen Lebens im Wesentlichen10 das Privileg ihrer Mitglieder blieben. Die Parteimitglieder ihrerseits sorgten mit der Durchsetzung der politischen Linie der Führung dafür, dass deren Macht unerschüttert blieb.
Neben dieser Interessenbindung existierte zweifelsohne eine Reihe von ideologischen Bindungen, die mit anderen Interessen teils konform gin-gen, teils in Konflikt lagen. Eine Wesensübereinstimmung in dem Sinne, dass die praktizierte Machtpolitik realer Ausdruck der SED-Ideologie gewesen sei, ist aber nicht mehr als ein Kernpostulat dieser Herrschafts-ideologie. Im Gegenteil, eine Vielzahl von historisch überlieferten Ideo-logemen sozialrevolutionärer oder ökonomischer Natur waren nicht nur in sich gegensätzlich, sondern auch deutlich nachrangig gegenüber politi-schen Grundsätzen, die sich isoliert neben dem marxistischen Traditions-Kanon fanden. Es ist daher kein Zufall, dass die SED im Konfliktfalle al-le ideologischen Arabesken der Parteilehrjahre in dem Satz auflöste, dass man mit der Macht nicht spielen dürfe. Die konkrete Politik mag im Einzelnen absurd gewesen und von einer Mehrheit der SED-Mitglieder auch als absurd erkannt worden sein, doch die Symbiose von an die Nomenklaturkader verliehener Macht und der Garantie dieser Lehen durch das Zentrum durfte nicht infrage gestellt werden. Die Stärke des Zentrum war Bedingung für die Stärke der Vasallen und umgekehrt.
Dabei war die Losung »Wo ein Genosse ist, da ist die Partei« Grund-satz der Politikumsetzung. Die Stellung jedes Genossen im kommunisti-schen Gesellschaftssystem hing von Existenz und Macht der Partei ab. Dieser Zusammenhang verpflichtete jedes Parteimitglied auf bedingungs-lose disziplinierte Unterordnung unter die Parteiführung, was im Sat-zungsgebot der Verbindlichkeit ihrer Beschlüsse seinen Ausdruck fand.
3. Die Besonderheit der SED-Herrschaft bestand darin, dass sie selbst stär-ker noch als ihre Bruderparteien in anderen Ostblockstaaten nur über ge-liehene Macht verfügte. Die Abhängigkeit der Stellung der SED im
10 Das Prinzip der Nomenklatura durchzog nicht allein die herrschende kommunistische Partei,
sondern alle Machtinstitutionen: Staat, Blockparteien, Massenorganisationen. In letzteren agierten freilich auch Nichtmitglieder der führenden Partei, die mit dem Mandat der führenden ihrerseits andere Menschen zu führen hatten. Das ausgeklügelte System der Integration der Blockparteien durch ihre zumeist einflusslose Privilegierung täuschte Pluralität nur vor, insbesondere wo es sich bei den Blockpolitikern ohnehin um abkommandierte Kommunisten handelte.
68 SED im Untergang
Osten Deutschlands von der Sowjetunion, die sich in historischen Ent-scheidungssituationen unzweifelhaft darstellte, äußerte sich in der auch ideologischen Orientierung der Parteimitglieder auf die Mutter der kommunistischen Parteien, die KPdSU.11
»Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen« war im machtpoliti-schen Sinne selbst dann für die SED eine rationale Losung, wenn die Übernahme einzelner Sachentscheidungen offensichtlich absurd war.
Es ist für die innere Situation der SED von entscheidender Bedeutung, dass die hier dargelegten Zusammenhänge einerseits gesichert waren, andererseits zugleich ideologisch verschleiert wurden. Der machtpolitische Zynismus wur-de gemildert durch sozialstaatliche Romantik. Er wurde historisch legitimiert durch die Erfahrungen des Naziterrors und des vom NS-Regime zu verantwor-tenden Krieges, die der kommunistischen Nachkriegsalternative Begründung verschafften. Und nicht zuletzt wurde er gestärkt durch die im Kalten Krieg hervorgerufene tatsächliche und subjektiv empfundene Bedrohungssituation der Protagonisten des SED-Regimes. Zweifellos sind dies Ideologeme, die im Einzelnen zu hinterfragen sind und die sich jeweils auflösen lassen. Nichtsdes-totrotz waren sie von fundamentaler Wirkungsmächtigkeit in den Köpfen und durch die Handlungen ihrer Träger.
Die Krise der SED, die im Zeitraum von Oktober bis Dezember 1989 zu ihrer faktischen Auflösung als Organisation kommunistischer Herrschaft führ-te, beruhte auf dem Zerfall der genannten Bedingungen des inneren Zusam-menhaltes, der die SED erst zu einem »Machtapparat in der Verkleidung einer Partei«12 schweißte. Sie war hingegen nicht das Ergebnis innerer Kritik oder gar des Sieges einer zur Parteiführung oppositionellen Fraktionierung oder Strömung oder gar des Putsches einer Reservenomenklatur13. Das soll nicht heißen, dass es innerhalb der SED nicht auch alternative politische Ansätze gegeben hätte. Ob diese sich in meckernden und nörgelnden Parteimitglie-dern14 oder in einer klandestinen Gegenelite15 verkörperten oder in den zeit-
11 Vgl. z. B. Krenz, Egon: Herbst ’89. Berlin 1999, S. 189–195, der die Sowjetunion an Vater-
schaftspflichten der DDR gegenüber erinnert; vgl. auch den Beitrag von Alexander von Plato in diesem Band. Die Formulierung von Krenz, dass die DDR ein Kind der Sowjetunion sei, muss er offenbar nicht nur gegenüber Gorbačev, sondern auch andernorts gebraucht haben. Vgl. Rakowski, Mieczysław: Es begann in Polen. Der Anfang vom Ende des Ostblocks. Hamburg 1995, S. 346.
12 Süß, Walter: Der Untergang der Staatspartei. In: Henke, Klaus-Dietmar (Hg.): Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte. München 2009, S. 284.
13 Vgl. Raluca Grosescu im vorliegenden Band. 14 Noch 1988 machte die SED-Führung »Meckerer und ewige Nörgler« unter den Genossen als
innere Hauptfeinde aus, von denen sich zu trennen sei: Zum einheitlichen und geschlossenen Han-deln der Mitglieder und Kandidaten der SED, Informationen, Nr. 245 (4/1988), März 1988, auch in: Herbst; Stephan; Winkler: Die SED, S. 798.
Bernd Florath 69
weise unterlegenen Trägern innerbürokratischer Rationalitätskonflikte16 mani-festierten – und all diese Phänomene sind hinreichend dokumentiert und für die Einzelnen durch mitunter schicksalhaften persönlichen Folgen gezeichnet –, keiner dieser Ansätze kann als tragend für den Niedergang der SED und ihren Machtverlust in dem Sinne angesehen werden, als er durch den Sturz der sich selbst folgenden Parteiführung die Machtmaschine SED gesprengt oder doch wenigstens in eine gewöhnliche politische Partei verwandelt hat. Vielmehr, um eine These vorwegzunehmen, ist es die Flucht der Träger der Maschine aus ihrer tragenden Position, die sie in sich zusammenbrechen ließ, sodass am Ende nur das Gerücht einer Partei übrig blieb, dessen sich meckernde und nörgelnde Mitglieder, klandestine Eliten und bürokratische Rationalisten bemächtigten, im Glauben eine politische Partei zu rekonstruieren, die es schon seit dem Mord an Rosa Luxemburg, spätestens aber seit dem Austritt Paul Levis in Deutschland nicht mehr gegeben hatte.
Als Erich Honecker am 17. Oktober 1989 von seinem Hofstaat mit allem Respekt in den Ruhestand versetzt wurde, hielt der diesem vollkommen zutref-fend entgegen, dass auch sie keine Antwort auf die politische Krise anzubieten hätten.17 Kritische Stimmen innerhalb der SED kamen nicht aus der Füh-rungsetage. Kritik übten vor allem Mitglieder, die sich angesichts immer drän-genderer Fragen aus ihrer Umgebung im Stich gelassen sahen. Kritik kam auch aus den Reihen jüngerer Intellektueller. Sie waren es vor allem, die der hausvä-terlichen und wirtschaftlichen Sprachlosigkeit Angebote für rationale Herr-schaftsorganisation machten, die angesichts »fast durchgängig[er] Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Parteiführung« von dort nicht mehr erwartet wur-den.18
Zwar war die Wut über die Sprachlosigkeit der Parteiführung durchaus ein neues Element in der SED-Geschichte, doch ein Großteil der Kritikpunkte war es keineswegs. Sie knüpften an älteren innerhalb und außerhalb der Partei vorgebrachten Einwänden an.
15 Vgl. Land, Rainer; Possekel, Ralf: Fremde Welten. Die gegensätzliche Deutung der DDR
durch die SED-Reformer und Bürgerbewegung in den 80er Jahren. Berlin 1999 (Forschungen zur DDR-Gesellschaft).
16 Vgl. Klein, Thomas: Zu Opposition und Widerstand in der SED. In: Herbst; Stephan; Winkler (Hg.): Die SED, S. 205; Ders.; Otto, Wilfriede; Grieder, Peter: Visionen. Repression und Opposition in der SED (1949–1989), Teil I. Frankfurt/O. 1996, S. 42 f.
17 Vgl. Süß, Walter: Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern. 2. Aufl., Berlin 1999 (Analysen und Dokumente; 15), S. 342; Hertle, Hans-Hermann: Der Fall der Mauer. Die unbeabsichtigte Selbstauflösung des SED-Staates. Opladen 1996, S. 132.
18 Frank Hauptmann: Gesprächsvermerk [über ein] Gespräch mit 1. Sekr[etär] der Z[entralen] P[artei] L[eitung] der H[ochschule] f[ür] Ö[konomie Berlin] und seinem 1. Stellv[ertreter], 10.10.1989; BStU, MfS, HA XVIII, Nr. 7951, Bl. 18. Die zitierten Zweifel wurden in dem Vermerk den »Mitarbeiter[n] (Dozenten, Professoren usw.)« zugerechnet und durch die Bemerkung erweitert: »neue Konzepte sind notw[endig] diese neuen Konzepte können nicht von den ›Alten‹ im P[olit]Büro getragen werden«.
70 SED im Untergang
Die eine Richtung der Kritik, die sich gegen das autokratische und unde-mokratische Parteiinnenleben richtet, ist selbst für die Zeiten des Hochstali-nismus zu verzeichnen. Das permanente Durchrütteln der Partei, die rastlose Abwechslung der Kampagnen gegen einander abwechselnde Feinde, für die Korrektur dieser oder jener Fehler oder für das kurzfristige Erreichen willkür-lich fixierter Teilutopien, waren beständiger Gegenstand mahnender Einwände nach Rationalität und Kontinuität vor allem wirtschaftlichen Handelns. Sie waren keine Erfindung der Revisionisten des Jahres 1956, keine der Parteidis-sidenten der 1960er oder 1970er Jahre. Schon gar nicht wurden diese Be-schwerden in der zweiten Hälfte der 1980er erstmals erhoben. Sie begleiten die Geschichte der SED wie die der kommunistischen Partei in allen Ländern der Erde kontinuierlich, ohne irgendein greifbares Resultat zu zeitigen außer der jeweils aktuellen Form der Eliminierung der Kritiker.
Die zweite, tendenziell entgegengesetzte Richtung der Kritik ist gegen den Bürokratismus gerichtet. Sie war – was in aller Regel übersehen wird – auch ein zentrales Moment in den stalinschen Säuberungen selbst. Die permanente Mobilisierung der kommunistischen Partei gehörte zu ihrem Wesen. Ihre Etablierung selbst als bürokratischer Apparat schlug jeweils unmittelbar in Stagnation um, die auf lang- und mittelfristige Sicht das System selbst wieder infrage stellen musste und sollte. So konnte eine intentional emanzipatorische Kritik an der lähmenden Herrschaft bürokratischer Apparate zugleich rasch als Argument tödlicher Säuberungen dienen und zu bitterem Erwachen seiner Protagonisten führen. Nicht unwesentlich beruhte die Sympathie westlicher Studenten für die chinesische Kulturrevolution unter Mao Zedong auf einer solchen Verwechslung.
Erst die Ablösung Nikita Chruščevs setzte den sich ablösenden Wellen von Mobilisierungen und Umstürzen im Bereich der sowjetischen Suprematie ein Ende, sicherte die Herrschaft der gerade das Ruder behauptenden Kader – um den Preis einer andauernden Lähmung der gesamten Gesellschaft. Ein von der permanenten Revolution (Siegmund Neumann) abweichendes Dynamisie-rungsmittel kannte das kommunistische System nicht. Blieb es mobil, fraß es die eigenen Kinder; verschlang es sie nicht, erstickte es an ihrer Saturiertheit.
Drittens stand der reale Sozialismus zugleich im Feuer einer sozialrevolutio-nären wie einer wirtschaftsreformerischen Kritik. Was jenen zuviel Ungerech-tigkeit, zu große Distanz zwischen Oben und Unten war, war diesen die not-wendige Durchsetzung des Leistungsprinzips und seiner Anreize zum Fort-schritt, was jene als Sieg der Gerechtigkeit ansahen, lehnten diese als hemmende Gleichmacherei ab.
Die insbesondere im November vorgetragenen Kritiken an der bisherigen Politik der SED erweisen sich als inhomogen, ja gegensätzlich. Die Politik der Führung wurde aus Gründen abgelehnt, die sich wechselseitig ausschlossen. Insofern ist die genervte Reaktion einiger Mitarbeiter des Apparates, die zur
Bernd Florath 71
Entgegennahme dieser Kritiken im Konsultationszentrum des ZK abgestellt waren, inhaltlich nachvollziehbar, auch wenn sie sich zur damaligen Zeit in der Öffentlichkeit sehr freundlich äußerte:
»ND: Sicherlich gibt es viele unterschiedliche Auffassungen, gewiß auch konträre Stand-punkte? Wolfgang Herger: Das ist richtig.«19
István Eörsi stellte für das Kádáristische Ungarn fest, dass sich Parteiführung und Bevölkerungsmehrheit in einem Punkt rasch einig gewesen seien: in ihrer Verachtung für den Marxismus.20 Kádárs Nomenklatura rettete sich in den 1980er Jahren zunehmend in die nationalistische Ersatzideologie zur Rechtfer-tigung ihrer Herrschaft. Der SED-Führung blieb selbst dieser Fluchtweg ver-sperrt. Vollkommen realistisch hielt Otto Reinhold im Sommer 1989 fest, dass eine DDR, die nicht sozialistisch sei, neben der Bundesrepublik keine Exis-tenzberechtigung behielte.21
Für die innere Stabilität der SED bedeutsamer als deren nationale Rückbin-dung in der Bevölkerung war ihre Orientierung auf die KPdSU. Die den SED-Mitgliedern anerzogene Loyalität zur eigenen wie zur sowjetischen Führung war eine unauflösliche Einheit.22 Sie ergab sich zwingend aus der international abhängigen Situation des halben Landes als der schwächeren, ärmeren und nicht durch Akzeptanz der Bevölkerungsmehrheit gesicherten Hälfte Deutsch-lands.
Gorbačevs Reformpolitik, die in zwei Richtungen zielte: auf Dynamisierung der Wirtschaft durch die Befreiung der Produzenten aus den Fesseln der Natu-ralplanung und auf Redefreiheit (und für nichts anderes steht das Wort Glas-nost), d. h. die Befreiung des Bürgers von seiner administrativen Fesselung in der öffentlichen Kommunikation, markierte die beiden schmerzhaften Selbst-fesselungen des Systems ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für deren Besei-tigung – Der bloße Verweis auf die Beibehaltung einer sozialistischen bzw. kommunistischen Perspektive führt bei Gorbačev ebenso ins Leere wie bei
19 Schon jetzt liegen 1 500 Anträge an den Parteitag vor – jeder wird beachtet. ND sprach mit
Dr. Wolfgang Herger, Mitglied des Politbüros des ZK der SED. In: Neues Deutschland v. 24.11.1989.
20 Eörsi, István: Der unliebsame Lukács. In: Ders.: Der rätselhafte Charme der Freiheit. Frank-furt/M. 2003, S. 142: »Die Machthaber benutzen den Marxismus zu ihrer Legitimation, sonst ist er ihnen gleichgültig; die Bevölkerung steht ihm feindselig gegenüber, weil sie in ihm lediglich ein Machtinstrument der Herrschenden sieht.«
21 Vgl. Reinhold, Otto: Der Kampf der beiden Systeme und die Gesellschaftskonzeption der SED, Radio DDR II, 19.9.1989.
22 Dies galt trotz aller Aversion gegen die Politik Gorbačevs selbst für Honecker: »Wie üblich in den letzten Jahren, erklangen im Freundeskreis in Berlin die Gläser um 22.00 Uhr zum sowjetischen Neujahrsfest und um Mitternacht zum deutschen.« – Honecker, Erich: Moabiter Notizen. Letztes schriftliches Zeugnis und Gesprächsprotokolle vom BRD-Besuch 1987 aus dem persönlichen Besitz Erich Honeckers. Berlin 1994, S. 24.
72 SED im Untergang
verschiedenen osteuropäischen Dissidentengruppen, die einem erklärten Anti-kommunismus fern standen. Der Impuls, Politik zur Erweiterung von Frei-heitsrechten zu machen, überwog jene doktrinären Befangenheiten, die einer entgegengesetzten Bewegung das Wort redeten. Gorbačev löste sich aus jener Tradition kommunistischen Denkens, deren Vorstellungen über Marxismus und Sozialismus, wie sein Berater Fedor Burlackij schrieb, aus den Händen Stalins stammten.23 Mit welchen Bezeichnungen aber die Alternative zur Des-potie umschrieben wurde, kann als sekundär angesehen werden, solange deren Gegner die Legitimitätskrise des Systems nicht mehr als die eigene ansah, sondern als die einer zu überwindenden Herrschaftsform und sie sich stützte auf den Willen und die Initiative der Mehrheit der Menschen. Welchen kon-zeptionellen Ideen, Entwürfen oder Utopien sie dabei anhingen bleibt sekun-där, solange sie sich nicht der Bewegung von Mehrheiten in den Weg stellten. Hier treffen sich die Überlegung von Fedor Burlackij, der das entscheidende Verbrechen jener Form des Sozialismus, die von den Verteidigern des Staatsso-zialismus, gegen die er polemisiert,24 verfochten wurde, darin sah, dass sie die Initiative der Menschen einkerkerte, mit denen des Beraters von Bärbel Boh-ley, Klaus Wolfram, der – und hierin schwingt durchaus ironische Selbstrefle-xion mit – die Bedeutungslosigkeit ideologischer Doktrin angesichts sich be-wegender Bürgerinnen und Bürger als Grundlage der Revolution ausmacht:
»In Wahrheit drang die Opposition erst durch in dem Moment, als eine Mehrheit der Bevölkerung selbst oppositionell und 30 Oppositionelle in Grünheide völlig undoktrinär geworden waren.«25
Gorbačevs Politik schien auch ein Schlüssel für die Probleme der DDR zu sein. Das wurde rasch klar. Doch auch die Konsequenzen waren für die DDR schneller überschaubar. Glasnost’ und Perestrojka in der DDR würden die westdeutsche Parallelgesellschaft, an der die Einwohner ihr Land immer ge-messen hatten und maßen, nicht mehr nur heimlich als überlegene erscheinen lassen, sondern die Frage früher oder später unerbittlich auf die Tagesordnung stellen, ob es nicht sinnvoller sei, ein funktionierendes politisches und ökono-misches System zu übernehmen, als an einem nicht funktionierenden weiter herumzulaborieren.
23 Vgl. Burlackij, Fedor: Kakoj socializm narodu nužen. Navstreču XIX Vsesojuznoj partkonfe-rencii. In: Literaturnaja gazeta, Nr. 16(5186) v. 20.4.1988, S. 2.
24 In seinem Artikel attackiert Burlackij namentlich Nina Andreevna (Ne mogu postupatsja principami. In: Sovetskaja Rossija v. 13.3.1988), deren Artikel von der politischen Führung dankbar aufgenommen und sofort im Neuen Deutschland nachgedruckt wurde. (Ich kann meine Prinzipien nicht preisgeben. Brief der Leningrader Dozentin Nina Andrejewa. In: Neues Deutschland v. 2./3.4.1988, S. 11 f.) Burlackij kommentiert trocken: »Die Gegner der Perestrojka glauben, die Schwierigkeiten ihrer Anfangsperiode ausnutzen zu können.« (Burlackij: Kakoj socializm) – womit er indirekt die SED-Führung als Gegner gekennzeichnet hat.
25 Wolfram, Klaus: Nachbericht. In: Bohley, Bärbel: Englisches Tagebuch 1988, aus dem Nachlass hg. v. Irena Kukutz. Berlin 2011 (Pamphlete; 25), S. 151.
Bernd Florath 73
Es war der herrschenden Parteinomenklatura klar, dass hier ihre Existenz zur Disposition stand. Selbst wenn sie die Notwendigkeit von Reformen er-kannte, konnte sie sich darauf nicht einlassen, wenn diese Weigerung bedeute-te, dass die DDR auch dann unterginge – nur ginge sie dann auf andere Art unter. Die Angst vor der eigenen Niederlage multiplizierte sich mit dem Un-vermögen, sie der Entscheidung jener zu übergeben, für die sie sie gemacht zu haben meinten. Sie war nicht ihr Kind, das laufen gelernt hatte und nun eige-ner Wege ging, sie war ihr eifersüchtig gehütetes Spielzeug, das herzugeben sie sich weigerte.
Sie musste sich gegen die Politik Gorbačevs stellen und sie stellte sich gegen sie. Auf den Parteitag der KPdSU 1986 folgte wenige Wochen später der der SED, der unmissverständlich signalisierte, dass die KPdSU fürderhin nicht mehr Modell und Maßstab sei. Kurt Hagers Gerede vom unnötigen Tapeten-wechseln26 stellte nicht deshalb ein Skandalon dar, weil er diese Distanzierung wiederholte, sondern wegen des groben Tons und der demonstrativen Weige-rung, überhaupt Argumente für sie aufzubringen. Er düpierte insbesondere die Intellektuellen durch seine Rüpelhaftigkeit und Ignoranz. Hager sprach aus, was auf der SED-Führungsetage über Moskau nicht zum ersten Mal gedacht wurde: dass der »Sozialismus in den Farben der DDR« auf dem chiliastischen Pfad zum Kommunismus der Sowjetunion weit voraus sei und daher schon seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung stünde, dass die Sowjetunion begön-ne von der DDR zu lernen. Wie weit die Arroganz Hagers ging, zeigt sich in seiner Interpretation der Rede Gorbačevs vor dem politisch beratenden Aus-schuss des Warschauer Paktes vom April 1987 in Prag, als dieser Abstand davon nahm, die sowjetische Realität zum allein gültigen Modell des Kommu-nismus zu erklären.27 Ganz ähnlich begriff offenbar auch Honecker später nicht, dass Gorbačev – logisch konsequent fortschreitend – den nicht mehr auf
26 Kurt Hager beantwortete Fragen der Illustrierten Stern. In: Neues Deutschland v. 10.4.1987,
S. 3 (zuerst im Stern am 9.4.1987). 27 Ders.: Erinnerungen. Leipzig 1996, S. 388: »Auf die Metapher vom ›Tapetenwechsel‹ ant-
wortete kurze Zeit nach dem Stern-Interview Michail Gorbatschow – ohne meinen Namen zu nennen – in einer Rede in Prag.« Gorbačevs Rede in Prag, einen Tag nach dem Stern-Interview, befasste sich indes kaum mit Hager, wohl aber mit den Ängsten aller Moskauer Satrapen davor, dem Weg der Perestrojka folgen zu müssen; sie richtete sich mithin an Gestalten wie Hager, aber kaum an ihn persönlich. »Wir meinen nicht, dass wir die endgültige Antwort auf alle Fragen gefunden haben, vor die uns das Leben gestellt hat. Wir sind weit davon entfernt, irgendjemanden dazu aufrufen zu wollen, uns zu kopieren.« (Gorbatschow, Michail: Rede auf der Kundgebung der tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft. 10.4.1987. In: Ders.: Ausgewählte Reden und Aufsätze. Bd. 4, Juli 1986 bis April 1987, Berlin 1988, S. 530.) Dass seine Bemerkung zwar noch nicht die Brežnev-Doktrin aufhob, sie aber einen ersten Schritt in diese Richtung bedeutete, vermerkt Hager 1996, »war uns zu diesem Zeitpunkt [...] nicht bewusst«.
74 SED im Untergang
sein politisches Modell verpflichteten Verbündeten die militärische Unterstüt-zung verweigerte, wenn diese ins politische Straucheln gerieten.28
Die primitive und verdummende Medienpolitik, die Gegenstand der Be-schwerde seit Anbeginn war, verzichtete auf jeden Versuch von Tarnung. Nur dass die mit ihr angestrebte Infantilisierung der Gesellschaft, wie das Edward Lipiński 1976 in seinem Offenen Brief an Edward Gierek genannt hatte,29 nicht zu erreichen war, weil jeder Einwohner der DDR nur das Radio oder den Fernseher anzumachen brauchte, um sich in westlichen elektronischen Medien über das zu informieren, was in den DDR-Zeitungen nicht stand.
Für die SED-Mitglieder entstand aus der Ablehnung der Politik der KPdSU ein Dilemma. Die jahrzehntelang eintrainierte Loyalität zur Führungskraft der Weltrevolution wurde ja nicht plötzlich außer Kurs gesetzt. Sie blieb im Nir-vana ideologischer Postulate bestehen, obwohl die wirkliche KPdSU zum Anathema geriet. Aus dem Parteilehrjahr verschwand das gewichtige Lehrbuch zum Kurs zur Geschichte der KPdSU. Es wurde ersetzt durch eine dürre »Handreichung« aus der Parteihochschule beim ZK der SED,30 der Hochburg parteikonservativer Ideologieproduktion. Die »Handreichung zur Geschichte der KPdSU« bringt es fertig, die Mutter aller kommunistischen Parteien fak-tisch zu einem historischen Phänomen zu reduzieren. Die Ironie dieses Vorge-hens scheint den Autoren freilich nicht aufgegangen zu sein. Zugleich sollte sie auch explizit der Darstellung der Geschichte der KPdSU entgegenarbeiten, die Gorbačev in seiner Festrede zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution am 7. November 1987 gegeben hatte.31 Offenbar hatte dieser »die heutigen Erfah-
28 Hintergrundinformationen zum Arbeitsbesuch Honeckers in Moskau vom September 1988
in: Vortragsunterlage [BND-]Pr[äsident] für N[achrichten-]D[ienst]-Lage. Betr.: DDR/UdSSR: Zur aktuellen Problemlage im bilateralen Verhältnis aus DDR-Sicht, 26.5.1989; BA Berlin, B 206/527, Bl. 232–242. In dieser mehr als ein halbes Jahr post festum verfassten, sehr detaillierten Information des BND wird aus dem Inhalt des Gesprächs zwischen Honecker und Gorbačev u. a. referiert, dass Letzterer auf ausdrückliche Rückfrage über die Gefährdung der inneren Sicherheit der DDR geant-wortet habe: »unter seiner [Gorbachevs] Führung werde die Sowjetunion nicht intervenieren, um eine Partei bzw. Obrigkeit vor unzufriedenen Massen zu schützen. Als Honecker nunmehr auf den zwi-schen der DDR und der UdSSR geschlossenen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand verwies, habe Gorbachev abermals unterbrochen und betont, die Passage zum gegenseitigen Beistand beziehe sich nicht auf Probleme im Innern, sondern ausschließlich auf den Fall eines Angriffs bzw. einer Bedrohung von außen. Honecker habe erneut sichtlich bestürzt reagiert.« – Bl. 236. Ich danke Ilko-Sascha Kowalczuk für den freundlichen Hinweis auf diese Akte.
29 Vgl. Lipiński, Edward: Offener Brief an Genossen Edward Gierek. In: Wiener Tagebuch, 1976, Nr. 7/8, S. 17–20.
30 Die Geschichte der KPdSU – ein nie versiegender Quell revolutionärer Erfahrungen im Kampf für Frieden und Sozialismus. Handreichung für den Lehrgang »Geschichte der KPdSU«, hg. von der Abt. Propaganda des ZK der SED, der Parteihochschule »Karl Marx« beim ZK der SED und der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Berlin, November 1987.
31 Vgl. Gorbatschow, Michail: Oktober und Umgestaltung. Die Revolution geht weiter. Referat des Generalsekretärs des ZK der KPdSU auf der gemeinsamen Festsitzung des Zentralkomitees der
Bernd Florath 75
rungen und Erkenntnisse […] den Erfahrungen und Erkenntnissen früherer Generationen schematisch gegenübergestellt«:
»Geschichte muss ohne Zweifel so vermittelt werden, wie sie verlaufen ist. Dabei sollte jedoch immer das Wesentliche des Kampfes in den Mittelpunkt gestellt werden, das der Entwicklung das Gepräge gab.«32
Der Versuch, die Beschäftigung mit der aktuellen Politik Moskaus in den Parteizirkeln so zu verhindern, scheiterte indes daran, dass viele Genossen das nun ausgedünnte Material durch russische Originale ersetzten.33
»Bei der Durchführung der Zirkel werden neben den Dokumenten des XI. Parteitages und der ZK-Tagungen der SED auch die Reden führender Politiker der DDR und der UdSSR sowie Zeitungsartikel ausgewertet und diskutiert. Gleichzeitig bemüht man sich, Aussagen der Klassiker des Marxismus-Leninismus, vor allem zu Fragen der sozialisti-schen Revolution und der sozialistischen Demokratie heranzuziehen und zu analysieren, wie deren Ideen in der Politik unserer Partei ihren Niederschlag finden.«34
Die Loyalität der Genossen irrlichterte zwischen der eigenen Führung und der sowjetischen. Zumal die SED-Führung zwar verkündete, nicht dem Beispiel des großen Bruders folgen zu wollen, die Auseinandersetzung mit ihm aber scheute. Abkopplung von Moskau blieb gefährlich, Folgsamkeit wurde es.35 Für die Einheitlichkeit der SED blieb das allerdings nicht ohne Folgen. Hitzi-ge Debatten, unklare Annahmen darüber, welche Politik nun dem Wissen-schaftsgebot des Marxismus-Leninismus entsprach, der schließlich nur eine Wahrheit kannte.
Es ist für die Aufnahme der politischen Substanz der Gorbačevschen Re-formen von entscheidender Bedeutung, dass sie nicht durch die Zustimmung des Politbüros auf die Größe einer Zwischenüberschrift im Parteilehrjahr der SED degradiert wurde.36 Ironischerweise war diese weniger durch die Substanz als durch das mediale Echo in Ost und West vorgeprägte Rezeption der Perest-
KPdSU, des Obersten Sowjets der UdSSR und des Obersten Sowjets der RSFSR anläßlich des 70. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, 2.11.1987. Moskau 1987.
32 Handreichung, S. 6. 33 Vgl. z. B. Gespräch mit Dieter Segert v. 23.9.1996. In: Der SED-Reformdiskurs der achtzi-
ger Jahre; Archiv, Bestand Segert, Bd. 1, S. 15. 34 Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Geschichte. SED-
Grundorganisation: Abschlußbericht für das Parteilehrjahr 1988/89, Juli 1989, Bl. 1. [Archiv d. Verf.] 35 Die vorerst zurückhaltenden Erklärungen Gorbačevs zur Verbindlichkeit der neuen sowjeti-
schen Linie für die Parteien des Ostblocks wurden jedenfalls in der SED bis zum Schluss nur sehr einseitig zur Kenntnis genommen. Noch auf der Festsitzung zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR am Abend des 7. Oktober 1989 wurde Gorbačevs Rede – so war der Eindruck Mieczysław Rakowskis – von der SED-Führung in dem Sinne begriffen: »Wir können ruhig weiterschlafen. Die Sowjetunion ist wie in der Vergangenheit auch jetzt mit uns! Der Saal zollte Gorbatschow auch dann noch Beifall, als er sagte, über die DDR betreffende Angelegenheiten werde nicht in Moskau, sondern in Berlin entschieden.« – Rakowski: Es begann in Polen, S. 347.
36 Vgl. Wolfram: Nachbericht. In: Bohley: Englisches Tagebuch 1988, S. 146.
76 SED im Untergang
rojka auch auf der Ebene des Politbüros von gravierender Wirkung. Kurt Hager motiviert sein Misstrauen gegenüber Gorbačev gerade aus dessen positi-ver Aufnahme im Westen.37 Für den unteren und mittleren Funktionärskader wie für nicht unwesentliche Teile der Nomenklatura brachte der unausgespro-chene Bruch mit der Mutterpartei KPdSU eine weitere Verunsicherung mit sich, die in früheren Traumatisierungen wurzelte. Wenn die Linie der Partei uneindeutig schlingerte, bestand das – zumindest für die künftige Karriere – große Risiko, sich zur am Ende unterliegenden Linie – und die musste post festum natürlich von Anfang an falsch, revisionistisch, ja konterrevolutionär gewesen sein – bekannt zu haben. Sich daher Gorbačevs Umbau-Postulat anzuschließen, atmete den Geruch des Absturzes zumindest in dem Maße, wie die Gefahr des Scheiterns von Gorbačev drohte, es nicht auszuschließen war, dass es – wie in der KPdSU gewitzelt wurde – Michail Sergeevič erginge wie Nikita Sergeevič.
Die praktischen Schritte zur Entspannung im deutsch-deutschen Verhält-nis, die Akzeptanz der Rüstungskontrolle und -inspektion unterlief klassische Feindbilder in der Armee. Doch war der Imperialismus friedensfähig? Eine solche These wurde von politikwissenschaftlich argumentierenden Vertretern des Faches wissenschaftlicher Kommunismus ebenso vertreten38 wie von theo-retisierenden Mitarbeitern außenpolitischer Institutionen.39 Es war diese An-nahme eine Grundlage tatsächlicher Außenpolitik. Doch sie demontierte zentrale Bedrohungstheoreme der herrschenden Ideologie.
Einen verheerenden Schlag versetzte das Politbüro den Argumenten der ei-genen Propagandisten, als es am 19. November 1988 das beliebte und weit verbreitete sowjetische Digest Sputnik verbot. Ein sowjetisches Presseorgan wegen der Verbreitung antisowjetischer Hetze zu verbieten hieß, die Sowjet-union vor sich selbst schützen zu wollen. Der Anmaßung, die eigenen Leser zu bevormunden, gesellte sich jene hinzu, die Sowjetunion darüber belehren zu wollen, was ihr fromme und was nicht.40 Zeitweise, aber heimliche Verbote
37 Vgl. Hager: Erinnerungen, S. 388 f. 38 Vgl. Klein, Dieter: Chancen für einen friedensfähigen Kapitalismus. Berlin 1988 (Lehrhefte
Politische Ökonomie); Ders.; Neubert, Harald; Schmidt, Max: Friedliche Koexistenz – Klasseninteres-sen und Menschheitsprobleme. Berlin 1989; dagegen Hager, Kurt: Friedenssicherung und ideologi-scher Streit. Aus dem Referat auf einer Parteiaktivtagung der Bezirksparteiorganisation Frankfurt/O., Oktober 1987. In: Ders.: Kontinuität und Veränderung. Beiträge zu Fragen unserer Zeit. Berlin 1988, S. 61–64.
39 Vgl. Brie, André; Müller, Manfred: Europa: Wieviel Waffen reichen aus? Berlin 1988 (Blick-punkt Weltpolitik); Brie, André: Wenn alle Menschen der Welt … Neue Situation – neues Denken. In: Junge Welt, Nr. 299 v. 19.12.1976, S. 6.
40 Vgl. Hager: Erinnerungen, S. 390, über ein Gespräch mit Aleksandr Jakovlev: »Er begründe-te die uferlose (um nicht zu sagen zügellose) Geschichtskampagne damit, dass man dem Sowjetvolk die ganze Wahrheit sagen müsse. Ich war der Meinung, dass die ständige Hervorhebung alles Negati-ven und das Verschweigen des Positiven zu einem Verlust aller Werte, besonders bei der Jugend führen müsse.«
Bernd Florath 77
anderer sowjetischer Publikationen (Nichtauslieferung einiger Nummern der Wochenzeitschrift Neue Zeit) fielen immer dann auf, wenn es sich um deutschsprachige handelte. Russische traf es seltener. Offenbar war sich das Politbüro sicher, dass in der gebildeten Nation niemand tatsächlich Russisch lesen konnte – trotz obligatorischen mindestens fünfjährigen Unterrichts. So bemerkte auch kaum jemand, dass das 1989 neu gegründete Organ des ZK der KPdSU nie in den Postzeitungsvertrieb der DDR gelang-te, mithin ein Organ des ZK der Mutterpartei von Anfang an auf dem Index verbotener Druckwerke stand. Die durchschaubare Doppelzüngigkeit ihrer Behandlung der Führungsmacht untergrub die eigene Glaubwürdigkeit bei jenen, die da glaubten. Natürlich nur bei diesen. Doch gerade bei diesen han-delte es sich hier um den herrschaftsgarantierenden Kern der Partei. Das Ver-bot des Sputnik war Teil einer reaktionären innenpolitischen Wendung, die nach dem Bonn-Besuch Honeckers im November 1987 durch den doppelten Angriff auf die in der Gemeinde der Berliner Zionskirche agierenden Opposi-tionellen eingeleitet worden war. Erst ließ das MfS Nazischläger ein Konzert in der Kirche zusammenschlagen, dann griff es selbst ein und setzte Aktivisten der Umwelt-Bibliothek fest. Der Beginn des Jahres 1988 blieb durch die Fest-nahme von Oppositionellen und Ausreisewilligen im Gedächtnis, die es ge-wagt hatten, an der Gedenkdemonstration für Rosa Luxemburg mit dem Luxemburg-Zitat »Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden« teilzu-nehmen. Die zur Einschüchterung parteiinterner Kritiker verbreitete SED-interne »Information«, die sich anschloss, sollte aufkommende Unruhe im eigenen Hause im Keim ersticken. Das Verbot des Sputnik richtete sich explizit gegen die Herausforderung durch die Resultate von Glasnost’ und bestätigte das Fortgelten der Tabuisierung der Geschichte des Kommunismus. Am Ende des Jahres 1988 wurde schließlich mit der Gründung des »Freidenkerverban-des« der Versuch gestartet, der als Diversionstätigkeit protestantischer Kirchen missverstandenen Opposition offensiv zu begegnen. Der Versuch scheiterte kläglich. Selbst die massive Unterstützung durch den SED-Apparat, staatliche Instanzen und – verdeckt freilich – das MfS konnte nicht verhindern, dass die neue Organisation des Kirchenkampfes ohne Resonanz selbst unter den SED-Mitgliedern blieb.41
Die wirtschaftlichen Probleme der DDR des Jahres 1989 waren offenkun-dig. Wer sie nicht begreifen wollte, konnte sie beim Gang durch die Städte und Dörfer greifen. Sie fielen als Dachziegel den Leuten auf den Kopf, als Züge von den Schienen. Einigkeit herrschte durchaus darüber, dass sich eine bloße Politik des Weiter-so nicht mehr umsetzen ließ.42 Das offensichtliche Dilemma führte dazu, dass die Eröffnung der Parteidiskussion zur Ausarbei-
41 Vgl. Kowalczuk: Endspiel, S. 304–307. 42 Vgl. ebenda, S. 109–134.
78 SED im Untergang
tung der Generallinie, die der XII. Parteitag zu beschließen haben würde, im Sommer 1989 von großen Erwartungen begleitet war. Erwartet wurde, dass die Kluft zwischen erlebter wirtschaftlicher und sozialer Realität und den Po-temkinschen Dörfern des Neuen Deutschlands überwunden würde und die SED-Mitglieder in den Betrieben aus dem Dilemma befreit würden, in das sie der Zwang, eine offenkundig falsche Politik zu verteidigen und eine unüber-sehbar verlogene Berichterstattung als Wahrheit auszugeben, brachte. Diese Sandwichposition der einfachen SED-Mitglieder hatte dazu geführt, dass sie sich kaum mehr in der Lage sahen, ihre Partei zu verteidigen oder gar zu ver-treten. So konstatierte das Politbüro am 6. Januar 1987 über einen sächsischen Betrieb, dessen Arbeiter sich über versteckte Preistreibereien und stagnierende Löhne beschwert hatten:
»Den 8 Genossen der Grundorganisation (bis auf einen Produktionsarbeiter sind das staatliche Leiter) fällt es schwer, mit der notwendigen Konsequenz die Beschlüsse des Zentralkomitees entsprechend den konkreten Bedingungen im Betrieb umzusetzen. Das Parteileben ist vorwiegend nach innen gerichtet und hat wenig Ausstrahlungskraft auf die Arbeitskollektive.«43
Ganzseitige Artikel im Neuen Deutschland gaben den Startschuss. Doch schon die ersten Artikel machten überdeutlich, dass hier keine einzige aus dem bishe-rigen Fahrwasser hinaustretende Option sichtbar wurde. Obwohl durchaus bekannt war, dass es Debatten und Studien in neue Richtungen gab.
Am weitesten gingen wohl die Diskussionen, die von Philosophen, Soziolo-gen, Juristen und Ökonomen an Universitäten geführt wurden. Doch wurde ihnen die Ehre des Abdrucks im Zentralorgan nicht zuteil, obwohl sie keinen Zweifel daran ließen, dass sie das Machtgefüge, d. h. das Machtmonopol der SED auch nicht im Geringsten anzutasten gedachten.
An die Stelle einer Debatte über die drängendsten Probleme des Landes trat eine tiefe Agonie. Sie wurde verstärkt, als bei sich zuspitzender Krise des Spät-sommers die SED-Führung offensichtlich handlungsunfähig war: Honecker ist krank. Sein Vertreter, der für die verheerende Wirtschaftpolitik verantwortli-che schwerstbeschädigte Günter Mittag, ist nicht in der Lage, auch nur eine politische Stellungnahme abzugeben, als die Ostdeutschen über die offene Grenze von Ungarn nach Österreich davonlaufen. Die einzige politische Erklä-rung dieser Zeit, die sich den Problemen der DDR stellt, und zwar im Sinne einer auf sie bezogenen Politik, die nicht lediglich das Land verlassen will, ist die Opposition. »Neues Forum«, »Demokratie Jetzt«, »Demokratischer Auf-bruch«, »Böhlener Plattform« fordern einen Kurswechsel. Demonstranten
43 Aus einer Information über die Bearbeitung der Eingabe von 35 Werktätigen des VEB Ma-schinenfabrik Großschönau, Kreis Zittau, an den Staatsrat der DDR. Anlage 1 des Beschlusses des Politbüros v. 6. Januar 1987. In: Behrendt, Manfred; Meier, Helmut (Hg.): Der schwere Weg der Erneuerung. Von der SED zur PDS. Eine Dokumentation. Berlin 1991, S. 75.
Bernd Florath 79
sprechen der Mehrheit der Genossen aus der Seele, als sie »Wir bleiben hier« skandieren. Die Handlungsunfähigkeit des Politbüros lässt viele SED-Mitglieder interessiert nach den Erklärungen der Opposition greifen.
Es geschieht etwas Unerwartetes: Diese Texte werden als Ausdruck legitimer Sorge um den Zustand des Landes akzeptiert. Das heißt nicht, dass die SED-Mitglieder in Gänze die Positionen der Oppositionsgruppen teilten. Doch es einte sie jener Satz, der vielen im September/Oktober 1989 verbreiten Stel-lungnahmen vorangestellt wurde: »In großer Sorge«. Die Einladung des »Neu-en Forums« an die SED-Mitglieder, sich an der Wiederherstellung der öffent-lichen Kommunikation im Landes zu beteiligen, nicht zuletzt weil viel der unentbehrlichen Kompetenz an Mitglieder der SED gebunden ist, macht den Weg zur Beteiligung von Parteimitgliedern an Demonstrationen frei, aller-dings ohne dass sie sich dort auch als solche kenntlich machen. In der Beurtei-lung der Situation des Landes und in der Auffassung über die Unfähigkeit der SED-Führung, diese zu meistern, stellte das MfS fest, würden sich SED-Mitglieder »kaum noch von Parteilosen unterscheiden«.44 Dieser Befund wurde mehrfach und mit außerordentlich besorgten Kommentaren versehen sowohl vom MfS als auch von Parteiorganisationen an die Führung vermeldet.45 Die kritische Sicht der SED-Mitglieder auf die Politik ihrer Führung äußerte sich auch nicht mehr eingehegt in privaten Gesprächen, sondern wurde mehr und mehr laut vorgebracht:
»Viele Werktätige, einschließlich zahlreicher Mitglieder und Funktionäre der Partei, sprechen ganz offen darüber, dass die Partei- und Staatsführung nicht mehr in der Lage und fähig sei, die Situation real einzuschätzen […] Es sei dadurch die Lage entstanden, dass selbst zahlreiche Bürger […] mit einer positiven Grundeinstellung sich mit Zielen und Inhalten der oppositionellen Sammlungsbewegung ›Neues Forum‹ identifizieren, die in dem Gründungsaufruf dieser Gruppierung enthaltenen politischen Grundinhalte und Forderungen akzeptieren und weiter verbreiten.«46
44 ZAIG: Hinweise auf beachtenswerte Reaktionen von Mitgliedern und Funktionären der
SED zu einigen aktuellen Aspekten der Lage in der DDR und zum innerparteilichen Leben, 11.9.1989. In: Mitter, Armin; Wolle, Stefan (Hg.): Ich liebe euch doch alle! Befehle und Lageberichte des MfS. Januar–November 1989. Berlin 1990, S. 148.
45 Vgl. Süß: Staatssicherheit, S. 235–237; Information 19/89 über aktuelle Aspekte der Reakti-on der Bevölkerung, 29.8.1989; BStU, ASt Neubrandenburg, Abt. XX, SbA, Bd. I, Bl. 188–192, zit. nach: Niemann, Andreas; Süß, Walter: »Gegen das Volk kann nichts mehr entschieden werden«. MfS und SED im Bezirk Neubrandenburg. Berlin 1996 (BF informiert; 12), S. 17; vgl. auch die erboste Reaktion des Erfurter SED-Chefs Gerhard Müller Anfang September 1989: »Es gibt auch Parteimit-glieder, die knieweich werden im Trommelfeuer des Klassenfeindes« – Mestrup, Heinz; Remy, Diet-mar (Hg.): »Wir können ja hier offen reden …« Äußerungen vom Politbüro-Kandidaten und Erfurter Bezirks-Chef Gerhard Müller. Eine Dokumentation. Erfurt 1997, S. 155.
46 ZAIG: Hinweise über Reaktionen progressiver Kräfte auf die gegenwärtige innenpolitische Lage in der DDR, 8.10.1989. In: Mitter; Wolle: Ich liebe euch doch alle, S. 204 f.
80 SED im Untergang
Die Reaktionen innerhalb der SED auf die neu entstandene Lage beginnen sich nun einerseits auszudifferenzieren, andererseits bilden sich aus divergie-renden Interessen gespeiste Bündnisse, selbst dort, wo sie nur zeitweiliger Natur sind. Allen gemein ist es, dass sie, nicht absichtlich, nicht einmal, so würden Staatsanwälte argumentieren, unter billigender Inkaufnahme den monolithischen Block der herrschenden Partei aufzulösen beabsichtigen.
Innerhalb des Politbüros und der herrschenden Parteibürokratie beginnt die Angst über den drohenden Verlust der politischen Initiative um sich zu grei-fen, zu einem Zeitpunkt, da diese längst verloren war. Die Illusion, die Initia-tive zurückerlangen zu können, verlockt zu Entscheidungen, die partiell eigene Machtpositionen aufgibt, frühere Entscheidungen selbst delegitimiert: Hone-cker wird abgelöst.
Warum wird diese Palastrevolte allerdings in einem Stil zelebriert, der Kon-sens unterstellt? Die Erklärungen, die lediglich auf eintrainierte Verhaltens-muster abzielen, scheinen mir nicht hinreichend. Es gab durchaus einen Druck, der von ideologisch gläubigen Mitgliedern ausging, den in der Vergan-genheit so verdienstvollen Honecker nicht wie seinen Vorgänger bei der Ablö-sung zu demütigen.47 Ein atavistischer Ruf nach Gerechtigkeit, der fernab von den Stimmen der Bevölkerungsmehrheit stand, glaubte so durch die Vermei-dung des ruchlosen Umgangs mit gestürzten Despoten in früherer Zeit einen neuen politischen Stil etablieren zu können.48 Die Honecker stürzenden Dia-dochen waren beim Umgang mit dem Alten offenbar unbewusst von der Furcht befangen, auch ihre Zeit könnte vorüber gehen. Zugleich entsprach der Übergang von Honecker zu Krenz im Stil seiner Substanz: Ein Übergang ohne Änderung. Bloßes Nachholen des unter Honecker verpassten Generations-
47 Stephan Hermlin an Erich Honecker, 20.10.1989: »Lieber Erich, [...] Ich gehöre nicht zu den Menschen, die angesichts einer Wende, einer Veränderung ihr Gedächtnis einbüßen. […] Du bist und bleibst für mich ein Vorbild, auch wenn die Zeiten und ihre Anforderungen an uns wechseln mögen«; mehr oder minder in ähnlicher Absicht und Tonlage: Jürgen Kuczynski an Erich Honecker, 19.10.1989; Eberhard Rebling an Honecker, 19.10.1989; Kurt Masur an Erich Honecker, 30.10.1989: »So glücklich ich bin über die Aufbruchstimmung in unserem Lande, so wenig konnte ich vergessen, was Sie in der zurückliegenden Zeit bei wichtigen Entscheidungen im Bereich der Musikkultur an Verdiensten haben.« Alle in: Eberlein, Werner u. a. (Hg.): Auskünfte über Erich Honecker. Berlin 2002, S. 64 f.; Krenz: Herbst, S. 66: »Honeckers Biographie hat mich stark geprägt«; Schabowski, Günter: Das Politbüro. Ende eines Mythos. Eine Befragung, hg. v. Frank Sieren u. Ludwig Koehne. Reinbek 1990, S. 108 u. 116: »Die Genossen wollten nicht hören, dass Honecker einen Fußtritt gekriegt hat, sondern, dass er in Ehren und Würde aus dem ZK entlassen worden war. Das brauchten die. Eine andere Behandlung von Honecker hätte bedeutet: Alles ist kaputt. Das hatten wir vermieden, um nicht noch weitere Unsicherheit zu verbreiten.«
48 In dieser Richtung soll sich, einem Bericht der HA Auswertung und Kontrolle – der MfS-Filiale in der Akademie der Wissenschaften – zufolge, selbst Hans-Jürgen Treder geäußert haben: »Zum Rücktritt von Erich Honecker brachte er eine gewisse Verbitterung zum Ausdruck, da nach seiner Auffassung er einen solchen Abgang nicht verdient hätte und ein günstigerer Zeitpunkt für eine solche Lösung verpasst worden sei.« – HA Auswertung und Kontrolle: Information, 19.10.1989; BStU, MfS, HA XVIII, Nr. 18721, Bd. 2, Bl. 48.
Bernd Florath 81
wechsels als Austausch der Alterskohorte in der obersten Führungsetage ohne tatsächlich politisches Revirement. Die Form des Sturzes signalisierte dem Apparat, der Nomenklatura der Partei, des Staates und der Wirtschaft, dass sich nichts an ihrer Machtstellung ändern würde. Und diese Machtstellung ist zugleich das Privileg der SED. Die im Zentralkomitee geführte Debatte über die Frage, mit welcher Formulierung die gerade gestürzten Politbüromitglieder in den Ruhestand geschickt werden, verdeutlicht die Ambivalenz des Vorge-hens: Einerseits soll deutlich werden, dass sie nicht aus Gründen des Alters oder der Gesundheit gehen, sondern eine verfehlte Politik abgelöst wird. An-dererseits soll die diese Politik begründende Verwurzelung aufrecht erhalten werden, indem z. B. Krenz immer wieder auf die Metapher zurückgreift, dass die gestürzten Genossen doch »unter spanischem Himmel gekämpft« hätten – zumindest »einige von ihnen« …
»Also, Genossen, ich bitte um Verständnis, aber wir müssen das miteinander trennen. […] Aber dass wir hier nun nicht mal mehr ein Wort des Dankes an Genossen sagen, die vierzig Jahre und länger gearbeitet haben – ich weiß nicht, ob das die vielen fleißigen Kommunisten im Lande verstehen. Zuruf: Das ist unanständig!«49
Eine Politik des Einerseits und Andererseits: Allerdings wolle man den Dialog mit den Demonstranten durchaus annehmen (welche Alternative dazu hätte es auch gegeben bei Demonstrationen mit sechsstelligen Teilnehmerzahlen?), doch blieben diese Demonstrationen feindliche Veranstaltungen. So feindlich, dass gar nicht mehr unterschieden wurde, wer demonstriert. Hans Modrow wird im ZK-Plenum von Günther Jahn angegriffen, weil er sich in Dresden in der Absicht, die Spannungen zu entschärfen, in die Demonstrationen einge-reiht hatte.50 Es ist ohnehin ein Irrtum, davon auszugehen, dass die zahllosen Demonstrationen des Oktober, November und Dezember Angelegenheit ausschließlich jener gewesen seien, die nicht Mitglieder der SED waren. Es fehlt an empirischen Untersuchungen hierzu, doch die Demonstrationen spiegelten in ihrer Zusammensetzung den Unmut, ja die Wut der Bevölkerung über die herrschende Clique wider, wie er sich in den vielen »in großer Sorge« verfassten Resolutionen darstellte, die nicht zuletzt auch von SED-Gruppen und -Organisationen verfasst worden waren. Deutlich wird dies nicht zuletzt in den gescheiterten Versuchen, die Parteimitglieder zu regimefreundlichen Demonstrationen zusammenzutrommeln. Löste sich die Kundgebung der SED-Bezirksleitung in Schwerin am 23. Oktober 1989 faktisch in eine opposi-
49 10. Tagung des ZK der SED, 1. Beratungstag, 8.11.1989, Nachmittagssitzung, Egon Krenz.
In: Hertle, Hans-Hermann; Stephan, Gerd-Rüdiger (Hg.): Das Ende der SED. Die letzten Tage des Zentralkomitees. Berlin 1997, S. 180 f.
50 Günther Jahn auf dem 10. Plenum. In: Hertle; Stephan: Das Ende der SED, S. 145. Selbst ein anonymes ZK-Mitglied, das die Wahl Modrows ins Politbüro unterstützte, tat dies »trotz der Tatsache, dass er an der Spitze einer Demonstration gestanden hat«. Ebenda.
82 SED im Untergang
tionelle Veranstaltung auf, so endeten ähnliche Versuche in Neubrandenburg und Erfurt mit unüberhörbaren Forderungen nach Rücktritt der SED-Bezirksfürsten Chemnitzer und Müller.
Neuartig war hingegen die Demonstration von SED-Mitgliedern vor dem ZK-Gebäude am Nachmittag des ersten Tages des 10. Plenums, deren Kern-forderung ursprünglich die Einberufung einer Parteikonferenz war, die der hilflosen Nachtrabpolitik des Politbüros ein Ende setzen sollte.51 Diese Forde-rung war die satzungskonforme Konsequenz von SED-Mitgliedern, die von einer Tagung des alten Zentralkomitees keine politischen Aussagen mehr erwarteten, die adäquat auf die Krise Antwort gaben. Sie sollte sich rasch zur Forderung nach einem Parteitag radikalisieren, als der Verlauf des Plenums bewies, dass diese Parteiführung nicht nur nicht in der Lage war, diese politi-schen Konsequenzen zu ziehen, sondern sich lediglich damit beschäftigte, den Status quo auch in personeller Hinsicht durch geringfügige kosmetische An-passungen zu zementieren. Die Parteikonferenz, die nach dem SED-Parteistatut nicht das Recht hatte, eine neue Parteiführung zu wählen, hätte daher zwar eine neue politische Linie beschließen können, deren Umsetzung dann aber in die Hände der Machthaber von gestern gelegt.
Das Plenum erkannte diese Gefahr sofort, wie die ersten Reaktionen auf diese Forderungen bewiesen,52 beugte sich schließlich unter dem Druck der Parteibasis in Berlin und akzeptierte das kleinere Übel, die Parteikonferenz. Erst die erbosten Reaktionen aus den Bezirken ließen Egon Krenz zwei Tage nach dem 10. Plenum die Mitglieder des Zentralkomitees wieder nach Berlin zitieren, um nun den SED-Mitgliedern doch einen Parteitag zu konzedieren. Wieder mal hinkte die SED-Führung den Forderungen der Straße hinterher. War sie bislang von den Bürgerinnen und Bürgern getrieben worden, so muss-te sie sich nunmehr exklusive der eigenen Mitgliedschaft beugen.53
Für die innerparteiliche Entwicklung indes – und dies ist die einzige, wenn auch nicht erklärte, Änderung – wurde auf schon geplante Disziplinierungen verzichtet. Schon die persönlichen Gespräche der Parteileitungen mit jedem einzelnen Mitglied, die als Teil des Umtausches der Parteidokumente angesetzt waren, wurden, als sie ins Gegenteil der intendierten Richtung umzukippen drohten, entschärft. Da immer mehr Genossen, anstatt sich von Funktionären
51 Zum Zustandekommen dieser Demonstration siehe unten, S. 94. 52 10. Plenum (hier insbesondere Günter Schabowski, Egon Krenz, Roland Bauer). In: Hertle;
Stephan: Das Ende der SED, S. 182–184. 53 Egon Krenz auf dem 11. Plenum. In: Ebenda, S. 440: »Wir müssen heute klar sagen, dass wir
mit Letzterem [der Einberufung der Parteikonferenz – Anm. d. Verf.] nicht die schnelle Entwicklung in der Partei berücksichtigt haben und vor allem nicht den Forderungen und Erwartungen breiter Teile der Parteibasis entsprochen haben.«
Bernd Florath 83
wegen wirklicher oder vermeintlicher Abweichungen vom elften Gebot54 die Leviten lesen zu lassen, ihrerseits die Versäumnisse und Fehler der Parteifüh-rung beklagten, wurde angeordnet, dass diese Gespräche nicht einmal mehr zu protokollieren seien. Am Ende wurde die angefachte Säuberung schlicht nicht mehr umgesetzt. Debatten über die einzuschlagende Politik gewannen nun-mehr auch oberhalb der Ebene der Parteigruppen an Schärfe und inhaltlicher Brisanz. Nicht jedoch, ohne erlernte Ängste sofort abzulegen. Die Angst vor dem Terror der eigenen Genossen war durchaus noch vorhanden.
Dagegen schwand die Angst der SED-Mitglieder vor der Rache des Geg-ners. Mit dem Schreckensbild, der würde sie an den nächsten Laternen auf-hängen, war oft argumentiert worden, um den Korpsgeist zu stärken.55 Dieses Horrorbild über den Tag, nachdem die Kommunisten die Macht verloren hätten, speiste sich aus sehr heterogenen, in der Regel historischen Quellen: Es waren Erfahrungen der unterlegenen Aufständischen der deutschen Novem-berrevolution und der verlorenen Bürgerkriege der Nachkriegszeit.56 Es war die unmittelbare Erfahrung der Älteren und die immer wieder den Jüngeren ver-mittelte Erfahrung. Es waren die traumatischen Erfahrungen nicht nur der Kommunisten mit dem Terror des Nationalsozialismus. Aber es war auch der immer wieder in Erinnerung gerufene Schrecken der Ohnmacht des 17. Juni 195357 oder die Bilder der im Oktober 1956 von ungarischen Demonstranten gelynchten ÁVO-Soldaten, die massakriert wurden, nachdem aus ihren Reihen in die Kundgebung gefeuert worden war.58 Es gab eine gerade in der DDR sehr
54 Dass ausgerechnet der gescheiterte Priesterschüler Stalin die Übertretung des nicht in den
Katechismus aufgenommenen 11. Gebotes (»Ihr sollt weder rechts noch links abweichen.« – 5. Mose 5, 32) als Kapitalverbrechen verfolgte, entbehrt nicht einer gewissen bitteren Ironie.
55 Noch am 24.10.1989 wurde in der SED-Konferenzparteigruppenversammlung der der SED angehörenden Mandatsträger der Volkskammer die frei erfundene Behauptung aufgestellt, in Berliner Kirchen seien Aufrufe mit der Forderung, Kommunisten aufzuhängen, plakatiert worden. – Vgl. Tonbandmitschnitt der Versammlung, Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin, Archiv der DDR-Opposition, zit. nach: Kowalczuk: Endspiel, S. 430; vgl. SED-Fraktionssitzung wurde heimlich mitgeschnitten. In: telegraph, Nr. 8 v. 16.11.1989, S. 2 f.
56 Vgl. Gumbel, Emil Julius: Vier Jahre politischer Mord und Denkschrift des Reichsjustizmi-nisters. Heidelberg 1980 (5. Aufl. von Zwei Jahre Mord. Berlin 1922).
57 Vgl. Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, Roger: Der Tag »X« und die Staatssicherheit. 17. Juni 1953. Reaktion und Konsequenzen im DDR-Machtapparat. Bremen 2003 (Analysen und Dokumente; 24), S. 65–67 u. 81–117. Seltsamerweise sind die während des Aufstandes ums Leben gekommenen Vertreter des SED-Staates später nicht in den Ruf von Märtyrern gekommen, offenbar war die Differenz zwischen zum Opfer eines faschistischen Putsches werdenden Helden der literari-schen Verarbeitungen wenig konkreter Vorgänge (z. B. bei Erik Neutsch) und der ernüchternden konkreten Tragik entgrenzter gewaltsamer Übergriffe in Rathenow und Magdeburg zu groß, um sie propagandistisch verwerten zu können. – Vgl. Eisenfeld, Bernd; Kowalczuk, Ilko-Sascha; Neubert, Ehrhart: Die verdrängte Revolution. Der Platz des 17. Juni 1953 in der deutschen Geschichte. Bre-men 2003 (Analysen und Dokumente; 25), S. 606–612.
58 Die damals von westdeutschen Illustrierten veröffentlichten Bilder fanden sich in jeder im Ostblock erschienenen Darstellung der ungarischen »Konterrevolution«. Freilich musste man nach
84 SED im Untergang
spezifische existenzielle Angst von SED-Mitgliedern, die als Kitt für deren Regimetreue nicht unterschätzt werden darf. Sie beruhte auf dem tiefen, of-fenbar untilgbaren Misstrauen derjenigen Minderheit, die gegen den National-sozialismus gekämpft hatte, vor der Mehrheit im eigenen Volk, die Hitler bis zum Schluss stützte.59 Selbst Bertolt Brecht reflektiert diesen Aspekt, wenn er das Misstrauen festhält, das ihn gegen die Deutschen heimsucht, mit denen er nach 1945 zu tun hat: Über ein Jahr nach dem 17. Juni 1953 notiert er in seinem Arbeitsjournal:
»dieses land ist immer noch unheimlich. neulich, als ich mit jungen leuten aus der dra-maturgie nach buckow fuhr, saß ich abends im pavillion, während sie in ihren zimmern arbeiteten oder sich unterhielten. vor zehn jahren, fiel mir plötzlich ein, hätten alle drei, was immer sie von mir gelesen hätten, mich, wäre ich unter sie gefallen, schnurstracks der gestapo übergeben …«60
Doch die Demonstrationen im Herbst 1989, an denen sich auch viele SED-Mitglieder beteiligten, waren von so systematischer Friedfertigkeit. Alle Ge-waltszenen gingen – das Dresdner Beispiel ausgenommen –61 selbst wenn man den DDR-Medien folgte, von der Staatmacht aus, sodass diese, die SED-Mitglieder zusammenschweißende Angst sich verlor.
Diese unabweisbare Erfahrung mit der bis dahin so fremden Opposition verbunden mit dem Umstand, dass während das Politbüro schwieg, sie es war, die der Sorge um den Zustand des Landes Ausdruck verlieh, richtete den Blick vielmehr nach innen, auf die eigene Führung. Das noch bis zur Maueröffnung aufrechterhaltene Verbot der Bürgerbewegungen verlor jede Nachvollziehbar-keit. Der verkündete Kurswechsel Mitte Oktober blieb substanziell nicht greifbar. Es begann eine fieberhafte Suche nach Konzepten, die der Partei, die sich im Oktober zweifellos noch nicht als allein führende politische Kraft außer Kurs gesetzt sah, neue Führungslegitimation hätte verleihen sollen. Allein die Fülle als auch die Gegensätzlichkeit der angestauten Probleme machte die Antwort faktisch unmöglich, zumindest solange die SED sich als Führerin des Landes und nicht als eine politische Partei unter anderen begriff, die bestimmte, partikuläre Interessen vertreten würde.
den Bildern von Csepel, der von sowjetischer Artillerie zerschossenen Hochburg der Budapester Arbeiter, vergeblich suchen.
59 Vgl. Fechner, Max: Erfahrungen aus der Aktionseinheit. In: Einheit, Monatsschrift zur Vor-bereitung der Sozialistischen Einheitspartei 1(1946)1, S. 4 f.: »Dennoch aber konnte man nicht annehmen, dass alle die Millionen, die bis in die letzte Zeit hinein hinter Hitler und seiner verbreche-rischen Politik gestanden hatten, nun über Nacht gute Demokraten und Friedensfreunde geworden wären. […] So ist es leider nur zu sicher, dass noch allzu viele ihre Faust in der Tasche ballen und nur darauf warten, dass sie uns wieder an die Gurgel pressen können.«
60 Brecht, Bertolt: Arbeitsjournal 1938–1955, hg. v. Werner Hecht. Berlin, Weimar 1977, S. 518 f.
61 In Dresden kam es am späten Abend des 4.10.1989 auch vonseiten der Demonstranten, die versuchten in die aus Prag gen Westen fahrenden Züge zu steigen, zu Gewaltanwendungen. – Vgl. Süß: Staatssicherheit am Ende, S. 251–260; Kowalczuk: Endspiel, S. 383–386.
Bernd Florath 85
Die bis hierher noch vollkommen unveränderten innerparteilichen Hierar-chien reagierten auch jetzt nicht mit einer Öffnung der schon im August ver-weigerten Debatte, sondern mit kläglich scheiternden Versuchen, Parteimit-glieder zur Rückeroberung der Straße antreten zu lassen. Solche Unterneh-mungen endeten in der Regel in einem Desaster. Der größere Teil des Parteivolks sah wenig Veranlassung, gegen das Volk zu demonstrieren, ließ sich auch nicht mehr beliebig kommandieren.
An die Stelle einer politischen Diskussion über den Kurs der SED setzte das Zentralkomitee auf der 10. Tagung vom 8. bis 10. November 1989 ein Akti-onsprogramm, das keines der anstehenden Probleme auch nur annähernd zu greifen vermochte, gerade weil es im alten Stile versucht, anstelle des Staates der Gesellschaft ein allumfassendes Politikkonzept zu oktroyieren.62 Dies hätte auch eine Koalitionsregierung überfordert.
Das 10. Plenum sollte zweierlei erreichen: Dem Land eine Politik verord-nen, die aus dem Chaos und dem wirtschaftlichen Desaster der Honecker-Zeit wieder die Aussicht auf Prosperität eröffnen und damit zugleich die Gründe ausräumen würde, die dem auf der Straße demonstrierten Unwillen der Bevöl-kerung die Berechtigung gaben. Für eine Reform des ökonomischen Systems, die zugleich die kontraproduktive Einmischung der ZK-Wirtschaftsabteilung beende, wie sie unter Günter Mittag praktiziert worden war, und die zentrale Planung beibehalte, konnte es indes nur eine Lösung geben, die auf eine Quadratur des Kreises hinausgelaufen wäre. Deutlich sichtbar wurde das Pro-blem im Unwillen der neuen Führung unter Krenz, in den emotionalen Aus-brüchen des neuen Generalsekretärs und der beschwichtigenden Bestätigung dieser Klage durch seinen Propagandachef Schabowski am zweiten Tage des Plenums. Erbittert wetterte Krenz gegen die sich unabhängig machende Presse. Irgendwie bunter und interessanter und unabhängiger solle sie zwar sein, die gewendete Presse, wenn aber Unabhängigkeit bedeute, dass sie etwas berichte, das Krenz nicht für die Wahrheit halte, so sage er: »Nicht mit mir!«63
»Manche Journalisten verstehen sich offensichtlich plötzlich als Privatpersonen, und ich denke, sie müssen sich wieder als Mitglieder unserer Partei verstehen. […] Die Chefre-dakteure unserer Parteipresse sind dem Statut unterworfen […] und in diesem Sinne
62 Die Bedeutungslosigkeit des Aktionsprogramms erhellt sich nicht zuletzt aus der Verfahrens-weise, mit der es verabschiedet wurde. Dieses für die künftige Politik der SED als grundlegend be-zeichnete Papier wurde vom 10. Plenum nicht beschlossen, sondern »im Prinzip bestätigt«, alle ZK-Mitglieder, »die Vorschläge zum Aktionsprogramm haben, übergeben diese dem Genossen Lorenz persönlich, und Genosse Lorenz prüft in Übereinstimmung mit denen, die diesen Antrag stellen, ob es zweckmäßig und notwendig ist, sie aufzunehmen«. (Krenz auf dem 10. Plenum des ZK, 3. Beratungs-tag, 10.11.1989. In: Hertle; Stephan: Das Ende der SED, S. 429). Dieser freihändige Umgang mit einem als so hochrangig angesehenen Papier, »das als Grundlage für die Vorbereitung der 4. Partei-konferenz« (ebenda, S. 435) dienen sollte, dürfte für eine Organisation, die sich selbst ernst nimmt, ungewöhnlich sein.
63 Ders., ebenda, 2. Beratungstag, 9.11.1989. In: Ebenda, S. 243.
86 SED im Untergang
müssen wir die Medien anleiten und nicht in dem Sinne, dass also Administration wie-der einsetzt.«64
Doch diese Kette war offenbar bereits am Reißen. Günter Schabowski wies am kritisierten Beispiel der Presse auf eine sich ändernde Realität hin, die den Weg zurück zur Kontrolle anderer Institutionen durch die leitenden SED-Kader untergrub:
»Haben die Chefredakteure versagt? […] Die Chefredakteure in den meisten Redaktio-nen stehen zur Disposition. […] Wir müssen aber aus den Sachen, die Erich, eh, die Egon gesagt hat, die Konsequenzen ziehen. […] Die Methoden dazu können nur wieder Methoden der Administration und Gängelei sein, wenn man das mal in Anführungszei-chen sagen will, anders ist es nicht möglich.«
Die selbst gestellten Ziele verfehlte das ZK-Plenum vor allem durch zwei of-fensichtliche Umstände: die Personalpolitik und die am 9. November verkün-dete Öffnung der Mauer.
Beides folgte vor allem dem Bestreben der Parteinomenklatura, ihre schwindenden Positionen zu bewahren. Die personellen Änderungen im Polit-büro sollten die öffentlich attackierten Problemfälle entsorgen. Das scheiterte aber binnen Stunden an der nicht mehr zu kaschierenden Verkommenheit auch der zweiten Reihe von Funktionären, an denen sich eine Debatte über Korruption, Inkompetenz und Privilegierung entzündete. Der suchtgefährdete Gewerkschaftsvorsitzende, der nicht über den Verbleib enormer Spendenmit-tel Auskunft geben konnte, verschwand ebenso plötzlich wie eine Reihe kom-munistischer Waidgenossen.65
Dagegen stellt die unpräzise vorbereitete Maueröffnung den wirklichen Po-litikersatz der SED-Führung dar: Sie sollte Luft verschaffen, den Druck der revoltierenden Bürgerinnen und Bürger auf die Parteiführung einerseits ver-ringern; persönlich erhoffte sich Günter Schabowski durch seinen Auftritt wohl besondere Vorteile im rotierenden Personalkarussell. Bärbel Bohleys spontane Reaktion auf den 9. November richtete sich damals keineswegs dage-gen, dass die furchtbare Grenze endlich offen war, als vielmehr gegen diesen Coup, mit dem die SED-Führung versuchte, der Opposition die Unterstüt-zung der Massen zu entwenden.66 Wieder einmal erwiesen sich diese Massen indes als klüger. Sie nutzten die neugewonnene Freiheit, doch dankten sie nicht dem ZK, sondern verachteten die SED mehr als zuvor.
64 Ebenda, S. 245. 65 Ihm war schon bei der ersten nicht präparierten Begegnung mit Berliner Arbeitern offen das
Misstrauen ausgesprochen worden, nachdem er die Verantwortung für die Misere in den Gewerk-schaften auf die Vertrauensleute abgeschoben hatte. – Krenz: Herbst ’89, S. 167; Eckelmann, Wolf-gang; Hertle, Hans-Hermann; Weinert, Rainer: FDGB intern. Innenansichten einer Massenorganisa-tion der SED. Berlin 1990, S. 140–148.
66 Vgl. Wolfram: Nachbericht, S. 152.
Bernd Florath 87
Die bislang herrschende Nomenklatur indes zerfiel. War die Ablösung der Bezirksfürsten der Honeckerschen Garde anfänglich Teil des Kaderrevire-ments, mit dem Krenz die Parteinomenklatur nach eigenen Vorstellungen anzupassen strebte, entglitt ihm dieses Verfahren durch den öffentlichen Druck, den die SED nicht mehr vor der Tür halten konnte. Die verunsicher-ten Bezirksleitungen opferten ihre Ersten Sekretäre, um die eigene Stellung zu behaupten. Bis zum 8. November wurde der Wechsel an den Spitzen noch durch Funktionäre aus Berlin begleitet, die neuen Ersten auf Vorschlag der Zentrale aus der Mitte des Bezirkskaders bestimmt.67 Das Prinzip der Nomenklatur blieb gesichert. Doch der wachsende Druck untergrub auch die Position jener Bezirkssekretäre, auf die sich Krenz fürderhin stützen zu können glaubte. Hinter dem Nebelvorhang der kollektiven Verantwortung (»Das Politbüro übernimmt die ganze Verantwortung für die entstandene Lage und jedes seiner Mitglieder, jedes seiner Kandidaten mit.«68) sollte die individuelle versteckt bleiben. Doch das Misstrauen der Demonstranten, das den Bezirks-
67 Am 3.11.1989 vermeldete das Neue Deutschland die Ersetzung der beiden Bezirkssekretäre
Herbert Ziegenhahn in Gera und Hans Albrecht in Suhl durch Erich Postler und Peter Pechauf. Ziegenhahn und Albrecht hatten Honecker noch nach dem 11. Oktober in der Beratung des ZK-Sekretariats mit den BL-Sekretären unterstützt. Krenz hatte die ZK-Sekretäre Werner Krolikowski nach Gera und Horst Dohlus nach Suhl geschickt, die dort den jeweiligen in Berlin entschiedenen Kader-»Vorschlag in Abstimmung mit dem Sekretariat der Bezirksleitung […] unterbreitet und begründet« haben. Dabei griff Krenz im Falle von Erich Postler, seinem langjährigen Stellvertreter als FDJ-Chef, auf die alte Ulbrichtsche Methode zurück, Parteikader von einem Ort an den nächsten zu »stecken«, auch gegen den Einspruch der SED-Bezirksleitung Schwerin, die auf ihren 2. Sekretär zu diesem Zeitpunkt gar nicht verzichten wollte. Vgl. Niemann, Mario: Die Sekretäre der SED-Bezirksleitungen 1952–1989. Paderborn u. a. 2007 (Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart), S. 354. Mit dem analogen Reiseauftrag ersetzten dieselben ZK-Sekretäre Krolikowski und Dohlus drei Tage später in Leipzig Horst Schumann durch Roland Wötzel und in Schwerin Heinz Ziegner durch Hans-Jürgen Audehm. – Vgl. Neues Deutschland v. 3. u. 6.11.1989. Schumann wurde die Situation in Leipzig angelastet, während Wötzel sich durch seine Beteiligung am Aufruf einer Reihe von Persönlichkeiten zur Besonnenheit am 9.10. als Sekretär für Wissenschaft und Volksbil-dung der BL aus der Deckung gewagt hatte. Ziegenhahn war durch seinen kläglich gescheiterten Versuch, den Demonstrationen in Schwerin einen SED-Aufmarsch entgegenzusetzen, in jeder Hin-sicht unhaltbar geworden. Doch alle neu eingesetzten Bezirkssekretäre waren nicht nur durch die alten Bezirksleitungen gewählt worden. Ihrer Kandidatur lag jeweils die entsprechende Kaderentscheidung der nomenklaturführenden Instanz, des Politbüros, zugrunde. Alle hatten die notwendige Kaderlauf-bahn absolviert, hatten Parteihochschulen in Berlin oder Moskau absolviert und langjährige Karrieren innerhalb des Parteiapparates hinter sich. Allein die Ablösung Günter Schabowskis folgte nicht der Logik, einen für Krenz unsicheren Sekretär zu entsorgen, sondern den ins ZK-Sekretariat aufgestiege-nen Bezirkschef zu ersetzen. Interessant an diesem Vorgang ist, dass der nur wenige Tage im Amt befindliche Helmut Müller, bis dahin in der Berliner Bezirksleitung für Wirtschaftsfragen zuständig, nie offiziell in sein Amt eingeführt wurde, sondern nach wenigen Tagen selbst zurücktrat: Er war »de facto ›Erster Sekretär, denn ich hätte ja noch auf der BL-Tagung gewählt werden müssen. Ich war amtierend, hatte aber schon das Mandat des Politbüros. Auf der Bezirksleitungssitzung wäre ich gewählt worden.‹« – Niemann: Die Sekretäre, S. 352.
68 So, um nur ein Beispiel für die stereotype Rede zu zitieren, die Formulierung des Bezirkschefs von Erfurt, Gerhard Müller, auf dem 10. Plenum. In: Hertle; Stephan: Das Ende, S. 152.
88 SED im Untergang
fürsten auf den öffentlichen Diskussionen, den sogenannten Dialog-Veran-staltungen entgegenschlug und das der Herrschaft der SED insgesamt galt, richtete sich ganz folgerichtig gegen deren Exekutoren:
»Vielleicht haben wir nicht früh genug damit begonnen, auch in den Bezirken. Wir führen diesen Dialog. Aber man muss auch sagen, dasselbe, was Hans-Joachim Böhme sagt, was andere sagen können: Wir sind gegenwärtig auf diesen Kundgebungen, ob es 30 000 oder 50 000 anbetrifft, härtesten Anfeindungen – das sind keine Dialoge – ausge-setzt […] Dort ist, ich muss das mal sagen, kein Dialog möglich.«69
Krenz’ Vorschläge für das neue Politbüro erwiesen sich als Fehlschlag. Mehr noch: sie desavouierten ihn selbst und untergruben in der Konsequenz ihres Scheiterns das System der Nomenklatur. Die Personalentscheidungen entglit-ten der Zentrale und gingen zunächst an die Bezirksleitungen über. Eine Aus-weitung des Verfalls stand zu befürchten.
»Wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise den ganzen Forderungen nach Rücktritt der Parteifunktionäre auch Einhalt gebieten, werden wir innerhalb kurzer Zeit wenig nicht nur Bezirkssekretäre, sondern auch wenig Kreissekretäre haben.«70
Die Zentrale versuchte ihre Personalhoheit zumindest im Nachhinein durch offizielle Bestätigungen wieder deutlich zu machen,71 was aber keine praktische Bedeutung mehr gewinnen konnte.
Die Öffnung der Grenze am 9. November 1989 mit ihren absehbaren bzw. gerade mit ihren noch nicht abzuschätzenden Konsequenzen einerseits und die Konzeptlosigkeit der SED andererseits führten viele Nomenklaturkader in der Wirtschaft aber auch in Teilen des Staatsapparates dazu, sich nach einer neu verankerten Legitimation umzuschauen.72 Die SED verlor weiter an Glaub-würdigkeit gerade bei »den mittleren Kadern, die da nicht so recht mitspie-len«.73 Letztlich konnte das drei Tage währende 10. Plenum des Zentralkomi-tees die Stabilität der SED weder sichern noch erneuern, wie der gerade zum Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK aufgestiegene Hans-Joachim Willerding am Ende erklärte:
»Weil ich glaube, weder die Geschichte mit der Grenze noch die zweieinhalb Tage, die wir hier diskutieren, sind dazu angetan, nicht mal das Parteiaktiv um uns zusammenzu-schließen.«74
69 Ders., ebenda. 70 Ders., ebenda, S. 153. 71 Vgl. Niemann: Die Sekretäre, S. 358. 72 Vgl. Luft, Christa: Treuhandreport. Werden, Wachsen und Vergehen einer deutschen Be-
hörde. Berlin 2002, S. 18 f. 73 Siegfried Funke auf dem 11. Plenum des ZK, 13.11.1989. In: Hertle; Stephan: Das Ende der
SED, S. 446. 74 Hans-Joachim Willerding auf dem 10. Plenum des ZK, 10.11.1989. In: Ebenda, S. 432.
Bernd Florath 89
Da sich der Druck der Demonstranten zuerst an die Adresse der SED-Leitun-gen richtete, versuchten Funktionäre der staatlichen Exekutive die eigene Posi-tion zu behaupten, indem sie nun ebenfalls den Rücktritt der Parteisekretäre forderten.75 Staatsfunktionäre entdecken auch gegen die Partei, der sie zu diesem Zeitpunkt noch angehören, die Rechtslage als Richtlinie anstelle von Beschlüssen einer legitimationslosen Partei. Aus den aufgeblähten Parteiappa-raten abgeschmolzene Funktionäre entdeckten den Staatsapparat als neues Betätigungsfeld, in welchen sie die neue Losung des Nichthineinadministrie-rens durch die SED importierten und gegen den gerade verlassenen Arbeitge-ber richteten. Wirtschaftskapitäne traten in direkte Kontakte mit westdeut-schen Firmen und suchten nach Kooperationsmöglichkeiten.76 Damit vollzo-gen sie freilich Überlegungen, die auf der Spitzenebene der DDR-Wirtschafts-hierarchie klammheimlich bereits früher angestellt worden waren.77 Hierauf war in Wirtschaftskreisen der Bundesrepublik schon frühzeitig aufmerksam gemacht worden:
»So wenig bundesdeutsche Hilfsangebote die starrsinnige Führungsriege zum Einlenken bewegen können, so verfangen sie sich doch durchaus unter mittleren SED-Funktionären. Zunichte gemacht wird der Aufweichungseffekt nur dann, wenn die Offerten aus Bonn mit Wiedervereinigungsparolen überfrachtet werden.«78
Die SED, die ihre Position bislang garantierte, wird zum lästigen Übel, ja zum Hindernis. Mit zigtausenden sich verprellt fühlenden Arbeitern verlassen die Mitglieder sukzessive das sinkende Schiff. Später ist es die SED, die ihren Mitgliedern im Staatsapparat sogar empfiehlt, die Partei zu verlassen oder die Mitgliedschaft ruhen zu lassen, um die Legitimation der staatlichen Behörden nicht durch die Tatsache zu untergraben, dass deren Mitarbeiter SED-Mit-glieder sind und deren Disziplin unterständen.79
Das Misstrauen der Bevölkerung orientierte sich ironischerweise an densel-ben irrationalen Kriterien wie die nomenklaturführenden SED-Instanzen. Wen letztere für zuverlässig genug hielten, die Politik der SED zu exekutieren,
75 Vgl. Liebold, Cornelia: Machtwechsel vor Ort. Die SED und ihr Apparat in Leipzig vom
Oktober 1989 bis Mai 1990. In: Heydemann, Günther (Hg.): Revolution und Transformation in der DDR 1989/90. Berlin 1999 (Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung; 73), S. 450 f.
76 Der Ruf nach Wirtschaftreformen im Sinne der Unternehmensleitungen kam zu dieser Zeit mitten aus dem Parteikader. Vgl. die in dieser Hinsicht klare Stellungnahme Albert Jugels, bis zu diesem Zeitpunkt einer der Berater von Hans Modrow in Dresden in: SED-Opposition: »Krenz muß weg«. In: Wirtschaftswoche v. 24.11.1989.
77 Vgl. Schürer, Gerhard: Gewagt und verloren. Eine deutsche Biographie. Frankfurt/O. 1996, S. 246.
78 Herz, Wilfried; Thelen, Friedrich; Ziesemer, Bernd: »Revolutionäre Lage«. Nach der Massen-flucht eine Kette von Massendemonstrationen: Die DDR gerät in eine kritische Lage. Stürzt Hone-cker? DDR: Auch unter SED-Funktionären wird der Ruf nach Reformen immer lauter. In: Wirt-schaftswoche v. 13.10.1989.
79 Vgl. Liebold: Machtwechsel vor Ort, S. 460 f.
90 SED im Untergang
und daher in eine der Nomenklaturen aufnahmen, den traf nunmehr das öffentliche Misstrauen, obwohl niemand Struktur und Listen der Nomenkla-tur kannte. Es war das Vertrauen der SED-Führung, das einer Person den öffentlichen Kredit entzog, wie es umgekehrt das Misstrauen der SED war, das nicht unwesentlich öffentliches Ansehen stärkte. Zweifellos waren die charak-terlichen Defekte, die privaten Pfründe der kleinen Satrapen vor Ort weitaus bekannter als in der Zentrale. Hier rächte sich das »Prinzip der Kollektivität der Führung« in der SED, das ihre verantwortlichen Politiker hatte gesichtslos werden lassen. Andererseits waren es schon geringfügige Differenzen, Unter-schiede im Stil und in ihrem Hintergrund undurchschaubare Maßregelungen durch die Zentrale, die einen Funktionär wie Hans Modrow gleichsam zur Lichtgestalt stilisierten.
Auch in dieser Frage differierte das Verhalten der Bevölkerungsmehrheit nicht von dem der SED-Mitglieder. Erschüttert reagierten zu dieser Zeit vor allem jene, die der Partei in erster Linie aus tiefem Glauben an deren sozialre-volutionäre Mission anhingen: Die Konzeptionslosigkeit der Führung einer-seits und das Ausmaß der persönlichen Korruptheit und Bigotterie ihrer Re-präsentanten ließ Illusionen zusammenbrechen, deren emotionale Verwurze-lung durchaus bewegend war. Einen Abglanz dieses moralischen Zusammen-bruchs lässt der Aufschrei des Altkommunisten Bernhard Quandt auf der letzten Sitzung des ZK am 3. Dezember erahnen, der noch am 24. Oktober den Waffeneinsatz gegen Opponenten empfohlen hatte, nun aber seine be-stechliche und bestochene Führung am liebsten füsiliert gesehen hätte.80
»Man wird die roten Götter schleifen, Viele wer’n es nicht begreifen. […] Der Götzendiener pisst sich ein. Es könnte alles falsch gewesen sein.«81
Das ist für die ideologischen und parteipolitischen Nomenklaturkader in die-ser Art und Weise nicht möglich. Während sich auf den oberen und mittleren Ebenen ein Prozess der Selbstreinigung vollzieht, der einen Bezirkssekretär der SED nach dem anderen des Amtes enthebt, mit Parteiverfahren oder gar An-klagen überzieht, suchen Kader der zweiten Reihe Kontakt zu Wissenschaft-lern, von denen bekannt ist, dass sie seit Jahren an Reformkonzepten arbeiten.
Die Besonderheit ihrer Interessen bestand darin, dass sie nicht wie die Ka-der des Staatsapparates oder der Wirtschaft die Chance sahen, sich eine Zu-kunft außerhalb und unabhängig von der SED zu sichern. Aus unterschiedli-
80 Vgl. Bernhard Quandt auf dem 12. Plenum des ZK, 3.12.1989. In: Hertle; Stephan: Das
Ende der SED, S. 496. 81 Herbst in Peking (Rex Joswig): Bakschischrepublik. In: Sound of Revolution. Berlin 2009,
Booklet, S. 4.
Bernd Florath 91
chen Richtungen hatten sie nur die Chance, sich als politische Sprecher eines idealen kommunistischen Staates zu profilieren, sich von diesen tragen zu lassen.
Während sich der Abfall der Staats- und Wirtschaftskader – personifiziert in den zumindest versuchten Übertritten Heinz Warzechas und Wolfgang Berg-hofers zur SPD – um die Jahreswende vollzog, kam es zugleich zu einer Aus-differenzierung des Zweckbündnisses zwischen ideologischen und parteipoliti-schen Nachrückkadern.
Unter den Ideologieproduzenten, die zu einem nicht unwesentlichen Teil nicht im Parteiapparat, sondern an den Universitäten und Akademien der DDR ihre Heimat hatten, war ein relevantes Reformpotenzial entstanden, das die DDR ändern, aber in ihrer politischen Grundsubstanz dadurch auch erhal-ten wollte. Sie empfanden sich als konspirative Gegenelite, z. T. so konspirativ, dass sie auch an der Kooperation mit der konspirativen Institution per se Ge-fallen fanden. Ihre Konzepte zielten nichtsdestotrotz auf Änderungen, deren Konsequenzen eher nolens denn volens das kommunistische System konterka-riert hätten. Die Herrschaft des Rechts, wie sie zwar zurückhaltend formuliert, aber dennoch zentral in Überlegungen zum sozialistischen Rechtsstaat von Rosemarie Will dargelegt wurde, rüttelte an der Machtfrage, wie sie kommu-nistisch gelöst worden war. Der Rekurs einer Gesellschaftstheorie auf das wi-derstreitende Individuum, anstatt auf die Klasse, erzwingt Konsequenzen, die ebenfalls dem Wesen des kommunistischen Systems unverträglich sind. Re-form ist – und hier folge ich Karl Griewank – im Unterschied zur Revolution der Versuch, das System wieder in Form zu bringen.82 In eine neue Form, in die alte Form, in die ideale Form, in die ideale alte oder die noch nie dagewe-sene ideale neue, welche Form auch immer Reformern vorschwebte, es ging ihnen um die Form dieses Systems. Mehr zu erwarten und dann enttäuscht über die geringe Reichweite der Reform zu sein, überfordert das Ziel der Re-former.
Zum Teil wurde den SED-Reformern, die vereinzelt gar zur »SED-Reformbewegung« überhöht wurden, eine Position unter den die friedliche Revolution treibenden Kräften zugerechnet, die sie auf Augenhöhe mit »Bür-gerrechtsbewegung, Massendemonstrationen, Fluchtbewegung« sieht.83 Dies scheint indes nichts anderes zu sein als ein im Kern geisteswissenschaftlicher Irrtum. Aus der gedanklichen Differenz zwischen den Konzepten der Refor-mer und der hinter der Machtpraxis der SED-Führung vermuteten elitären »wissenschaftlichen Einsicht im Denksystem des Marxismus-Leninismus […],
82 Griewank, Karl: Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung. Weimar 1955, S. 30.
83 So z. B. Sabrow, Martin: Der Konkurs der Konsensdiktatur. Überlegungen zum inneren Zer-fall der DDR aus kulturgeschichtlicher Perspektive. In: Jarausch, Konrad H.; Sabrow, Martin (Hg.): Weg in den Untergang. Der innere Zerfall der DDR. Göttingen 1999, S. 88.
92 SED im Untergang
die der Arbeiterschaft in ihrer großen Mehrheit und selbst der Masse der Or-ganisationsmitglieder verwehrt war«,84 wurde eine politische Differenz vermu-tet, die zwingend hervortreten würde. Tatsächlich legitimierte sich die SED-Führung zwar mit der Behauptung, »dass sie ›historischen Gesetzen‹ zum Durchbruch verhelfe«, in Wahrheit war sie Vollstrecker einer gedankenlosen Praxis, die sich jedes Denkmodells bediente, solange das der Sicherung ihrer Macht diente.85 Erst der Sturz dieser Macht der Nomenklatura konnte auch sozialistischen Reformüberlegungen einen revolutionären Impuls verleihen – vorausgesetzt, die ihnen zugrunde liegende historische Illusion, das »aus Lenin-schem Geist […] von Stalin geschweißte« kommunistische Herrschaftssystem sei durch Re-Formation auf einen ihm innewohnenden emanzipatorischen, im Marxschen Sinne sozialistischen Kern zurückführbar, war noch nicht an den Realitäten zerbrochen. Unbeschadet dieser wohl nur im Sinne von Glaubens-fragen zu beantwortenden Frage, kann die konkrete Stellung der SED-Reformer in der Friedlichen Revolution nur beschrieben werden, indem weni-ger nach der theoretischen Substanz ihrer Konzepte, denn nach der prakti-schen, politischen Aktivität seiner Träger in der Revolution geforscht wird. Bis dahin blieb ihre Wirkung abhängig von der Reaktion der Rezipienten, die diese Theorien sowohl zur Stabilisierung und Modernisierung des bestehenden Systems adaptieren konnten oder aber zur Unterminierung der Herrschaftsge-wissheit seiner Träger. Beide Wirkungsmöglichkeiten waren zu verzeichnen. Sie waren allerdings ebenso unabhängig von der Substanz der Konzepte wie von der Intention ihrer Schöpfer.
Deren Handeln war zwiespältig: Persönliche Querverbindungen einzelner Akteure in Oppositionskreise hinein waren nicht selten, doch blieben sie ein individuelles Phänomen. Kennzeichnend blieb eher eine auf Fremdheit und Argwohn beruhende Distanz.86 Selbst dort, wo Analysen und gewünschte Perspektiven nicht weit voneinander entfernt lagen, blieben kulturelle und mentale Gräben, die zu vertiefen nicht zuletzt das Ministerium für Staatssi-cherheit intensive und vielgestaltige Anstrengungen unternahm.87
84 Süß, Walter: Der Untergang der Staatspartei. In: Henke, Klaus-Dietmar (Hg.): Revolution
und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Phantasie die Realität überholte. München 2009, S. 284.
85 »Die Macht ist das Allererste, die wichtigste Seite, um den historischen Auftrag der Arbeiter-klasse zu erfüllen, die kommunistische Gesellschaft zu errichten«. – Erich Mielke auf der zentralen Dienstkonferenz des MfS, 6.7.1979, zit. nach: Vollnhals, Clemens: »Die Macht ist das Allererste.« Staatssicherheit und Justiz in der Ära Honecker. In: Engelmann, Roger; Vollnhals, Clemens (Hg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft. Rechtspraxis und Staatssicherheit in der DDR. Berlin 1999 (Analysen und Dokumente; 16), S. 227.
86 Vgl. Land, Rainer; Possekel, Ralf: Fremde Welten. Die gegensätzliche Deutung der DDR durch SED-Reformer und Bürgerbewegung in den 80er Jahren. Berlin 1998, S. 107–114.
87 Vgl. Uschner, Manfred: Die zweite Etage. Funktionsweise des Machtpparates. Berlin 1993, S. 138 f.
Bernd Florath 93
Die erste Voraussetzung eines politischen Eingreifens der Reformer in die Auseinandersetzungen wäre gewesen, dass sie die Differenz zur eigenen Partei-führung öffentlich sichtbar gemacht hätten. Zaghafte Ansätze innerhalb ein-zelner Basisorganisationen88 verließen indes bis zum Ablauf des Oktober 1989 nicht deren Rahmen. Die theoretische Diskussion verblieb im Raum derer, die diskutierten, was ihnen in etwa jenen Rang zuweist, der Debatten in Arbeits-pausen oder an Kneipentischen zukommt: Sie waren Indikatoren und Fermen-te der Stimmungslage, sie konnten Akteure hervorbringen, doch mussten sich diese hierfür vom Tisch erheben.
Ich will mich im Folgenden auf eine Skizze von Spannungen und Schran-ken der Vorgänge in Berlin beschränken, die indes für die überzentralisierte SED zugleich von entscheidender Bedeutung sind, da sie direkt auf die Partei-führung und deren Apparat zielten.
Der vorerst eingeschlagene Weg der Reformideologen verharrte noch auf jenen Pfaden, die ohne Verlust der eigenen Position beschreitbar erschienen: es wurde versucht, »prominente ZK-Mitglieder dafür zu gewinnen«.89 Kontakte zu Personen aus der SED-Führung, denen zumindest punktuell eigenständiges politisches Denken zugeschrieben wurde, sollten die Reformkonzepte als neue SED-Politik durchsetzen helfen: Hermann Kant, Manfred Wekwerth,90 Mar-kus Wolf,91 Günter Schabowski,92 Hans Modrow.93
Die Kontakte, vermittelt durch Dieter Klein, Prorektor für Gesellschafts-wissenschaften der Humboldt-Universität und seit Jahren Mentor und Schirmherr eines wissenschaftlichen Projektzusammenhanges zur Konzipie-rung eines »modernen Sozialismus«,94 der als Mitglieder der Berliner Bezirkslei-tung der SED Zugang zum Zentrum der Macht organisieren konnte, verliefen letztendlich politisch ergebnislos. Zwar wurden Passagen der Ausarbeitungen
88 So berichtet Dieter Segert von einem Antrag André Türpes auf einer Versammlung der SED-Grundorganisation der Philosophen der Humboldt-Universität vom 9.10.1989, »gemäß Statut Abschnitt IV/34 die Einberufung eines außerordentlichen Parteitages in zweimonatiger Frist zu beantragen«. Der Antrag wurde mit 34 gegen 19 Stimmen angenommen, aber außerhalb dieses Rahmens nirgendwo bekannt. – Segert, Dieter: Das 41. Jahr. Eine andere Geschichte der DDR. Wien, Köln, Weimar 2008, S. 87.
89 Land; Possekel: Fremde Welten, S. 101. 90 So André Brie in: Ebenda. 91 Vgl. Segert: Das 41. Jahr, S. 117 f. 92 Vgl. ebenda, S. 90 f. 93 Vgl. ebenda, S. 98. 94 Vgl. Land, Rainer: Vorwort. In: Ders. u. a.: Studie. Überlegungen zu Problemen und Per-
spektiven des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels des Sozialismus und der Weiterentwick-lung gesellschaftsstrategischer Konzeptionen in der DDR und anderen Staaten des RGW. 2. Fassung November 1989 (1. Fassung Juli 1989), Internes Arbeitsmaterial. Akademie der Wissenschaften der DDR. Wissenschaftliches Informationszentrum. Berlin 1989, S. 4–8. Die Studie ist wenig später unter weniger barocken Titeln auch mehrfach im Buchhandel erschienen: Brie, Michael u. a.: Studie zur Gesellschaftsstrategie. Berlin 1989; Dies.: Grundzüge eines modernen Sozialismus. Berlin 1990; Land, Rainer (Hg.): Das Umbaupapier (DDR). Argumente gegen die Wiedervereinigung. Berlin 1990.
94 SED im Untergang
in offizielle Papiere der SED übernommen (so in das vom 10. Plenum berate-ne »Aktionsprogramm« oder in die Regierungserklärung von Hans Modrow), doch wurden sie auf diese Weise zugleich in die Anstrengungen der alten Eli-ten integriert, ihre Macht zu rationalisieren und zu erhalten. Mithin dienten sie zur Re-Formation des alten Systems. Sollten die Reformüberlegungen zur Re-Formation dessen, was als (moderner) Sozialismus gedacht war und der sich zum bestehenden nur als dessen revolutionäre Überwindung bewähren konnte, dienen, durften sie nicht auf die Rationalisierung der alten Herrschaft, sondern auf deren Sturz zielen.
Wo die Substanz der Papiere selbst über die freilich erkannte Bereitschaft der Herrschenden zur Kurskorrektur hinausging, blieb sie ohnehin außen vor. Als Dieter Klein im Verbund mit Hans Albrecht, dem neuen Berliner SED-Bezirkschef, dem Philosophen Alfred Kosing, dem Ökonomen Wolfgang Krause, dem Soziologen Rolf Reißig und der Juristin Rosemarie Will dem Generalsekretär Egon Krenz einen alternativen Entwurf für dessen politischen Bericht an das 10. Plenum vorlegte, ignorierte Krenz diesen.95 Immerhin war das die unmissverständliche Aussage, dass Krenz selbst mit der Rationalisie-rung des alten Regimes intellektuell überfordert war. Doch auch dieses zu-rückhaltend formulierte Papier gewann eine eigenständige politische Wirkung erst, als es als »Standpunkt der Berliner SED-Organisation« nach dem ZK-Plenum mit dem greifbaren Impuls der Kritik an den Resultaten des Plenums in der Presse veröffentlicht wurde.96
Zum Akteur wurde die Gruppe von SED-Reformern, als sie auf die Straße ging und ihre Position gegen die Parteispitze formulierte. Bereits am Abend des ersten Tages des 10. Plenums versammelte sich eine beachtliche Zahl von SED-Mitgliedern vor dem ZK-Gebäude. Es war dies wohl die erste von Par-teimitgliedern in eigener Verantwortung organisierte Demonstration.97
Aufgerufen hatte die Grundorganisation des Zentrums für wissenschaftli-chen Gerätebau der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof. Dessen Ende Oktober erst neu gewählter SED-Sekretär Christian Rempel erklärte, er sei auf die Idee zu einer Demonstration von SED-Mitgliedern nach seiner Teilnahme an der Protestdemonstration auf dem Alexanderplatz am 4. No-vember gekommen. Er war enttäuscht über die fortdauernde Sprachlosigkeit der Parteiführung:
95 Vgl. Hertle; Stephan: Die letzten Tage des Zentralkomitees der SED. Einführung und histo-
rischer Rückblick. In: Dies.: Das Ende der SED, S. 67, Fn. 115. 96 Vgl. Was erwarten wir von der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED? In: Berliner Zei-
tung v. 9.11.1989. Vgl. Schabowski: Politbüro, S. 140; Ders.: Der Absturz. Berlin 1991, S. 319 f. 97 Vgl. Demonstration von Berliner Genossen vor dem Haus des ZK. Forderungen an die ZK-
Tagung und Bekenntnisse zur Erneuerung. In: Neues Deutschland v. 9.11.1989, S. 1.
Bernd Florath 95
»Wir gingen bei unserem Aufruf davon aus (ausgehend von der gegenwärtigen Konzepti-onslosigkeit im Politbüro), von der Parteibasis aus konstruktiv zu handeln. Das heißt, alle Genossen, sowohl Intellektuelle als auch Arbeiter, zu erreichen.«98
Sie protestieren gegen die durchsichtigen Personalrochaden und forderten die sofortige Einberufung eines außerordentlichen Parteitages, weil nur ein Partei-tag satzungsgemäß ein neues Zentralkomitee wählen durfte. Die vom Plenum beschlossene Einberufung einer Parteikonferenz, die das alte ZK in seiner Substanz nicht infrage stellte, sondern lediglich über taktische und strategische Fragen debattieren und entscheiden konnte, wurde vehement abgelehnt.
Aufgeschreckt durch die Eigeninitiative versuchten die zuständigen SED-Leitungskader die Aktion zu kanalisieren:
»Nach Beratung zwischen H. Klemm u. H. Müller,99 BL Berlin, beschlossen die Sekretä-re der KL der AdW, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Im gleichen Sinne rea-gierte die KL der Humboldt-Universität, die auf unterer Ebene von Rempel einbezogen wurde. […] Rempel, der am gleichen Tage eine zweite Einladung des 1. Sekr[etärs] H. Klemm ignoriert hatte […], habe am 7.11.[1989] 50 Delegierte zu Großbetrieben ausge-sandt, um mit den Leitungen die Teilnahme zu verabreden. Zusagen seien von Funk-werk Köp[enick], Steremat u[nd] KWO eingegangen. Rempel umgeht bewusst die gewählten Funktionäre der Kreisleitung der AdW u[nd] propagiert die Basisaktion.«100
Auf der Demonstration kam es zum direkten Zusammenstoß zwischen Köpfen der Reformgruppen und Vertretern des Apparates.101 Aus dem Gebäude des ZK auf den Platz strömende Kader konnten Michael Brie daran hindern, seine Rede zu Ende zu führen.102 Dennoch war es dem Apparat erstmals nicht ge-lungen, die Kontrolle wenigstens noch der eigenen Mitgliedschaft auszuüben.
Unter Aufbietung der noch immer verfügbaren Logistik gelang es der SED-Führung allerdings noch einmal, wenigstens in den von den Fernsehkameras erfassbaren vorderen Reihen, einer zwei Tage später einberufenen Kundgebung im Lustgarten den Anschein der Unterstützung der Krenz’schen Führung durch die SED-Mitglieder zu erwecken. Während man am Abend des 10. November Egon Krenz zujubelnde Genossen in den Nachrichten sehen konn-te, blieb die von der Mehrheit der Kundgebungsteilnehmer erhobene Forde-rung nach einem Parteitag ausgeblendet. Die Inszenierung vermochte den innerparteilichen Druck nicht mehr zu mindern. Die Reaktionen der Parteior-
98 HA XVIII: Information. Angaben des bisherigen Sekretärs der Grundorganisation der SED
des Zentrums für wissenschaftlichen Gerätebau der Akademie der Wissenschaften der DDR, 8.11.1989; BStU, MfS, HA XVIII, Nr. 14523, Bl. 1.
99 Horst Klemm, 1. Sekretär der SED-Kreisleitung der Akademie der Wissenschaften; Helmut Müller, zu diesem Zeitpunkt amtierender 1. Sekretär der SED-BL Berlin.
100 Information, o. D. [ca. 8.11.1989]; BStU, MfS, HA XVIII, Nr. 14523, Bl. 4. 101 Vgl. Uschner, Manfred: Die zweite Etage. Funktionsweise eines Machtapparates. Berlin
1993, S. 149. 102 Vgl. Segert: Das 41. Jahr, S. 98.
96 SED im Untergang
ganisationen in den Bezirken unterstützten, was vor dem ZK-Gebäude gefor-dert worden war massiv. Schon am folgenden Montag musste das ZK auf dem hastig einberufenen 11. Plenum den zuvor abgelehnten außerordentlichen Parteitag für Dezember anberaumen.
Die Organisation des Parteitages freilich wollte der Apparat fest unter Kon-trolle halten. Doch schon der Zeitdruck, aber auch der Unwillen der SED-Basis erzwang ein neues Wahlverfahren: Die Delegierten zum Parteitag wur-den von den Kreisdelegiertenkonferenzen bzw. großen Grundorganisationen direkt mandatiert. Keine Bezirksdelegiertenkonferenz konnte als zweiter Filter auf dieser Ebene im Interesse der kaderführenden Apparate aus Bezirksdele-gierten aussondern. Und schließlich war das ZK auch nicht mehr in der Lage, in einer Wahldirektive die zu wählenden Delegierten auf eine bestimmte poli-tische Aussage bereits im Vorfeld festzulegen.
Zugleich sollte aber auch keine Neuwahl der nachgeordneten Leitungen stattfinden, sondern nur die der Delegierten für den Parteitag. Es galt – so war offenbar die Absicht – einen Parteitag zuwege zu bringen, der der SED eine neue innere Legitimität verleihen, dabei aber das Gerippe der Machtmaschine, den Apparat nicht demontieren, sondern ihm gleichermaßen von oben neues Leben einhauchen würde. Indes erwies sich die Lage in den Kreisen und Be-trieben als zu marode. Die Mitglieder rannten der Partei davon. Im Bezirk Suhl hatte sie bis Ende November 1989 15 Prozent ihrer Mitglieder verloren:
»Als Gründe dafür nannte Peter Pechauf den Vertrauensverlust bei vielen aufrechten, stets mit ganzem persönlichem Einsatz engagierten Genossen. Gerade sie fühlten sich durch das Handeln von Honecker, Mittag, Albrecht und anderen, die nicht die Partei darstellen, betrogen. Nicht zuletzt dadurch befänden sich viele Grundorganisationen in einem desolaten Kaderzustand, seien Sekretäre und Leitungen zurückgetreten.«103
Die nunmehr stattfindenden Kreisdelegiertenkonferenzen wählten nicht nur die Parteitagsdelegierten, sondern zugleich neue Kreisleitungen, für die das System der Nomenklatur nicht mehr angewandt werden konnte.
Das Nomenklatursystem sorgte dafür, dass jede Machtposition in SED und DDR von einer präzise definierten Leitungsebene der SED personell besetzt wurde. Wahlen hatten diese Entscheidung lediglich zu bestätigen. Dass auch die Besetzung von Positionen in Wirtschaft und Verwaltung direkt oder indi-rekt von der SED bestimmt wurde, muss hier nicht extra erwähnt werden. Es waren von diesem Prinzip auch die Blockparteien und Massenorganisationen nicht ausgenommen, die das Prinzip intern jeweils reproduzierten.
Die neu gewählten Delegierten und Kreisleitungsmitglieder unterschieden sich von den neuen Spitzenfunktionären in den Bezirksleitungen vor allem
103 Statt Arbeiterpartei eine Partei der Werktätigen. Überlegungen im Bezirk Suhl. In: Neues
Deutschland v. 1.12.1989, S. 3.
Bernd Florath 97
durch diese Änderung. Viele neue, junge Gesichter tauchten auf. Sie waren ungeübt in diesen Funktionen, häufig politisch hochgradig naiv, zweifelsohne durch eine mehr oder minder lange Mitgliedschaft in der SED politisch ge-prägt, aber doch in viel höherem Grade bereit zu Entscheidungen, die aus dem Gleis bisheriger SED-Politik ausbrachen. Ihr Interesse war nicht der Erhalt der Position des Apparats. Die Machtstellung der SED vor allem in den Betrieben war rapide am Schwinden, die neuen Parteisekretäre wurden nicht mehr in die Leitungsentscheidungen einbezogen.
Doch der fehlende Disziplinierungsdruck von oben allein reichte nicht hin. Noch unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse konstatierte ein an der Basisbewegung maßgeblich Beteiligter 1990:
»Nur hier und da hatte man sich eigene Gedanken gemacht; die meisten warteten weiter auf Vorgaben von oben. Wenn sie in diesen Tagen zornig wurden, so nur deswegen, weil die Anleitung von oben so gründlich danebenging. […] Diese Partei suchte selbst im Sterben noch ihre Götter, die Schöpfer einer heilen Welt. Die Partei war somit doppelt gelähmt – an der Spitze und an der Basis.«104
Mit den schwächelnden Grundorganisationen, der Delegitimierung der einst mächtigen Parteisekretäre, hörte die SED auf, Kontrollorgan der Betriebslei-tungen zu sein. Die Betriebsleiter verließen die SED. Sie folgten eigenen Inte-ressen, suchten Verbündete außerhalb der alten Machtstrukturen.105
Indes kämpfte der Apparat um sein Überleben. Hinhaltend suchte er die in Fluss geratene Entwicklung auszumanövrieren.106 Das Konsultationszentrum im Zentralkomitee sollte den Unmut der Mitglieder sowohl auffangen und kanalisieren, als auch alle irgendwie nützlichen Ideen abschöpfen und für den Überlebenskampf der alten Eliten verwendbar machen. Dem setzten die Re-former an der Humboldt-Universität eine eigene Konsultationsstelle entge-gen.107 Am 20. November mahnten sie, nur solche SED-Mitglieder als Partei-
104 Thomas Falkner in: Gysi, Gregor; Falkner, Thomas: Sturm aufs Große Haus. Der Untergang der SED. Berlin 1990, S. 55.
105 Vgl. Stabilisierung der Volkswirtschaft und nächste Schritte der Wirtschaftsreform. Beiträge zur Wirtschaftsreform. Arbeitsberatung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik mit den Generaldirektoren der zentralgeleiteten Kombinate und Außenhandelsbetriebe sowie den Vorsit-zenden der Bezirkswirtschaftsräte und den Bezirksbaudirektoren am 9.12.1989. Berlin 1989; Edeling, Thomas: Entstaatlichung und Entbürokratisierung. Strategien und Resultate der Reorganisation ostdeutscher Betriebe. In: Heidenreich, Martin (Hg.): Krisen, Kader, Kombinate. Kontinuitäten und Wandel in ostdeutschen Betrieben. Berlin 1992, S. 49; Neuaufbau der Wirtschaft nicht ohne alte SED-Manager. In: Süddeutsche Zeitung v. 20.11.1990; Oldag, Andreas: Wenn aus Bonzen Manager werden. Am Beispiel eines Betriebes in der früheren DDR zeigt sich, welche Macht ehemalige Partei-genossen wieder ausüben. In: Frankfurter Rundschau v. 19.11.1990.
106 Vgl. Werner Hübner in: Gysi; Falkner: Sturm, S. 49: »Und dem hauptamtlich bei der SED Angestellten ging es natürlich um seine nackte Existenz.«
107 Erst Tage nach der Gründung dieses Informationszentrums informiert auch das Neue Deutschland über seine Existenz: Informationszentrum an der Uni. In: Neues Deutschland v. 28.11.1989, S. 8.
98 SED im Untergang
tagsdelegierte zu wählen, die »mit Entschiedenheit für die Erneuerung des Sozialismus eintreten«. »Wählt Delegierte, die sich für die radikale Neuformie-rung unserer Partei von der Basis bis zum Generalsekretär verbürgen.«108
Bereits am 4. November hatte die SED-Betriebsparteiorganisation des Werks für Fernsehelektronik in Berlin (WF) die Erneuerung der Partei analog zur Umgestaltung der Gesellschaft gefordert.109 Im Laufe des Monats nahm die neue SED-Leitung des Betriebes110 Kontakte zu den Reformgruppen an der Humboldt-Universität und der Parteiakademie auf. Nachdem sich die Re-formgruppe der Humboldt-Universität der Vereinnahmungsstrategie von Egon Krenz am 27. November verweigert hatte,111 forderten sie in ihrer Ant-wort statt dessen, die Wahlen zum Parteitag nach verschiedenen politischen Plattformen durchzuführen.112
Am 28. November lud die SED-Organisation des WF zu einem Treffen ein, das betriebliche Basisaktivisten der SED in Berlin und Reformer zusam-menführen sollte. Die am 30. November 1989 durchgeführte Versammlung gipfelte nach heftigen und erschöpfenden Debatten in der Verabschiedung eines Papiers, das die Gründung einer Plattform innerhalb der SED bekannt gab:
»Mit dem bevorstehenden außerordentlichen Parteitag muss die Parteibasis der SED ihre Partei zurückerobern. Wir haben diesen Sonderparteitag gegen die Führung der Wende-politiker erzwingen müssen. […] Wir haben ihn erzwungen, weil die Partei in ihrer jetzigen Verfassung zu einer Gefahr für unser sozialistisches Vaterland geworden ist. […] Der Parteiführung und dem sie stützenden Apparat entziehen wir das Vertrauen, die jetzige Regierung stützen wir. Die Rettung der Partei liegt in ihrer kompromisslosen Erneuerung, die einer faktischen Neugründung gleich käme.«113
Die Bildung einer Plattform selbst ist bereits der Bruch mit einem zentralen Prinzip der kommunistischen Partei: sie löst den monolithischen Charakter der Partei auf und sortiert die Mitglieder nach politisch nachvollziehbaren und
108 Delegierte zum Parteitag sorgfältig wählen. Appell der Kreisleitung der Humboldt-
Universität Berlin. In: Neues Deutschland v. 20.11.1989, S. 3. 109 Vgl. Falkner in: Gysi; Falkner: Sturm, S. 53; Schabowski: Politbüro, S. 134. 110 Es ist bemerkenswert, dass diese Initiative, die von der neuen SED-Parteileitung in dem
Großbetrieb vorangetrieben wurde, innerhalb der Belegschaft kaum auf Resonanz stieß. Während sich also die neue Parteileitung den Kopf über die Neukonstituierung einer sozialistischen Partei zerbrach, suchten parteilose Aktivisten innerhalb der Belegschaft nach neuen Wegen der unmittelbaren Interes-senvertretung, diskutierten über die Bildung von Gewerkschaften. – Vgl. Gehrke, Bernd; Hürtgen, Renate (Hg.): Der betriebliche Aufbruch im Herbst 1989: Die unbekannte Seite der DDR-Revolution. Diskussion – Analysen – Dokumente. Berlin 2001, S. 65 f. u. 70.
111 Krenz hatte sie zu einem Gespräch über die aktuelle politische Situation eingeladen. Diese Ein-ladung wurde abglehnt. – Vgl. Segert: Das 41. Jahr, S. 100.
112 Vgl. ebenda, S. 101. 113 Vgl. ebenda, S. 101 f.; Gysi; Falkner: Sturm, S. 58–71; Text der Plattform, S. 62 f., zuerst in:
WF-Sender, 1.12.1989.
Bernd Florath 99
debattierten Inhalten. Es gelingt nicht nur in Berlin, dass sich ganze Kreisor-ganisationen der WF-Plattform anschließen. Die faktische Neugründung ist der entscheidende Punkt. Er setzt den in der Plattform auch explizit festgestell-ten Entzug des Vertrauens zur bestehenden Führung voraus. Zugleich zeigt der in der Plattformgründung hervortretende Rekurs auf Kostüme der bolschewis-tischen Parteigeschichte die Befangenheit selbst der kühnsten innerparteilichen SED-Aktivisten in den Denkschemata des Kommunismus.114
Das Krenz’sche Politbüro begreift den Aufruf der WF-Plattform vollkom-men zutreffend als Kampfansage. Nach wenigen Stunden, die der Text über den Rundfunk verbreitet werden konnte, unterbindet Heinz Albrecht mit einem Anruf im Funkhaus dessen weitere Verbreitung.115 Während der Aufruf »Für unser Land« durch alle Zeitungen116 rasch in Umlauf kam, gelang es, die Veröffentlichung der WF-Plattform in den Zeitungen der DDR zu verzögern. Krenz sah die WF-Plattform als Bedrohung einer Einheit der Partei, die inhalt-lich er zu bestimmen versuchte. In einem Rundschreiben warnte er die Kreis-sekretäre der SED vor der Initiative und ließ die Veröffentlichung der Platt-form verhindern.117 In traditioneller Manier polemisiert in der Wochenend-ausgabe des Neuen Deutschlands ein Parteiveteran gegen die Positionen der Reformer, die dieselbe Zeitung dem Publikum verschweigt. Und indem der Autor die Einheit der Partei beschwor, ohne im Geringsten nach dem politi-schen Inhalt dieser Einheit zu fragen, schob er in denunziatorischer Manier die Frage an die Verfasser der WF-Plattform wie analoger Vorstöße in Leipzig nach: »Wer hat sie dazu eigentlich legitimiert?«118
Am Wochenende des 2. und 3. Dezember fanden die letzten Kreisdelegier-tenkonferenzen statt. Am 3. Dezember eröffnete Egon Krenz auch ein neues ZK-Plenum. Das hätte traditionell die Aufgabe gehabt, den Bericht des ZK an den Parteitag und den Entwurf der neuen Strategie auszuarbeiten. Schon am Samstag, dem 2. Dezember versammelten sich SED-Mitglieder der Hum-boldt-Universität, die gerade ihre Delegierten für den Parteitag gewählt hatten, vor dem ZK-Gebäude und forderten das ZK auf, zurückzutreten. Für den Nachmittag des 3. Dezember rief die SED-Kreisorganisation der Akademie der Wissenschaften der DDR, die in der Nacht zuvor getagt hatte, ebenfalls zu einer solchen Demonstration auf.
114 Nicht nur Dieter Segert und Michael Brie hatten ihre Reformkonzepte historisch an den
Mustern der Debatten des X. Parteitages der KPdSU erarbeitet. – Vgl. Segert: Das 41. Jahr, S. 54 f. 115 Vgl. Falkner in: Gysi; Falkner: Sturm, S. 66. 116 So auch im Neuen Deutschland v. 29.11.1989, S. 2. 117 Vgl. Krenz: Herbst, S. 338; vgl. Richter, Michael: Die friedliche Revolution. Aufbruch zur
Demokratie in Sachsen 1989/90. Göttingen 2009, S. 926 f. Tatsächlich wird sie im Zentralorgan Neues Deutschland nie gedruckt.
118 Läßt sich durch Neugründung der Partei Vertrauen zurückgewinnen? Gedanken von Prof. Heinz Lüdemann, seit 1946 Genosse. In: Neues Deutschland v. 2./3.12.1989, S. 5.
100 SED im Untergang
Hier – und ich kann und will an dieser Stelle nochmals meine Zeitzeugen-schaft einfließen lassen – wurde nicht allein die Forderung nach dem Rücktritt des ZK wiederholt. Es galt, die Macht des Apparats, der ja auch ohne das zusammengerufene ZK funktionierte, zu brechen. Die neu gewählte Über-gangsleitung der SED-Kreisorganisation hatte noch in der Nacht die Büros ihrer Vorgänger besetzt, um, ganz wie es die Bürgerinnen und Bürger im Lan-de an diesem Wochenende mit Dienststellen des MfS taten, die Vernichtung von Akten zu verhindern.
Ebenfalls an diesem Sonntag fand eine die ganze DDR überspannende Menschenkette statt, die für die friedliche Lösung der sich zuspitzenden Kon-flikte demonstrierte. Eine öffentliche Diskussion, die die Berliner Künstler-Initiative des 4. November im Friedrichstadtpalast am Vormittag des 3. Dezember organisiert hatte, führte Sprecher verschiedener Bürgerbewegun-gen, aber auch Antje Vollmer von den Grünen der Bundesrepublik oder Spre-cher der SED-Reformgruppen (Rosi Will) zusammen. Die Flucht Alexander Schalck-Golodkowskis erhitzte die Debatte über die Verantwortung der SED, doch konnte der Aufruf der SED-Kreisorganisation der AdW, sich an der Demonstration zu beteiligen, die den Sturz des ZK zum Zweck hatte, die Anwesenden überzeugen. In dieser Frage verschwand die Differenz zwischen dem Volk und dem Parteivolk. Letzteres konnte politisch in einem demokra-tisch verfassten Gemeinwesen nur agieren, wenn es die Selbstbestimmung innerhalb der eigenen Partei errang und das Machtmonopol der eigenen Partei beseitigte. Die Annäherung der Demonstranten an das ZK-Gebäude kündigte keinen Freundschaftsbesuch an. Die Herbstrevolution, so wurde in den dort gehaltenen Reden ausgeführt, bliebe solange unvollendet, wie die Macht der SED nicht gebrochen ist.
Zur selben Zeit hatten die neuen Mitglieder der Kreisleitung der Akademie begonnen, SED-Kreisorganisationen in der DDR zu kontaktieren, um die bereits gewählten Delegierten des Parteitages sofort nach Berlin einzuladen. Diese Delegierten sollten – da sie nach dem Rücktritt des ZK nun auch sat-zungsgemäß die einzigen legitimierten Vertreter der SED waren, unmittelbar als Parteitag zusammentreten. Sie sollten das in eigener Regie organisieren, um die Verfahrenshoheit nicht dem immer noch aktiven Apparat im benachbarten Hause des Zentralkomitees zu überlassen.
Eine beträchtliche Anzahl von Delegierten fand sich am Abend des 3. Dezember im Leibniz-Saal der Akademie ein, während zur gleichen Zeit der vom scheidenden ZK zusammengesetzte und installierte Arbeitsausschuss seine Arbeit aufgenommen hatte.
Dessen Entstehen und Zusammensetzung spiegelte den Stand der politi-schen Entwicklung des vergangenen Monats: Die 15 neuen SED-Bezirks-sekretäre, die ausnahmslos der alten Nomenklatur angehörten – auch wenn sie, aus der zweiten Reihe hervortretend, nicht oder weniger Verantwortung für
Bernd Florath 101
das alte Regime zu tragen schienen. Ergänzt wurde der Arbeitsausschuss durch eine Reihe in einem undurchsichtigen Verfahren kooptierter Kader, die ohne jegliches Mandat vom alten Apparat ausgewählt worden waren.119
Der Arbeitsausschuss war das Mittel des alten Apparats, die eigene Fortexis-tenz durch eine Gruppe relativ unverbrauchter Gesichter zu garantieren. Der einzige Vertreter im Arbeitsausschuss aus den Kreisen, die einen radikalen Bruch mit der alten Apparatepartei anstrebten, der WF-Parteisekretär Andreas Thun, wurde erst nachträglich hinzugerufen und zugleich von allen Verbin-dungen zu den Gruppen abgeschnitten, aus denen er stammte.
Durch Reformkräfte, Mitglieder der WF-Plattform, der Kreisorganisation der Akademie der Wissenschaften und der Humboldt-Universität angebotene Hilfe für den Arbeitsausschuss, um diesen von den Mitarbeitern des ZK unab-hängig zu machen, wurde abgelehnt.120 Hinter der logistischen Bequemlichkeit – so konnte Gregor Gysi auf die ihm vertrauten Mitarbeiter der Abteilung Staat und Recht des ZK zurückgreifen –121 steckte das klare politische Kalkül, die Fäden in der Hand zu behalten und sie nicht in die Hände von für den Apparat unberechenbaren Außenseitern fallen zu lassen.
Zwar unterblieb eine offene politische Attacke auf WF und AdW. Sie hätte das politische Kalkül sichtbar werden lassen. Es blieb versteckt hinter der Trägheit, dem organisatorischen Pragmatismus auch der neu gewählten Dele-gierten, die sich bereits am 3. Dezember auf Einladung der Kreisorganisation der Akademie in deren Leibniz-Saal versammelt hatten. Als ihnen im Namen des Arbeitsausschusses Markus Wolf entgegentrat und die Gemüter mit dem Argument beruhigte, dass der Arbeitsausschuss genau im Sinne der Delegierten operiere, die Lage und vor allem die Ressourcen der SED kontrolliere und für diese Zwecke einsetze, offenbarte sich die tief verwurzelte Hörigkeit der Mehr-heit der Delegierten. Anstatt ihre Legitimation zu nutzen, überließen sie einer vermeintlichen Parteiobrigkeit die Regie. Die Vertreter der aufständischen Parteibasis unterwarfen sich willig der neuen Führung. Während im Land die Revolution zur Besetzung und Auflösung des am meisten verhassten Repressi-onsinstruments schritt, kapitulierten die Genossen vor der eigenen Courage.
Der Arbeitsausschuss verweigerte jede Zusammenarbeit mit der WF-Plattform, mit den neuen Delegierten, mit den SED-Mitgliedern, die die Demonstrationen organisiert hatten. Die Türen des Grauen Hauses blieben verschlossen und wurden noch bis zum 5. Dezember – bis zur Besetzung der
119 Vgl. zur Genesis und Zusammensetzung des Arbeitsausschusses Booß, Christian: Der Son-
derparteitag der SED im Dezember 1989. In: DA 42(2009)6, S. 997 f. 120 Falkner in: Gysi; Falkner: Sturm, S. 70 f.; Segert: Das 41. Jahr, S. 27–33; vgl. Ballaschk, Wil-
fried: Nur eine Farce? Ein Besuch im Zentralkomitee der SED, Manuskript, 4.12.1989 [Archiv d. Verf.]; Chronik der Arbeit des Arbeitspräsidiums der Kreisdelegiertenkonferenz der SED-Kreisorganisation Akademie der Wissenschaften, 3.12.1989; ebenda.
121 Vgl. Booß: Der Sonderparteitag der SED, S. 998; Uschner: Die zweite Etage, S. 151.
102 SED im Untergang
Kreisdienststellen des MfS in Erfurt und Leipzig – vom Wachregiment Feliks Dzierżiński bewacht.122
Anstatt mit den gewählten Parteitagsdelegierten gegen die Nachfolgemann-schaft des Zentralkomitees im Arbeitsausschuss die SED zu übernehmen, versuchten die Reformer dem Arbeitsausschuss Unterstützung zukommen zu lassen. Sie wurden abgewiesen. So wurde z. B. das Angebot, Herrn Gysi bei den von ihm durchzuführenden juristischen Ermittlungen über Amtsmiss-brauch und Korruption zu unterstützen, strikt zurückgewiesen. Es gelang dem Arbeitsausschuss unter derselben Losung wie Krenz, in dieser komplizierten Situation nicht die Einheit der Partei zu gefährden, die Umwälzung in der Partei abzuwenden. Die Frage nach der politischen Substanz dieser Einheit wurde auch diesmal nicht gestellt.
Der Parteitag wurde in Regie und mit der Logistik des alten Apparates am 8. Dezember zu seiner ersten (Nacht-)Sitzung zusammengerufen. Verunsi-chert, desorientiert und letztlich übermüdet wagten sich die Delegierten am Ende nicht jenen Schritt zu tun, den sie eingangs noch gefordert hatten: Diese Partei aufzulösen.123 Als er wenige Tage später wieder zusammentrat, hatten die Delegierten ihre ungeteilte Legitimation bereits an einen gewählten Vor-stand abgetreten, der in einer Dimensionierung konstruiert wurde, dass sich innerhalb kleinere Machtzentren bilden konnten, die die faktische Regie usur-pierten.
Dennoch wurde die zweite Tagung zumindest konfrontiert mit einem An-trag, der anstelle der Auflösung der SED einen Akt einforderte, der aus der nur postulierten Neukonstituierung, dem nur behaupteten radikalen Bruch mit der Vergangenheit der Staatspartei einen wirklichen machen sollte. Der von den Delegierten der AdW eingebrachte Antrag forderte die Übertragung des Vermögens der SED an öffentliche Stiftungen, die unter öffentlicher Kontrolle aller politischen Parteien der DDR standen. Es sollte den zu diesem Zeitpunkt am Runden Tisch vertretenen Organisationen gleichberechtigt zur Verfügung gestellt werden. Das schloss die Immobilien der SED und deren logistische Mittel ein:
»Zur Stabilisierung der politischen Situation sind alle gesellschaftlichen Kräfte zu unter-stützen, die bereit sind, in diesem Sinne selbstständig zu arbeiten. Besonders den neuen politischen Organisationen kann die Partei hierbei praktisch dadurch helfen, dass sie ihnen Möglichkeiten zur Organisation, zur Kommunikation und zur Information bereit-stellt.«124
122 Vgl. Segert: Das 41. Jahr, S. 31. 123 Vgl. Hornbogen, Lothar; Nakath, Detlef; Stephan, Gerd-Rüdiger: Außerordentlicher Partei-
tag der SED/PDS. Protokoll der Beratungen am 8./9. u. 16./17.12.1989 in Berlin. Berlin 1999, S. 97. 124 Vgl. SED-KL AdW der DDR, Berlin, 9.(–12.)12.1989: Entwurf. Antrag an den außeror-
dentlichen Parteitag [Archiv d. Verf.].
Bernd Florath 103
Die Überführung der Massenmedien in öffentliche Kontrolle zu denselben Bedingungen, die ersatzlose Auflösung der SED-eigenen Forschungs- und Ausbildungsinstitute ergänzten das Ansinnen, das im veröffentlichten Proto-koll des Parteitages nicht auffindbar ist. Der Antrag wurde nie befasst, nie veröffentlicht. Allerdings wurde von Gregor Gysi explizit dagegen polemisiert und die Bewahrung des Parteieigentums zum zentralen Argument für die Nichtauflösung der SED, ja selbst für die Beibehaltung des alten Parteina-mens.125
Ein labiler Kompromiss zwischen intellektuellen Reformern und nachge-rückten Parteikadern gab der noch immer beachtlichen Zahl von Mitgliedern ein neues Gerüst politischer Organisation. Die Relegitimierung des verbliebe-nen Parteiapparates wurde unmittelbar nach Abschluss des Parteitages spürbar. Die Defensive der Monate November und Dezember schien abgeschlossen, die Rückgewinnung von Einfluss in der Gesellschaft erneut auf die Tagesordnung zu geraten. Doch schon der erste politische Konflikt drohte die Konstruktion aus SED und PDS, aus Verwurzelung der Partei in ihrer Vergangenheit als Herrschaftsmaschine der Diktatur und angestrebter Perspektive als sozialisti-scher Partei in einer pluralistischen Gesellschaft wieder zu sprengen. Der Auf-marsch der Staatssicherheit am Treptower Ehrenmal zur Jahreswende, ihr Ruf nach Etablierung eines Verfassungsschutzes, erwies sich als zu durchsichtiges Manöver zur Restauration des Ministeriums für Staatssicherheit. Die empörte Reaktion der Demonstranten wandte sich nunmehr gegen die letzte Bastion des MfS, dessen Berliner Zentrale am 15. Januar 1990 besetzt wurde. Die dilatorische Politik der Modrow-Regierung bei der Auflösung der politischen Polizei, die vom neuen Parteivorstand der SED/PDS in keiner Beziehung infrage gestellt wurde, ließ die vorerst vertagten Konflikte des außerordentli-chen Parteitages wieder aufbrechen: Mit dem stellvertretenden Parteivorsitzen-den Wolfgang Berghofer verließen eine Reihe von Wirtschafts- und Verwal-tungskadern das sinkende Schiff der Partei. Wenige Tage später126 versammel-ten sich die Köpfe des Reformflügels, die Sprecher der neugebildeten Plattformen (WF-Plattform, Plattform 3. Weg, sozialdemokratische Plattform, kommunistische Plattform) und forderten, mit Ausnahme der kommunisti-schen, die sofortige Auflösung der SED/PDS, weil diese die größte Gefahr für den Fortbestand einer selbstbestimmten DDR darstelle. Ihr Einfluss erwies sich indes als zu schwach.
Auf der folgenden Tagung des Parteivorstandes wurde dieser Antrag ebenso abgelehnt wie in dieselbe Richtung gehende Vorstöße von Kreis- und Bezirks-verbänden. Die Kohäsion der verbliebenen Parteikader war stark genug. Insbe-
125 Vgl. Hornbogen; Nakath; Stephan: Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS, S. 303 f. 126 Der zeitliche Abstand war gewahrt worden, um die Unterschiedlichkeit der Gründe nicht zu
verwischen.
104 SED im Untergang
sondere jüngere Mitglieder, weniger wundgerieben am Apparat, wollten die Chance, eine noch immer große Organisation mit einer funktionierenden Struktur, mit Vermögen und Logistik, für ihre politischen Vorstellungen nutzen. Ihre Initiative, das Beharrungsvermögen der Kader der zweiten Reihe und das intellektuelle Vermögen in anderen politischen Richtungen aufgrund ihrer Biografien abgelehnter Reformer bildeten den Kitt der PDS.
Sie boten sich der noch immer kopf- und konzeptlosen Partei als Organisa-tor des nun anstehenden Wahlkampfes zur Volkskammer an. Ein Wahlkampf, der unabhängig von seinen Inhalten, den politischen Zielen, die die zu wäh-lenden Vertreter einer nunmehr Partei gewordenen Staatsorganisation in die parlamentarische Auseinandersetzung einzubringen hätten, vor allem einen Zweck hatte: Den Mitarbeitern des Apparates Lohn und Brot zu geben. 16 Prozent der Wählerstimmen in der ersten und einzigen freien Wahl einer Volkskammer der DDR zeigen das heterogene Potenzial der Klientelpartei der gestürzten und gescheiterten Teile der Nomenklatura an. Zugleich trug die PDS als Teil des politischen Gesamtspektrums unfreiwillig dazu bei, diese alten herrschenden Schichten widerspenstig in den neuen Staat zu integrieren.
Die in den Plattformen organisierten Reformkräfte verweigerten den Par-teikadern zwar die Loyalität, scheiterten indes an deren Organisationsmacht, mit der sich die um den Namen SED erleichterte PDS in den Wahlkampf zur Etablierung begab. Eigene politische Organisationsversuche wie bei den De-mokratischen Sozialisten in Leipzig oder in der Unabhängigen Sozialistischen Partei in Berlin blieben letztlich erfolglos.
Die Disparatheit der programmatischen und politischen Konzepte der Nachfolgeorganisationen der SED indes bleibt eine Folge ihrer unaufgelösten Verwurzelung in der kommunistischen Herrschaftsmaschine.