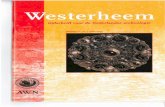Die legio XIIII Gemina Martia Victrix in Nordwestpannonien am Ende des 1. Jhs. n. Chr.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Die legio XIIII Gemina Martia Victrix in Nordwestpannonien am Ende des 1. Jhs. n. Chr.
1
Die legio XIIII Gemina Martia Victrix in Nordwestpannonien am Ende des 1. Jhs. n. Chr.
Martin Mosser
Mit diesem Beitrag soll im Geiste der For-schungen des Jubilars der Bedeutung von Bildmo-tiven auf römischen Steindenkmälern Rechnung getragen werden, welche im Zusammenspiel mit epigrafischen und archäologischen Kriterien einen wesentlichen Beitrag zu exakten Datierungsmög-lichkeiten und historischen Aussagen liefern kön-nen.
Carnuntum als Statthaltersitz und jahrhunderte langer Standort der legio XIIII Gemina Martia Vic-trix war spätestens ab dem 2. Jh. n. Chr. das Macht-zentrum der Pannonia Superior bzw. der spätantiken Pannonia I. Donauauf- bzw. -abwärts wurde Carnun-tum von den Legionslagern Vindobona (Wien) mit der legio X Gemina und Brigetio (Komárom-Szöny) mit der legio I Adiutrix flankiert. Gemeinsam mit der Garnison in Aquincum in der Pannonia Inferior gehörte die mittlere Donau damit zu den am stärk-sten mit Legionen besetzten Grenzabschnitten des römischen Imperiums. Doch noch in flavischer Zeit finden wir im noch ungeteilten Pannonien völlig an-dere Verhältnisse vor: Poetovio (Ptuj) an der Drau, weitab von der Donaugrenze, war Provinzhaupt-stadt und Standort der legio XIII Gemina und mit der legio XV Apollinaris in Carnuntum befand sich lange Zeit nur eine einzige Legion an der Donau. Mit der Machtübernahme Traians und den darauf folgenden Truppenverschiebungen am Vorabend der Dakerkriege erfolgten die entscheidenden Impulse für militärische Maßnahmen und Bauprogramme, die den nordwestpannonischen Raum nachhaltig für die nächsten drei Jahrhunderte prägen sollten. Dabei spielte die erst knapp zwei Jahrzehnte später als dauerhafte Garnison in Carnuntum etablierte 14. Legion eine entscheidende Rolle, die in diesem Bei-trag näher beleuchtet werden soll.
Die Dislokation der Legionen an der Rhein- und Donaugrenze von den Germanenkriegen Domi-tians über die Dakerkriege Traians bis zum Beginn der hadrianischen Epoche war in der Forschungs-
geschichte seit Emil Ritterling (1924/1925) Gegen-stand zahlreicher kontrovers diskutierter Aufsät-ze (vgl. u.a. Alföldy 1959; Lörincz 1981; Strobel 1988a; Strobel 1988b; Schmitz 2008). Dabei zeigten Truppenverschiebungen in den germanischen Pro-vinzen oft unmittelbare Auswirkungen auf den pannonischen Raum. So ist nach derzeitigem For-schungsstand am Ende des 1. Jhs. n. Chr. folgendes Bild an den germanischen und pannonischen Legi-onsstandorten skizzierbar (Abb. 1):
In Niedergermanien waren bis zu den Daker-kriegen in Noviomagus (Nijmegen) die legio X ge-mina und in Novaesium (Neuss) die legio VI Victrix stationiert (Schmitz 2008, 158f.). In Vetera (Xan-ten) stand die legio XXII Primigenia bis 97 n. Chr., die danach nach Mogontiacum (Mainz) verlegt wurde (Schmitz 2008, 154) und in Bonna (Bonn) die legio I Minervia. In der Germania Superior lag in Argentorate (Straßburg) die legio VIII Augusta, in Vindonissa bis zu den Dakerkriegen die legio XI Claudia und in der Provinzhauptstadt Mogontia-cum bis zum Jahr 97 die legio XIIII Gemina Martia Victrix. Diese wurde frühestens im Zuge des bellum Suebicum unter Kaiser Nerva 97 n. Chr., spätestens aber in der zweiten Hälfte dieses Jahres nach Pan-nonien verlegt und durch die legio XXII Primige-nia ersetzt (Lörincz 1981, 285; Franke 2000, 199; Schmitz 2008, 154).
In Pannonien ist allerdings der Aufenthaltsort der 14. Legion von 97 bis 101 n. Chr. bislang nicht eindeutig geklärt. Die frühere Ansicht, dass sie von 92-97 n. Chr. in Mursa Minor (Mursella) stationiert war, ist inzwischen widerlegt (vgl. Alföldy 1959, 126; Lörincz 1981, 285). Zur Diskussion steht ein Aufenthalt in Ad Flexum (Mosonmagyaróvár) zwi-schen 97 und 101 n. Chr. (CIL III 13444; Alföldy 1959, 137f.; Brandl 1999, 151). Gesichert scheint ihre Anwesenheit in Vindobona von 101-114/118 n. Chr., zuvor begann die aus Poetovio abkomman-dierte legio XIII Gemina ab 97/98 mit dem Bau des
2
Legionslagers von Vindobona, den die 14. Legion fortsetzte und wahrscheinlich im Herbst 102 been-dete (Mráv / Harl 2008). In Carnuntum war zumin-dest bis zu den Partherkriegen Traians im Jahr 114 die legio XV Apollinaris zu finden. Ab 97 begann in Brigetio die legio I Adiutrix bis zu den Dakerkrie-gen das Legionslager zu errichten, danach folgte die legio XI Claudia, wobei am Bau des Lagers nach-weislich auch die benachbarten Legionen beteili-gt waren (legio XIII Gemina, legio XIIII Gemina Martia Victrix, legio XV Apollinaris). Schon etwas früher im Zuge der Germanenkriege Domitians er-baute die legio II Adiutrix das Legionslager Aquin-cum (Budapest). Während der Dakerkriege Traians wurde sie von der legio X Gemina ersetzt.
Dies zeigt, dass mit der Verlegung der 13. und 14. Legion sowie der legio I Adiutrix an den nordwestpannonischen Grenzabschnitt um 97/98 n. Chr. plötzlich vier Legionen anzutreffen waren, aber dort nur ein einziges Legionslager existierte, jenes der legio XV Apollinaris in Carnuntum. Of-fensichtliches Ziel war es aber mit Vindobona und Brigetio zwei weitere Legionsstandorte und wohl auch weitere Auxiliarkastelle (z.B. Ad Flexum oder Ad Statuas / Ács-Vaspuszta; vgl. Visy 2003, 65, 70-72) durch diese vier Legionen so rasch als möglich errichten zu lassen, um in Pannonien eine ähnlich starke Militärpräsenz wie etwa in den germanischen Provinzen oder in Syrien zu schaffen.
Abb. 1: Übersichtsplan zur Verteilung der Legionen in den germanischen Provinzen und in Pannonien zwischen 97 und 101 n. Chr. (Plan: M. Mosser, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie; Kartengrundlage: Natural Earth).
3
Urheber dieser Maßnahme war der im Okto-ber 97 von Kaiser Nerva adoptierte und damit als sein Nachfolger feststehende M. Ulpius Traianus. Werner Eck (2002, 16-18) konnte dabei glaubhaft nachvollziehbar machen, dass die Statthalterschaft Traians in der Germania Superior im Jahr 97 und die währenddessen erfolgte Adoption (Franke 2000, 199) eine bald nach der Ermordung Domitians und dem wohl von Anfang an als nur vorübergehend betrachteten Herrschaftsantritt Nervas von einer Gruppe von Senatoren initiierte Aktion darstell-te. Ziel war es dabei dem Herrschaftsanspruch des M. Cornelius Nigrinus, einem hochdekorierten Feldherren Domitians, entgegenzutreten, der von den syrischen Legionen und der Prätorianergarde unterstützt wurde (Speidel 2002, 24). Der in Mo-gontiacum im Jahr 97 residierende Traian sollte dabei die sieben am Rhein stationierten Legionen auf seine Seite bringen, was ihm in der Folge auch gelang. Am Statthaltersitz in Mogontiacum war zudem die legio XIIII Gemina Martia Victrix sta-tioniert, die offensichtlich noch vor dem Tod Ner-vas (27.1.98) – vielleicht auch unter dem Einfluss der aktuellen Auseinandersetzungen an der Donau (bellum Suebicum; vgl. Grainger 2004, 112-117) – nach Pannonien transferiert wurde (Strobel 1988b, 447), um gemeinsam mit den oben genannten Le-gionen die umfangreichen Baumaßnahmen in die Wege zu leiten. Dies kann aber nur bedeuten, dass die militärische Aufrüstung in Nordwestpannonien ein spätestens im Jahr 97 im Umkreis des Senators Traian entwickeltes und vielleicht von Nerva mit-getragenes Programm darstellte. Welche politisch-militärischen Gründe dafür ausschlaggebend waren, kann nur vermutet werden. Möglich wäre eine wei-tere Machtsicherung Traians, um die pannonischen Legionen neben den germanischen auf seiner Seite zu wissen oder einfach die Notwendigkeit seit den Germanenkriegen Domitians die Grenzsicherung gegenüber den Germanen massiv auszubauen. Nachdrücklich unterstrichen wird die Bedeutung dieser Maßnahmen durch die Inspektionsreisen Traians an Rhein und Donau in den Jahren 98 und 99 n. Chr. ohne dass er nach seiner Machtübernah-me in der Zwischenzeit nach Rom zurückgekehrt wäre (Speidel 2002, 26-28). Inwieweit dabei be-reits eine künftige Eroberung Dakiens eine Rolle gespielt haben wird, ist in der Forschung umstritten (Speidel 2002, 31). Bemerkenswert ist aber in die-sem Zusammenhang, dass ab 97/98 vier Legionen in NW-Pannonien „nur“ zwei Legionslager errich-ten, somit eine Truppe offensichtlich von Anfang an nicht für eine Stationierung in Vindobona, Carnun-tum oder Brigetio vorgesehen war. Wie sich heraus-
stellen sollte, war diese eine Legion die legio XIII Gemina, die ab dem ersten Dakerkrieg nicht mehr in Pannonien zu finden war und im dakischen Apu-lum (Alba Iulia) ihren ständigen Garnisonsort fand. Eine etwas früher anzusetzende Verlegung der 14. Legion nach Pannonien in Zusammenhang mit den Vorbereitungen zum Suebenkrieg Nervas im Jahr 97 n. Chr., wie sie Karl Strobel annimmt, ist vor dem Hintergrund des langfristig geplanten Baupro-gramms ebenso möglich, aber für die Datierung des Aufenthaltes der Legion nur bedingt relevant (Stro-bel 1988a, 441 u. 448; Grainger 2004, 23; Schmitz 2008, 156).
Im folgenden soll nun versucht werden, der 14. Legion nach ihrer Ankunft in Pannonien spätestens Ende des Jahres 97 mit entsprechenden Zeugnissen (Steindenkmäler und Ziegelstempel) auf die Spur zu kommen und zu skizzieren wo und in welcher Form diese Truppe bis zu ihrem gesicherten Aufent-halt in Vindobona ab 101 n. Chr. stationiert gewesen sein kann.
CarnuntumVon der Gräberstraße westlich des Legionsla-
gers existieren acht Grabstelen (vgl. Mosser 2005, 135-137; Gugl 2013, 124-128) und vom Heiligtum des Iupiter Optimus Maximus am Pfaffenberg ein Weihealtar (Piso 2003, 17f.), die wohl mit einem Aufenthalt von Teileinheiten der 14. Legion zwi-schen 97 und 101 n. Chr. in Verbindung zu bringen sind.
Kat. Nr. 1: Altar für Iupiter Optimus MaximusDrei Fragmente vom oberen Teil des Schaftes und des Aufsatzes sowie die untere rechte Ecke des In-schriftfeldes.FO: Carnuntum, Pfaffenberg, zwei Fragmente gef. 1877 in Tempel I, ein Fragment in Tempel III.VO: Bad Deutsch-Altenburg, Museum Carnunti-num Inv. Nr. 99; I 1/80.B: 0,60m, H: erh. ca. 0,80m, T: 0,35mInschrift:I(ovi) O(ptimo) M(aximo)/ ve[xi]llati(o)/ leg(ionis) [XI]III [G(eminae)]/ su[b …]/ […]CL/ […]AR/ […] co(n)s(ulibus.Literatur: Piso 2003, 17f. Nr. 2 (mit weiterer Lite-ratur)
Ioan Piso vermutet als Stifterin des Altars eine Arbeitsvexillation der frühestens ab 113 in Carnun-tum stationierten Legion, die in einem Steinbruch
4
am Hundsheimer Berg tätig gewesen sein soll und datiert die Weihung jedenfalls vor das Ende der Re-gierungszeit Hadrians. Doch erscheint die Angabe einer vexillatio bei vollständiger Anwesenheit einer Legion weniger wahrscheinlich als die zwischen 97
und 101 ausgeführte Weihung eines neben der 15. Legion in Carnuntum stationierten Detachments der legio XIIII Gemina Martia Victrix.
Jüngst kartierte Christian Gugl (2013, 124-129 Abb. 78) die Fundorte von acht Grabstelen der 14.
Abb. 2: Frühe Grabsteine der legio XIIII Gemina Martia Victrix (Kat. Nr. 2-8) in Carnuntum (97-101 n. Chr.?) im Vergleich mit Mainzer Grabstelen (Fotos: Museum Carnuntinum, Kulturabteilung des Landes Niederösterreich; Zeichnungen: aus Fuchs 1771/1772, Teil 1 Taf. XVII u. Teil 2 Taf. VIII).
5
Legion, die in die Zeit zwischen 97/98 und 101 n. Chr. zu datieren sind (Kat. Nr. 2-9, Abb. 2). Bis auf das wohl verlagerte Bruchstück Kat. Nr. 9 und der näher beim Auxiliarkastell gefundenen Ste-le Kat. Nr. 6 können alle auf einem dicht belegten Gräberbereich in einem Abstand von etwa 200m nordöstlich des Auxiliarkastells verortet werden. In diesem Abschnitt der Gräberstraße (S32) zwi-schen Legionslager und Auxiliarkastell konzentrie-ren sich auch die der zweiten Stationierungsphase der 15. Legion zwischen 71 und 114 n. Chr. zuzu-rechnenden Grabsteine (Beszédes/Mosser 2002, 21 Abb. 5). Grabstelentypus, Ornamentik und Bild-motive sowie epigrafische Merkmale der Steine der 14. Legion unterscheiden sich aber wesentlich von jenen der zeitgleichen 15. Legion. Sie folgen aber sowohl typologisch als auch ikonographisch nahtlos den flavisch datierten Grabsteinen der legio XIIII Gemina Martia Victrix in Mainz (Abb. 2), die vor dem Abzug der Legion im Jahr 97 errichtet wur-den (Boppert 1992, Nr. 113, 151-153, vgl. auch Nr. 154 u. 158). Die generelle typologische Entwick-lung von Grabstelen in Mainz und Carnuntum von einfachen Stelen mit Dreieckgiebel über jene mit Eckakroteren hin zu Fünfeckgiebel und zu Stelen mit Horizontalabschluss und eingeschriebenem Dreieckgiebel ist zwar durchaus vergleichbar, be-stimmte Ausformungen sind aber – mit Ausnahme der genannten Stelen der 14. Legion in Carnuntum – speziell nur jeweils an einem der beiden Legions-standorte anzutreffen. So zeigen die frühen Stelen der legio XIIII Gemina Martia Victrix in Carnun-tum in drei Fällen bogenförmig abgeschlossene In-schriftfelder, wie sie in Carnuntum ansonsten nie festzustellen sind, aber in Mainz zum Standardre-pertoire der dortigen Steinmetzwerkstätten gehö-ren. Ebenso sind schmale Zwischenfriese über dem Inschriftfeld und unterhalb des eingeschriebenen Giebels typisch für spätflavisch-frühtraianische Stelen in Mogontiacum, aber kein Markenzeichen der Carnuntiner Grabstelen. Bei mindestens drei der acht Stelen der 14. Legion in Carnuntum (Kat. Nr. 5, 7 u. 8) sind aber derartige Dekorationen in Form eines Waffenfrieses und Friesen mit Doppelhenkel-gefäßen im Zentrum feststellbar.
Kat. Nr. 2 (Abb. 2):Grabstele für L. Ponpeius TaurinusStele mit Fünfeckgiebel, eingeschriebener Akan-thus-Dreipass und mehrblättrige RosetteFO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagers
VO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 76B: 0,49m, H: 1,11m, T: 0,22mInschrift:L(ucius) Ponpeius / L(ucii) f(ilius) Vol(tinia) Tau/rinus Tolo(sa) / mil(es) leg(ionis) XIIII / g(eminae) M(artiae) v(ictricis) an(norum) XL / stip(endiorum) XIX h(ic) s(itus) / e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 532; Genser 2005, 12f.; Gugl 2013, 231 UID 775; Lupa 253 (mit weiterer Literatur).Dieser Stelentyp ist gut vergleichbar mit der Grab-stele des M. Gellius Secundus, miles der 14. Legion aus flavischer Zeit in Mainz (Boppert 1992, 225f. Nr. 113 Taf. 82).
Kat. Nr. 3 (Abb. 2):Grabstele für T. Attius VegetusOben gerade abgeschlossene Stele mit eingeschrie-benem Giebeldreieck, darin mehrblätterige Rosette und Akanthusfüllung, in den Schrägen Halbpalmet-ten und Akanthusornament.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 65B: 0,54m, H: 1,65m, T: 0,27mInschrift:T(itus) Attius T(iti) f(ilius) / Vol(tinia) Vegetus / Luco mil(es) / leg(ionis) XIIII g(eminae) / M(artiae) v(ictricis) an(norum) L / stip(endiorum) XXI h(ic) s(itus) / e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 533; Genser 2005, 28f.; Gugl 2013, 229 UID 713; Lupa 254 (mit weiterer Literatur).
Eine vergleichbare Stele der 14. Legion aus Mainz wäre jene mit Horizontalabschluss und Reli-efgiebel des C. Titius Mestrius (Boppert 1992, 256f. Nr. 151 Taf. 105). Ein Grabaltar aus Carnuntum nennt mit C. Iulius Veranus einen Veteranen der 14. Legion und decurio der colonia Claudia Savaria, der ebenfalls aus Lucus Augusti (Luc-en-Diois) in Südostgallien stammte (Kremer 1997). Dieser ver-starb mit 65 Jahren und wurde wohl gemeinsam mit T. Attius Vegetus für die Legion in Mainz rekrutiert und zwischen 97 und 101 nach Carnuntum dislo-ziert. Letzterer verstarb aber bereits kurz vor seiner Entlassung aus dem Militärdienst, während C. Iuli-
6
us Veranus wohl noch ca. 20 Jahre seinen Vetera-nenstand genießen konnte und dabei auch eine ge-wisse Zeit als Gemeinderat von Savaria verbrachte.
Kat. Nr. 4 (Abb. 2):Grabstele für L. Comagius SeverinusStele mit Horizontalabschluss und Reliefgiebel mit Doppelhenkelgefäß und Blattranken. Inschriftfeld bogenförmig abgeschlossen, darüber in den Zwi-ckeln Akanthusornament.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 70B: 0,72m, H: 1,65m, T: 0,16mInschrift:L(ucius) Comag[ius ---] / Vol(tinia) Seve[rinus] / Aven(nione) mil(es) l[eg(ionis)] / XIIII G(eminae) M(artiae) V(ictricis) an(norum) / XX-XIX stip(endiorum) [---] / h(ic) s(itus) [e(st) t(estamento)] f(ieri) i(ussit) / h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 401; Genser 2005, 18f.; Gugl 2013, 231 UID 772/4; Lupa 176 (mit weiterer Literatur).
Die Stele ist beinahe identisch mit jener des in Ara Agrippinensium (Köln) bereits „lokal“ rekru-tierten C. Iulius Marinus, eines Elitesoldaten (ar-matura) der legio XIIII Gemina Martia Victrix in Mainz (Abb. 2; Boppert 1992, 258f. Nr. 153 Taf. 106).
Kat. Nr. 5 (Abb. 2):Grabstele für Sex. Aponius ValensOben abgebrochene Stele mit Resten einer Frieszo-ne (Delphine) über dem bogenförmig abgeschlos-senen Inschriftfeld. In den Zwickeln über der In-schrift Akanthusornament.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 64B: 0,74m, H: erh. 1,55m, T: 0,25mInschrift:Sex(tus) Apo/nius Sex(ti) f(ilius) / Quir(ina) Va-lens / Camun(nis) mil(es) / leg(ionis) XIIII g(eminae) M(artiae) / v(ictricis) an(norum) XXXV / stip(endiorum) XI h(ic) s(itus) e(st) / t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 530; Genser 2005, 26f.;
Gugl 2013, 231 UID 772/3; Lupa 251 (mit weiterer Literatur).
Die Stele ist ebenfalls gut vergleichbar mit je-ner des C. Iulius Marinus in Mainz (Abb. 2; Bop-pert 1992, 258f. Nr. 153 Taf. 106).
Kat. Nr. 6 (Abb. 2):Grabstele für C. Visius ProculusStele mit Horizontalabschluss und zwei übereinan-der eingeschriebenen Reliefgiebeln mit Doppelhen-kelgefäß, Delphinen und Hippokampen im unteren und Akanthusblatt sowie Halbpalmetten im oberen Relief. Inschriftfeld bogenförmig abgeschlossen, darüber in den Zwickeln Akanthusornament.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 79B: 0,72m, H: 1,94m, T: 0,23mInschrift:C(aius) Visius C(aii) f(ilius) / Pub(lilia) Procu-lus / Vero(na) mil(es) leg(ionis) / XIIII g(eminae) M(artiae) v(ictricis) an(norum) / XL stip(endiorum) XV h(ic) / s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 402; Genser 2005, 22f.; Gugl 2013, 231 UID 773; Lupa 177 (mit weiterer Literatur).
Die Ornamentik der Grabstele bildet eine Kombination aus mehreren ähnlichen Grabstelen von Soldaten der 14. und 22. Legion in Mainz wie jene des Q. Pompeius Severus, des C. Iulius Mari-nus oder des C. Valerius Secundus (Abb. 2; Boppert 1992, 257-260 Nr. 152-154 Taf. 106-107, vgl. auch Nr. 158 Taf. 109)
Kat. Nr. 7 (Abb. 2):Grabstele für L. Lucceius BlaesiusStele mit Horizontalabschluss und eingeschrie-benem Reliefgiebel mit Doppelhenkelgefäß und Delphinen, in den Schrägen darüber je ein Greif. Zwischen Giebel und Inschriftfeld Waffenfries.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 73B: 0,80m, H: erh. 1,00m, T: 0,19mInschrift: L(ucius) Lucceius L(uci) f(ilius) / Saba(tina) Blae-sus Fir/m(o) mil(es) leg(ionis) XIIII Ge(minae) /
7
Mar(tiae) Vic(tricis) an(norum) XXXV / stipendio-rum / XVIIII h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 388; Genser 2005, 20f.; Gugl 2013, 229 UID 714; Lupa 169 (mit weiterer Literatur).
Ein offensichtlich identischer Waffenfries un-terhalb eines Reliefgiebels mit Delphinen ist auf einem flavischen Grabstelenfragment in Mainz in Ansätzen erkennbar (Boppert 1992, 263 Nr. 158 Taf. 109). Vgl. auch das Giebelrelief der Stele für C. Iulius Marinus (Abb. 2; Boppert 1992, Nr. 153).
Kat. Nr. 8 (Abb. 2):Grabstele für C. Lucretius SuadullusStele mit dreieckigem Reliefgiebel, darin Skylla. Darunter Zwischenfries mit zentralem Doppelhen-kelgefäß, flankiert von zwei Panthern und Säulen. Inschrift mit vegetabilem Ornament gerahmt.FO: Carnuntum, Gräberstraße südwestlich des Le-gionslagersVO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 74B: 0,88m, H: 1,25m, T: 0,20mInschrift:C(aius) Lucretius C(ai) f(ilius) / Vol(tinia) Sua-dullus / Alba mil(es) leg(ionis) XIIII / G(eminae) M(artiae) V(ictricis) an(norum) XL stip(endiorum) / XIX h(ic) s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1970, Nr. 228; Genser 2005, 30f.; Gugl 2013, 229 UID 715; Lupa 144 (mit weiterer Literatur).
Ein vergleichbarer Zwischenfries mit von Greifen flankiertem Doppelhenkelgefäß zeigt die Stele für C. Valerius Secundus, eines Soldaten der der 14. Legion in Mainz nachfolgenden legio XXII Primigenia (Boppert 1992, 259f. Nr. 154 Taf. 107). Dies scheint zu belegen, dass in flavischer Zeit ge-gründete Steinmetzbetriebe in Mainz auch noch in traianischer Zeit Bestand hatten, aber aus diesen Werkstätten einige Steinmetze mit der 14. Legion nach Pannonien gegangen waren.
Kat. Nr. 9:Unteres Bruchstück der Grabstele für M. Matius MaximusInschriftfeld von Blattfries gerahmt.FO: Carnuntum, Verbindungsstraße zwischen Grä-berstraße und Donauuferstraße südwestlich des Legionslagers, eventuell verlagert (Gugl 2013, 63
Abb. 32, 124 Abb. 78)VO: Hainburg, Archäologisches Zentraldepot, Inv. Nr. 75B: 0,60m, H: erh. 0,81m, T: 0,14m (nur Inschriftfeld erhalten)Inschrift:M(arcus) Matius / M(arci) f(ilius) Fab(ia) Maxi/mus Brix[ia] / mil(es) leg(ionis) XII[II] / G(eminae) M(artiae) V(ictricis) an(norum) XXX stip(endiorum) / VI h(ic) s(itus) e(st) h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: Krüger 1972, Nr. 506; Gugl 2013, 234 UID 1116; Lupa 229 (mit weiterer Literatur).
Signifikante inschriftliche Merkmale an diesen Stelen sind die ausnahmslose Nennung von milites der 14. Legion mitsamt ihren Herkunftsorten aus dem italischen und südgallischen Raum. Auffal-lend ist auch die fast durchgängige Verwendung der Grabformeln t(estamento) f(ieri) i(ussit) und h(eres) f(aciendum) c(uravit) und das Fehlen der Einlei-tungsformel D(is) M(anibus), was ebenfalls im Ver-gleich zu den Inschriften der 15. Legion auf eine frühtraianische Datierung weist (Beszédes / Mos-ser 2002, 28 Anm. 88; Mosser 2005, 135-137). Die Dienstjahre der Soldaten liegen zwischen sechs und 21 stipendia, was unter der Prämisse der Stelenda-tierung zwischen 97 und 101 schließen lässt, dass alle milites ursprünglich für den Stationierungsort Mogontiacum rekrutiert wurden.
Diese Stelen und der Weihealtar vom Pfaffen-berg belegen somit die Anwesenheit zumindest von Teileinheiten der legio XIIII Gemina Martia Victrix gemeinsam mit der ebenfalls gut nachweisbaren le-gio XV Apollinaris in Carnuntum am Ende des 1. Jhs. n. Chr. Dass diese Grabsteine erst knapp 20 Jahre später, ab 114 n. Chr., zum Zeitpunkt der end-gültigen Stationierung der 14. Legion in Carnuntum errichtet worden wären (Gugl 2013, 126f.), kann auf Grund der äußerst nahen Verwandtschaft zu den fla-vischen Stelen in Mogontiacum und der ab dann üb-lich werdenden Verwendung der Grabformel D(is) M(anibus) ausgeschlossen werden. Die Grabstelen des M. Mogetius Pudens (Lupa 1778; Gugl 2013, 229 UID 711) und des M. Valerius Secundus (Lupa 1781; Gugl 2013, 229 UID 712), beide milites der 13. Legion, die in Carnuntum im selben Gräber-feldabschnitt wie jene der 14. Legion bestattet wur-den, dürften hingegen etwas früher, in die Zeit der Germanenkriege Domitians datieren (Mosser 2005, 132f.).
Auch ein Bautrupp der legio I Adiutrix ist durch einen Bauquader der Legion in Carnuntum nach-
8
weisbar. Manfred Kandler zieht allerdings eine Da-tierung dieses Denkmals zu Beginn des 3. Jhs. vor (Kandler 1991, 237-240 Abb. 43).
BrigetioDer Zeitpunkt der Errichtung des Legionslagers
Brigetio ist zwar umstritten, nach Barnabas Lörincz dürfte es zeitgleich mit Vindobona ab dem Jahr 97 von der legio I Adiutrix, die auch am Quadenkrieg Nervas nachweislich teilnahm, errichtet worden sein. Dies scheint eine entsprechende Bauinschrift zu bestätigen (CIL III 13436; Lörincz 1975, 343, 345, 349f.; Kandler 1991, 237; Lörincz 2000, 153f.; Mráv / Harl 2008, 51; anders Strobel 1988a, 215-217; Reuter 2012, 9). Dass an den Baumaßnahmen auch die anderen, benachbarten nordpannonischen Legionen beteiligt waren, bezeugen eindrücklich Ziegel mit dem Stempel VEXILLATIO III, VEXIL TRES und VEXIL III, die sich auf die legio XIII Ge-mina, die legio XIIII Gemina Martia Victrix und auf die legio XV Apollinaris beziehen (Szilágyi 1933, 83 Taf. XXII 3.2.1; Lörincz 1975, 345 Anm. 45, 349). Dazu existieren auch noch Stempel mit der In-schrift V L XIIII ET XV, also von Vexillationen der 14. und 15. Legion, die allerdings bislang erst nach 101 n. Chr., also nach dem Abzug der 13. Legion in den Dakerkrieg, datiert werden (Szilágyi 1933, 83 Taf. XXII, 4; Mráv / Harl 2008, 51f. Anm. 69). Eine Vexillation der 14. Legion ist aber auch noch durch einen Bauquader aus Brigetio mit dem Wappentier der Legion, dem Capricornus, gut belegbar.
Kat. Nr. 10:Bauquader der legio XIIII Gemina Martia VictrixRechteckiges Bildfeld mit capricornus mit Fisch-schwanz (Wappentier der 14. Legion), rechts davon Delphin, darunter gerahmte Inschrift (tabula ansa-ta). Unterer Rand beschädigt.FO: Brigetio (Komárom-Szöny)VO: Komárno, Lapidarium, Bastion VI, Inv. Nr. II 2815H: 0,50m, B: 0,79m, T: 0,20mInschrift:Vexillatio/ leg(ionis) XIIII G(eminae) M(artiae) V(ictricis)Literatur: AE 1903, 218; Harl / Lörincz 2002, 28f. Nr. 26; Lupa 4735.
Eine Bauvexillation der legio XIIII Gemina Martia Victrix kann somit für die Errichtung des Le-gionslagers Brigetio als erwiesen betrachtet werden.
Vielleicht ist sogar ein hier gefundener bronzener Stempel der Legion in Form einer capricornus-Sta-tuette mit diesem Bauunternehmen in Verbindung zu bringen (Soproni 1965).
VindobonaDer früheste mögliche Zeitpunkt für die Errich-
tung des Legionslagers Vindobona ist an die Auflas-sung des Legionsstandortes Poetovio an der Drau am Ende des 1. Jhs. n. Chr. und der damit verbun-denen Dislokation der legio XIII Gemina gekoppelt. Danach, wohl im Zuge der Inspektionsreise Traians 98/99 n. Chr., wurde Poetovio zur Colonia Ulpia Traiana ernannt (Galsterer-Kröll 1979, 125 Nr. 357; Mann 1983, 32f.; Zahrnt 2002, 60). Nach aktuellem Forschungsstand kam somit die legio XIII Gemina spätestens 98 n. Chr. nach Vindobona, wo seit den Germanenkriegen Domitians die ala I Flavia Augu-sta Britannica mil. c. R. stationiert war. Beide Trup-pen verließen im Zuge der Dakerkriege Vindobona um 101 n. Chr. und die legio XIIII Gemina Martia Victrix trat an Stelle der 13. Legion. Bauinschriften und Ziegelstempel der Legion bezeugen ihre Tätig-keit bei der Fertigstellung des Lagers (Mosser 2005, 138-140, 151; Mráv / Harl 2008), ehe sie 114/118 an den Standort Carnuntum wechselte. Auch wenn die-se Abfolge stichhaltig argumentiert werden kann, so sollte doch nicht die Möglichkeit außer Acht gelas-sen werden, dass die 14. Legion bereits ab 97/98 gemeinsam mit der 13. Legion das Lager Vindobo-na erbaute und vielleicht sogar von Anfang an als Besatzungstruppe von Vindobona vorgesehen war. Denn ansonsten ist, wie oben ausgeführt, nach wie vor kein Lager in dem die vollständige 14. Legion Platz hätte, im nordpannonischen Raum auszuma-chen. Bei einer Analyse der je ca. 400 bekannten Ziegelstempel der beiden Legionen im Bereich des Legionslagers Vindobona fällt auf, dass sie jeweils an bestimmten Gebäudekomplexen mehr oder we-niger stark vertreten sind, auch wenn in Betracht gezogen werden muss, dass die meisten Ziegel erst in sekundärer Verwendung oder in spätantiken Zie-gelbruchlagen aufgefunden wurden (Abb. 3). In situ wurden hingegen Ziegel mit Stempel der 13. Le-gion an der Sohle aller Hauptabwasserkanäle und bei den Backöfen entlang der via sagularis gefun-den. Ansonsten ist ein Übergewicht an Ziegel der 13. Legion nur noch im Bereich der Kasernen der ersten Kohorte feststellbar. Vor allem bei den Ka-sernen der quingenaren Kohorten und bei den Tri-bunenhäusern ist hingegen eine eindeutige Mehr-zahl an Ziegeln der 14. Legion zu konstatieren. Da der Bau des Legionslagers aber wohl von Beginn an
9
flächendeckend auf dem gesamten Areal in Angriff genommen wurde, kann durchaus in Betracht gezo-gen werden, dass Bautrupps der 13. und 14. Legion jeweils für bestimmte Lagerabschnitte und Infra-struktureinrichtungen vorgesehen waren und bei der Ausführung ihrer Arbeiten gleichzeitig agierten. Dem widersprechen auch nicht die fünf Bautafeln, die entlang der östlichen Umfassungsmauer des Lagers in sekundärer Verbauung bzw. in der Ver-füllung des Lagergrabens gefunden wurden (Abb. 3). Vier Bauquader der 14. Legion (Mosser 2005, 138f.; Mráv /Harl 2008) stehen dabei nur einem der 13. Legion (Mosser 2005, 133f.) gegenüber, wobei
dieses (scheinbare) Übergewicht nicht unbedingt auf die endgültige Fertigstellung durch die 14. Le-gion frühestens im Herbst 102 n. Chr. zurückge-führt werden muss (vgl. Mráv / Harl 2008, 48-50). Auch eine Inschrifttafel für einen Grabbau eines namentlich unbekannten praefectus castrorum der 14. Legion, gefunden nachantik zu einem Mühl-stein umgearbeitet im südöstlichen Abschnitt des Legionslagers, muss nicht unbedingt erst nach 101 n. Chr. entstanden sein, zumal die bei den carnunti-ner Stelen einheitlich vorgefundenen Grabformeln t(estamento) f(ieri) i(ussit) und h(eres) f(aciendum) c(uravit) auch an diesem Stein zu finden sind:
Abb. 3: Verbreitungskarte von Denkmälern der 13. und 14. Legion im Bereich des Legionslagers Vindobona (Plan: M. Mosser, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie; Kartengrundlage: DGM der Stadt Wien, MA 14 – ADV, MA 41 – Stadtvermessung).
10
Kat. Nr. 11:Grabtafel für einen praefectus castrorumDer ursprünglich rechte Teil des Inschriftfeldes ist nachträglich zu einem Mühlstein umgearbeitet wor-den, der Rest (mindestens ein Drittel der Inschrift) ist nicht erhalten.FO: Wien, 1. Bezirk, Jasomirgottstraße 1/Stephans-platz 9, vor 1891VO: Kunsthistorisches Museum Wien, Inv. Nr. AS III 807.Dm: 0,90m (B: ursprünglich mind. 1,50m), D: 0,15mInschrift:[…] f(ilius) Aniensis/ [… Arim]ini (centurio) leg(ionis) X G(eminae) p(iae) f(idelis)/ [p(rimus) p(ilus) leg(ionis XIIII G(eminae) M(artiae) v(ictricis)?] praef[ec]tus/ [castrorum? l]eg(ionis) eiusdem/ [testam(ento) fie]ri iussit h(eres) f(aciendum) c(uravit)Literatur: CIL III 11310 = 14360/1; Mosser 2005, 137 Abb. 5 (mit weiterer Literatur).
Der Offizier aus Ariminum (Rimini) kam als centurio der legio X gemina von Noviomagus (Nij-megen) zur 14. Legion nach Mogontiacum, wo er das Primipilat erreichte. Mit der Legion war er dann ab 97/98 in Pannonien, wo er wohl einer der ersten Lagerpräfekten von Vindobona wurde.
Auch der archäologische Befund von zwei zuletzt aufgedeckten Brennöfen innerhalb der rö-mischen Legionsziegeleien von Vindobona zeigt ein ähnliches, nicht hundertprozentig auflösbares Bild der Präsenz der 13. und 14. Legion. Als Bau-material der beiden Ofenkonstruktionen, die ein-deutig vor der Stationierungszeit der legio X ge-mina ab 114/118 n. Chr. errichtet wurden, lagen mehrheitlich Ziegel der legio XIIII Gemina Martia Victrix, aber auch vereinzelt jene der legio XIII Ge-mina vor. Eine Einrichtung der Anlagen durch die 14. Legion ab 101 n. Chr. erscheint dabei genauso argumentierbar wie eine Inbetriebnahme der Öfen durch Bautrupps beider Legionen (Mosser 2013, 158f.). Bemerkenswert ist zudem die Typenvielfalt der Ziegel der 14. Legion: etwa 600 bekannte ge-stempelte Ziegel aus dem Raum Vindobona zeigen über 300 verschiedene Stempeltypen, wohingegen ebenso viele Ziegel der 13. Legion nur ca. 100 ver-schiedene Typen aufweisen.
Eine frühe Anwesenheit der 14. Legion bereits ab 97/98 n. Chr. wäre gut belegbar durch Ziegel-stempel der Legion aus Vindobona, welche jenen an ihrem früheren Stationierungsort in Mogontiacum
entsprechen (vgl. Brandl 1999, 152f.). So hat Ulrich Brandl einen sehr gut vergleichbaren, allerdings nicht ganz identischen Stempeltyp aus Carnuntum auch aus der Mainzer Stationierungszeit identifi-zieren können (Brandl 1996, Abb. 3,1 u. 3,2). In Wien (und auch im benachbarten Auxiliarlager Klosterneuburg) ist diese U-förmige Stempelform ebenfalls insgesamt bisher 12-mal zu finden, aller-dings im Gegensatz zum carnuntiner bzw. Mainzer Typ mit den Legionszusatz „GM“ (Neumann 1973, Taf. XLVI, T.1 [1350]). Mainzer Ziegelstempel der 14. Legion aus der Spätphase, produziert in der ab 88/89 n. Chr. im Betrieb befindlichen Ziegelei von Nied bei Höchst hat Jürgen Wahl anhand einer Ty-pologie der bekannten Stempel vom Frankfurter Domhügel zusammengestellt (Wahl 1982, 122-145, Taf. 12-14). Zumindest drei Stempeltypen aus Frankfurt, die auch aus Heddernheim und Arnsburg bekannt sind (Wahl 1982, 127-130, Taf. 12-13: Typ 4, 9 u. 10), können dabei gut mit Material aus dem Legionslager Vindobona verglichen werden, ohne dass diese allerdings völlig übereinstimmen würden (Abb. 4). Sowohl die späten Stempel aus der Ger-mania Superior als auch jene in Vindobona weisen prozentuell weitaus öfter den Legionszusatz G[C?](emina) M(artia) V(ictrix) auf, als jene in Carnun-tum aus der späteren Stationierungsphase, die sehr häufig nur das „C“ für Gemina angeben (Gugl / Kastler 2007, 283-304 Kat. Nr. 17-300 Taf. 2-12). Letztendlich können die bekannten Ziegelstempel der 14. Legion die Anwesenheit in Vindobona ab 97/98 zwar nicht beweisen, allerdings ist eine Kon-tinuität der Stempelformen von den späten Mainzer Ziegeln zu jenen in Vindobona durchaus feststell-bar.
ResümeeDie hier vorgebrachten Ausführungen sollen
ohne Anspruch auf eine letztgültige Beweismög-lichkeit eine Indizienkette darstellen, welche zur Frage des Aufenthaltes der 14. Legion zwischen 97 und 101 n. Chr. im nordpannonischen Raum ei-nen Vorschlag anzubieten versucht. Diese beginnt bei der Machtübernahme Traians zur Zeit seines Aufenthaltes in Mogontiacum, wo während seiner Statthalterschaft die legio XIIII Gemina Martia Victrix stationiert war. Die Legion wurde im Zuge der umfassenden Reorganisation des Donau- und Rheinlimes nach Pannonien beordert, wo bis zu diesem Zeitpunkt mit Carnuntum nur ein Legions-lager an der Donau zu finden ist. Carnuntum dürfte in der Folge zum logistischen Zentrum für ein en-ormes militärisches Bauprogramm avancieren, das die Errichtung von zwei weiteren Legionslagern an
11
Abb. 4: Vergleich der Ziegelstempel aus Vindobona und Mogontiacum, Maßstab 1:2. (Vindobona: Zeichnung B. Lörincz; Mogon-tiacum: Wahl 1982, Taf. 12,4, Taf. 13,9, Taf. 13,10).
der mittleren Donau zum Ziel hatte. Hier wurden auch, wohl bald nach ihrer Verlegung aus Mainz, die verstorbenen Soldaten der 14. Legion im selben Areal der Gräberstraße wie jene der 15. Legion be-stattet. In Nordwestpannonien stationierten in den Jahren zwischen 97 und 101, aufgeteilt auf unter-schiedlich große Arbeitsvexillationen (vgl. auch
Strobel 1988b, 445), vier Legionen (I Adiutrix, XIII Gemina, XIIII GMV, XV Apollinaris) in drei Gar-nisonen (Vindobona, Carnuntum, Brigetio). Die je-weilige Truppenstärke vor Ort wird sich nach dem Baufortschritt gerichtet haben, wobei die 13. Legi-on offensichtlich von Anfang an nur zur Errichtung des Lagers Vindobona vorgesehen war, um mit dem
12
SigelActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum HungaricaeAE – L‘Année épigraphiqueCSIR – Corpus Signorum Imperii RomaniFWien – Fundort WienJahrb. RGZM – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums MainzLupa – www.ubi-erat-lupa.orgRE – Paulys Realencyclopädie der classischen AltertumswissenschaftRLÖ – Der römische Limes in ÖsterreichZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
LiteraturAlföldy G. 1959: Die Truppenverteilung der Donaulegionen am Ende des 1. Jahrhunderts. ActaArchHung 11,
113-141.Beszédes J. / Mosser M. 2002: Die Grabsteine der legio XV Apollinaris in Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch
2002, 9-98.Boppert W. 1992: Militärische Grabdenkmäler aus Mainz und Umgebung. CSIR Deutschland II/5. Germania
Superior. Mainz.Brandl U. 1996: Bemerkungen zu einem Ziegelstempeltyp der Legio XIV Gemina aus der Germania Superior
und Carnuntum. ZPE 112, 224-228.Brandl U. 1999: Untersuchungen zu den Ziegelstempeln römischer Legionen in den nordwestlichen Provinzen
des Imperium Romanum. Katalog der Sammlung Julius B. Fritzemeier. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 6. Rahden/Westf.
Eck W. 2002: Traian – Der Weg zum Kaisertum. In: Nünnerich-Asmus A. (ed.), Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit? Mainz, 7-20.
Franke Th. 2000: Legio XIV Gemina. In: Le Bohec Y. (ed.), Les Légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon. 17-19 septembre 1998. Lyon, 191-202.
Fuchs J. 1771/1772: Alte Geschichte von Mainz. Mainz.Galsterer-Kröll B. 1972: Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum. Epigraphische
Studien 9.Genser K. 2005: Römische Steindenkmäler aus Carnuntum 1. Archäologischer Park Carnuntum. Neue
Forschungen 3. St. Pölten.Grainger J. D. 2004: Nerva and the Roman succession crisis of AD 96–99. Gloucestershire.
Beginn der Dakerkriege in den Osten verlegt zu werden. Tendenziell scheint aus den vorhandenen archäologisch-epigrafischen Quellen ablesbar, dass die legio XV Apollinaris gemeinsam mit der legio I Adiutrix und mit kleineren Einheiten der 13. und 14. Legion das Lager Brigetio errichtete, die beiden letzteren dafür schwerpunktmäßig in Vindobona anzutreffen waren. Dass die 14. Legion schließlich für dieses Lager vorgesehen war, zeigen Inschriften in Carnuntum und Brigetio, welche vexillationes der Legion anführen, wohingegen in Vindobona eine explizite Anführung eines Detachments bis-lang fehlt. Neben dem Bau der Legionslager dürf-ten auch Auxiliarkastelle an der mittleren Donau in diesem Zeitraum um- und neugebaut worden sein,
wie etwa Ziegelstempel der 14. Legion in Ad Sta-tuas, Ad Flexum, Gerulata (Rusovce), Ala Nova (Schwechat) oder Klosterneuburg (Szilágyi 1933, 72; Ubl 1979, 118) nahelegen, wobei eine Datie-rung der Stempel ebenso Schwierigkeiten bereitet, wie die Bauinschrift aus Ad Flexum, welche oft als Argument für eine dortige Stationierung der Legi-on zwischen 97 und 101 herangezogen wurde (CIL III 13444; Alföldy 1959, 137f.; Lörincz 1975, 345). Auch hier wie in den anderen Hilfstruppenkastellen wird eine bestimmte, wahrscheinlich variierende Anzahl an Arbeitsvexilllationen vor Ort tätig ge-wesen sein. Weitaus besser greifbar sind aber für diesen Zeitraum Einheiten der legio XIIII Gemina Martia Victrix in Carnuntum und Vindobona.
13
Gugl Ch. 2013: Die Carnuntiner Canabae – Luftbilder und Grabungsbefunde im Vergleich. In: Doneus M. / Gugl Ch. / Doneus N., Die Canabae von Carnuntum. Eine Modellstudie der Erforschung römischer Lagervorstädte. RLÖ 47. Wien, 41-145 u. 227-235 (Anhang A).
Gugl Ch. / Kastler R. (ed.) 2007: Legionslager Carnuntum. Ausgrabungen 1968–1977. RLÖ 45. Wien.Harl F. / Lörincz B. 2002: Das römische Lapidarium in der Festung Komarno. Komarno. Kandler M. 1991: Die Legio I Adiutrix und Carnuntum. In: Maxfield V. A. / Dobson M. J. (ed.), Roman
Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies. Exeter.Kremer G. 1997: Der Grabaltar des C. Iulius Veranus in Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch 1997, 83-97.Krüger M.-L. 1970: Die Reliefs des Stadtgebietes von Carnuntum 1. Die figürlichen Reliefs. CSIR Carnuntum
I/3. Wien.Krüger M.-L. 1972: Die Reliefs des Stadtgebietes von Carnuntum 2. Die dekorativen Reliefs. CSIR Carnuntum
I/4. Wien.Lörincz B. 1975: Zur Erbauung des Legionslagers von Brigetio. ActaArchHung 27, 343-352.Lörincz B. 1981: Some remarks on the history of the Pannonian legions in the late first and early second
centuries A. D. Alba Regia 19, 285f.Lörincz B. 2000: Legio I Adiutrix. In: Le Bohec Y. (ed.), Les Légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du
Congrès de Lyon. 17-19 septembre 1998. Lyon, 153-155.Mann J. C. 1983: Legionary recruitment and veteran settlement during the principate. London.Mosser M. 2005: Die römischen Truppen in Vindobona. FWien 8, 126-153.Mosser M. 2013: Zwei römische Ziegelöfen in Wien 17, Steinergasse 16/Geblergasse 47. FWien 16, 144-161.Mráv Zs. / Harl O. 2008: Die trajanische Bauinschrift der porta principalis dextra im Legionslager Vindobona –
Zur Entstehung des Legionslagers Vindobona. FWien 11, 36-55.Neumann A. 1973: Ziegel aus Vindobona. RLÖ 27. Wien.Piso I. 2003: Die Inschriften. In: Jobst W. (ed.), Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem
Pfaffenberg/Carnuntum. RLÖ 41.1. Wien.Reuter M. 2012: Legio XXX Ulpia Victrix. Ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler. Xantener Berichte
23. Darmstadt.Ritterling E. 1924/1925: Legio. RE XII, 1186-1837. (W. Kubitschek / E. Ritterling [?!]).Schmitz D. 2008: Das Lager Vetera II und seine Legionen. In: Müller M. / Schalles H.-J. / Zieling N. (Hrsg.),
Colonia Ulpia Traiana. Xanten und sein Umland in römischer Zeit. Geschichte der Stadt Xanten 1. Mainz, 141-170.
Soproni S. 1965: Der Stempel der Legio XIV Gemina in Brigetio. Folia Archaeologica 17, 119-126.Speidel M. A. 2002: Bellicosissimus Princeps. In: Nünnerich-Asmus A. (ed.), Traian. Ein Kaiser der
Superlative am Beginn einer Umbruchzeit? Mainz, 23-40.Strobel K. 1988a: Bemerkungen zum Wechsel zwischen den Legionen XIV Gemina und XXII Primigenia in
Mainz und zur Struktur des untergermanischen Heeres in trajanischer Zeit. Germania 66, 437-453.Strobel K. 1988b: Bemerkungen zur Dislozierung der römischen Legionen in Pannonien zwischen 89 und 118
n. Chr. Tyche 3, 193-222.Szilágyi J. 1933: Inscriptiones tegularum Pannonicarum. Dissertationes Pannonicae 2.1. Budapest.Ubl H. 1979: Neues zum römischen und babenbergischen Klosterneuburg. Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg,
Neue Folge 11, 99-125.Visy Zs. (ed.) 2003: The Roman Army in Pannonia. An archaeological guide of the Ripa Pannonica. Pécs.Wahl J. 1982: Der römische Militärstützpunkt auf dem Frankfurter Domhügel. Schriften des Frankfurter
Museums für Vor- und Frühgeschichte 6. Frankfurt.Zahrnt M. 2002: urbanitas gleich romanitas. Die Städtepolitik des Kaisers Traian. In: Nünnerich-Asmus A.
(ed.), Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit? Mainz, 51-72.