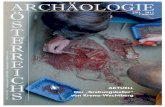Archäologische Forschungen in der Mongolei
Transcript of Archäologische Forschungen in der Mongolei
9
Archäologische Forschungen in der Mongolei – Ein Rückblick auf ein
erfolgreiches Kapitel deutsch-mongolischer Kooperationen
Jan Bemmann
In den deutsch-mongolischen Beziehungen kommt den gemeinsamen archäologisch-
en Forschungen seit knapp 15 Jahren eine besondere Rolle zu, so dass es anlässlich
des 40-jährigen Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Mongolei geboten erscheint, einen Blick
zurück auf die erfolgreichen Kooperationen auf dem Fachgebiet der Archäologie zu
werfen. Die Staatsoberhäupter beider Länder weisen in ihren Ansprachen bei
Besuchen im jeweiligen Gastland stets auf diese erfolgreiche Partnerschaft hin. In der
Tischrede von Bundespräsident Horst Köhler beim Staatsbankett, gegeben vom
Präsidenten der Mongolei, Herrn Nambaryn Enkhbayar, und Frau Onon Tsolmon am
5. September 2008 in Ulaanbaatar heißt es: „Die Ausstellung [gemeint ist die
Ausstellung Dschingis Khan und seine Erben 2005 in der Bundeskunst- und
Ausstellungshalle Bonn] präsentierte auch die Ergebnisse der deutsch-mongolischen
Expedition zur Ausgrabung der alten Hauptstadt Karakorum. Bei einer weiteren
Expedition gelang 2006 einem Team von deutschen, mongolischen und russischen
Experten unter der Leitung von Professor Parzinger, der mich als Sondergast
begleitet, ein sensationeller Fund, der so bedeutend war, dass Sie, Herr Präsident,
persönlich die Fundstelle aufsuchten: Die über 2000 Jahre alte ,Eismumie aus dem
Altai‘. An ihr lassen sich Lebensweise, Kunst und Technik der Hochkultur der
Skythen ablesen. Für mich ist es ein Zeichen des besonderen Vertrauens, dass gerade
deutsche Archäologen so intensiv an der Erforschung der mongolischen Geschichte
mitwirken. Diese Zusammenarbeit stützt sich nicht nur auf das staatliche Deutsche
Archäologische Institut, sondern umfasst auch die private Gerda Henkel Stiftung, die
heute eine Vereinbarung zur Ausweitung ihrer Aktivitäten in der Mongolei
unterzeichnet hat.“1 Letzteren Aspekt bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel in
ihrer Rede vor dem mongolischen Parlament, dem Großen Staatskhural, am
13.10.2011: „Die Gerda Henkel Stiftung fördert in hervorragender Weise die
historische und archäologische Forschung im Orchon-Tal.“2 Und zuletzt betonte
Bundespräsident Joachim Gauck beim Staatsbankett zu Ehren des Präsidenten der
Mongolei, Herrn Tsakhia Elbegdorj, am 29. März 2012 in Schloss Bellevue: „Herr
Präsident, ein Reich kann man vom Rücken eines Pferdes erobern, nicht aber
verwalten – so heißt es in den alten Chroniken. Die legendäre Hauptstadt Karakorum
markierte diesen wichtigen Schritt von der Eroberung zur Verwaltung und damit zur
Staatlichkeit der Mongolei. Sie spielt für die Identität Ihres Landes eine große Rolle.
Die Stadt war – wie das mongolische Weltreich – von religiöser Toleranz geprägt: Der
flämische Mönch Rubruck berichtete 1254 von buddhistischen und taoistischen
Tempeln, Moscheen und sogar einer christlichen Kirche. Das passt nicht zu lange
1 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-
Koehler/Reden/2008/09/20080905_Rede.html. Zuletzt besucht am 27.07.2014. 2 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2011/10/2011-10-13-rede-parlament-
mongolei.html. Zuletzt besucht am 27.07.2014.
Bemmann
10
gehegten Vorurteilen sesshafter Gesellschaften gegenüber Nomaden. Ein differen-
zierteres Bild – wie es zum Beispiel auch die derzeit laufende Ausstellung ,Steppen-
krieger‘ in Bonn vermittelt – hilft dagegen, Weltgeschichte besser zu verstehen. Ich
werte es als Zeichen besonderen Vertrauens, dass die Mongolei die archäologischen
Arbeiten in Karakorum mit deutschen Partnern durchführt. Daher führe ich sehr
gerne gemeinsam mit Ihnen, Herr Präsident, unsere Schirmherrschaft über dieses
Forschungsprojekt fort.“3
Die Anfänge der wissenschaftlichen Zusammenarbeit reichen jedoch wesentlich
weiter zurück als die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern vor 40 Jahren, einmal abgesehen davon, dass die DDR schon am 13.
April 1950 diplomatische Beziehungen zu der Mongolischen Volksrepublik aufge-
nommen hatte.
Deutschstämmige Wissenschaftler waren – wenn auch in russischem Auftrag – an der
Erforschung Sibiriens beteiligt und sammelten erste Informationen zur Mongolei4. Zu
nennen sind hier vor allem die bekannten Gelehrten Daniel Gottlieb Messerschmidt
(1685–1735) (dazu Brentjes 1990), Johann Georg Gmelin (1709–1755) (Dahlmann 1999)
und Peter Simon Pallas (1741–1811). Den größten Bekanntheitsgrad nicht nur unter
Archäologen besitzt der Berliner Turkologe Friedrich Wilhelm Radloff (1837–1918),
der u. a. die berühmte Orchon-Expedition im Auftrag der Russischen Akademie der
Wissenschaften in Sankt Petersburg 1891 leitete (Radloff 1892/1899). Ihm und seinem
Team verdanken wir grundlegende Kenntnisse zu den Denkmälern im Orchontal
und im Altai, die bis heute noch nicht überholt sind.
Die erste von deutschen
Institutionen finanzierte und
von dem Mongolisten und
Sinologen Erich Haenisch
(1880–1966) unternommene
wissenschaftliche Expedi-
tion ist für 1928 zu vermel-
den (Abb. 1). Der Leipziger
Lehrstuhlinhaber für Ost-
asiatische Philologie wurde
von der Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft,
dem Vorläufer der DFG, mit
11.000 Reichsmark gefördert. Anscheinend geht diese Reise auf eine Vereinbarung
zwischen dem Burjaten Ceveen Žamsranov, der das 1921 gegründete Institut für
Schrifttum – den Vorgänger der Akademie der Wissenschaften – leitete und zugleich
stellvertretender Innenminister war, und dem deutschen Botschaftsrat Rudolf Asmis
(1879–1945) zurück, die im Jahr 1922 u. a. vereinbart hatten, eine archäologische
Expedition in die Mongolei zu entsenden (Budbayar 2009, 91). Haenisch unterstützte
3 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2012/03/120329-
Staatsbankett-Mongolei.html. Zuletzt besucht am 27.07.2014. 4 Einen Überblick vermitteln die Publikationen von Kossack 1995, 18 ff.; Parzinger 2006, 31 ff.; Dahlmann
2012 sowie Heissig 1989.
Abb. 1
Bemmann
11
den Begründer der modernen mongolischen Literatur, D. Nacagdorž, während seines
Aufenthaltes in Leipzig 1927 (Budbayar 2009, 98) und hatte auch Kontakt zu den
anderen nach Deutschland entsandten mongolischen Schülern und Auszubildenden.
Auf diesem Wege gewann er sicherlich wertvolle Informationen über sein Reiseziel.
Überliefert sind von der Forschungsreise ein bisher unpublizierter Reisebericht mit
dem Titel „Reise nach Han Taischiri Ola und Uljasutai (27.VI – 26.VIII 1928)“, der sich
im Nachlass unseres langjährigen Freundes Prof. Bayar, Institut für Archäologie der
Mongolischen Akademie der Wissenschaften, befindet und die im Bundesarchiv
verwahrten Unterlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu denen ein
aussagekräftiger Abschlussbericht zählt5. Da die für Juni 1928 vorgesehene
archäologische Expedition des Wissenschaftskomitees nicht zustande kam, bekam
Haenisch den Sonderauftrag, zwei Inschriftensteine aufzusuchen, was eine
zweimonatige Reise in die Westmongolei bedeutete. Einer sollte sich in der von
Haenisch als Han Taisiri Ola bezeichneten Region bei der heutigen Stadt Altaj im
Gov’-Altaj ajmag befinden. Haenisch durchstreifte das Gebiet weiträumig bis zur
chinesischen Grenze und entdeckte eine Vielzahl an Petroglyphen, aber keine
Inschriften. Bei dem zweiten Denkmal handelte es sich um den nördlich von Uliastaj
gelegenen alttürkischen Steinpfeiler von Möngöt Khiasaan, Zavkhan ajmag, der
umgestürzt und halb in die Erde eingesunken war. Er fertigte Photos und einen
Abrieb an, die später von Albert von Le Coq veröffentlicht wurden (von Le Coq 1929;
vgl. Osawa 2009, 404 f.). In Uliastaj schloss sich Haenisch der Expedition des
russischen Geographen S. A. Kondrat’ev an und beteiligte sich an den botanischen
Sammlungen. Das Herbarium übergab er nach seiner Rückkehr dem Berliner
Botanischen Museum. Insgesamt einen Monat verbrachte Haenisch in Ulaanbaatar in
den Bibliotheken und äußerte sich begeistert über die Vielzahl an mandschurischen
Manuskripten. Auf dieser Reise erstellte Photos verwendete Haenisch für die
Bebilderung seines Beitrages „Die Mongolei – Bilder aus Alter und Neuer Zeit“ zur
Berliner Orientalistentagung im Herbst 1942 (Haenisch 1944). Erich Haenisch
übersetzte als Erster „Die geheime Geschichte der Mongolen aus einer mongolischen
Niederschrift des Jahres 1240 von der Insel Kode’e im Keluren-Fluß“, die 1941 im
Harrassowitz Verlag erschien und 1948 eine zweite Auflage erhielt. Er ist als ein
Mensch im Gedächtnis geblieben, der sich auch unter schwierigen Bedingungen für
verfolgte Kollegen einsetzte und zu seiner Meinung stand (Taube 2004)6.
In den 1930er Jahren, einhergehend mit einer Orientierung an Stalins Politik und dem
Abschluss des Geheimabkommens vom 27. Juni 1929 zwischen der MVR und der
UdSSR, schottete sich die Mongolei von den westlichen Industrienationen ab
(Barkmann 1999, 280 ff.). Die nach Deutschland zur Ausbildung geschickten Schüler,
Studenten und Erwachsenen wurden 1929 und 1930 zurück in die Mongolei beordert,
und die in der Mongolei tätigen deutschen Fachkräfte wurden in denselben Jahren
zurückgeschickt7. Folgerichtig kamen nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch
Expeditionen aus Ostblockländern in die Mongolei, wobei Forscher aus der
Sowjetunion am stärksten vertreten waren. Doch auch die DDR schickte wenigstens
5 Bundesarchiv, Bestand R 73/11424/a. 6 Zu seiner Bedeutung für die Mongolistik: Poppe 1960. 7 Die mongolisch-deutschen Beziehungen bis zu diesem Zeitpunkt beschreibt Budbayar 2009.
Bemmann
12
einmal einen Archäologen in die Mongolei. Dietrich Mania (*1938), damals frisch
diplomierter Archäologe und Aspirant am Geologisch-Paläontologischen Institut der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, bereiste 1961 gemeinsam mit dem
bekannten Mongolisten und Tibetologen Johannes Schubert (1896–1976), damals
Ostasiatisches Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig, die Mongolei und konnte
verschiedene Teile des Landes gemeinsam mit Chödöögijn Perlee (1911–1982)8, dem
mongolischen Gründungsvater der heimischen Archäologie, besuchen (Abb. 2)9.
Mania nahm eine kleinere Ausgrabung an der Wallanlage von Chürėėt Dov vor
(Mania 1963, Taf. 13,1–3; Taf. 14,10.17–18; Schubert 1963, 80) und veröffentlichte einen
guten Überblick zum Stand der archäologischen Erforschung der Mongolei (Mania
1963). Während dieser Expedition erfolgte die Entdeckung antiker Ruinen von
Rašaan dersnij balgas, dem heutigen Avraga balgas, am Nordwestufer des Avraga
Flusses, Delgerchaan sum, Chentij ajmag (Tsogtbaatar 2004, 204 f.;
Shiraishi/Miyake/Tsogtbaatar 2007, 1 f.). Seit dem Jahr 2001 nimmt ein mongolisch-
japanisches Team Ausgrabungen an diesem Platz vor, der mit dem Yeke Ordu – dem
großen Palast – von Dschingis Khan identifiziert wird (zusammenfassend:
Shiraishi/Tsogtbaatar 2009). Mania und Schubert besuchten anscheinend als erste
Europäer den 2450 m hohen Berg
„Chentei-uul“ im Chentij-Gebirge
mit seinen im chinesischen Stil
errichteten Tempeln sowie Ovoos
und Opfergaben (Schubert 1963, 96
ff.) und dokumentierten signifikante
Dachziegel aus dem 13./14. Jahr-
hundert (Mania 1963, 858 Taf. 19,7.9;
20,17; 29). Dieser prominent situierte
Berg wird mit dem Burchan Chaldun
aus der Geheimen Geschichte der
Mongolen gleichgesetzt und kann
als Begräbnisstätte von Dschingis
Khan angesehen werden (de
Rachewiltz 1997).
Von Mitarbeitern des VEB Geologische Forschung und Erkundung, Betriebsteil
Freiburg, Arbeitsstelle Leipzig, wurden zahlreiche Petroglyphen und Inschriften
während ihrer Prospektionstätigkeit in den 1960er Jahren am Südhang des Changaj-
Gebirges im Bajanchongor ajmag zwischen dem Baydrag gol im Westen und dem
Taatsyn gol im Osten entdeckt und dokumentiert. Der Geologe Dietmar Lauer
verfasste zu diesen Beobachtungen einen umfangreich bebilderten Bericht (Lauer
1972). Ebenfalls photographierte Statuen und Grabdenkmäler aus dieser Region wie
Hirschsteine und Khirigsuur10 blieben bisher unpubliziert (Lauer 2005). Außerdem
8 Zum 100. Geburtstag von Perlee sind seine gesammelten Schriften in fünf Bänden herausgegeben
worden: Ch. Perlee, Bütėėlijn Čuulgan 1-5 (Ulaanbaatar 2012). 9 Für Johannes Schubert war es nach 1957 und 1959 bereits die dritte Mongoleireise (Schubert 1963). 10 Als Khirigsuur, früher Kereksur geschrieben, etymologisch aus xirgis-ūr = Kirgisen-Grab, werden in der
Mongolei seit alters her bronzezeitliche Grabmonumente der Zeit von ca. 1400 bis 800 v. Chr. bezeichnet,
die aus einem runden zentralen Hügel bestehen, der in einem frei variierenden Abstand von einer
Abb. 2
Bemmann
13
stießen die Geologen bei ihren Erkundungen im Bajanchongor ajmag am Hang des
Cagaan Cachir uul auf Spuren prähistorischen Goldabbaus (Andreas/Gebhardt 2005,
283), wie er sich in einem veröffentlichten Rillenschlegel und einem Hammerstein
dokumentiert (Abb. 3). Diese wichtige Beobachtung ist meines Erachtens bisher von
archäologischer Seite nicht aufgegriffen worden und ist der erste direkte Beleg für
Goldgewinnung im Altertum. Umfangreich erforscht wurden von den deutschen
Geologen die Goldvorkommen in Boroo und Sudža, das heißt, in der Nähe der
xiongnuzeitlichen Siedlung (Ramseyer 2013) und des berühmten Gräberfeldes von
Noyon Uul, ca. 110 km nördlich von Ulaanbaatar. Das Potenzial dieser
Untersuchungen wurde leider bei der Bewertung der Analyseresultate der
Goldfunde aus Noyon Uul (Šackaja et al. 2011) und anderen xiongnuzeitlichen
Gräbern noch nicht genutzt, möglicherweise ließen sich auf diesem Wege Indizien
für eine lokale Produktion gewinnen. Die bisherigen Analysen legen die
Verwendung von Flussgold nahe (Radtke et al. 2013).
Einen ersten Höhepunkt der kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern
stellte die von Walter Heissig und Claudius Müller organisierte Ausstellung „Die
Mongolen“ von 1989 dar, die im Haus der Kunst in München vom 22. März bis 28.
Mai 1989 und im Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim vom 24. Juli bis 26.
November 1989 präsentiert wurde11. Die Archäologie spielte darin zwar nur eine
untergeordnete Rolle12, aber die Ausstellung weckte das Interesse an der Mongolei
nachhaltig.
Erst nach der Demokratisierung der Mongolei 1989/90 und einer stärkeren Loslösung
von der UdSSR kamen wieder Expeditionen aus den westlichen Industrienationen
ins Land, was zu einem enormen Aufschwung der Archäologie und einem deutlichen
Wissenszuwachs führte. Von deutscher Seite wird die archäologische Erforschung
der Mongolei von zwei Institutionen vorangetrieben: dem Deutschen Archäolog-
ischen Institut und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
runden oder viereckigen Steinsetzung eingerahmt wird. Diese äußerst vielgestaltigen Denkmäler
können um weitere Steinsetzungen ergänzt und um sogenannte Satelliten – Steinsetzungen, die
Extremitätenknochen eines Pferdes enthalten – erweitert werden. Khirigsuur sind in der Mongolei und
den angrenzenden Regionen zu Tausenden verbreitet. 11 Zur Ausstellung erschienen ein zweibändiger Katalog mit Essays (Heissig / Müller 1989) sowie ein
Begleitband (Eggebrecht 1989). 12 Ein knapper Überblick zur archäologischen Erforschung der Mongolei (Stand 1979) findet sich bei
Jettmar 1983, 218–220.
Abb. 3
Bemmann
14
Aktivitäten des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Die Anfänge unserer Zusammenarbeit führen in das Jahr 1997 zurück, als die
Mongolische Akademie der Wissenschaften den Wunsch übermittelte, deutsche
Archäologen möchten Ausgrabungen in der altmongolischen Hauptstadt Karakorum
aufnehmen, um im Hinblick auf das 800. Jubiläum der Reichsgründung durch
Dschingis Khan im Jahr 2006 den Kenntnisstand über die erste Hauptstadt des
mongolischen Weltreiches zu verbessern.
Unser Institut hat diese
herausragende Möglich-
keit, an einem der promi-
nentesten Plätze in der
Mongolei forschen zu dür-
fen, mit Begeisterung er-
griffen. Gemeinsam mit
dem Deutschen Archäo-
logischen Institut erfolgte
1998 eine erste Besich-
tigung des Stadtareales,
und noch im selben Jahr
konnte am 18. September
ein Abkommen der drei
Partner (Mongolische Aka-
demie der Wissenschaften, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
Deutsches Archäologisches Institut) zur Zusammenarbeit im Beisein des deutschen
Bundespräsidenten Prof. Dr. Roman Herzog auf der historischen Stätte unterzeichnet
werden (Abb. 4). Der Vertrag der Mongolisch-Deutschen Karakorum Expedition
(MDKE) bildet bis heute die Basis unserer Kooperation, er wurde mehrfach
verlängert, und die MDKE genießt die Schirmherrschaft der Staatspräsidenten beider
Länder, worauf wir sehr stolz sind.
Das Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie
unter Federführung von Prof. Dr. Helmut Roth (1941–
2003)13 und seinem Grabungsleiter Dr. Ernst Pohl wählte
gemeinsam mit den mongolischen Partnern Prof. Dr.
Dovdoi Bayar (1946–2010)14 und Ulambayar Erdenebat
M.A. eine Fläche in der Stadtmitte an der in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Magistrale als Grabungsplatz aus
(Abb. 5). Ziel war es, die Stadtentwicklung anhand einer
Stratigraphie zu analysieren, Gründung und Dauer unab-
hängig von schriftlichen Quellen zu überprüfen sowie zu
ermitteln, inwieweit das Auf und Ab in der Stadtge-
schichte seinen Niederschlag in den Bauten und den
materiellen Hinterlassenschaften gefunden hat. Umfang
13 Ernst Pohl/Claudia Theune, Helmut Roth (1941–2003). Archäologisches Nachrichtenblatt 9, 2004, 181–
182. 14 Bemmann/Pohl 2010/11.
Abb. 4
Abb. 5
Bemmann
15
und Dauer der Versorgung mit Luxusgütern und mit chinesischem Geschirr müssten
– so unsere These – den Verlust des Hauptstadtstatus und den Rückgang des Fern-
handels widerspiegeln.
Die Arbeiten im Gelände und in den Labors wurden von einer interdisziplinären
Arbeitsgruppe getragen: Prof. Dr. Hans Mommsen und Dipl. Phys. Roger Renner,
Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn, nahmen in
den Jahren 1999 und 2000 in dem Südwestteil der Stadt eine großflächige geomag-
netische Prospektion vor (Mommsen et al. 2001), Dipl. Ing. Andreas Rieger, Susanne
Kühn und Michael Tisler, Fakultät für Geomatik der Hochschule Karlsruhe - Technik
und Wirtschaft, erstellten in mehrjähriger Arbeit einen vollständigen Vermes-
sungsplan und ein Höhenschichtenmodell des umwallten Stadtbereiches, Prof. Dr.
Manfred Rösch und sein Team, Universität Heidelberg und Landesamt für Denk-
malpflege Baden-Württemberg, führten die paläobotanischen Untersuchungen seit
2002 durch (Rösch et al. 2005), Prof. Dr. Angela von den Driesch (1934–2012) und Prof.
Dr. Joris Peters, Institut für Paläoanatomie und Geschichte der Tiermedizin, Ludwig-
Maximilians-Universität München, und Lkhagvadorzh Delgermaa M. A. bestimmten
die Tierknochen (von den Driesch et al. 2010), der Islamwissenschaftler Prof. Dr.
Stefan Heidemann, Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg, katalogisierte die
chinesischen und islamischen Münzen und entdeckte auf diesem Wege die früheste
Erwähnung Karakorums (Heidemann et al. 2006), Dr. Bernd Kromer und seine
Mitarbeiter vom Radiokarbon-Labor, Arbeitsstelle Radiometrische Altersbestim-
mung von Wasser und Sedimenten, Heidelberger Akademie der Wissenschaften,
nahmen konventionelle Radiokarbonbestimmungen vor, Beschleuniger-Massen-
spektrometrie (AMS)-Datierungen lieferten Dr. Thomas Uhl und seine Mitarbeiter
vom AMS C14-Labor Erlangen, das Teil des Physikalischen Instituts der Universität
Erlangen-Nürnberg ist.
Unsere Unternehmungen in Karakorum wurden finanziell gefördert vom Min-
isterium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
von 1999–2001, der Abteilung Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amtes
im Jahr 2002 und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2003 bis
2005.
Die bisherigen Auswertungen belegen, dass wir einen Ausschnitt des in den
Schriftquellen erwähnten chinesischen Handwerkerviertels erfasst haben (Bemmann
et al. 2010). Eine Vielzahl an technischen Anlagen wie Öfen und Feuerplätze sowie
Schlacke, Gusstiegel, Halbfertigprodukte, Abfälle und diverse andere Gegenstände
bezeugen Eisen- und Edelmetallverarbeitung, Glasperlenproduktion, Knochen- und
Geweihschnitzerei, Edelsteinbearbeitung und die mannigfaltige Verwendung von
Birkenrinde.
Nachdem die Stratigraphie hinreichend geklärt war, der anstehende Boden in den
meisten Grabungsschnitten erreicht und mehrere einzigartige Befundsituationen im
Handwerkerviertel dokumentiert worden waren, beendeten wir die Untersuchungen
an dieser Stelle im Herbst 2005. Zusammen mit der Eröffnung der Ausstellung
“Dschingis Khan und seine Erben” in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-
republik Deutschland in Bonn im selben Jahr, auf der erste Forschungsergebnisse
einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden konnten, markieren diese beiden
Bemmann
16
Ereignisse das Ende der ersten Phase unserer Forschungen
in der Mongolei15. Der opulente Begleitband zur Ausstel-
lung liegt inzwischen in mongolischer Übersetzung vor16.
Für Karakorum steht seither die Aufarbeitung, Analyse und
Publikation der umfangreichen archäologischen Hinterlas-
senschaften sowie der komplexen, bis zu 5 m mächtigen
Stratigraphie im Vordergrund. So konnte beispielsweise
2008 ein wichtiges Depot aus dem Werkstattareal Dank
einer Zuwendung der Deutschen Stiftung Welterbe in
Wismar von Helmut Biebler, Mühlhausen in Thüringen,
restauriert werden (Abb. 6).
Einen ersten umfangreichen Sammelband mit Studien zu
Karakorum veröffentlichten wir gemeinsam mit unserem
langjährigen mongolischen Partner 2010 (Bemmann et al.
2010) und durften dem Staatspräsidenten der Mongolei,
Tsakhia Elbegdorj, ein Exemplar überreichen (Abb. 7).
Momentan bearbeiten zwei Nachwuchswissenschaftler besonders aussagekräftige
Aspekte aus unseren Ausgrabungen. Gonchigsüren Nomguunsüren, Institut für
Archäologie der Mongolisch-
en Akademie Wissenschaften,
beschäftigt sich mit der lokal
produzierten grauen Dreh-
scheibenware und Susanne
Reichert, Universität Bonn,
analysiert die Hinterlassen-
schaften der Handwerksbe-
triebe in einem Dissertations-
projekt.
Unsere Forschungen in Karakorum zeigten uns deutlich, dass sich solch ein Platz
zentraler Bedeutung – eine Stadt in der mongolischen Steppe – nur verstehen lässt,
wenn das Umland einbezogen wird und ein landschaftsarchäologischer Analysean-
satz gewählt wird. Es muss das mittlere Orchontal als herrschaftslegitimierende
15 Stationen der Ausstellung waren: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn, 16. Juni bis 25. September 2005, Staatliches Museum für Völkerkunde München, 26. Oktober bis
29. Januar 2006, Schloss Schallaburg, Österreich, 31. März 2006 bis 01. November 2006, Sakip Sabanci
Museum, Istanbul, 07. Dezember 2006 bis 08. April 2007, Ungarisches Nationalmuseum, Budapest, 24.
Mai 2007 bis 02. September 2007. Die Ausstellung diente zudem als Blaupause für ein gleichartiges
Vorhaben, das seinen Anfang im Museum of Natural Science, Houston vom 27. Februar bis 7. September
2009 nahm und folgende Stationen umfasste: Denver Museum of Nature & Science, September 2009 bis
Januar 2010, San Jose Tech Museum, Mai bis Oktober 2010, Singapore ArtScience Museum at Sands
Point, Dezember 2010 bis Mai 2011, Irving Arts Center, Texas, 01. Juni bis 30. September 2011, North
Carolina Museum of Nature & Science, Raleigh, November 2011 bis Januar 2012, The Field Museum,
Chicago, Illinois, Februar bis September 2012, The Fernbank Museum of Natural History, Atlanta,
Oktober 2012 bis Januar 2013. 16 Die Übersetzung, ein Gastgeschenk von Bundespräsident Horst Köhler, konnte 2010 von Botschafter
Pius Fischer dem Staatspräsidenten Elbegdorj überreicht werden.
Abb. 6
Abb. 7
Bemmann
17
Region dreier großer Reiche mit seiner einzigartigen
Konzentration an zentralen Orten als Ganzes in den
Blick genommen werden. Um diesen Fragestellung-
en verstärkt nachgehen zu können, haben wir das
Projekt „Geoarchäologie in der Steppe“ in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR, Prof. Dr. Martin Oczipka,
Dipl. Geol. Frank Lehmann), dem Institut für Pho-
tonische Technologien Jena (IPHT, Dr. Sven Linzen),
der Geophysik der RWTH Aachen (Dr. Norbert
Klitzsch, Christoph Grützner) und den Geographen
der Freien Universität in Berlin (Prof. Dr. Brigitta
Schütt, Riccardo Klinger) ins Leben gerufen. Vom
Institut für Archäologie der Mongolischen
Akademie der Wissenschaften begleiteten
Lkhagvadorj Munkhbayar M.A. und Gončigsüren
Nomguunsüren M.A. das Vorhaben. Der Schwer-
punkt des Projektes lag auf der Analyse der Mensch-
Umwelt- und der Stadt-Umland-Beziehungen, in
der Annahme, dass im hochsensitiven Ökosystem
Steppe eine hohe Bevölkerungsdichte und urbane
Zentren deutliche Spuren in den Bodenarchiven
hinterlassen haben müssen. Aus diesen Frage-
stellungen ergab sich, dass insbesondere die Zeit der
Reichs- und Staatsbildungen (3. Jahrhundert v. Chr.
bis 14. Jahrhundert n. Chr.), die Zeit von den Xiongnu bis zum Weltreich der
Mongolen, von Interesse war. Ein zweiter Teil des Verbundvorhabens umfasste die
Entwicklung und Verbesserung von Messinstrumenten für die schnelle und zugleich
detaillierte photogrammetrische und geophysikalische Vermessung großer Anlagen
unter schwierigen Wind-, Klima- und Infrastrukturbedingungen. Dieses vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über drei Jahre von 2008 bis
2011 in dem Förderschwerpunkt „Wechselwirkungen zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaften“ finanzierte Projekt hat unser Verständnis vom Orchontal grundle-
gend gewandelt17. Die Dominanz der uighurenzeitlichen Plätze18, mit der wir vorher
nicht gerechnet hatten, ist beeindruckend, genauso wie die unterschiedliche Nutzung
des Tales durch Türken, Uighuren und Mongolen. Um die räumliche Vernetzung der
zahlreichen neu entdeckten und dokumentierten Plätze besser analysieren und
weitere Denkmäler identifizieren zu können, erfolgte im Juni 2011 mit Mitteln der
Gerda Henkel Stiftung eine Luftprospektion eines 51,2 km langen und 15 km breiten
Streifens von insgesamt 714 km2 Größe in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR, Prof. Martin Oczipka) und der Firma Geosan LLC
17 Bemmann/Munkhbayar 2010; Bemmann et al. 2011; Bemmann 2011; Grützner et al. 2012; Bemmann et
al. 2014. 18 Diese Erkenntnisse werden in einem von der Gerda Henkel Stiftung geförderten Projekt von Dr. Ts.
Odbaatar, Nationalmuseum für Geschichte in Ulaanbaatar, vertieft werden können, der in Kooperation
mit meinem Institut in den kommenden beiden Jahren eine Neuaufnahme aller Hinterlassenschaften aus
dem Uighurischen Reich erstellen will.
Abb. 8
Bemmann
18
(Director Ikhbayar) in Ulaanbaatar. Hierbei konnte ein Gebiet, das von Karakorum
im Süden bis zu Dojtyn Balgas im Norden reicht, auf der westlichen Seite des
Orchontales vollständig abgedeckt werden (Abb. 8).
Aufgrund der umfassenden Übersicht und der Registrierung einer beeindruckenden
Vielfalt an Geländedenkmälern im mittleren und oberen Orchontal sowie die erst
jetzt mögliche genaue Einschätzung ihres wissenschaftlichen Potenzials während
dieses dreijährigen Surveyprojektes entstand die Idee zu drei neuen Forschungsvor-
haben. Ein erstes Projekt – wiederum gefördert von der Gerda Henkel Stiftung –
knüpft an die Forschungen in Karakorum an und nimmt insbesondere eine knapp 5,5
km südwestlich der altmongolischen Hauptstadt gelegene offene Siedlung mit
Hinweisen auf zahlreiche Produktions-
stätten ins Visier. Die zuerst mit dem
SQUID-System geomagnetisch prospek-
tierte Siedlung konnte gezielt durch
Grabungen erkundet werden. Hervor-
zuheben sind die Lokalisierung eines
großen Töpferofens vom Drachen-Typ,
eines Ofens zum Verhütten von Eisenerz
und ein dendrochronologisches Datum
von 1237 einer Bodenplanke aus einem
Grubenhaus (Pohl et al. 2012;
Mönchbajar et al. 2013). Letztere belegt
die Gleichzeitigkeit mit der Gründung
Karakorums; im selben Jahr errichtete
Ögödei Qaghan (1229-1243) seinen bei
Dojtyn Balgas gelegenen Frühlingspa-
last im Orchontal. Diese Ausgrabungen
verdichten unsere Informationen zu
Technologietransfer und Produktions-
bedingungen zur Zeit des mongolischen
Weltreiches erheblich.
Zwei weitere Projekte, gefördert von der DFG und der Gerda Henkel Stiftung, zielen
darauf ab, die Fülle an steinernen Grabdenkmälern der Bronze- und Eisenzeit im
Orchontal zu datieren und zu klassifizieren, die Abfolge der unterschiedlich
detailliert ausformulierten archäologischen Kulturen, die mit den Grabbauten
verbunden werden, zu klären sowie ihr Verhältnis zueinander bzw. die ihnen
zugrunde liegenden wissenschaftlichen Konzepte zu beleuchten. Dafür haben wir
gemeinsam mit Dr. Chimiddorzh Yeruul-Erdene und Zham’ian-Ombo Gantulga
M.A. drei dicht beieinander liegende Plätze im oberen Orchontal ins Visier
genommen: Majchan tolgoj-OOR 96 ist charakterisiert durch Ecksteinkurgane,
Khirigsuur, Steinplattengräber und noch nicht eindeutig klassifizierbare Steinset-
zungen und -pflaster, in Ar Bulan-OOR 213 dominieren Steinplattengräber und Ar
Bulan-OOR 226 kennzeichnen runde Grabeinfassungen aus der Epoche der Xiongnu
(Erööl-Erdene/Gantulga 2012). Die für die Mongolei in weiten Teilen untypische hohe
Konzentration an Denkmälern auf kleinem Raum, die zudem eine erstaunlich große
Varianz aufweisen und alle bekannten Formen abdecken, bietet eine hervorragende
Abb. 9
Bemmann
19
Ausgangssituation für eine intensivere Analyse des komplexen Totenrituals.
Besondere Berücksichtigung finden in diesen beiden Projekten Fragestellungen der
Bioarchäologie und der Landschaftsarchäologie. Die rituelle Gestaltung der Land-
schaft und die Konzeption der Gräberfelder und einzelner Grabstätten als Orte der
Erinnerung sowie die damit einhergehende Umgestaltung und/oder Erweiterung der
Monumente wurden als Forschungsfragen in der Mongolei bisher noch nicht
adressiert.
Mit den Forschungen zur Bronze- und Eisenzeit haben wir in den letzten Jahren ein
zweites Standbein ausgebildet, in das sich die Beteiligung an dem von der Gerda
Henkel Stiftung finanzierten Projekt „Erforschung des Äneolithikums und der
älteren Bronzezeit im Mongolischen Altaj“ unter Leitung von Prof. Dr. Tsagaan
Turbat nahtlos einfügt (Turbat et al. 2012; Hollard et al. 2014).
Langfristig ist es unser Bestreben, durch mehrere regionale Analysen die
archäologischen Kulturen der Bronze- und Eisenzeit in der Mongolei in ihrer
Diversität und ihren unterschiedlichen Verbindungen detaillierter zu erfassen,
regionale Abfolgen zu erarbeiten und die Kulturmodelle zu überprüfen. Daher
unterstützen wir die 14C-Analysen von Proben aus Gräberfeldern dieser Zeitstellung,
die bei Rettungsgrabungen untersucht wurden, um ein dichteres Raster an absoluten
Daten zu gewinnen und die Forschungen unserer mongolischen Freunde zu fördern.
Außerdem gilt unser Interesse generell der naturwissenschaftlichen Datierung von
Komplexen aus frühgeschichtlichen, bisher vornehmlich historisch datierten
Epochen, um unabhängig von Schriftquellen Einblicke in Kontinuität und Wandel
der archäologischen Kultur zu erhalten. Beispielhaft sei ein Projekt aufgeführt, das
auf die Gewinnung einer archäologischen absoluten Datierung der bisher historisch
datierten Epoche des Xiongnu Reiches zielte und in dem 53 Proben von 16
Fundplätzen 14C-datiert werden konnten (Brosseder/Yeruul-Erdene 2011; Brosseder
et al. 2011). Ein Begleiteffekt war über die vergleichende Betrachtung von 14C-
Datierungen verschiedener Materialien aus einem Grab und die Beachtung der
unterschiedlichen 13C-Werte die Feststellung, dass Fisch und/oder C4-Pflanzen wie
beispielsweise Hirse häufig von den Xiongnu verzehrt worden waren. Diese Vielfalt
in der Ernährung ist aus den vorhergehenden Epochen nicht bekannt (Machicek
2012).
Ergänzend zu den Feldfor-
schungen trat von 2009 bis
2012 ein Analyse- und Restau-
rierungsprojekt hinzu, dessen
außergewöhnliche Ergebnisse
und einzigartige Artefakte
uns veranlassten, in Koopera-
tion mit dem LVR-Landes-
museum Bonn und dem Institut für Archäologie der Mongolischen Akademie der
Wissenschaften die internationale Ausstellung „Steppenkrieger – Reiternomaden des
7.–14. Jahrhunderts aus der Mongolei“ zu konzipieren (Abb. 9), die nach Stationen in
Bonn, Amsterdam und Manching 2014 pünktlich zum Jubiläum der diplomatischen
Beziehungen zwischen Deutschland und der Mongolei in Ulaanbaatar gezeigt
Abb. 10
Bemmann
20
werden konnte (Bemmann 2012; Turbat 2014).
Prof. Tsagaan Turbat hatte 2008 mit seinem
Team die Inventare aus mehreren Felsgräbern
im Altaj sicherstellen und diese nachunter-
suchen können. Unter den vielen Stücken ragt
sicherlich das bisher älteste Saiteninstrument
aus der Mongolei hervor, das schon inter-
national für hohe Aufmerksamkeit gesorgt
hat (Abb. 10). Dank einer Förderung durch
die Gerda Henkel Stiftung war es erstmals
möglich, Artefakte aus Felsgräbern, die durch
ihre sensationell gute Erhaltung von
organischen Stücken bestechen und denen
daher eine hohe kulturgeschichtliche
Bedeutung zukommt, umfassend von einem
Restauratorenteam im LVR-Landesmuseum
Bonn unter Leitung von Frau Regina Klee
untersuchen zu lassen. Dieses Projekt konnten wir Dank einer Zuwendung des BMBF
noch ergänzen um Textilfunde aus Duguj Cachir – darunter der älteste erhaltene
Filzkaftan aus der eurasischen Steppe (Piecuch 2013) – und um die Artefakte aus
einem mongolenzeitlichen Felsgrab, das unter Leitung von Gonchigsüren
Nomguunsüren und unter Beteiligung Bonner Archäologen im Sommer 2010
untersucht werden konnte. Ein wichtiges Anliegen war es, den möglichen Zugewinn
an Erkenntnis durch aufwendige Restaurierungen und naturwissenschaftliche
Analysen beispielhaft zu verdeutlichen. So wurden zum ersten Mal tauschierte
Eisenartefakte aus der alttürkischen Zeit entdeckt, und die hier untersuchten
mongolenzeitlichen Pfeilschäfte entpuppten sich als Kompositschäfte, bestehend aus
Bambus sowie einem Endstück aus Birken- oder Weidenholz. Damit sind nur zwei
Beispiele genannt, die eindrucksvoll den Nutzen naturwissenschaftlicher Analysen
belegen.
Ein besonderes Bedürfnis ist uns der Erkenntnis-
austausch über die aktuellen archäologischen For-
schungen in der Mongolei und den Nachbarre-
gionen auf internationalem Niveau. Dazu haben
wir 2007 die erste große internationale Tagung
„Current Archaeological Research in Mongolia“
in Ulaanbaatar organisiert (Abb. 11a) und ihre
Ergebnisse 2009 publiziert (Bemmann et al. 2009).
Erstmals steht jetzt in englischer Sprache ein
Überblick zu den Forschungen in der Mongolei
zur Verfügung. 2008 schloss sich eine in Ko-
operation mit der University of Pennsylvania
organisierte Tagung an, die sich speziell der
Epoche des Xiongnu Empire gewidmet hat (Abb.
11b). Diesem Zeitabschnitt galten bisher die mei-
sten archäologischen Expeditionen, und er steht
Abb. 11a
Abb. 11b
Bemmann
21
seit langem im Blick der inter-
nationalen Forschung. Zum 2220-
jährigen Jubiläum der Gründung
des Xiongnu Empire konnten wir
die gedruckten Beiträge dieser
Tagung unseren mongolischen
Partnern und Freunden präsentier-
en (Brosseder/Miller 2011). Für die
Veröffentlichung der Tagungsbei-
träge und unserer Forschungen
haben wir eine eigene Reihe ins
Leben gerufen: „Bonn Contribu-
tions to Asian Archaeology –
BCAA“, in der bisher fünf Bände
erschienen sind und deren Beiträge
sich ausschließlich des Englischen
als der lingua franca der archäo-
logischen und historischen Wissen-
schaft in diesem Erdteil bedienen.
Den binationalen Wissenschaftleraustausch konnten wir Dank stetiger Förderung
durch den DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) kontinuierlich
ausbauen19. Mit Hilfe eines langjährigen Promotionsstipendiums des DAAD wurde
2009 Herr Ulambayar Erdenebat von der Philosophischen Fakultät der Universität
Bonn promoviert (Erdenebat 2009) (Abb. 12). Jetzt hat er die angesehene Position
eines Full-Professors an der Nationaluniversität der Mongolei in Ulaanbaatar inne.
Promotionsstipendien des DAAD erhielten weiterhin die beiden Nachwuchs-
wissenschaftler Lkhagvadorj Munkhbayar M.A. und Gonchigsüren Nomguunsüren
M.A. (Abb. 13). Letzterer war zuvor schon durch ein Heimatlandstipendium der
Gerda Henkel Stiftung gefördert worden. Von deutscher Seite aus erhielten Birte
Ahrens M.A. (2010) und Susanne Reichert M.A. (2011 und 2013) mehrmonatige
Stipendien, um in der
Mongolei ihre Promo-
tionsthemen verfolgen
zu können. Gleichfalls
wurden die beiden
Bachelorarbeiten von
Thomas Pabst (2010)
und Annette Heider
(2010) vom DAAD
durch Aufenthalte in
der Mongolei geför-
dert. Mit einem drei-
monatigen
19 Zur Rolle des DAAD und seiner Lektoren in der Mongolei: Barkmann 2007.
Abb. 12
Abb. 13
Bemmann
22
Stipendium für Wissenschaftliche Kurzaufenthalte kamen Anfang 2012 Prof. Tsagaan
Turbat und Dunbüree Batsukh M.A. nach Bonn. Weiterhin förderte der DAAD
zweimal eine Summer School für mongolische Studenten in der Mongolei (2006 und
2009) und einmal ein Studienpraktikum für deutsche Studierende (2009) (Abb. 14).
Die Mitarbeiter des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der
Universität Bonn kommen darüber hinaus regelmäßig in den Genuss eines Reise-
kostenzuschusses im Rahmen des Wissenschaftleraustauschprogrammes, so dass der
DAAD gerade durch seine kontinuierliche Förderung wesentlich zum Erfolg unserer
Forschungen in der Mongolei beigetragen hat, was wir in hohem Maße zu schätzen
wissen. Als erster Archäologe und Geisteswissenschaftler erhielt kürzlich Prof. Dr.
Tsagaan Turbat, Institut für Archäologie der Mongolischen Akademie der Wissen-
schaften, von der Alexander von Humboldt Stiftung ein zweijähriges Stipendium für
einen Forschungsaufenthalt an der Bonner Universität verliehen, was uns mit Stolz
und Freude erfüllt. Das Stipendium trat er nach einem Sprachkurs zum 1. Juni 2013
an.
Der räumliche Schwerpunkt und Bezugspunkt für unsere Forschungen wird auch in
Zukunft das Orchontal und insbesondere die altmongolische Hauptstadt Karakorum
bilden. Ausgehend von und vergleichend zu Karakorum soll langfristig eine syste-
matische Registrierung, Vermessung und Prospektion von Stadtanlagen, umwallten
Plätzen, Residenzen und ortskonstanten Siedlungen erfolgen. Damit einhergehend
müssten die Anfänge und Intensität der Landwirtschaft bzw. des Ackerbaus erforscht
werden, hängt dies doch mit der Versorgung größerer Menschenmassen an einem
Ort unmittelbar zusammen. Es gilt zu überprüfen, ob und in welchem Ausmaß die
Nomaden der Mongolei auf landwirtschaftliche Produkte aus ackerbautreibenden
Kulturen angewiesen waren.
Gemeinsam mit unseren Projektpartnern wollen wir auch in Zukunft internationale
Tagungen organisieren, um ergänzend zu unseren Forschungsschwerpunkten den
Wissensstand aus anderen Expeditionen und Nachbarregionen zu bündeln und neue
Perspektiven aufzuzeigen. Der bilaterale Wissenschaftleraustausch wird gleichfalls
Abb. 14
Bemmann
23
ein wichtiges Anliegen bleiben, wobei unser Hauptaugenmerk auf der Förderung des
Nachwuchses in beiden Regionen liegen wird.
Wir haben das Glück gehabt, von Beginn an mit einer Vielzahl von Partnern in der
Mongolei, in Deutschland und international kooperieren zu können. Nur so ließ sich
die Vielzahl an sehr unterschiedlichen Projekten erfolgreich verwirklichen. Dieses
langfristig angelegte, auf Vertrauen und Kompetenz basierende Netzwerk ist das
Fundament unserer Arbeit.
Das Deutsche Archäologische Institut
Das Deutsche Archäologische Institut (DAI), eine Organisationseinheit des
Auswärtigen Amtes, ist die zweite wissenschaftliche Einrichtung, die sich der
archäologischen Erforschung der Mongolei von deutscher Seite aus widmet und
speziell dafür eine Referentenstelle in der Kommission für die Archäologie
Außereuropäischer Kulturen mit Sitz in Bonn eingerichtet hat. Unsere gemeinsamen
Wurzeln liegen in der oben erwähnten Mongolisch-Deutschen Karakorum
Expedition begründet. Das DAI und der langjährige Projektleiter Dr. Hans-Georg
Hüttel legten ihren Arbeitsschwerpunkt in Karakorum auf die Frage nach der
genauen Lokalisierung des Palastes von Ögödei und der anderen Herrscher
(zusammenfassend Franken 2012). Diese Forschungen wurden von 2003 bis 2009
zusätzlich von der DFG finanziert. In einem zweiten großangelegten Projekt begann
2007 die Erforschung der uighurischen Hauptstadt Karabalgasun, die von 2009 bis
2011 von der Gerda Henkel Stiftung gefördert wurde. Aufsehen erregte die Vermes-
sung der über 32 km2 großen Stadtanlage durch einen Laserscan vom Flugzeug aus;
diese moderne Technik kam hier erstmals in der Mongolei zum Einsatz. Die
Quintessenz seiner Forschungen im Orchontal fasste Hüttel, der 2011 in den
Ruhestand trat, in einer Broschüre zusammen, die anlässlich einer Photoausstellung
in der Deutschen Botschaft in Ulaanbaatar 2009 gedruckt wurde und sein Schriften-
verzeichnis enthält (Hüttel/Erdenebat 2009). Neue Akzente setzt Dr. Christina
Franken, die Nachfolgerin von Herrn Hüttel. So kann Dank einer Förderung durch
die Gerda Henkel Stiftung seit 2013 ein mongolischer Restaurator am LVR-Landes-
museum Bonn in modernsten Verfahren zum Erhalt archäologischen Kulturguts
ausgebildet werden. Zum Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern wird die Sicherung und auch für Besucher attraktive Herrichtung
des Tempelfundaments in Karakorum im Rahmen eines vom Auswärtigen Amt und
der Gerda Henkel Stiftung finanzierten Projektes durchgeführt. Zugleich wird die
Erforschung von Karabalgasun und Karakorum fortgesetzt (Franken 2013; Franken
2014).
In einem eigenen DFG-Projekt nahmen die Architekten Prof. Dr. Andreas Brandt und
Dr.-Ing. Niels Gutschow 2001 in Kooperation mit Hüttel eine Bauaufnahme des Klo-
sters Erdene Zuu vor und veröffentlichten ihre Ergebnisse zeitnah (Brandt/Gutschow
2003). Außerdem erarbeiteten sie ein Konzept für einen Museumsbau über den 2000
ergrabenen eindrucksvollen großen Ofenanlagen, das bedauerlicherweise nicht
weiter verfolgt wurde (Hüttel 2002, 306).
Als akademischer Lehrer – die Universität Bonn hatte Hans-Georg Hüttel im Jahr
2000 eine Honorarprofessur verliehen, um die Archäologie Innerasiens in der Lehre
vertreten zu wissen – hat er Abschlussarbeiten zu Themenkomplexen aus seinen
Bemmann
24
Projekten an verschiedenen Universitäten und unter Betreuung mehrerer Kollegen
angeregt. An der Humboldt-Universität Berlin wurde Eva Becker mit dem Thema
„Die altmongolische Hauptstadt Karakorum – Forschungsgeschichte nach his-
torischen Aussagen und archäologischen Quellen“ 2007 promoviert und konnte ihre
Arbeit im selben Jahr als Band 39 der Reihe „Internationale Archäologie“ im Verlag
Marie Leidorf, Rahden/Westfalen publizieren. Ulambayar Erdenebat gelang es 2009,
mit der Schrift „Altmongolisches Grabbrauchtum – Archäologisch-historische Unter-
suchungen zu den mongolischen Grabfunden des 11. bis 17. Jahrhunderts in der
Mongolei“ an der Universität Bonn promoviert zu werden. Christina Franken
bearbeitete in ihrer 2012 abgeschlossenen Dissertation „Die Befunde der ‚Großen
Halle’ von Karakorum. Die Ausgrabungen im sogenannten Palastbezirk“20. Noch
nicht abgeschlossen ist die Arbeit von Eva Chandler, „Plastischer Dekor aus der
‚Großen Halle’ in Karakorum“, die damit an ihre 2007 erstellte Magisterarbeit „Die
Wandmalereifragmente aus dem ‚Palastbezirk’ von Karakorum“ anknüpft. Burkart
Dähne, der von Hüttel als örtlicher Grabungsleiter in Karabalgasun eingesetzt
worden war, erhielt ein Promotionsstipendium der Gerda Henkel Stiftung verliehen,
in dem er „Die archäologischen Ausgrabungen der uigurischen Hauptstadt Kara-
balgasun im Kontext der Siedlungsforschung spätnomadischer Stämme im östlichen
Zentralasien“ an der Universität in Leipzig erforscht.
Den höchsten Bekanntheitsgrad haben jedoch nicht die Forschungen im Orchontal
erzielt, sondern ein anderes Projekt des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI).
Nicht zuletzt aufgrund eines mehrfach ausgestrahlten Films im Fernsehen und der
hervorragend besuchten Ausstellung „Im Zeichen des Goldenen Greifen – Königs-
gräber der Skythen“21 sind die von Hermann Parzinger, damals Präsident des DAI,
gemeinsam mit russischen und mongolischen Kollegen betriebenen Forschungen zu
skythenzeitlichen Kurganen in den Hochgebirgstälern des mongolischen Altaj einer
Vielzahl von Mongolen und Deutschen eng vertraut. Dank einer Eislinse in der 2006
untersuchten, außergewöhnlich gut erhaltenen hölzernen Grabkammer von Kurgan
10 in Olon Güurin gol, Bajan-Ölgii ajmag, haben sich die hölzernen Ausrüstungs-
gegenstände und die Kleidungsteile sensationell perfekt konserviert (Parzinger 2008;
Parzinger et al. 2009; Molodin et al. 2012).
Besonders hervorzuheben ist die Einrich-
tung einer Forschungsstelle des DAI in
Ulaanbaatar, die am 21. August 2007 er-
öffnet wurde und von der viele im Land
tätige Wissenschaftler profitieren dürfen
(Abb. 15). Damit wird von deutscher Seite
das auf Langfristigkeit angelegte Engage-
ment unterstrichen.
20 Dissertation, Universität Bonn 2012, online zugänglich unter urn:nbn:de:hbz:5-28682. 21 Die Ausstellung hatte drei Stationen: Berlin, Martin-Gropius-Bau: 6. Juli bis 1. Oktober 2007; München,
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung: 26. Oktober 2007 bis 20. Januar 2008; Hamburg, Museum für Kunst
und Gewerbe: 15. Februar bis 25. Mai 2008.
Abb. 15
Bemmann
25
Ausblick
Die deutsch-mongolischen Kooperationsprojekte auf dem Gebiet der Archäologie
gehören sicherlich mit zu den erfolgreichsten und vielschichtigsten Unternehmungen
der umfassenden Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Sie haben zudem die
Mongolei für ein breites Publikum in Deutschland interessant gemacht. Wir betreiben
nicht nur die auf Erkenntnisgewinn zielenden Expeditionen, sondern engagieren uns
in der Nachwuchsförderung und dem Wissenschaftleraustausch, organisieren inter-
nationale Konferenzen, entwickeln gemeinsam Konzepte für die Bewahrung des
kulturellen Erbes sowie für die Restaurierung von Artefakten, und wir präsentieren
unsere Ergebnisse publikumswirksam auf Ausstellungen.
Die archäologische Erforschung des Landes wurde durch die Gerda Henkel Stiftung
ganz wesentlich beflügelt, die zu unserer großen Freude 2008 erstmals einen
Sonderförderschwerpunkt Mongolei aufgelegt hatte, der 2011 noch einmal um drei
Jahre verlängert wurde. In Kombination mit dem Sonderprogramm Zentralasien
konnte eine Vielzahl an Projekten von Forschern mehrerer Nationen verwirklicht
werden.
Auch auf unsere Forschungen, und das gilt insbesondere für diejenige der
Hochschulen, wirkt sich das Zeitalter der Globalisierung aus. Meines Erachtens
werden in absehbarer Zeit nationale Forschungsergebnisse und -interessen stärker in
den Hintergrund rücken und Spezialisten weltweit kooperieren. In den Natur-
wissenschaften hat sich die internationale Verbundforschung schon lange etabliert,
in den Geisteswissenschaften hält sie allmählich Einzug. Durch die EU und ihre gut
finanzierten Förderprogramme, um die die Wissenschaftler konkurrieren, wird
dieser Prozess beschleunigt. Nationale Sparmaßnahmen und die demographische
Entwicklung in den europäischen Ländern werden ohnehin einen Konzentrations-
prozess einleiten. Zur Stärkung unserer Mongoleiforschungen und zur Inter-
nationalisierung der Zusammenarbeit ist mein Institut daher eine Kooperation mit
der Hebrew University Jerusalem eingegangen. Ermöglicht wurde dies durch die
Verleihung des Anneliese Maier-Forschungspreises der Alexander von Humboldt-
Stiftung an Prof. Dr. Michal Biran im Jahr 2013. Gemeinsam mit unseren mon-
golischen Partnern wollen wir beginnend im Jahr 2014 die Erforschung Karakorums
und seiner Funktionen im Mongolischen Weltreich intensiv vorantreiben.
Das Arbeiten und Forschen in der Mongolei bereitet uns außerordentlich viel Freude
und wird von uns mit ganzem Herzen betrieben. Die sprichwörtliche nomadische
Gastfreundschaft, die idealen Arbeitsbedingungen und die Offenheit unserer Partner
wissen wir sehr zu schätzen. Für die langandauernde harmonische Zusammenarbeit
mit unseren Freunden und Kollegen im Institut für Archäologie sowie den jeweiligen
Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der Mongolei und ihren General-
sekretären bedanken wir uns und blicken hoffnungsfroh in die Zukunft, die uns
weiterhin viele gemeinsame Erfolge bescheren möge.
Bemmann
26
Literatur
Andreas/Gebhardt 2005
Dieter Andreas/Rainer Gebhardt, Die Geologenexpedition 1966-1968 im Aimak Bajan
Chongor aus der Sicht des Hauptgeologen. In: Joachim Stübner/Aribert
Kampe/Reinhard Schirn (Hrsg.), Auf Goldsuche in der Mongolei. Chronik der
Geologenexpedition der DDR in der MVR (Dresden 2005) 267–296.
Barkmann 1999
Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei oder die „Mongolische Frage“. Die
Mongolen auf ihrem Weg zum eigenen Nationalstaat (Bonn 1999).
Barkmann 2007
Udo Barkmann, Wandel durch Austausch – Change by Exchange. Die Rolle des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes in den deutsch-mongolischen Wissen-
schaftsbeziehungen. In: Udo B. Barkmann (Hrsg.), Čingis Chaan und sein Erbe. Das
Weltreich der Mongolen (Ulaanbaatar 2007) 201–215.
Bemmann 2011
Jan Bemmann, Was the center of the Xiongnu Empire in the Orkhon Valley? In:
Brosseder/ Miller 2011, 441–461.
Bemmann 2012
Jan Bemmann (Hrsg.), Steppenkrieger – Reiternomaden des 7.-14. Jahrhunderts aus
der Mongolei (Darmstadt 2012).
Bemmann/Munkhbayar 2010
Jan Bemmann/Lkhagvadorj Munkhbayar, Im Zentrum der Steppenreiche.
Archäologie in Deutschland 2010, Heft 3, 14–18.
Bemmann/Pohl 2010/11
Jan Bemmann/Ernst Pohl, Dovdoi Bayar (11. Mai 1946–10. November 2010).
Mongolische Notizen. Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft 19,
2010/2011, 71–72.
Bemmann et al. 2009
Jan Bemmann/Hermann Parzinger/Ernst Pohl/Damdinsurengin Tseveendorj (Hrsg.),
Current Archaeological Research in Mongolia. Papers from the first International
Conference on „Archaeological Research in Mongolia“ held in Ulaanbaatar, August
19th–23rd, 2007. Bonn Contributions to Asian Archaeology 4 (Bonn 2009).
Bemmann et al. 2010
Jan Bemmann/Ulambayar Erdenebat/Ernst Pohl (Hrsg.), Mongolian-German
Karakorum-Expedition Vol. 1: Excavations in the Craftsmen-Quarter at the Main
Road. Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen 8 (Wiesbaden
2010).
Bemmann
27
Bemmann et al. 2011
Jan Bemmann/Birte Ahrens/Christoph Grützner/Riccardo Klinger/Norbert Klitzsch
/Frank Lehmann/Sven Linzen/Lkhagvadorj Munkhbayar/Gonchigsuren
Nomguunsuren/Martin Oczipka/Henny Piezonka/Brigitta Schütt/Solongo Saran,
Geoarchaeology in the Steppe – First results of the multidisciplinary Mongolian-
German survey project in the Orkhon valley, Central Mongolia. Studia Archaeologica
30, 2011, 69–97.
Bemmann et al. 2014
Jan Bemmann/Thomas O. Höllmann/Birte Ahrens/Thomas Kaiser/Shing Müller, A
Stone Quarry in the Hinterland of Karakorum, Mongolia, with Evidence of Chinese
Stonemasons. Journal of Inner Asian Art and Archaeology 6, 2014.
Brandt/Gutschow 2003
Andreas Brandt/Niels Gutschow, Erdene Zuu. Zur Baugeschichte der Klosteranlage
auf dem Gebiet von Karakorum, Mongolei. Beiträge zur Allgemeinen und Verglei-
chenden Archäologie 23, 2003, 21–48.
Brentjes 1990
Burchard Brentjes, Daniel Gottlieb Messerschmidt. Ein Absolvent der Hallischen
Universität und ein Entdecker Sibiriens (1720–1727). In: János Harmatta (Hrsg.), From
Alexander the Great to Kül Tegin. Studies in Bactrian, Pahlavi, Sanskrit, Arabic,
Aramaic, Armenian, Chinese, Türk, Greek and Latin Sources for the History of Pre-
Islamic Central Asia. Collection of the sources for the history of pre-islamic Central
Asia Series 1, Vol. 4. (Budapest 1990) 145–213.
Brosseder/Miller 2011
Ursula Brosseder/Bryan K. Miller (Hrsg.), Xiongnu Archaeology. Multidisciplinary
Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. Bonn Contributions to Asian
Archaeology 5 (Bonn 2011).
Brosseder/Yeruul-Erdene 2011
Ursula Brosseder/Chimmidorj Yeruul-Erdene with Damdinsüren
Tseveendorj/Chunag Amartuvshin/Tsagaan Turbat/Tsend Amgalantugs and a
contribution by Michelle L. Machicek, 12 AMS-radiocarbon dates from Xiongnu
period sites in Mongolia and the problem of chronology. Arkheologiin sudlal 32,
2011, 53–70.
Brosseder et al. 2011
Ursula Brosseder/Jamsranjav Bayarsaikhan/Bryan K. Miller/Tserendorj Odbaatar,
Seven Radiocarbon dates for Xiongnu Burials in Western and Central Mongolia. Öv
Nüdelchdiin sudlal 11, 2011, 234–240.
Budbayar 2009
Ishgen Budbayar, Die mongolisch-deutschen Beziehungen in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Mongolische Notizen. Mitteilungen der Deutsch-Mongolischen
Gesellschaft 18, 2009, 73–100.
Bemmann
28
Dahlmann 1999
Dittmar Dahlmann, Expedition ins unbekannte Sibirien. Neuausgabe von: Johann
Georg Gmelin, Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis zum Jahr 1743
(Sigmaringen 1999).
Dahlmann 2012
Dittmar Dahlmann, Deutsche Forschungsreisende in Rußland vom 18. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts. In: Alexander Lewykin/Matthias Wemhoff (Hrsg.), Russen und
Deutsche - Essay-Band: 1000 Jahre Wissenschaft, Kunst und Kultur (Petersberg 2012)
316–325.
von den Driesch et al. 2010
Angela von den Driesch/Joris Peters/Lkhagvadorzh Delgermaa, Animal economy in
the ancient Mongolian Town of Karakorum. Preliminary Report on the Faunal
Remains. In: Bemmann et al. 2010, 251–269.
Dschingis Khan und seine Erben 2005
Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen (München 2005).
Eggebrecht 1989
Arne Eggebrecht (Hrsg.), Die Mongolen und ihr Weltreich. (Mainz 1989).
Erdenebat 2009
Ulambayar Erdenebat, Altmongolisches Grabbrauchtum. Archäologisch-historische
Untersuchungen zu den mongolischen Grabfunden des 11. bis 17. Jahrhunderts in
der Mongolei (Bonn 2009). urn:nbn:de:hbz:5-19581.
Erööl-Erdene/Gantulga 2012
Č. Erööl-Erdene/Ž. Gantulga, Mongol-Germany chamtarsan „Orchony chöndij dech
bio-archeologijn sudalgaa“ töslijn cheerijn sudalgaa. Mongolyn Archeologi 2012, 72–
74.
Franken 2012
Christina Franken, Die Befunde der „Großen Halle“ von Karakorum. Die Ausgra-
bungen im sogenannten Palastbezirk (Diss. Universität Bonn, 2012).
urn:nbn:de:hbz:5-28682.
Franken 2013
Christina Franken, Ausgrabungen der Mongolisch-Deutschen Karakorum-
Expedition und der Mongolisch-Deutschen Orchon-Expedition in Karakorum und
Karabalgasun im Jahr 2012. Zeitschrift für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
5, 2013, 359–368.
Bemmann
29
Franken 2014
Christina Franken, Karabalgasun und Karakorum, Mongolei. Die Arbeiten der Jahre
2012 und 2013. E-Forschungsberichte des Deutschen Archäologischen Instituts
2014,1, 93–99. urn:nbn:de:0048-dai-edai-f.2014-1-7.
Grützner et al. 2012
Christoph Grützner/Jan Bemmann/Jonas Berking/Manfred Frechen/Riccardo
Klinger/Norbert Klitzsch/Sven Linzen/Sonja Mackens/Martin Oczipka/Henny
Piezonka/Susanne Reichert/Michael Schneider/Brigitta Schütt, Improving
archaeological site analysis: a rampart in the middle Orkhon Valley investigated with
combined geosciences techniques. Journal of Geophysics and Engineering 9, 2012, 1–
11.
Haenisch 1944
Erich Haenisch, Die Mongolei – Bilder aus Alter und Neuer Zeit. In: Hans Heinrich
Schaeder (Hrsg.), Der Orient in deutscher Forschung. Vorträge der Berliner
Orientalistentagung Herbst 1942 (Leipzig 1944) 126–136, Taf. 13–20.
Heidemann et al. 2006
Stefan Heidemann/Hendrik Kelzenberg/Ulambayar Erdenebat /Ernst Pohl, The First
Documentary Evidence for Qara Qorum from the Year 635/1237–8. Zeitschrift für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen 1, 2006, 93–102.
Heissig 1989
Walther Heissig, Frühe deutsche Berührungen mit der mongolischen Kultur und
Geschichte. In: Heissig/Müller 1989, 101–105.
Heissig/Müller 1989
Walther Heissig/Claudius C. Müller (Hrsg.), Die Mongolen (Innsbruck, Frankfurt am
Main 1989).
Hollard et al. 2014
Clémence Hollard/Christine Keyser/Pierre-Henri Giscard/Turbat Tsagaan/Noost
Bayarkhuu/Jan Bemmann/Eric Crubézy/Bertrand Ludes, Strong genetic admixture in
the Altai at the middle Bronze Age revealed by uniparental and ancestry informative
markers. Forensic Science International: Genetics. DOI: 10.1016/j.fsigen.2014.05.012
Hüttel 2002
Hans-Georg Hüttel, Mongolei. Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden
Archäologie 22, 2002, 303–306.
Hüttel/Erdenebat 2009
Hans-Georg Hüttel/Ulambayar Erdenebat, Karabalgasun und Karakorum – Zwei
spätnomadische Stadtsiedlungen im Orchon-Tal (Ulaanbaatar 2009).
Bemmann
30
Jettmar 1983
Karl Jettmar, Geschichte der Archäologie in Sibirien und im Asiatischen
Steppenraum. Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 5, 1983,
187–226.
Kossack 1995
Georg Kossack, Geschichte und Aufgaben der archäologischen Erforschung
Mittelasiens an der Schwelle zur frühen Eisenzeit. Eurasia Antiqua 1, 1995, 15–43.
Lauer 1972
Dietmar Lauer, Archäologische Beobachtungen aus dem Bajan-Chongor-Aimak der
Mongolischen Volksrepublik. Felszeichnungen und Inschriften. Ethnographisch-
Archäologische Zeitschrift 13, 1972, 1–37.
Lauer 2005
Dietmar Lauer, Archäologische Beobachtungen in der Mongolischen Volksrepublik.
In: Joachim Stübner/Aribert Kampe/Reinhard Schirn (Hrsg.), Auf Goldsuche in der
Mongolei. Die Geologenexpedition der DDR in der MVR (Dresden 2005) 35–43.
von Le Coq 1929
Albert von Le Coq, Stein mit Menschen- und Tier-Darstellungen aus der Mongolei.
Ostasiatische Zeitschrift N. F. 5, 1929, 249–251.
Machicek 2012
Michelle L. Machicek, Reconstructing diet, health and activity patterns in early
nomadic pastoralist communities of inner Asia. (Ph.D.) University of Sheffield,
Department of Archaeology, 2012.
Mania 1963
Dietrich Mania, Archäologische Studien in der zentralen Mongolei. Wissenschaftliche
Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 12 (2), 1963, 847–888.
Molodin et al. 2012
V. I. Molodin/G. Parcinger/D. Ceveendorž, Zamerzšie pogrebalʹnye kompleksy
pazyrykskoj kulʹtury na južnych sklonach Sajljugema (Mongol’skij Altaj) (Moskva
2012).
Mommsen et al. 2001
Hans Mommsen/ Florian Jansen/Roger Renner, Geomagnetische Prospektions-
messungen in Karakorum, Mongolei. In: Ernst Pohl/Udo Recker/Claudia Theune
(eds.), Archäologisches Zellwerk. Beiträge zur Kulturgeschichte in Europa und Asien.
Festschrift für Helmut Roth. Studia Honoraria 16 (Rahden/Westf. 2001) 71–77.
Mönchbajar et al. 2013
L. Mönchbajar/E. Püül/B. Arens, Bajangolyn amand chijsen maltlaga sudalgaa. Studia
Archaeologica 33, 2013, Fasc. 18, 263–270.
Bemmann
31
Osawa 2009
Takashi Osawa, The Cultural Relationship between Old Turkic Kingship and Deer
Image. In: Bemmann et al. 2009, 401–416.
Parzinger 2006
Hermann Parzinger, Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum
Mittelalter (München 2006).
Parzinger 2008
Hermann Parzinger, Der skythenzeitliche Krieger aus dem Eis: Neue Entdeckungen
im Mongolischen Altaj. Ergebnisse einer russisch-deutsch-mongolischen Expedition
im Sommer 2006. Dertigste Kroon-Voordracht (Amsterdam 2008).
Parzinger et al. 2009
Hermann Parzinger/Viacheslav I. Molodin/Damdinsüren Tseveendorzh, New
Discoveries in Mongolian Altai. The Warrior Grave of the Pazyryk Culture at Olon-
Güüriin-Gol 10. In: Bemmann et al. 2009, 203–220.
Piecuch 2013
Maike Piecuch, Textile archäologische Funde aus einem mongolischen
Felsspaltengrab des 11. Jahrhunderts. Erfassung und Untersuchung eines Mantels
sowie weiterer Gewandteile aus Filz. Masterarbeit, Fachhochschule Köln 2013.
Pohl et al. 2012
Ernst Pohl/Lkhagvadorj Mönkhbayar/Birte Ahrens/Klaus Frank/Sven
Linzen/Alexandra Osinska/Tim Schüler/Michael Schneider, Production Sites in
Karakorum and its Environment. A New Archaeological Project in the Orkhon
Valley, Mongolia. The Silk Road 10, 2012, 49–65.
Poppe 1960
Nikolaus Poppe, Erich Haenisch als Mongolist. Ural-Altaische Jahrbücher 32, 1960,
157–160.
de Rachewiltz 1997
Igor de Rachewiltz, Searching for Činggis Qan: Notes and Comments on Historic Sites
in Xentiǐ Aǐmag, Northern Mongolia.Rivista degli Studi Orientali 71, 1997, 239–256.
Radloff 1892/1899
Wilhelm Radloff, Atlas der Alterthümer der Mongolei. Arbeiten der Orchon-Expedi-
tion. Erste bis Vierte Lieferung (Sankt Petersburg 1892-1899).
Radtke et al. 2012
Martin Radtke/Ina Reiche/Uwe Reinholz/Heinrich Riesemeier/Maria F. Guerra,
Beyond the Great Wall: Gold of the Silk Roads and the First Empire of the Steppes.
Analytical Chemistry 85 (3), 2013, 1650–1656.
Bemmann
32
Ramseyer 2013
Denis Ramseyer (Hrsg), L’habitat Xiongnu de Boroo Gol. Recherches archéologiques
en Mongolie (2003–2008). Terra Archaeologica: Monographies de la Fondation Suisse-
Liechtenstein pour les Recherches Archéologiques à l’Étranger (FSLA/SLSA) 7 (Mainz
2013).
Rösch et al. 2005
Manfred Rösch/Elske Fischer/Tanja Märkle, Human diet and land use in the time of
the Khans – Archaeobotanical research in the capital of the Mongolian Empire, Qara
Qorum, Mongolia. Vegetation History and Archaeobotany 14 (4), 2005, 485–492.
Šackaja et al. 2011
S. S. Šackaja/I. A. Derevjagina/N. F. Glazyrina, Rezul’taty issledovanij metalličeskich
izdelij 20-go i 31-go kurganov. In: Natalʹja V. Polos’mak/Evgenij S.
Bogdanov/Damdinsüren Cėvėėndorž, Dvadcatyj Noin-Ulinskij Kurgan (Novosibirsk
2011) 152–163.
Schubert 1963
Johannes Schubert, Ritt zum Burchan-chaldun. Forschungsreisen in der
Mongolischen Volksrepublik (Leipzig 1963).
Shiraishi/Miyake/Tsogtbaatar 2006
Noriyuki Shiraishi/Toshihiko Miyake/Batmunkh Tsogtbaatar, An Outline of
Archaeological Research in 2006 at Avraga. In: Noriyuki Shiraishi (ed.), Preliminary
Report on Japan-Mongolia Joint Archaeological Expedition “New Century Project”
2006 (Niigata 2007) 1–8.
Shiraishi/Tsogtbaatar 2009
Noriyuki Shiraishi/Batmunkh Tsogtbaatar, A preliminary report on the Japanese-
Mongolian archaeological excavation at Avraga site: The great ordu of Chinggis
Khan. In: Bemmann et al. 2009, 549–562.
Taube 2004
Erika Taube, Erich Haenisch – nicht nur ein Gelehrter. Mongolische Notizen. Mit-
teilungen der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft 13, 2004, 101–108.
Tsogtbaatar 2004
Batmunkh Tsogtbaatar, “Avargyn balgas”-yn archeologijn sudalgaany tovč tojm.
Studia Archaeologica, Tom. II (XXII), fasc. 17. Ulan-Bator 2004, 204–207.
Turbat et al. 2012
Ts. Turbat/D. Batsuch/N. Bajarchüü, „Mongol Altajn chürlijn üe“ töslijn cheerijn
šinžilgeenij ažlyn tovč ür dün. Mongolyn Archeologi 2012, 45–49.
Turbat 2014
Ts. Turbat (Hrsg.), Talyn Mor’ton Dajčdyn öv Soel: VII-XIV zuuny Mongolyn chadny
oršuulgyn šilmel chereglegdechüün (Ulaanbaatar 2014).
Bemmann
33
Abbildungsverszeichnis
Abb. 1. Erich Haenisch mit einem namentlich nicht bekannten mongolischen
Begleiter 1928 in der Westmongolei (Photo: Privatbesitz).
Abb. 2. Dietrich Mania, Khödöögijn Perlee und Johannes Schubert 1961 auf dem
Süchbaatar Platz in Ulaanbaatar (Photo: Privatbesitz).
Abb. 3. Für den prähistorischen Golderzabbau verwendeter Rillenschlegel und
Hammerstein von Cagaan Cachir, Bajanchongor ajmag (nach Andreas/Gebhardt
2005).
Abb. 4. Im Beisein von Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog wird anlässlich
seines Staatsbesuches in der Mongolei am 18. September 1998 auf dem Gebiet der
altmongolischen Hauptstadt Karakorum der Vertrag für die Mongolisch-Deutsche-
Karakorum-Expedition unterzeichnet. Von rechts nach links: Prof. Dr. Baatar
Chadraa (Präsident der Mongolischen Akademie der Wissenschaften), Prof. Dr.
Wolfgang W. Wurster (Deutsches Archäologisches Institut) und Prof. Dr. Helmut
Roth (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) (Photo: Christian
Stutterheim, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bundesbildstelle
Bonn).
Abb. 5. Grabungssituation in Karakorum (Photo: Vor- und Frühgeschichtliche
Archäologie, Universität Bonn).
Abb. 6. Eine Buddha-Figur aus dem 2008 restaurierten Depotfund von Karakorum
(Photo: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Bonn).
Abb. 7. Staatspräsident Tsakhia Elbegdorj bekommt von Jan Bemmann die
Monographie zu Karakorum überreicht (Photo: Presseamt des mongolischen
Staatspräsidenten).
Abb. 8. Das mittlere Orchontal mit der Kennzeichnung des 2011 überflogenen
Gebietes (Graphik Martin Oczipka).
Abb. 9. Plakat für die Ausstellung „Steppenkrieger“ in Bonn vom 26. Januar bis 29.
April 2012 (Graphik Christoph Duntze, LVR-Landesmuseum Bonn).
Abb. 10. Musikinstrument aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. aus dem Felsgrab von
Žargalant, Chovd ajmag (Photo: Jürgen Vogel, LVR-Landesmuseum Bonn).
Abb. 11. Plakate der beiden in der Mongolei organisierten Konferenzen.
Abb. 12. Promotionsfeier für Ulambayar Erdenebat an der Universität Bonn, links
und rechts die Gutachter Prof. Veronika Veit und Prof. Jan Bemmann (Photo: Vor-
und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Bonn).
Bemmann
34
Abb. 13. Kollegen vom Institut für Archäologie der Mongolischen Akademie der
Wissenschaften zu Gast in Bonn (Photo: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie,
Universität Bonn).
Abb. 14. Teilnehmer des Studierendenpraktikums 2009 in der Mongolei (Photo: Vor-
und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Bonn).
Abb. 15. Eröffnung der Forschungsstelle des Deutschen Archäologischen Instituts am
21. August 2007 in Ulaanbaatar. Rechts Prof. Dr. Chadraa, MAS, links Prof. Dr.
Hermann Parzinger, DAI (Photo: Renate Bormann).





























![Archäologische Forschungen in Litauen bis zum Ausbruch des I Weltkrieges [Archaeological investigations in Lithuania before WW1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63171e4b831644824d035672/archaeologische-forschungen-in-litauen-bis-zum-ausbruch-des-i-weltkrieges-archaeological.jpg)