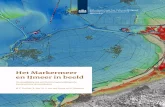BIRKA II:3 Systematische Analysen der Gräberfunde Ed. Greta Arwidsson
Historisch-systematische Überlegungen zur Sequenz seit 1600
Transcript of Historisch-systematische Überlegungen zur Sequenz seit 1600
1
Historisch-systematische Überlegungen zur Sequenz seit 16001 Johannes Menke In den letzten zehn bis 20 Jahren hat in der deutschsprachigen Musiktheorie ein Wandel in der Beschreibung von Klangfolgen im weitesten Sinn stattgefunden: Stand zuvor, pauschal gesagt, das individuelle Werk einer übergreifenden »großen Theo-rie« wie beispielsweise der Funktionstheorie, der Stufentheorie oder der Lehre Hein-rich Schenkers gegenüber, so erkannte man nun zunehmend den Einfluss standardi-sierter Klangfolgen auf tonale Werke des gesamten Repertoires, von der frühen Mehrstimmigkeit bis heute.2
Während die aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammenden »großen Theorien« stilübergreifend operieren und an Stilistik und Idiomatik zunächst genauso wenig interessiert sind wie an einer Bindung an historische Denkweisen, lässt sich mithilfe von standardisierten Klangfolgen sowohl ein engerer Kontakt zu den Werken als auch zur zeitgenössischen Theorie herstellen. Die vielfältigen Konsequenzen dieser Erkenntnis sind noch gar nicht recht ins Bewusstsein getreten. Der Werkbegriff, das Verhältnis von Komposition und Improvisation, oder besser gesagt von schriftlicher und schriftloser Musizierpraxis, das Selbstverständnis von Theorie, die analytische Interpretation müssten von Grund auf neu durchdacht werden.
Der Diskurs über standardisierte Klangfolgen, die oft auch Modelle, Topoi, Mus-ter, Formeln etc. genannt werden, hat sich in den letzten Jahren intensiviert.3 Dabei ist deutlich geworden, dass bislang weder eine einheitliche Begrifflichkeit noch eine einheitliche Systematik auszumachen ist. Dies muss im Grunde auch gar nicht weiter beklagt werden, ist es doch eine Selbstverständlichkeit des akademischen Diskurses, dass differierende Ansätze nebeneinander bestehen.
Der folgende Beitrag versteht sich als ein Versuch, die Sequenz, verstanden als eine bestimmte Form von Modellhaftigkeit, innerhalb des Generalbasszeitalters vor dem Hintergrund zeitgenössischer Lehrwerke systematisch zu erfassen. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Generalbassdenken, verstanden als Codierung eines Außen-stimmensatzes, für tonale Musik seit 1600 bis in die Gegenwart Gültigkeit beanspru-chen darf. Die skizzierte Systematik möchte, ausgehend von historischen Denkwei-
1 Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich meinem Freund und Kollegen Ludwig Holtmeier für unzählige nützliche
und anregende Hinweise. Einige der im folgenden vorgetragenen Ideen sind das Resultat unseres über zehn Jahre währenden regen Austauschs, aus dem theoretische Entwürfe und didaktische Modelle hervorgingen, die wir schon seit längerem an der Hochschule für Musik Freiburg sowie an der Schola Cantorum Basiliensis anwenden und die in diesem Artikel ihren Niederschlag finden.
2 Vgl. Aerts, »Modell« und »Topos«. 3 Kaiser, Gehörbildung, Fladt, Satztechnische Topoi sowie die Online-Ausgabe der ZGMTH (Zeitschrift der Gesell-
schaft für Musiktheorie) 4/1–2 (2007).
2
sen, einige wichtige Aspekte zur Systematik und Kombinatorik tonaler Sequenzen deutlich machen.
1. Facetten eines Phänomens: Modell, Sequenz, Rosalie, Passage, Improvisationsvorlage
Der für standardisierte Klangfortschreitungen am häufigste benutzte Begriff ist »Modell«. Dieser Terminus ist insofern zutreffend, als er den exemplarischen Cha-rakter, das Moment des Vorgefertigten und Musterhaften ausdrückt. Er ist jedoch sehr allgemein, denn modellhaft sind sehr viele Klangfortschreitungen: Ostinato-Bässe, Endigungsformeln (Kadenzen), Anfangsformeln, Modulationswege etc. Ein »Modell« muss dabei keineswegs zwangsläufig sequentiell angelegt sein. Konstitutiv für das Sequenzmodell als eine bestimmte Ausprägung von »Modell« ist das Prinzip der Versetzung. Die Sequenz ist also eine Folge4 (lat. sequi) von versetzten Fortschrei-tungen. Ob die Unterscheidung zwischen Sequenz (Folge) und Consecutive5 (Abfol-ge) notwendig ist, sei dahingestellt, das Prinzip der Versetzung gilt für beides. Die Momente der zeitlichen Abfolge, der Bewegungsrichtung, der Versetzung und deren Logik greifen also ineinander. Die entscheidende technische Operation ist die Versetzung. Durch sie kann prinzipiell jedes musikalische Gebilde sequenziert werden. Versetzt wird in der Regel eine Sekunde, eine Terz, oder selten eine Quart auf- oder abwärts, d.h. es bestehen, abgesehen von chromatischen Varianten, sechs Versetzungsmöglichkeiten: Sekunde aufwärts, Sekunde abwärts, Terz aufwärts, Terz abwärts, Quart aufwärts, Quart abwärts. Damit eine Sequenz als solche wirkt, darf sich der Vorgang des Versetzens freilich nicht nur im Bass oder allgemein in der
4 Rekurriert man auf den Bedeutungsreichtum des lateinischen Verbs sequi, so wird ohnehin deutlich, dass der
Begriff Sequenz geradezu das Konzept des Gegenstandes beinhaltet. Sequi bedeutet »folgen, begleiten, verfolgen,
sich (logisch) ergeben, von selbst folgen, zuteil werden, ein Ziel verfolgen, befolgen«.
Dies kann man als Beschreibung dessen lesen, was auch eine Sequenz ausmacht: In einer Sequenz folgt etwas
aufeinander, ein Sequenzglied begleitet das vorhergehende, man könnte aber auch sagen, es verfolgt es, dabei ergibt
sich eine logische Folge, bei der eines aus dem anderen wie von selbst folgt, dem Folgenden wird also das Vorherge-
hende zuteil, durch die Versetzung auf- oder abwärts wird aber auch ein Ziel verfolgt, oder doch zumindest eine
Richtung befolgt.
5 Der Begriff »Consecutive« rührt von der von PhilippSpitta herausgegebenen, Johann Sebastian Bach zuge-
schriebenen Generalbasslehre Vorschriften und Grundsätze zum vierstimmigen Spielen des General-Bass oder
Accompagnement für seine Scholaren in der Music (Spitta, Johann Sebastian Bach, S. 943). Die Consecutive
unterscheidet sich von der Sequenz insofern, als keine Bassfortschreitung sequenziert wird, sondern der Bass sich
sekundweise auf- oder abbewegt, wobei das Geschehen über ihm sequenziert wird (in der Regel Sextakorde bzw.
aufwärts 5-6, abwärts 7-6). Im Vergleich zu anderen Quellen ist die Unterscheidung zwischen Consecutive und
Sequenz bei Spitta/Bach jedoch eher ungewöhnlich.
3
Klangstruktur zutragen, sondern muss sich auch auf die motivisch-melodische »Oberfläche« auswirken.
Was ihre ästhetische Bewertung anbelangt, so wird gerade diese motivisch-melodische Oberfläche der Sequenz seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert zum Verhängnis. Die sequentielle Versetzung einer Phrase, v.a. sekundweise aufwärts, wird abwertend als »Rosalie«6 (Koch) oder »Schusterfleck«7 (Riepel) gebrandmarkt. Für Arnold Schönberg schließlich ist die Sequenz eine »minderwertige Konstrukti-onsmethode«8 , die als Anbiederung an einen verdorbenen Publikumsgeschmack interpretiert wird. Nichtsdestotrotz erfreut sich die Sequenz auch im 19. Jahrhundert größter Beliebtheit. Die ihr innewohnenden Effekte sind nicht gebunden an den barocken Stil. Gerade ihre Zeitstruktur musste sie auch für die klassische und roman-tische Musik attraktiv machen: Die Sequenz ist ein stetiger Übergang, weshalb sie Stil der Wiener Klassik vorzugsweise in Überleitungen und Durchführungen anzutreffen ist; sie ist im wörtlichen Sinne etwas Progressives, etwas Fortschreitendes. Wer fortschreitet, hat ein Ziel. Steigerungen lassen sich daher hervorragend mit Sequen-zen bewerkstelligen. Wer fortschreitet, durchmisst einen Raum9: daher die räumliche Assoziation, die ein sequentielles Modell auslösen kann, man denke nur an die Verwandlungsmusik aus dem ersten Akt von Richard Wagners Parsifal: »Zum Raum wird hier die Zeit«. In der Tat erfüllt die Sequenz im räumlichen Gefüge einer Kom-position die Funktion einer Passage: Man kann sich darin aufhalten, wird aber wegen ihrer Unabgeschlossenheit dazu angehalten, sich zu bewegen.
Der tonale Raum ist präformiert: Er ist durch die diatonische Skala auf eine gestalthafte Weise gerastert. Weil Diatonik nicht äquidistant ist, ist eine Versetzung zunächst keine Transposition. Das Versetzte passt sich dem gestalthaften Hinter-grund der Diatonik an und erscheint damit auf jeder Stufe in einem anderen Licht. Durch Chromatisierung, oder allgemeiner gesprochen durch den Einsatz von Akzidentien lässt sich aus jeder Sequenz aber auch eine modulierende Sequenz machen. Dabei kann die Bezugstonart einmal oder bei jeder Versetzung wechseln: Aus der Sequenz wird dann eine sequentielle Transposition (vgl. Abschnitt 7b).
Steht die Sequenz also aufgrund der eben skizzierten gesteigerten Raum- und Zeitwahrnehmung zwar offen für besondere ästhetische Erlebnisse, so steht sie in technischer Hinsicht der Genieästhetik diametral entgegen. Die Sequenz ist bere-chenbar, imitierbar, lehrbar, sie ist etwas zutiefst Rationales, ihre technische Ver-fasstheit verkörpert auf geradezu paradigmatische Weise einen produktionsästheti-schen Ansatz. So nimmt es auch kein Wunder, dass die Sequenztechnik gerade in der Improvisation bzw. schriftlosen Musizierpraxis der Vergangenheit eine eminente
6 Vgl. Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition , S. 447. 7 Vgl. Riepel, Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, S. 134. 8 Schönberg, Kriterien für die Bewertung von Musik, in: Stil und Gedanke, S. 176. 9 Vgl. Hindrichs, Der musikalische Raum.
4
Rolle einnahm. Dies beweisen sowohl Traktate, die sich mit Improvisation befassen, als auch Kompositionen, die eine Nähe zur Improvisation aufweisen, wie etwa Toccaten oder später Fantasien.
2. Herkunft: Kanonsequenzen und gemelli im contrapunto alla mente
Die sequentiellen Klangfortschreitungen des Generalbasszeitalters haben ihren Ur-sprung in Improvisationstechniken des späten Mittelalters und der Renaissance. Es handelt sich dabei einerseits um Fortschreitungen, die aus der Parallelführung in Terzen oder Sexten resultieren, und andererseits um zweistimmige Kanonsequenzen. Beide Sorten von Satzgerüsten wurden sowohl für die Improvisation, den contrapunto alla mente, genutzt bzw. sind daraus entstanden und hielten auch Einzug in Kompositionen. Gerade das Moment des Berechenbaren und Vorausschaubaren macht Sequenzen für die nicht-schriftliche Musizierpraxis besonders geeignet. Wo-möglich rührt der dem ästhetischen Gebot der varietas verpflichtete Vorbehalt gegen Sequenzen in der Komposition auch daher, dass dergleichen Sequenzen aus impro-visierten Kontrapunkten allzu bekannt waren und ihr Einsatz in der komponierten Musik nur mit einer bestimmten rhetorischen Absicht tolerabel war. 10
Hinweise auf Kanonsequenzen finden sich bei einigen Autoren11, so bei Ramos de Pareja (1482), Nicolaus Burtius (1487), im Traktat Ogni contrapunto oder bei Ugolino von Orvieto, um nur einige relevante Quellen des 15. Jahrhunderts zu nennen. Die Technik der Kanonsequenzen wird tradiert bis ins frühe 18. Jahrhundert, wird dann in die Generalbasslehre integriert und spielt in der zwar genuin italienischen, aber europaweit verbreiteten Partimento-Tradition bis ins 19. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle. Michael Dodds und Folker Froebe haben zu Geschichte, Systematik, Einfluss auf die Komposition und zur ästhetischen Beurteilung der Kanonsequenzen in jüngster Zeit wertvolle Untersuchungen beigetragen. 12
Bei Kanonsequenzen (Abb. 1a) handelt es sich um zweistimmige Gerüstsätze, die diminuiert und beliebig mehrstimmig erweitert werden können; es kann sich also um ein Oberstimmenpaar, um ein Außenstimmenpaar oder eine andere Kombinati-on handeln. Dazu können ein Cantus firmus oder frei komponierte Stimmen treten. Ebenso ist eine Potenzierung des Kanons möglich, indem sich die übrigen Stimmen ebenso am Kanon beteiligen, Beispiele hierfür finden sich zuhauf.13 Ebenso finden sich Passagen, in denen das Modell einer Kanonsequenz hindurch schimmert, ohne
10 Über die Rhetorik hinaus scheint der Einsatz sequentieller Klangfolgen aber auch das Markenzeichen der
Josquin-Generation gewesen zu sein. Vgl. hierzu: Ens, Josquin Desprez’ Deploration. 11 Vgl. Sachs, Die Contrapunctus-Lehre, S. 198f. 12 Dodds, Columbus’s Egg und Froebe, Satzmodelle des »Contrapunto alla mente«. 13 Etwa der Schlussteil der Deploration de Johan. Ockeghem von Josquin Desprez (ab Takt 118: »Josquin, Brumel,…«,
in dem eine vierstimmige Terzfall-Kanonsequenz verwendet wird, desgleichen in anderer kontrapunktischer Kombination im Dixit Dominus aus Monteverdis Marienvesper, Takt 105ff.)
5
die varietas durch zu offenkundige redicta (penetrante Wiederholungen) zu gefähr-den.14
Weitere Sequenzen entstehen aus der Parallelführung imperfekter Konsonanzen, also aus dem Gymel oder gemellus. Es handelt sich dabei um primär dreistimmige Gebilde, die wiederum diminuiert und mehrstimmig ausgebaut werden können und von Guilielmus Monachus im 15. Jahrhundert beschrieben worden sind.15 Es ist das große Verdienst von Markus Jans, in zwei Artikeln herausgearbeitet zu haben, dass sich eine regelrechte Systematik aus Klangverbindungen ergibt, die aus gemelli resul-tieren. 16 Es ist hier nicht der Ort, die sequentiellen Klangfolgen, die sich aus Kanonsequenzen und gemelli ergeben, einer differenzierten Darstellung zu unterzie-hen. Da das Interesse hier vorrangig der Sequenztypologie nach 1600 gilt, soll der Versuch unternommen werden, aus der Generalbassperspektive das »Erbe« der übernommenen sequentiellen Klangverbindungen in einer stark konzentrierten und komprimierten Fassung wiederzugeben.
Abbildung 1: Sequentielle Klangverbindungen aus dem contrapunto alla mente: a) Kanonsequenzen und b) Gemelli-Versionen
14 Eine von Palestrina gerne verwendete Technik. Man kann dies im Sanctus der Missa Papae Marcelli studieren, wo ab
Takt 66 eine Quartstieg-Kanonsequenz mehr angedeutet als durchgeführt wird. 15 Monachus, De preceptis, vgl. auch Sachs, Die Contrapunctus-Lehre, S. 232-236. 16 Jans, Alle gegen eine sowie Modale »Harmonik«. Markus Jans und Dominique Muller arbeiten seit den 1980er Jahren
an der Schola Cantorum Basiliensis mit Satzmodellen und dürften auf diesem Gebiet Pioniere gewesen sein.
6
Die Darstellung der Kanonsequenzen in Abbildung 1 erfolgt dem Usus des 15. bis 18. Jahrhunderts entsprechend nach der Größe der Intervallbewegung geordnet, wobei vorausgesetzt wird, dass jede Progression prinzipiell vorwärts wie rückwärts mög-lich ist. Synkopische Varianten, die in Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts eine große Rolle spielen, weil sie eine mehrstimmige Potenzierung ermöglichen, wurden, abgesehen von der 5-6-Folge, nicht aufgeführt. Von großer Bedeutung für die Kom-positionstechnik ist die Eigentümlichkeit, dass jede Kanonstruktur eine andere Intervallverbindung ausprägt. Damit ist jeder Intervallschritt – auch unabhängig von der Kanonsequenz – an eine nahe liegende vertikale Intervallfolge gekoppelt. Wie wir sehen werden, spielen exakt dieselben Klangfolgen als Außenstimmensätze auch später noch eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Gemelli-Varianten ist zu vermerken, dass in ihnen die zunächst einmal nicht unbedingt nahe liegende Ver-wandtschaft von Fauxbourdon, Parallelismus und Folia-Bass deutlich wird. Des Weiteren ist offensichtlich, dass sowohl die Aria della Romanesca als auch der Ostina-to-Bass des berühmten Canon per 3 Violini e Basso von Johann Pachelbel Versionen des absteigenden Teils der zweiten Gemellus-Variante sind.
3. Wandel um 1600: Außenstimmensatz und Generalbass Mit dem Aufkommen der Monodie, des Generalbasses und der seconda pratica voll-zieht sich ein kompositionstechnischer Wandel. Der Primat des Außenstimmensatzes deutet sich zwar bereits im 16. Jahrhundert an, mit dem Generalbass der Monodie wird er schließlich zum satztechnischen Paradigma schlechthin. Bass, Melodie und Generalbassziffer sind fortan die Koordinaten des musikalischen Satzes. Diese Koor-dinaten sind untereinander dergestalt verknüpft, dass die Außenstimmen einen Intervallsatz bilden, der die Generalbassziffern konstituiert und daher allein durch Bass und Bezifferung ausgedrückt werden kann. Pointiert gesagt legt die vertikale Beziehung der Melodie zum Bass eine bestimmte akkordische Füllung nahe und auf der anderen Seite provoziert die Ziffer einen bestimmten, sozusagen »idealen« Melodieverlauf. Die conditio sine qua non aber bleibt der Bass, weshalb das Wort vom »General-Bass« nur allzu treffend ist. Gleichwohl beerbt dieses neue Koordina-tensystem alte Organisationsstrukturen: Pauschal gesagt wird das komplette Inven-tar des Intervallsatzes auf den Außenstimmensatz appliziert und gleichzeitig durch die Lizenzen und Erweiterungen der seconda pratica angereichert.
Bei Christopher Simpson17, einem einflussreichen englischen Theoretiker des 17. Jahrhunderts, lässt sich trefflich studieren, wie auf elementare Weise ein musikali-scher Satz zustande kommt: Zunächst wird der Bass entwickelt (»How to frame a
17 Simpson, A Compendium, S. 37-48.
7
Bass«, S. 37), danach wird nach den Kriterien eines gut klingenden Intervallsatzes eine Melodie darüber gesetzt (»How to join a treble to the Bass«, S. 38), schließlich wird der Außenstimmensatz mit einer Stimme (»Composition of three Parts«, S. 42) oder mehr Stimmen (»Composition of four Parts«, S. 44) ausgefüllt. Den Primat der Bassstimme formuliert Simpson folgendermaßen:
In reference to Composition in Counterpoint, I must propose unto you the Bass, as the Groundwork or Foundation upon which all Musical Composition is to be erected: And from this Bass we are to measure or compute all those Distances or Intervals which are requisite for the joyning of other Parts thereto.18
Dies wird am Beginn des Jahrhunderts in Italien bereits genau so gesehen, so heißt es bei Francesco Bianciardi im Jahre 1607:
Principalmente si considerano i movimenti del Basso come fondamento della musica, che procede da una corda all’altra, salendo in cinque modi, e discen-dendo in altri cinque, come nell’esempio.19
Es folgen die »cinque modi«, also die fünf Arten der Bassbewegung (jeweils auf und abwärts): Sekunde, Terz, Quarte, Quinte und Sexte. Gemäß dieser (bereits seit dem 16. Jahrhundert üblichen) Anordnung werden im 17. Jahrhundert auch Sequenzie-rungen der Bassbewegungen angeordnet. Man verwendete allerdings nicht den Terminus »Sequenz«: Spiridionis spricht von »Cadenzen« (1670)20, Georg Muffat (1699) vermeidet einen Begriff und führt verschiedene »Manieren« vor, mit denen der lediglich technisch beschriebene Bassverlauf mit »Grieffen« zu nehmen sei21, Fedele Fenaroli spricht, ähnlich wie Bianciardi 170 Jahre vor ihm, von den »Movimenti del Partimento« (1775)22 und Cherubini23, dessen zahllose Diminutionen an Spiridionis erinnern, spricht schon im Titel nur von »Marches«, also »Gangarten«, ein französisches Pendant zu den »Movimenti«. Die Tatsache, dass kein eigener Begriff für sequentielle Fortschreitungen benutzt wurde, indiziert die Selbstverständ-lichkeit solcher Klangverbindungen: Das Sequenzmodell ist der Normalfall bzw. es dient dazu, auf exemplarische Weise die Organisation von Klangverbindungen zu verdeutlichen. Fenaroli unterscheidet klar zwischen drei Klassen der Klangverbin-
18 Ebda., S. 30. 19 Bianciardi, Breve Regola, S. 5: »Man kann grundsätzlich die Bewegungen de Basses als Fundament der Musik
ansehen; dieser schreitet von einem Ton zum anderen fort, indem er auf fünf Arten auf- und auf andere fünf Arten absteigt, wie im folgenden Beispiel.«
20 Spiridionis, Nova Instructio, S. XXV. 21 Muffat, Regulae concentum Partiturae, S. 49 22 Fenaroli, Regole musicali, S. 23. 23 Cherubini, Marches d’harmonie, S. 1
8
dung: Kadenz (Cadenza), Oktavregel (von Fenaroli einfach »Scala« genannt), Se-quenzen (»Movimenti«). Die Darstellung letzterer nimmt den breitesten Raum der Darstellung ein, rund zwei Drittel der Regole ist ihrer Vorführung gewidmet.
4. Systematik I: Konsonante Sequenzen Wie viele und welche »Movimenti« gibt es nun? Hier unterscheiden sich die Quellen. Da es nicht allein um Kombinatorik, sondern im Verlauf des Barockzeitalters zu-nehmend um die Vermittlung eines bestimmten Idioms geht, wird in didaktischen Schriften nie die gesamte Palette an Möglichkeiten ausgeschöpft. Die heutige Musik-theorie kann sich aber dazu angehalten fühlen, gemäß den Prämissen der histori-schen Quellen eine eigene, möglichst erschöpfende Systematik zu erstellen. Das folgende Schema (Abb. 2) orientiert sich an der üblichen Anordnung, setzt – auch gemäß der historischen Praxis – immer die Krebsläufigkeit mit ein und berücksich-tigt (zunächst) nicht die metrische Gewichtung, auch nicht Synkopationen, sie unter-scheidet nicht, wie manche Quellen (etwa Fenaroli) zwischen Terzfall und Sextstieg respektive Sextfall und Terzstieg, da diese Unterscheidung aufgrund gleicher Klang-folgen redundant erscheint.
Abbildung 2: Systematik möglicher Sequenztypen.
9
Gemäß der historischen Praxis wird in der Systematik nicht zwischen Quintstieg und Quartfall, Quintfall und Quartstieg etc. unterschieden. Je größer der sequenzierte Sprung ist, desto mehr Möglichkeiten der Sequenzierung ergeben sich: Der Terzstieg lässt sich auf eine Weise, der Quartstieg auf zwei und der Quintstieg auf drei Weisen sequenzieren. Die folgende Übersicht zeigt welche der Sequenztypen in den bereits genannten vier relevanten Quellen genannt werden: Spiridi
onis 1670
Muffat 1699
Fenaroli 1775
Cheru-bini 1847
1.a) Sekundgang aufwärts × × × × 1.b) Sekundgang abwärts × × × × 2.a) Terzstieg × × × × 2.b) Terzfall × × × × 2.c) Terzfall terzweise versetzt24
×
3.a) Quartstieg sekundweise versetzt
× × × ×
3.b) Quartfall sekundweise versetzt
× ×
3.c) Quartstieg terzweise versetzt
×
3.d) Quartfall terzweise versetzt
× × ×
4.a) Quintstieg sekundweise versetzt
× × × ×
4.b) Quintfall sekundweise versetzt
× × × ×
Abbildung 3: Sequenztypen in Lehrwerken des 17.–19. Jahrhunderts. Alle Autoren liefern Gerüste, die diminuiert und ggf. auch chromatisiert werden können, Fenaroli stellt einige dieser chromatischen Varianten vor. Die Übereinstim-mung insbesondere von Spiridionis und Fenaroli ist ein deutlicher Hinweis auf eine bestehende Lehrtradition. Beide Autoren vermeiden den sekundweise abwärts sequenzierten Quartfall, wohl aus stilistischen Gründen (er wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vermutlich als zu altmodisch empfunden, nicht so jedoch
24 Diese in Abbildung 2 nicht aufgeführte Folge findet sich nur bei Cherubini.
10
bei Muffat). Der terzweise versetzte Quartstieg wird nur bei Cherubini aufgeführt, obgleich er in der Literatur oft anzutreffen ist, etwa im verbreiteten Folia-Bass oder im berühmten Anfang von Pergolesis Stabat Mater. Terzweise und quartweise ver-setzte Quintfälle/-stiege werden ebenfalls überhaupt nicht aufgeführt; auch in der Literatur kommen sie seltener als die anderen Sequenztypen vor. Mit der Auswahl und erst recht mit den über die Bässe zu setzenden Oberstimmen wird ein Idiom vermittelt, das, zumindest was die Bassführung anbelangt, eine große historische Kontinuität aufweist.
Vergleicht man Abbildung 2 mit dem »Erbe« der Renaissance (Abb. 1) so wird deutlich, dass sämtliche Renaissance-Varianten in unserer Barock-Systematik vor-kommen. Zugleich gibt die Renaissance-Systematik Auskunft darüber, welche Ober-stimmen gebildet werden können. Die unterschiedliche Herkunft (Kanonsequnz oder Gemellus-Variante) spielt nunmehr eine untergeordnete Rolle, wenngleich auffällig ist, dass die aus dem Gemellus entstandenen terzweise versetzten Quartstie-ge/-fälle in den barocken Systematiken nicht komplett aufgeführt werden.
Festzuhalten ist, dass die Sequenz seit dem Barock einzig und allein durch den Bass definiert wird, auch Fenaroli und Cherubini, denen das Umkehrungsdenken vertraut war, messen diesem in systematischer Hinsicht keinerlei Bedeutung zu, mehr noch: Grundtöne werden nicht einmal erwähnt. Die Ausrichtung an Grundtö-nen würde offensichtlich zu einer vollkommen anderen Anordnung der Sequenzen führen und darüber hinaus eine Vorstellung des musikalischen Satzes implizieren, welche die Basis des Außenstimmensatzes verlässt. Erst gegen Ende des 18. Jahr-hunderts hat sich das Denken in Umkehrungen soweit verbreitet, dass sich dies in den Systematiken niederschlägt25; damit werden aber schon längst etablierte Sequen-zen nur auf eine andere Weise beschrieben. Nach wie vor werden sie mit General-bässen praktisch eingeübt.26
Prinzipiell ist über den in der Systematik aufgeführten Bässen jede satztechnisch legitimierbare Klangfolge möglich. Der Lehrpraxis des 17. und 18. Jahrhunderts folgend sollen zunächst die konsonanten, dann die dissonanten Varianten gezeigt werden. Üblicherweise werden bereits im 17. Jahrhundert zunächst Verbindungen mit Grundakkorden, dann der Einsatz von Sextakkorden und schließlich die Einbe-ziehung von aus der Syncopatio resultierenden Vierklängen gelehrt. Dieser Reihen-folge entspricht eine zur Klassifizierung der Intervalle analoge Einteilung der Ak-korde, die schematisch folgendermaßen wiedergegeben werden könnte:
25 So etwa bei Vierling, Anleitung, S. 7-11. 26 In seinem 1860 erschienenen Lehrbuch fügt Ferdinand Hiller Übungen von Mattei und Fenaroli, also der »alten«,
man möchte fast sagen »klassischen« Generalbassschulen bei.
11
Intervall Akkord perfekt: 8,5 Grundakkord imperfekt: 6,3 Sextakkord dissonant: 9,7,4,2 Quartsextakkord, Vier-
klänge
Über unsere Bassfolgen können also Dreiklänge, Sextakkorde oder Vierklänge ge-setzt werden. Die Klassifizierung macht verständlich, warum Muffat seine »Exempla« mit dem »Ordinarius« als erstem »Grieff« beginnt, also mit der Kombina-tion aus Terz, Quint und Oktav. Die Möglichkeiten der Außenstimmenführung sind begrenzt: In Frage kommen, vertikal betrachtet, einerseits die bereits im 15. Jahrhun-dert empfohlenen Imperfekt-perfekt-Verbindungen27, also 3-8/8-3 und 3-5/5-3, und andererseits die weniger geschätzte Perfekt-perfekt-Verbindung 5-8/8-5 sowie die sehr wohlklingende Imperfekt-imperfekt-Verbindung 3-3. Somit lassen sich mit Grundakkorden stets sieben verschiedene Oberstimmen bilden, die wiederum unter-schiedlich gefüllt werden können. Dies sei anhand der Terzfallsequenz exemplarisch verdeutlicht:
Abbildung 4: Mögliche Oberstimmen über der Terzfallsequenz mit Grundakkorden Es wird sichtbar, dass die entstehenden Oberstimmen kanonisch dieselbe Sequenz wie der Bass (e) oder andere Sequenzen wie sekundweise versetzter Quintfall (a, d), Sekundgang abwärts (b, c), sekundweise versetzter Quartfall (f) oder sekundweise versetzter Septimfall28 (g) entstehen lassen. Darin liegt freilich ein kontrapunktisches Potential: Der versierte Komponist kann daraus Rückschlüsse ziehen, wie er se-quenzhaltige Themen kombinieren kann.
27 Klaus-Jürgen Sachs geht so weit zu formulieren, dass die Imperfekt-perfekt-Verbindungen »historisch die
Keimzelle, ästhetisch das Ideal der Contrapunctus-Lehre« bildeten (Sachs, Die Contrapunctus-Lehre, S. 192). 28 In melodischer Hinsicht ist die Unterscheidung zwischen Terzstieg und Sextfall natürlich angebracht.
12
Die Ausfüllung mit einer dritten Stimme nun folgt weniger akkordischen Kriterien als vielmehr dem Prinzip der klanglichen Ergänzung: Die Oktav wird mit der Terz, die Quinte ebenfalls mit der Terz, die Terz mit der Quinte gefüllt. Zieht man Sextak-korde in Betracht, so können Oktav und Terz auch mit der Sexte gefüllt werde. Will man die Sexten auch in der Oberstimme bringen, so tun sich sieben neue Möglichkei-ten der Oberstimmenführung auf. Zusammen mit den Sextakkorden ergeben sich somit 14 unterschiedliche mögliche Oberstimmen: 3-8/8-3, 3-5/5-3, 5-8/8-5, 3-3, 6-6, 3-6/6-3, 5-6/6-5 und 8-6/6-8. Da Oktaven und Terzen auf zweierlei Weise gefüllt werden können, gibt es 42 unterschiedliche Kombinationen, akkordisch gesehen vier (Grundakkord-Sextakkord, Sextakkord-Grundakkord, Grundakkord-Grundakkord, Sextakkord-Sextakkord).
Dies mag wie eine kunstfremde Kombinatorik anmuten, es sind aber die Optio-nen, die den Komponisten zur Verfügung stehen, und auch genutzt werden. So gesehen verwundert es auch nicht, dass Spiridionis 59 unterschiedliche Diminutio-nen der Terzfallsequenz mit 13 unterschiedlichen Oberstimmen vorführt (Abb. 5).29
29 Vgl. Spiridionis, Nova Instructio, S. 26-31.
13
Abbildung 5: Oberstimmen über der Terzfallsequenz bei Spiridionis (ohne Diminuti-
on) Spiridionis verwendet neben den oben aufgeführten Varianten auch synkopierte und teils dissonante Lösungen, er nimmt sogar (Nr. 31) Akzentquintparallelen in Kauf, um eine neue Version zu gewinnen.
Gerade die Fülle an kombinatorischen Möglichkeiten wirft die Frage nach Kriteri-en dafür auf, welche Oberstimme nun besonders schön sei. Ohne dies empirisch-statistisch nachweisen zu können, lässt sich behaupten, dass es durchaus bevorzugte Oberstimmen gibt. Es sind dies einerseits die kontrapunktisch ergiebigen, schon aus der Renaissance bekannten kanonischen Lösungen sowie die abwechslungsreichen Folgen mit imperfekten Konsonanzen, also 3-6/6-3, 3-5/5-3 und 3-8/8-3, wobei jene Varianten bevorzugt werden, die melodisch besonders reizvoll sind. Nach diesen Kriterien ließe sich eine Auswahl der gebräuchlichsten Bass- und Melodiefolgen
14
erstellen. Die folgende Grafik versucht einen Überblick zu geben und beinhaltet bereits einige dissonante Varianten, die im Folgenden besprochen werden.
Abbildung 6: Typische Sequenzen.
15
5. Systematik II: Aus der Syncopatio stammende dissonante Sequenzen Bei den konsonanten Sequenzen spielt die metrische Verteilung in satztechnischer Hinsicht eine untergeordnete Rolle30, nicht aber sobald Dissonanzen ins Spiel kom-men. Vierklänge sowie Vorhaltsbildungen sind prinzipiell den Regeln der Syncopatio unterworfen, aus der sie auch historisch hervorgegangen sind. Dies bedeutet, dass der dissonante Klang auf einer betonten Zählzeit zu kommen hat. Tatsächlich ist dies nicht immer, aber meistens der Fall, vor allem in den Außenstimmen. Wichtiger als gelegentliche Verstöße gegen die korrekte metrische Behandlung der Syncopatio ist die Möglichkeit, je nach metrischer Gewichtung unterschiedliche Dissonanzen für ein Sequenzmodell im Bass zu verwenden.
Man kann die dissonanten Sequenzen methodisch in zwei Gruppen einteilen: Die erste Gruppe besteht aus Bässen, die unter einem syncopierten Terzen-Gemellus, also einer 2-3-Kette stehen können, die zweite Gruppe sind die übrigen Dissonanzen, die in Bezug zum Bass entstehen können. In Hinblick auf die erste Gruppe liefert Angelo Berardi im dritten Buch seiner Documenti armonici31 (1687) eine systematische Vorlage, die soweit amplifizierbar ist, dass tatsächlich sämtliche fallende Bassse-quenzen (mit Ausnahme der seltenen quartweise versetzten Quintfälle) mit der 2-3-Kette der Oberstimme kompatibel sind.32 Die Systematik in Abbildung 7 zeigt in der zweiten Hälfte, dass die gewonnenen Bassstimmen auch im doppelten Kontrapunkt verwendet werden, also als Oberstimmen einer Syncopatio im Bass fungieren können.
30 Nur Cherubini differenziert in dieser Hinsicht. 31 Im Documento VI des dritten Buches, vgl. Berardi, Documenti, http://www.musica-antica.info/berardi/documenti/documenti_3_6.php 32 Sucht man nach Beispielen von derlei kombinatorischen Kunstgriffen, so wird man bei Georg Friedrich Händel
auch hinsichtlich der ausgefallenen Varianten fündig: So finden sich etwa im zweiten Satz des Concerto grosso op. 3 die beiden Kombinationen aus Terzfall 2 und Syncopatio, im zweiten Teil des Gloria Patri des Dixit Dominus HWV 232 (ab Takt 55, »Et in saecula…«) werden Quartfall und Syncopatio kombiniert.
16
Abbildung 7: Kette aus 2-3-Synkopationen mit verschiedenen Bassunterlegungen In der zweiten Gruppe finden sich dissonante Fortschreitungen, die auf anderem Wege entstehen (Abb. 8). Es handelt sich um dissonante Versionen des Sekundgangs und des sekundweise versetzten Quintstiegs und Quintfalls. Diese Sequenzmodelle sind hinlänglich bekannt und für die Idiomatik der barocken und nachbarocken
17
Epoche äußerst relevant. Es handelt sich um dreistimmige Satzmodelle33, die nach Belieben mit einer vierten oder fünften Stimme erweitert werden können.
Abbildung 8: Weitere dissonante Sequenzen Zwischen diesen Sequenzmodellen bestehen offensichtliche kontrapunktische Bezie-hungen: Die Außenstimmen von c und d stehen im doppelten Kontrapunkt, f wiede-rum kann als Diminution von c begriffen werden.
33 Es ist davon auszugehen, dass im Barock der dreisstimmige Satz paradigmatisch war. Die Triosonate war die
zentrale kompositorische Gattung der Instrumentalmusik, Concerti grossi basieren auf einem dreistimmigen Concertino-Satz, die meisten Arien werden dreistimmig notiert, ebenso Suitensätze für Tasteninstrumente; Muffat notiert fast alle Beispiele seiner Regulae dreistimmig.
18
6. Idiomatisierung um 1700-1800 Bisher erfolgte die Darstellung nach kombinatorischen Gesichtspunkten. Dies ent-spricht der Tendenz vieler musiktheoretischer Autoren des 17. Jahrhunderts, eine möglichst breite Palette an Möglichkeiten anzubieten, um Anregungen zu bieten. Um 1700 herum aber vollzieht sich ein Stilwandel, der insgesamt eine stärkere Idiomati-sierung beinhaltet. Dies kommt nirgends sonst so deutlich zum Ausdruck wie im überschaubaren Œuvre von Arcangelo Corelli, dem »Fürst aller Ton-Künstler«34 (Mattheson), dessen Werke Mattheson noch über 25 nach seinem Tod und über 50 Jahre nach ihrer Entstehung (!) als »treffliche[s] Muster«35 empfiehlt. Corelli nutzt nicht die Vielfalt der Möglichkeiten, sondern wählt ganz bestimmte Varianten aus, die seinen Stil prägen.
Wollte man ein Hauptcharakteristikum der Corellischen Sequenzierungstechnik benennen, so wäre dies die konsequente Verwendung der Syncopatio. Corelli hat insbesondere – außer bei den Tanzsätzen – eine Vorliebe für Sekundreibungen in den Oberstimmen, weshalb die unter Abbildung 7 aufgeführten Bassunterlegungen für seine Musik besonders idiomatisch sind. Konsonante Sequenzen kommen nur noch gelegentlich vor. Generell ist im 18. Jahrhundert dann zu beobachten, dass sich das Repertoire an Sequenzen stark reduziert, ein Umstand, der in Korrelation steht zur allgemeinen Idiomatisierung der Musik in dieser Zeit.36 Fasst man, um einen beson-ders repräsentativen Autor zu wählen, die Sequenzen zusammen, die in Händels Generalbassübungen vorkommen, so kann man sich die am meisten verbreiteten Modelle vor Augen führen (Abb. 9).37 Händel präsentiert die Sequenzen nicht sepa-rat nach der üblichen Anordnung, sondern integriert sie in seine Systematik (perfek-te, imperfekte, dissonante Akkorde). Dass bis auf eines sämtliche Modelle mit der Syncopatio einhergehen, ist Corellisches Erbe.
34 Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, S. 650 (Register). 35 Ebda., S. 91. 36 Eine eindrucksvolle Studie zur Idiomatisierung im 18. Jahrhundert liefert Gjerdingen, Music in the Galant Style. 37 Vgl. Händel, Continuo playing. Die bei Händel aufgeführten chromatischen Varianten der Quintstieg/-
fallsequenzen sowie der Sekundstieg mit 9-8 und 7-6-Vorhalten werden hier nicht aufgeführt, da sie mir nicht in dem Maß repräsentativ erscheinen wie die anderen Typen. Die Sequenz aus Händels Übung Nr. 18 (S. 26) wird weiter unten (Abbildung 10) behandelt.
19
Abbildung 9: Sequenztypen in Händels Generalbassübungen
7. Tendenzen des 19. Jahrhunderts Versucht man, die Entwicklung der Sequenztechnik im 19. Jahrhundert zu überbli-cken, so könnte man drei Tendenzen ausfindig machen, die sich in der Praxis freilich durchdringen: a) Mehrgliedrigkeit, b) Chromatisierung und c) variable Füllung. a) Mehrgliedrigkeit Eine sehr häufige Klangfortschreitung bei Corelli ist die Unterlegung einer 2-3-Syncopatio-Kette mit der Sequenzierung der Bassstufen 6-7-1-338:
Abbildung 10: Sequenzierung der Bassstufen 6-7-1-3
38 Hier und im Folgenden geben die arabischen Bassstufen nicht die Grundtöne, sondern die tatsächlich erklingen-
den Basstöne als Skalentöne wider. Dies entspricht der Praxis der Oktavregel-Tradition und soll den Bezug der Bassstufen zu einer bestimmten Tonart verdeutlichen.
20
Auch wenn diese Sequenz recht barock anmutet, bleibt sie in der Wiener Klassik und im 19. Jahrhundert stets präsent.39. Nach 1800 kann man immer häufiger auf Sequen-zen treffen, in denen eine Akkordfolge aus drei oder mehr Klängen sequenziert wird. Die Übungen des Beethoven-Freundes Emmanuel Alois Förster, die »zum Fort-schrittlichsten, was die zeitgenössische Kompositionslehre zu bieten«40 hatte, gehö-ren, weisen eine Vielzahl solcher Sequenzierungen auf, die der Autor stets mit den Skalenstufen bezeichnet. Gemäß Försters Vorgehensweise könnte man etwa die berühmte Sequenz aus der Durchführung des Kopfsatzes von Beethovens Pathetique-Sonate folgendermaßen darstellen:
Abbildung 11: Beethoven: Grande Sonate pathetique, op. 13, 1. Satz, Takte 207-219, harmonisches Schema. Ein Oktavregel-Auschnitt (Beethoven verwendet die denkbar einfachste Form) mit gegenläufiger Stimmführung wird mithilfe einer Umdeutung der fünften zur vierten Stufe (mittels Sekundakkord) sekundweise aufwärts sequenziert.
Auch die berühmte Teufelsmühle kann, wie Wolfgang Budday gezeigt hat41, als ei-ne Sequenzierung der Stufen 4#-5-6 um eine kleine Terz verstanden werden (Abb. 12). In diesem Fall wird ein halbtöniger Skalenaussschnitt im Bass so versetzt, dass eine durchgehende chromatische Skala entsteht. Die Teufelsmühle ist also ein Beispiel für die oben angesprochene Durchdringung der beiden Tendenzen Mehrgliedrigkeit und Chromatisierung.
39 Als Beispiele mögen genügen: Joseph Haydn: Sonate in D Hob. XVI:37, 1. Satz Takte 47-50, Wolfgang Amadeus
Mozart: Präludium (Fantasie) und Fuge KV 394 (383a) Takte 38-40, Robert Schumann: Die beiden Grenadiere, Takte 11-17.
40 Holtmeier, Förster, S. 254. 41 Budday, Harmonielehre, S. 215.
21
Abbildung 12: Die Teufelsmühle als Sequenzierung der Stufen 4#-5-6 (nach Budday,
Harmonielehre,S. 215) b) Chromatisierung Chromatisierung kann einerseits bedeuten, dass eine diatonische Sequenz mittels Akzidentien in einer oder mehreren Stimmen chromatisiert wird, womit die diatoni-sche Präformation gewissermaßen koloriert wird. Dies ist im Barock beliebt, ein Paradebeispiel dafür wäre etwa der chromatisierte Lamentobass.42 Andererseits kann die Chromatisierung dazu führen, dass der Bezug zu einer Diatonik völlig ver-schwindet und man eine Transposition erlebt. Man kann diesen Sachverhalt auch umgekehrt beschreiben und sagen, dass die Transposition zu einer chromatischen Stimmführung, sei es im Bass, in der Melodie oder in einer Mittelstimme, führt. Es ist hier nicht der Raum um eine komplette Systematik solcher Fortschreitungen zu entwickeln. Im folgenden Beispiel sind lediglich einige Fortschreitungen aufgeführt, die Förster verwendet.
Abbildung 13: Chromatische Sequenzierungen in Emanuel Alois Förster’s Practische
Beyspiele als Fortsetzung zu seiner Anleitung des Generalbasses (1818).
42 Vgl. Kaiser, Gehörbildung, Bd. 2, S. 352.
22
c) variable Füllung Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begegnen oft stabile Außen-stimmensätze, die gelegentlich archaisch anmuten können (und sollen), aber variabel (harmonisch) »gefüllt« sind. Die Harmonisierung kann mit einfachen Akkorde wie Grundakkorden und Sextakkorden, aber auch mit dissonanten Klängen ausgeführt werden. Richard Wagner bedient sich oft und gerne dieser Technik, um groß ange-legte Entwicklungen oder Steigerungen zu gestalten. Die Sequenz bleibt damit zwar berechenbar und »eingängig«, weckt aber durch die harmonische »Würzung« stän-dig neues Interesse. Abbildung 14a zeigt einen stabilen Außenstimmensatz mit dissonanter Akkordfüllung aus dem Vorspiel der Meistersinger, in dem sowohl die Verengung der sequenzierten Intervalle im Bass als auch die Vergrößerung des Ambitus eine Steigerung bewirken. Einer Quintfallsequenz (e-a-d-g) folgt ein Quart-stieg, diesem ein Terzstieg. Die Quartfallsequenz aus dem Vorspiel zu Parsifal (Abb. 14b, die zugrundeliegende Bassfortschreitung ist durch * gekennzeichnet) trägt wegen des altertümlich-modal wirkenden Sequenztypus, der imperfekt-perfekt-Fortschreitung (3-5) und der konsonanten Füllung deutlich archaische Züge.
Abbildung 14: Sequenzen aus Wagners Meistersinger (a) und Parsifal (b)
23
8. Semantiken Hartmut Fladt, der den Diskurs über Satzmodelle in den letzten Jahren ganz wesent-lich mit angeregt hat, bevorzugt zu deren Kennzeichnung den Begriff »Topos«, um auszudrücken, dass Modellen »immer auch zugleich geschichtlich gewachsene Semantik anhaftet«.43 Dies trifft auf wenige Modelle, wie den Lamento-Bass, sicher-lich zu, auch das Erscheinen eines Modells als erratischer Block inmitten eines ganz anderen idiomatischen Umfeldes (etwa die von Fladt angeführte Folia inmitten des zweiten Satzes von Beethovens fünfter Sinfonie44) mag den Topos-Begriff rechtferti-gen, jedoch mit einer Einschränkung: Wenn Beethoven die Folia verwendet, wirkt dies wie ein Topos, aber er evoziert nicht (automatisch) dieselbe Semantik wie das Thema einer Folia-Variation des 17. Jahrhunderts. Das Reizvolle der Variationen über modellhafte Bässe besteht ja nicht darin, oder: die semantischen Konnotationen des Themas fortgesetzt nur zu wiederholen, sondern dem Bass möglichst viele Be-deutungsschichten abzugewinnen. Das Modell wird zum Topos erst in seiner Konk-retion. Vergleichbare Konkretionen ließen sich dann zu Recht als Topoi bezeichnen.
Nicht alle Modelle, und schon gar nicht alle Sequenzmodelle, sind also von sich aus semantisch aufgeladen. Es fällt auf, dass sich historische Lehrwerke meist jegli-cher Begriffsbildung enthalten, von Semantisierung ganz zu schweigen, sondern vielmehr eine rein kompositionstechnische Beschreibung liefern45. Die Organisation von Klangfolgen als Sequenz ist seit dem Barockzeitalter ein so tief verankertes und elementares Prinzip, dass die Entwicklung einer allgemeinen Semantik allein auf-grund der Omnipräsenz von Sequenzen kaum sinnvoll erscheint. Semantik entsteht immer erst in einem konkreten Kontext, insbesondere in Verbindung mit einem Text, etwa wenn in Claudio Monteverdis Madrigal Soave libertate (7. Madrigalbuch) von »schönen Ketten neuer Liebesqualen« (»belle catene d’altr’amorose pene«) die Rede ist und dazu eine Quartfallsequenz mit synkopischer Dissonanzenkette in den Ober-stimmen illustriert.
Die hier ausgewählten Quellen, hervorgehoben seien noch einmal Spiridionis, Muffat, Fenaroli und Cherubini, sind nicht allein historisch »interessant«. Sie lassen eine Systematik erkennen, deren implizite Theorie entfaltet werden und durch ande-re Quellen ergänzt werden kann. Historischer und systematischer Zugang schließen sich also nicht aus, im Gegenteil: Es gilt, die Systematik historischer Quellen frucht-bar zu machen und andererseits die Historizität gängiger Systematiken zu erkennen.
43 Fladt, Satztechnische Topoi, S. 189. 44 Fladt, Modell und Topos, S. 350. 45 Lediglich in einigen Lehrwerken der so genannten »Figurenlehre« finden sich vereinzelte Semantisierungen von
Sequenzen.
24
Eine solche historische Systematik macht hinsichtlich der Sequenzen seit 1600 vier grundlegende Sachverhalte deutlich, die sich aus einer modernen Harmonielehre-Systematik allein nicht ergeben, ja ihr sogar entgegenstehen:
1. Sequenzen konstituieren sich primär durch einen intervallischen Außenstim-mensatz. 2. Der diatonische Gerüstsatz ist der Diminution und/oder der Chromatisierung hierarchisch übergeordnet. 3. Identifizierung und Einordnung der Sequenzen erfolgt über die Bassfortschrei-tung. 4. Nur die Generalbassbezeichnungen vermögen die akkordische Struktur zu be-schreiben, da eine Analyse der Akkordstrukturen als Terzschichtungen oder der Grundtöne Außenstimmensatz und Bassverlauf nicht adäquat erfasst. Im vorliegenden Aufsatz wurde versucht, das Phänomen der Sequenz zunächst
disziplinär zu untersuchen, um eine Grundlage für weitergehende interdisziplinäre Forschungen zu schaffen. Wie Sequenzen in ihrer konkreten Erscheinung und Kon-textualisierung Bedeutung zu erlangen vermögen, könnten Werkanalysen aufzeigen. Beziehungen und Wechselwirkungen zu einem Text (in Vokalmusik), zur Gramma-tik und Rhetorik (auch in Instrumentalmusik) müssten hier eine große Rolle spielen. Darüber hinaus wäre die Wirkung von Sequenzen unter besonderer Berücksichti-gung räumlicher Assoziationen und ihres zeitlichen Erlebnisses aus musikpsycholo-gischer und musikästhetischer Perspektive zu untersuchen. Unabdingbar aber bleibt ein solides Wissen um (historisch informierte) Sequenztechnik und -kombinatorik und um die schier unerschöpflichen Möglichkeiten auf dieser technischen Basis neue Klangfolgen zu generieren. Literatur Aerts, Hans: »Modell« und »Topos« in der deutschsprachigen Musiktheorie seit Riemann,
in: ZGMTH (Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie) 4/1–2 (2007) http://www.gmth.de/www/zeitschrift.php?option=show&ausgabe=13&archiv=
1 Budday, Wolfgang: Harmonielehre Wiener Klassik, Stuttgart: Berthold & Schwerdtner
2002. Dodds, Michael R.: Columbus’s Egg: Andreas Werckmeister’s Teaching on Contrapuntal
Improvisation in Harmonologia musica (1702), in: Journal of Seventeenth-Century Music, Band 12 (2006),
http://www.sscm-jsm.org/v12/no1/dodds.html. Ens, Dietmar: Josquin Desprez’ Deploration de Johan. Ockeghem, in: Musik & Ästhe-
tik 13 (2000), S. 45–58. Fladt, Hartmut, Satztechnische Topoi, in: ZGMTH (Zeitschrift der Gesellschaft für
Musiktheorie) 2/2–3 (2005) [Hildesheim: Olms 2007], S. 189–196.
25
— Modell und Topos im musiktheoretischen Diskurs, in: Musiktheorie 19/4 (2005), S. 341–369.
Froebe, Folker: Satzmodelle des »Contrapunto alla mente« und ihre Bedeutung für den Stilwandel um 1600, in: ZGMTH (Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie) 4/1–2 (2007).
http://www.gmth.de/www/zeitschrift.php?option=show&ausgabe=13&archiv=1
Gjerdingen, Robert: Music in the Galant Style, Oxford University Press 2007. Hindrichs, Gunnar: Der musikalische Raum, in: Musikphilosophie (Musik-Konzepte
Sonderband), hrsg. von Ulrich Tadday, München: edition text + kritik 2007, S. 50–69.
Holtmeier, Ludwig: Art. Generalbaß; Förster, Emaunel Aloys; Satzmodelle; Teufelsmühle; Tonalität, in: Loesch, Heinz von/Raab, Claus (Hrsg.): Das Beethoven-Lexikon, Laaber: Laaber 2008.
Jans, Markus: Alle gegen Eine. Satzmodelle in Note-gegen-Note-Sätzen des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 10, Winterthur: Ama-deus 1986, S. 101–120.
— Modale »Harmonik«. Beobachtungen und Fragen zur Logik der Klangverbindungen im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 16, Winterthur: Amadeus 1992, S. 167–188.
Kaiser, Ulrich: Gehörbildung. Satzlehre – Improvisaiton - Höranalyse, 2 Bde. , Kassel: Bärenreiter 2000.
Pertsch, Erich/Lange-Kowal, Ernst Erwin: Langenscheidts Schulwörterbuch Lateinisch, Berlin/München: Langenscheidt 1991.
Sachs, Klaus-Jürgen, Die Contrapunctus-Lehre im 14. und 15. Jahrhundert, in: Die mittel-alterliche Lehre von der Mehrstimmigkeit (Geschichte der Musiktheorie, Bd.5), hrsg. v. Frieder Zaminer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1984, S. 161–256.
Schönberg, Arnold: Kriterien für die Bewertung von Musik, in: Stil und Gedanke, Frank-furt am Main: Fischer 1992, S. 171-184.
Spitta, Philipp: Johann Sebastian Bach (Reprint der 4. Auflage Leipzip 1930), Dar-mstadt: 1962.
Historische Quellen Berardi, Angelo: Documenti armonici (Bologna 1687), http://www.musica-antica.info/berardi/documenti/documenti_home.php Bianciardi, Francesco, Breve Regola per imparar’a sonare sopra il Basso con ogni sorte
d’Instrumento (Siena 1607), http://www.bassus.cmusge.ch/bianciardi/bianciardi.html.
Cherubini, Luigi: Marches d’harmonie, Paris: Heugel 1847. Fenaroli, Fedele: Regole musicali per i principianti di cembalo (Neapel 1775), Bologna:
Forni.
26
Förster, Emanuel Alois: Emanuel Alois Förster’s Practische Beyspiele als Fortsetzung zu seiner Anleitung des Generalbasses, erste Abtheilung, Wien: Artaria 1818.
Händel, Georg Friedrich, Continuo playing according to Handel: his figured bass exercises, hrsg. von David Ledbetter, Oxford: Oxford University Press 1990.
Hiller, Ferdinand: Übungen zum Studium der Harmonie und des Contrapunktes, Köln: DuMont 1860.
Koch, Heinrich Christoph: Versuch einer Anleitung zur Composition (Rudolfstadt 1782–93), Hannover: Siebert 2007.
Mattheson, Johann: Der vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739), Kassel: Bärenrei-ter 1999.
Monachus, Guilielmus: De preceptis artis musicae , Hildesheim: Olms 1963, oder: http://www.chmtl.indiana.edu/tml/15th/MONPRE_TEXT.html Muffat, Georg: Regulae concentum Partiturae (1699), http://www.bassus.cmusge.ch/muffat/muffat-regulae.html. Riepel, Joseph: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst (1752–68) in: Musiktheoreti-
sche Quellen 1750-1800, hrsg. von Ulrich Kaiser und Stefan Eckert, Berlin: Directmedia 2007.
Simpson, Christopher: A Compendium of Practical Musick, London 1678. Spiridionis, a Monte Carmelo: Nova Instructio pro pulsandis organis spinettis manuchor-
dis etc. (Bamberg 1670), Colledara: Andromeda 2003. Vierling, Johann Gottfried: Versuch einer Anleitung zum Präludiren, Leipzig: Breitkopf
1794.




























![[co-author: D. Alkemade] Het absurde serieus nemen: Interview met Jeffrey Herf, Skript Historisch Tijdschrift 34.2 (2012) pp. 103-109.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631e060e4da51fc4a3036833/co-author-d-alkemade-het-absurde-serieus-nemen-interview-met-jeffrey-herf.jpg)