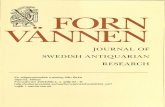BIRKA II:3 Systematische Analysen der Gräberfunde Ed. Greta Arwidsson
BIRKA II:3 Systematische Analysen der Gräberfunde
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of BIRKA II:3 Systematische Analysen der Gräberfunde
BIRKA II:3
Systematische Analysen der Gräberfunde
Ed. Greta Arwidsson
KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS
ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL STOCKHOLM • SWEDEN
Gedruckt mit Unterstützung des Schwedischen Forschungsrats für Humaniora und Gesellschaftswissenschaften
Früher herausgekommene Schriften in der Serie BIRKA. Untersuchungen und Studien
BIRKA I. Die Gräber. Text und Tafelband. Von H. Arbman, 1943, 1940 BIRKA II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde. Ed. Greta
Arwidsson, 1984 BIRKA II:2. Systematische Analysen der
Gräberfunde. Ed. Greta
Arwidsson, 1986 BIRKA III. Die Textilfunde aus den
Gräbern. Von A. Geijer 1938 BIRKA IV THE BURIAL CUSTOMS.BY Anne-Sofie Gräslund, 1980 BIRKA V. The Filigree and Granulation Work of the Viking Period By Wladyslaw Duczko, 1985
Bild auf dem Einband: Anhänger aus Bronze aus dem Grab Bj 968.
Übersetzung Hannelore Zeitler
Sprachliche Prüfung von Kap. 4 Hannelore Zeitler
© Die Authoren 1989 ISBN 91-7402-204-0
Gedruckt von Bohusläningens Boktryckeri AB, Uddevalla, Schweden 1989
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort des Birka-Komitees 3
1. Schmuckanhänger. Einleitung von Greta Arwidsson 7 2. Runde Silberblechanhänger mit punziertem Muster von
Wladyslaw Duczko 9 3. Gegossene Schmuckanhänger mit nordischer Ornamentik von
Johan Callmer 19 4. Schmuckanhänger von orientalischem Typ von Ingmar Jansson 43 5. Perlengarnituren von Greta Arwidsson 46 6. Metallperlen von Greta Arwidsson 51 7. Echte Perlen an dem Anhänger aus Silberdraht aus Bj 854 von
Greta Arwidsson 52 8. Bernstein von Greta Arwidsson 53 9. Verschiedene Schmuckgegenstände/Amulette in Form von
Menschenfiguren, Reitern, Pferden, Vierfüsslern, Vögeln und Schlangen von Greta Arwidsson 55 9.1. Vorbemerkungen 9.2. Zwei Reiterfiguren aus Bj 825; 9.3. Zwei Beschläge in Form von Pferden aus Bj 854; 9.4. Kriegerfigur aus Bj 571; 9.5. Zwei Frauenfiguren aus Bj 825 und 968; 9.6. Menschenfigur aus Bj 649; 9.7. Vogelfigur aus Bj 759; 9.8. Vogelspange aus Bj 1055; 9.9. Schlangenförmige Anhänger aus Bj 632 und 844; 9.10. Bronze schmuckstück aus Bj 1046; 9.11. Plastische Tierfigur aus Bj 1079.
10. Zwei vergoldete Bronzespangen mit Zellenemail aus Bj 854 von Greta Arwidsson 62
11. Zwei gotländische Silberbrakteaten aus Bj 523 und Bj 1130 von Greta Arwidsson 65
12. Spangen, Fibeln und Beschläge/Anhänger verschiedener Formen von Greta Arwidsson 67 12.1. Die runde finnländische Schlangenspange aus Bj 104; 12.2. Dosenförmige Spange aus Bj 1067; 12.3. Die kreuzförmigen Spangen aus Bj 1079; 12.4. Die gotländische Bügelscheibenfibel aus Bj 1079; 12.5. Ringschnallen aus Bj 418 und 1131; 12.6. Bronzespange aus Bj 418; 12.7. Die zungenförmige Bronzespange aus Bj 1037; 12.8. Zwei ungewöhnliche Schmuckanhängertypen aus Bj 165 und 306A; 72.9. Der ringkreuzförmige Beschlag aus Bj 511.
13. Das Bronzeglöckchen aus Bj 735 von Greta Arwidsson 72 14. Ketten von Greta Arwidsson 73 15. Arbeitsmesser aus den Gräbern von Birka von Birgit Arrhenius
mit einem Appendix 79 16. Die Messerscheiden in den Frauengräbern von Birka von
Greta Arwidsson 93 17. Klappmesser von Greta Arwidsson 95 18. Spinnwirtel von Greta Arwidsson 97 19. Geräte und Werkzeug von Greta Arwidsson 98 20. Specksteinkessel von Greta Arwidsson 100
21. Schleif- und Wetzsteine von Karin Sundbergh und Greta Arwidsson 102
22. Die Eisenbüchse aus dem Grab Bj 542 von Greta Arwidsson 111 23. Kästen und Schachteln von Greta Arwidsson und
Håkan Thorberg (t) 113 24. Schlüssel von Anna Ulfhielm 122 25. Die Vorhängeschlösser von Jan-Erik Tomtlund 133 26. Löffel von Inga Lindeberg 135 27. Die Münzen der Gräber von Birka. Ein Kommentar mit einem
Appendix von Greta Arwidsson 137 28. Kommentar zu den Knochenfunden aus den Gräbern mit einem
Appendix von Greta Arwidsson 143 29. Resultate der Birka-Forschung in den Jahren 1980 bis 1988.
Versuch einer Auswertung von Anne-Sofie Gräslund 151 30. Verzeichnis sämtlicher Beiträge in Birka II:1-3 164 31. Literaturverzeichnis mit Abkürzungen 167 32. Verzeichnis der Gegenstände, die in Birka II:1-3 nicht behandelt
werden, die aber im Katalog Birka I beschrieben sind, mit Hinweisen auf andere Veröffentlichungsstellen 175
33. Verzeichnis einiger im Depot neuentdeckter Fundstücke aus den Gräbern 176
34. Zu den Fundtabellen in Birka II:1-3 177 35. Berichtigungen zu Birka I, Textteil und Tafeln nach Kontrollen
von Anne-Sofie Gräslund, 1974-1976 178 36. Abkürzungen 179 37. Chronologische Begriffe 180
Greta Arwidsson (ed.). Birka II:3. Systematische Analysen der Gräberfunde. (Systematic Analyses of the Grave Finds.) Stockholm 1989. ISBN 91-7402-204-0.
Birka II:1-3 are intended as a systematic analysis and evaluation of the Viking Period finds published by Holger Arbman in Birka I, Die Gräber, in the form of a detailed catalogue of the finds from each grave together with plates illustrating the objects arranged according to category.
Responsible for Birka II:1-3 is a committee appointed by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities, the Central Office of National Antiquities and the Museum of National Antiquities. The project's aim has been to present a systematic analysis of the objects, their frequency and distribution within the different cemeteries surrounding Birka's settlement area, the „Black Earth". An extensive Scandinavian comparative material has been drawn upon by the scholars who have contributed with special investigations. A total re-working of the Scandinavian Viking Period material in general has, however, not been feasible within the confines of the programme as stipulated by the committee.
Volumes II:1 and II:2 have been divided-up in the following way. II:1 contains jewellery, ornament and dressaccessories, Thor's hammers, crosses, crucifixes and bells, bags, toilet-articles, mirrors/pailetts, smaller tools and strike-a-lights, gaming-pieces and gaming-boards, and also vessels of glass, copper alloy, wood, horn and pottery together with analyses of carbonized bread, nuts and seeds. Volume II:2 contains weapons, dresses, belts, arm- and finger-rings, fittings for rider and horse-equipment, weighings scales, weights, measures and bone skates.
A preliminary chronological table is included in volume II:1 which also contains a micro-fich edition of Birka I (1940-1943, text and plates).
Volume II:3 deals with pendant jewellery of varying types, beads, amber, metal chains, certain forms of brooches and ornaments, bronze fibulae with cloisonné enamel, various small tools and household equipment, and finally commentaries on the osteological determinations and on the coin finds (supplemented by the Royal Coin Cabinet's list of coinfinds from Birka's cemeteries). The work is concluded by a summary and evaluation of 1980-88's analyses of the Birka material.
An index to all articles in the complete volume II:1-3 is included in volume II:3.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Villagatan 3, S-11432 Stockholm, Sweden.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ausgabe des Bandes Birka II:3 gelangt die Aufgabe des Birka-Komitees zum Ab-schluss. Die anfangs nicht geplante Aufteilung von Band II in drei Teile ergab sich als notwendig wegen des grossen Umfangs des Fundmaterials und seiner Vielartigkeit und aus Gründen der Koordination der zahlreichen mitwirkenden Forscher und Spezialisten.
Mitglieder des Birka-Komitees waren Professor Bertil Almgren, Uppsala, Abteilungsdirektor Dozent Björn Ambrosiani, Stockholm, Professor Birgit Arrhenius, Stockholm, Professor Greta Arwidsson, Stockholm, Reichsantiquar Margareta Biörnstad, Stockholm, Ab-teilungsdirektor Doktor David Damell, Stockholm, Abteilungsdirektor Doktor Inga Lindeberg, Stockholm, Ministerialdirektor Doktor Erik B. Lundberg (bis 1979), Abteilungsdirektor Dozent Hans-Åke Nordström, Stockholm (seit 1977) und Ministerialdirektor Doktor Gustaf Trotzig, Stockholm.
Ein Appendix am Ende von Band II:3 enthält die Namen sämtlicher Verfasser von Artikeln in den Bänden II:1-3, sowie ein Verzeichnis der Mitarbeiter, die Übersetzungen, Zeichnungen, Photographien und Materialanalysen ausgeführt haben.
Greta Arwidsson war beauftragt, die Mitglieder des Komitees zu den Sitzungen einzuberufen. Ihr wurde von diesen der Vorsitz anvertraut. Bei der Arbeit an den Bänden II:1-2 erhielt sie zeitweilig bedeutende Hilfe mit Sekretär- und Redaktionsaufgaben und beim Korrekturenlesen von Elisabeth Almgren-Aiken, Ingmar Jansson, Else Nordahl und Anne-Sofie Gräslund, alle in Uppsala, Ann-Marie Hansson und Helena Joseph, beide in Stockholm. Seit Anfang 1988 war Inga Lindeberg, Stockholm, Greta Arwidsson bei der Zusammenstellung und kartenmässigen Erfassung der Funde und bei der Kontrolle der Manuskripte für Birka II:3 behilflich. Für alle drei Teile von Band II war Greta Arwidsson Hauptredakteur. Björn Ambrosiani hat das Literaturverzeichnis zu Band II:3 mittels des Computers im Historischen Museum, Stockholm, zusammengestellt. Lena Thålin-Bergman hat die Tabelle in Birka II:3 mittels ihres Computers ausgeschrieben. Die Übersetzung
der Artikel in Band II:3 hat Hannelore Zeitler, Uppsala, mit Geschick und grosser Geduld ausgeführt.
Die für die Datierung der Funde von Birka bedeu-tungsvollen orientalischen Münzen aus den Gräbern hat Ulla S. Linder Welin viele Jahre lang bearbeitet. Ihre Datierung der Münzen liegt der Datierung der einzelnen Gräber zugrunde, die man bis vor zehn Jahren verwendet hat. Leider konnte sie aber die grosse Zusammenfassung ihrer Untersuchungen nicht mehr vorlegen, an der sie so intensiv gearbeitet hatte. Nach ihrem Tode im Jahre 1983 wurde die Analyse aller orientalischen Münzen im Königl. Münzkabinett, Stockholm, fortgesetzt, das eine vollständige Veröffentlichung plant. Gegenwärtig liegt eine vorläufige Liste der Münzen von Birka für den Druck vor, einschliess-lich der westeuropäischen und nordischen Münzen, die Professor Brita Malmer 1966 veröffentlicht hat. Der Bitte des Birka-Komitees, dies Verzeichnis im Band II:3 abzudrucken, hat man freundlicherweise zugestimmt.
Geldmittel für die Gehälter der Übersetzer, Sekretäre und der Forscher, die zeitweilig Anstellungen im Rahmen des Projekts hatten, und für sonstige Bearbeitungskosten erhielt die Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi auch weiterhin vom Schwedischen Forschungsrat für Humaniora und Gesellschaftswissenschaften, und von folgenden Stiftungen: Olle Engkvist Byggmästare, Marcus und Amalia Wallenbergs Minnesfond, Humanistiska Fonden, während die Akademie selbst mit Zuschüssen aus Engelkes Donationsfond und anderen Forschungsgeldern, die ihr zur Verfügung stehen, beigetragen hat. Das Zentralamt für Denkmalpflege und das Staatliche historische Museum haben von ihren Zeichnern und Photographen eine Reihe von Bildern herstellen lassen, die sie dem Komitee zur Verfügung gestellt haben. Und schliesslich hat das Birka-Komitee zwei Geldbeiträge für den Abschluss der Bear-beitung erhalten: aus Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur und von Kungl. Patriotiska Sällskapet.
Für alle Mitglieder des Birka-Komitees und alle Mit-arbeiter der vorliegenden Untersuchungen ist es offen-kundig, dass es in erster Linie das Verdienst Greta
Arwidssons ist, dass die Veröffentlichung jetzt abge-schlossen werden konnte. Greta Arwidsson hat nicht nur die Arbeit des Komitees geleitet, sie hat auch die oft sehr undankbare Aufgabe auf sich genommen, als Redakteur zugleich auch aktiv an der Herausgabe der einzelnen Artikel mitzuarbeiten. Ausserdem hat sie zahlreiche Artikel selbst verfasst. Mit ihren umfassenden Kenntnissen, ihrer Klugheit und einer nie erlahmenden Ausdauer hat Greta Arwidsson die systematische Analyse der Funde von Birka zum Ende gebracht. Alle, die an dieser Arbeit teilgenommen haben, danken Greta Arwidsson für ihren bedeutenden Einsatz.
Allen Fonden und Stiftungen und jedem einzelnen der Mitarbeiter an diesem Forschungsunternehmen gilt
unser warmer und aufrichtiger Dank für ihren Einsatz und die wichtigen Beiträge zu demselben. Es ist uns eine grosse Freude, dass wir nun endlich die bereits hundertjährige Verpflichtung haben einlösen können, die Gräberfunde von Hjalmar Stolpes Untersuchungen in Birka in einer vollständigen Publikation des Materials - zum Nutzen der zukünftigen Forschung über die Wikingerzeit - vorzulegen.
Stig Strömholm Praeses der Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien (Kgl. Akademie
der Literatur, Geschichte und Altertumsforschung)
Vorwort des Birka-Komitees
Die Bände BIRKA II:1-3 bilden eine Einheit, deren Aufteilung in drei Teile, die in verschiedenen Jahren veröffentlicht wurden, eine Folge des ausserordentlichen Reichtums an Funden und der Schwierigkeit ist, die Arbeit der vielen Mitarbeiter zu koordinieren.
Bei der Abfassung des Vorwortes zu diesem letzten Teil kann ich in vielen Fällen auf die Vorworte zu den beiden vorhergehenden Teilen, BIRKA:II:1 und 2, hinweisen. Es ist jedoch angebracht, gewisse Veränderungen in der Planung zu nennen und sie zu begründen.
Da der Band BIRKA I (1940-43) seit langem ausverkauft ist, hat das Komitee lange gehofft, eine neue Auflage herausgeben zu können. Es ist uns durchaus bewusst, dass die Mikrofiche-Auflage, die dem Band BIRKA II:1 beigelegt war, eine Ausgabe in Buchform nicht ersetzen kann, - andererseits konnten wir auch feststellen, dass immer mehr Institute über Leseapparate für Mikrofiches verfügen.
Es wurde grosse Mühe darauf verwandt, die osteolo-gischen Funde der Gräber von Birka zu bestimmen, -leider ohne so befriedigende Resultate, wie wir sie erwartet hatten. Die Arbeit der Osteologen Sabine Stens und Berit Sigvallius ergab, dass die Funde teils sehr unvollständig, teils allzu sehr vermischt waren, als dass man zu wichtigen Ergebnissen gelangt wäre, z.B. über die Verteilung der Geschlechter, über eventuelle fremde Gruppen der Bevölkerung oder über Verwandt-
schaftsverhältnisse zwischen Individuen, die im gleichen Gräberbezirk begraben lagen. Aus diesen Gründen unterblieb der Druck der Listen. Sie sind jedoch in ATA archiviert (vgl. Kap. 28).
Die Verteilung auf Männer- und Frauengräber wird also auch jetzt noch, wie auf der Übersichtstabelle Holger Arbmans - mit geringfügigen Änderungen - durch die Art der Grabbeigaben bestimmt.
Die Bestrebungen des Komitees, Unterlagen für eine genauere Diskussion der Chronologie der Wikingerzeit zu schaffen, haben nur teilweise Erfolg gehabt. Für die notwendige Revision der wikingerzeitlichen Funde in Skandinavien, wenn nicht gar in internationalen Zusam-menhängen, dürfte die Zeit noch nicht gekommen sein. Neue Fundkomplexe von grossen Untersuchungsgebieten und sorgfältig dokumentierte Untersuchungen der Schichtenfolge in wikingerzeitlichen Stadtgründungen deuten darauf, dass das Bild von der Verbreitung der Artefakte und ihrer Typen, sowie das Bild möglicher Kulturkontakte vielleicht revidiert werden muss.
Wichtige Beiträge zur Chronologie von Birka und der schwedischen Wikingerzeit haben Ingmar Jansson (1985) und Ola Kyhlberg (1980 A und B) geliefert.
Der Entwurf einer vorläufigen chronologischen Tabelle, die dem Band II:1 beiliegt, ist nur als ein Beispiel zu betrachten, in welcher Art einige reich ausgestattete Gräber von Birka die Unterschiede zwischen
Margareta Biörnstad Riksantikvarie (Chef des Zentralamtes für Denkmalpflege)
der Ausstattung von Männer- und Frauengräbern und zwischen einer älteren und einer jüngeren Kulturphase in Birka (Ältere Birka-Stufe, ÄBS, und jüngere Birka-Stufe, JBS) veranschaulichen können.
Einen Index der auf Björkö gefundenen wikingerzeit-lichen Münzen hat das Königl. Münzkabinett, Stockholm, dem Komitee zuvorkommenderweise zur Verfügung gestellt. Da die Liste dem nächst veröffentlicht werden soll, hat das Komitee in dieser Lage beschlossen, den Index im schwedischen Original in den Band II:3 aufzunehmen und eine deutsche Übersetzung nur für gewisse, durchgängige Termini und Bezeichnungen beizufügen.
Bei der Durchsicht der Knochenfunde und mehrerer älterer Schachteln im Magazin mit Funden aus Birka sind hier und dort Artefakte, hauptsächlich als Fragmente, aufgetaucht. Einige dieser Funde von grösserem Interesse sind am Ende des Bandes II:3 in einer Liste zusammengestellt: „Verzeichnis über die in den 1970-er und 1980-er Jahren im Magazin gefundenen kleineren Funde."
Für das Komitee Greta Arwidsson
Bemerkungen Die Nummern der Tafeln (Taf.) und Abbildungen (Abb.) beziehen sich in diesem Heft, ebenso wie in BIRKA 11:1 und 11:2, auf die Illustrationen in BIRKA I. Eine Mikrofichekopie des ganzen Bandes I (Text und Tafeln) liegt BIRKA 11:1, bei.
Kursiv gedruckte Abbildungsnummern beziehen sich auf Abbildungen in diesem Heft: Abb. 1:1 bedeutet also Kap. 1, Abbildung 1 in BIRKA 11:3.
Der Index zu sämtlichen Artikeln in Band II, der in Band 11:3 steht (Kap. 34), ist in 17 Hauptgruppen (A-R) eingeteilt. Innerhalb jeder dieser Gruppen stehen die Artikel über die Artefakte in Buchstabenfolge.
Zu den Übersichtstabellen in BIRKA, Band 11:1-3 Für die Mehrzahl der systematischen Analysen der in Band II behandelten Gegenstände haben wir möglichst einheitlich for-mulierte Fundtabellen ausgeführt, wobei jedoch inhaltlich bedingte Variationen in der Form vorkommen können. Zweck dieser Tabellen ist es, Fakta wie die Verteilung auf Männer-und Frauengräber, die Fundfrequenz in verschiedenen Gräbertypen und die Verteilung auf die einzelnen Gräberfeldbezirke in übersichtlicher Form zusammenzufassen, sodass sie bei Untersuchungen auf Spezialgebieten leicht zugänglich sind.
Eine Liste sämtlicher Tabellen in BIRKA II steht am Ende von Band 11:3 (Kap. 34).
Karte der Gräberfelder auf Björkö mit der Einteilung in Bezirke. Die Karte dient als Unterlage zu den Angaben über die Verbreitung der Gegenstände. Vgl. die Karten in Birka I. Die „Salvik Grube" ist mit A markiert.
1. Schmuckanhänger
Greta Arwidsson
Einleitung
Zur Kategorie der Schmuckanhänger im weitesten Sinne gehören zahlreiche Gegenstände aus den Birka-Gräbern. Das Material ist so reichhaltig und verschiedenartig, dass es sich empfahl, seine analytische Behandlung auf mehrere Mitarbeiter zu verteilen. Folgende Archäologen haben sich mit ihnen befasst: Greta Arwidsson, Johan Callmer, Wladyslaw Duczko, Anne-Sofie Gräslund, Ingmar Jansson und Krister Ström. Ihre Beiträge verteilen sich auf die Bände BIRKA II:1 und BIRKA V und das hier vorgelegte BIRKA II:3 wie folgt:
Siehe Kap. 7 und 12:8. BIRKA II:3.
Schmuckanhänger aus Silber- und Bronzeguss mit skandinavischer Orna-mentik von den Gräberfeldern Birkas.
BIRKA II:3. The Filigree and Granulation Work of the Viking Period. BIRKA V, 1985. Schmuckanhänger aus Silber- oder Bronzeblech mit getriebenem, ge-stempeltem oder gepunztem Dekor.
BIRKA II:3. Kreuzanhänger, Kruzifix und Reli-quiar-Anhänger.
S. 111-118, BIRKA II:1, 1984. Zu Schmuckanhängern umgearbeitete Beschläge orientalischer Herkunft.
BIRKA II:3. Thorshammerringe und andere Ge-genstände des heidnischen Kults.
S. 126-140, BIRKA II:1, 1984.
Bis zu einem gewissen Grade geben uns Hjalmar Stolpes Detailzeichnungen ein Bild davon, wie die Schmuckanhänger getragen wurden und in welchem Verhältnis sie zu den Perlen/Perlenketten standen, mit denen sie zusammen vorkommen.
In Bj 860B (Abb. 283 in Birka I) lagen nicht weniger als sechs Schmuckanhänger aus Silber oder vergoldeter Bronze (Typ C, D, E und zwei Einzeltypen, Taf. 98:20 und 99:7), sowie sechs kleine, mit Ösen versehene Silberdrahtringe, auf die eine oder zwei Perlen aufgezogen sind. Dazu kommen drei nordische Münzen mit angenieteten Silberösen. Die 84 Perlen hat Stolpe als zusammenhängende Kette gezeichnet, die von der einen ovalen Schalenspange zu der anderen läuft. Kleine und grosse Perlen wechseln mit einer gewissen Regelmässigkeit ab. Neben dieser Perlenkette sind die Schmuckanhänger in solchen Lagen eingezeichnet, die auf ein eigenes Band für sie zu deuten scheinen, und zwar in einer Anordnung, dass die sechs grossen, auffälligsten Anhänger zunächst den Schalenspangen sassen, während sich die Münzen und die Silberringe mit den aufgezogenen Perlen in der Mitte des Bandes befanden. Wenn diese letzteren statt dessen zur Perlenkette gehört haben, wäre das Band mit den Anhängern kurz gewesen und die beiden vergoldeten Exemplare vom Typ E hätten vielleicht nebeneinander in der Mitte des Bandes gehangen.
Bj 825 enthielt ein Silberreliquiar und zehn Schmuck-anhänger von verschiedenen Typen, aber alle aus Silber. Hier scheinen alle Perlen um den Hals herum ausgegraben zu sein, zusammen mit vier Anhängern, zwei davon kleine Reiterfiguren (Taf. 92, 7 und 11), während das Reliquiar und wenigstens fünf der Anhänger, u.a. eine kleine weibliche Figur (Taf. 92:10, Abb. 248, Birka I), neben oder in der Nähe der Schalenspangen in der Brustgegend lagen. Auch hier ist es denkbar, dass ein Teil der Schmuckanhänger an einem eigenen Band befestigt war.
Es gibt indessen auch sichere Belege dafür, dass Perlen und alle Schmuckanhänger, einschliesslich der mit Ösen versehenen Drahtringe, auf die eine bis fünf Perlen aufgezogen waren, zusammen zu einem Schmuckstück aufgefädelt waren. Das beste Beispiel hierfür kommt aus Bj 632 (Taf. 119) mit Stolpes genauer Zeichnung der Fundlage.
Arwidsson, G.
Callmer, J.
Duczko, W.
Duczko, W.
Gräslund, A. S.
Jansson, I:
Ström, K.
8 Greta Arwidsson
Unter den Birka-Funden kommt jedoch nicht selten Hals- oder Brustschmuck aus zahlreichen Perlen ohne Schmuckanhänger vor, z.B. Bj 507, 639, 5591.
Die Kombination der Taf. 118 mit einer langen Per-lenkette, an der eine einzige grössere farbige Glasperle an einem Silberdrahtring hängt, dessen beide Ösen eine der Goldfolienperlen umschliessen, die zu dieser Kette gehören, ist wahrscheinlich leider ein Irrtum, da zu dem Fund mehrere Drahtringe und ein Paar berlockartige Anhänger gehören (Abb. 275: 2c-e, 2k; s. zu 2c Kap. 7).
Gegenstände, die mit Religion oder Kult in Zusam-menhang standen, scheinen entweder mit dem Halsoder Brustschmuck kombiniert zu sein oder wurden an eigenen Bändern oder Schnüren getragen (s. Gräslund, A.-S., 1984, 114 u.a., Duczko 1985, 55ff., Ström 1984, 127ff.). So gehören z.B. das Reliquiar in Bj 825, die Silberkreuze in Bj 703, 835 und 983 mit Perlen und Anhängern zusammen, während das kleine Silberkreuz in Bj 480 an einer Schnur o.dgl. für sich um den Hals
getragen wurde. Das Silberkreuz in Filigrantechnik aus Bj 501 (Taf. 102:4 a-c) gehörte mit zwei bikonischen Silberperlen und einer zylindrischen in feiner Filigranarbeit zusammen (Taf. 114:3). Sonst gab es an Perlen in diesem Fund nur zwei kleine Glasperlen. Hier scheint das Silberkreuz zu einem Schmuckstück besonderer Art gehört zu haben. Eine interessante Kombination von Thorshammeranhänger und Kreuz liegt aus Bj 750 vor, wo ein kleines Silberkreuz mit beiderseitigem Filigranschmuck zu einem mit Goldfaden eingewebten Band in Verbindung stand, ebenso wie der silberne Thorshammer gleich daneben (Abb. 217, 218:24 und Taf. 102:1, 104:4; vgl. Birka II:1, Kap. 15, 136 und Kap. 12, 111). Zusammenfassend gilt also für die Grabfunde von Birka, dass die Frauen ihre Schmuckanhänger auf verschiedene Art getragen haben, wobei keine der vorkommenden Formen einen besonders hervortretenden Platz unter den Schmuckkombinationen einnimmt, mit Ausnahme einiger der christlichen Kreuze (s. Gräslund 1984 A).
1 Es ist zu beachten, dass die Abbildungen in Birka I, Taf. 116, 118 und 124 (mit einem Anhänger) irreführend sind, da man alle Perlen zu einer einzigen Kette aufgefädelt hat, obwohl es bekannt war, dass die Perlen in der Regel in einer oder mehreren Reihen auf der Brust getragen wurden (s. Kap. 5: Perlengarnituren).
2. Runde Silberblechanhänger mit punziertem
Muster
Birka I, Taf. 97:3-12, 14, 16-20, 23-25, 99:25 Abb. 73:7-8, 116:3, 171:3n, 360
Abb. 2:1-24, Tab. 2:1 und Fundverzeichnis
Wladyslaw Duczko
Einleitung
Zwanzig Gräber von Birka enthielten 30 runde Anhänger aus Silberblech mit punziertem Muster. Sechzehn dieser Schmuckstücke sind sog. Schildanhänger mit einem kleinen Buckel in der Mitte und einem Wirbelmuster. Von den übrigen Anhängern sind drei schalenförmig, zwei buckeiförmig, sieben Exemplare haben Doppelkreise, und zwei fragmentarische Anhänger hatten wahrscheinlich einen kleinen Buckel in der Mitte und Kreuzmuster mit dreieckigen Feldern.
1. Anhänger mit Wirbelmuster
1.1. Fundmaterial Abb. 2:1-16
Die sechzehn Anhänger mit Wirbelmuster kommen aus sechzehn Gräbern, von denen fünfzehn Frauengräber sind: vierzehn Skelettgräber und ein Brandgrab. Ein Grab ist ein Kindergrab.
Die Anhänger sind aus einem runden Silberblech her-gestellt, in dessen Mitte ein halbkugelförmiger Buckel von der Rückseite vorgetrieben ist. Die Blechdicke beträgt bei 10 Exemplaren 0,1 mm, bei 5 Exemplaren 0,2 mm und bei einem Exemplar 0,3 mm. Der Durchmesser liegt bei 5 Exemplaren zwischen 1,7 und 2 cm, bei 11 Exemplaren zwischen 2,1 und 2,8 cm. Das Gewicht der unbeschädigten Exemplare liegt zwischen 0,29 und 2,46 g.
Bei zwei Anhängern, Bj 825 und 983, besteht die Aufhängevorrichtung aus einem auf der Rückseite fest-gelöteten Blechband, dessen eines Ende zu einer Öse umgebogen ist. Sechs Exemplare, Bj 800, 963, 966, 973, 980 und 987 tragen auf der Rückseite Lötspuren für ein schmales Band, das quer über die Fläche des Anhängers ging. Diese aufgelöteten Bänder können als eine Imitation vom Handgriff des Waffenschildes aufgefasst wer-
den (vgl. 1.6. unten). Drei Exemplare, Bj 825, 954 und 986, haben eine kurze, am Rande festgenietete Öse aus einem schmalen, geriefelten Silberband.
Das Wirbelmuster der Anhänger besteht aus einge-punzten Kreisen oder Punkten, die von dem Buckel in der Mitte ausgehen und deren Bogen stets im Uhrzeigersinn verläuft. Die Zahl der gepunzten Linien variiert zwischen 25 und 5. Um den Rand der Anhänger verlaufen entweder einfache oder doppelte punzierte Kreise.
Die Dekoration ist mit verschiedenen Geräten ausgeführt. An den Anhängern aus Bj 800, 825, 844, 968 und 983 hat man mit einem Perlpunz gearbeitet, d.h. mit einem Gerät, das an der Spitze schalenförmig vertieft war. Die Verzierung an den Anhängern aus Bj 531, 817, 835, 973, 980 und 946 ist mit einem Kugelpunz ausgeführt, d.h. mit einem Gerät mit halbkugelförmiger Spitze. Den Punz mit runder, flacher Spitze hat man bei der Verzierung des Anhängers aus Bj 963 verwendet. Die Abdrücke auf dem Anhänger aus Bj 954 deuten auf die Anwendung eines Geräts mit rhombischer Spitze. In drei Fällen, bei Bj 58A, 966 und 987 hat man die Verzierung mit einer Messerspitze ausgeführt.
An acht Anhängern ist wahrzunehmen, dass der Goldschmied vor dem Punzieren das Muster mit dünnen Linien eingeritzt hat, nämlich bei Bj 58A, 812, 835, 963, 966, 980, 983 und 987.
1.2. Die Lage in den Skelettgräbern
Acht Anhänger lagen in unmittelbarer Nähe oder zwischen ovalen Schalenspangen: Bj 800, 825, 835, 954, 963, 973, 980 und 844. In fünf Gräbern, Bj 58A, 531, 968, 983 und 946 waren die Anhänger Bestandteile eines Halsschmucks. Im Grab Bj 966 lag der Anhänger in einer Sammlung von Gegenständen neben dem Skelett, und in Bj 987 lag der Anhänger am Fussende des Grabes in der Nähe eines Beschlags.
10 Wladyslaw Duczko
Abb. 2:1. Bj 968. Abb. 2:2. Bj 954. Abb. 2:3. Bj 825.
Abb. 2:4. Bj 800. Abb. 2:5 a. Bj 983. Abb. 2:5b. Bj 983 Rückseite.
Abb. 2:6. Bj 835. Abb. 2:7. Bj 973.
Silberblechanhänger 11
Abb. 2:8. Bj 531. Abb. 2:9. Bj 963. Abb. 2:10. Bj 966. Abb. 2:11. Bj 987.
Abb. 2:16. Bj 946.
Abb. 2:1-7. Rundanhänger mit punziertem Wirbelmuster. Photo W. D.Skala 2/1.
Abb. 2:8-16. Rundanhänger mit punziertem Wirbelmuster. Photo W. D.Skala 2/1.
Bj 817. Bj 980. Bj 844 Bj 58A.
14 Wladyslaw Duczko
1.3. Die Verteilung auf den Gräberfelder
Neun der sechzehn Gräber mit schildförmigen Anhängern lagen im Bezirk des nördlichen Stadtwalls, 1A. Eines davon, Bj 987, lag gleich ausserhalb des Walls, während die übrigen innerhalb des Walls plaziert waren: Bj 973 lag nördlich der rechteckigen Terasse, auf der sich vier Gräber befanden, Bj 963, 966, 968 und 983. Zwei Gräber, Bj 946 und 980 lagen nahe beieinander am Abhang zur schwarzen Erde hin, während ein weiteres Grab, Bj 954, gleich nördlich der letzteren lag.
Am weitesten südlich im mittleren Stadtwallsgebiet, 1B, gab es zwei Gräber: Bj 58A ausserhalb und Bj 844 innerhalb des Walls.
In der nördlichen Hälfte des südlichen Stadtwallsgebiets, 1C, lagen zwei Gräber unter dem Wall: Bj 835 und 800. Unter dem mittleren Teils des Walls befand sich das Grab Bj 825. In der östlichen Hälfte dieses Gräberfeldes lag Bj 817.
Auf dem Gräberfeld 2A, nördlich der Burg, gab es nur ein Grab mit einem Schildanhänger, Bj 531.
1.4. Datierung
Die Fundkombinationen, zu denen die hier besprochenen Silberanhänger gehören, erlauben ihre Einordnung in die JBS. Dreizehn der Gräber enthalten ovale Schalenspangen, von denen zehn verschiedene Varianten
vom Typ P 51 sind und drei vom Typ Borre P 47, P 42 und P 52. Diese Typen sind alle Vertreter der JBS (Jansson 1985, 131, 135f.). In drei der Gräber mit dem Typ P 51 lagen Münzen vom Anfang des 10. Jahrhunderts.
Auch die übrigen drei Gräber ohne ovale Schalenspangen enthielten Funde von der Art der JBS: in Bj 58 A lag eine Ringspange mit zäpfchentragenden Endknäufen, in Bj 531 gab es ein Tongefäss vom Typ Selling AIV:2A, und in Bj 817 einen Hornlöffel vom gleichen Typ wie z.B. in Bj 644, 823 und 959, die sicher auf die JBS zu datieren sind. S. Ginters, 1984, Selling, 1955, Lindeberg, Birka II:3. Kap. 26.
1.5. Vergleichsmaterial
Die runden Silberblechanhänger mit Wirbelmuster sind eine der häufigsten Gruppen von Anhängern unter den Funden der Wikingerzeit in Skandinavien, und zwar vor allem in schwedischen und dänischen Funden. In Schweden, ausser Schonen und Blekinge, konzentrieren sie sich vor allem auf Gotland, Uppland und Västmanland. Einzelne Exemplare gibt es in Närke, Södermanland, Östergötland, auf Öland, in Hälsingland und Ångermanland. Aus diesen Gebieten kommen insgesamt 24 Exemplare.
In Dänemark, Schonen und Blekinge gibt es zehn Funde. Ein Anhänger ist von Aland bekannt und ein etwas atypischer aus Norwegen.
Tab. 2:1 Rundanhänger mit Wirbelmustern (Zusammengestellt von W.D.)
Abb. 2:17
Abb. 2:18
Silberblechanhänger 15
Ausserhalb Skandinaviens treten diese Schmuckstücke nur in Russland auf (7 Ex.).
Die Silberanhänger kommen in Hortfunden ebenso wie in Grabfunden vor. Im Mälarseegebiet überwiegen die letzteren, während die Hortfunde in Südskandinavien vorherrschen.
Anhänger dieses Typs gehören zu einer Periode von der Mitte des 10. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. Nur in einem Fall kommt ein Anhänger in einem Hort vor, der nach 1120 niedergelegt worden ist. - Auch Anhänger, deren Wirbelmuster in Filigran ausgeführt ist, gehören zur gleichen Periode (Duczko 1985, 48ff.).
1.6. Herkunft
Nach Stenberger (1953, 126) besteht kein Zweifel, dass die runden Anhänger mit Wirbelmuster nordische Arbeiten sind, die völlig spontan in der Wikingerzeit entstanden sind. Die einheimische Herstellung der Anhänger unterliegt keinem Zweifel, aber ihre Entstehung ist keineswegs spontan. Die Form und das Muster haben eine weit zurückreichende Tradition in der europäischen Kultur (Duczko 1985, 50). Ähnlicher Schmuck kommt im 6. und 7. Jahrhundert in Norwegen, England, Dänemark und Deutschland vor (Vierck 1978B, Abb. 18; Manger 1970, 24). Man deutet sie als Miniaturschilde mit symbolischer Funktion (Vierck 1978 B, 271). Die Richtigkeit dieser Deutung geht nicht nur aus ihrer Form hervor, sondern auch aus zahlreichen Abbildun-gen von bewaffneten Männern mit ähnlichen Schilden in illuminierten Handschriften im zentralen Europa aus dem 9. und 10. Jahrhundert (Abb. 2:19, s. z.B. bei Hubert, 1968, Abb. 158, 177).
2. Weitere runde Silberanhänger mit punziertem Muster Abb. 2-20-24
Fünfzehn runde Anhänger mit gepunzter Verzierung hat man in fünf Gräbern von Birka gefunden: Bj 462, 539, 597, 632 und 980.
In Bj 980 lag ein Satz von sieben Anhängern mit identischer Verzierung. Sie sind die einzigen Schmuck-stücke dieser Gruppe, die aus flachem Blech bestehen, die übrigen Anhänger haben entweder einen kleinen oder grossen Buckel oder eine schalenförmige Vertiefung in der Mitte.
Die Gräber konzentrieren sich auf einen Platz: vier liegen nördlich der Burg Bezirk 2A, eins innerhalb der Burg Bezirk 3 (Vgl. Abb. 2:17).
Chronologisch gehören drei Gräber (Bj 462, 539, 597) zur ÄBS, während zwei (Bj 632, 980) der JBS zuzuordnen sind.
Abb. 2:19. Krieger mit Schilden aus dem Stuttgarter Psalter. Nach Schiller 1968.
Gemeinsam ist den Anhängern aus diesen Gräbern, dass sie an die westeuropäische Feinschmiedekunst an-schliessen.
2.1. Anhänger mit grossem Buckel in der Mitte Abb. 2:20-21
Zu dem Brandgrab Bj 462 auf dem Gräberbezirk 3 gehören u.a. vier ovale Schalenspangen vom Typ P 27, d.h. einem für die ÄBS charakteristischen Typ. Zu diesem Grab gehören auch zwei identische runde Silberblechanhänger, von denen einer besser erhalten ist (Taf. 97:24, Abb. 20), während von dem anderen jetzt nur sieben kleine Fragmente erhalten sind (Abb. 73:7-8).
Die Anhänger, die ursprünglich ca. 3 cm Durchmesser hatten, sind aus ca. 0,3 mm dünnem Blech hergestellt, sie bestehen aus einem grossen, ein wenig ovalen Buckel in der Mitte und einer flachen Krempe. Der Buckel ist unverziert, die Krempe trägt drei Kreise aus kleinen, mit einem Kugelpunz hergestellten Punkten. Am Rand der Krempe gibt es ein beschädigtes Loch, in dem ursprünglich ein Ösenring gesessen hat.
Zu diesen Anhängern gibt es unter den nordischen Funden der ÄBS nur eine einzige Parallele, nämlich einen Bronzeanhänger, der in der Nähe von Birka gefunden wurde, in Grab 5 des Gräberfeldes von Stora
16 Wladyslaw Duczko
Dalby auf Adelsö (Rydh 1936, Abb. 88:6; Abb. 2:21). In diesem Grab lag auch eine Kleeblattfibel und ein fischkopfförmiger Anhänger, - beide Schmuckstücke von gotländischem Typ aus der Vendelzeit.
Die einzigen ausserskandinavischen Schmuckstücke, die mit den Anhängern von Birka und Adelsö vergleichbar sind, sind runde Buckelspangen aus dem Rheinland. Aus Mainz kommen zwei Exemplare, die auf das 9.-10. Jahrhundert datiert werden (Warners 1986, 44, Abb. 57, 58; Warners benennt diese Spangen „Buckeiförmige Scheibenfibeln").
Ob die Anhänger in Uppland lokale Kopien oder aus dem Rheinland importiert sind, lässt sich nicht entscheiden.
2.2. Schalenförmige Anhänger Abb. 2:22-23
Aus zwei Gräbern, Bj 539 und 632, stammen drei runde Silberblechanhänger mit schalenförmiger Mitte und einer Krempe.
In Bj 539 lagen zwei Exemplare (Taf. 97:23; der andere Anhänger ist nur auf Abb. 116:3 abgebildet). Ein Exemplar ist fast vollständig, der Durchmesser, inkl. Öse beträgt 2,7 cm, es besteht aus 0,1 cm dünnem Blech und wiegt 1,14 g. Die Öse des Anhängers ist ein Zipfel der Krempe, der auf die Rückseite herabgebogen und durch einen Niet verstärkt ist. Die Krempe ist mit zwei Kreisen aus kleinen runden Gruben verziert, die mit Kugelpunze ausgeführt sind. Der andere Anhänger ist von derselben Form und hat dieselbe Verzierung, ist aber schlechter erhalten. Der grösste Teil des Krempenrandes sowie der hintere Teil der Öse fehlen.
Der Anhänger aus Bj 632 (Taf. 97:25; Abb. 171:3n) hat einen Durchmesser, inkl. der Öse, von 2,7 cm und besteht aus 0,1 cm dünnem Blech, er wiegt 1,66 g. Er hat eine sekundäre Öse aus einem geriefelten Blechstreifen, der am Rand festgenietet ist. Mit Kugelpunz ausgeführte kleine Vertiefungen sind in einem Kreis um den Rand der Krempe angebracht. Die Schale des Anhängers ist von zehn Löchern perforiert.
Von dem einen Exemplar aus Bj 539 weiss man, dass es zwischen zwei ovalen Schalenspangen vom Typ P 37:1 lag. Diese Spangen zusammen mit einer rechteckigen Silberspange mit Greiftierornamentik (Taf. 83:2) datieren das Grab auf die ÄBS (Jansson 1985, 125). Der Anhänger aus Bj 632 gehört zu dem grossen Halsschmuck, Taf. 119. In dem Grab lag eine byzantinische Münze von 829-842, sowie ein Paar ovale Schalenspangen vom Typ P 42. Nach Jansson (1985, 139) ist dieser Typ charakteristisch für eine frühe Phase der JBS.
Neun weitere schalenförmige Anhänger, jedoch mit Filigrandekoration lagen in fünf Gräbern von Birka (Taf. 97:21, 22, 26; Duczko 1985, 42ff.).
Ausserhalb von Birka sind keine schalenförmigen Anhänger ohne Filigrandekoration bekannt.
Die Herkunft dieser Anhänger ist bei den schalenför-migen Anhängern der germanischen Funde aus der Merowingerzeit sowohl auf dem Kontinent als auch in England, Dänemark und Schweden zu suchen (Vierck 1981, Fig. 2:12; Leeds 1936, pl. 31; Nordahl 1959, Fig. 13a; Duczko 1985, 48).
2.3. Mit einem doppelten Kreis verzierte Anhänger aus Bronzeblech Abb. 2:24
Aus dem Grab Bj 980 kommt ein Satz von sieben identi-schen Anhängern aus Bronzeblech (Taf. 99:25, Abb. 360). Sechs Exemplare sind gut erhalten, während von dem siebten nur noch kleine Fragmente vorliegen. Sie haben ungefähr denselben Durchmesser, 2,4 cm und wiegen 0,88 g; das Blech ist 0,3 cm dünn. Sämtliche Anhänger haben eine Öse aus einem Zipfel des Blechs, der zur Rückseite hin umgebogen ist. Die Verzierung besteht aus zwei parallellen Perlenwülsten am Rande entlang, und innerhalb derselben aus einem Doppelkreis aus kleinen Buckeln. Oldeberg (1966, 123) beschreibt die Herstellung dieser Anhänger folgender-massen: „Bei der Herstellung hat man aus einem grösseren Bronzeblech mit einer Blechschere die Anhänger mit dem zugehörigen Ösenteil ausgeschnitten, und dann auf einer geeigneten Unterlage mit verschiedenen Punzgeräten die ziemlich einfachen Ornamente getrieben."
Bj 980, in dem auch ein runder Wirbelanhänger lag (s. 1.3.) gehört zur JBS.
Zu den sieben runden Anhängern aus diesem Grab gibt es in dem Bestand an nordischem Schmuck keine Entsprechungen. Sie sind lokale Erzeugnisse von Gold-schmieden (in Birka?), denen wahrscheinlich Filigran-schmuck vom Typ den Taf. 98:21 als Vorlagen diente.
2.4. Fragmente von runden Silberblechanhängern Taf. 97:20
Aus zwei Gräbern, Bj 539 und 597, liegen zwei Silber-anhänger vor, die als Fragmente erhalten sind.
In Bj 597 (mit den oben besprochenen schalenförmigen Anhängern) lag auch zwischen den ovalen Schalenspangen ein in zwei Stücken erhaltener Anhänger. Das ursprüngliche Muster des Anhängers scheint aus einem punzierten Kreuz und einem kleinen Buckel in der Mitte bestanden zu haben. Zwischen den Kreuzarmen gab es eine gerade Linie aus kleinen, mit einem Kugelpunzgerät ausgeführten Gruben. Die Kreuzarme bestanden aus doppelten Reihen von feinen punzierten Abdrücken. Um den Rand verliefen dieselben Abdrücke in zwei Kreisen, zwischen denen es einen Kreis aus kleinen Gruben gab.
Verzeichnis 17
Abb. 2:20. Bj 462.
Abb. 2:21. Grab 5, St. Dalby.
Abb. 2:22. Bj 539.
Abb. 2:23. Bj 632. Abb. 2:24. Bj 980.
462. Skala 1/1. Photo ATA. Abb. 2:21. Bronzeanhänger aus Grab 5, Stora Dalby, Adelsö Ksp. Nach Rydh 1936. Abb. 2:22. Zwei schalenförmige Anhänger aus Bj 539. Skala 1/1. Photo ATA.
Photo ATA. Abb. 2:24. Zwei von den sechs Anhänger aus Bronzeblech aus Bj 980 (Taf. 99:25). Skala 1/1. Photo ATA.
Das Grab Bj 539 ist ein Schachtgrab auf dem Gräberfeld 2A, nördlich der Burg. Der Anhänger, der zwischen zwei ovalen Schalenspangen lag, ist unvollständig, nur ein unregelmässiges Stück ist erhalten: in der Mitte ist ein rundes Loch (wahrscheinlich gab es hier ein Mittelbuckel). Es ist von einem Ring aus kleinen mit einem Kugelpunzgerät getriebenen Buckeln umgeben; aus ähnlichen Buckeln bestehen die einfachen radialen Linien, die die Fläche in dreieckige Felder einteilen, die von drei /grösseren/ Buckeln ausgefüllt sind. Die Zahl dieser Felder ist schwer zu beurteilen, wahrscheinlich waren es sieben.
Die übrigen Funde dieses Grabes, u.a. ein Paar ovale Schalenspangen, Typ P 37:1, und einer Glasbecher, datieren es auf die ÄBS.
Vergleichsmaterial zu den beiden Anhängern findet man in Westeuropa, und zwar im Rheinland. Unter den fränkischen Schmuckfunden des 7. Jahrhunderts gibt es einfache runde Bronzespangen, deren Muster dem dieser Anhänger von Birka sehr nahesteht (vgl. Böhner 1958, Taf. 18:1, 4, 5). Diese Art von Schmuck, auch in Form von Anhängern, wurde im Rheinland auch während der karolingisch-ottonischen Zeit noch hergestellt, z.B. in Mainz und in Domburg, Holland (Warners 1986, Abb. 50; Capelle 1976, Taf. 267, 280). Wie bei den oben besprochenen buckeiförmigen Anhängern ist es unmöglich zu entscheiden, ob diese Anhänger von Birka örtliche nordische Kopien oder ein Import aus dem Rheinland sind.
Verzeichnis der Anhänger mit
Wirbelmustern
1. Schweden: 31 Ex.
Blekinge: 1 Ex. - Johannishus, Hjortsberga Ksp SHM 3491 (Hårdh 1976b,
Taf. 7:I:39) 1 Ex., Silber; Schatzfund, t.p.q.: 1120
Gotland: 7 Ex. 1 Botels, Havdhem Ksp SHM 6331 (SGW II, Abb. 54:19)
1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 983 2 Bjers, Roma Ksp SHM 15678A-15680 (SGW II, Abb.
114:2) 1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 962
3 Gåshagen, Västerhejde Ksp SHM 4092, 6088, 7245, 9086, 9162, (SGW, Abb. 161:3) 1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 973
Abb. 2:20. Anhänger mit grossem Buckel in der Mitte, aus Bj Abb. 2:23. Schalenförmiger Anhänger aus Bj 632. Skala 1/1.
18 Wladyslaw Duczko
4 Endre Ksp SHM 1337 (SGW II, Abb. 180:1) 1 Ex., Silber; Schatzfund, t.p.q.: 1009
5 Sigsarve, Hejde Ksp SHM 16077, 1620 (SGW II, Abb. 230:4) 1 Ex., Silber, Schatzfund, t.p.q. 1055
6 Bosarve, Stånga Ksp SHM 22468 (SGW II, Nr 521, nicht abgebildet) 1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 1027
7 Viflings, Hellvi Ksp SHM 7736:4 1 Ex., Silber; Grabfund
Hälsingland: 1 Ex. - Ullsäter, Hälsingtuna Ksp (Olsson 1986, 12, Abb. 10)
1 Ex., Silber, Erdgrab; Münzen: u.a. Ethelred (Last small cross), 1009-17
Närke: 1 Ex. - Sandtorp, Viby Ksp SHM 14935 Fv. 1913, 305, Abb. 72
1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 1034
Skåne: 3 Ex. 1 Glemminge, Glemminge Ksp SHM 14452 (Hårdh 1976b,
Taf. 29:13) 1 Ex., Silber; Schatzfund, t.p.q. 1016-35
2 Ramsåker, Stävie Ksp LUHM 3390, 3827 (Hårdh 1976b, Taf. 44:II:17) 1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 955
3 Kyrkogården, S. Sandby Ksp SHM 6997 (Hårdh 1976 b, Taf. 46:11) 1 Ex., Silber, Schatzfund, t.p.q. 983
Södermanland: 1 Ex. - Finkarby gärde, Näsby, Taxinge Ksp SHM 9136 (Arne 1909,
67, Abb. 99) 1 Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 961-77
Uppland: 3 Ex. 1 Stockholm, Brännkyrka SHM 22004 (Hansson 1938, 154,
Abb. 8 A) 1 Fragm., Silber; Brandgrab Nr IV
2 Ölsta, Norrby Ksp SHM 15795 1 Fragm., Silber; Grabfund
3 Eke, Skuttunge Ksp SHM 226682 1 Ex., Silber; Grabfund
Västmanland: 10 Ex. 1 Östjädra, Dingtuna Ksp SHM 16217 (Schnittger 1920, 42,
Abb. 7) 4Ex. + 3 Fragm. von verschied. Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 991
2 Vedby, Badelunda Ksp SHM 20671:7 (Stenberger 1956, Abb. 43) 1 Ex., Silber; Grabfund
3 Tuna, Badelunda Ksp VLM O. Nr (Jansson 1985, 207; Simonsson 1969a, 84) 3 Ex., Silber; 1 Ex. aus Bootgrab A48 + 2 Ex. aus anderen Gräbern
4 Åsta, Björskog Ksp VLM 14662 (Simonsson 1969a, 84, Abb. 8; Jansson 1985, 207) 1 Ex. (Fragm.), Silber; Brandgrab All
5 Sylta, Köping VLM (Simonsson 1969b, 41) 1 Ex., Silber; Grandgrab A18 (Doppelgrab)
Ångermanland: 1 Ex. - Frök, Nora Ksp SHM 655
1 Fragm., Silber; Schatzfund, t.p.q. 1056
Öland: 2 Ex. - Klinta, Köping Ksp SHM 128 (Stenberger 1947-58,I, Abb.
41:7, 10) 2Ex., Silber; Schatzfund, 10. Jahrh.
Östergötland: 1 Ex. - S. Smedby, Tingstad Ksp SHM 28832 (SML 1982, 53, Nr
125, Abb. 11) 1 Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 964/5
2. Funde ausserhalb von Schweden
Bundesrepublik Deutschland (BRD): 1 Ex. Schleswig-Schuby, Kr. Schleswig-Flensburg (Kühn 1936, Abb. 4:6) 1 Ex., Silber; Siedlungsfund
Dänemark: 6 Ex. 1 Tarup, Naerå Ksp, Åsum H., Fyn (Skovmand 1942, 86 f, Abb.
19) 2 Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 971 2 Yholm, Bregninge Ksp, Sunds H. (Skovmand, 90f) 1 Fragm., Silber; Schatzfund t.p.q. 1002
3 Vålse, Falster (Skovmand, 95f.) 1 Fragm., Silber; Schatzfund t.p.q. 991
4 Sejrø, Skippinge H. (Skovmand 103f, Abb. 22) 1 Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 953
5 Skjeppingegård, Rø Ksp, Bornholm (Skovmand 117f, Abb. 26)1 Ex., Silber; Schatzfund t.p.q. 954
Finnland-Åland: 1 Ex. - Storhagen, Kulla by, Finström Ksp (Kivikoski 1946, 46,
Abb. 33) 1 Ex., Silber; Hausgrund 5
Norwegen: 1 Ex. - Flakstad, Vang, Hedmark (Petersen 1928, Abb. 165)
1 Ex., Bronze; Grabfund, datiert auf JBS
Russland: 7 Ex. 1 Vaskovo, Pskov Prov (Korzuchina 1954, Tab. XXIIL3) 1 Ex.,
Silber; Schatzfund, dat. 1011-59 2 Lisyno, Leningrad Prov (Spicyn 1896, Tab. VI: 18) 1
Ex., Silber; Grabfund 3 Gnezdovo, Smolensk Prov (Sizov 1902, Tab. V:18) 1 Ex.,
Silber; Grabfund 4 Sestovicy in der Nähe von Cernigov (Blifeld 1977, Tab.
XXII) 1 Ex., Silber; aus einem skandinavischen Frauengrab, datiert auf JBS
5 Maksimovski mogilnik, an dem Fluss Kama (Spicyn 1901, Tab. XXVI: 19) 1 Ex., Silber; Grabfund
6 Sarskoje gorodisce, in der Nähe von Rostov (Gornajova 1961, Abb. 39:14) 1 Ex., Silber; Siedlungsfund
7 Jurjev, Vladimir Prov (Spicyn 1905, Abb. 196) 1 Ex., Silber; Grabfund
3. Gegossene Schmuckanhänger mit nordischer
Ornamentik
Birka I, Taf. 92:5-6,12, 97:27, 98:15-30, 99:1-2, 6, 21-22, 24,103:5-7,104:4, 6. Abb. 11:4 Abb. 3:1-37, Tab. 3:1
Johan Callmer
1.1. Einleitung
Die hier behandelte Schmuckkategorie ist zu definieren als aus Silber oder Bronze gegossene Schmuckgegenstände, die primär mit einer Öse versehen sind und unzweideutig nordische Stilmotive aufweisen2. Ferner bespreche ich in diesem Kapitel einige Gegenstände, deren Fundumstände darauf schliessen lassen, dass sie an einem Band oder einer Schnur um den Hals getragen wurden.
1.2. Fragestellungen und einleitende Gesichtspunkte
Eine Untersuchung der gegossenen Schmuckanhänger aus den Birka-Gräbern aktualisiert eine Reihe von Problemen, von denen drei zentrale Fragen hier zu behandeln sind: erstens die Frage nach der zeitlichen Einordnung der Anhänger, zweitens ob dieser Schmuck teilweise oder insgesamt am Ort hergestellt sein kann, oder ob bestimmte Typen eher als Import nach Birka zu betrachten sind. Und drittens, ob der Gebrauch von Schmuckanhängern in Birka sich von dem Gebrauch derselben im übrigen Mälartal unterscheidet3. Die Schmuckanhänger sind insofern besonders interessant, als sie keinen funktionellen Teil der Tracht darstellen, wie es bei den meisten gegossenen Schmuckstücken der Wikingerzeit der Fall ist. Die Anwendung von Schmuckanhängern und Perlen beruht direkt auf dem Wunsch des Individuums, im Rahmen der lokalen Gesellschaft zu imponieren (vgl. Callmer 1977, 105). In Skandinavien tragen die Frauen zum Teil in der aktuellen Periode Schmuckanhänger4.
1.3. Vergleichsmaterial
In den spärlichen westeuropäischen Funden der Birkazeit kommen Schmuckanhänger selten vor (vgl. z.B. Capelle 1976, van Giffen 1927, Stein 1967). Auch in
Mitteleuropa waren sie selten (vgl. Rempel 1966, Poulik 1948, Hruby 1955). Im slawischen Osteuropa liegen mehrere Formen von Schmuckanhängern vor, die in der Mehrzahl aber frühestens auf das Ende des 10. Jahrhunderts oder später zu datieren sind (vgl. Zurzalina 1961, Uspenskaja 1967). Bei den finnischen und baltischen Völkern waren Schmuckanhänger weit verbreitet, jedoch in besonderen Formen mit einer anderen Tradition als die skandinavischen5, ebenso bei den Völkern der Steppenzone (vgl. Pletneva 1967, 171ff.). Vergleichsweise muss die häufige Verwendung von Schmuckanhängern als eine typisch skandinavische Erscheinung teils schon im 9. aber vor allem im 10. Jahrhundert betrachtet werden.
1.4. Frequenz der Schmuckanhänger
15 % der Frauengräber in Birka enthalten Schmuckanhänger der hier behandelten Gruppen. Der Anteil ist höher bei den Skelettgräbern (21 %) und besonders bei den Kammergräbern (71%), während nur 7,5% der Brandgräber diese Schmuckanhänger aufweisen6. Im Vergleich zum übrigen Mälartal sind Schmuckanhänger
1 Eine Definition des Begriffs Schmuckanhänger (Eisenzeit) dürfte vollständig fehlen. 2 Für den Begriff der skandinavischen Ornamentik lage ich hier keine Definition vor, sondern verweise ganz allgemein auf die traditionelle Auffassung wie z.B. bei Klindt-Jensen & Wilson 1965. 3 Mälartal - die schwedischen Provinzen Södermanland, Uppland, Västmanland und Närke. 4 Mir sind Schmuckanhänger der hier behandelten Typen aus eindeu tig als Männergrab definierten Funden nicht bekannt. 5 Kivikoski 1973, 195ff., Abb. 1, Volkaité - Kulikauskiené 1970, XXXII und XXXIV pav. (späte Exemplare), Katalog der Ausstellung zum X, archäologischen Kongress in Riga 1896, Taf. 9 und 18 (spät.). 6 Dieser Vergleich gründet sich auf insgesamt 130 Funde von Schmuckanhängern, die sich verteilen auf: 16 Einzelfunde, zwei Sied lungsfunde, sieben unsachgemäss und 96 sachverständig untersuchte Brandgräber, drei unsachgemäss und sechs sachverständig unter suchte Körpergräber.
20 Johan Callmer
in den Birka-Gräbern insgesamt häufiger. Im übrigen Mälartal gibt es Schmuckanhänger in 9 % der Frauengräber, berechnet nach der früher von mir benutzten Anzahl (Callmer 1977, 141, Anm. 735). Der Unterschied ergibt sich in erster Linie aus dem höheren Anteil der Skelettgräber in Birka. Im 9. und 10. Jahrhundert sind Skelettgräber ausserhalb Birkas relativ selten.
In den Skelettgräbern von Birka kommen mehrfach bedeutend grössere Sätze von Schmuckanhängern als im übrigen Mälartal vor, wo es Ausstattungen von mehr als fünf Schmuckanhängern kaum gibt7. In dieser Hinsicht geben die Brandgräber von Birka ein abweichendes Bild, denn hier kommen keine Ausstattungen mit mehr als vier Anhängern vor, und auch dies nur in einem Fall (Bj 418) von zwanzig. Sonst gibt es höchstens zwei Schmuckanhänger zugleich in den Brandgräbern.
Schmuckanhänger aus Silberguss sind in Birka bedeutend häufiger als im übrigen Mälartal (SHM 15340, Einzelfund, 19464:7, 2 Ex., 23576:14, Vendelzeit?). Sie treten in Birka mit 9,1 % und im Mälartal mit 2,3 % der Gräber mit Schmuckanhängern auf. Vor allem in den Skelettgräbern Birkas sind Schmuckanhänger aus Silberguss zu finden (13,2%), während der Prozentsatz der Brandgräber (5 %) den Verhältnissen im Mälartal bedeutend näher kommt.
Schmuckanhänger aus Bronzeguss sind im Mälartal mehr als doppelt so häufig (69,2%) wie in Birka (30,7 %), wo sie in den Brandgräbern (45 % der Gräber mit Schmuckanhängern) häufiger sind als in den Skelettgräbern (26,5 % der Gräber mit Schmuckanhängern).
Schmuckanhänger aus Silberblech mit Filigran kommen im Mälartal äusserst selten vor (SHM 2025 Sö, Ksp. Tumbo, Berga; 8588 So, Ksp Bettna, Löta), während sie in Birka in 22,7 % der Gräber mit Schmuckanhängern vorliegen (nur Skelettgräber).
Schmuckanhänger aus Silberblech ohne Filigran sind nicht so ungewöhnlich im übrigen Mälartal8 (s. Verzeichnis; 6,9% der Gräber mit Schmuckanhängern), während sie in Birka in 28,4 % der Gräber mit Schmuckanhängern vorliegen, wobei die Skelettgräber mit 18,4% dominieren, und die Brandgräber 10% enthalten.
Schmuckanhänger aus Bronzeblech sind im Mälartal relativ häufig9 (s. Verzeichnis; 14,6% der Gräber mit Schmuckanhängern), in Birka dagegen ungewöhnlich (4,5%). Auch hier besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Skelettgräbern mit 2,9 % und den Brand-gräbern mit 10 % der Gräber mit Schmuckanhängern.
Schmuckanhänger aus Eisenblech sind in den Birka-Gräbern selten (2,3 % der Gräber mit Schmuckanhängern), sie kommen nur in Brandgräbern vor. Im übrigen Mälartal liegen sie in 5,3 % der Gräber vor (s. Verzeichnis und Anm. 10).
Andere Gruppen von Schmuckanhängern sind praktisch nur in Birka vertreten. Orientalische Silberbeschläge gibt es hier ebenso oft in Brandgräbern wie in Skelettgräbern mit Schmuckanhängern (25%). Fragmentarische Schmuckstücke als Anhänger kommen sowohl in Birka wie im Mälartal selten vor, 2,3 % bzw. 1,1 % der Gräber mit Schmuckanhängern. Die Gruppe der übrigen Schmuckanhänger ist in Birka reich vertreten, und zwar in 20% der Brandgräber und in 35,5% der Skelettgräber mit Schmuckanhängern, während das Mälartal im übrigen nur 3,2% aufweist11.
1.5. Zusammenfassung zur Frequenz der Anhängerfunde
Es lassen sich also deutliche Qualitätsunterschiede nachweisen, einerseits zwischen den Gräbern von Birka und dem übrigen Mälartal, andererseits zwischen den Brandgräbern und den Skelettgräbern von Birka.
Schmuckanhänger aus Silber sind in Birka viel zahl-reicher als im übrigen Mälartal. Auch auf Öland waren sie wahrscheinlich häufiger als im Mälartal. Wenn dies in Birka auch mit dem Überwiegen der Skelettgräber zusammenhängen mag, so stand hier offenbar wesentlich mehr Edelmetall zur Verfügung als sonst im Mälartal. Nur Anhänger aus Silberblech ohne Filigran, oft mit einem gepunzten Wirbelmuster, sind im Mälartal ziemlich gut vertreten (s. Kap. 2). Dagegen gibt es im Mälartal ausserhalb von Birka als Ersatz für Silberanhänger (sowohl für eigentliche Schmuckanhänger als auch für Münzenanhänger) solche aus Bronze- und Eisenblech, die meistens rund sind. Chronologisch gehören diese zu einem Zeitabschnitt, der teilweise vor der Produktion der unten behandelten Schmuckanhänger aus Bronzeguss (mit Ausnahme der älteren feuerstahlförmigen Gruppe) liegt, nämlich zum späten 9. und frühen 10. Jahrhundert.
7 Grab X in Tuna, Ksp. Alsike, Uppland (Arne 1934, 37) und Grab 22 bei Strömsbro, Gävle, Gästrikland (Yngström 1942) enthielten je sechs Schmuckanhänger, während Grab 75 in Tuna, Ksp. Badelunda, Västmanland, sogar vierzehn Schmuckanhänger erbrachte (Stenber- ger 1956, 62). 8 SHM 15795 (Einzelfund), 17289:1, 20671:6, 22004:1:IV, 22668:2:a, VSM (Västerås) 14642:11,0. Nr. die Gräber Tuna Nr. 48 (2 Ex.) und 84, o. Nr. Bjurhovda. 9 SHM 9521, 10280:X, 11357:1, 16220, 16576:1, 16863:3, 17289:1, 18212:2, 19412:10 II-III, 20066, 21473:1, 21922:43, 21956:7, 23610:7, 25581, 25849:6, 28045:11, UMF Ytterbacken, Grab 47, VSM (Västerås) Tuna Grab 75. 10 SHM 16863:3, 20671:7, 22460:2, 22868:7:2, 25240, UMF 3740. 11 Orientalische Beschläge kommen im Mälartal sehr selten vor; vgl. jedoch SSM, o.N. Grab 40, Gräberfeld 104, Hästa, Ksp. Spånga, Uppland, einen Fund vom Gräberfeld 70 bei Stora Tensta, Ksp. Spånga, Up., sowie KVHAA Årsbok 1969, 182.
Gegossene Anhänger 21
Die Funde von Schmuckanhängern deuten wie wenig andere auf die Sonderstellung Birkas im östlichen Mit-telschweden. Die Einwohner und Besucher Birkas waren Individuen, deren Bewertung des Edelmetalls sich weitgehend von der der übrigen Bevölkerung der Gegend unterschied12.
Es ist auch deutlich, dass zwischen der Bevölkerung, die in Körpergräbern beigesetzt ist, und der, die in Brandgräbern liegt, bedeutende Unterschiede bestehen, die wohl kaum ausschliesslich mit dem unterschiedlichen Grabritual zusammenhängen. Steuers Annahme, dass Beisetzungen in Brandgräbern und Körpergräbern von wirtschaftlich und sozial durchaus gleichartigen Populationen geübt wurden, ist daher mit Vorsicht zu betrachten.13
Der chronologische Aspekt des Problems darf indessen nicht übersehen werden. Unter den von Stolpe aus-gegrabenen Brandgräbern ist der grösste Teil der datierbaren Frauengräber der mittleren Periode der Belegungzeit der Gräberfelder von Birka zuzuordnen, während die meisten Körpergräber jünger sind und zur letzten Periode gehören.
Auffallend sind auch die qualitativen Verschiedenheiten der Schmuckanhängerfunde von Birka in der chro-nologischen Abfolge14a. Aus der für diese Kategorie ältesten Phase liegen Schmuckanhänger aus Silberblech mit oder ohne Filigran vor und in einem Fall ein umgearbeiteter orientalischer Silberbeschlag. In der mittleren Periode sind Schmuckanhänger aus Bronze- und Sil-berguss gebräuchlich. Orientalische Silberbeschläge werden zu Schmuckanhängern umgearbeitet, und Silberblechanhänger mit oder ohne Filigran sind noch zahlreicher. Es gibt auch eine kleinere Zahl von Schmuckanhängern aus Bronze- und Eisenblech, und zu Anhängern umgearbeitete Schmuckfragmente u.a. In der spätesten Zeit der Gräberanlagen dominieren Anhänger aus Silberguss und vor allem aus Bronzeguss. Sehr häufig sind auch Schmuckanhänger aus Silberblech mit oder ohne Filigran. Anhänger aus umgearbeiteten orientalischen Silberbeschlägen (s. Kap. 4, Jansson) sind relativ häufig, während die übrigen Anhängertypen fast völlig fehlen.
2.1. Einteilung der gegossenen Schmuck-anhänger in Gruppen
Formal lassen sich die Anhänger in folgende neun Gruppen einteilen. Eine der Gruppen ist darüber hinaus auf Grund der Ornamentik in drei Varianten unterteilt. Innerhalb der Gruppen und Varianten sind Typen zu unterscheiden, zu denen im Muster identische Exemplare gehören.
A: runde, flache Schmuckanhänger mit ungebrochener Kontur, die nicht zur Gruppe C gehören. Variante 1: mit Ornamentik aus Spiralen und/oder Kreisen und Perlenreihen. Taf. 98: 15-19, 21-22. Variante 2: mit Flechtbandornamentik. Taf. 98:23. Variante 3: mit zoomorpher Ornamentik. Taf. 98: 25-28, 99:1-2, 6.
B: Runde, flache Anhänger mit gebrochener Kontur, die nicht zur Gruppe C gehören. Taf. 98:29-30.
C: Feuerstahlförmige Anhänger, flach, rund oder oval. Taf. 103:5-7.
D: Anhänger in Form einer Gesichtsmaske. Taf. 92:5. E: Anhänger in rhomboider Form. Die Ornamentik besteht
aus vier symmetrisch angebrachten und miteinander verflochtenen Feuerstahlmotiven. Die Gruppe steht damit der Gruppe C nahe. Taf. 99:22.
F: Anhänger in Form eines Sieblöffels. Taf. 97:27. G: Anhänger in Form des Thorshammers (s. Birka II:1, Kap.
15, K. Ström). H: Radförmiger Anhänger mit Aufhängevorrichtung, aber
ohne Öse. Taf. 99:21 und 24. I: Andere gegossene Anhänger.
12 Besonders die sehr verschiedenartige Verwendung des Silbers fällt auf. 13 Steuer 1969. 14A Vgl. Callmer 1977, 155f., 168f. Ich benutze die hier von mir vorgeschlagene Einteilung der reich ausgestatteten Frauengräber in Perioden (Callmer 1977, Kap. IV und VIII).
Die älteste Belegungsphase der Gräberfelder von Birka Anhänger aus Silberblech mit Filigran Bj 854; Anhänger aus Silberblech ohne Filigran Bj 462, 539, 597; Anhänger aus einem umgearbeiteten orientalischen Silberbeschlag Bj 552;
Die mittlere Periode der Belegung der Gräberfelder von Birka Anhänger aus Silberguss Bj 29, 523, 825; Anhänger aus Bronzeguss Bj 54, 119, 158, 165, 199, 348, 418, 843 B, 1010; Anhänger aus Silberblech mit Filigran Bj 606, 632, 825, 946; Anhänger aus Silberblech ohne Filigran Bj 632, 800, 825, 849, 946, 950, 966; Anhänger aus Bronzeblech Bj 966, 1064; Anhänger aus Eisenblech Bj 54, 418; Anhänger aus einem umgearbeiteten orientalischen Silberbeschlag Bj 163, 184, 306 A, 523, 557, 606, 632, 800, 925, 838; Anhänger aus einem silbernen Schmuckfragment Bj 513, 649; Anhänger aus einem bronzenen Schmuckfragment Bj 418; Andere Anhänger Bj 39, 163, 370, 606, 632, 649, 925, 843 B, 946;
Die späteste Periode der Belegung der Gräberfelder von Birka Anhänger aus Silberguss Bj 739, 750, 791, 844, 965, 968; Anhänger aus Bronzeguss Bj 371, 502, 642, 759, 762, 823, 835, 844, 860B, 884, 901, 963, 964, 967, 968, 971, 1062, 1084, 1162; Anhänger aus Silberblech mit Filigran Bj 501, 660, 707, 739, 750, 758, 791, 823, 835, 865, 901, 943, 983, 1062, 1161; Anhänger aus Silberblech ohne Filigran Bj 58, 480, 517, 531, 703, 817, 835, 844, 849, 954, 963, 968, 973, 980, 983, 987; Anhänger aus Bronzeblech Bj 980; s. Forts. S. 22.
22 Johan Callmer
2.2. Frequenz der Typen
Gegossene Schmuckanhänger aus Silber oder Bronze mit skandinavischer Ornamentik sind unter den Funden der verschiedenen Gräberfelder von Birka verhältnismässig gut vertreten. Hier besteht wie schon betont wurde ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen Birka und dem übrigen Mälartal, da 23 % der Anhänger von Birka gegenüber nur 3 % im übrigen Mälargebiet aus Silber hergestellt sind.
2.3. Anhänger der Gruppe A, Variante 1
2.3.1. Typ Birka, Grab 199 Taf. 98:17-18. Abb, 3:4 Die Ornamentik des Anhängers Taf. 98:18 besteht aus vier symmetrischen Doppelspiralen, die durch Bänder zusammengehalten werden. In den freien Feldern an der Peripherie des Anhängers runde Knöpfe. Die Mitte bildet ein Ring, von dem kreuzweise vier kurze Bänder ausgehen, die mit der Doppelspirale und einem konzen trischen Ring verflochten sind.
Ein etwas grösserer Anhänger mit demselben Muster liegt (wahrscheinlich) aus Grab 844 vor, Taf. 98:17. Hier ist die Öse erhalten. Sie ist breit (> 0,5 cm) und mit Bandgruppen verziert.
Grösse: Durchmesser 3,9, bzw. 4,1 cm, - also wesentlich grös-ser als die übrigen gegossenen Anhänger.
Dieser Anhängertyp war bisher eigentlich nur in diesen beiden Exemplaren aus Birka bekannt. Kürzlich hat man ein nahe verwandtes, vielleicht zum gleichen Typ gehöriges Exemplar in einem Brandgrab bei Nötanab-ben, Ksp. Edestad, Blekinge, gefunden (Grab. 57)14b.
2.3.2. Typ Vimmerby Taf. 98:21, Abb. 3:1 Die Ornamentik des Anhängers aus Bj 418 geht eben falls von vier Doppelspiralen aus, die hier von vier run den Knöpfen zusammengehalten und abgeschlossen werden. Die Einfassung besteht aus einer Perlenreihe zwischen zwei Graten.
Grösse: Durchschnittlicher Durchmesser dieses Typs ca. 2,3 cm. Öse schmal (< 0,5 cm) und gerade.
Der Zusammenhang mit Schmuckanhängern aus Silberblech mit Filigran erscheint eindeutig (z.B. SHM 2025:7, Sö, Ksp. Tumbo, Berga). Abgesehen von einem Fund in Småland kenne ich diesen Typ nur aus dem Mälartal. S. das Fundverzeichnis.
Anhänger aus einem umgearbeiteten orientalischen Silberbeschlag Bj 518, 573, 791, 817, 845, 860B, 861, 943, 954, 983, 1102; Andere Anhänger Bj 60 A, 543, 571, 750, 835, 844, 860B, 964, 965, 968, 983, 1012, 1084.
2.3.3. Typ Söderby Taf. 98:16 Die Spiralornamentik dieses Typs aus Bj 119 ist von ganz anderer Art als die der beiden oben behandelten Typen. Sie knüpft hier direkt an Pflanzenornamentik an. Senkrecht in der Mitte steigt ein zweiteiliger Stamm von einer Triquetra auf und schliesst oben mit zwei kleinen Spiralen ab. Zwei Paar Seitenzweige sind als einfache Spiralen ausgeführt, oder sie sind unterteilt und haben spiralförmig eingerollte Enden. Alle Ver zweigungsstellen sind durch Bänder markiert. Die Öse ist schmal und fast gleichmässig breit.
Grösse: Durchmesser dieses Typs ca. 2,3 cm.
Verbreitung: Der Typ kommt im Mälartal vor, ausserdem ist ein Fund aus der Sowjetunion bekannt. S. Verzeichnis.
Ein Anhänger dieses Typs wurde kürzlich bei der Untersuchung eines Grabhügels in Slagsta, Ksp. Botkyrka, Sö. gefunden. In dem Grab lagen vier weitere Anhänger von ähnlichem Typ, zwei rhombische und einer vom Typ Riddarholmen 3:25 (Bennet 1972, 251f). Unter den Birkafunden gibt es diesem Typ nahestehende Anhänger sowohl in Filigranarbeit als auch in Metallguss (Taf. 98:10, 15; Bj 791, 967). Abb. 3:2.
2.3.4. Typ Birka Grab 523 Taf. 98:19 Der Silberanhänger aus Bj 523 steht in der Ornamentik dem vorhergehenden Anhänger, Typ Söderby, sehr nahe, doch unterscheidet sich die etwas unsicher gezeichnete Ornamentik vor allem im Mittelteil und in der Form der unteren Spirale deutlich von diesem. Eigentümlich ist auch, dass dieser Anhänger nicht kreis rund, sondern schwach oval geformt ist. Das ist auch bei den Anhängern des Typs A3 (aus Bronze) der Fall.
Grösse: 2,1x1,9 cm (exkl. Öse). Die Öse ist schmal (< 0,5 cm).
Anhänger dieses Typs kenne ich nur aus Birka.
2.3.5. Typ Birka Grab 967 Taf. 98:15, Abb. 3:2 Der Bronzeanhänger aus Bj 967 ist dem oben behandel ten Anhänger Typ Söderby, Taf. 98:16 sehr ähnlich. Seine Ornamentik ist aber einfacher, sie besteht aus einem Pflanzenstamm mit drei Paaren von Spiralen. In der Form ein wenig oval. Direkte Parallelen hierzu sind mir nicht bekannt.
Grösse: 2,3 x2,2 cm (exkl. Öse). Schmale Öse, die nach oben etwas schmäler wird.
Freundlicherweise von Fil. kand. T. Persson, Ronneby, mitgeteilt.
Gegossene Anhänger 23
2.3.6. Typ Alvesta Taf. 98:22, Abb. 3:3 Der Schmuckanhänger, Taf. 98:22 (aus Bj 642) lässt sich mit dem oben behandelten Anhänger, Taf. 98:21 (aus Bj 418) vergleichen. Statt der Doppelspiralen gibt es hier einen Ring in der Mitte, umgeben von vier weiteren Ringen, die alle einen Knopf in der Mitte haben. Auch die Felder zwischen den äusseren Ringen sind mit vier runden Knöpfen ausgefüllt. Die Öse ist wie bei dem Anhänger, Typ Vimmerby Taf. 98:21 bandförmig, wird hier aber an der Basis von zwei Knöpfen flankiert. Dies Detail deutet auf einen nahen Zusammenhang mit manchen Filigrananhängern (vgl. Taf. 98:2 und 5).
Grösse: Grösster Durchm. 2,3 cm, ein wenig ovale Form.
Ein Anhänger vom gleichen Typ stammt aus einem Grabfund von Värendsgatan, Alvesta, Småland (SHM 19803:3; Callmer 1977, 20).
2.4. Schmuckanhänger der Gruppe A, Variante 2
2.4.1. Typ Stora Ryk Taf. 98:23-24, Abb. 3:5 Die Bronzeanhänger, Taf. 98:23 und 24 aus Bj 901 und 502 haben nonfigurative Ornamentik. Ein dreiarmiges Motiv mit konkaven Seiten in der Mitte ist von drei kringeiförmig gewundenen, der Länge nach geritzten Bändern umgeben, die mit einem kreisförmigen Band regelmässig verflochten sind. Wahrscheinlich geht das dreiarmige Motiv auf die Filigrananhänger vom Typ Taf. 97:21-22, Taf. 98:4-6 zurück. Duczko 1985 S. 44, 33-35.
Details der Ornamentik sind bei den einzelnen Ex. ziemlich verschieden.
Grösse: Durchmesser 2,7-3,3 cm (Nur das Exemplar aus Bj 502 weicht mit seinem Durchm. von 2,7 cm ab). Die Ose ist breit (> 0,5 cm) und ist bei Bj 502 als Gesichtsmaske gestaltet.
Ausser den Birka-Funden kenne ich diesen Anhängertyp nur aus St. Ryk, Dalsland (SHM 21668, Arbman 1937B), von Fünen und aus Haithabu (Odense Mus. 11591 bzw. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig, KS 224946 HCJ 43 und Hb sine numero). Ausserhalb Birkas gibt es in Mittelschweden kein Ex. dieses Typs.
2.5. Schmuckanhänger der Gruppe A, Variante 3
2.5.1. Die Typen Kållerstad, Tuna, Träslöv (und Kipplingeberg) Taf. 98:26-28, Abb. 3:6-8 Die in den Birka-Gräbern (Bj 835, 1084 und 968) gefun-denen runden Anhänger mit einem laufenden, zurück-
blickenden Tier vertreten drei Typen dieser Kategorie. Ein weiterer Typ, Kipplingeberg, (Abb. 3:19) liegt in einem Silberanhänger aus Birkas Schwarzer Erde vor (SHM 7187:1). Einen Typ gibt es nur in Norwegen, den Opstad-Typ (Abb. 3:21) (Petersen 1928, Fig. 154), und ein weiterer Typ, der Haugen-Typ, liegt in zwei Funden aus Tröndelag und Blekinge vor. Diese Anhänger sind durch die Öse zu unterscheiden, die in zwei Fällen bandförmig ist (< 0,5 cm). Die Varianten mit breiter Öse sind im Allgemeinen im westlichen Skandinavien verbreitet, während die Anhänger mit schmaler, bandförmiger Öse ausgesprochen östliche Verbreitung haben. Der Kopf des Tieres ist im Profil dargestellt und variiert ein wenig in der Form der Kiefer und der Ohren. Ein Nackenschopf kommt nirgends vor. Auch der Körper ist im Profil dargestellt, langgestreckt, kann aber wohl nur in einem Fall (Typ Kipplingeberg Abb. 3:19) als bandförmig betrachtet werden. Die Kontur des Körpers ist mit einfachen oder doppelten Linien gezeichnet, und seine Fläche ist mehrfach quergestrichelt. Die Beine sind unter den Körper gebeugt, nur in einem Fall (Kipplingeberg-Typ) ist ein Vorderbein vor den Hals hochgehoben. Sowohl Anhänger in durchbrochener Arbeit (z.B. Taf. 98:27-28) wie massive Exemplare liegen vor.
Grösse: Der Durchmesser liegt zwischen 2,3 und 3,0 cm.
Es ist kaum richtig, diese Tierdarstellung direkt mit dem Jellingestil zu verknüpfen. Es gibt andere Anhängertypen, die diesem Stilbegriff besser entsprechen (z.B. JP Abb. 157). Die identische Form bei diesen einander sehr nahestehenden Anhängertypen ist bei ihrer Verbreitung über sehr weite Gebiete bemerkenswert. Das gilt vor allem für den Typ Tuna (Abb. 3:23), der von Island und Sogn und Fjordane im Westen bis zum Ladogasee und dem Gebiet von Smolensk im Osten verbreitet ist (s. Verzeichnis). Das südlichste Exemplar in Skandinavien kommt von Bornholm und das nördlichste aus Jämtland. Von der Verbreitung wird mehr zu sagen sein (Typ Fiskeby).
2.5.2. Typ Lillå Taf. 99:1-2, Abb. 3:9 Die Anhänger (aus Bj 884, 823) gehören zu der Minderheit der Schmuckanhänger von ovaler und nicht kreisrunder Form. Im Rahmen eines Perlbandes zwischen zwei Linien liegt ein kreisförmig gebeugtes Tier im Borrestil mit bandförmigem Leib und separat markierten Bug- und Lendenteilen. Leider bleibt unsere Auffassung der Ornamentik im Detail unklar, da die vorliegenden Exemplare sehr schlecht erhalten sind.
Grösse: Grösster Durchmesser 2,0-2,1 cm, ein wenig oval in der Form. Die Öse ist schmal (< 0,5 cm) und bandförmig.
24 Johan Callmer
Das Vorkommen dieses Anhängertyps beschränkt sich auf Ostskandinavien, genauer gesagt auf das Mälartal. Ausser in Birka gibt es Funde in Lillån, Ksp. Hovsta, Närke (Örebro Mus. 18144) und Överhassla, Ksp. Häg-geby, Uppland (Uppsala Univ. Mus. 4582).
2.5.3. Typ Birka Grab 825 Taf. 99:6 Die Ornamentik des Silberanhängers aus Bj 825 (Taf. 99:6) ist, wie schon Arbman (1943, 299) feststellte, undeutlich. Ob die als Maske gestaltete Öse den Kopf des unklar gezeichneten Tiers darstellt, ist unsicher. Von grossem Interesse ist die perlenförmige Umrah mung dieses Anhängertyps, da sie dem Rahmen schmuck von einigen Beschlägen entspricht, die in den Birka-Gräbern vorkommen und von den Steppengebie ten Osteuropas importiert sind (Taf. 95:1-3, 96:3, 10, s. Kap. 4 unten, Jansson). Der verhältnismässig geringe Durchmesser dieses Anhängertyps mag vielleicht auf eine Imitation der importierten Beschläge deuten. Direkte Parallelen zu diesem Anhänger fehlen, aber im Hinblick auf die Form der Öse und den kleinen Durch messer könnte man zwei Anhänger aus Grävsta, Ksp. Skuttunge, Uppland (SHM 19464:7) erwähnen, die aber sonst keine Gleichheit hinsichtlich der Ornamentik auf weisen.
Grösse: Durchmesser 1,6 cm.
2.5.4. Typ Birka Grab 965 Taf. 98:25 Ein streng symmetrisch gestaltetes Borre-Tier sitzt in der Mitte dieses Schmuckanhängers. Der Kopf ist en face dargestellt, an den der Leib in Form einer Trique- tra anschliesst. Oberkörper und Hinterteil sind getrennt dargestellt und je mit einem wimpelförmigen Zipfel ver sehen. Ein Hinterbein und ein Vorderbein greifen um den Rahmen des Anhängers, während die beiden ande ren Beine an der Schnauze liegen. Die geritzten Linien sind teilweise quergestrichelt.
Grösse: Die Öse ist breit (> 0,5 cm). Durchmesser 2,7 cm, horizontal gemessen.
Die hier vorliegende vollständige Symmetrie der Orna-mentik kommt in der Metallkunst der Wikingerzeit relativ selten vor - ausser an den ovalen Spangen. Die Form des Anhängers deutet vielleicht auf einen Zusammenhang mit dem feuerstahlförmigen Typ.
Dieser Anhängertyp ist mir sonst nirgends begegnet. Man kann aber einen weiteren relativ späten Anhängertyp aus dem Mälartal heranziehen, dessen Rahmen der Form des Feuerstahls ähnelt (Haga 2186, Ksp. Svinnegarn, Uppland, SHM 25240; vgl. auch Bennett 1972, Fig. 76), der ebenfalls spät zu sein scheint.
2.6. Schmuckanhänger der Gruppe B
2.6.1. Typ Norelund Taf. 98:29-30, Abb. 3:10 Die Anhänger Bj 371, 791 gehören zu einer kleinen Gruppe in durchbrochener Arbeit in runder Form aber mit gebrochener Kontur. Dargestellt ist ein vierfüssiges Borre-Tier mit dem Kopf en face gesehen. Bug und Lenden sind separat gestaltet. Ein Hinterfuss greift um die Mitte des Tiers, die anderen drei Füsse greifen um den Rahmen. Eine Folge von vier Köpfen im Profil mit Nackenschopf bildet den Rahmen. Das Exemplar Taf. 98:30 (Bj 791) ist im Detail der Ornamentik etwas vereinfacht.
Grösse: Grösster Durchmesser in der Regel: 3,4 cm. Die Öse ist breit (0,5 cm) und verziert.
Der Anhänger kommt in zwei Versionen vor, teils mit Ohren an der Basis der Öse, die meistens hervorstehen (Typ Norelund), teils ohne diese Ohren (Typ Skemo, s. Verzeichnis und Abb. 3:24). Alle Exemplare aus den Birka-Gräbern, sowie sämtliche ostskandinavische Funde haben markierte Ohren. Auch in Westskandinavien ist die Variante in zwei Exemplaren vertreten (Univ. oldsaksaml., Oslo, C 9463-72, SHM 115), wo auch die Variante ohne Ohrenmarkierung vorkommt. Gussformfragmente zur Herstellung der ostskandinavischen Variante liegen in Haithabu vor.
Die Ornamentik dieses Anhängers zeigt deutlich die Parallelen zwischen Borrestil und Jellingestil (Jansson 1970, 36ff). Ein sehr ähnlicher Anhänger in kreisrunder Ausführung mit dem Kopf des Tieres auf der Öse ist nur in Ostskandinavien und Osteuropa verbreitet (der Typ von Riddarholmen Abb. 3:25; SHM 15340, Bennett 1972, Fig. 8; Sizov 1902, Tab. V:14; Kivikoski 1939, Taf. XXVIL7; Brandenburg 1885, ris. 13). Ein paar andere, sehr ähnliche Anhänger, sowohl mit gebrochener wie mit ungebrochener Kontur kommen nur im Mälartal und benachbarten Gebieten vor (SHM 12016:A Gä, Ksp. Hedesunda, Östveda, 19464:1 Up, Ksp. Skuttunge, Grävsta, 19490:13 Up, Ksp. Bälinge, Kipplingeberg).
2.7. Schmuckanhänger der Gruppe C
2.7.1. Typ Birka Grab 158 Taf. 103:7, Abb. 3:4 Der Anhänger aus Bj 158 kann, ohne Rücksicht auf die Datierung des Skelettgrabs mit gleicher Nummer auf das späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert, mit den feuer-stahlförmigen Anhängern der frühen Wikingerzeit verknüpft werden.
Eine Eigenheit des zu dieser Gruppe gehörigen Exemplars ist das Fehlen zoomorpher Ornamentik. Mir
Gegossene Anhänger 25
ist sonst nur etwa ein halbes Dutzend Exemplare dieser Gruppe ganz ohne Spuren von Tierornamentik bekannt (z.B. SHM 5560; Uppsala Univ. Mus. 5648; LUHM ohne Nummer).
Grösse: Grösster Durchmesser dürfte ca. 3,5 cm gewesen sein. Die Öse des Anhängers ist schmal (< 0,5 cm).
Feuerstahlförmige, gegossene Anhänger (s. Birka II: 1, Kap. 15, Ström) sind für die Wikingerzeit in Ostskandinavien typisch, sie kommen vom östlichen Schonen und Pommern im Süden bis Gästrikland im Norden vor. Der westlichste Fund stammt aus Draftinge, Ksp. Ås, Småland (SHM 6746:B; vgl. Almgren 1955, 77ff.). Ähnliche Anhänger gibt es auch in Hedmark und Nordland in Norwegen (Univ. oldsaksaml. C 24466, Oslo und Tromsø 1965/109).
2.7.2. Typ Birka Grab 860 B Taf. 98:20 Zu dem feuerstahlförmigen Anhänger aus Bj 860B sind keine Parallelen bekannt. Arbman (1943, 337) meint, die Ornamentik des Anhängers imitiere Filigran. Wahr-scheinlich sind es eher die Stempelmuster der feuer-stahlförmigen Anhänger aus Silberblech, die als Vorbild dienten (Petersen 1928, Fig. 168).
Grösse: Grösster Durchmesser ca. 2,4 cm. Die bandförmige Ose ist ca. 0,5 cm breit.
2.8. Schmuckanhänger der Gruppe D (Typ Gile)
2.8.1. Typ Birka Grab 642 Taf. 92:5-6, Abb. 3:12 Die beiden Anhänger, Taf. 92:5 und 6 (aus Bj 642 und 860B) in Form eines Mannskopfes sind in dieser Form nur aus Birka bekannt. Charakteristisch ist hier die ein fache, realistische Darstellung des Kopfes.
Grösse: Länge der beiden erhaltenen Exemplare wahrschein-lich ca. 4,2 cm. Die verzierte Öse ist breit (> 0,5 cm).
Der mit dem vorliegenden Anhänger nahe verwandte Gile-Typ (Abb. 3:26) mit nicht gespaltenem Bart kommit vor allem im westlichen Skandinavien, einschliesslich Island vor, ist aber auch aus einem Fund in Södermanland bekannt (SHM 17804:8 Ksp. Tumbo, Prästgården). Die wenigen Kombinationen, in denen die Gile-Typ vorkommt, deuten auch auf eine Datierung auf das spätere 10. Jahrhundert. (Nordfjord, Sogn o. Fjordane und Arnestad, Ksp. Gjemmestad; Gloppen p., Sogn o. Fjordane (Hist. mus., Bergen B 5525, 7653).
2.8.2. Typ Birka Grab 649 Taf. 92:12 In der Grabkammer Bj 649 lag ein kleiner, vergoldeter Silberanhänger in Form eines bärtigen Mannskopfes.
Trotz der starken Abnutzung sind Augen, Nase, Schnurrbart und Mund deutlich markiert. Das Schmuckstück kann beim ersten Anblick den Eindruck machen, als sei es von einem grösseren Schmuckstück oder Beschlag abgebrochen und abgefeilt. Aus den unten angeführten Gründen dürfte es aber keine Adaption eines Fragments darstellen, sondern als ein Typ für sich aufzufassen sein.
Grösse: L. 2,1 cm. Br. 0,8 cm.
Ein fast identischer Anhänger aus vergoldeter Bronze wird zusammen mit dem Inventar eines Grabs aus Geneby, Ksp. Själevad, Ångermanland verwahrt (SHM 4180), das aus das 10. Jahrhundert zu datieren ist.
Der Anhänger befindet sich indessen nicht im ursprünglichen Verzeichnis der Funde im Katalog, weshalb seine Herkunft unsicher ist. Da aber das Material in SHM seit sehr langer Zeit nach Provinzen zusammengehalten wird, ist es nicht unwahr-scheinlich, dass er zu einem Fund aus Norrland gehört.
In Bj 649 lag noch ein weiterer Männerkopf in Sil-berguss (Taf. 92:3a-c, Birka I, 228). Dieser ist mit einer Öse versehen. Er wird hier nicht als Schmuckanhänger im gewöhnlichen Sinn behandelt, da er offenbar direkt mit zwei stilistisch nahestehenden, gegossenen Armen mit markierten Händen und Fingern zusammengehört (s. Arwidsson, Kap. 9:6).
Das Grab Bj 649 ist ausserordentlich interessant, da es zu einer kleinen Gruppe der ältesten Körpergräber gehört, die mit der Anfangsphase von Birka als Handelsplatz in Zusammenhang gebracht werden können. Die zu diesem Fund gehörigen Perlen (u.a. Taf. 114:8, 117:13, 20, 121:19a-b) können im Hinblick auf die Dendro-Datierungen von Staraja Ladoga kaum jünger als von etwa 830 sein (vgl. auch Callmer 1977, 105ff.).
2.9. Schmuckanhänger der Gruppe E
2.9.1. Typ Gnezdovo Taf. 99:22, Abb. 3:13 Zu dieser Gruppe gehört nur der vierkleeblattförmige Anhänger aus Bj 860B, Taf. 99:22. Das Ornament besteht aus vier ineinander verflochtenen feuerstahlförmigen Ringen in durchbrochener Arbeit.
Grösse: Durchmesser 2,7 cm. Die Öse ist schmal (< 0,5 cm) und bandförmig.
Ausser in Birka kennt man diesen Anhängertyp nur aus Gnezdovo, im Gebiet von Smolensk, USSR, wo er zusammen mit segmentierten Glasperlen gefunden wurde (Spicyn 1905 A, 39).
26 Johan Callmer
Abb. 3:1. Bj 418. A1 (Taf. 98:21).
Abb. 3:2. Bj 967. A1 (Taf. 98:15).
Abb. 3:3. Bj 642. A1 (Taf. 98:22).
Abb. 3:4. Bj 639. A4 (Taf. 98:17).
Abb. 3:6. Bj 835. A3 (Taf. 98:26).
Abb. 3:7. Bj 1084.
A3 (Taf. 98:27).
Abb. 3:8. Bj 968. A3 (Taf. 98:28).
Abb. 3:5. Bj 901. A2 (Taf. 98:23).
Abb. 3:9. Bj 884.
A3 (Taf. 99:1).
Abb. 3:10. Bj 371. B (Taf. 98:29).
Abb. 3:11. Bj 158. C (Taf. 103:7). Abb. 3:12. Bj 642.
D (Taf. 92:5).
Abb. 3:13. Bj 860B. E (Taf. 99:22).
Abb. 3:14. Bj 963. F (Taf. 97:27).
Abb. 3:15. Bj 844. H (Taf. 99:24).
Abb. 3:1-15. Anhängertypen aus Birka-Gräbern. Skala 1/1. Photo W. D. und ATA.
Gegossene Anhänger 27
Abb. 3:16.
Nordfjord, Norwegen. A1
Abb. 3:17. Gnezdovo, Russland
(Nach Spicyn 1905 A).
A1
Abb. 3:18. Fuglie, Sk.
A2
Abb. 3:19. Sorunda, Sö.
A3
Abb. 3:20. Kung Karl, Sö.
A3
Abb. 3:21. Skemo, Norwegen.
A3
Abb. 3:22. Kipplingeberg, Up.
A3
Abb. 3:23. Tuna, Alsike, Upl.
A3 (Typ Tuna).
Abb. 3:24.
Skemo, Norwegen. B
Abb. 3:25. Gnezdovo, Russland.
B Abb. 3:26.
Gile, Norwegen (Nach B.M.Å. 1904:6).
D
Abb. 3:16-26. Anhängertypen: Vergleichsmaterial. Skala ca. 1/1. Photo B, C1, ATA, W. D., Zeichn, nach Spicyn 1905 A.
Abb. 3:16. Nordfjord, S. og Fj. Norwegen.
Abb. 3:17. Gnezdovo, Russland. (Nach Spicyn 1905 A.)
Abb. 3:18. Fuglie Ksp. Sk.
Abb. 3:19. Sorunda Ksp. Sö. Abb. 3:20. Kungshatt, Lovö Ksp. Up. Abb. 3:21. Skemo. Aust Agder, Norwegen1 Abb. 3:22. Kipplingeberg, Bälinge Ksp. Up.
Abb. 3:23. Tuna, Alsike Ksp. Up. Typ Tuna.
Abb. 3:24. Skemo, Aust Agder, Norwegen1.
Abb. 3:25. Gnezdovo (Schatzfund 1868), Gebiet Smolensk, Russland.
Abb. 3:26. Gile, Hof Ksp., Norwegen. (Nach B.M.Å. 1904:6.
© Universitetets Oldsaksamling, Oslo.
28 Johan Callmer
2.10. Schmuckanhänger der Gruppe F (Sieblöffel)
2.10.1. Typ Birka Grab 963 Taf. 97:27, Abb. 3:4 Die Ornamentik dieses Anhängers, der mit einem runden Sieb abschliesst, besteht aus vier en face gezeichneten Köpfen im Borrestil, deren Leiber zu je zwei Spiralen jeweils mit einer Greifklaue stilisiert sind. Eine ähnliche Ornamentik gibt es an bestimmten gleicharmigen Spangen (Hildebrand 1880, Fig. 239). Der auffällig spitzwinklige En-face-Kopf am Ende des Schaftes hat grosse Ähnlichkeit mit manchen Köpfen an Ringnadeln ostskandinavischer Typen (Taf. 42:1, 3, 43:5, 7; s. Thunmark-Nylén 1984, 5ff.).
Grösse: Gesamtlänge 9,1 cm.
Dieser Anhänger mit Sieb ist der jüngste Beleg der skandinavischen Weiterentwicklung eines älteren mit-teleuropäischen Typs von Gegenständen (Roes 1958), der im 1. Jahrtausend nach Chr. in verschiedenen Teilen des „Barbaricum" weit verbreitet war. Ein weiteres gegossenes, spätes Exemplar aus der Wikingerzeit liegt aus dem Mälartal vor (Brista, Ksp. Norrsunda, Uppland, SHM 26042:181/121). Silberne Sieblöffel, sowohl aus Blech (Bj 632) als auch aus Metallguss (Hist. mus., Bergen B 708-17) kommen in wikingerzeitlichen Funden vor.
2.11. Schmuckanhänger der Gruppe G
2.11.1. Die Typen Birka Grab 750 und 964, Thorshämmer Taf. 104:4 und 6 Zwei Thorshämmer aus Silberguss bzw. Bronzeguss liegen aus Bj 750 und 964 vor. Diese Anhänger aus Metallguss gehören im allgemeinen zu einer späten Phase, während Thorshämmer aus Eisen an Halsringen in mindestens einem Fall sehr früh datiert werden können (Arwidsson 1942, 79). Ein früher Fund eines Thorshammeranhängers aus Bronze stammt aus Schleswig-Holstein (Stein 1967, 348).
Die beiden Thorshämmer aus Silberguss müssen im Zusammenhang mit den ihnen nahestehenden Anhängern aus Silberblech betrachtet werden (s. Abschnitt 3). Ausführlicher werden die thorshammerförmigen Anhänger von Ström 1984, Birka II:1, Kap. 15 behandelt.
2.12. Schmuckanhänger der Gruppe H. (Radförmige)
2.12.1. Typ H:l Birka Grab 844 Taf. 99:24, Abb. 3:15
Der radförmige Anhänger aus dem Brandgrab Bj 844 ist aus Bronze gegossen, vergoldet und hat eine Knotenor-
namentik, die Filigran imitiert (s. Birka I, Abb. 266). Die Rückseite ist nicht verziert. Die Radspeichen sind deutlich als radiale Grate von der erhöhten, realistisch ausgeführten Nabe aus markiert.
Grösse: Durchmesser 2,8 cm.
Ein sehr ähnlicher radförmiger Anhänger liegt in Schonen vor (SHM 9822:812; Hårdh 1976 B, Taf. 55:VII). In der Ornamentik sind nur unbedeutende Unterschiede nachweisbar. Das Exemplar aus Schonen besteht aus vergoldetem Silber.
2.12.2. Typ H:2 Birka Grab 29 Taf. 99:21, Abb. 11:4 Der radförmige Anhänger aus dem Brandgrab Bj 29 besteht aus Silber und ist heute stark beschädigt. Die Öse aus Bronzedraht ist durch ein Loch in der Mitte der Radnabe gezogen. Die Speichen sind in durchbrochener Arbeit ausgeführt und die Verzierung besteht aus gestempelten Kreisen.
Grösse: Durchmesser 2,3 cm.
Ausser ein paar radförmigen Anhängern mit Tierorna-mentik, dem oben genannten aus Bj 844 und Kopenhagen C 27256 gibt es einen einfachen radförmigen Anhänger aus Silber in einem unsicheren Grabfund in Westnorwegen (Hist. Mus., Bergen B 708-17). Aus dem Mälartal kenne ich diesen Anhängertyp - abgesehen von Birka - nur auf Helgö (Excavations at Helgö I, 115). Ein radförmiger Anhänger von ganz anderem Typ aus einem Brandgrabfund in Gästrikland ist ein Import von der Saltov-Majaki-Kultur (SHM 19847:30 C, Gävle Mus. 5372; Pletneva 1957, 175).
2.13. Weitere gegossene Schmuckanhänger
Die beiden Silberanhänger, Taf. 92:15 und Taf. 102:6 sind gegossen, sie müssen aber in Zusammenhang mit den ihnen nahestehenden Anhängern aus Silberblech betrachtet werden.
3.1. Die Frage der Datierung
Nach der allgemeinen Übersicht über die in den Birka-gräbern gefundenen gegossenen Schmuckanhänger können wir hinsichtlich der Datierung feststellen, dass sie im Wesentlichen zu den jüngeren Gräberfeldern gehören. Abgesehen von der sehr frühen Gruppe der feuer-stahlförmigen Anhänger, die aus der Schwarzen Erde bekannt sind, (SHM 5208:89 und 12160), aber noch nicht in Gräbern angetroffen wurden, dürften die gegossenen Anhänger nicht eher als um die Mitte des 10. Jahrhunderts oder etwas früher auftreten. Die Orna-
Gegossene Anhänger 29
mentik der ältesten Anhänger (Variante A1) besteht aus paarweise geordneten Spiralen oder Doppelspiralen, die den Anhängern aus Silberblech mit Filigran direkt entsprechen. Verhältnismässig frühe Kombinationen finden wir z.B. in Grab 19 auf dem Gräberfeld 98 in Söderby, Ksp. Danmark, Uppland und Grab 3, Gräberfeld 12 in Bådstorp, Ksp. Kvillinge, Östergötland. Wahrscheinlich hatte die Verwendung runder Silberanhänger mit Filigran eine reiche Blüte gerade um die Mitte des 10. Jahrhunderts (s. Duczko 1985, 106ff und Stenberger 1958, 160; vgl. Hårdh 1976A, 85). Anhänger der Variante A3 und der Gruppe B mit Tierornamentik kommen erst um die Mitte und in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts vor. Die Gruppe B (Taf. 98:29-30) mag vielleicht etwas älter sein. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts treten also Anhänger mit Spiralschmuck und mit Tierornamentik eine Zeitlang parallel mit zahlreichen anderen Typen auf. Nach dem Ende des 10. Jahrhunderts verschwinden diese Anhänger zugleich mit vielen anderen Schmucksachen aus Metallguss.
3.2. Die Verbreitung auf den Gräberfeldern von Birka
Die Verbreitung der Anhänger auf die Gräberfelder von Birka geht aus der Abb. 3:36 hervor, die zeigt, dass die Gruppen A-F sich bis zu einem gewissen Grade auf die Gräberfeldbezirke 1A, 1C und 2A konzentrieren. Im übrigen verteilen sie sich dünn auf die Gräberfelder 1 und 4. Dies Verbreitungsbild entspricht der hauptsächlichen Lage der Gräber aus dem 10. Jahrhundert ziemlich gut.
3.3. Provenienz und Verbreitung
Die Frage nach der Herkunft der Anhänger ist äusserst wichtig zum Verständnis der Rolle Birkas als Handelsplatz und Produktionsort. In anderem Zusammenhang habe ich die Ansicht vertreten, dass die Herstellung von Schmuck aus Bronzeguss in Birka nur beschränkt vorkam (Callmer 1977, 177). Eine Untersuchung der hier behandelten Funde stützt diese Auffassung in gewissem Masse. Von 21 Typen skandinavischer Anhänger aus Bronze- und Silberguss kommen vierzehn ausschliesslich in Ostskandinavien und Osteuropa vor (s. Verbreitungskarten Abb. 3:27-35). Sechs dieser Typen sind nur aus Birka bekannt, zwei aus Birka und dem Mälartal, drei aus Birka und Ostschweden und einer aus Birka und Osteuropa. Es dürfte interessant sein, bei diesen 21 Typen die Zahl der bekannten Funde der nur in Ostskandinavien vorkommenden Typen mit der Zahl der auch ausserhalb dieses Gebiets vorkommenden zu ver-gleichen. Die ersteren kommen 40 Mal vor (durch-
schnittlich 2,5 Mal pro Typ), während die letzteren 63 Mal (durchschnittlich 9 Mal pro Typ) vorliegen. Die nur mit Ostskandinavien, und da vor allem mit dem Mälartal verknüpften Anhänger treten also in verhältnismässig kleinen Serien auf. Die meisten nur in Birka gefundenen Anhänger sind nur in einem oder zwei Exemplaren bekannt, während die in Ostskandinavien verbreiteten etwas zahlreicher sind. Dabei ist zu beachten, dass eins der letzteren nur im Mälartal und in Birka vorkommt, Birka Grab 963 (Taf. 97:27). Auch die Anhänger Taf. 98:17 und 18 (Birka Grab 199), 21 und 22 (Typ Vimmerby und Alvesta), Taf. 99:1 und 2 (Typ Lillå) gehören in diesen Zusammenhang, da sie jeweils nur einmal ausserhalb des Mälartals auftreten (Verbreitungskarten Abb. 3:27-35). Das gilt vor allem für den Typ Lillå, der nur in einem Schatzfund aus Öland vorkommt (SHM 129).
Es ist auffällig, dass mehrere skandinavische Schmuckanhänger mit sehr weiter Verbreitung in den Birka-Gräbern fehlen, von denen u.a. mehrere im Mälartal vorkommen. Besonders bemerkenswert ist das Fehlen der Typen Fiskeby, Gryta, Liljenäs und Arnestad (Verbreitungskarten Abb. 3:32). Wichtig ist es auch festzustellen, dass die Typen von gegossenen Anhängern, die in Norrland, auf Aland und in Finnland vorkommen, zu den in Skandinavien sehr weit verbreiteten Typen gehören15. Diese Tatsache scheint darauf zu deuten, falls in Birka Schmuckanhänger gegossen wurden - und das wäre nicht unmöglich bei der Mehrzahl der nur in Birka vorkommenden Anhänger, so wenig wie bei denen, die nur in Birka, im Mälartal und im übrigen östlichen Schweden auftreten - dass das Absatzgebiet nicht nur südlich, sondern auch nördlich und östlich begrenzt war. Diese Verbreitungstendenz steht in scharfem Kontrast zu der Verbreitung der im grösseren Teil von Skandinavien vorkommenden Schmuckanhänger (Verbreitungskarten).
3.4. Produktionsverhältnisse
Hier sei auch eine wichtige Frage im Hinblick auf die Produktion aufgegriffen. Bei den übrigen Schmucksachen der Wikingerzeit ist es schwierig, das Verhältnis zwischen primären und sekundären Produkten, Originalen und Nachbildungen, zu bestimmen. In einem auch
15 SHM 7965, 13887, 18809:4, 22293, 26127: 94, Zornmuseet (Mora), LMG (Gävle) 7172, JLM (Östersund) 530, Härnösand Mus. 1946ff., Mariehamn Mus. (Åland) 57:29, 58:33,34, 300:1, 367: Grab 81, NMH (Helsingfors) 4617:8, 4780:47, 7603:24. Eine Ausnahme stellt NMH (Helsingfors) 7603:25 dar. Die Situation ist in Osteuropa im Wesentlichen dieselbe, mit Ausnahme hauptsächlich des obengenannten Typs: Brandenburg 1895, Tab. VII:5, Sizov 1902, Tab. IV:1, 2, Spicyn 1905 B, ris. 9, 12, 13.
30 Johan Callmer
sonst bemerkenswerten Grabfund von Årby, Ksp. Tur-inge, Södermanland, gibt es eine ganze Reihe von Anhängern, die offenbar Nachbildungen primärer Typen sind, u.a. einen Versuch, den Typ von Tuna zu kopieren. Im übrigen scheinen sekundäre Exemplare/ Nachbildungen auch unter den Anhängern ungewöhnlich zu sein.
Meiner Ansicht nach sind die gegossenen Bronzean-hänger mit identischer Ornamentik, die im grösseren Teil von Skandinavien - in einigen Fällen sogar auf Island und in Russland - verbreitet waren, eher in nur wenigen Orten mit guten Verbindungen zwischen denselben hergestellt worden, als in einer grösseren Anzahl lokaler Werkstätten, die kontinuierlich mit identischen Matrizen beliefert wurden, wie es Jansson vorschlägt (1981, 7-8; 1985, 12). Ebenso ist für die Bronzegiesserei ein Wanderhandwark mit einem sehr weitverzweigten System von Reiserouten nicht gut denkbar im Hinblick auf die für das frühe Mittelalter belegten politischen, juridischen und administrativen Verhältnisse16. Zu dieser wichtigen Frage muss man die bedeutendste Kategorie des gegossenen Bronzeschmucks, die ovalen Spangen heranziehen (s. Jansson 1985, 85; Callmer 1977, 176). Die ovalen Spangen sind in Serien in wenigen Werkstätten hergestellt17. Eine Auswertung der Ge-samtherstellung von Gegenständen aus gegossener Bronze in der Wikingerzeit zeigt eine weitgehende Kontinuität und enge gegenseitige Beziehungen der Produkte in Technik und Ornamentik. Technische Details der Herstellung, z.B. die Brandvergoldung (Oldeberg 1966, 187) und der Weissmetallbelag deuten auf starke Spezialisierung (Capelle & Vierck 1971, 98). Die Tatsache, dass die Rohstoffe, alle Bronze, alles Quecksilber und ein Teil des Goldes, von Produktionsgebieten ausserhalb Skandinaviens importiert wurden, dürfte eher für eine Konzentration der Produktion auf nur wenige Orte sprechen, als für die Herstellung in vielen regionalen Werkstätten. Auch war die Funktion des Bronzeschmucks wohl eher die eines Tauschobjekts als die einer Anregung lokaler Handwerkstüchtigkeit18.
3.5. Die Verbreitung gegossener Bronzegegenstände in Nordeuropa
Ein Vergleich der Verbreitung gleichzeitiger Bronze-gussfunde in Nordeuropa ist sehr aufschlussreich. Der skandinavische Kreis ist auffallend gross, er umfasst Schleswig-Holstein, ganz Dänemark, Norwegen, Island und Schweden ausser Gotland. Gotland ist in dieser, wie in mancher anderen Hinsicht, eine Provinz mit einem Sondergepräge. Daneben sind mehrere östliche Verbreitungskreise erstaunlich klein, z.B. der westfinnische, der estnische und der kurische. Gewissermassen
ein Gegenstück zum skandinavischen Kreis stellt im Norden und Osten das permische Verbreitungsgebiet dar. Die Grenzen dieser Gebiete ergeben sich wahrscheinlich aus mehreren Faktoren. Wichtig waren vor allem administrative und handelspolitische Verhältnisse, aber auch ethnische Unterschiede dürften eine Rolle gespielt haben. In den kleinsten hier genannten Gebieten, die im Wesentlichen mit juridisch einheitlichen Stammterritorien zusammenfallen dürften, ist ein Wanderhandwerk innerhalb des Gebiets durchaus denkbar. Voraussetzungen für eine solche Organisationsform hatten vielleicht Südwestfinnland19 und Gotland20. Beide Gebiete zeigen eine markante Geschlos-senheit nach aussen. Zwar können wir auch in Skandinavien kleinere Produktions- und Absatzgebiete wahrnehmen, doch sind diese von anderer Art.
Die Verbreitung der vielleicht lokalen Typen von Anhängern in Birka und im Mälartal deutet wahrscheinlich darauf, dass es für die Anhänger ein lokales Absatzgebiet gegeben hat, das womöglich vom Herstellungsort Birka, aber vielleicht auch gelegentlich von einem grösseren Markt wie dem von Lindqvist vorgeschlagenen Gamla Uppsala ausging21. Ausserdem existierten einige wenige örtliche Handwerker, die versuchten, die Originalproduktion nachzubilden. Ihre Rolle war jedoch unbedeutend.
16 Capelle (1968, 91 ff.) und Kyhlberg (s. Ambrosiani et al. 1973, 164) deuten die Schmuckherstellung in der Wikingerzeit als Arbeit von wandernden Handwerkern. Werner (1970, 70) gibt Beispiele von Wanderungen durch mehrere politische Zonen in Mitteleuropa, er weist aber auch auf die offensichtlichen Gefahren hin. 17 Capelies Argumente für die Herstellung ovaler Schalenspangen eines bestimmten Typs nur in einer lokalen Werkstatt hat sich bei einer Gesamtuntersuchung der skandinavischen Funde als hinfällig erwiesen (1968, 67). Callmer 1977, 176, Oldeberg 1966, 187, Capelle & Vierck 1971, 98. 18 Eine deutliche Auffassung der konkreten Tauschsituation ist für die Deutung von grundlegender Bedeutung, auch wenn es sich nur um eine Hypothese handelt. Vgl. Callmer 1977, 177-9. 19 Werkstätten eines Typs, wie er sich in dem Gussformenfund von Hylli andeutet, sind in einem solchen System denkbar (vgl. Edgren 1968). Der Fund ist jedoch spät zu datieren und daher für die Verhältnisse im 9. und 10. Jahrhundert vielleicht nicht vollständig zutreffend. 20 Für die Beurteilung der Verhältnisse auf Gotland dürfte der Giesse-reifund von Smiss, Ksp. Eke, wichtig sein (Zachrisson 1962). Die Auffassung Zachrissons (S. 206), dass alle Gegenstände des Fundes auf Gotland hergestellt seien, erscheint wenig glaubhaft. Es ist wohl kaum notwendig, den Fund als das Werk eines Wanderhandwerkers aufzufassen. Die allgemein skandinavischen Gegenstände des Fundes, d.h. die drei runden Spangen und die Unterschalen zu ovalen Schalenspangen, sind eher als importierte Halbfabrikate zu betrachten. Im System der gotländischen Tracht waren die Schmucktypen des skandinavischen Festlandes eigentlich gar nicht akzeptiert worden. Der Import von Rohmaterial als Halbfabrikat ist ja nicht unbekannt. Es sollte möglich sein, den Fund von Smiss geradezu als Depot von Rohmaterial zu betrachten, was teilweise durch den unvollständigen Zustand der Gegenstände und ihre schlechte Qualität bestätigt wird (Zachrisson 1962, 222-3). Export von noch nicht ganz fertigen Gegenständen von allgemein skandinavischen Typen scheint in der Wikingerzeit vorgekommen zu sein (vgl. Bakka 1965, 142-3, und Lundström 1974, 93).
Gegossene Anhänger 31
3.6. Die Relevanz der Fundkarten
Für die obigen Überlegungen ist es wichtig festzustellen, ob die Fundkarte uns ein zuverlässiges Bild gibt, - ein grundlegendes Problem, das mehrere Archäologen behandelt haben (z.B. Eggers 1940, Stjernquist 1967). H. Jankuhn hat in einer Studie, die dem vorliegenden Beitrag thematisch nahesteht, die Relevanz skandinavischer Verbreitungskarten für Metallgegenstände zwischen ca. 940 und 1000 n.Chr. behandelt, u.a. auch für Schmuckanhänger und runde Spangen der Typen Lilje-näs Abb. 3:18 und Tjureda Toregård (Jankuhn 1950, 11-12). Jankuhn meint, dass im westlichen Ostseegebiet die Sitte, Schmuck als Beigaben in den Gräbern niederzulegen, im Lauf dieser Periode aufhört. Die Fundkarte wäre also für Südwestskandinavien mit anderen Worten nicht zuverlässig. Von Anfang an müssen wir uns aber klarmachen, dass eine solche, an sich denkbare Veränderung mehr als einen Grund oder andere Erklärungs-gründe haben kann. Theoretisch betrachtet könnte es sich ebenso gut so verhalten, dass sich die Kleidungsweise gewandelt hat oder dass sich die äusseren Han-delsverbindungen oder die innere wirtschaftliche Struktur verändert haben.
Nun verhält es sich wohl kaum so, dass die Anwendung allgemein skandinavischen Bronzeschmucks in Südwestskandinavien aufgehört hätte. Das geht deutlich aus Brøndstedts Darlegung (1936) hervor, nach der es -abgesehen von Bornholm - im 10. Jahrhundert sieben Fibelfunde gab (Fundnummern 25, 37, 48:3, 70:12, 99, 118 und 120) gegenüber dreizehn Fibeln (Fundnummern 11, 45, 57, 58, 68, 73, 74, 76, 77:2, 81, 112, 116, 149) in der vorhergehenden Periode (dem späten 8. und dem 9. Jahrhundert). Diese Beobachtung bestätigen spätere Funde wie die Gräberfelder Hesselbjerg (Andersen & Klindt-Jensen 1971), Stengade (Skaarup 1976) und Trelleborg (Nörlund 1948) in Dänemark und Råga Hörstad (Strömberg 1968) und Norrvidinge in Westschonen (nicht publizierte Funde im Hist. Mus. der Univ. Lund), wo gerade späte Fibeln, vor allem kleine runde Spangen, vorkommen, wenn auch nur in geringer Zahl. Zwei ovale Schalenspangen von Typen des 10. Jahrhunderts sind z.B. auch aus Århus bekannt (Hellmuth Andersen et al. 1971, 215). Hieraus müssen wir schliessen, dass es nicht unmöglich ist, dass sich die Tracht in Südwestskandinavien im 10. Jahrhundert ver-ändert hat, aber kaum radikal. Die Tracht mit der Fibel wurde auch hier von mehreren Individuen während
Um ethnisch bedingte Absatzgebiete hat es sich kaum gehandelt (vgl. Capelle und Vierck 1971, 89-91). Aus Gamla Uppsala ist ein Fund eines wikingerzeitlichen Gussformfragments (zu einer ovalen Spange) zu erwähnen, das unter der heutigen Kirche lag (Nerman 1943, Fig. 48). Ein älterer Markt in Gamla Uppsala ist von Lindqvist (1953) vorgeschlagen.
eines grossen Teils des 10. Jahrhunderts getragen. Die Tracht mit zwei ovalen Spangen kann also allmählich mit der Zeit seltener geworden sein, aber die Veränderung hat nicht zur Folge gehabt, dass andere Fibeln, die nicht so spezifisch mit einem Kleidungsstück verbunden waren, aus dem Gebrauch gekommen wären. Und es dürfte kein Hindernis bestanden haben, auch weiterhin Schmuckanhänger zu tragen.
Auch die beiden anderen Erklärungegründe sind zu beachten. Es ist unwahrscheinlich, dass verschiedene geographische Gebiete in Skandinavien in einem Zeitraum von 200 Jahren alle miteinander die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten, Schmuck zu erwerben und dann reiche Gräber auszustatten. Es verhält sich ja unwiderleglich so, dass der Schwerpunkt des wikingerzeitlichen Fundmaterials sich allmählich von Westen nach Osten verlagert. Diese Beobachtung kann man auch bei einem Vergleich zwischen norwegischen und schwedischen Funden machen (Callmer 1977, 162, 175-176). Es ist wenig glaubhaft, dass das Christentum die Begräbnisweise bedeutend beeinflusst hat. Auch späte reiche Funde liegen im Zentrum der Bebauung überall in Norwegen, ebenso wie auf Island. Auch die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Gemeinwesen ist zu beachten. Die archäologischen Funde deuten auf den Machtzuwachs einer besitzenden Schicht, für die Reitergräber mit voller Ausrüstung charakteristisch sind (Callmer 1977, 108-109). Diese Veränderungen deuten auf eine stärkere soziale Differenzierung, durch die reiche Grabausstattungen noch mehr beschränkt wurden. Die Zahl der Gräber mit Schmuckbeigaben hat in vielen Gebieten allmählich abgenommen.
Wir dürfen folglich mit einer Relevanz der Fundkarten rechnen, mit dem Vorbehalt, dass sie die Proportionen der Einzelfunde, sowie der sachgemäss und unsach-gemäss ausgegrabenen Objekte der Wikingerzeit wiedergeben. Ich habe in anderem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass manche Gebiete zu viel oder zu wenig repräsentiert sein dürften (Callmer 1977, 10). Diese Proportionen ungefähr festzustellen ist zwar nicht unmöglich, gehört aber nicht in den Rahmen des vorliegenden Beitrags. Das starke Übergewicht des Mälartals sollte die Analyse nicht nennenswert beeinträchtigen, da man diesem Gebiet in den meisten Fällen grosse Teile des übrigen Skandinavien gegenüberstellen konnte. Es hat sich ergeben, dass manche Schmuckanhänger der hier behandelten Typen in ganz Skandinavien getragen wurden.
32 Johan Callmer
4. Zusammenfassung
Wir haben zeigen können, dass die Auswahl der Anhänger in Birka sich teilweise von der im Mälartal gebräuchlichen quantitativ, vor allem aber qualitativ unterscheidet. Eine kleine Anzahl von Anhängertypen kommt nur in Birka vor, aber da von den vielleicht am Ort hergestellten nur so wenige Exemplare aufgefunden wurden, braucht dies wohl nicht zu bedeuten, dass sie nur auf Birka beschränkt waren, sondern in kleinerer Zahl auch in benachbarten Teilen des Mälartals vorkamen. Wie schon gesagt, ist es bemerkenswert, dass mehrere Anhänger mit grosser Verbreitung in Skandinavien in Birka fehlen. Diese Tatsache lässt sich kaum damit erklären, dass sie zu einer späteren Periode als die Birkafunde in ihrer Gesamtheit gehörten. Diese Anhänger wurden wahrscheinlich in Serien in einem oder einigen wenigen Orten im südlicheren Skandinavien hergestellt
und in nicht vollständig geputztem Zustand ausgeliefert, z.B. kann die Perforierung der Ösen fehlen. Ein Fund von zwei Anhängern in diesem Zustand auf dem Handelsplatz von Paviken auf Gotland und andere ähnliche Funde veranschaulichen dies. Die Distribution solcher Anhänger, die Birka sicher passiert haben, war effektiv: sie sind schnell in die Gebiete ausserhalb von Birka weitergegangen.
Nach Birka sind sicher gelegentlich wandernde Me-tallschmuckgiesser gekommen, die eine begrenzte Zahl von grösseren Handelsplätzen in Südskandinavien besucht hatten. Es hat also auch im 10. Jahrhundert sicher einige Handwerker in Birka gegeben, deren Produkte grossenteils am Ort geblieben und nur in begrenztem Umfang weitergelangt sind, und zwar hauptsächlich innerhalb des Mälartals. Wir erhalten damit eine interessante Beleuchtung der Gesellschaftsstruktur von Birka im 10. Jahrhundert und den wechselnden Bedingungen für die Herstellung von Schmucksachen.
36 Johan Callmer
Tab. 3:1. Gegossene Schmuckanhänger (zusammangestellt von J. C.)
Anmerkungen I Spalte 1-4: Die Berechnungen gründen sich auf insgesamt 597 untersuchte Gräber, von denen 331 Körpergräber (darunter 45 Kammergräber) und 266 Brandgräber sind. III:1 Spalte 8: Bj 119, 199, 418, 523, 642, 843B, 844, 967
Spalte 9: Bj 165, 502, 901 Spalte 10: Bj 502, 823, 825, 835, 884, 965, 968, 1084 Spalte 11: Bj 371, 791, 971 Spalte 12: Bj 158, 860 B Spalte 13: Bj 642, 649, 860 B Spalte 14: Bj 860 B Spalte 15: Bj 963 Spalte 16: Bj 750, 964 Spalte 17: Bj 29, 844
Gegossene Anhänger 37
Fundverzeichnung*
A 1 Typ Vimmerby
SHM 11485:108 - 4224:5 h - 25847:4 - Dnr 4892/70 - 20327:18 - Dnr 2728/68 - 21473:1 Sigtuna fornhem SHM 19464:1 - 26788:202 - Birka Grab 418
Taf. 98:21, Abb. 3:1 Abb. 3:27 Sm. Vimmerby. Gästgivarehagen. Abb. 3:1. Sö. Barva Ksp. Skäggesta. Sö. Salem Ksp. Söderby.
Up. Danmark Ksp. Söderby, Grab 19. Järfälla Ksp. Järfälla. Lovö Ksp. Hemmet, Grab 10. Rasbo Ksp. Henriksberg. Sigtuna (2 Ex., Silber). Skuttunge Ksp. Grävsta (2 Ex.). Sollentuna Ksp. Knistahammar. 3:1.
Typ Söderby
SHM 13934:1 - 30982:12 - Dnr 7751/72 - 25847:4 - 23610:7 - Birka Grab 119 - Birka Grab 843 B - Birka Grab 967 Inv. Nr. nicht bekannt
Taf. 98:15-16, Abb. 3:2 Abb. 3:29 Nä. Edsberg Ksp. Logsjö. Sö. Botkyrka Ksp. Slagsta, Gräberfeld 82. So. Turinge Ksp. Årby, Grab 57. Sö. Salem Ksp. Söderby. Up. Lovö Ksp. Prästgården.
Abb. 3:2 USSR, Smolensk-Gebiet, Gnezdovo, Grab Nr 7. (Sergejev). Abb. 3:17.
Typ Birka Grab 199
Karlskrona Mus., ohne Nummer SHM Birka Grab 199 - Birka Grab 639
- Birka Grab 844
Taf. 98:17-18, Abb. 3:4 Abb. 3:28 Bl. Edestad Ksp. Nötanabben, Grab 67 (unsicher).
Abb. 3:4.
Typ Alvesta
SHM 19803:3 - Dnr 7751/72 - Birka Grab 642
Taf. 98:22, Abb. 3:3 Abb 3:28 Sm. Aringsås Ksp. Alvesta, Värendsgatan. Sö. Turinge Ksp. Årby, Grab 57. (2 Ex.). Abb. 3:3 (zusammen mit vielen Anhängern verschiedener Typen).
Typ Arnestad
SHM 2076 LUHM ohne Nummer SHM 6638:22 Hist. mus. Bergen D 7653 - B 5525 Schl. Holst. Landesmus. Hb 1937
Abb. 3:16 Abb. 3:30 Go. Sk. Valleberga Ksp. Tygapil. Sm. Berga Ksp. Trotteslöv (2 Ex.). Norge, Sogn og Fjordane, Gjemmestad Ksp. Arnestad (5 Ex.). Norge. Sogn og Fjordane, Nordfjord? (3 Ex.). Abb. 3:16. BRD. Schleswig-Holstein, Schleswig, Haithabu.
*In dieser Verzeichnung der von Johan Callmer differentierten Anhängertypen kommen einige Typen vor, die im Birka-Material nicht repräsentiert sind, und im Text des Kapitels nicht einzeln behan-delt werden, siehe aber die Diskussion Abschnitt 3.3. und die Verbrei-tungspläne.
Up. Up. Up. Up. Up. Up. Abb.
Johan Callmer
Typ Stora Ryk
SHM 21668 - Birka Grab 502 - Birka Grab 901 Odense Mus. 11591 Schl. Holst. Landesmus. - KS 24946 - Hb J 43 - ohne Nr.
Taf. 98:23-24, Abb. 3:5 Abb. 3:30 Ds. Färgelanda Ksp. Stora Ryk. (zusammen mit zwei Anhängern von Typ A3). Abb. 3:5 Danmark, Odense amt, Bederslev.
BRD Schleswig-Holstein, Haddeby, Busdorf. BRD Schleswig-Holstein, Schleswig, Haithabu. BRD Schleswig-Holstein, Schleswig, Haithabu.
Typ Liljenäs
Nat. Mus. København C 25570 SHM 2549 - 6746:1
- 5912:40 - 17804 Trondheim Mus. T 4453 Nat. Mus. København C 1820 - C 20248
Abb. 3:18 Abb. 3:30 Sk. Sk. Fuglie Ksp. Fuglie, Abb. 3:18. Sm. Dannäs Ksp. Dannäs. Sm. Ås Ksp. Liljenäs (2 Ex.). Sö. Tumbo Ksp. Husby. Norge, Tröndelag, Fundort nicht bekannt. Danmark, Bornholm, Knudsker Ksp. Rabekkegaard (2 Ex.). Danmark, Bornholm.
Typ Lillå
Örebro Mus. 18144:3 UMF 4582 SHM 129 - Birka Grab 502
- Birka Grab 823
- Birka Grab 884
Taf. 99:1-2, Abb. 3:9 Abb. 3:34 Nä. Hovsta Ksp. Lillå. Up. Häggeby Ksp. Överhassla (unsicher). Öl. Köping Ksp. Klinta (Silber). zusammen mit Taf. 98:24 Typ A 2.
Abb. 3:9
Typ Haugen SHM 1543 Trondheim, T 1746-57
Bl. Jämjö Ksp. Sör Tröndelag, Tiller Ksp. Haugen.
Typ Tuna
Zornsamlingarna, Mora SHM 22293:2 C - 22354 - Dnr 2044/69 - 13887:1 - 18809:4 - 26127:94 Länsmus. i Gävleborgs län. 7172 JLM 530 SHM 7965 Jönköping länsmus. 16887:15 SHM Dnr 7751/72 - 10035:V SHM 29983:28a - 19512:4 - 972 - 14365 - 19464:7 VLM, ohne Nummer
SHM 11370 - 19732 - 1304:1844:21 ÖLML 667
Taf. 98:27, Abb. 3:7 Abb. 3:31 Dr. Mora Ksp. Kråkberg. Dr. Sollerö Ksp. Bengtsarvet. Go. Mästerby Ksp. Bander. Go. Västergarn Ksp. Paviken. Gä. Hedesunda Ksp. Berg. Gä. Ockelbo Ksp. Ulvsta. Gä. Årsunda Ksp. Sörby. Gä. Österfärnebo Ksp. Rasbo. Jä. Norderö Ksp. Backen. Jä. Rödön Ksp. Frusta. Sm. Bringetofta Ksp. Bringetofta, Grab 15B (2 Ex.). Sö. Turinge Ksp. Årby, Grab 57 (Nachbildung). Up. Alsike Ksp. Tuna, Abb. 3:7. Up. Bondkyrka Ksp. Sunnersta, Grab 28a. Up. Bälinge Ksp. Kipplingeberg (2 Ex.). Up. Långtora Ksp. Jädra. Up. Simtuna Ksp. Vassbacken (Albäck). Up. Skuttunge Ksp. Grävsta. Vs. Badelunda Ksp. Tuna Grab 43. Vs. Badelunda Ksp. Tuna Grab 48 (2 Ex.). Vs. Berg Ksp. Kvalsta. Vs. S:t Ilian Ksp. Tunby (4 Ex.). Öl. Gårdby Ksp. Gårdby by (3 Ex.). Ög.
Gegossene Anhänger 39
SHM Birka Grab 1084 (7 Ex.). - 14995:1 Reykjavik Mus. 5218 Historisk Mus. Bergen B 8060 Univ. oldsaksaml. Oslo C 9527-9600 Nat. Mus. København C 2683 Ålands Mus. 57:29 - 58:33 - 30:1 Rumjancev Mus. 2112 - 2087 Hist. Mus. Moskva
Typ Opstad
Univ. Oldsaksaml. Oslo C 3922-5 C 15924-5
Typ Träslöv
SHM 26343:31 - Birka Grab 968 Univ. Oldsaksaml. Oslo C 1672
Typ Kållerstad
SHM 6064:2 - 16194 - Birka Grab 835 Univ. Oldsaksaml. Oslo C 9589
Typ Kipplingeberg
SHM 26985
- Dnr 7751/72 UMF 5394 SHM 19464:7 LUHM 12356 SHM 7187 Univ. Oldsaksaml. Oslo 9482-3 NM Helsingfors 7603:24 Hist. Mus. Moskva Erem. Leningrad
Typ Fiskeby
SHM Dnr 2044/69 - 13887 - 26343:31 Jönköping länsmus. 16887:18 SHM Dnr 7751/72 - 19490:13 - 26788:202 SSM ohne Nummer SHM 25917:6 - 11749 - 5406
VLM 14642:12 - 14547:3 Härnösand länsmus. 1046 SHM 5786
Abb. 3:7 Birka, Die schwarze Erde. Island, Skaftártunguhreppur, Granagil. Norge, Sogn og Fjordane, Nedstryn Ksp, Kirkeide, Solbakken (2 Ex.). Norge, Hedmark, Löten Ksp. By, Grab 35 (2 Ex.). Danmark, Bornholm, Gudhjem Ksp. Lillevang, Grab 3. Finland, Åland, Finström Ksp. Svartsmara, Knösbuskarna. Finland, Åland, Finström Ksp. Pålsböle. Finland, Åland, Geta Ksp. Östergeta, Erik Jans. USSR, zwischen Volga und Kljazma. USSR, Vladimir-Gebiet, 'Bol'Saja Brembola, Grab 1434. USSR, Vladimir-Gebiet, Ves'kovo Grab 982. USSR, Leningrad-Gebiet, Isajevo Grab 10:4. USSR, Smolensk-Gebiet, Gnezdovo Grab 29.
Abb. 3:21 Abb 3:31 Norge, Aust-Agder, Vegårdshei Ksp. Skemo, Abb. 3:21 Norge, Östfold, Tune Ksp. Opstad.
Taf. 98:28, Abb. 3:8 Abb. 3:31 Ha. Träslöv Ksp. Korsgata. Abb. 3:8 (2 ex.) (zusammen mit vielen Anhängern verschiedener Typen). Norge, Aust-Agder, Hyllestad Ksp. Nomeland.
Taf. 98:26. Abb. 3:6 Abb. 3:31 Sm. Kållerstad Ksp., Kvarnagården. Sö. Kung Karl Ksp., Malmberga. Abb. 3:6 Norge, Hedmark, Löten Ksp., By, Grab 35.
Abb. 3:19 Abb 3:31 Sö. Sorunda Ksp. Södra Lövtorp (Silber). Abb.
3:19 Sö. Turinge Ksp. Årby, Grab 57. (Nachbildung). Up. Bälinge Ksp. Kipplingeberg. Up. Skuttunge Ksp. Grävsta, Grab 7. Öl. Gegend von Borgholm. Birka, Die schwarze Erde (Silber). Norge, Hedmark, Löten Ksp., By, Grab 6. Finland, Egentliga Finland, Maaria Ksp. Saramäki. USSR, Vladimir-Gebiet, Gorodiosce, Grab 1899. USSR, Smolensk-Gebiet, Gnezdovo.
Abb. 3:22 Abb. 3:32 Go. Västergarn Ksp. Paviken. Gä. Hedesunda Ksp. Berg (2 Ex.). Ha. Träslöv Ksp. Korsgata. Sm. Bringetofta Ksp. Bringetofta, Grab 15 A (3 Ex.). Sö. Turinge Ksp. Årby, Grab 57 (Nachbildung). Up. Bälinge Ksp. Kipplingeberg, Abb. 3:22. Up. Sollentuna Ksp. Knistahammar. Up. Spånga Ksp. Ärvinge, Gräberfeld 157B. Up. Täby Ksp. Roslags Näsby. Up. Vendel Ksp. Karby. Up. Vessland Ksp. Sandby. Vs. Björskog Ksp. Åsta. Vs. Svedvi Ksp. Rallsta. Ån. Ullånger Ksp. Äskja. Öl. Hulterstad Ksp. Hulterstad, Kiesgrube.
40 Johan Callmer
Kalmar länsmus. 24192 SHM 5154 - 24569:56 A Historisk Mus. Bergen B 7812 Forhistorisk mus. Moesgård Århus C 2604 NM Helsingfors ohne Nummer Ålands Mus. Mariehamn 58:34
Öl. Torslunda Ksp. Ölands Skogsby. Öl. Ås Ksp. Ottenby. Ög. Östra Eneby Ksp. Fiskeby (3 Ex.). Norge, Hordaland, Alversund Ksp. Fjeldsende. Danmark, Viborg amt, Viborg.
Finland, Åland. Finland, Åland, Finström Ksp. Pålsböle.
Typ Gryta
SHM 22293:1 SHM 10035: V - 28045:23
- 21514:70
- 22777:1
- 10974 VLM 14547:15 SHM ohne Nummer Univ. Oldsaksaml. Oslo C 9463-72 Nationalmus. Reykjavik 5217
Kleine Rundspangen Typ York Schl. Holst. Landesmus. 17932 b Yorkshire mus.
Up. Up. Up. Up. Vs. Vs. Vs. Norge, Hedmark, Löten Ksp. By Grab 1.
Island, Skaftartunguhreppur, Granagil (3 Ex.).
mit Mustern wie an den Anhängern von Typ A3. BRD. Schleswig-Holstein, Haithabu. England, Yorkshire, York (Silber).
Abb. 3:24 Abb. 3:33
Ha. Träslöv Ksp. Korsgata (2 Ex.). Norge. Akershus, Ullensaker Ksp. Fonbekk.
Norge, Aust Agder, Gjerstad, Vegårdshei Ksp. Skemo. Abb. 3:24. Norge, Opland, Lom Ksp. Blaker (2 Ex.). Norge, Hedmark, Löten Ksp. Vestre Engelaug, Grab 7.
Hist. Mus. Bergen ohne Nummer Norge, Sogn og Fjordane, Årdal Ksp. Ytre Moa.
Typ Norelund
SHM 1453:186 - 19802:4 - 3970d - 4224:8 a - 14737:10 - 4516 - 16194 - 26788:202 - 115 - Birka Grab 371
Taf. 98:29-30, Abb. 3:10 Abb. 3:33 Bl. Förkärla Ksp. Hjortahammar. Gä. Valbo Ksp. Hemlingby, Norelund. Sö. Barva Ksp. Söderby Ås. So. Barva Ksp. Söderby Ås. Sö. Barva Ksp. Säby. Sö. Huddinge Ksp. Vårby (6 Ex. aus Silber) Sö. Kung Karl Ksp. Malmberga. Up. Sollentuna Ksp. Knistahammar. Vg. Skånings Åsaka Ksp. Skån (Silber). Abb. 3:10
Abb. 3:23 Abb. 3:32 Dr. Sollerö Ksp. Bengtsarvet.
Alsike Ksp. Tuna. Abb. 3:23. Hammarby Ksp. Lilla Vilunda. Hökhuvud Ksp. Borrgårde. Knutby Ksp. Prästgården. Hubbo Ksp. Gryta. Svedvi Ksp. Rallsta.
B Typ Skemo
SHM 26343:31 Univ. Oldsaksaml. Univ. Oldsaksaml. Univ. Oldsaksaml. Univ. Oldsaksaml.
Oslo C 5292-5302 Oslo C 3923 Oslo C 6742:4 Oslo C 10704-10
Gegossene Anhänger 41
- Birka Grab 791 - Birka Grab 971 Univ. Oldsaksaml. Oslo C 9463-Nat. Mus. København C 20248 Schl. Holst. Landesmus. ohne Nummer Eremitaget, Leningrad
Typ Riddarholmen
SHM 30982:12 - 15340 NM Helsingfors 7603:25 Hist. mus. Moskva Eremitaget Leningrad
(4 Ex. aus Silber, Taf. 98:30).
72 Norge. Hedmark. Löten Ksp. By Grab 1. Danmark. Bornholm.
BRD. Schleswig-Holstein, Schleswig, Haithabu (Silber). USSR. Smolensk-Gebiet, Gnezdovo (Silber).
Abb. 3:25 Abb. 3:33 Sö. Botkyrka Ksp. Slagsta, Gräberfeld 82. Up. Stockholm, Riddarholmen (Silber). Finland, Egentliga Finland, Maaria Ksp. Saramäki. USSR. Leningrad-Gebiet, Vachrusevo, Grab 117:2 (2 Ex.). USSR. Smolensk-Gebiet, Gnezdovo (2 Ex. Silber), Abb. 3:25. USSR. Smolensk-Gebiet, Gnezdovo.
D Typ Gile
SHM 14836:8 - 17804:8 - Birka Grab 642 - Birka Grab 860 B Univ. Oldsaksaml. Oslo C 22764 Hist. mus. Bergen B 5525 - B 7653 Nationalmus. Reykjavik 6020
Taf. 92:5-6, Abb. 3:12 und 3:26 Abb. 3:33 Sm. Reftele Ksp. Mellby1. Sö. Tumbo Ksp. Husby (3 Ex.). Abb. 3:12
Norge. Toten Ksp. Hof. Gile, Grab 4. Abb. 3:26. Norge. Sogn og Fjordane, Nordfjord (2 Ex.). Norge. Sogn og Fjordane, Gloppen, Gjemmestad Ksp. Arnestad. Island. Rangarvallahreppur, Rangá.
E Typ Gnezdovo
SHM Birka Grab 860 B Eremitaget, Leningrad
Taf. 99:22 Abb. 3:13
USSR. Smolensk-Gebiet. Gnezdovo. Abb. 3:13.
Typ Birka Grab 963
SHM 26042:181/121 - Birka Grab 963
Taf. 97:27, Abb. 3:14 Abb. 3:35 Up. Norrsunda Ksp. Brista. Abb. 3:14.
Typ Tjureda Toregård LUHM ohne Nummer SHM 9041:25 - 5786 Nationalmus. Reykjavik 26.6.1950 Forhist. Mus. Moesgaard 1600 Nat. Mus. København 5081 Schl. Holst. Landesmus. Hb H 39
(Musteridentisch mit Typ Liljenäs) Sk. Löddeköpinge Ksp. Löddeköpinge. Sm. Tjureda Ksp. Tjureda Toregård. Öl. Hulterstad Ksp. Hulterstad (Kiesgrube). Island. Öngulstatahreppur, Ytri-Tjarnir. Danmark Danmark, Hjörring amt, Raabjerg Ksp. BRD. Schleswig-Holstein, Schleswig. Haithabu.
1 Abweichend in einigen Details.
42 Johan Callmer
Abb. 3:37. Björkö-Grab 968. Nach Birka I, Abb. 346 u. der Zeichnung von Hj. Stolpe. Ca. 1/9.
1. Zwei Ovalspangen (wie Taf. 66:8). 2. Kleeblattfibel Taf. 74:4. 3. Kleine Rundspange Taf. 71:13. 4. Brettchenband mit Silberschuss. 5. Zwei grosse Perlen. 6. Silberkreuz Taf. 102:6. 7. Silbermünze Taf. 143:11. 8. Silberanhänger mit Wirbelmuster Taf. 97:14. 9. Silberanhänger, Frauenfigur, Taf. 92:8. 10. Silberanhänger, Klotzstuhl, Taf. 92:14. 11. Perlen Taf. 122:12. 12. Bronzeanhänger, Typ A3, Taf. 98:28. 13. Kleiner Silberring Taf. 111:10. 14. Nadelbüchse Taf. 168:6. 15. Schlüsselbruchstücke (?). 16. Eisenmesser Taf. 178:2. 17. Eisenschere (vgl. Taf. 175:7a). 18. Eisenkette (wie Taf. 113:19). 19. Leder(?)-beutel Abb. 347. 20. Eisenkrampe mit Eisenring. 21. Silberfingerring Taf. 111:9.
4. Schmuckanhänger von orientalischem Typ
Birka I, Taf. 95:3 oben, 5-7, 96:6, 13, 99:6 (ev. 95:3 links und rechts, 9, 96:18) Abb. 4:1-5
Ingmar Jansson
In Birka II:2, Kap. 10, „Gürtel und Gürtelzubehör vom orientalischen Typ", wurden S. 91 vier zungenförmige Zierstücke aus Bj 150, 573 und 791 (Taf. 95:3, 9, 96:18) mit Vorbehalt als Anhänger zu Gürteln besprochen. Diese Deutung baut darauf, dass Gürtelanhänger dieser Form im Karpatenbecken bekannt sind, und dass die Form der Anhänger - mit geradem Oberrand - durch die Deutung eine natürliche Erklärung erhält. Gegen diese Deutung kann angeführt werden, dass die Zierstücke keine näheren Parallelen unter den bekannten Gürtelanhängern haben (die Übereinstimmung mit den Gürtelanhängern im Karpatenbecken betrifft hauptsächlich die Form, nicht die Ornamentik), und dass die bekannten Fundumstände keine Stütze zur Deutung geben. Die Zierstücke von Björkö stammen alle aus Frauengräbern, und dies dürfte auch der Fall mit den wenigen bekannten Parallelen aus dem übrigen Schweden und aus dem Gebiet des russischen Reiches sein (Birka II:2, 84). Eine alternative Deutung ist deshalb, dass die Anhänger auch primär als Frauenschmuck gedient haben.
Die zwei zungenförmigen Anhänger aus Bj 791 (Taf. 95:3) sind mit einem schwerverständlichen Reliefmuster verziert, das hypothetisch als Tierornamentik aufgefasst werden kann. Diese Ornamentik erinnert an das Dekor auf zwei kleinen Schmuckanhängern der gewöhnlichen runden Form von Bj 825. Die Anhänger sind mit einem Reliefmuster und mit einem Perlrand von derselben Art wie die beiden zungenförmigen Anhänger verziert. Auch hier ist eine sichere Deutung des Musters unmöglich. Die Öse ist mit einem von oben gesehenen, langgestreckten Tierkopf verziert. Parallelen sind mir nicht bekannt.
Ein anderes Muster, das einen Zusammenhang zwischen dem orientalischen Gürtelzubehör und den runden Schmuckanhängern zeigt, ist auf einem D-förmigen Beschlag von Bj 845 (?) und seinen Parallelen in Russland und Nordkaukasien zu sehen: ein en face gesehe-
ner Menschenkopf, der von zwei gewinkelten Armen umgeben ist (Taf. 96:19; Diskussion Birka II:2, 84, 85f., 88f.). Was die Gestalt in den Armen hält, kann nicht bestimmt werden. Eine Variante desselben Motivs ist aber auf einer Reihe von runden Anhängern bekannt, und hier kann festgestellt werden, dass die Gestalt zwei Vögel festhält {Abb. 4:1). Zwei Gräber auf Björkö enthielten Anhänger von diesem Typ: Bj 150 und 762 (Taf. 95:5). Ausserhalb Birkas sind Anhänger desselben Typs in Grabfunden von Södermanland und dem russischen Reich, dazu auch in einem Silberhort aus der DDR bekannt. Die schon genannten Gürtelbeschläge und andere Gegenstände mit ähnlichen Mustern vom eurasi-schen Steppengebiet und dem Kalifat deuten den südöstlichen Zusammenhang an (Birka II:2, 88f. mit angeführter Literatur; betreffs des Fundes aus der DDR, s. Zak 1963, 32f., Abb. 25:1).
Ein weiterer Typ der runden Anhänger ist mit einem Vogel (Hahn oder Pfau?) und einem Pflanzenzweig verziert. Dieser Anhängertyp ist in vier Gräbern auf Björkö gefunden worden: Bj 54, 348, 739 und 1062 (Taf. 95:6-7). Weitere Exemplare sind im Gebiet des russischen Reiches bekannt (Arne 1914, 158f.). Ähnliche Vogeldarstellungen gibt es auf verschiedenen Gegenständen in der orientalischen Kunst, jedoch nicht, soweit ich weiss, auf Anhängern (Arne 1914, 159ff.).
In demselben Grab wie die zwei anfangs erwähnten zungenförmigen Anhänger lag auch ein einzigartiger runder Silberanhänger mit einer frontalgesehenen, sitzenden Menschenfigur innerhalb eines Perlrandes (Bj 791; Abb. 4:2; Taf. 95:3). Der Anhänger ist abgenutzt, und die Details sind schwer zu deuten. Die sitzende Stellung, die Krone auf dem Kopf und die Flügel an den Schultern deuten aber darauf, dass die Figur einen orientalischen Herrscher nach sassanidischer Tradition darstellt. Gute Parallelen bieten einige buyidische Goldmedaillons des 10. Jhs. und Silbergefässe sassanidischer Tradition (Abb. 4:3-4; Bahrami 1952; s. auch Arne
44 Ingmar Jansson
Abb. 4:1. Bronzener Anhänger aus Bj 762. Gezeichnete Ana-lyse H. Faith-Ell. Nach Lundström 1961, Abb. 5. 2:1.
Abb. 4:2. Silberner Anhänger aus Bj 791. Gezeichnete Ana-lyse H. Faith-Ell. Nach Lundström 1961, Abb. 3. 2:1.
1914, 165, Lundström 1961, 194ff.). Auf einem zungenförmigen Anhänger des anfangs
erwähnten Typs im Silberhort von Fölhagen, Ksp. Björke, Gotland, ist die Öse mit einem bärtigen Männergesicht verziert. Ähnliche Gesichter kenne ich nur auf zwei runden Silberanhängern aus einem Frauengrab in Gräfsta, Ksp. Skuttunge, Uppland, aber hier ist die Arbeit von höherer Qualität und die Darstellung bemerkenswert naturalistisch {Abb. 4:5). Für naturalistische Gesichter dieser Art gibt es keine Beispiele in Nord-und Osteuropa. Auffallende Parallelen bilden die sassa-nidischen Herrscherporträts mit ihren kräftigen Bärten und fernblickenden Augen. Eine Reihe von Beispielen zeigt, dass diese sassanidische Bartmode in Iran bis ins 10. Jh. weiterlebte oder wieder aufgenommen wurde. Einige der Beispiele sind die schon genannten goldenen Medaillons von buyidischen Herrschern, deren Gesichter mit denen der Anhänger von Gräfsta nahe übereinstimmen {Abb. 4:3-4). Die runde Scheibe der beiden Anhänger ist mit einer Rosette oder Lotusblüte innerhalb einer Perlenborte verziert. Dieses Pflanzenmotiv ist uralt im Orient, und es gibt gute Gegenstücke in der sassanidischen und frühislamischen Kunst (Herzfeld 1927, Abb. 48; Day 1952, Abb. 1-12).
Ein bärtiges aber stark stilisiertes Männergesicht an der Öse weist auch ein Silberanhänger von Bj 861 auf (Taf. 96:13). Die Randborte besteht hier aus Kreisen und Längsstrichen, ein Bortenmotiv das mit ähnlichen Mustern auf gewissen orientalischen Gürtelbeschlägen (z.B. Taf. 95:3, 96:12) und islamischen Münzen (Vorbemerkungen, S. XX, in jedem Band von Corpus num-morum saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt) verglichen werden kann. Das flächendeckende Volutenmuster innerhalb der Borte kann aber als westlich bezeichnet werden (Birka V, 33ff.), und die allgemeine Ausführung erinnert an mehrere skandinavische Schmuckstücke. Dieser Anhänger dürfte deshalb am
ehesten als ein skandinavisches Produkt mit orientalischen Stilelementen charakterisiert werden. Zwei Parallelen sind bekannt. Die eine stammt aus einem Silberhort von Schonen (Hårdh 1976, Taf. 50:4; ohne Gesicht). Die zweite ist ein Streufund aus Westenschou-wen, Zeeland, an der Nordseeküste in den Niederlanden (Zeeuws Museum, coll. Hubregtse; Capelle 1978, Nr 100; Ypey 1979, 183f. mit Abb.; Öse oberhalb des Gesichtes abgebrochen; Lötspuren auf der Rückseite zeigen, dass das Stück sekundär als Fibel benutzt worden ist).
Alle bisher erwähnten Anhänger sind in Silber oder Bronze gegossen und oftmals vergoldet.
Zu erwähnen bleibt noch ein rechteckiger Anhänger mit abgerundeten Ecken von Bj 1932:1 aus Bronzeblech mit geritztem Dekor von zwei „fetten" Pflanzenzweigen orientalischen Charakters (Taf. 96:6). Das Stück hat, meines Wissens, keine näheren Parallelen.
Hiermit sind alle mir bekannten, in Skandinavien gefundenen Schmuckanhänger von orientalischem Typ erwähnt worden. Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese verschiedenartige Gruppe von Anhängern in ihrer Gesamtheit im Fundmilieu der JBS zu Hause zu sein scheint (die Silberhorte dürften um das Jahr 1000 niedergelegt worden sein), und dass sie Verwandtschaft mit Erzeugnissen der steppennomadischen und islamischen Kulturbereiche aufweist. Genaue Parallelen sind aber ausserhalb Schwedens und des russischen Reiches (in einem Fall der DDR - ein Silberhort) nicht bekannt, und Anhänger dieser Art sind seltene Funde innerhalb der steppennomadischen und islamischen Gebiete. Die Frage der Herkunft ist deshalb schwer zu beantworten: einige Anhänger dürften im Kalifat oder im steppennomadischen Kulturbereich, die Mehrzahl aber eher im russischen Reich oder eventuell in Schweden hergestellt worden sein.
Orientalische Anhänger 45
Abb. 4:3. Goldmedaillon in „postsasanidischem" Stil, Vor- Abb. 4:4. Goldmedaillon mit dem Porträt des buyidischen der- und Rückseite. Unbekannter Fundort. 10. Jh. Nach Bah- Herrschers 'Adud al-Dawlah, Geprägt in Fars (in Iran) 970/1 rami 1952, Abb. 1. 1:1. n. Chr., Vorder- und Rückseite Nach Bahrami 1952, Abb. 2.
1:1.
Abb. 4:5. Silberner Anhänger aus Gräfsta, Skuttunge, Uppland (SHM 19464:7). Photo ATA. 2:1.
5. Perlengarnituren
Taf. 91:7, 114-124
Greta Arwidsson
1. Einleitung
Die Perlenfunde in den Frauengräbern von Birka geben der Forschung eine Reihe interessanter Fragen auf. Auf Holger Arbmans primäre Katalogisierung der Perlentypen und ihrer Kombinationen in jedem einzelnen Grab (BIRKA I) folgte Johan Callmers Analyse desselben Materials in seiner Bearbeitung der Formen und Herstellungstechnik der Perlen der Wikingerzeit, bei der er sich auf die in Skandinavien in datierbaren Funden von etwa 800 bis 1000 nach Chr. angetroffenen Perlentypen beschränkte.
Da in den letzten Jahrzehnten im Norden mehrere Werkstätten zur Herstellung von Perlen und Fundplätze mit guter Stratifikation in wikingerzeitlichen Siedlungszentren entdeckt wurden, erscheint es ratsam, vorläufig die chronologische Analyse ebenso wie die Diskussion über die Wege und die Bedeutung des Perlenhandels aufzuschieben (vgl. Danielsson, K., 1973, Callmer, 1977 und 1984 A und B, Bencard, 1979 und 1981, Heyerdahl-Larsen, 1979 B). Kristina Danielsson bereitet gegenwärtig eine Spezialbearbeitung des gesamten Materials von Birka vor, unter besonderer Beachtung der typologi-schen und chronologischen Fragen.
2.1. Die Perlengarnituren und ihre Lage in den Gräbern von Birka
Die Zusammensetzung der Perlenketten im Einzelnen und ihre Anbringung auf der Tracht im Verhältnis zu den übrigen Schmuckstücken hat man bisher nicht eingehend diskutiert.
Hj. Stolpes Angaben über die Lage der Perlen im Verhältnis zu den Skelettresten und zu der sonstigen Schmuckausstattung ist leider meistens so unvollständig, dass die Deutung, wie die Perlen in den einzelnen Fällen getragen wurden, meistens sehr unsicher bleibt. So zeigen z.B. die Grabpläne der Gräber Bj 507 und 508 (Abb. 94-95) mit aller Deutlichkeit, dass die Lage der Perlen, wie sie hier angegeben ist, keine Auskunft über
die ursprüngliche Zusammensetzung der Perlenketten gibt.1 Als die Perlen im Museum (oder von Stolpe?) auf einen Faden aufgezogen wurden, stellte man einreihige Ketten her. In dieser Form wurden die Ketten auch im Museum ausgestellt und oft auch „abgebildet" (s. Taf. 116-119, 124), da man gar nicht versucht hatte, zwei-oder mehrreihige Kompositionen auszuprobieren.2
Als Holger Arbman um 1935 die Funde Stolpes zur Bearbeitung auspackte, arbeitete er mit fil. dr. Agnes Geijer zusammen, die für die Textilfunde zuständig war. Sie erinnert sich, dass Perlen auf Fäden in verschiedenen Farben aufgezogen waren, als man sie aus den Fundschachteln nahm.
Eine weitere Augenzeugin war die Dozentin Dagmar Selling, die beim Auspacken der Kästen mit den Birka-funden mitarbeitete. Bei einem Gespräch im Januar 1987 erinnert sie sich, dass die Perlen teils lose in den Kästen lagen und teils auf Fäden aufgezogen waren.
Eine Kontrolle der im Magazin von SHM verwahrten Perlen aus Birka zeigt, dass die heutigen Fäden, auf denen sie aufgezogen sind, wahrscheinlich in den meisten Fällen neuen Datums sind (vgl. unten 2.7.).
Bemerkenswert ist es, dass man in der Regel zusammen mit den Perlen keine Ringe, Haken oder andere Vorrichtungen gefunden hat, die zeigen, wie sie befestigt waren. Auch gibt es meistens keine Beweise, dass die Perlenketten an den ovalen Spangen befestigt waren - entweder in den häufig vorhandenen Löchern an der
' In Anbetracht dessen, dass Stolpe bei den Ausgrabungen die Funde nicht eigenhändig aufnahm, und dass Perlen in der Moderschicht eines Grabes leicht aus ihrer Lage geraten, ist es erklärlich, dass Stolpe auf den Zeichnungen in diesen Fällen nur eine ungefähre Anzahl der Perlen und ihre ungefähre Ausbreitung angibt. Vgl. die Diskussion in Abschnitt 2.1.
In einigen Fällen hat Stolpe jedoch so genaue Skizzen und Auf-zeichnungen gemacht, dass er die Perlen sicher in ungestörter Lage gesehen hat. Die Analyse dieser Skizzen gibt uns Belege für ein interessantes Variationsmuster. 2 Arbman bemerkt zu den 229 Perlen, die auf einem Haufen in Bj 508 (Birka I, 149) lagen, dass man nicht entscheiden kann, ,,ob die Perlen ursprünglich in der gleichen Ordnung aufgereiht waren, wie sie seit Stolpes Zeit im Museum aufbewahrt sind".
Perlengarnituren 47
Kante der Spangen oder an den Spangennadeln, an denen sowohl die Trägerösen der Röcke als auch manche gewebte Bänder erhalten sind (Hägg 1974, Abb. 121-135). Dagegen gibt es Metallketten, die von den ovalen Spangen ausgehen und an den Randlöchern oder an der Nadel befestigt sind (s. Hägg 1974, 121, Spange Bj 464; 127, Spange Bj 645).
2.2. Die Garnitur in Bj 854 Taf. 91:7-8, Abb. 275-276
In nur einem Grab kommt ein Perlenverteiler vor, nämlich in dem frühen Grab Bj 854, bei dem Stolpe den Halsschmuck auf einer Detailskizze dokumentiert hat, Abb. 276. Die Perlenverteiler (Abb. 275:2m-n) und die Perlenstränge liegen hier gleich unterhalb des Unterkiefers und sie werden teilweise von der grossen gleicharmigen Spange (Taf. 76) zugedeckt. An der rechtwinklig abstehenden Leiste auf der Rückseite des Perlenverteilers gibt es acht Löcher. Wieviele davon zum Durchziehen von Perlenschnüren dienten, ist ungewiss, wahrscheinlich waren es drei oder vier.
2.3. Der Halsschmuck aus Bj 860 B Abb. 282-283
Der Perlenschmuck in Bj 854 wurde also als Halsschmuck ganz oben auf der Brust getragen, offenbar im Gegensatz zu dem Schmuck in Bj 860 B, der nach Stolpes Detailzeichnung (Abb. 283) aus einer langen einreihigen Perlenkette bestanden zu haben scheint, die unterhalb und zu einem kleinen Teil auf den beiden ovalen Spangen liegend herabhing, sowie aus einem zweiten (?) Band neben der Perlenkette, das eine grosse Zahl von Anhängern trug. Unter diesen gibt es mit Ösen versehene nordische Münzen (Abb. 283:6-7) und vier Anhänger aus Silberdrahtringen mit Ösen zum Aufhängen, auf die Perlen aufgezogen sind. Ein Anhänger (283:12) trägt eine Karneolperle, ein zweiter (283:14) eine Bergkristallperle, ein dritter (283:13) eine Perle aus Glasfluss, und der vierte schliesslich (283:15) eine Perle aus Bergkristall und eine aus Glas. - Die Perlenkette besteht aus insgesamt 84 Perlen, wobei grosse Perlen aus Karneol oder Bergkristall mit kleinen Perlen aus Glas oder Glasfluss in verschiedenen Farben abwechseln, - wenn man im vorliegenden Fall annehmen kann, dass Stolpes Zeichnung die wirklichen Fundlagen wiedergibt.
Unsere Beschreibung ist hier so ausführlich, weil in Birka I keine Rekonstruktion dieses Prachtschmucks beschrieben oder abgebildet ist, obwohl Stolpes Zeichnung eine gute Unterlage zu einem solchen Gesamtbild gibt (vgl. auch Abschnitt 2.7. unten).
2.4. Der Halsschmuck aus Bj 632 Taf. 119, Abb. 170-171
Vergleicht man den Halsschmuck aus Bj 860 B mit dem aus Bj 632, so erheben sich Zweifel über die richtige Deutung trotz der detaillierten Zeichnungen in beiden Fällen.
In Bj 632 haben die ovalen Spangen eine merkwürdige Lage über den Schlüsselbeinen, und die Perlen und die zahlreichen Anhänger sind zusammen aufgezogen und bilden einen geschlossenen Ring, den Arbman (Birka I, 211) als „Perlenband" bezeichnet, das „möglicherweise an dem Kleid festgenäht" war. Von den insgesamt 58 Perlen gehören 29 zu dem „Perlenband", und die 21 übrigen, die Stolpe verstreut in dem grossen Ring gezeichnet hat, sind zu einem kleineren Ring aufgezogen (Taf. 119, und S. 212).
Auf dem Perlenband in diesem Grab sollen Anhänger verschiedener Art in ziemlich regelmässigem Wechsel mit den Perlen aufgezogen gewesen sein. Zwischen den Anhängern sitzen in der Regel je zwei Perlen, es können aber auch vier oder fünf Perlen und an einigen Stellen nur eine Perle vorkommen. Die Anhänger bestehen aus einer byzantinischen Silbermünze (für Theophilus 829-833), und verschiedenen anderen Silberanhängern (s. Duczko Kap. 3. 1. oben und 1985, Abb. 38, 82-83, Sowie Jansson Kap. 4 oben) sowie aus fünf Anhängern aus Silberdraht, auf die Perlen aufgezogen sind.
Wenn Stolpes Zeichnung zuverlässig ist, deutet die Lage des Schmuckringes darauf, dass er lose ins Grab gelegt worden ist.
Mir persönlich erscheint es leider nicht ausgeschlossen, dass die so sorgfältig von Stolpe gezeichnete Anordnung sich daraus ergab, dass man die beiden Schalenspangen, die Perlen und die Anhänger bereits aus dem Grabe genommen hatte, während man auf Stolpes Ankunft zu der Ausgrabung wartete3 und die Perlen etc. gewissenhaft auf einen Faden aufgezogen hatte. Der „kleine Ring" (Taf. 119) könnte in dem Falle aus Perlen bestehen, die man zunächst nicht wahrgenommen hatte, und die nun die ursprüngliche Lage der grossen Sammlung kennzeichnen.
Inga Hägg (1986, 67) erwähnt die Garnituren aus Bj 632 und Bj 791 kurz, sie meint, dass sie „der Komposition und dem allgemeinen Aussehen nach... an Kragenschmuck aus fränkischen Frauengräbern in Mitteleuropa erinnern". Wegen der Herkunft dieser Mode
3 Die mündliche Aussage verschiedener Personen, dass feinere Funde aufgenommen und in den Wohnhäusern verwahrt wurden, bis Stolpe Zeit hatte, nach Birka zu kommen, kann leider nicht bestätigt werden, weil der Brief von einem Mitarbeiter auf Birka nicht länger in ATA erhalten zu sein scheint.
48 Greta Arwidsson
verweist sie auf Schultze 1976, 149, und Vierck 1978 A. Vgl. Vierck 1978 C.
2.5. Der Halsschmuck aus Bj 844 Abb. 265-266
Eine Kombination von Perlen und Anhängern auf derselben Schnur kann u.a. in Bj 844 vorliegen, wo 29 Perlen in einer Reihe zwischen den ovalen Spangen, von denen die rechte verschoben ist, eingezeichnet sind und mindestens fünf zu Anhängern umgearbeitete Silbergegenstände in einer Reihe neben der Perlenkette liegen. Ausserdem gibt es zwei Anhänger in weiterem Abstand von den Schalenspangen, Abb. 265:2, Taf. 99:24, sowie 265:11, der verschwunden ist.4
2.6. Der Kettenschmuck aus Bj 464 Abb. 75
Auf die Deutung von Stolpes Zeichnungen der Schalen-spangen, der silbernen Spange, der Silberkette und der Bänder in diesem Grab (Birka I, 132, Abb. 75) hat Inga Hägg grosse Mühe verwendet (Hägg 1974, 40, Abb. 27-34). Ihre Analysen zeigen, dass es Stolpe schwer gefallen ist, den Komplex darzustellen. Selbst hat er jedoch notiert, dass die auf Häggs Abb. 31 wiedergegebene Detailzeichnung ,,richtiger ist als auf dem grossen Papier".
Auf diesen Skizzen wird die Perlenkette mit Punktreihen wiedergegeben, die eine Schlinge oberhalb der ovalen Spangen und eine lange Schlinge zwischen ihnen nach unten bilden. Ein Abschluss an den beiden Enden ist nicht markiert, sie schliessen auch nicht an die Spangen an.
2.7. Stolpes Dokumentation der Perlenketten
Bei der Betrachtung von Stolpes Skizzen kam mir der Gedanke, dass der Mangel an Details bei der Zeichnung der Perlen in Bj 464, wie auch in vielen anderen Fällen, vielleicht darauf beruht, dass die Perlen in der Reihenfolge, wie man sie fand, auf Fäden aufgezogen wurden, und dass Stolpe diese Perlenketten - bei denen bestenfalls die ursprüngliche Reinhenfolge der einzelnen Perlen erhalten war - als gute Dokumentation betrachtete. Dass es in manchen Fällen so zugegangen ist, würde u.a. Stolpes Zeichnung der Perlenkette in Bj 860 B vollständig erklären, wo die Enden der Kette oben auf den beiden recht gewendeten ovalen Spangen liegen. Weitere Beispiele hierfür geben die Gräber Bj 843 A (Abb. 263) und Bj 843B (Abb. 264), wo zu der letzteren Perlenkette vielleicht vier Anhänger und eine arabische Silbermünze mit Öse (abbassidischer Dirhem um 785-800 n. Chr.) gehören, sowie Bj 791 (Abb. 235) mit acht Silberanhängern.
Die Perlengarnitur in Bj 1081 hat Stolpe auf der Grabzeichnung als gleichmässige Punktreihe eingezeichnet, auch der schriftliche Kommentar enthält nichts über die Anordnung der Perlen (Abb. 418). Dasselbe gilt von der Kette mit 93 Perlen, (Abb. 323) aus Bj 948. Man fragt sich wirklich, ob die Anordnung in diesen Fällen (Farbtafel 124:1 und 2) nur eine Konstruktion des Museums ist oder ob sie schon von den Ausgräbern auf Schnüre aufgezogen wurden. Das letztere erscheint mir durchaus nicht als eine abwegige Hypothese (vgl. oben 2.1).
Eine systematische Durchsicht der Perlenfunde aus Birka im Magazin von SHM ergab, dass einige Perlensammlungen jetzt noch auf Metallfäden aufgezogen sind, an denen Nummerzettel befestigt sind. Im übrigen sind die Perlen, wenn sie nicht lose in Schachteln liegen, auf dunkles Nähgarn aufgezogen und die Nummerzettel sind mit der gleichen Sorte von Garn an diesen befestigt.
Die prachtvollen Perlen der einen Kette aus Bj 550 (Farbtaf. 120, a-s) sind auf einen Metalldraht aufgezogen, aber auch die kleinen Perlen der anderen Kette aus diesem Grab sind auf einen dünneren Metalldraht aufgezogen (Taf. 120:11, t-y). Wie gewöhnlich gibt Stolpe auf der Grabzeichnung nur die Lage der beiden Ketten durch Reihen von Ringen, bzw. kleinen Punkten an.
Ein weiteres Beispiel sind die Perlen aus Bj 559 (Taf. 116:3). Hier sind die 29 Perlen auf einen ähnlichen Metalldraht aufgezogen. Stolpes Plan zeigt die gegenwärtige Anordnung der Perlen nicht (d.h. so wie sie für Taf. 116:3 photographiert sind). Indessen gibt Stolpe hier an, dass es auch unter der rechten ovalen Spange (a auf der Zeichnung) Perlen gab.5
3.1. Die Anbringung des Perlenschmucks
Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass die Doku-mentation der Perlenfunde auf den Gräberplänen Stolpes teilweise unbefriedigend und teilweise schwer zu deuten ist. Einige Modelle sind jedoch als wahrscheinlich festzustellen oder anzunehmen.
4 Die Anhänger bestehen aus einem Dirhem mit Öse (Taf. 138:4), 809/10 nach Chr. geprägt, einem Silberbeschlag mit angenieteter Öse (Taf. 99:3), einem anhängerähnlichen Fragment (Taf. 97:5), einem Anhänger in Form einer aufgerollten Schlange (Taf. 97:29) und einer Buchschliesse (?), die mit einer Öse versehen ist (Taf. 99:11). 5 Es ist aber zu beachten, dass in einem Fall auch Perlen aus einem Brandgrab auf Metalldraht aufgezogen wurden, wo man ja die Doku mentation über die Fundlage der Perlen nicht als wichtig betrachtet haben kann. Es handelt sich um das Brandgrab Bj 151 (Abb. 42), dessen vom Feuer beschädigte Perlen im Magazin des Museums auf zwei verschiedene Fäden aufgezogen sind: die kleinen Perlen auf einen Draht aus Eisen, während die grösseren, aus Karneol, Bergkri stall u.a. auf den gewöhnlichen schwarzen Zwirn des Museums aufge zogen sind.
Perlengarnituren 49
3.2. Modell A
Modell A ist der mehrreihige Perlenschmuck mit einem Kettenverteiler aus Bj 854 (Birka I, 326ff., Taf. 118,6 und Abb. 274-276). Nach Stolpes Detailzeichnung, Abb. 276, sassen zwischen den drei grössten Perlen drei kleine Silberringe. Wo die Silberperlen (Abb. 275:2) lagen, ist ungewiss, während die Silberberlocke (Taf. 100:4) und die Silberanhänger (Taf. 100:5) ebenso wie der Anhänger mit einer grossen farbigen Perle, die auf einen Silberdraht aufgezogen war (Taf. 118, Abb. 275:2 d), zu einem der Perlenstränge gehört haben. Vielleicht gehört auch der unike Anhänger, Taf. 103:9, mit kleinen echten Perlen an Silberdraht (Kap. 7) hierher. Insgesamt gab es 81 Perlen.
Der Perlenschmuck vom Modell A lag hoch oben auf der Brust /dicht am Halsansatz/ mit den Perlenverteilern an den Schlüsselbeinen.
3.3. Modell B
Als ein gutes Beispiel von Modell B kann der Perlen-schmuck in Bj 946 dienen, der zweireihig ist und bei dem auf der unteren Reihe vier Silberanhänger mit den Perlen zusammen aufgezogen sind. Insgesamt 40 Perlen.7
Die Anbringung der Garnitur hat Stolpe auf der Zeichnung genau angegeben, sie sass am oberen Teil der Brust, die äusseren Enden der Perlenbänder lagen ungefähr auf den Schlüsselbeinen.
Weitere Beispiele von wahrscheinlich zwei- oder mehrreihigen Garnituren gibt es z.B. in Bj 1131, wo die Lage jedoch nicht ungestört ist (Abb. 438) und in Bj 557, 1081.
3.4. Modell C
Man hat häufig angenommen, dass die Perlenketten eine Verbindung zwischen den beiden ovalen Spangen darstellten und an diesen befestigt waren (s. z.B. Birka I, 173, Bj 550). Einen sicheren Beleg für diesen Gebrauch kann ich nicht finden. Inga Hägg (1974, 124) bildet auf der Unterseite der ovalen Spange in Bj 559 einen feinen gezwirnten Faden ab, der unter dem Fragment der Bandöse für den Rock lag. Einen Kommentar zu diesem Bild habe ich nicht gefunden.8
Dass der Perlenschmuck weit unten auf der Brust getragen werden konnte, ist in vielen Fällen klar doku-mentiert. Sie sind zwischen den ovalen Schalenspangen eingezeichnet, aber auch weiter oben oder weiter unten auf der Tracht. Ob dies einen wirklichen Unterschied in
ihrer Anbringung anzeigt, ist vielleicht nicht sicher. Eine leicht bewegliche Perlenkette kann sich natürlich aus ihrer normalen Lage verschieben, etwa bei der Beisetzung des Toten.
Nur in einem Grab, Bj 507, gibt es gleich neben den Perlen einen Silberhaken (Taf. 112:4), der vielleicht zur Befestigung der prachtvollen Kette aus Bergkristall-und Karneolperlen gedient haben kann. Er gehört mög-licherweise mit dem daneben abgebildeten geschlossenen Silberring zusammen, der in der Fundbeschreibung nicht erwähnt wird.
Bj 507 (Abb. 94 und Taf. 116:1) gibt ein gutes Beispiel einer Perlenkette, die wahrscheinlich zwischen den ovalen Spangen gelegen hat. Mit dem erwähnten Silberhaken (und dem Ring?) kann sie an der Nadel der Spange oder an einer Bandöse befestigt gewesen sein.
In Bj 515 (Abb. 104, Taf. 120:1) ist der Perlenschmuck in einer Lage gleich oberhalb der ovalen Spangen angedeutet, und Stolpes einziger Kommentar zu der Zeichnung ist, dass „die grosse blaue Mosaikperle in der Mitte lag". Die Gesamtlänge, die die 32 Perlen ergeben, lässt es glaubhaft erscheinen, dass der Halsschmuck in diesem Falle zweireihig war.
In Bj 550 (Abb. 126, Taf. 120:11 a-s) lag die Reihe der grossen Perlen in einem Bogen ein Stück unterhalb der ovalen Spangen und parallel mit einer Silberkette. Ein Anschluss an die Spangen ist nicht angedeutet. Eine Reihe kleinerer Perlen (Taf. 120:11 t-y) wurde hier am Halse getragen (s. oben Modell B).
Auf dem Grabungsplan von Bj 557 (Abb. 130, Taf. 121:2 und 114:2) sind zwischen den ovalen Spangen zahlreiche Perlen und zwischen diesen liegende Silbergegenstände eingezeichnet9 (s. Birka I, 177f.). Die Zahl der Perlen - 100 Stück - macht es wahrscheinlich, dass der Perlenschmuck hier mehrreihig war. Man darf wohl annehmen, dass die Anhänger und die Silberdrahtringe, Taf. 121:21 a-c, zu der Schmuckgarnitur gehört haben (vgl. oben Abschnitt 3.3).
In Bj 660 (Abb. 189, Taf. 121:10) sind die 28 Perlen zwischen den beiden ovalen Spangen und bogenförmig verstreut oberhalb derselben eingezeichnet. Ob es sich
6 Taf. 118 gibt ein falsches Bild von dieser mehrreihigen Garnitur. 7 Siehe Farbentaf. 121:9, Taf. 97:5, 98:9 und 14,100:8 und ein Anhän ger Abb. 2:16, sowie Abb. 323. 8 Dagegen beschreibt Hägg das Fragment einer roten Schnur an einem Leinenfragment unter der ovalen Spange in Bj 563 (1974, 125, Abb. la-b, 2a-d). Nach Hägg handelt es sich hier um eine Zierschnur am Rock. 9 U.a. eine Silbermünze Karls des Kahlen (840-877), eine byzantini sche Silbermünze Michaels III., Theodoras und Theklas (842-856), zwei Silberanhänger, Taf. 96:la-b, drei Silberperlen und zwei „End knöpfe?" (Taf. 114:2, s. Duszko, 1986, 72), vier Ringe aus Silberdraht mit daranhängenden Perlen und kleinen Silberringen (Taf. 121:2).
50 Greta Arwidsson
hier um eine zweireihige Perlenkette gehandelt hat, ist nicht zu entscheiden.
In Bj 959 (Abb. 334), in dem die Skelettreste ziemlich gut erhalten waren, ist eine Perlenkette aus 17 Perlen als gleichmässiger Bogen eingezeichnet, der von den ovalen Spangen ausgeht und auf dem unteren Teil des Brustkorbs liegt. In Bj 980, ebenfalls mit erhaltenen Skelettteilen, darf man annehmen, dass die Perlengarnitur aus 50 Perlen und 8 Silberanhängern (Abb. 360, Taf. 99:25, 97:7) dieselbe Lage hatte.
Im Grab Bj 1081 (Abb. 418, Taf. 124:1) lagen 94 Perlen, die Stolpe als eine Punktreihe, ausgehend von den ovalen Spangen, über die Brust herab gezeichnet hat, aber ausserdem eine Reihe, die zu der gleicharmigen Spange führt. Die Perlengarnitur scheint hier zweireihig gewesen zu sein.10 Auf der Farbtafel 124:1 sind die Perlen zu einem geschlossenem Ring aufgezogen, was sicher irreführend ist.
In dem Grab Bj 1131 scheint eine zweireihige Perlenkette aus 66 Perlen bei den Spangen gelegen zu haben (Abb. 438, Taf. 117:1), sie ist in einem Bogen oberhalb der ovalen Spange, an der kleinen runden Spange vorbei bis zu der gleicharmigen Spange eingezeichnet. Die zweite ovale Spange fehlt in diesem Grab, das also wahrscheinlich vor Stolpes Untersuchung gestört war.
3.5. Modell D (?)
Es verbleibt unsicher, ob man die Garnituren wie die aus dem Grab Bj 632 (Taf. 119 und Abb. 170-171) und die aus Bj 791 (Abb. 235) als ein eigenes Modell aussondern soll, vgl. oben Abschnitt 2.4.
3.6. Vergleichsmaterial
Høilund-Nielsen (1987) gibt viele Beispiele mehrreihiger Perlengarnituren aus der jüngeren germanischen Eisenzeit Bornholms und stellt fest, dass in der Phase I A-B (ca. 540-600 n. Chr.) besondere Endstücke gebräuchlich waren (Tab. 6 und Fig. 10), an denen die Perlenreihen befestigt waren. In späteren Phasen kommen diese Endstücke seltener vor. Dies entspricht offenbar dem Gebrauch von Kettenhaltern in der Vendelzeit vor allem auf Gotland (VZG, Abb. 211-212, 1016-1024, 1516, 1920-1923, 1934-1935, 2245-2249, 2250-2225).
Aus der jüngeren Wikingerzeit besitzen wir ein schönes finnländisches Beispiel einer vierreihigen Perlengarnitur, die aus dem reich ausgestatteten Grab Nr. 29 auf dem Gräberfeld C auf Kjuloholm, Kjulo in Finnland stammt (Cleve, 1978, 41 ff. und Kivikoski 1973, Abb. 822, Farbbild). Wie die vier Ketten aus insgesamt 184 Perlen befestigt waren, ist nicht dokumentiert (es gibt keine Angaben über Reste eines Halskettenverteilers) und Cleve gibt in seiner Beschreibung nur an, dass die Perlen um den Hals gelegt waren, während zwei runde Bronzespangen (Typ Appelgren 1897, Typ D = Kivikoski 1973, Abb. 659) auf der Brust durch eine Bronzekette verbunden waren. Zu der Perlengarnitur gehören zwei, vielleicht noch mehr, arabische Silbermünzen mit Ösen. Nach Cleve 1978, 238, können alle arabischen Silbermünzen, die in den Gräbern von Gräberfeld C auf Kjuloholm lagen, auf die Zeit zwischen 898/899 und 980/ 981 datiert werden. Kivikoski 1973, 90, Abb. 659, datiert Spangenpaare von Appelgrens Typ D auf den Anfang des 11. Jahrhunderts.
Um den Hals hat die Frau hier einen Thorshammerring aus Eisen getragen.
6. Metallperlen
Birka I, Taf. 114:1-13, 16-18
Greta Arwidsson
In den Perlenfunden von Birka kommen Perlen aus Silber und Bronze nur sparsam vor, im Gegensatz zu der grossen Menge der Perlen aus Glas, Glasfluss, Karneol und Bergkristall. Wie bei den Bernsteinperlen (s. Kap. 8) gibt es meistens nur eine Metallperle in jeder Garnitur, in einigen Fällen zwei, einmal drei, und in zwei Fällen sogar fünf Perlen.
1.1. Die Silberperlen Taf. 114:1-8
Aus sieben Birkagräbern liegen neun Silberperlen mit Filigran und Granulationsschmuck vor, aus der Schwarzen Erde kommt eine weitere, die Wladyslaw Duczko im Band Birka V (1985, 72ff.) publiziert hat, zusammen mit einem grösseren Vergleichsmaterial und Angaben zur Datierung.
Aus dem Brandgrab Bj 66 stammt eine mit Filigran verzierte Perle (s. Duczko 1985, 74) zusammen mit einer Spiralperle, aus spulenförmig gedrehtem Silberdraht. Diese hängt an einer Öse aus Silberdraht. In Bj 649 gab es drei Spiralperlen aus Silber, von denen eine (unvollständig?) aus zwei zusammengezwirnten Drähten besteht, Taf. 114:8.
1.2. Die Bronzeperlen Taf. 114:7-12 und 16-18
Spiralperlen aus Bronzedraht, bzw. schmalen Bronzestreifen kommen aus den Gräbern Bj 151 (eine ganze und eine halbe), Bj551 (6 oder 7 Ex.), Bj 606 (5 Ex.), Bj
791 (3 Ex.), Bj 1046 (1 Ex.), Bj 1081 (1 Ex.) und Bj 1146 (1 Ex.). In dem letztgenannten Grab lag die hübsche Spiralperle in einer Tasche, in den übrigen Fällen gehören sie zu Perlengarnituren oder Ketten mit etwa 6-30 Perlen aus anderem Material; in Bj 151 gab es insgesamt 136 Perlen.
Die für die Perlen verwendeten Bronzedrähte sind quergeriefelt oder rund und glatt, die Bronzestreifen sind flach und glatt.
Grösse: Die Länge der Perlen liegt zwischen 0,7 und 1,2 cm, ihr Durchmesser zwischen 0,4 und 1,2 cm.
1.3. Weitere Bronzeperlen Taf. 114:13,16
Im Brandgrab Bj 349, das zu den vendelzeitlichen Gräbern auf Björkö gehört (s. Arrhenius 1976, Abb. 8), gab es zwei kugelförmige, mit einem Loch gegossene Bronzeperlen, von denen die eine mit einem Flechtbandmotiv verziert ist (vgl. eine Perle aus dem Ksp. Veta, Ög., Arwidsson 1942 A, Abb. 3).
Grösse: 2,2 x 1,6 cm.
Ein kleiner, mit Punktaugen verzierter Bronzewürfel aus Bj 1046 ist durchbohrt und wurde vielleicht als Perle getragen.
Endlich gibt es aus Bj 1158 und 306 A zwei fast ton-nenförmige, glatte Bronzeperlen.
7. Echte Perlen an dem Anhänger aus Silberdraht
aus Bj 854
Birka I, Taf. 103:9
Greta Arwidsson
Der Anhänger aus Bj 854 ist aus feinen Silberdrähten hergestellt, die wahrscheinlich drei oder zwei konzentrische Kreise gebildet haben und durch Querstäbchen verbunden waren, auf einen der letzteren ist eine Perle aufgezogen. Auch auf den übrigen Drähten sitzen in gleichmässigen Abständen kleine echte Perlen. Die Öse aus zwei zusammengewundenen ähnlichen Drähten ist um den Draht des äusseren Kreises gelegt, sie setzt mit einem geraden „Schaft" fort und ist schliesslich spiralförmig zu einer tonnenförmigen, offenen Öse aufgerollt. Der Anhänger ist sehr fragmentarisch, von den Perlen sind nur zehn erhalten. Alle sind mit einem dünnen Loch durchbohrt, was gutes technisches Können voraussetzt. Auf der einen Seite des Anhängers ist der Glanz der Perlen teilweise erhalten, auf der anderen sind sie stärker angegriffen.
Grösse: Durchm. des Anhängers wahrscheinlich ca. 2,4 cm. Der Durchm. der Perlen wechselt zwischen 0,1 und 0,3 cm.
Vergleichsmaterial Eine Entsprechung zu diesem Anhänger ist mir nicht bekannt. Wie mehrere andere Gegenstände in diesem Grab darf man wahrscheinlich den Anhänger aus Bj 854 als Import aus Westeuropa betrachten (s. Kap. 10. Abschnitt 2.2). Allerdings könnten die extrem kleinen Perlen sehr wohl auch aus nordischen Miesmuscheln stammen.
In dem Brandgrab Bj 29 lag eine kleine echte Perle, die auf einen Bronzedraht aufgezogen war und an einem kleinen Bronzering hing (Abb. 11:16), und wahrscheinlich auch eine lose Perle zusammen mit ca. 180 Perlen aus Glas und Glasfluss. Der Durchmesser der echten Perlen ist 0,4 bzw. 0,8 mm. Sie scheinen beide vom Brand beschädigt zu sein, ebenso wie ein Teil der Glas-und Glasflussperlen.
Vielleicht ist der kleine Silberdrahtanhänger als verwandt mit den Anhängern vom Typ Taf. 121:2, 122:18:f, sowie Taf. 117:16 und Abb. 38:8-14 zu betrachten. Solcher Perlenschmuck ist in den Birkagräbern nicht ungewöhnlich (s. Taf. 117-119 und 121).
8. Bernstein
Birka I, Taf. 103:2-4, 110, 149:1, Abb. 319 Abb. 8:1
Greta Arwidsson
1.1. Hjalmar Stolpes Bernsteinuntersuchungen
Als Hjalmar Stolpe 1872 nach Björkö kam, um dort das seit langem bekannte Vorkommen von Bernstein zu untersuchen, lagen ihm mehrere schriftliche Angaben darüber vor. In seinem Bericht von 1872 zitiert er (S. 84f.) Sjöborg (1830 III), der teils ältere Schriften angibt, in denen der Bernstein von Björkö erwähnt wird, teils eigene Nachforschungen auf der Insel betrieb und auch die Funde Alexander Setons kannte (s. Selling 1945, Fig. 22).
Zu der Auffassung Sjöborgs (1830 III, 113), dass „man glauben möchte, ein damit (mit Bernstein) befrachtetes Schiff sei zwischen Björkö und Hofgården verunglückt", scheint Stolpe keine Stellung genommen zu haben. Seine Seegrundschabungen am Ufer entlang von der „alten Schiffslände" bis nach Kugghamn hin (s. das Hafengebiet der Schwarzen Erde 1973, die Karte S. 33) waren recht unergiebig, nach Stolpes Vermutung deshalb, weil die Seegrunduntersuchungen nur in einer Tiefe zwischen 20 und 10 Fuss ausgeführt wurden. Am Strand fand er im Herbst 1872 nur einige wenige Bernsteinstücke (Stolpe 1873, 76).
Die bei der Seegrunduntersuchung gefundene Mischung von Kohle, Holzstückchen, Nusschalen und einer grossen Menge von Schlehenkernen lassen Stolpe vermuten, dass Bernstein mit Absicht ins Wasser geworfen worden war. Eine sichere Lösung der Frage ergab sich nach seiner Ansicht nicht aus den vorgenommenen Untersuchungen.
1.2. Bernstein von verschiedener Qualität
Die Grabung in der Schwarzen Erde von 1872 erbrachte nach Stolpe eine ziemlich grosse Menge Bernstein, vor allem unbearbeitete Stücke, aber auch „Spinnwirtel, Perlen und dergleichen" (Stolpe 1873, 61). Er fand, dass ein deutlicher Unterschied in der Farbe zwischen den
am Strande gefundenen Stücken und denen aus der Schwarzen Erde bestand. Die ersteren, sagt er, haben stets einen hellgelben Farbton, während die in den Kul-turschichten gefundenen tiefrot sind. Das liegt nach seiner Auffassung daran, dass die tiefroten ihre Farbe unter der Einwirkung von Licht und Luft verändert haben. Ob diese Theorie sich halten lässt, ist zweifelhaft, da es offenbar rötlichen Bernstein gibt, der für bestimmte Fundplätze charakteristisch ist. Trotz vieler neuerer Versuche, die Herkunft des Bernsteins festzustellen, scheint es bis jetzt keine sicheren Methoden zu geben (Jensen 1965, 1982, 1986, 1987 und Jankuhn 1986,153). Eine Durchsicht der Bernsteinfunde aus den Gräbern von Birka zeigt, dass grosse Farbunterschiede vorliegen. Es gibt klaren, durchsichtigen, rötlichen Bernstein (Qualität A) unter den Gegenständen und ebenso unter den unbearbeiteten Stücken. Zwei der Spielsteine aus Bj 524 (Taf. 149:1) sind von der Qualität A, während die übrigen fleckig und opak sind (Qualität B). Sorgfältig ausgeführte Gegenstände in der Qualität A gibt es unter den Funden aus der Schwarzen Erde, u.a. das Katzenfigürchen (Abb. 8:1a) und den kleinen verzierten Anhänger (Abb. 8:1 d, SHM Inv. 8252 und 8208:1998). Aus demselben feinen Bernstein besteht auch ein axtförmiger Anhänger (SHM Inv. 5208:1999) Stolpe 1876B, 633, Abb. 4 und 788, Abb. 18.
Eine platte, ringförmige Perle aus der Schwarzen Erde (SHM, Inv. 5208:2530) zeigt eine ungewöhnliche Farbveränderung. Auf der Aussenseite liegt eine dunklere, bräunliche Farbschicht, während der Bernstein darunter hellgelb ist.
Die unbearbeiteten Stücke haben oft unter einer äusseren Kruste durchgehend einen rötlichen Farbton, aber auch Stücke in der fleckigen Qualität B sind nicht ungewöhnlich.
Die wenigen kleinen Bernsteinperlen, die zusammen mit anderen Perlen an den Perlenketten vorkommen, gibt es in beiden Qualitäten, A und B. Die beiden fein
54 Greta Arwidsson
Abb. 8:1. Bernsteingegenstände. Skala 2/1. a) Die kleine „Katze" aus der Schwarzen Erde, SHM 8252; b) ein Anhän-ger aus Bj 943; c) der Thorshammer aus Bj 943; d) ein verzier-ter Anhänger aus der Schwarzen Erde, SHM 5208:1998. Zeichn. B. H.
geschliffenen Anhänger und die drei Perlen aus Bj 835 (Taf. 115:2) bestehen aus rötlichem, klarem Bernstein, Qualität A, ebenso der Anhänger aus der Tasche in Bj 943 mit einem nicht fertig gebohrten Loch (Abb. 319:b). Der kleine Thorshammer, der wahrscheinlich auch in dieser Tasche lag, ist dagegen aus einem fleckigen Stück Bernstein der Qualität B hergestellt (Abb. 319 ganz unten und Abb. 8:1c).
1.3. Die Untersuchungen des Hafengebiets in den Jahren 1970-1971
Hinsichtlich der Bernsteinsfrequenz in der Schwarzen Erde sind die Funde des Hafengebiets und die hier festgestellte Schichtenfolge von Interesse (K. Ambrosiani 1973, 56 und Tab. 7; siehe auch die Lage des Grabungsgebiets im Verhältnis zur heutigen Strandlinie).
2.1. Gegenstände aus Bernstein
Kristina Ambrosiani (1973, 57) stellt fest, dass Bern-steinperlen in 45 Birkagräbern gelegen haben, darunter in vier Männergräbern, und zwar in den Waffengräbern Bj 116 (Taf. 115:26), Bj 536 (Taf. 115:24), Bj 710 und 727 (Taf. 115:6). In zwei Fällen (Bj 536 und 727) lagen die Bernsteinperlen in einer Tasche, ebenso ein Stück unbearbeiteter Bernstein in Bj 710.
In den Frauengräbern gehören die Bernsteinperlen zu den Perlengarnituren/-ketten, aber sie kommen nur vereinzelt vor. Eine einzige Perle ist das Gewöhnliche, in einigen Fällen gibt es zwei (Bj 523, 535, 943), und in einem Grab gibt es drei Perlen zusammen mit zwei Bernsteinanhängern (Bj 835, Taf. 115:2). In einem Frauengrab lag auch Bernstein in einer Tasche (Bj 943, Abb. 319). Es gibt hier einen kleinen Anhänger und einen Thorshammer (s. oben, Abschn. 1.2.) und dazu etwa zehn Stückchen unbearbeiteten Bernstein. Zur Perlenkette in diesem Grab gehören zwei geschliffene Bernsteinperlen (Taf. 115:3).
Die Bernsteinperlen (Taf. 115) sind oft klein und manchmal nur grob bearbeitet. Bei einigen grösseren „Perlen" ist zu erwägen, ob sie nicht als Spinnwirtel gebraucht wurden (s. Kap. Spinnwirtel).
Im Hinblick auf die grosse Menge von Bernstein, die bei Nord- und Nordweststurm im Verlauf der Jahrhunderte auf den westlichen Strand von Björkö geworfen wurde, wie es vielfach bezeugt ist (s. Sjöborg 1830, III, 113 und Stolpe 1872, 102), sowie auf das reiche Vorkommen von unbearbeitetem Bernstein in der Schwarzen Erde (Stolpe 1873, 61 und 77 sowie 1876B, 619 und 777), erscheint das Vorkommen von Bernsteinartefakten in den Gräbern auffällig geringfügig.
In einigen Fällen ist der Bernstein gut bearbeitet und fein geschliffen (z.B. die Anhänger Taf. 103:2-3 und 115:2 und die Perlen Taf. 115:2-5, 14, 22 und 24, sowie die Spinnwirtel, Taf. 115:27-28). Die Herstellung des leider unvollständigen Satzes von Spielsteinen in Bj 524 (Taf. 149:1), dessen Steine von verschiedener Form und Grösse sind (vgl. Abschnitt 1.2. oben), zeugt von ziemlich schlechtem handwerklichen Können, im Vergleich z.B. mit dem schön ausgeführten Satz von Spielsteinen aus Bein in Bj 624 (Taf. 149:3).
Abgesehen von der Katzenfigur (s. oben Abschnitt 1.2 mit Abb. 8:1) gibt es unter den Birkafunden keine Tierskulpturen aus Bernstein, wie sie in Norwegen vor-kommen (s. z.B. das Gesamtbild von sechs solchen bei Hagen und Liestøl 1961, Farbentaf. 56).
Schmuckgegenstände 55
2.2. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Funde von Gegenständen aus Bernstein kaum von avanciertem Handwerk zeugen. Es erscheint nicht unmöglich, dass viele der Gegenstände in Birka hergestellt sind. Vielleicht erhält diese Hypothese eine Stütze in den jüngst veröffentlichten Angaben, dass in Haithabu ein Grubenhaus mit Resten einer Bernsteinwerkstatt ausgegraben wurde (Jankuhn 1986, 85). Es wäre interessant, diese Funde mit dem Abfallsmaterial der Schwarzen Erde auf Björkö zu vergleichen.
Sehr interessante Entsprechungen zu dem Werkstattsfund von Haithabu gibt es in den wikingerzeitlichen Fundschichten der Stadt Wolin (Polen), wo man zahlreiche Perlen, Anhänger und Amulette (u.a. kleine Thorshämmer), sowie Halbfabrikate und Rohmaterial gefunden hat (Filipowiak 1985).
Ob die einzelnen oder wenigen Bernsteinperlen an den Halsketten und die Bernsteinstückchen, die in
Taschen verwahrt wurden, die Auffassung bestätigen, dass Bernstein auch in der Wikingerzeit als Amulett getragen wurde, bleibt weiterhin offen (vgl. Ambrosiani 1973, 57 und Trotzig 1969, 25). Zum Vergleich mit den von Männern und Frauen in Birka getragenen einfachen Anhängern oder unbearbeiteten Bernsteinstücken sind die Funde des Gräberfeldes von Barsaldershed, Gröt-lingbo, Go. (Trotzig 1969, 25f.) hochinteressant. Hier liegen die mit einem Loch versehenen Bernsteinanhänger nicht bei den Schmucksachen, sondern in oder neben grösseren Bronzegefässen am Fussende der Gräber. In den Männergräbern haben die Anhänger oft die Form einer einfach geformten Axt (vgl. Taf. 103:2 aus Bj 954, falsch signiert?). Die Kombination eines Bernsteinanhängers mit einem Thorshammer aus Bernstein und etwa zehn unbearbeiteten Bernsteinstückchen in der Tasche des Frauengrabs Bj 943 (s. oben Abschnitt 1.2.) ist wohl ein deutliches Indiz, dass Bernstein mit der grossen Gruppe der Thorshammeramulette gleichstellbar war.
9. Verschiedene Schmuckgegenstände
in Form von Menschenfiguren, Reitern, Pferden, Vierfüsslern, Vögeln und Schlangen Abb. 9:1-3, Tab. 9:1
Greta Arwidsson
1. Vorbemerkungen
Schmuckgegenstände in Form von kleinen, freistehenden Figuren bilden eine sehr kleine Gruppe unter den Funden von Birka. Sie sind jedoch von grossem Interesse, vor allem wegen mancher Details der abgebildeten Kleidung und wegen der Verbreitung, in der einige der Figurentypen vorkommen.
Sie deuten auch auf sehr langlebige Traditionen und auf kulturelle Kontakte mit West- und Südeuropa ebenso wie mit Osteuropa.
Man hat viel über Miniaturfiguren dieser Art geschrieben, über ihre symbolische Bedeutung und ihre
Entsprechungen in der Wirklichkeit. Zu der Diskussion haben viele Forscher beigetragen, zu der jedoch noch etliches hinzuzufügen wäre. Bei ihren Deutungen haben sich skandinavische Forscher in erster Linie der Gestalten der altnordischen Literatur und der nordischen Mythologie bedient, während aussernordische Wissenschaftler von den Gestalten der klassischen Bildkunst, Mythologie und Religion ausgegangen sind.
Da Schmuckstücke/Amulette dieser Art unter den Birka-Funden keine hervorragende Rolle spielen, dürfte es hier in Birka II:3 nicht der rechte Platz sein, den gesamten grossen Problemkreis zu untersuchen, für wie interessant ich die Exemplare von Birka auch halte.
56 Greta Arwidsson
Daher beschränke ich mich hier auf einen kurzen Kom-mentar, in dem ich nur die sechs Gruppen der Männer-und Frauenfiguren, der Reiterbilder, der Pferde, Vierfüssler, der Vogel- und Schlangenfiguren berühre, die in Birka vertreten sind. Die in verschiedenen Ausführungen und Formen vorkommenden Männermasken diskutiere ich hier nicht, sondern ich verweise auf Kap. 3:2.8.1. (Callmer), auf Duczko 1985, 68, 5.2 mit der dort angegebenen Literatur (Vgl. auch Shetelig 1931 und Arwidsson 1963).
Bemerkenswert ist es, dass es in Birka die Frauen sind, die diese Symbole in Miniaturgrösse getragen haben (s. Tab. 9:1).
Zur Verwendung entsprechender Symbole an Waffen und Pferdeausrüstung verweise ich auf meine Zusam-menstellung in Valsgärde 7 (1977, 113ff., vor allem S. 125) und der dort zitierten Literatur sowie auf Shetelig (1950). Die apotropäische Bedeutung einer Kombination von Schlange und Vogel ist kaum deutlicher zu
illustrieren als durch das Bildblech A am Helm von Valsgärde 7 (Arwidsson 1977, 116, Abb. 110-115).
2.1. Zwei Reiterfiguren aus Bj 825 Taf. 92:7 und 11, Abb. 9:1
Zwei Reiterfiguren in Flachrelief aus Silberguss. Sie scheinen in derselben Form gegossen zu sein und haben auf der glatten, unverzierten Rückseite zwei beim Guss hergestellte Ösen, die jetzt defekt sind. Bei dem einen Exemplar sind sie durch zwei aufgenietete Silberstreifen mit vier parallelen Wülsten ersetzt. Der Abstand zwischen ihnen ist 0,9 cm. Die Nietköpfe sind gut eingeebnet und treten auf der Vorderseite nur schwach hervor, zwei am Bug des Pferdes zwischen dem Zügel und dem Fuss des Reiters und zwei an der Lende des Pferdes (Taf. 92:7).
Ein Schwert, ohne sichtbaren Griff hängt erstaunlich-erweise auf der rechten Seite des Reiters. Ein Riemen
Tab. 9:1. Grabformen, Geschlechtsbestimmungen und Grä-berbezirkverteilung betr. in Kap. 9, 10, 11, 12 und 13 disku-tierte Gegenstände.
Schmuckgegenstände 57
unter dem Bauch des Pferdes deutet wohl einen Sattel an. Die Beinhaltung ist charakteristisch für einen Reiter, der keine Steigbügel hat.
Die Verzierung der Vorderseite besteht aus Reihen von kleinen Vertiefungen am Bug und am Hals des Pferdes. Beide Exemplare sind sehr abgenutzt, das eine ist ausserdem unvollständig.
Grösse: Das unvollständige Exemplar: 3,4 x ca. 2,4 x ca. 1,5-2,0 cm. Das andere Exemplar: 3,4 x 2,4 x ca. 2,0 cm.
2.2. Vergleichsmaterial
In Nordeuropa dürften wenige Entsprechungen zu Figuren dieser Art bekannt sein (vgl. Tallgren 1922 und 1925, II, Taf. V:4, Gjessing 1943, Kühn 1935 Taf. 450, sowie Veeck 1931 u.a. Taf. 30:5 und Sachsen und Angelsachsen 1978, 613, Abb. 284). Umso mehr Entsprechungen gibt es zu Pferdebildern, sowohl kleine Exemplare aus Metall, als auch Bilder auf Pressblechen oder Steinmonumenten (Olsén 1945, 79ff., Abb. 347-356. Almgren 1940, 155, Abb. 1-4; Lindqvist 1941-1942 passim; Arwidsson 1954, Abb. 78-79 und 1977, Abb. 128 und 133). Charakteristisch für diese Pferdeabbildungen ist ihre Darstellung im Trab, die gleichmässige Bogenlinie des Halses und der lange, bis zur Erde reichende Schwanz.
Die Datierung der Gruppe auf die spätere Vendelzeit ist gut belegt (Olsén 1945, 85 u.a.), ebenso wie die Bedeutung dieser Pferdedarstellungen für die Entwicklung des Vendelstils C (Olsén 1945, 76ff.; vgl. auch Abschnitt 3.1. unten). Da die stark abgenutzten Pferdefiguren in Bj 825 in Kombination mit einem Anhänger in Form einer Frauengestalt - ebenfalls stark abgenutzt - auftreten (s. unten Abschnitt 5.1.), sind wahrscheinlich alle drei auf die Vendelzeit zu datieren, während die Datierung des Grabes sich auf die ÄBS festlegen lässt, u.a. auf Grund der beiden ovalen Schalenspangen, Taf. 60:4, Typ P 47 (vgl. Jansson 1985, 34, Abb. 22).
3.1. Zwei Beschläge in Form von Pferden aus Bj 854 Taf. 92:1-2, Abb. 275, 276
Die beiden Beschläge in Form von Pferden sind aus vergoldetem Bronzeguss. Ursprünglich waren sie mit Nadelhalter und Nadelrast versehen, sie wurden also als Fibeln verwendet. Dann wurden sie mit aufgenieteten Silberblechen repariert und erhielten Ösen zum Aufhängen oder Festnähen (Taf. 92:1b). Die Pferde bilden ein gegenständiges Paar, sie unterscheiden sich jedoch bedeutend in den Details des Flächendekors. Bei einem
Exemplar hat das Auge ein flaches Granatplättchen als Einlage, die bei dem anderen verloren ist. Das Pferdebild ist in seiner Form und mit dem reichen Flächendekor typisch für den Vendelstil C (Olsén 1945, 76 ff. und Abschnitt 3:2 oben).
Grösse: 5,1x3,3x0,15 cm.
3.2. Kommentar
Die Pferdefiguren gehören zu dem ungewöhnlich reich-haltigen Halsschmuck der hier bestatteten Frau, zu dem u.a. ein Kettenverteiler mit mehrreihigen Perlenketten und eine grosse gleicharmige Spange gehören (Typ II B:l, s. Birka II:1, Abb. 11:1). Ob die Pferde als Anhänger getragen wurden oder als Beschläge festgenäht waren, ist nicht zu entscheiden. Das Grab lässt sich auf die ÄBS datieren.
Zwei kürzlich gefundene, fragmentarische Pferdefiguren aus Bronze sind von ganz ähnlichem Formcharakter (Claréus 1988, 24, Abb. 15). Die zum Guss gehörige Öse, die am Fragment der Pferdelende erhalten ist, kann als Öse zum Aufhängen gedeutet werden (vgl. unten, Abschnitt 5.4).
4.1. Kriegerfigur aus Bj 571 Taf. 92:9
Anhänger in Form eines Mannes mit einem Schwert und einem Stab (Speer?) in den Händen und mit hörnerför-migem Schmuck auf dem Kopf. In flachem Relief in Silber gegossen, mit Ausnahme des platten Hörnerschmucks, was den Kopf in markiertem Relief hervortreten lässt. Die Augen sind als tiefe Gruben markiert, während der Flächendekor im übrigen aus ringförmigen Vertiefungen besteht. Zwischen den beiden Hörnern wie auch zwischen den in die gleiche Richtung gewendeten Füssen gibt es runde Löcher. Die Rückseite ist uneben und hat keine Verzierungen. Eine Öse zum Aufhängen, die in einem Stück mit der Figur gegossen ist, sitzt auf der Rückseite des Kopfes.
Grösse: 2,9 x 2,0 x ca. 0,3 cm.
4.2. Vergleichsmaterial
Ein nahe verwandtes Figürchen aus Bronzeguss kommt sus einem Brandgrab des Gräberfeldes von Ekhammar, Kungsängen, Ksp. Stockholms Näs, Upl. (Ringquist 1969, 287, Abb. 1). Hier hält der Mann ein Schwert in der rechten Hand und zwei gekreuzte Stäbe in der lin-
58 Greta Arwidsson
ken. Der Hörnerschmuck hat Verdickungen an den Spitzen, die wahrscheinlich dem tierkopfförmigen Abschluss entsprechen, den wir auf vielen ähnlichen Abbildungen auf Pressblechen finden (s. z.B. Bruce-Mitford 1978, Abb. 140, Sutton Hoo, Vgl. Abb. 153, 156a, 164b-c; Arwidsson 1977, Abb. 133 und 138, Valsgärde 7), sowie an den Kopfmasken, die den Abschluss verschiedener kleiner Werkzeuge/Geräte bilden. Beispiele sind u.a. ein Schaft einer Pinzette aus Anlage 2, Bezirk 3-4, Gåtebo, Ksp. Bredsätra, Öl. (Beskow Sjöberg 1987, 244) und Gerätschäfte aus Sta-raja-Ladoga, Russland (Davidan 1982, Abb. 3:11) und aus Dover Grab 161, England, (Evison 1987, 84, Abb. 63). Vgl. auch Nadeln/Pfrieme und Pinzetten mit verschiedenen Formen von Männerköpfen aus Birka (Waller 1984, 187, Abb. 20, 30-31).
Ein aus Bronze gegossener Schlüsselschaft aus dem Ksp. Gamla Uppsala hat einen ähnlichen Abschluss: ein doppelseitiger Mannskopf ist von zwei am Hals zusam-menlaufenden Adlerköpfen bekrönt (Olsén 1949-1951, 116ff., Abb. 1). Die Adlerköpfe sind hier jedoch nach unten gebeugt und reichen bis zu den Wangen des Manns.
Leider hat man für diese Figuren mit Hörnerschmuck die Bezeichnung Odinsbild oder Odinskämpfer eingeführt (Shetelig 1931, 208f., Davidan 1982, 175, Abb. 3:11; Meinander 1985, 65ff., Claréus 1988, 25), und verwendet sie zur Identifikation auch in höchst unwahrscheinlichen Zusammenhängen, z.B. für einen Krieger, der einen mit einem Wolfspelz (?) verkleideten Mann leitet, auf einer der Pressblechmatrizen von Torslunda (Holmqvist 1955, Abb. 82, Arwidsson, 1977, Abb. 66) und für die beiden Krieger auf dem Helm aus Valsgärde 7, bzw. aus Sutton Hoo (Referenzen s. oben). Meine Auffassung habe ich in der Diskussion über den Ursprung der Helmblechkompositionen in Valsgärde 7 dargelegt (Arwidsson 1977, 116ff.)1-
5. Zwei Frauenfiguren
5.1. Frauenfigur aus Bj 825 Taf. 92:10 Abb. 248 und Abb. 9:1
Frauenfigur in Silberguss mit gestricheltem Flächendekor, der Gewandfalten andeutet. Der Kopf mit dem charakteristischen Haarknoten und dem herabhängenden Haarschopf (Band?) ist stark abgenutzt. Die Füsse bilden eine Öse mit kreisrundem Loch. Auf der etwas ungleichmässigen Rückseite gibt es eine in einem Stück mit der Figur gegossene Öse an der Rückseite des Kopfes.
Grösse: 2,7 x 1,2 x ca. 1,5 cm.
Hj. Stolpe hat eine gute Zeichnung der Figur ausgeführt und gibt an, dass sie auf der Rückseite des Reliquiars, Taf. 102:3, lag, nicht weit von der linken Schalenspange, in einem Teil des Grabes, in dem die Ordnung etwas gestört zu sein scheint.
5.2. Frauenfigur aus Bj 968 Taf. 92:8
Frauenfigur aus Silberguss, deren Verzierung in der Gussform hergestellt ist. Der Kopf ist abgenutzt, aber der Haarknoten und der herabhängende Schopf (das Band?) sind deutlich erkennbar. Auf der Rückseite des Kopfes eine beim Guss Hergestellte Öse.
Grösse: 2,5 x 1,4 x ca. 0,2 cm.
5.3. Vergleichsmaterial
Frauenfiguren dieser Art sind viel diskutiert worden und man hat sie vor allem zur Illustration bei der Behandling der Frauentracht herangezogen (Hägg 1971, 1974; Blindheim 1958-1959; Arrhenius 1962 und Bau 1982 mit zitierter Literatur). In der Regel werden sie als Walküren mit einem Trinkhorn (oder einem Korb mit Esswaren oder mit beiden) in der Hand gedeutet. Die Komposition vieler solcher Darstellungen auf den gotländischen Bildsteinen hat Sune Lindqvist (1941-1942 Abb. 132) gedeutet, der auch auf die Anknüpfung an klassische Motive, u.a. auf die Siegesgöttin, die einem reitenden Helden/Kaiser entgegentritt, hinweist (Lindqvist 1941-42, 96ff.). Eine in einem Frauengrab neben den Hügeln von Gamla Uppsala gefundene Frauenfigur aus Bronzeguss scheint ein Füllhorn zu tragen, - so deutet Else Nordahl sie (1984, 111 ff.). In der römischen Bildkunst kommen gerade Frauen mit Füllhörnern oder Fruchtschalen häufig vor.
Wenn wir unsere Vergleiche auf das römische Gebiet ausdehnen, so finden wir hier auch Bilder der Pferdegöttin Epona (s. z.B. Pobé 1961, Abb. 181), die mit einem Füllhorn oder einer Schale reitend dargestellt wird. (Vgl. Der kleine Pauly, Lexikon der Antike II, 1967, 1582 mit einer Diskussion und Literaturhinweisen.)
Eine andere Göttin, die ganz besonders mit einem Kult verknüpft ist, in dem Reiter eine wesentliche Rolle
1 Auch Karl Haucks Bezeichnung dieser Krieger als „Dioskuren", bzw. als „Einzeldioskur" für nur einen Krieger mit ähnlicher Ausrüstung ist kaum annehmbar (1983, 435ff., u.a. Abb. 11-14).
Schmuckgegenstände 59
spielen, wurde in Südosteuropa verehrt. Darstellungen des Kultes sind von einer grösseren Zahl gegossener Bleiplatten bekannt, sie kommen aber auch auf Marmorplatten, bzw. auf Platten aus Terracotta vor (Popo-vic 1983, 53ff., Abb. 1-15 mit Literaturangaben). Verbreitet war dieser Mysterienkult vor allem in Panno-nien, Dacien und Mösien im Donaugebiet und man bezeichnet ihn gewöhnlich als den Kult der danubischen Reiter (la culte des cavaliers danubiens). Die Bilder zeigen gewöhnlich eine sitzende oder stehende Frau in langem Gewand, flankiert von zwei Reitern, die sie mit erhobenem rechtem Arm grüssen. Andere Bildmotive der Platten sind häufig ein Opfertisch, an dem mehrere Personen Gaben darbringen - in einigen Fällen liegt ein Fisch auf dem Opfertisch. Mehrfach treten auch naturalistisch gezeichnete Schlangen als Symbole auf.
In dem Grab Bj 825 gab es insgesamt zehn Silberan-hängar (Taf. 92:7, 10-11, 97:2, 17, 98:1, 11, 99:6 [2 Ex.] und 103:5) und einen zu einer Spange umgearbeiteten Silberbeschlag (Taf. 96:4). Offenbar gehören die beiden Reiterfiguren (Taf. 92:7 und 11, Abb. 9:1) und zwei runde Anhänger mit Filigranschmuck (Taf. 97:2, 98:1, Duczko 1985, 50, Fig. 46 und 35, Fig. 21) zusammen, die vielleicht an einem besonderen Band um den Hals gehangen haben und nicht zur Perlengarnitur gehört haben. Auch der ursprüngliche Platz des feuerstahlför-migen Anhängers (Taf. 103:5; Ström 1984, 138) und der des sog. Reliquiars (Taf. 102:3; Gräslund 1984 A, 111 ff. und Duczko 1985, 65, Fig. 74) ist unsicher (vgl. Gräs-lund 1984A, 114:3). Stolpe gibt an (s. Birka I, 299), dass die kleine Frauenfigur (Taf. 92:10) von der Rückseite des Reliquiars abgelöst wurde, und der neunte Silbergegenstand, der runde Anhänger (Taf. 97:17, vgl. Abb. 3:1:5 bei Duczko Kap. 3) in der rechten (südli-chen) ovalen Schalenspange lag.
Alle Anhänger wurden also auf dem oberen Teil der Brust verstreut gefunden oder in einer ursprünglicheren Lage am Hals gesammelt. Sie können alle zum Halsband gehört haben (s. oben).
5.4. Kommentar zu Abb. 9:1
Ich gebe gerne zu, dass die Verbindung zwischen den Reitern und der Frauenfigur aus Bj 825 (Abb. 9:1), die ich hier angedeutet habe, wegen der oben beschriebenen Fundverhältnisse falsch oder irreführend erscheinen mag. Gleichwohl meine ich, man sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass zwischen diesen drei Anhängern, die zum Schmuck derselben Birka-Frau gehört haben, ein naher Zusammenhang besteht.
Eine Andeutung einer Verknüpfung von Pferdegeschirr mit einer Frauengestalt gibt uns vielleicht auch ein schwedischer Grabfund der Wikingerzeit, aus dem Bootgrab Vendel IV (Stolpe & Arne 1912, Taf. 15:1; vgl. auch Strömberg 1984, 146). An einem Kumtbeschlag von einem für Skandinavien ungewöhnlichen Typ ist zuoberst zwischen den beiden Bügeln eine Frauengestalt angebracht. Die Frau scheint mit ihren beiden Händen zwei Haarflechten oder zwei Schlangen (?) festzuhalten, während an den Aussenseiten der Bügel zwei Vierfüssler (?) plaziert sind. Die Figur ist doppelseitig und das Gesicht zeigt auf der einen Seite einen breit grinsenden Mund und kleine runde Augen (Abb. 9:2). Der Beschlag ist sehr abgenutzt und die Details sind undeutlich. Ebenso wie Gesichtsmasken häufig als Schmuck an verschiedenen Teilen der Pferdeausrüstung vorkommen (s. oben Abschnitt 1.) und als Schutzsymbole dienen, ist wohl auch diese Frauengestalt als Schutzspenderin aufzufassen.
Abb. 9:1. Die drei silbernen Figuren aus Bj 825. Photo ATA.
60 Greta Arwidsson
6.1. Die Menschenfigur aus Bj 649 Taf. 92:3 a-c
Teile einer männlichen Figur aus Silberguss: eine Kopf-maske im Relief mit gewölbten Glotzaugen, Nase beschädigt, mit Schnurrbart und Spitzbart, sowie zwei gebeugte Arme mit durch feine Striche markierten Fingern an den Händen. Die mit dem Kopf in einem Stück gegossene Öse ist stark abgenutzt, ebenso die kleinen Löcher am oberen Ende der Arme. Der eine Arm ist dreifach mit einem 2-3 mm breiten Silberband umwik-kelt, das mit eingestempelten Dreiecken verziert ist, die mit drei Punkten ausgefüllt sind.
Grösse: L. des Kopfes 2,9 cm, L. der Arme 3,9, bzw. 4,1 cm.
Wahrscheinlich gehören der Kopf und die beweglichen Arme zu einer Art Puppe, deren übrige Teile vielleicht aus organischem Material bestanden haben (vgl. Callmer, Kap. 3:2.8.2 oben, sowie Birka I, 228, wo Arbman annimmt, dass die Figur zu dem Perlenhalsband gehört hat.
7.1. Vogelfigur aus Bj 759 Taf. 100:1
Gegossene Vogelfigur aus Bronze, verziert mit gegossenen Punktlinien (erhöhte Punkte, aber auch einzelne, kreisrunde Stempelmuster). Das Auge ist rund und gewölbt. Vorder- und Rückseite sind flach, mit Ausnahme eines Bandes um den Schwanz, das auf beiden Seiten erhöht ist, und des Kamms auf dem Kopf, der auf der Vorder- und Rückseite gegen die Nackenlinie des Kopfes abgesetzt ist.
Der Fuss, der von einer offenen Öse ersetzt zu sein scheint, ist unvollständig.
In dem rundlichen Vorsprung auf der Rückseite des Halses nahe beim Kopf sitzt der Rest eines Eisenniets. Auf der Rückseite des Hinterteils gibt es viel Eisenrost, aber ein Niet ist nicht zu sehen.
Grösse: 7,9 x 4,8 cm (der Fuss nicht einberechnet) Dicke: 0,15 cm.
7.2. Vergleichsmaterial
Dieser Beschlag ist, soviel ich weiss, in Schweden immer noch unik, aber in Finnland und auf russischem Gebiet gibt es deutliche Entsprechungen. Kivikoski (1973, Taf. 90, 791 mit Anm. 47; sowie 1938, 246, Abb. 14) beschreibt zwei beinahe identische Exemplare aus Kju-loholm, Gräberfeld C (vgl. Cleve 1978) und beschreibt den Typ als gebräuchlich in Finnland, wo auch eine Variante vorkommt (Kivikoski 1973, Taf. 90, 792). Zu
Abb. 9:2. Kumtbeschlag aus dem Bootgrab Vendel IV. 1:1. Zeichnung C. B.
der Variante kenne ich auch Entsprechungen aus dem Gebiet des Ladogasees (Raudonikas, 1931, 358, Fig. 131.
8.1. Vogelspange aus Bj 1055 Taf. 84:4
Die Vogelspange ist aus Bronze gegossen. Die Oberfläche ist stark beschädigt und der vordere Teil der Spange sehr deformiert. Der an Spangen dieses Typs übliche grosse gekrümmte Schnabel ist in diesem Falle wahrscheinlich von einem geraden, leicht geöffneten Schnabel ersetzt, der durch einen schmalen Steg mit der ebenfalls schwer zu deutenden Klaue verbunden ist. Das Auge ist etwas erhöht. Schwache Spuren von einfachen Punktreihen (?), sonst keine Verzierung mit Stempeln. Der hinter dem Vogelkopf befindliche Nadelhalter besteht aus einem breiten Zipfel, der in einem Stück mit der Spange gegossen ist, die Nadelrast ist beschädigt und teilweise von Rostklumpen verborgen.
Grösse: Länge 4,8 cm, Breite des Schwanzes 2,6 cm.
Die Spange ist mit einem guten Bild von Birgit Arrhenius (1976) veröffentlicht.
8.2. Vergleichsmaterial
Im Vergleich zu allen anderen Vogelspangen in der grossen Gruppe dieses charakteristischen Typs erscheint diese Spange ziemlich misslungen. Siehe Attermans Zusammenstellung dieser Vogelspangen von 1934, und neuere Funde u.a. zwei Spangen aus den Gräbern von Lovö, Lunda 25 und 29 (Petré 1984, 41, Abb. A 25:1 und A 29:1).
Schmuckgegenstände 61
Viele dieser Spangen haben deutliche Entsprechungen zu den prachtvollen Vogelbildern auf vendelzeitlichen nordischen Schilden und auf einem entsprechenden Schild aus dem Fund von Sutton Hoo (s. Lindqvist 1950, Abb. 3-5, Arwidsson 1977, Taf. 5, 10, 11 und Bruce-Mitford 1978, Taf. 1, Fig. 44). Eine sehr interessante Neuigkeit für die zukünftige Diskussion des Symbolwertes der Vogelbilder und ihrer Anwendung als Frauenschmuck, bzw. als Emblem an Waffenteilen und am Pferdegeschirr stellt D. Kidds Rekonstruktionsvorschlag (1987) des prachtvollen Schmuckfundes aus Domagnano, Italien, dar. Die grossen Vogelfibeln, die er in seinem Vorschlag an den Achseln anbringt, sind auf Grund ihrer Form und der technischen Ausführung (Gold mit flächendeckendem Granatcloisonné) auf das siebte oder achte Jahrhundert zu datieren.
9.1. Zwei Schlangenförmige Anhänger Taf. 97:28-29
Bj 632. Schlangenförmiger Anhänger aus geriefeltem Silberdraht, aufgehängt an einer Öse, die aus einem ähnlichen, aber dünneren Draht zusammengewunden ist. Der Kopf der Schlange sitzt an der Aussenkante, mit beiden Augen sichtbar auf der Vorderseite. Der schmale Schwanz der konzentrisch aufgerollten Schlange ist zuinnerst. Der Kopf ist glatt, mit spitz zulaufendem Maul und den Augen als zwei eingestempelten Ringen. Der Anhänger ist abgenutzt.
Grösse: Durchm. 1,7 cm.
Bj 844. Schlangenförmiger Anhänger mit angenieteter Öse, die quergestellt ist. Hergestellt aus geriefeltem Silberdraht. Der Kopf ist platt und glatt mit Augen aus eingestempelten Ringen. Er sitzt in der Mitte und liegt flach auf dem zu dichten Ringen gewundenen Körper. Die Schwanzspitze ist an der abgenutzten Aussenkante nicht zu sehen. Der Anhänger ist stark abgenutzt.
Grösse: Durchm. 2,1 cm.
9.2. Kommentar
Diese beiden Schlangenförmigen Anhänger wurden zusammen mit mehreren anderen Anhängern und Perlen, sowie mit Silbermünzen mit angenieteten Ösen getragen (vgl. Birka I, 210ff., Abb. 170-171, und 317ff., Abb. 265-266). Die Münze in Bj 632 ist eine byzantinische Silbermünze, geprägt für Theophilus, 829-832 (Taf. 140:13). In Bj 844 ist die Münze ein vergoldeter Abbasid, der für al-Mamun in Madinat Balkh 809/10 geprägt ist (Taf. 138:4).
Abb. 9:3. Schlange aus Gold. Hon, Eker, Buskerud, Norge. Photo und Copyright Historisk Museum, Bergen.
9.3. Vergleichsmaterial
Zwei Schlangenförmige Spangen aus Bronzeblech aus dem Grab Nr. 30 vom Gräberfeld Albäck, Ksp. Sim-tuna, Upl., sind wegen ihrer wahrscheinlich sehr frühen Datierung interessant (Völkerwanderungszeit, Vendelzeit? Vgl. Ambrosiani 1955, 261, Fig. 2). Beide haben den eingerollten Schwanz in der Mitte und den Kopf an die Aussenkante der Spange gedrückt, sie sind etwas grösser als die Anhänger von Birka (Durchmesser 2,5 bzw. 3 cm)2.
Im übrigen kenne ich in Schweden keine Entsprechungen zu diesen Schlangenförmigen Spangen/Anhängern, dagegen gibt es einige in Norwegen und Dänemark, die aus Gold, Silber oder Bronze ausgeführt sind. Aus dem grossen Schatzfund von Hon, Eker, Buskerud, stammt das schöne Goldexemplar, Rygh, Fig. 690 (Oslo Inv. Nr. C 728) mit einem wohlgeformten, grossen Kopf. Abb. 9:3. Eine nahe Entsprechung hierzu bildet Jan Petersen ab (1928, Fig. 183). Dies Exemplar ist aus Bronze und hat auf der Rückseite des Kopfes eine in einem Stück mit der Schlangenfigur gegossene Öse. Laut Angabe hat der Anhänger zu einem Halsband mit acht anderen Schmuckanhängern und wenigstens sechzehn Perlen gehört (vgl. Petersen 1928, 141 und Bergens Museums Aarbok 1904, 25f., Fig. 8). Ein silbernes Exemplar gehört zu einem Fund von Traa, Ksp. Gran-vin, Hordaland (Petersen 1928, 141, Bergens Museums Aarbok 1913, 45, Fig. 29). Das einzige dänische Exemplar (abgebildet bei Petersen 1928, Fig. 163) stammt von einem unbekannten Fundort in Dänemark (gehört dem NM in Kopenhagen). Es ist aus Bronze gegossen.
2 Die Köpfe der Spangen von Simtuna haben in ihrer Form und Lage auffallende Ähnlichkeit u.a. mit einer Schlangenösenspange aus dem Grab Lunda A30, Ksp. Lovö, Upl. (Petré 1984, 127, 277, Abb. 3). Die Spange, die nur aus einer Schlange besteht, hat flächendeckenden, gut ausgeführten Stempelschmuck, im Auge ist ein rundes Glas-plättchen eingelegt, und je ein Glasplättchen im Zentrum jeder Öse des Schlangenkörpers. Wahrscheinlich auf die späte Völkerwanderungszeit zu datieren.
62 Greta Arwidsson
10.1. Bronzeschmuckstück aus Bj 1046 Taf. 103:11
Ein Schmuckgegenstand oder Amulett aus Bronzeguss in Form eines bogenförmigen Bronzezains mit einem Loch zum Aufhängen und einer auf dem Zain stehenden Tierfigur „en rond bosse" mit rückwärts gewandtem Kopf. Das Loch, das nicht kreisrund ist, ist in der Gussform entstanden.
Grösse: 4,5 cm (Sehnenmaass) x 0,5 x 0,8 cm.
Der Gegenstand lag in dem Brandgrab Bj 1046 zusammen mit 28 Perlen und Fragmenten u.a. einer gleicharmigen Bronzespange. Vergleichsmaterial ist mir nicht bekannt.
11.1. Plastische Tierfigur aus Bronzeguss aus Bj 1079 Taf. 100:17a-b
Ein Vierfüssler (?) oder ein Seehund (?), auf einer Platte sitzend, deren Unterseite mit Kreisen verziert ist. Die eine Seite ist stark korrodiert.
Nach einer Notiz Stolpes war die Figur mit einer Textilschnur an einem Bronzearmreif befestigt (Taf. 108:6). Das Grab ist wahrscheinlich ein Kindergrab (s. Gräslund, 1973, 161ff.), daher lässt sich die kleine Tierfigur vielleicht als Spielzeug oder Amulett deuten. Ola Kyhlberg (1980B, 228) reiht sie jedoch unter die Gegenstände ein, die vielleicht als Gewichtslot verwendet wurden.
Grösse: 2,0 x 1,9 x 1,6 cm, Gewicht: 7,5 g.
10. Zwei vergoldete Bronzespangen mit Zellenemail aus Bj 854
Birka I, Taf. 84:1-2, Abb. 275:2 a-b Abb. 10:1, Tab. 9:1
Greta Arwidsson
Zu dem reich ausgestattenen Frauengrab Bj 854 gehören zwei viereckige, flache Spangen aus vergoldeter Bronze mit mehrfarbigen Emaileinlagen.
1.1. Beschreibung
Die Spangen sind vollständig vergoldet und haben Einlagen aus einer opaken Glasmasse in drei Farben. An einer Spange ist eine Nadel aus Eisen erhalten, an der anderen gibt es Spuren einer solchen Nadel. Die Nadelhalter und die wahrscheinlich doppelten Nadelrasten sind in einem Stück mit der Spangenplatte hergestellt und wie die ganzen Spangen vergoldet. Die vier Kanten der Platten sind leicht nach innen geschwungen und mit
Reihen von kleinen Bogen verziert. Kleeblattförmige Vorsprünge an den vier Ecken haben jeweils drei kleine runde Gruben, die mit lackrotem Email ausgefüllt sind.
In der Mitte, entlang der Längsachse liegen nebenein-ander drei rhombische, glatte Felder mit Vergoldung. Von den beiden äusseren Rhomben gehen seitlich jeweils zwei gebogene Lamellen aus, die zu einer ringförmig geschlossenen Zelle eingerollt sind. Zwei etwas grössere ringförmige Zellen liegen zu beiden Seiten des mittleren Rhombus. Die Lamellen zeigen auch Spuren von Vergoldung an der Oberkante. Die ringförmigen Zellen enthalten alle rotes, bzw. lackrotes Email.
Die Zwischenräume zwischen den bogenförmigen Lamellenpaaren und dem mittleren rhombischen Feld
Spangen mit Zellenemail 63
sind bei beiden Spangen mit hellem, grünblauem Email ausgefüllt, während die Flächen an den Schmalseiten der Platte dunkelblaues Email enthalten. Das grünblaue und das dunkelblaue Email hat vielfach eine ungleich-mässige Oberfläche mit kleinen Bläschen in der Glasmasse. Kleinere Stosschäden sind erkennbar.
Grösse: 2,9x2,1 cm.
Beim gegenwärtigen Zustand der Spangen ist es schwer zu entscheiden, welche Methode zur Herstellung verwendet worden ist. Die rhombischen Felder scheinen Teile der Bodenplatte der Spange zu sein, die also beim Guss entstanden sind. Die dünnen Zellenwände können nach zwei Methoden hergestellt sein: entweder sind sie auf der Bodenplatte festgelötet, oder man hat die fertig geformten Lamellen mit der Glaspulverfüllung eingelegt vor der Erhitzung oder zu Anfang des Schmelzprozesses1. Die letztere Technik kennt man von einigen Prachtschnallen mit Emaileinlagen aus der Merovinger-zeit (Arwidsson 1942A, 77f. und Abb. 111).
Abb. 10:1. Eine Bronzespange mit Zellenemail aus Bj 854, ca. 2,5:1. Zeichnung (nach ältere Abbildungen) von B. H.
2.1. Vergleichsmaterial
Unter den schwedischen Funden der Wikingerzeit sind diese Spangen von einem uniken Typ2. Aber in Westeuropa so gut wie im europäischen Teil der heutigen Sowjetunion sind nahe Entsprechungen zu finden. In einem Aufsatz über Hjalmar Stolpe als Altertumsforscher zog Holger Arbman (1941, 155f.) einen in ATA archivierten Brief heran, den Stolpe am 15. Juni 1880 an Hans Hildebrand geschrieben hatte, in dem er erzählt, dass er Vergleichsmaterial zu den Birka-Funden in den Sammlungen des Museums von Dorestad gefunden hat. Er schreibt: „Das alte Duurstede erwies sich als Exportort aller meiner feineren Tongefässe und wahrscheinlich auch der emaillierten, rechteckigen Bronzeschmuckstücke im Grab mit der grossen gleicharmigen Bogen-spange" (= Bj 854).
Als Arbman 1937 das Inventar dieses reichausgestatteten Grabes, Bj 854, kurz zusammenstellte (Arbman 1937, 239 mit Abb. 5 b: 2a-b), wies er darauf hin, dass T. J. Arne (1914, 213) entsprechende Typen in Russland und vor allem im Gebiet von Kiew gefunden hatte.
2.2. Vergleichsmaterial aus Westeuropa
Wegen der Kombination mit mehreren, aus Westeuropa importierten Gegenständen im gleichen Grab (die Kanne, der Glasbecher, die Bronzeschüssel und wahrscheinlich die Bronzeperlen) glaubte Arbman am ehesten, dass auch die Emailspangen aus Westeuropa ein-
geführt waren, aber mit Hinweis auf Arnes Angaben (1914, 213) schrieb er, dass „auch wenn die Emailspangen orientalisch sind, oder nach orientalischen Vorbildern in Westeuropa bearbeitet, können wir sie mit ähnlichen Funden aus dem karolingischen Gebiet in Verbindung setzen". Er verweist auf Reinecke 1936, 220 (irrtümlich, soll Seite 200 sein), mit Taf. 42:1 und die weiteren hier angegebenen Funde. Reineckes Verzeichnis umfasst runde, scheibenförmige Spangen mit Zellenemail aus Südbayern und aus Frankreich. (S. Guide to the Anglo-Saxon Antiquities 1923, 150, Fig. 200.) Dies Verzeichnis lässt sich durch weitere runde Scheiben/ Scheibenspangen aus den Sammlungen des römisch-germanischen Zentralmuseums in Mainz und dem Provinciaal Museum van Drente in Assen, Niederlande, ergänzen: u.a. eine flache Scheibe aus Bronze mit weissem und grünem Grubenschmelz als Hintergrund eines aus Goldlamellen dargestellten Tiermotivs - ein rückwärts blickender Vierfüssler - publiziert bei Neeb 1911, 151, Abb. 11, Museum Mainz ohne Fundort.
1 Über die Herstellungsprobleme konnte ich Gunnel Werner und Erik Norgren an SHM's technischem Institut zu Rate ziehen. " Einen weiteren Typ von Emailverzierung aus den Gräbern von Birka vertreten zwei zu Schmuckanhängern (?) umgearbeitete Bronzebeschläge aus dem Schachtgrab Bj 835 (Taf. 99:19-20 und Abb. 255). Die fünf Zellen sind mit rotem Email gefüllt, im übrigen besteht der Flächenschmuck aus zwei Tierprotomen und zwei Feldern mit rippen-förmiger Verzierung. Der Typ scheint in Skandinavien hergestellt zu sein (s. Arrhenius, 1976, 185, Abb. 11).
64 Greta Arwidsson
Mehrere ähnliche Funde kommen aus Domburg, Nie-derlande (Roes 1954, PL XVIII) und aus Dorestad (Roes 1965, Pl. II, Abb. 11-13). Eins der wenigen Beispiele angelsächsischer Email-Arbeiten dieser Art ist die grosse „disc fibula" aus Grab XV, Ash, Kent, mit einer vierblättrigen weissen Blume vor grünem Hintergrund auf einem kleinen Mittelfeld umgeben von feinem Goldfiligran und verroterie cloisonné (Abb. s. Brown 1915, Pl. DXLVI, 4, p. 519). Brown schreibt: ,,The rarity of genuine enamelling in Anglo-Saxon work of this period makes the piece specially notable" (vgl. Arwidsson 1942 A, 75).
Die belgische Archäologin Anne Roes hat später Fibelfunde veröffentlicht, die von entscheidender Be-deutung für die Frage der Herkunft des Typs sind, zu dem die beiden Spangen aus Bj 854 gehören (Roes 1954 und Roes 1965). In ihrer Arbeit von 1954 bildet sie neben Hj. Stolpes eigenen Zeichnungen zwei Spangen aus Dorestad ab3, sowie eine Photographie einer weiteren Spange vom gleichen Ort (Taf. II:15). Bei der letzteren fehlen heute die Emaileinlagen4.
Arne (1914, 212) diskutiert das Vorkommen von Emaileinlagen an Gold- und Silbergegenständen aus dem Gebiet von Kiew unter Hinweis auf die Untersuchungen von Hanenko 1900, Spitsyn 1905, Beliachevskij 1904. Zum Vergleich bildet Arne teils eine der Spangen aus Bj 854, teils einen ähnlichen vergoldeten Bronzerahmen aus Bj 154 ab5, sowie zwei runde Spangen von einem Kirchhof in Hälsingborg, Schonen (Fig. 355, SHM Inv. 14214) bzw, aus dem Ksp. Böda auf Öland (Fig. 356, SHM Inv. 13878). Ferner erwähnt er die in den Museen des Gebietes von Kiew vorliegenden Schmucksachen mit Emaileinlagen mit bildlichen Darstellungen (Christus, Heilige und Tiere, vor allem Vögel).
Zu den runden Emailspangen aus Schweden, die Arne aufzählt (zusammen sechs Ex.), ist wenigstens ein neues und sehr interessantes Exemplar hinzuzufügen, nämlich eine runde Bronzespange aus der Burg Eketorp auf Öland. Die Spange stammt wahrscheinlich aus der Siedlungsphase Eketorp III, die zur späten Wikingerzeit und dem Mittelalter gehört. Sie ist beschädigt und besteht jetzt aus zwei Teilen: einer runden Bodenplatte (mit Nadelhalter und Nadelrast) mit einer erhöhten, profilierten Kante, und einer flachen emailverzierten Platte, die auf der ersteren sass und in ihren Rahmen eingefügt war (Werner, G., 1983, 62, Fig. 2-4). Das Muster der Zellenwände setzt sich aus treppenförmigen Einheiten zusammen. Die ursprüngliche Farbe des Emails lässt sich schwer bestimmen.
Diese Technik mit losen, emailverzierten Platten, die in separat ausgeführte Rahmen eingefügt werden, scheint offenbar häufig vorgekommen zu sein6. Als
sicheres Beispiel einer so hergestellten Plattenfibel ist ein Exemplar aus Rotenburg-Bötersen, Kr. Verden, Niedersachsen, zu nennen (Potratz 1941, 125, Farbbild Taf. 71, und Biere, 1937, 15ff.). Diese Spange besteht ganz aus Silber, sie ist nahezu rechteckig, mit schwach einwärts geschwungenen Seiten. Wie bei dem Exemplar von Eketorp sind die Zellenwände auch hier treppenför-mig. Das Email ist dunkelblau vor einem Hintergrund von grünblauer Farbe. Eine gut erhaltene Scheibenspange stammt aus Holtenbüttel-Niendorf, Kr. Verden, Niedersachsen, die den Birka-Spangen aus Bj 854 sehr nahe entspricht, sie scheint ebenfalls in dieser Technik zusammengesetzt zu sein (Kamolz 1965, 102, Taf. 1 b; s. auch Bild Nr. 366, S. 642 in: Sachsen und Angelsachsen, Ausstellungskatalog 1978). - Eine weitere Spange in dieser Technik stammt aus einem Grabfund von Wolt-wiesche, Kr. Peine, Braunschweig (s. Sachsen und Angelsachsen 1978, 590, Nr. 193).
Zu den von Arne (1914, 212) besprochenen Email-spangen mit bildlichen Darstellungen gibt es vorläufig offenbar keine Entsprechungen im Norden. Dagegen finden wir viele Belege in Westeuropa. Wahrscheinlich sind sie durch die Kirche verbreitet worden. Ein paar typische Exemplare aus Westfalen und Niedersachsen bildet Kamolz 1965 ab: Nr. 453 C, Farbbild, aus Enger, Kr. Herford, und Nr. 493 aus Paderborn, Kr. Paderborn (Abb. s. auch in: Sachsen und Angelsachsen, Ausstellungskatalog 1978, Farbtafeln M-N und Nr. 493 S. 697). Ein besonders schönes Beispiel dieser Bildkunst ist das berühmte „Alfred Jewel," 1693 in Newton Park, Somerset, England, gefunden (s. Bakka 1966, sowie den erwähnten Ausstellungskatalog 1978, 521 f, und Bild 3).
Eine in zwei Teilen hergestellte runde Emailspange aus Silber mit einem Heiligenbild (?) stammt aus Stru-venburg bei Benzingerode, Kr. Wernigerode. Eine ähnliche aus Merseburg, Stadtteil Altenburg, bildet Schultz ab (1960, Abb. 2c und Taf. 65 m). Dinklage (1941, 494) hält die letztere für die am weitesten östlich gefundene Bildspange dieser Gruppe, er datiert sie auf das frühe 10. Jahrhundert.
" Sie veröffentlicht auch die wichtigsten Passagen aus Hj. Stolpes Brief aus dem Juni 1880 (in schwedischer Sprache). In der Untersuchung von 1965 veröffentlicht sie Fibelfunde von Domburg auf Walcheren, Prov. Seeland, Niederlande, unter denen es mehrere viereckige Exemplare zum Vergleich mit den Funden von Dorestad und den Exemplaren aus Birka gibt. 4 Vielleicht hat die Spange eine separate Platte mit Emaileinlagen gehabt, die man in den erhaltenen Rahmen eingefügt hat. Zu dieser Konstruktion vgl. unten.
Gefunden im Brandgrab Bj 154 (Taf. 91:3). Arbman bezeichnet ihn (Birka I, 67) im Anschluss an die Angaben Arnes als orientalisch, aber er hat offenbar grosse Ähnlichkeit mit der Gruppe von Emailspangen, zu der die Spange aus Bj 854 gehört. 6 Die Spangen aus Bj 854, die sehr gut erhalten sind, scheinen nicht aus zwei Teilen bestanden zu haben.
Silberbrakteaten 65
3. Zusammenfassung
Die Emailspangen aus Bj 854 gehören offenbar zu einer gut belegten Gruppe kleiner Emailarbeiten, die im nordwestlichen Europa am weitesten verbreitet waren. Das Emailhandwerk spielte in der römischen Kaiserzeit keine bedeutende Rolle, ausser zur Herstellung kleiner Fibeln (s. Exner 1939 und Brown 1915, 278 und 519), es zog sich erneutes Interesse in der Merowingerzeit zu (s. Arwidsson 1942A, 76-81, Abb. 109-113) und lebte in
neuen Formen in der Karolingerzeit weiter, als Gruben-schmelz an einfacheren Schmuckstücken und als Zellen-email an einigen besonderen Typen von Bronze- und Silberspangen oder an Goldarbeiten von hoher Qualität, z.B. an der Bildspange aus Enger, Kr. Herford, Westfalen, und dem in Email ausgeführten Bild zu „Alfreds Jewel" aus Goldfiligran (s. oben). Die hier besprochene Gruppe von Emailarbeiten dürfte sich mit der exklusiven, meistens als irländisch bezeichneten Emailkunst keineswegs vergleichen lassen (s. Henry 1965 und Bruce-Mitford 1983, 272-295).
11. Zwei gotländische Silberbrakteaten aus
Bj 523 und Bj 1130
Birka I, Taf. 84:7-8 Abb. 11:1. Tab. 9:1
Greta Arwidsson
1.1. Der Brakteat aus Bj 523
Der Brakteat besteht aus vergoldetem Silber. Der Mit-telstempel zeigt drei Tierprotome in triskeleartiger Komposition mit einer stark stilisierten Menschenmaske darüber. Das Bildfeld ist von einem regelmässigen Per-lenkranz zwischen zwei konzentrischen feinen Graten umgeben, und diese wiederum von zwölf kreisförmigen Borten mit unregelmässigen feinen Stempelabdrucken (mit einem Rollstempel ausgeführt?). Um die Kante des Brakteaten verläuft eine Borte aus bogenförmigen Stempelabdrucken und ganz aussen eine Reihe von punktierten Dreiecken. An der einen Kante sind neun Löcher gebohrt, Spuren, die auf einen aufgenieteten, dreieckigen Filigranschmuck unter der ursprünglichen Öse deuten (Vgl. Stenberger 1947, Abb. 58). Ein spiralförmig aufgerollter Filigranfaden ist neben einem Loch erhalten.
Auf der entgegengesetzten Seite ist ein Loch aufgebohrt. Die Rückseite ist nicht vergoldet.
Grösse: Durchmesser 6,3 cm, Dicke weniger als 0,1 cm.
1.2. Der Brakteat aus Bj 1130
Der Silberbrakteat aus Bj 1130 ist nicht vergoldet. Der Mittelstempel tritt nur schwach hervor (abgenutzt?), aber er ist von ähnlichem Typ wie der des Brakteaten in Bj 523. Auch der Perlenkranz um das Bildfeld ist beiden gemeinsam. Dieser ist hier von einem Kreis mit rhombi-schen Stempelabdrücken umgeben, auf den fünf Kreise mit Zickzackbändern aus eingestempelten Dreiecken folgen.
Zwei Löcher verschiedener Grösse sind gleich neben-einander aufgebohrt, zwei Löcher gibt es an anderen Stellen, von denen das eine mit Eisenrost ausgefüllt ist.
Der Brakteat ist an einer Kante beschädigt.
Grösse: Durchmesser 6,5 cm, Dicke an der Kante 0,1 cm.
2. Kommentar
Arbman (Birka I, 157 und 466) meinte bei beiden Brak-teaten feststellen zu können, dass sie zu Spangen umge-
66 Greta Arwidsson
Abb. 11:1. Ein Teil des Silberbrakteaten Bj 1130. Das Bild zeigt deutliche Spuren älterer Verzierung nahe bei der späte-ren Borte aus dreieckigen Stempeln. Mikrophoto von B. A., 70-fache Vergrösserung.
arbeitet waren und mit Nadelhalter, Nadelrast und einer Ose für eine Kette versehen waren. Fragmente dieser Details sind heute schwer zu deuten.
Brakteaten dieses Typs aus Gold gibt es in vielen Exemplaren auf Gotland, sie werden von Nerman auf die Periode VII:5 datiert (VZG, Taf. 274-277). Den Fund von Hulte, Ksp. Hemse, Go, behandeln auch Stenberger (1947, 118, Abb. 58 und 1958, 185ff.) und Arbman (1937, 192 und 196), nach ihrer Meinung muss der Typ auf das Ende des 8. Jahrhunderts oder um 800 datiert werden. Duczko (Birka V, 51) behandelt den Brakteaten aus Bj 523 im Hinblick auf die Reste seines Filigranschmucks und meint, er sei aus technischen Gründen auf die Vendelzeit zu datieren. Auch Arrhenius (1976, 188, Taf. 12) nimmt die beiden Brakteaten unter die vorwikingerzeitlichen Gegenstände der Birkafunde auf. Indessen ist zu beachten, dass Stenberger 1958 (289, Abb. 7) die punktierten Dreiecke, die an der
Kante des Brakteaten aus Bj 523 und mehreren gotlän-dischen Brakteaten vorkommen, als typisch für wikin-gerzeitliche Silberschmiedearbeiten betrachtet, die u.a. Nerman (Taf. 274, Abb. 2209, 2211, 2214, 2220, 2223 u.a.) der Periode VII:5 der Vendelzeit zuordnet.
Bei einer näheren Untersuchung des Brakteaten aus Bj 1130 entdeckte ich ein System von schwach hervortretenden konzentrischen Borten um das hier undeutliche Figurenfeld in der Mitte. Photographien in einem Scanning Electron Microscope in siebzigfacher Vergrösserung, die Birgit Arrhenius freundlicherweise ausgeführt hat, lassen diese ältere Verzierung neben den scharf hervortretenden rhombischen und dreieckigen Stempeln deutlich erkennen {Abb. 11:1). Es erweist sich also, dass es sich hier um einen abgenutzten, oder eher noch um einen misslungenen Brakteaten handelt, der bei einer späteren (?) Gelegenheit durch neue Stempelborten verbessert wurde.
12. Spangen, Fibeln und Beschläge/Anhänger
verschiedener Formen
Birka I, Taf. 84:5-6, 85:3, 5-9, 96:12, 99:23, 101 Abb. 32:6, 50:3, 98, Tab. 9:1
Greta Arwidsson
1. Die runde finnländische Schlangenspange aus Bj 104 Taf. 84:5
Abb. 32:6
1.1. Beschreibung
Eine runde Bronzespange mit Schlangenmotiv, finnlän-discher Typ, gegossen und mit Löchern von verschiedener Grösse. Manche Löcher sind wahrscheinlich sekundär aufgebohrt. Die aus dreifachen Graten bestehenden Schlangenkörper mit dem Kopf an der Kante der Spange sind zu erkennen. Die vier Knäufe um die Mitte und die drei heute erhaltenen an der Aussenkante zeigen geringe Abnutzung. Um die Kante der Spange verlaufen drei Grate nebeneinander, von denen der äussere an einem Viertel des Spangenumkreises durch Abnutzung verschwunden ist. Der Nadelhalter und die wahrscheinlich einfache Nadelrast sind in einem Stück mit der Spange gegossen.
Ein Viertel der Spange ist vom Feuer beschädigt und neben der beschädigten Partie sitzt ein Rostklumpen, in dem man Teile von Kettengliedern aus Bronze und Eisen unterscheiden kann. (Unter den Funden dieses Brandgrabes gibt es eine gut erhaltene Kette mit acht ähnlichen Gliedern, Kettentyp 8. S. Kap. 14, Ketten.)
Grösse: Durchm. 6,8 cm, Höhe ca. 2 cm (Die Spange ist gewölbt).
1.2. Kommentar
Die Spange gehört zu einer in Finnland häufigen Variante der runden Spangen mit Schlangenornament, die Appelgren (1897, Abb. 6) als Typ C bezeichnet. Nach Kivikoski gibt es in Finnland mindestens 28 Exemplare, bei denen die Tierornamentik noch nicht völlig entstellt ist (s. Kivikoski 1973, 90f. und Taf. 73-74; vgl.
Arwidsson 1940). Finnländische Schlangenspangen sind in Schweden, abgesehen von dem Exemplar von Birka, aus mehreren Funden bekannt (s. Floderus 1930).
2. Dosenförmige Spange aus
Bj 1067 Taf. 85:9a-b
2.1. Beschreibung
Dosenförmige Spange gotländischen Typs mit Band-und Tierornamenten (?). Die Bodenplatte fehlt und die Spange ist sekundär mit einer Eisennadel versehen. Die Ornamentik ist sehr entstellt: nur auf einem der Seitenfelder sind Details zu erkennen, die an ein Tier erinnern. Die vier Kantenstäbe sind unverziert. Auf der Oberseite fünf Knöpfe, von denen der in der Mitte der Spange höher als die übrigen war. Jetzt ist er stark abgenutzt und hat im Zentum ein gebohrtes Loch für einen Niet (?), dessen Platte (?) vielleicht auf der Innen-seite der Spange erhalten ist. Die vier Zapfen, mit denen die Bodenplatte gewöhnlich befestigt ist, sind völlig abgenutzt oder abgefeilt. Die Eisennadel ist in einem Loch nahe der Unterkante der Spange eingelassen. Nadelspitze und Nadelrast fehlen.
In einem anderen, an der Kante der Spange aufgebohrten Loch sitzt ein Eisenring und an diesem ein unvollständiges Glied (?) einer Bronzekette.
Grösse: Durchm. 4,9 cm, Höhe 2,2 cm.
2.2. Kommentar
Allgemein zu den dosenförmigen Spangen von Gotland siehe Thunmark-Nylén 1983 A, und einen Aufsatz in Vorbereitung von derselben mit genaueren Ausführungen über die Spange aus Bj 1067.
68 Greta Arwidsson
3. Die kreuzförmigen Spangen aus
Bj 1079 Taf. 85:8
Zwei kreuzförmige Spangen aus Bronzeguss mit Nadel-halter und doppelter Nadelrast, die in einem Stück mit der Spange gegossen sind.
3.1. Beschreibung der grösseren Spange
Die Vorderseite hat ein vierteiliges Mittelstück mit vier Knäufen. Die Kreuzarme sind rhombisch und entlang den Kanten mit scharfen Graten versehen. Die drei freien Enden der Kreuzarme schliessen in dreieckigen Tierköpfen mit Augenhöhlen und gerade abgeschnittenen Schnauzen. Die Rückseite ist glatt. In der Nadelrast ein Eisensprint und Reste einer Eisennadel. Einer der Kreuzarme ist etwas beschädigt.
Grösse: ca 4,5 x 3,5 cm.
3.2. Beschreibung der kleineren Spange
Diese Spange stimmt offenbar in allen Details mit der Spange, 1.1. überein. Ihre Vorderseite ist stark korrodiert und abgenutzt (?). Die Details der Tierköpfe sind nicht zu erkennen. Die Nadel ist ganz erhalten. Sehr feiner und dichter Stoff in Leinwandbindung ist vom Rost der Nadel imprägniert.
Grösse: 4,0x3,2 cm.
3.3. Kommentar
Nahe Entsprechungen zu diesen Spangen habe ich im skandinavischen Fundmaterial der Wikingerzeit nicht finden können. Eine gewisse formale Ähnlichkeit mag mit dem Kreuzanhänger aus Domerarve, Ksp. Öja, Gotland bestehen (Stenberger 1947, 248; Abb. 260), der zu einem Silberschatzfund gehört, der durch Münzen auf die späte JBS zu datieren ist.
4. Die gotländische Bügelschei benfibel aus Bj 1079 Taf. 84:6
Eine Bügelscheibenfibel aus Bronze. Nadelrast und Nadelhalter (wahrscheinlich mit aufgenietetem Blech ausgebessert) sind in einem Stück mit der Fibel gegossen. Der Nadelhalter verläuft als eine schmale, teilweise
offene Rinne bis zum unteren Ende der Fibel. Die Rückseite, mit Weissmetall belegt, zeigt keine Ornamente. Die Vorderseite ist vergoldet und hat Stempelschmuck aus Rhomben, Gittermustern, Dreiecken, halben Punktaugen mit erhöhtem Mittelpunkt. Eine gute Abbildung zeigt Arrhenius 1976. Die Nadel aus Eisen (fehlt zum grösseren Teil) ist mit unterliegender Feder konstruiert.
Von dem Granatschmuck ist nur noch eine Einfassung mit waffeiförmig gemustertem Goldblech am Grunde erhalten. Die Kante der Einfassung ist glatt. Alle verlorenen Einfassungen waren mit Nieten in der Mitte der vertieften Rundel (Tiefe ca 1 mm) befestigt. Es gab drei runde Zellen an der oberen Querplatte, drei aussen an der Fussplatte und je eine an den beiden „Tierköpfen" neben dem Ansatz der Fussplatte am Bügel. Von der Krone, die auch mit einem Niet befestigt war, ist kein Rest vorhanden (drei Niete aus Bronze sind erhalten).
Grösse: 6,2x3,1x1,2 cm.
Über gotländische Bügelscheibenfibeln siehe Nerman 1919 und 1969; vgl. Arrhenius 1976, 186f.
5. Ringschnallen1 aus Bj 418 und
1131 Taf. 85:6a-b,85:7a-b
5.1. Die Ringschnalle aus Bj 418
Runde, durchbrochene Schnalle aus Bronzeguss mit erhöhtem, ringförmigem Mittelteil, der von vier Stützen getragen wird, die jeweils mit einem dreieckigen Tierkopf auf der Oberseite des Ringes abschliessen. Spuren von Augenmarkierungen sind zu erkennen. Dorn aus Bronze ist über den erhöhten Ring hinweggebogen und ruht mit der Spitze auf der gegenüberliegenden Seite des Ringes. Die Unterkante der Schnalle hat zwei Stufen, von denen die obere in der Mitte zwischen den Stützenpaaren durchschnitten ist (s. Taf. 85:6a). Die untere Stufe zeigt deutliche Abnutzungsspuren.
Spuren von Eisenrost auf der Rückseite der Schnalle.
Grösse: Durchm. 3,2 cm, Höhe 1,1 cm.
1 Bo Petré (1984, 50) meint, es fehle an einem angemessenen Namen für diesen Schnallentyp, findet aber, dass die nicht ganz zutreffende Bezeichnung Ringschnalle jetzt allgemein akzeptiert ist (Stenberger 1962, 82, 96). Ein anderer Vorschlag ist die Bezeichnung Gerätespange (Lena Thunmark-Nylén, 1983 B Abb. 5-6 und Carlsson 1983, 160, 162 Nr 46:7-10). Pettersson, 1968, 181, verwendet die Bezeichnung Kettenverteiler.
Eine ältere Bezeichnung dieses Gegenstandstyps aus der Vendelzeit ist „Hohe Schnalle mit Aussprung" (VZG 16, 39, 54, 67, 78).
Spangen, Fibeln und Beschläge 69
5.2. Die Ringschnalle aus Bj 1131
Runde Schnalle aus Bronzeguss mit zipfeliger Kante. Der Mittelteil ist kegelstumpfförmig erhöht und hat einen ringförmigen Oberteil. Die breiten Zipfel der Unterkante scheinen unverziert zu sein. Die Kante des ringförmigen Oberteils ist mit einer Reihe von Grübchen verziert, die auch mindestens an einer der Stützen zu sehen sind, die das kegelförmige Mittelstück bilden. Diese Stützen sind von verschiedener Breite (0,4-1,0 cm) und alle mit groben Perlenreihen verziert. Die breitere hat in der Mitte eine Reihe von Grübchen, die von Perlenreihen flankiert wird. Der Dorn aus Eisen verläuft quer über die obere Öffnung. Auf der Innenseite der Schnalle und am Dorn Spuren von feingefälteltem Stoff (s. Birka III, 38f, 174f, Geijer; Hägg 1974, 26f und Birka II:2, 60ff, Hägg).
Grösse: Durchm. ca. 3,0 cm, Höhe 1,6 cm. Länge des Dorns ca. 1,9 cm.
5.3. Kommentar
Nach der Lage im Grab und den Stoffresten in der Schnalle Bj 1131 dürften beide Schnallen zur Kleidung gehört haben, der fein gefältelte Stoff gehört in der Regel zu den Frauenhemden (Hägg 1974, 26f. und 1986, 60ff.).
5.4. Vergleichsmaterial
Eine nahe Entsprechung zu diesen beiden Schnallen lag in der Schwarzen Erde (SHM o. Nr.; ATA Klichébok: Järnålder 4: söljor, Upl. 19015). Sie hat jedoch keine Verzierungen.
Im übrigen scheint dieser Typ von Ringschnallen in den Gräbern der Wikingerzeit auf Gotland gut vertreten zu sein. In Form und Funktion stehen diese in deutlichem Zusammenhang mit den reichlichen Funden verschiedener Typen aus der Vendelzeit (VZG Fig. 158-190; 952-976; 1436-1450; 1870-1879; 2192. S. 16, 39, 54, 67 und 78). Stenberger betont die Kontinuität zwischen Vendelzeit und Wikingerzeit auch für diese Schnallenform (1962), 82f.). Aus dem Grab 134 vom Gräberfeld Ihre/Hellvi (Stenberger 1962, Abb. 63-65) kommt eine Ringschnalle mit einem breiten, zungenförmigen Aussprung, der mit gebohrten Löchern durchbrochen und reich verziert ist. Ein diesem sehr ähnliches Exemplar stammt von dem Gräberfeld von Barsalders-hed (Pettersson 1968, 181, Abb. 10, 20; wird hier als „Kettenverteiler" bezeichnet). Dieses Grab gehört zur späten Wikingerzeit, woraus hervorgeht, dass Ringschnallen mit Aussprung während der ganzen Wikingerzeit in Gebrauch waren. Gewöhnlich haben die gotlän-
dischen Exemplare der Wikingerzeit keinen Aussprung, sie gleichen den beiden Schnallen aus Bj 418 und 1131. Die meisten sind mit Bronzeketten kombiniert. Vom Ihre-Gräberfeld nennt Stenberger (1962, 56, 71 f. und 127f.) drei, und zwar aus dem Grab 105 (Abb. 54 und 58), Grab 131 (Abb. 69) und Grab 133 (Abb. 75, 77).
Ein gut erhaltenes Exemplar mit vier daran befestigten Ketten aus Bronzegliedern (Typ 6 nach Arwidsson, Kap. 14) kommt aus einem Grab in Barsaldershed, Grötlingbo, Go. (Gustafson 1905, 101 f., Abb. 66). Ein weiteres gutes Beispiel ist die Schnalle aus Grab 70 des Gräberfeldes von Bjärs, Hejnum, mit zwei Kettengliedern aus Bronze vom gleichen Typ wie die vorhergehende (Ekhoff & Arne 1906, 88ff., Abb. 40; dasselbe Exemplar ist auch abgebildet bei Thunmark-Nylén 1983B, Fig. 6).
Auf Gotland wurden diese Ringschnallen mit Ketten zur Befestigung von Schlüsseln verwendet, ev. auch von Schlüssel und Schere, bzw. Messer, und an der Kleidung getragen (Pettersson 1968, Abb. 20, 182; das Messer hing an einem Lederriemen). So kann auch die Ringschnalle aus Bj 1131 verwendet worden sein, doch fehlen hier bestimmbare Fragmente von Ketten oder Bändern zwischen der Schnalle und dem Messer und der Schere, die hier beieinander lagen.
6. Bronzespange aus Bj 418 Taf. 85:5
6.1. Beschreibung
Vierkantige, durchbrochene Spange aus Bronzeguss. Die Kanten sind nach innen geschwungen und die vier Ecken haben die Form von Tierköpfen mit ovalen, vorstehenden Augen und stumpfer Schnauze. Der schwach erhöhten quadratischen Mitte ist ein geriefeltes quadratisches Feld eingeschrieben. Von diesem Mittelstück gehen kreuzförmig vier Arme aus, die mit den Tierköpfen abschliessen. Zwischen den Köpfen und um die Spange herum verläuft ein quergestricheltes Band. Ein Band aus zwei erhöhten Graten überschneidet das erstere bei den vier Köpfen und verläuft hinter den vier Kreuzarmen.
Die Nadelrast ist doppelt und geht wie der Nadelhalter zu einer in einem Stück mit der Spange gegossenen Öse, in der wahrscheinlich Spuren eines Eisenringes (?) wahrnehmbar sind.
Grösse: 3,5 x3,5 cm.
6.2. Vergleichsmaterial
Eine Spange, die in ihrer Form und der Komposition ihrer Verzierungen der Birka-Spange nahe stehen
70 Greta Arwidsson
dürfte, ist ein Einzelfund aus Haväng, Ksp. Ravlunda, Skåne (Strömberg, 1961, 154 Taf. 73:6). Diese ist jedoch nicht durchbrochen, und Strömberg vergleicht sie mit einer Silberspange aus Mörstorp, Östergötland (Montelius 1905, 24, Abb. 20) und einer ähnlichen aus Bj 607 (Taf. 71:7), die beide zur JBS gehören.
Bj 418 lässt sich dagegen mit Sicherheit auf die ÄBS datieren, sie gehört zu demselben Fund wie die oben besprochene Ringschnalle, Abschnitt 12:5. (S. Birka I, 117, Abb. 63).
7. Die zungenförmige Bronze spange aus Bj 1037 Taf. 85:3 a-b
7.1.
Zungenförmige Spange aus Bronzeguss mit gut erhaltener Vergoldung der Oberseite und Weissmetallbelag auf der Unterseite. Dem erhöhten Mittelstück entspricht auf der Unterseite eine tiefe Rinne, in der die Nadel teilweise liegt. Die Nadelrast und der doppelte Nadelhalter sind in einem Stück mit der Spange gegossen. Die eiserne Nadel ist gut erhalten. An der einen Längsseite der Spange ein Loch mit darin festsitzendem Eisenrost, und in der einen Ecke der geraden Schmalseite ein aufgebohrtes Loch. Zu beiden Seiten des mit drei „Perlenreihen" verzierten Mittelteils verläuft ein stark stilisiertes Pflanzenmotiv, das wiederum von einer feineren Perlenreihe umgeben ist, die rund um die bogenförmige Schmalseite geht, an der geraden Schmalseite aber von einer Borte aus geraden Stäbchen und einer Reihe von Knöpfchen unterbrochen wird.
Grösse: 9,4x3,5 cm, Dicke der Platte ca. 0,2 cm.
7.2. Vergleichsmaterial
In Birka gibt es keine anderen Spangen dieses Typs. Ein Einzelfund vom gleichen charakteristischen Typ und mit derselben „Pflanzenornamentik" stammt aus Vestfold in Norwegen (Petersen 1928, 126, Abb. 133, Fundort Gipø, Nøtterø).
Nahe verwandt hiermit ist zweifellos auch eine Spange aus Torshov, Gjerdrum, Akershus, Norwegen (Petersen 1928, 103, Abb. 96), deren Ornamentik weniger stark stilisiert ist als bei den anderen Spangen dieses Typs2.
Aus einem Brandgrab in Stensgården, Ksp. Brunn, Vg., stammt ein vom Feuer beschädigtes Exemplar, das alle für den Typ charakteristischen Details aufweist, nur ist es nicht vergoldet (Warners 1984, 64ff. Abb. 3).
Aus dem Hafen von Haithabu kommt endlich eine gut erhaltene zungenförmige Spange, die weitgehend mit der Spange aus Bj 1037 übereinstimmt (Warners 1984, 64, Abb. 1). Sie hat aber weder Vergoldung noch Weissmetallbelag. E. Wamers weist in seiner Schrift auf die grossen Übereinstimmungen hin und konstatiert, dass die wenigen Spangen dieser Art, die er als Haitha-butyp bezeichnet, bemerkenswert geringe Variationen haben3. Das Hauptcharakteristikum der Verzierung, die stilisierte Pflanzenborte, vergleicht er eingehend mit den zungenförmigen Spangen mit karolingischer Pflan-zenornamentik und mit den aus dieser entwickelten nordischen Varianten.
Da keine der Spangen vom Haithabutyp in datierbaren Fundkombinationen gefunden worden ist, schlägt er eine Datierung auf 850-950 n.Chr. vor, in welche Zeitspanne nach seiner Meinung die meisten der mit karolingischer Pflanzenornamentik verzierten Gegenstände, die in Nordeuropa gefunden wurden, gehören.
7.3. Herstellungsgebiet
Die einheitlichen und speziellen Charakteristika der wenigen Spangen dieses Typs deuten auf ein gemeinsames Herstellungsgebiet. Die Verbreitung der Funde trägt aber kaum zur näheren Bestimmung desselben bei, auch wenn die Produktion wahrscheinlich nordisch sein dürfte.
8. Zwei ungewöhnliche Schmuck-anhänger-Typen
A. Schmuckanhänger aus Bj 165 Taf. 99:23 Durchbrochener Anhänger aus Bronzeguss mit angenie-tetem Bronzeblech als Öse. Keine Spuren einer ursprünglichen Öse oder von Nieten, um den Beschlag (?) zu befestigen. Von ovaler Form mit ganz platter Rückseite. Das „Rahmenwerk" der Vorderseite hat durchgehend reliefartige Struktur als Perlenband mit einigen dickeren, wulstförmigen Partien. An der Unterkante befinden sich zwei tierkopfähnliche Vorsprünge. Der Anhänger ist sehr abgenutzt.
Grösse: 3,0x2,3 cm (mit der Öse: 3 cm).
2 Hjalmar Stolpe (1881, 55f.) sagt von der Spange aus Bj 1037, dass sie aus stark kupferhaltigem Silber besteht und „durch ihre eigentümliche Ornamentik sogleich ihren fremden, wahrscheinlich karolingischen Ursprung verrät". 3 Die Spange aus Torshov, Gjerdrum, Akershus (s. oben) ist ihm nicht bekannt.
Spangen, Fibeln und Beschläge 71
Dieser Anhänger ist zusammen mit u.a. 20 Perlen und einer Bügelfibel (Taf. 57:6) in einem Brandgrab gefunden worden.
B. Zwei Schmuckanhänger aus Silberblech aus Bj 306A Taf. 96:12, Abb. 50:3 Silberblechanhänger mit ungewöhnlichen Ornamenten. Das dreiseitige Zentralmotiv, die Punktaugen und die Doppelwülste sind getrieben. Die Ösen aus gerieffeiten Silberbändern sind angenietet.
Grösse: Durchmesser 1,7 cm.
Diese Anhänger sind zusammen mit u.a. ca. 70 Perlen und einer nordischen Münze (Taf. 142:18) in einem Brandgrab gefunden worden.
Kommentar zu 12:8 A und B Ich kenne zu diesen beiden Typen kein Vergleichsmaterial.
umrahmen die Flächendekoration der übrigen, verzierten Partien des Beschlags.
Die Kreuzarme bestehen jeweils aus zwei viereckigen Feldern, von denen zwei der äusseren blattförmige Ornamente innerhalb des Rahmens tragen, die bei den beiden anderen fehlen. Die vier inneren Felder der Kreuzarme haben in den Ecken blattähnliche Ornamente, einen eingeschriebenen Rhombus mit einem gleicharmigen Kreuz darin. Bei einem der Felder fehlt das Kreuz in dem Rhombus. Der Hintergrund aller Felder mit Flächenornamenten ist ungleichmässig schraffiert. In den Zwickeln zwischen den Kreuzarmen des Mittbuckels gibt es vier Aussprünge, die zum Ring reichen, wo sie sich verbreitern und mit zwei gegenständigen Spirallinien verziert sind, die aus einer radialen Linie hervorwachsen.
Grösse: ca. 14,0 x 14,3 cm.
9. Der ringkreuzförmige Beschlag
aus Bj 511 Taf. 101, Abb 98
9.1. Beschreibung
Kreuzförmiger Beschlag aus Bronze mit Weissmetallbelag in durchbrochener Arbeit mit einem grösseren, getriebenen Buckel in der Mitte und ähnlichen, aber kleineren Buckeln aussen an den vier Kreuzarmen.
Der Beschlag war mit acht Nieten an einer Unterlage befestigt. Die erhaltenen Nietlöcher sind gleich gross, ca 2 mm. Es gab je ein Loch zuäusserst an jedem Kreuzarm - drei davon sind erhalten - und eins in der Mitte jedes Quadranten des Ringes - zwei sind erhalten, und vielleicht Spuren von einem dritten.
Auf einem der kleineren getriebenen Buckel ist ein gleicharmiges Kreuz mit sehr feinen Linien eingeritzt, es ist von einem Ring aus doppelten Linien umgeben. In der Mitte dieses Kreuzes ist ein kleines Loch mit kaum 1 mm Durchmesser aufgebohrt. Der Buckel am gegen-überliegenden Kreuzarm zeigt einen Ring aus ähnlichen feinen Linien, ungleichmässig geritzt und nur teilweise doppelt. Spuren von einem Kreuz sind nicht wahrzunehmen und die beiden übrigen kleinen Buckel tragen keine Spuren von geritzten Linien. Der Buckel in der Mitte dagegen hat einen ungleichmässig geritzten Doppelring und wahrscheinlich ein kleines Loch in der Mitte.
Auch der Flächenschmuck im übrigen besteht aus fein geritzten Linien. Entlang den Kanten der sonst unverzierten Ringquadranten sind Linien eingeritzt und sie
9.2. Verwendung des Beschlags
Nach Birka I, 151, war der Beschlag an grobem Wollstoff befestigt, vielleicht den Resten eines Kleidungsstücks, das neben der hier begrabenen Frau niedergelegt war (s. Birka III, 39 und 160, Geijer). Die Kreuzform des Beschlags und die Kreuzsymbole der Verzierung deuten wohl darauf, dass er ursprünglich für kirchliche Zwecke bestimmt war.
9.3. Vergleichsmaterial
Eine Parallele zu dem Ringkreuz ist mir weder unter nordischen noch unter aussernordischen Funden bekannt. Die Technik der Verzierung deutet wahrscheinlich auf Westeuropa. So gibt es auf der Rückseite mit Weissmetallbelag der grossen angelsächsischen Spange von Faversham, Kent (Kendrick 1934, Taf. 24, Abb. 2 und 28, Abb. 11) in Ritztechnik ausgeführte Tierfiguren auf schraffiertem Hintergrund.
Warners (1985, 34) teilt diesen Beschlag der Gruppe „Hiberno-sächsischer Metallschmuck ohne nähere Pro-venienzbestimmung" zu, von denen die meisten nach seiner Ansicht „aus Irland kommen dürften".
Hinsichtlich der Verzierungstechnik kann der Beschlag aus Bj 511 mit den verzierten Bronzeblechen an den Holzeimern von Hopperstad, Sogn och Fjordarne, und Farmen, Vestfold, und mit einem Fragment aus Torshov, Akershus, alle in Norwegen, verglichen werden (s. Bakka 1963, 28ff. mit Abb. 24-28). Bakka sucht den Ursprung der „norwegischen" Arbeiten, sowie auch der Beschläge an dem nahe verwandten
72 Greta Arwidsson
schönen Eimer aus Bj 507 (Birka I, Taf. 204, vgl. Birka Die Kreuzform des Beschlags und die eingeritzten II:1, 233ff.), in einer Werkstatt in Northumbrien. Viel- Kreuzsymbole besagen, dass seine Herkunft auf christli- leicht stammt auch unser ringkreuzförmiger Beschlag chem Gebiet zu suchen ist, in Birka war er auf jeden aus dieser Kunstprovinz, aus der nur wenige Metallar- Fall importiert. beiten erhalten sind.
13. Das Bronzeglöckchen aus Bj 735
Birka I, Taf. 100:3 Tab. 9:1
Greta Arwidsson
1.1. Der Fund
Aus dem reich ausgestatteten Doppelgrab Bj 735 stammt eine kleine Glocke aus Bronze mit einem Eisenklöppel. Hj. Stolpe hat die Lage im Grabe nicht angegeben, weshalb es unsicher verbleibt, ob sie zur Ausstattung der Frau, des Mannes oder vielleicht des Pferdes gehört hat, das in einem Schacht östlich der Grabkammer beigesetzt war. Die Glocke ist in einem Stück gegossen und hat keine Verzierungen. Der Klöppel, dessen unterer Abschluss sehr verdickt ist, besteht aus Eisen. Die Unterkante der Glocke ist beschädigt und ausserdem hat die Wand ein Loch.
Grösse: Länge inkl. des Klöppels 6,4 cm. Grösster Durchmes-ser heute 3,2 cm.
2. Vergleichsmaterial
Ein Glöckchen aus Eisenblech mit erhaltenem Klöppel kommt aus einem Hausgrund bei Rings, Ksp. Hejnum, Go. Die Fundkombinationen stützen eine Datierung in die spätere Völkerwanderungszeit (Stenberger & Klindt-Jensen 1955, Vgl. Mbl. 1886, 159, Abb. 23).
Auf nordischem Boden ist mir noch ein zweites Exemplar bekannt, nämlich die Glocke von der Unter-
suchung in Trelleborg auf Fünen in Dänemark (Nørlund 1948, 129, Nr. 13)1. Nørlund vergleicht sie fälschlich mit den Schellen, die in den Kinder- und Frauengräbern von Birka vorkommen (Gräslund, 1984C, 119ff.). Im wikin-gerzeitlichen Umkreis gibt es ferner zwei ähnliche, aber kleinere Glocken unter den Funden von Domburg in Holland (Capelle 1975, Taf. 31, 456-457 und S. 36). Capelle hält sie für sehr bemerkenswert und kennt offenbar keine weiteren Exemplare als die eben genannten aus Trelleborg und Birka.
In der Merowingerzeit hat man offenbar ähnliche Bronzeglocken im südlicheren Europa gebraucht, wofür ich einige Beispiele nennen kann. Eine Glocke aus Bronzeguss mit einem Klöppel aus Eisen und Blei hat man in einem reich ausgestatteten Frauengrab des grossen Gräberfeldes Güttingen, Landeskreis Konstanz, gefunden (Fingerling 1964, Taf. 5:3). Gerhard Fingerling datiert das Grab auf „spätestens um 600", er bezeichnet die Glocke aber ohne besonderen Kommentar oder Vergleichsmaterial als römisch. Ungefähr gleichzeitig ist wahrscheinlich ein Frauengrab des Gräberfeldes von Schwarzrheindorf, Rheinprovinz, in dem eine gegossene, vierkantige Bronzeglocke lag, die Beh-
1 Von ganz anderem Typ und Format sind ein paar grosse Glocken aus Eisenblech, die zu einem Werkzeugfund von Mästermyr auf Gotland gehören (Arwidsson & Berg 1983, Pl. 17).
Glöckchen. Ketten 73
rens (1947, 6, Grab 13, Abb. 13) ebenfalls als römisch bezeichnet.
Glocken aus Bronzeguss mit Eisenklöppeln, die in ihrer Grösse und Form den merowingischen sowie dem Exemplar aus Birka entsprechen, hat man u.a. im Gebiet des Sees von Neuchatel in der Schweiz gefunden2.
In den grossen systematischen Untersuchungen über dies Gebiet bildet Schwab (1973) viele Funde aus Schichten ab, die auf die römische Kaiserzeit zu datieren sind, und darunter auch Bronzeglocken (Schwab
1973, Abb. 125, rechts, aus Le Rondet, Gem. Vully-le-Haut, Fr., und Abb. 148, rechts, gefunden am Fluss Aare in Solothurn)3.
Kürzlich habe ich erfahren, dass es Glöckchen dieser Art und von verschiedenen anderen Typen in der kel-tisch/römischen Anlage bei Fishbourne gibt (Cunliff 1971, Fig. 46, No 106-108). „All from first Period level" (= AD 43-75).
Wozu diese Glocken verwendet wurden, ist ungewiss. In den Gräbern der Merowingerzeit haben sie den Frauen gehört.
14. Ketten
Birka I, Taf. 112:14-18, 113:1-19, 167:2-3, Abb. 10:21, 11:2, 32:8, 42:1, 44:1, 53:2, 73:14, 218:39, 321:26 Abb. 14:1-2, Tab. 14:1
Greta Arwidsson
1.1. Einleitung
In 58 Frauengräbern von Birka gibt es Teile von Ketten aus Silber, Bronze oder Eisen. Nur in einem Männer-grab hat man eine Kette aus groben Eisengliedern gefunden (Bj 1125, wahrscheinlich vom Typ 7).
Die Kettenfunde sind interessant und variationsreich, aber wegen ihres fragmentarischen Zustandes hat diese Fundgruppe der Gräber von Birka wenig Beachtung gefunden.
Offenbar hat die Mehrzahl der Ketten von Birka praktischen Zwecken gedient. Kleinere Geräte wie Schlüssel, Messer, Scheren und Nadelbüchsen haben die Frauen an Ketten hängend getragen, die an einer der zur Tracht gehörigen Spangen befestigt waren (s. u.a. Hägg 1974 und 1986). Als Hals- oder Brustschmuck scheinen die Metallketten seltener gedient zu haben. Ein Beispiel dafür gibt es wahrscheinlich in Bj 479, wo die beiden ovalen Spangen laut Angabe durch eine Bronzekette verbunden waren (Typ 1, Taf. 112:15). Schwerer zu deuten ist die Lage der Silberkette in Bj 464 (Typ 6, Taf. 112:18 rechts). Sie scheint nach der
Zeichnung Stolpes (Abb. 75) teils die beiden ovalen Spangen miteinander verbunden zu haben, teils unterhalb der Spange auf der rechten Körperseite weitergegangen und mit einem Silberschmuckstück abgeschlossen zu sein, nämlich mit einer zu einer Spange umgearbeiteten karolingischen Buchschliesse (Taf. 83:4)1.
Inga Hägg (1974, 39ff.) hat Stolpes Grabplan und seinen Versuch zur Deutung der Ketten und Bänder eingehend diskutiert. Häggs Abb. 33 und 27 zeigt ihren Vorschlag zur Rekonstruktion, wobei die Silberkette
Unter den Glocken römischen Ursprungs sei hier auch an die beiden gut erhaltenen Glocken des Schatzfundes in der Fluchtburg von Havor auf Gotland (Ksp. Grötlingbo) erinnert (Nylén 1962, 94, Taf. 3), die in Skandinavien unik sind. 3 In Schwabs Untersuchung von 1973 sind zwei weitere Glockentypen vertreten, vgl. Abb. 85, Abb. 125, links, und 148, links.
1 In diesem Grab gab es ausserdem eine Bronzekette (Typ 4), an der ein Messer hing, und zwei Seidenbänder zum Aufhängen einer Schere, bzw, eine Silberkapsel (s. Birka III, 158 und Arwidsson 1984 A, 125.
74 Greta Arwidsson
Abb. 14:1. Die Ketten-Typen 1-9. Zeichn. C. B.
quer über der Brust liegt und beide Enden am unteren Teil der ovalen Spangen befestigt sind.
Torsten Capelle (1968, 1ff.) sah einen Zusammenhang zwischen Kleeblattfibeln und den Zierketten - wie er sie nennt. Diese Auffassung bestätigen die Funde von Birka wohl kaum. Wenn er behauptet (S. 9): „Die Häufigkeit des Kettenschmuckes ergibt sich besonders aus der Tatsache, dass allein in Birka 51 Gräber Zierketten enthielten", so ist dies irreführend. Birgitta Hårdh (1984 A, 88) hat Capelles Ansichten bereits im Zusammenhang der Bearbeitung der Kleeblattfibeln aus Birka kritisiert. Ein weiterer Einwand gegen Capelles Ausführungen sei im vorliegenden Zusammenhang erhoben, nämlich wenn er meint, eine reicher Kettenschmuck sei eine Innovation in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (1968, S. 8). Die Behauptung lässt sich nicht mit dem zahlreichen Vorkommen von Metallketten in den Schmuckgarnituren der Vendelzeit auf Gotland und in Finnland vereinbaren (S. Abschnitt 2:3 unten).
Da Scheren, Messer, Nadelbüchsen usw. in den Gräbern von Birka häufig in ungestörter Lage vorgefunden wurden, ohne dass Reste von Metallketten wahrzunehmen waren, darf man annehmen, dass Bänder oder Schnüre aus Textilmaterial oder aus Leder in grösserem Umfang verwendet wurden. Spuren von solchem organischen Material gibt es z.B. in Bj 464 (s. oben, Anm. 1) und Bj 824 A (s. Hägg 1974, 78).
2.1. Beschreibung der Typen2
Typ 1: Ketten aus ganz oder fast ganz ge-schlossenen Ringen aus Zainen oder rundem Draht, die ineinander greifen.
Typ 2: Ketten aus kleinen, ringförmigen Gliedern, die jeweils aus zwei oder drei, dicht zusammenliegenden, ge-schlossenen Bronzeringen beste-hen.
Typ 3: Ketten aus ineinander greifenden Spiralringen in 21/2 bis 4 Windungen aus rundem Draht.
Typ 4: Ketten aus gleichmässig und dicht zusammengefügten, S-förmigen Gliedern aus rundem Draht, die in zwei Ebenen gedreht sind.
Typ 5: Ketten aus kringeiförmigen, inein-ander greifenden Gliedern aus run-dem Draht.
Typ 6: Ketten aus --förmigen, ineinander greifenden Gliedern aus rundem Draht, die in der Mitte zusammen-gebogen und zu einer „Flechte" ineinander gesteckt sind.
Typ 7: Ketten aus geraden Eisen-, ev. Taf. 113:11, 17, Bronzegliedern, deren Enden zu 19 Ösen zusammengedreht sind, die Abb. 73:14, ineinander greifen. 218:39
Abb. 14:1
15 Taf. 112:14-Abb. 53:2
Taf. 112:16-17
Taf. 113:2, 4-5, 7, 9 Abb. 42:1, 44:1
Taf. 113:8, 10 Abb. 11:2
Taf. 112:18 (rechts) 113:1, 3-4 Abb. 321:26
Ketten 75
Bemerkungen
Typ 1. Spalte 1: Bj 965. Spalte 3: Bj 479. Spalte 4: Bj 349, 1035. Typ 3. Spalte 2: Bj 867. Spalte 3: Bj 797. Spalte 4: Bj 24B, 419, 456. Typ 4. Spalte 1: Bj 507, 632, 850, 1081. Spalte 2: Bj 464, (483), 552, 837. Spalte 3: Bj 485, 645, 1105. Spalte 4: Bj 9, 47, 117, 127,
134, 151, 153, 158, 212, 391, 419, 997, 1009, 1026. Typ 5. Spalte 4: Bj 29, 649. Typ 6. Spalte 1: Bj 464, 660, 854. Spalte 2: Bj 550, 552. Spalte 3: Bj 485, 1105. Spalte 4: Bj 153, 158, 997, 1026, 1046. Typ 7. Spalte 1: Bj 735, 750, 834, 844, 966, 968, 1011. Spalte 2: Bj 978. Spalte 3: Bj 597, 844, 1130. Spalte 4: Bj 151, 462, 902. Typ 8. Spalte 4: Bj 104, 115. Typ 9. Spalte 1: Bj 968. Spalte 4: Bj 9, 1158.
Typ 8: Ketten aus langen Eisengliedern, Taf. 113:18 die dicht mit rundem Bronzedraht Abb. 32:8 umwunden sind und an den Enden mit je einer zusammengebogenen Ose abschliessen. Die Ösen der Glieder greifen ineinander (Bj 104) oder sie sind paarweise an ringförmige Zwischenglieder angeschlossen, die aus rundem Eisendraht zusammengebogen sind (Bj 115).
Typ 9: Aus runden Bronzedrähten herge- Taf. 113:13-14, stellte steife Glieder. Jedes Glied 16 besteht aus zwei Drähten, von denen der eine in vier bis sieben Windungen eng um den anderen gewik-kelt ist. Anschliessend sind beiden zu einer offener Öse zusammengedreht, um dann wieder in ein gewundenes Stück überzugehen.
die reichhaltigen Kettenfunde der baltischen und slawischen Gebiete in die Diskussion einzubeziehen, verbleibt sie leider unvollständig. Diese Bearbeitung der Funde muss indessen zukünftigen Spezialuntersuchungen überlassen bleiben.
2.3. Kommentar zum Abb. 14:1, Vergleichs-material Typ l Taf. 112:14-15 Ketten aus ineinandergreifenden, geschlossenen Ringen, die aus Bronzedraht oder schmalen Zainen mit gewölbter/gewinkelter Aussenseite und flacher Innenseite bestehen, sind in den Birka-Funden ungewöhnlich. Die Ringe der gleichmässigen Kette aus Bj 349 sind aus gewinkelten Zainen zusammengelötet und entsprechen
2.2. Kommentar
Es ist mir durchaus bewusst, dass der Vergleich mit nur einem Teil der Kettenfunde in Skandinavien und Finnland keinen Überblick über die Gesamtzahl der Typen und ihre Verbreitung bietet. Da es nicht möglich war,
2 Ella Kivikoski (1963 und 1980) verwendet bei ihrer Einteilung der Bronzeketten fünf Gruppen. Ihre Beschreibung der Gruppen dürfte teilweise mit den hier vorgelegten Definitionen der Typen überein-stimmen. Eine Kette, die meinem Typ 7 entspricht, behandelt sie im Zusammenhang mit dem Grabfund 140 (Kvarnbacken, Ksp. Saltvik, Åland, 1963, 91 f. und Taf. 59:6) und meint, dieser Fund sei schwedi-scher Herkunft. Bei der Beschreibung der in den Birka-Funden vorlie-genden neun Typen verweise ich auf die entsprechenden Gruppen Kivikoskis und die zugehörigen Abbildungen.
76 Greta Arwidsson
Kivikoskis (1963) Gruppe 1. Die gröbere Kette aus Bj 479 dagegen weist keine Lötspuren auf. Entsprechende Ketten gab es in zwei weiteren Gräbern (Bj 965 und 1035).
Die Kette aus dem Brandgrab Bj 349 (Taf. 112:14) lag zusammen mit einer kleinen ovalen Spange von deutlich vendelzeitlichem Charakter. Sie lässt also die Verbindung mit den zahlreichen Kettenfunden dieses Typs der Vendelzeit auf Gotland und in Finnland, da vor allem auf Åland, erkennen.
Aus den Vendelperioden VI und VII liegen auf Gotland zahlreiche grosse Kettengarnituren mit Ketten von derselben hohen Qualität wie die aus Bj 349 (Taf. 112:14) vor, und auch auf Aland waren sie gebräuchlich (s. u.a. Beispiele in VZG, Taf. 20:211-212, Taf. 116:1018-1022, 1026, Taf. 233:1927-1928 und Taf. 280:2245; sowie Kivikoski 1963, 90 und Taf. 3:1, 13:17, 20:1-5, 37:1; 1980, 27 und Taf. 8:1-2, 14:5). Diese Ketten scheinen eine bestimmte Standardqualität zu vertreten, die sowohl in der Vendelzeit als auch in der frühen Phase der Wikingerzeit (ÄBS, s. Kivikoski 1973, Nr. 469, 470 und 759 mit zugehörigem Text und Cleve 1943, 82ff. und Taf. 22:132, 24:145, 25:155) gebräuchlich war.
Zu den prachtvollen Kettengarnituren auf Gotland gibt es unter den Funden von Birka keine Entsprechung, dagegen kommt von der nahegelegenen Insel Munsö eine schöne Garnitur dieser Art (Abb. 14:2) (Ginters, 1981, Abb. 32), die besonders interessant ist, weil hier drei verschiedene Kettentypen zur Anwendung gekommen sind.
Die meisten Ketten der Garnitur von Munsö bestehen aus kleinen, sehr gleichmässigen Bronzeringen, die paarweise ineinander greifen (Typ 2). In der Regel fehlen Lötspuren. Ein kammförmiger Anhänger ist an einer Kette aus drei acht-förmigen, doppelten Gliedern aufgehängt, die mit einem ,,Voluten"-schloss an der einen Längsseite geschlossen ist. Zwei ähnliche Glieder sitzen noch an dem einen Kettenhalter. Reste einer weiteren Kette bestehen aus fünf stabförmigen Gliedern und vier Ringen aus Bronze (Kettentyp 8).
Typ 2 Lehtosalo-Hilander (1982, 113f.) hat die Ketten aus doppelten Ringen (Typ 2) kürzlich im Zusammenhang mit der Verlöffentlichung der Funde aus Luistari, Eura, besprochen. Unter Hinweis auf Schauman (1971, 23-25) sagt sie, dass die Ketten schon zu Ende der Merowingerzeit und bis zur Kreuzzugszeit vorkommen, aber dass sie gegen Ende der Wikingerzeit besonders gebräuchlich gewesen zu sein scheinen. Sie bemerkt, dass ähnliche Ketten im Ostbaltikum vorkommen, dass sie aber in Skandinavien selten sind.
Abb. 14:2. Ein Detail der Kettengarnitur aus Munsö, Up. (SHM 479). Photo ATA.
Typ 3 Taf. 112:16-17 Die Ketten dieses Typs bestehen aus ineinander greifenden Spiralringen aus rundem Bronzedraht. Die Zahl der Spiralwindungen kann bei ein und derselben Kette wechseln. Die Ketten sind grob und im Vergleich zu den übrigen Kettentypen aus Birka ziemlich ungleichmässig. Der Durchmesser der Spiralringe bis ca. 1,3 cm.
Ketten von Typ 3 (entsprechend Kivikoskis [1963] Gruppe 4) gab es in fünf Gräbern von Birka, sie sind auch unter den finnischen Funden gut vertreten (s. Lehtosalo-Hilander 1982, 114, Schauman 1971 und Kivikoski 1963, 91). Dort soll der Typ im 10. Jahrhundert und Anfang des 11. Jahrhunderts gewöhnlich gewesen sein.
Typ 4 Taf. 113:2,4-5,7,9 Abb. 42:1
Ketten von Typ 4, bestehend aus S-förmigen Gliedern (Kivikoski 1973, Gruppe 5), gibt es in 24 Exemplaren aus den Gräbern von Birka. Sie sind sehr verschieden dick, weisen aber eine bemerkenswert gleichmässige Qualität - unabhängig von der Dicke der Drähte - auf. Die Herstellung dieser Ketten zeigt grosses technisches Geschick und einen gleichmässigen Standard. Sie
Ketten 77
sind weit verbreitet in Schweden (s. u.a. Stenberger 1962, Abb. 58, 62, 77, 78, 84; Oldeberg 1966, Abb. 609, Othem Go., VZG Abb. 2255 - Vendelzeit VII:5) und in Finnland (vor allem auf Åland, Kivikoski 1963, 90, Taf. 6:9-10, 58:9 u.a.m., 1973, 104, Taf. 760). Ferner gibt es eine schöne Kette aus Rörby, Bälinge, Upl. (SHM 26337:1), die zusammen mit einer gleicharmigen Spange, Typ IV A1, gefunden wurde, sowie fragmentarische Ketten in Brandgräberfunden aus Valsgärde (Grab 85 und 94, die nicht publiziert sind).
Die Funde im übrigen Skandinavien (s. Petersen 1928, 171, Abb. 204) deuten wohl auf eine standardisierte Herstellung. Kivikoski ist der Auffassung (1973, 104, Abb. 760), dass diese Ketten skandinavischer Herkunft sind.
Typ 5 Taf. 113:8,10 Abb. 11:2
Ketten von Typ 5 haben kringeiförmige Drahtglieder und sie können vielleicht nur als eine vereinfachte Variante von Typ 4 mit S-förmigen Gliedern betrachtet werden. Unter den Ketten aus den Birka-Gräbern habe ich nur zwei Beispiele gefunden (Bj 29 und 494), von denen Arbman die letztere (Birka I, 142) als eine grobe Kette von Typ 4 auffasst. Auf dem Gräberfeld von Tuna, Alsike, Upl., gab es ein Fragment dieses Typs (Arne 1934, Taf. l:Abb. 8).
Typ 6 Taf. 112:8 (rechts) Taf. 113:1, 3-4, Abb. 321:26
Ketten von Typ 6 sind aus 8 -förmigen Gliedern hergestellt. Durch eine raffinierte Technik hat man ein Produkt erzielt, das in Aussehen und Qualität den komplizierten gewirkten Ketten nahekommt. Stenberger (1958, 279f.) hat diese Art der Gliederkette im Detail beschrieben (1958, Textabb. 65-68) und zum Vergleich Beispiele der von der Textiltechnik entliehenen Technik zur Herstellung der gewirkten Kette herangezogen (1958, Textabb. 69-70).
Nach ihrem Aussehen hat man die Ketten von Typ 6 zuweilen als geflochtene Ketten bezeichnet (u.a. Sten-berger 1947, 198 und Kivikoski 1973, 141), was jedoch irreführend ist. Stenberger 1958, Abb. 65-68 veranschaulicht die Technik deutlich: indem man die in der Mitte zusammengebogenen Glieder dicht oder weniger dicht ineinander hakte, liess sich das Aussehen der Kette variieren3. Die beste Qualität erhielt man, indem man jedes neue Glied in das vorletzte und nicht in das zunächst vorhergehende Glied einhakte. Aber auch die letztere Methode kommt vor. Sie ergibt eine einfachere Kette mit leicht beweglichen Gliedern (s. u.a. Stenber-ger 1958, Abb. 19:5, Torstuna, Ksp, Hälsingtuna, Hä.; Hårdh 1976 passim und z.B. Taf. 14:4-5, 7-10: Kette zu
einem Thorshammer (?) sowie sieben andere Ketten-fragmente aus Halmstad, Ha.; Taf. 27:6-8, 3 Fragmente einer Kette aus Brunkeflo, Ksp. Brunkeflo, Sk.; Taf. 53:I:7 Teil eines Schmuckstücks mit fünf Ketten an einem Drahtring aus Q. Herrestad, Ksp. Ö. Herrestad, Sk.).
Auch in den Silberschatzfunden auf Gotland kommen gute Beispiele von diesem Typ vor (s. Stenberger 1947, Abb. 129:3, 227:2, 230:10, dazu ein Exemplar in sehr einfacher Ausführung Abb. 54).
Aus dem Grab C von Kaupang, 27997 C, liegt das Fragment einer Bronzekette von Typ 6 vor, neben der Nadel der einen ovalen Spange liegend (Kaupang-Fun-nene I, 1981, Taf. 79).
Einige Prachtschmuckstücke der späten Wikingerzeit zeigen, dass Typ 6 in der damals hochentwickelten Edel-metallschmiedekunst eine geläufige Technik war. So sind einige runde Prachtspangen, in nordischen Funden mit Ketten Typ 6 in Silber oder Gold kombiniert, z.B. die Garnitur aus Jämjö/Gärdslösa, Öl., in der zwei vergoldete Silberspangen durch eine lange Silberkette verbunden sind, welch letztere mit tierkopfförmigen Hülsen abschliesst (Fornvännen 1908, 274, Abb. 150 a-c). Eine ähnliche Kette aus Gold mit Tierkopfhülsen stammt aus Faestad, Ksp. Frøs, Jütland, Dänemark (Brøndsted 1966, 348, Farbentafel und AA V, 181), und die Silberketten, die zu dem Fund von Terslev gehören, (Friis Johansen 1912, Taf. I—II) sind vom gleichen Typ (s. auch weitere Beispiele bei Skovmand, 1942).
In Finnland scheint der Typ 6 während der Kreuzzugs-periode vorzukommen (Kivikoski 1973, Taf. 127-128).
Typ 7 Taf. 113:11,113:17 Abb. 42:11
Typ 7 ist ein gebräuchlicher Kettentyp in Birka4, er ist in der Regel aus runden oder vierkantigen Eisenstäbchen hergestellt. Es gibt nur ein Exemplar aus Bronze (Bj 1011), das aus rundem Draht hergestellt ist. Die Ösen an den Enden der Glieder hat man durch Umbiegen der Stäbchen gebildet und die Enden in einigen oder mehreren Windungen um das Stäbchen gewickelt.
Trotz der oft sehr starken Verrostung sind in einigen Fällen Spuren von Verzierungen der Glieder wahrzu-
3 Zu gröberen Ketten aus Eisen hat man diese kräftige Konstruktion u.a. für das Halfter aus Bj 944 (Taf. 30, Abb. 321:26) verwendet, vgl. auch Birka II:2, 135. Aus der Vendelzeit kennen wir grobe Eisenket ten dieses Typs als Hundehalsband (Valsgärde 6, 68, Taf. 29:666, und Valsgärde 7, 65, Hundehalsband I, Taf. 25:1080; und auf dem Gräber feld von Vendel liegen aus den Bootsgräbern 6-9 dieser Eisenketten auch vor (Stolpe & Arne 1912, Taf. 18, 21-22, 26). 4 In der Vendelzeit verwendete man gröbere Ketten dieser Konstruk tion als Hundehalsband und als Halfter (s. Arwidsson 1942 B, 64 und 68, Taf. 29:715, Hundekoppel, und Taf. 29:509, Halfter; Arwidsson 1954, 74, Taf. 23:568 u.a., Hundekoppel).
78 Greta Arwidsson
nehmen, so sieht man z.B. deutlich an der Kette aus dem Brandgrab Bj 151, dass die Glieder quergeriefelt sind (Spuren von eingehämmerten Metalldrähten?, Taf. 113:17 und Abb. 42:11).
In dem Grab Bj 1030 gab es eine Kette aus wenigstens zwanzig Gliedern in Längen zwischen 6,5 und 7,0 cm.
Eine gut erhaltene Bronzekette von Typ 7 stammt aus dem Grab 140 von Kvarnbacken/Saltvik, Åland (Kivikoski 1963, 91, 62, Taf. 59:6; in demselben Grab lag auch eine Bronzekette von Typ 1). Siehe Anm. 2 oben).
Typ 8 Taf. 113:18 und 113:12 Abb. 32:8
Ketten aus langen Eisengliedern, die dicht mit rundem Bronzedraht umwunden sind und deren beide Enden zu Ösen umgebogen sind. Die Ösen der Glieder greifen entweder einzeln in die Öse des anschliessenden Gliedes (Bj 104), oder sie werden paarweise durch ringförmige Zwischenglieder verbunden, die aus runden Eisendrähten zusammengebogen sind (Bj 115).
In dem Grab Bj 1083 gibt es eine Variante von Typ 8 in fragmentarischem Zustand. Bei den vier Fragmenten ist der Bronzedraht um Lederstreifen statt um Eisenstäbchen gewickelt. Zu der Technik dieser Variante von Typ 8 gibt es in den baltischen Funden viele Entsprechungen. Spiralen aus Bronzedraht können in Gewebe eingefügt sein oder um Fäden oder Streifen aus organischem Material gewunden sein. (Vgl. u.a. Ginters 1981, Abb. 38).) Ledergürtel mit Quasten aus schmalen
Lederstreifen, die mit Bronzespiralen umwickelt waren, sind übrigens ein charakteristisches Zubehör der Männertracht der Wikingerzeit auf Gotland (Stenberger 1962, 49, Abb. 38, 40, 41, 44, von den Gräberfeldern Ihre/Hellvi und Sandegårda/Sanda). Stenberger meint, dass Quasten dieser Art wahrscheinlich ostbaltischen Ursprungs sind (Stenberger 1962, 49, Abb. 38, 44).
Typ 9 Taf. 113:13 und 16 Aus runden Bronzedrähten hergestellte steife Glieder. Jedes Glied besteht aus zwei Drähten, von denen der eine in vier bis sieben Windungen eng um den anderen gewickelt ist. Anschliessend sind beide zu einer offenen Öse zusammengedreht, um dann wieder in ein gewickeltes Stück überzugehen.
Drahtglieder von Typ 9 sind mir nur in zwei Funden aus Birka sowie in zwei Varianten davon bekannt. Sie sind alle vollständig in der Skala 1:1 auf der Tafel 113 abgebildet.
Als Variante fasse ich das Fragment aus Bj 1158, Taf. 113:14, auf. Es besteht aus nur einem Draht, der zusam-mengebogen ist, und der in den geraden Stücken zwischen den Ösen zusammengedreht ist.
Das Fragment aus dem Brandgrab Bj 47, Taf. 113:15, ist wahrscheinlich auch am ehesten als eine Variante von Typ 9 aufzufassen.
Vorläufig kenne ich keine Entsprechungen zu Ket-tengliedern dieses Typs 9.
15. Arbeitsmesser aus den Gräbern von Birka
Mit einem Appendix
Abb. 15:1-13
Birgit Arrhenius
1.1. Einleitung
Die vorliegende Untersuchung geschah in vier Etappen. In der ersten Etappe wurden alle Messerfunde aus den Gräbern und der Schwarzen Erde von Birka durchgesehen. Alle Messer der Gräberfunde, die vorhanden waren, wurden herausgesucht, wobei es sich zeigte, dass zwischen den Messern des Verzeichnisses in Birka I und den heute auffindbaren Messern eine gewisse Diskrepanz bestand. Aber ausserdem war ein grosser Teil der Messer so fragmentarisch, dass sie für die geplante detaillierte Bestimmung der Form nicht brauchbar waren. Während in Birka I insgesamt 455 Messer aufgeführt waren, wurden in der vorliegenden Untersuchung nur 124 Messer verwendet, die sich fast gleichmässig auf Männer- und Frauengräber verteilen (37 Männergräber, 33 Frauengräber, 1 Kindergrab und 50 unbestimmbare). Die starke Verminderung lag nicht nur an dem fragmentarischen Zustand der Messer, sondern auch daran, dass es nicht möglich war, diejenigen Messer, die noch in der Messerscheide sassen, für die Formenanalyse zu verwenden. Vor allem, wenn die Messerscheiden Bronze-beschläge hatten, verursachten diese eine starke Verrostung und Fragmentarisierung der Messer1. Eine Durchsicht der ausgeschiedenen Funde zeigt indessen, dass dadurch das bei den vollständigeren Messern erhaltene Bild nicht wesentlich verändert wird. Zugleich sei betont, dass es die feinsten Messer waren, die eine Scheide mit Bronzebeschlägen oder einen mit Silberdraht umwundenen Griff gehabt haben. Die Messerscheiden bespricht Greta Arwidsson, Kap. 16, während ich die Form und den metallographischen Aufbau dieser Messer im Folgenden diskutiere.
1.2. Die Präparierung der Funde
Die ausgewählten Messer wurden nach bestimmten Kri-terien katalogisiert (Arrhenius 1970, 43ff.), wobei Erik
Wegraeus und Håkan Thorberg mitwirkten. Bei dieser Katalogisierung ergab es sich jedoch, dass die Messer eine dicke Korrosionsschicht hatten, die die Bestimmungen teilweise erschwerte.
Eine Gruppe von Messern aus der Schwarzen Erde wurde daher zur Präparierung herausgesucht. Wir kommen damit zur zweiten Etappe, in der es galt, die ursprüngliche Oberfläche der Messer herauszuholen. Die Präparierung geschah mit Hilfe von EDTA, einem Komplexbilder, der bewirkt, dass man Karbonatfällungen leicht entfernen kann. Hierdurch erhielten wir Flächen, die sich in erstaunlich grossen Partien als intakt erwiesen. Bei vielen Messern mit einer geraden Rük-kenlinie trat eine Schichtung des Rückens hervor, die in der Regel aus drei Schichten bestand, von denen die mittlere dunkler und die beiden äusseren heller erschienen. Die Schichtung war so deutlich, dass es wahrscheinlich ursprünglich beabsichtigt war, dass sie sicht-bar war. Das geht u.a. daraus hervor, dass die Schichten in einigen Fällen durch hochstehende Grate markiert sind Abb. 15:1 (Schwarze Erde, Nr. 326). Beim Präparieren löste sich der Korrosionsbelag in einer solchen Art, dass man den Eindruck hatte, als wäre die Fläche behandelt gewesen, vielleicht geätzt, damit die Schichtung deutlich hervortreten sollte.
In der dritten Etappe wurden daher die Messer aus den Gräbern von Birka erneut durchgesehen, um die Frequenz dieses Typs von geschichteten Messern zu erkennen. Hierbei war es nicht möglich, die umfassende Präparierung der Funde aus der Schwarzen Erde vorzunehmen, sondern es wurde eine Teilpräparierung am Messerrücken ausgeführt.
1 Bronze und Eisen bilden im Erdboden ein galvanisches Element, was bewirkt, dass das Eisen sehr stark korrodiert.
80 Birgit Arrhenius
Abb. 15:1. Das Messer aus der „Schwarze Erde", Nr. 326. a 3:4, b 3:1. Zeichnung B.J.
2.1. Typologie und Chorologie der Messer von Birkas Gräberfeldern
Unter den 124 untersuchten Messern aus den Gräbern Birkas sind Messer mit gerader oder fast gerader Rük-kenlinie und abgesetzter Angel der durchaus überwiegende Typ, hier als Typ A bezeichnet (112 Ex., Abb. 15:2). Beim Typ A sind zwei Varianten zu unterscheiden: Typ AI mit ganz gerader Rückenlinie und einer Schneide, die in weichem Bogen zum Rücken gebogen ist (Birka I, Taf. 181:1 und 3), und Typ A2, bei dem Rücken und Schneide beide zur Spitze hin gebogen sind (Birka I, Taf. 182:5 und 9). Die beiden Varianten haben keine verschiedene Verbreitung unter den Funden und sie kommen fast gleich oft vor: AI in 56 Ex. und A2 in 52 Ex., zwei waren nicht bestimmbar. Die Angel ist bei AI und A2 gegen den Rücken abgesetzt und hat meistens einen spitzovalen Querschnitt. Ebenso ist bei der
Abb. 15:2. Schematische Zeichnung den verschiedenen Tech-niken zur Herstellung den Messerklingen, ca. 5:1.
Mehrzahl sowohl von A1 wie auch von A2 die Angel gegen den Rücken in einem kleineren Winkel als 90° abgesetzt. Die Angel ist in der Regel gleichmässig breit. Beim Typ A2 gab es jedoch eine grössere Anzahl von Messern (10 Ex.) als bei A1 (6 Ex.), bei denen die Angel zum Ende hin schmäler wird. Es scheint also, als sei die Form der Angel beim Typ A eher als ein individuelles Herstellungsdetail zu deuten, das als solches nicht typentscheidend wirkt. Auch an Länge, Breite oder Gewicht lassen sich A1 und A2 nicht unterschei-den. Bei beiden Gruppen liegt die Variation um einen mittleren Wert mit einer Standardabweichung, die man für die gesamte A-Gruppe ausrechnen kann: die Länge beträgt 13,06 cm mit einer St.a. von 3,34 (offenbar fragmentarische Exemplare ausgeschieden), das Gewicht 17,9 g bei einer St.a. von 10,08 g (hier hängt die Variation offenbar mit dem Korrosionsfaktor zusammen), und die Breite der Messerklinge beträgt, 1,39 cm mit einer St.a. von 0,26 cm. Diese Maasse können mit denen der vom Rost befreiten 29 Messer vom Typ A aus der Schwarzen Erde verglichen werden, deren mittlere Länge 12,37 cm mit einer St.a. von 3,54 cm und die mittlere Breite der Klinge 1,18 cm bei einer St.a. von 0,45 cm war. Hier besteht ein kleiner Unterschied in den mittleren Werten zwischen den Gräberfunden und den Siedlungsfunden, vor allem hinsichtlich der Messer-breite. Der Unterschied könnte vielleicht andeuten, dass die in der Schwarzen Erde gefundenen Messer stärker abgenutzt, d.h. abgeschliffen sind, als es bei den Messern aus den Gräbern der Fall war. Im Vergleich zu den etwas späteren Funden von Eketorp III (Arrhenius,
Arbeitsmesser 81
1989) sind jedoch die Messer von Birka durchgehend länger. Der Durchschnittswert der Messer, Typ A1 und A2, von Eketorp liegt bei 10,6 cm mit einer St.a. von 1,5 cm.
Auch wenn man also zwischen den Typen A1 und A2 keinen direkten anderen Unterschied als die Form der Rückenlinie wahrnehmen kann, so gibt es wahrscheinlich bei einem Teil der Messer vom Typ A2 einen Unterschied in der Herstellungstechnik. So war die Frequenz der Messer mit sichtbarer dreifacher Schichtung am Rücken beim Typ A1 grösser als bei den Messern vom Typ A2 (33, bzw. 22 Ex.). Ausserdem war die Schichtung undeutlich bei den letzteren, sodass man sie oft bei der Katalogisierung mit einem Fragezeichen versehen musste.
2.2. Metallographische Analyse
Zur metallographischen Analyse wurden daher teils Messer ausgewählt, bei denen die dreifache Schichtung deutlich sichtbar war, aus den Gräbern Bj 18,145 A und B, 656, 1053 und 1133, teils Messer, bei denen die Schichtung undeutlich oder gar nicht sichtbar war, aus Bj 187, 618 und 1033. Von diesen gehören die Messer aus Bj 18, 145 (2 Ex.), 618, 1033 und 1133 zum Typ A1, während die aus Bj 187 und 656 zum Typ A2 gehören. Es ist zu beachten, dass bei dem Messer Bj 187 nur zwei Schichten ohne farblichen Unterschied wahrnehmbar waren. Wie die unten folgende metallographische Analyse zeigt, sind die Exemplare aus Bj 18, 145 A und B, 618, 656 und 1133 in der Technik 1 hergestellt, Abb. 15:2, bei der das Messer laminiert wird, mit einer Stahlschicht in der Mitte, die auf beiden Seiten von einer Schicht aus weicherem Eisen umgeben ist. Ganz anders war dagegen das Messer aus Bj 187 hergestellt, nämlich in der Technik 2, Abb. 15:2, bei der der Schneidenstahl keilförmig zwischen zwei Schichten aus weicherem Eisen eingefügt war, deren Schweissfuge an der Rük-kenlinie wahrnehmbar war. Das Messer aus dem Brandgrab Bj 618, bei dem man bei der Untersuchung keine Schichtung erkennen konnte, ist insofern unik, als es wohl dreischichtig ist, seine Mittelschicht aber nicht aus Stahl, sondern aus Weicheisen besteht. Das beruht wahrscheinlich auf einem sekundären Kohleentzug bei der Verbrennung des Toten. Die eine äussere Schicht der Messerklinge hatte eine schmale Zone von Perlit an der Oberfläche, die auch bei der Verbrennung entstanden sein kann. Das Messer war auffallend klein mit einer Länge von 8,5 cm. Dasselbe gilt auch für das Messer aus dem Kindergrab, Bj 1033, das 7 cm lang war. Es gehörte wie das Messer aus Bj 618 zur Herstel-lungsgruppe la und war gekennzeichnet durch eine Mit-telschicht aus Martensit, d.h. aus gehärtetem Stahl. Leif
Tappers metallographische Untersuchung zeigte ferner, dass der Stahl aus ursprünglich vier Einheiten hergestellt war, in sog. Quickschweissung. Das Messer ist also, obwohl es so klein ist, von sehr hoher Qualität. Bei meiner Bearbeitung der Messerfunde von Eketorp III konnte ich eine ganze geschlossene Gruppe von kleinen Messern des Typs A (Aa genannt) unterscheiden (22 Ex.), deren Länge zwischen 6,0 und 8,5 cm lag. Metallographische Analysen zeigten, dass sie wie das Messer aus Bj 1033 in der Technik la hergestellt waren und die Mittelschicht aus Martensit bestand. Wie mein Bericht oben zeigt, sind die Messer aus Bj 618 und 1033 kleiner als der Durchschnittswert mit seiner Standardabweichung, und es ist daher zu erwägen, dass auch in diesem Fall die Messer eine eigene Gruppe bilden.
Das Messer aus Bj 656 endlich gehörte zum Typ A2, war aber trotzdem nach dem Herstellungsmodell la laminiert, Abb. 15:2. Es ist sehr gut gearbeitet und scheint ganz ungebraucht zu sein. Die Schneide ist gehärtet und die Stahlschicht lässt sich auch in der Angel verfolgen. Es ist zu beachten, dass das Messer zwar von höchster Qualität war, seine Laminierung aber nicht besonders deutlich sichtbar war. Man möchte daher vermuten, dass das Messer nicht ganz fertig bearbeitet war, und deshalb zum Typ A2 zu rechnen ist. Das heisst, dass man die Abschleifung und Ätzung der Rük-kenpartie am Schluss nicht ausgeführt hat, die die Messer vom Typ A1 kennzeichnet. Diese Hypothese deutet an, dass sich als natürliche Form bei der Herstellung eines Messers eine leicht gebogene Rückenlinie ergibt. Gebraucht man aber die Herstellungstechnik 1 und will dies am Messer markieren, ergibt sich automatisch eine gerade Rückenlinie. Die Messer der Gruppe A2 sind jedoch zum grössten Teil in der Technik 2 hergestellt, d.h. mit eingesetzter Schneide, weshalb man sich die Bearbeitung der Rückenpartie erspart.
3.1. Chronologie der Messer Typ A in Birka
Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist der Typ A am häufigsten unter den Messern von Birka. Bei der Variante A1, d.h. dem Messer mit geradem Rücken und einem metallographischen Aufbau gemäss der Technik 1, zeigt Bj 854, dass diese schon in der ältesten Birkastufe vorkommt. Er lässt sich dann durch die ganze Zeitspanne Birkas verfolgen, wie z.B. das Messer, Typ A1, aus Bj 544 zeigt. Die Variante A2 lässt sich schwerer datieren. Wenn wir zu dieser Variante nur die Messer rechnen, bei denen die Schneide eingesetzt ist - eine Annahme, die sich ja nur durch einen metallographischen Schnitt sicher nachweisen lässt - dann kennzeichnet diese Variante damit eine höhere technische Spezialisierung. Das metallographisch untersuchte Messer aus
82 Birgit Arrhenius
Bj 187 vom Typ A2, lässt sich durch die Abassiden-münze des Grabes eindeutig auf die JBS datieren. Es ist auffallend, dass es kein einziges Messer vom Typ A2 gibt, das mit Sicherheit auf die ÄBS datiert werden kann, während es mehrere aus der JBS gibt. Vorläufig meine ich daher, dass die Variante A2 vor allem auf die JBS zu datieren ist. Es könnte also eine gewisse Berechtigung für die Hypothese geben, dass eine Entwicklung von Messern, Typ A1, die in der Technik 1 hergestellt sind, zu solchen vom Typ A2 mit eingesetzter Schneide stattfindet, bei der man Stahl spart.
Auf slawischem Gebiet scheinen Messer vom Typ A2 mit eingesetzter Schneide schon im 8. Jahrhundert vor-zukommen, u.a. in der slawischen Burg Dessau-Mossi-gau (Pleiner 1967, 175ff.).
Kolcin (1959), der Messer aus Nowgorod untersucht hat, weist in der Technik 1 hergestellte Messer schon für die älteste Phase von Nowgorod nach, während Messer mit eingesetzter Schneide erst im 11. Jahrhundert vorliegen.
3.2. Messer vom Typ A mit Scheiden
Wie schon gesagt, konnten Messer in erhaltenen Mes-serscheiden nicht im Detail untersucht werden. Bei einer eher visuellen Beurteilung scheint aber das Messer Bj 543, Taf. 177:2, zur Gruppe A2 zu gehören. Bei dem Messer aus Bj 501, das zum Typ A1 gehört, war der Holzgriff mit Silberdraht umwunden (Taf. 179:12), und das Messer, Typ A1, aus dem sicher datierten Grab Bj 944 aus der ÄBS hatte eine bronzebeschlagene Scheide mit geriefeltem Dekor (Taf. 6:2 a-b). Daraus lässt sich schliessen, dass Messer vom Typ A1 mit bronzebeschlagenen Scheiden (Typ 1 bei Arwidsson) und mit Silberdraht umwundenen Griff schon in der ÄBS auftreten. Die Messer aus Bj 632 und 968 (Taf. 177:1 und 178:2) gehören auch mit aller Wahrscheinlichkeit zum Typ A1.
4.1. Herstellungsort der Messer Typ A
Wie schon gesagt, sind die Messer vom Typ A im übrigen Europa wohlbekannt, sowohl in den Varianten A1 und A2 als auch in der Herstellungstechnik 1 und 2. Wie Tapper bei der metallographischen Bearbeitung festgestellt und wie die Behandlung im Laboratorium bestätigt hat, sind die Messer vom Typ A1 aus Birka durchweg von ausserordentlich hoher Qualität. Diese kann teilweise auf der guten Erhaltung der Messer beruhen, die ihrerseits wahrscheinlich direkt mit der Wahl des Eisenmaterials zu tun hat. Eine Mikrosondenanalyse des Messers aus Bj 145 A (Abb. 15:13 und Abb. 15:6 in den Beschreibungen unten) zeigte, dass das in der Technik A1 hergestellte Messer Seitenschichten mit einem Phos-
phorgehalt von bis zu 1,2 % hatte, während die Stahllamelle in der Mitte einen Mangangehalt von 0,3 % aufwies, im Vergleich zu den Seitenschichten mit 0,1%. Der Phosphorgehalt der Stahllamelle war geringfügig. Der hohe Phosphorgehalt hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle beim Schutz der Messer vor Korrosion gespielt, abgesehen davon, dass er das Zusammen-schweissen erleichtert hat.
Leif Tapper konnte ausserdem nachweisen, dass die Stahllamellen der Messer von Birka wesentlich besser bearbeitet waren als die entsprechenden Lamellen bei drei Messern von Typ A1 aus Haithabu, die wir untersuchen konnten. Bei den Messern aus Haithabu war die Stahllamelle mit ungleichmässigen Schweissfugen einge-setzt und es kamen auch Sprünge vor (Abb. 15:3). Die von Pleiner bearbeiteten Messer dieses Typs aus Haithabu (Pleiner 1983, Messer 5) bestätigen unsere Beobachtungen. Ferner ist zu bemerken, dass die Seitenschichten der von ihm behandelten Messer keinen erhöhten Phosphorgehalt hatten.
Die gleiche hohe Qualität wie die Messer von Birka liess sich auch an den Funden von Helgö nachweisen (Tomtlund 1973 und 1978B, 28), während die Messer vom Typ A1 aus Eketorp III (Arrhenius, 1989) nicht durchweg von so hoher Qualität sind. Wie schon gesagt,
Abb. 15:3. Ein Messer aus Haithabu, a 1:1, b 10:1, schema-tische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ. c ca. 10:1, Mikrophoto desselben Schnitts. Photo B.A./L.T.
Arbeitsmesser 83
zeichneten sich die Messer aus Birka auch durch ihre Länge aus. Die Annahme ist daher nicht unmöglich, dass die Messer vom Typ A1 am Orte oder im Interessengebiet von Birka hergestellt sind.
5.1. Andere Arbeitsmesser aus Birka
Im Vergleich zu den Messern vom Typ A kommen in Birka nur wenige andere Messertypen vor.
5.2. Typ B: Messer mit stark gebogenem Rücken. Typologie und Chorologie
Kennzeichen der Messer mit stark gebogenem Rücken ist es, dass die ganze Rückenlinie gerundet ist und die Schneide, je nach der Abnutzung, gerade oder konkav ist. Die Angel kann variieren, ist aber in der Regel zugespitzt. Das Messer ist massiv, d.h. die Klinge ist dick und nicht biegsam. Typisch für diese Form, Typ B, sind in Birka I, Taf. 182:12 und 183:6.
In den Gräbern von Birka hat man neun Messer mit stark gebogenem Rücken gefunden. Von diesen lagen sieben in Körpergräbern auf dem Gräberfeld 2A, nördlich der Burg, eins lag auf einem Brandfleck im Anschluss an ein Körpergrab, Bezirk 1C, Hemlanden, und eins in einem Brandgrab, Bezirk 1B oder E, Hemlanden. Die beschränkte Verbreitung dieser Messer in Birka ist auffällig.
Fünf Messer lagen in Frauengräbern, zwei in Männer-gräbern, deren übrige Beigaben hauptsächlich Pfeilspitzen waren (vielleicht also Kindergräber) und zwei lagen in geschlechtlich nicht bestimmbaren Gräbern.
Die Länge der Messer liegt zwischen 10 und 16,5 cm und die Breite der Klinge zwischen 1,3 und 1,5 cm, in einem Fall abgenutzt zu 0,7 cm (Bj 605 A). Das Gewicht liegt zwischen 8,7 und 22,3 g.
Die Messer zeigen oft Spuren von sog. Blutrinnen, d.h. am Rücken entlang gravierte Linien. Sie zeichnen sich allgemein durch sehr gutes Handwerk aus und sind gut erhalten. Daher erschien es nicht ratsam, einen metallographischen Schnitt an diesen Messern vorzu-nehmen. Dagegen wurde ein Messer mit stark gebogenem Rücken, das als Einzelfund in der Schwarzen Erde von Birka lag (Inv. Nr. 13794B) metallographisch untersucht. Es ergab sich, dass dies Messer in einem Stück aus Perlit hergestellt war, d.h. in der Herstellungstechnik 4, ebenso wie die entsprechenden Messer, die wir von Helgö kennen (Tomtlund 1973, und Arrhenius 1974, 107, zur Deutung des Schnitts) und von Eke-torp III (Arrhenius, 1989). An den Messern von Eke-torp war Härtung wahrnehmbar, während an diesem Messer aus Birka die Härtung verschwunden war, -wahrscheinlich durch sekundäre Erhitzung.
5.3. Chronologie der Messer mit gebogenem Rücken
Vier der stark gebogenen Messer lagen in sehr reich ausgestatten Körpergräbern, Bj 551, 557, 605 A und 606 (Bezirk 2 A). Auf Grund der Typen der Schalenspangen datiert Jansson (1985, 46ff.) Bj 551 (P37) und Bj 557 (P15) auf die ÄBS. Es sei bemerkt, dass in diesen beiden Gräbern auch trichterförmige Glasbecher lagen. Ebenso enthielt Bj 24 (Bezirk 1B oder 1E, Hemlanden) mit seinen beiden Brandgräbern Fragmente eines trichterförmigen Glasbechers im Männergrab, während das Messer aus dem Frauengrab stammt. Bj 605 A und 606 datiert Jansson (1985, 67ff.) nach den hier gefundenen Schalenspangen vom Typ P51 und P42 (1985, 57ff.) auf die JBS. Die Messer kommen also während der ganzen Birkaperiode vor.
Ausserhalb von Birka kennen wir den Messertyp schon aus der Vendelzeit (Arrhenius 1970).
5.4. Die Funktion der Messer mit gebogenen Rücken
Bei meiner Bearbeitung der Messer von Eketorp III (Arrhenius, 1989) konnte ich nachweisen, dass die Messer mit gebogenen Rücken zum grössten Teil am südlichen Tor dieser Burg angetroffen wurden. Daraus folgerte ich, dass die Messer bei einem besonderen Handwerk benutzt wurden, wahrscheinlich bei der Bearbeitung von Häuten. Der Grund hierfür war, dass bei der Bereitung von Häuten ein starker Geruch entsteht, weshalb diese Arbeit an einem besonderen Platz ausgeführt wird (Arrhenius, 1989). Auch in Birka ist es auffällig, dass diese Messer auf Frauengräber der Gräberfelder nördlich der Burg (Bezirk 2A) konzentriert sind. Die übrigen Beigaben dieser Gräber deuten eigentlich nicht auf eine besondere Handwerksgruppe, es sei denn z.B. die Pelzbearbeitung. Jedenfalls kann man feststellen, dass diese Messer bei einer Gruppe von Menschen vorkommen, der Handelswaren vor allem aus Westeuropa zugänglich waren.
5.5. Klappmesser (Abb. 15:5)
In Birka I sind vier Klappmesser aus den Brandgräbern Bj 129, 451, 456 und 506 verzeichnet. Ich halte es für möglich, dass ein Fragment eines weiteren Klappmessers aus dem Körpergrab Bj 60A stammt. Das Fragment besteht nur aus der Messerklinge mit einer Achse und gleicht in der Form am ehesten dem Klappmesser aus Bj 129 (Taf. 184:3) d.h. die Schneide hat nur aus einer Schicht bestanden. Das Fragment erinnert auch an die Klappmesser aus Eketorp III (Arrhenius, 1989). Die metallographische Analyse bestätigt auch die Deutung
84 Birgit Arrhenius
des Fragments als Klappmesser, da aus dieser hervorging, dass die Klinge aus mehreren, zusammenge-schweissten Perlitstücken bestand, ähnlich wie bei der Herstellungstechnik 3, bei der in der Schneide angelaufenes Martensit vorlag. Dieselbe Technik ist bei den Klappmessern von Eketorp festzustellen (Arrhenius, 1989).
Pleiner verzeichnet ein Klappmesser aus Dessau-Mossigau vom 8. Jahrhundert (Pleiner 1967, 184), während diese Messer in Nowgorod ins 14. Jahrhundert gehören (Kolcin 1959, 57). Zum Vorkommen der Klappmesser im übrigen in Birka sei auf Greta Arwids-sons Kap. 17 verwiesen
Appendix
von Leif Tapper und Birgit
Arrhenius
1. Metallographische Untersuchung einiger Messer von Birka ausgeführt von Ingenieur Leif Tapper
2. Das Klappmesser (?) aus Bj 60 A
Abb. 15:5
Das Messer besteht aus mehreren verschiedenen Teilen, die nicht parallel wie bei den übrigen Messern liegen, vielmehr gehen die Schweissfugen quer über die Klinge. An der Schneide sieht man eine sehr deutliche Schweissfuge quer über das Messer. Im übrigen Teil gibt es wenigstens noch sieben weitere Schichten.
Die Schlackenpartikel sind im rechten Winkel zu den Schweissfugen ein wenig ausgeschmiedet, was darauf deuten könnte, dass das Messer nach dem Zusam-menschweissen warmgeschmiedet ist. Ganz aussen am Schneidenteil gibt es angelaufenes Martensit, dessen Gehalt zur Schweissfuge hin abnimmt und in Perlit übergeht. Die Schneide ist in der üblichen Weise geschichtet mit einer Schweissfuge in der Mitte. Die Grenze zwischen den übrigen Schichten ist nicht scharf, sondern der Kohlegehalt hat sich ausgeglichen. Die Struktur variiert zwischen Perlit und Ferrit. Ebenso unterscheidet sich die Korngrösse in den verschiedenen Schichten. Die Härte des Schneidenteils beträgt 618 Hv, die der übrigen Teile 100-150 Hv.
Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe 3.
1. Das Messer aus Bj 18 Abb. 15.-4
Das Messer aus Bj 18 besteht aus drei deutlichen Schichten, eine davon bildet die Schneide mit einer Schicht zu beiden Seiten derselben. Die Schneidenschicht enthält in der Mitte eine Schweissfuge. Die Seitenschichten sind sehr stark korrodiert und enthalten eine grosse Anzahl von Schlackenstreifen. In der Mitte der Seitenschichten verläuft ein Schlackenstreifen von abweichendem Aussehen, dieser kann eine Schweissfuge sein. Die Struktur der Schneide besteht aus Perlit und Ferrit. Der Perlitgehalt ist am grössten an der Spitze und nimmt zum Rücken hin ab. Die Seitenteile sind ferritisch, zunächst der Schweissfuge zur Schneide hin sind sie etwas verkohlt, weshalb hier etwas Perlit vorliegt. Die Schweissfuge zwischen der Schneidenschicht und den Seiten ist sehr deutlich, was darauf beruht, dass der Kohlegehalt in der Mitte der Fuge stark zunimmt und ein Streifen Perlit in dieser vorliegt.
Die Härte ist gleichmässig im ganzen Messer 140-150 Hv. Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe 1b.
3. Das Messer A aus Bj 145 Abb. 15.-6
Wie bei dem Messer Bj 187 wurden hier zwei Schnitte ausgeführt, einer an der Klinge und einer an der Angel.
Die Klinge. Das Messer ist mit einer ganz durchgehend eingesetzten Schneide hergestellt, mit umgebenden Schichten zu beiden Seiten. Schräg über den Schneidenteil mitten zwischen Rücken und Schneide verläuft ein breites Band von Schlackeneinschlüssen, die rund und zuweilen ein wenig kantig sind. Der Schneidenteil enthält bedeutend weniger Einschlüsse von Schlacke als die Seitenteile.
Um die Schweissfuge zwischen den Seiten und der Schneide liegt ein dünnes Band mit abweichender Zusammensetzung. Die Seitenschichten bestehen aus je sieben Schichten (verschiedene Ätzung in Stead I). Schweissfugen zwischen diesen sind nicht wahrzunehmen. Die Schneidenschicht enthält hauptsächlich Perlit, zunächst der Schneide gibt es stark angelaufenes Mar-
Erklärungen zu den Zeichnungen der metallografischen Schnitte. Abb. 15:3-15:12.
Abb. 15:4. Das Messer aus Bj 18. a 1:1. b ca. 15:1, schematische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ.
Appendix 85 Abb.
15:4
Abb. 15:5
Abb. 15:5. Das Klappmesser aus Bj 60. a 1:1, b ca. 10:1, schematische Zeichnung nach einem metallogra-phischen Schnitt. Zeichnung BAZ. c ca. 20:1. Mikrophoto eines Teils des-selben Schnitts. Photo B. A./L. T.
86 Birgit Arrhenius & Leif Tapper
tensit in einem sehr kleinen Gebiet. Der Messpunkt für die Härteprobe liegt in der Perlitzone. Zunächst der Schweissfuge zu den Seiten hin enthält die Schneiden-schicht keine Kohle. Mitten in der Schneidenschicht verläuft eine Schweissfuge, die gegen den Rücken in einen Sprung übergeht. Die Schweissfuge zwischen denn Seiten und der Schneide ist sehr gut ausgeführt, nur ein sehr dünner Schlackenstrang ist wahrzunehmen. Die Seitenschichten sind ferrithaltig mit vielen Einschlüssen von Schlacke. Die Seitenschichten sind etwas härter als die Klinge, Hv 204, 216 resp. 153.
Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe 1b.
4. Das Messer B aus Bj 145 Abb. 15:7
Das Messer ist aus drei Hauptschichten hergestellt, einer Schneide und Seitenschichten. In der Schneiden-
Abb. 15:6. Das Messer A aus Bj 145. a 1:1, b ca. 15:1, schematische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ. c ca. 300:1, Mikrophoto einer Teil desselben Schnitts. Photo B.A./L.T.
schicht gibt es eine Schweissfuge, die die Schneide in zwei Schichten unterteilt. Die Seitenteile enthalten viel Schlacke, aber keine Stränge, die Schweissfugen sein könnten. Die Struktur der Schneide ist Perlit mit Stellen von Ferrit. Der Perlitgehalt ist zunächst der Schneide am höchsten. Die Seitenteile sind ferrithaltig mit ein wenig Perlit. Am Rücken überwiegt das Ferrit. Zunächst der Schweissfuge sind die Seitenteile verkohlt, die Schneide weist hier keine Kohle auf.
Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe la.
5. Das Messer B aus Bj 187 Abb. 15:8
Um festzustellen, ob ein Unterschied zwischen der Angel und der Klinge besteht, wurden an diesem Messer zwei Schnitte vorgenommen.
Die Klinge. Das Messer ist gemäss der Methode 2, mit eingesetzter Schneide hergestellt. Die Schneide endet im Abstand von 1/4 der Messerbreite vom Rücken. Vom
Appendix 87
Abb. 15:7. Das Messer B aus Bj 145. a 1:1, b-c ca. 3:1, schematische Zeichnungen nach metallographischen Schnitten. Zeichnung BAZ. d ca. 30:1, Mikrophoto desselben Schnitts. Photo B. A./L. T.
88 Birgit Arrhenius & Leif Tapper
Abb. 15:8. Das Messer aus Bj 187. a 3:4, b ca. 9:1, schematische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ. c ca. 35:1, Mikrophoto eines Teils desselben Schnitts, d Mikrophoto desselben Schnitts, ca 12:1. Photo B. A./L. T.
Appendix 89
Abschluss der Schneide verläuft eine sehr deutliche Schlackenzone zum Rücken hinauf.
In der Schneide gibt es zwei Schweissfugen, die nicht parallel mit den Schweissfugen zu den Seitenteilen, sondern eher diagonal über die Fläcke verlaufen. Das eine der Seitenteile hat eine querverlaufende Schweissfuge ziemlich nahe der Schneide. Das andere Seitenteil hat mehrere diffuse Streifen mit verschiedenem Phosphorgehalt, zwischen denen keine Schlackenzonen wahrnehmbar sind. Rund um die Schneide und um die Schweissfuge zum Rücken hinauf liegt ein Band in abweichender Zusammansetzung. Die Mikrostruktur der Schneidenschicht enthält Perlit und Ferrit in verschiedener Konzentration. Zunächst der Schneide überwiegt das Perlit, während am Rücken umgekehrt der Ferritgehalt grösser ist. Auch bei den Seitenschichten variiert die Zusammensetzung der Strukturen zwischen Perlit und Ferrit, wobei der Ferritgehalt überwiegt. Keine grössere Härteunterscheide zwischen die Seitenschichten und die Schneide, 92 resp. 128 Hv.
Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe 2.
Die Angel. Die in der Klinge sichtbare Schneide ist auch in der Angel zu sehen, hier ist ihr Anteil jedoch kleiner und diffuser. Die Schneide ist nicht von deutlichen Schlackenzonen umgeben, dagegen sind andere, sehr unregelmässig liegende Schlackenzonen wahrzunehmen. Der Schneidenteil erstreckt sich über den ganzen Querschnitt der Angel, aber mitten im Messer liegt eine Ansatzstelle vor. Der Kohlegehalt variiert stark und folgt im grossen Ganzen den erwähnten Schlackenstreifen, d.h. die ferritische Struktur überwiegt bei mehr oder minder hohen Anteilen an Perlit.
Die Seitenschichten sind etwas härter als die Schneide, Hv 153 resp. 196 und 179. Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe la.
7. Das Messer aus Bj 656 Abb. 15:10
Um den Querschnitt der Klinge und der Angel studieren zu können, wurden zwei Schnitte durch das Messer ausgeführt.
Die Klinge. Das Messer hat drei deutliche Schichten, von denen die Hauptschicht quer durch das Messer geht, mit je einer Schicht an den Seiten. Die Schneidenschicht ist gleichmässig dick. Die Schweissfugen liegen jetzt in den Seitenschichten, der Kohlegehalt der Schneidenschicht ist also verschwunden. Direkt an der Schneide ist die Schneidenschicht martensithaltig. Zum Rücken hin nimmt der Martensitgehalt ab, statt dessen tritt Perlit auf. Die Seitenteile sind ferrithaltig mit vielen Schlackeneinschlüssen, die meistens rund und ziemlich klein sind, aber auch grössere kommen vor.
Die Angel besteht ebenfalls aus drei Schichten, einer Schneide und zwei flankierenden Seitenschichten. Zur Mitte hin ist die Schneidenschicht etwas dünner, wo sie aus zwei Stahlsorten zu bestehen scheint. Auf der einen Seite enthält die Schneide Perlit und im übrigen etwas angelaufenes Martensit, die andere enhält nicht so viel Perlit, dagegen stark angelaufenes Martensit. Es gibt keine Schlackenzonen in der Schneide, so wenig wie in den Seitenteilen, die ferrithaltig sind. Die Härte der Schneide beträgt 910 Hv, die der Seiten 200-300 Hv.
Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe la.
6. Das Messer aus Bj 618 Abb. 15:9
Das Messer ist aus einer Schicht in der Mitte und je einer Schicht zu ihren Seiten laminiert, wobei ein grosser Sprung auf der einen Seite durch die Schweissfuge zwischen der Schneide und einer der Seiten entstanden ist. Sie ist also schlecht ausgeführt. Die andere Schweissfuge weist stellenweise sehr viel Schlacke auf, während es dazwischen gar keine gibt. Man erkennt hier eine sehr deutliche Lücke. Mitten in der Schneide gibt es eine deutliche Schweissfuge. Die Struktur ist sowohl in der Schneide als auch in den Seitenteilen so gut wie vollständig ferritisch. An dem einen der Seitenteile gibt es jedoch eine schmale Zone, die überwiegend perlithal-tig ist.
8. Das Messer aus Bj 1033 Abb.15:11
Das Messer besteht aus zwei verschiedenen Stahlqualitäten, einer für die Schneide, und einer für Schichten zu beiden Seiten. Die Schneidenschicht setzt sich wiederum aus drei, vielleicht aus vier Schichten zusammen und wird am Rücken etwas dicker. An den Seitenteilen sind keine Spuren von Schweissfugen wahrzunehmen. Die Schneidenschicht enthält zunächst der Schneide und dem Rücken ca. 50 % Martensit, dazwischen aber nur wenig. Die Seitenteile sind durchgehend ferrithaltig. Die Schneidenschicht ist markant dichter und schlackenärmer als die Seitenteile. Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe la.
90 Birgit Arrhenius & Leif Tapper
Abb. 15:9. Das Messer aus Bj 618. a 1:1, b ca. 10:1, schematische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ.
Abb. 15:10. Das Messer aus Bj 656. a 1:1, b-c ca. 6:1, schema-tische Zeichnungen nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ.
Abb. 15:11. Das Messer aus Bj 1033. a 1:1, b ca. 18:1, schema-tische Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ.
Appendix 91
Abb, 15:12. Das Messer aus Bj 1133. a 1:1, b 12:1, schemati-sche Zeichnung nach einem metallographischen Schnitt. Zeichnung BAZ. c ca. 20:1 Mikrophoto desselben Schnitts. Photo B. A./L. T.
9. Das Messer aus Bj 1133 Abb.15:12Das Messer ist laminiert und besteht aus einer Schneidenschicht und zwei Seitenschichten. Die Schneidenschicht enthält eine Mischung aus Martensit, Perlit und ein wenig Ferrit. Der Martensitgehalt ist an der Schneide und am Rücken am höchsten. Die umgebenden Seitenteile sind ausschliesslich ferrithaltig. In der Schweissfuge
zwischen der Schneidenschicht und den Seitenschichten gibt es einen Schlackenstrang. Die Schlacke liegt innerhalb der Seitenteile, d.h. dass der Schneidenschicht zunächst der Schweissfuge die Kohle entzogen ist. Innerhalb der Schneidenschicht liegen drei sehr dünne Schlackenstränge vor, die auf Schweissfugen deuten könnten, und demnach bestände die Schneide aus fünf Schichten. Die Schneidenschicht enthält ungewöhnlich
92 Birgit Arrhenius & Leif Tapper
viele Schlackeneinschlüsse, aber in den Seitenschichten durch Schlackenstränge getrennt sind, die Schweissfu- sind diese sowohl zahlreicher als auch grösser. In den gen sein können. Die Härte der Schneide beträgt 690 Seitenteilen kommen Zonen mit verschiedenem Phos- Hv, die der Seiten 150, bzw. 166 Hv. phorgehalt vor, die ganz unsymmetrisch verlaufen, aber Das Messer gehört zu der Herstellungsgruppe la.
Abb. 15:13. Mikrosondenanalyse des Messers aus Bj 145A. Die Analyse geht quer über den metallografischen Schnitt, siehe unten und Abb. 15:6.
16. Die Messerscheiden in den Frauengräbern
von Birka
Birka I, Taf. 177-180, Abb. 18:1, 42
Greta Arwidsson
1.1. Einleitung
Ein Messer in einer Lederscheide gehörte häufig zur Ausstattung der Frauen in den Gräbern von Birka. Leider sind diese Messer meistens so fragmentarisch, dass sich nur eine kleinere Zahl von Scheiden rekonstruieren und photographieren liess. Das Messer aus Bj 151 (Taf. 178:1 und Abb. 42), als Zeichnung rekonstruiert, gibt uns eine gute Auffassung des gebräuchlichsten Typs. Die Messer aus Bj 837, 968 und 973 sind nach Photographien abgebildet (Taf. 177:3 und 178:2-3), sie sind mit Scheiden desselben Typs ausgerüstet, den wir hier als Typ 1 bezeichnen.
Von der Holz- oder Hornbekleidung des Messergriffs sind nur in Ausnahmefällen Reste erhalten, gewöhnlich bei der Umwindung mit Silberdraht, die das Heft schmücken (Taf. 179:1, 4, 6-10)1. In einigen Fällen besteht die Umwindung aus geflochtenen Drähten aus Silber und Kupferlegierung (Taf. 177:3 und 179:5, 11-12). Vom Messer aus Bj 950 mit breiter Silberdraht-umwindung sind Reste des mit eingravierten Linien geschmückten Hefts erhalten (Taf. 179:l)2.
1.2. Typen
Messerscheiden von Typ 1 Dieser Typ ist bereits in Birka II:1, Kap. Hiebmesser, beschrieben, mit deren Scheide Typ 1 nahe zusammen-gehört. Messerscheiden mit Beschlägen von Typ 1 gibt es in etwa zwanzig Frauengräbern.
Charakteristisch ist bei diesem Typ die aus Leder gefertigte Scheide, die die ganze Klinge und das Heft umschliesst und auf der einen Seite des Hefts in dessen gesamter Länge eine breite Zunge aus doppeltem Leder bildet. Die Metallbeschläge der Scheide bestehen aus einem rinnenförmigen Ortband aus U-förmig, zusam-mengebogenem Bronzeblech mit langgezogenen Schenkeln, aus quergeriefelten Klemmen in variierender Zahl, die zwischen dem obersten Teil des Ortbandes
und dem verzierten Bronze- oder Silberbeschlag sitzen, der die Lederzunge am Heft bedeckt. Dieser Beschlag ist meistens an der oberen, umgebogenen Kante am breitesten und wird nach unten zu schmäler. Beschläge mit gleichbreiter Form kommen jedoch auch vor (Taf. 180:1 und 6).
Die Verzierung dieser zu Seiten des Hefts zusammen-gebogenen Beschläge entspricht völlig der an den Hieb-messern. Sie besteht aus stufenförmig ausgestanzten Zipfeln an der nach innen gerichteten Längsseite, oft kombiniert mit T-förmig oder stufenförmig ausgestanzten Löchern. Die Verzierung ist meistens auf beiden Seiten des Beschlags gleich, während der Flächenschmuck auf der Rückseite der Beschläge jedoch nur aus geritzten Linien bestehen kann. An den Kanten des Beschlags kommen feine, doppelte Linien vor, wie zuweilen auch zwischen den T-förmigen Löchern (Taf. 178:3), wo sie eine ausgewogenere Verzierung in doppeltem Tremolierstich ersetzen, die in regelmässiger Zickzacklinie zwischen den Befestigungsnieten verläuft (Taf. 180:3 und Abb. 18:1).
Trageringe. Im Gegensatz zu den Hiebmessern mit ihren zwei bis drei Ringen zum Aufhängen gibt es hier in der Regel nur einen Ring, der aus einem zu einem Ring zusammengeknoteten Bronzedraht besteht. Nur in Einzelfällen (Bj 59, Abb. 18:1 und Bj 391, Taf. 180:8) besteht der Ring aus Metallguss und ist an den Enden trompetenförmig verdickt wie bei den Trageringen, die gewöhnlich zu den Hiebmessern gehören.
Grösse: Die Länge der Messerscheiden liegt zwischen 16 und 20 cm.
1 Aus Bj 543 stammt ein Messer, dessen Scheide nicht erhalten ist, mit reich verziertem Heft aus Silberblech in Granulations- und Punztech nik, Taf. 177:2 und Abb. 122. (Siehe hierzu BIRKA V, 101 f., Duczko 1985.) 2 Eine metallographische Analyse der Messerklingen und eine Bespre chung ihrer verschiedenen Formen hat Birgit Arrhenius ausgeführt, die sie im diesem Band in Kap. 15, Messerklingen, vorlegt.
94 Greta Arwidsson
Der Beschlag aus Bj 860B Taf. 180:6 Dieser Beschlag unterscheidet sich nach Form und Qualität von den übrigen Exemplaren des Typs. Er besteht aus Silber, seine beiden Längsseiten sind gerade, und stufenförmig ausgestanzte Löcher gibt es auf der Vorder- und Rückseite. Under dem Beschlag liegt ein glattes, vorgoldetes Silberblech.
Grösse: 9,0 x 1,1 cm.
1.3. Messerscheiden von Typ 2 Taf. 180:5
Messerscheidenbeschlag aus Bronzeguss, gleichmässig breit und mit geraden Längsseiten. Die Verzierung besteht aus einem Kettenringmotiv in durchbrochener Arbeit. Der Beschlag ist doppelt, aber er unterscheidet sich von den Typen 1 und 3 dadurch, dass beide Enden geschlossen sind. In einem durch Abnutzung vergrösser-ten Loch hängt ein Ring aus Bronzedraht. Das Exemplar aus Bj 877 ist gut erhalten. Eine Parallele zu diesem Exemplar ist mir bis jetzt nicht bekannt.
Grösse: 9,5 X 1,4 cm.
1.4. Messerscheiden von Typ 3 Taf. 180:9-10
Einen dritten Typ repräsentieren zwei Scheidenbeschläge aus Bronzeblech ohne die für den Typ 1 charakteristischen ausgestanzten Zipfel und Löcher. Es sind zusammengebogene Bronzeblechbeschläge zum Oberteil der Scheide. Bei dem Beschlag aus Bj 1083 besteht die Verzierung auf der einen Seite aus unregelmässigen Linien in Tremolierstich, auf der anderen aus eingeritzten, feinen, gewinkelten Linien. An dem unvollständigen Beschlag aus Bj 1005 gibt es vierfache Querbänder aus gröberen und feineren Punktreihen. Dieser Beschlag hat an Stelle eines Trageringes aus Bronzedraht eine angenietete, U-förmige Öse aus einem Bron-zezain.
Grösse: ca. 9x1,8-2,3 cm.
2. Das Aufhängen der Messer
An jeder Messerscheide gibt es einen Ring zum Aufhängen oder ein Loch für einen solchen, der verloren gegangen ist. Da der Ring regelmässig weit unterhalb der Oberkante der Scheide angebracht ist, muss das an
einem Band oder einer Kette befestigte Messer schräg gehangen haben. Nach mehreren Grabplänen zu urteilen muss das hängende Messer zusammen mit anderen kleinen Geräten, der Schere und eventuell den Schlüsseln, sich wenig unterhalb der Taille in bequemer Lage für die Hand befunden haben.
3. Vergleichsmaterial
Im Abschnitt 1.1. oben haben wir bereits auf die Ähnlichkeit der Scheiden zu den Frauenmessern mit den Scheiden der Hiebmesser für die Männer hingewiesen. Diese Typen scheinen in Mittelschweden verbreitet gewesen zu sein (s. BIRKA II:2, Arwidsson, Kap. Hiebmesser, 37). Von grossem Interesse ist das Vorkommen ähnlicher Scheidenkonstruktionen auf Gotland. Stenberger verzeichnet 1961 mehrere Messer mit Scheiden aus Frauengräbern auf dem Gräberfeld von Ihre, Ksp. Hellvi, u.a. aus den Gräbern 124, 131 und 135 (Stenberger 1962, 82f., Abb. 86-88). Die Verzierung dieser Scheiden unterscheidet sich jedoch - wie bei den übrigen gotländischen Scheiden - von der der mittelschwedischen. Zwar kommen an der Kante der Scheide aus Grab 131 von Ihre die charakteristischen stufenförmigen Zipfel vor, aber in der Regel gibt es diese nicht, sondern die Verzierung ist mit Stempeln und ziselierten Linien oder aus Pressblechen mit Bandmotiven ausgeführt. Nach Stenberger (1962, s. 83f.) scheint dieser Scheidentyp „erst gegen Mitte der Wikingerzeit aufzutreten" .. . „Wahrscheinlich sind sie eine neue Form dieser Zeit, die unter starkem Einfluss der slawisch-baltischen Kulturkreise entstanden ist".
Stenberger zitiert u.a. Knorr 1938 und Tallgren 1922. Der inzwischen verstorbene Waldemars Ginters, Stockholm, bereitete eine Untersuchung der Messerscheidenfunde im Baltikum vor und hat eine ausserordentlich feine Serie eigener Zeichnungen der baltischen Scheiden hinterlassen3. Typenmässig gehören diese Scheiden nahe mit den gotländischen zusammen, dagegen weicht ihre Verzierung, die reiche Variation aufweist, von der der letzteren ab.
Ganz kürzlich ist mir eine Untersuchung über Messer und Messerscheiden zugekommen (Cogwill, J., de Neergaard, M. & Wilthew, P., 1987). Ausgrabungen der wikingerzeitlichen und jüngeren Fundschichten in London haben reiche Funde von Messerscheiden in der-
3 Vgl. auch die Notiz über eine ausstehende Veröffentlichung über die Hiebmesser der Wikingerzeitlichen Gräber von Valsgärde, Birka II:2, Arwidsson, 1986, 37.
Klappmesser 95
selben Form wie die schwedischen und baltischen zutage gebracht, jedoch ohne die besonderen Metallbeschläge und die Verzierung.
Die Form der Scheide ist also wahrscheinlich wesent-
lich weiter verbreitet gewesen, als man annehmen konnte, da Scheiden ohne grosse Metallbeschläge völlig vermodern, wenn die Voraussetzungen für ihre Erhaltung nicht günstig sind.
17. Klappmesser
Birka I, Taf. 184:1-4
Greta Arwidsson
1.1. Die Funde
Vier oder fünf Klappmesser liegen aus ebenso vielen Gräbern der Gräberfelder von Birka vor. Zwei davon lagen in Brandgräbern (Bj 452 und 456 auf den Gräber-feldabschnitten 2 B und 3), eins oder zwei kommen aus Grabkammern (Bj 708 und vielleicht 735 im Abschnitt 1C) und eins aus einem Schachtgrab (Bj 506 im Abschnitt 2A).
Das Klappmesser, Taf. 184:3, stammt aus der Schüttung des Brandgrabs Bj 129 (Abschnitt 1B oder 1E) und gehört wohl kaum zum Grabgut, da es keine Spuren von Glühpatina trägt.
Als Männergräber gesichert sind das Brandgrab Bj 452 und die Grabkammer Bj 708, die beide Waffen enthalten und wahrscheinlich zur ÄBS gehören. Das Brandgrab Bj 456 mit dem verzierten Messerfutteral dürfte degegen ein während der ÄBS angelegtes Frau-engrab sein. Das heute sehr fragmentarische, unsichere Klappmesser aus der Grabkammer Bj 735 lag in einem Doppelgrab für Mann und Frau. Nach dem Grabplan und den Angaben Hj. Stolpes soll es mit anderen kleinen Geräten der Frau zusammengelegen haben. Dies Grab gehört zur JBS. Das Schachtgrab Bj 506 endlich lässt sich nicht datieren und enthält keine Skelettreste zur Bestimmung des Geschlechts.
Die Gräber von Birka deuten also an, dass auch Frauen diese besondere Messerform gebraucht haben, die im übrigen Skandinavien und in den germanischen Reichen Europas durchwegs zu den Grabbeigaben der Männergräber gehört zu haben scheinen (vgl. im Folgenden).
1.2. Die Typen
Die Klappmesser von Birka, die so gut erhalten sind, dass man ihre Konstruktion näher untersuchen kann, zeigen, dass sie wahrscheinlich zu zwei Typen gehört haben.
Typl hat ein viereckiges Futteral mit schwach nach aussen, gebogenen Längsseiten. Er ist mit zwei Klingen versehen, die beide nach aussen schmäler werden und am Ende zu einem Haken gebogen sind. Vgl. unten Steins Bezeichnung „geschweifte Klingen".
Grösse: ca. 8,9x2,3 cm.
Ein Exemplar aus Bj 456 ist mit Tierfiguren aus Linien in doppeltem Tremolierstich verziert.
Typ 2 hat ein viereckiges Futteral in weniger regelmässiger Form und nur eine Klinge in derselben Form wie Typ 1 (Bj 452)1 oder ohne den Haken an der Spitze (Bj 129).
Grösse: L. zwischen 8,7 und 14,5 cm.
Drei Exemplare: Bj 452 und 708, dazu Bj 129 aus der Schüttung des Grabs.
1 Auf dem Röntgenbild dieses Messers, Arwidsson 1942B, Abb. 62 links, ist der Haken deutlich sichtbar.
96 Greta Arwidsson
2.1. Vergleichsmaterial
Aus dem Bootsgrab IV von Tuna in Alsike, Upl., liegt ein Klappmesser vor, das vielleicht zwei Klingen gehabt hat und daher zum Typ 1 gehören kann (Arne 1934, Taf. VIII:7). Arne datiert das Grab, ein Männergrab, auf 850-900 nach Chr.
Wesentlich älter ist ein Exemplar, das aus dem Bootsgrab Valsgärde 6 stammt und auf etwa 750 nach Chr. zu datieren ist (Arwidsson 1942B, Abb. 62 rechts, Taf. 35:275 und die Seiten 80 und 132 mit Vergleichsmaterial). Auf dem Röntgenbild erkennt man deutlich den Niet zum Zusammenhalten und, dass die Spitze der Klinge vielleicht abgebrochen war. Es gehört zum Typ 2. Arbman publizierte 1937, 236ff., ein Verzeichnis der Klappmesser von Birka, sowie der entsprechenden Funde im übrigen Skandinavien und im südlicheren Europa. Er meinte, man könne die Verbreitung von den südgermanischen Gebieten über den Mittelrhein und Westfalen nach Schleswig-Holstein verfolgen, von wo die schwedischen Exemplare „am ehesten als ... eingeführt zu betrachten sind". (Vgl. Wegewitz 1968, Taf. 12, 13 und 40.) Arbman hielt also die Klappmesser für eine Importware von Westeuropa.
Später haben Stein (1967) und Fingerling (1971) Klappmesser aus einer Anzahl von Waffengräbern der Gräberfelder Güttingen und Merdingen in Südbaden veröffentlicht, sowie aus mehreren Gräberfeldern in
Bayern und Niedersachsen und Holland (vgl. die Ver-breitungskarte, Taf. 118, bei Stein). Stein (1971, 130f.) stellt fest, dass die Klappmesser durchgehend zu Gräbern gehören, die sich ,,der letzten Belegungsphase zuweisen" lassen und datiert diese Periode „auf das ausgehende siebte und beginnende achte Jahrhundert". Die von ihr als „Messer mit geschweifter Spitze" bezeichneten Formen (u.a. ihre Taf. 1:14, 14:10, 24:17 und 96:1) entsprechen genau den Klingen der Exemplare von Birka (Taf. 184:2 und 4; vgl. Abschnitt 1.2. oben). Die Futterale sind häufig rechteckig. Nach Stein gehören die Klappmesser in der Regel nur zu Männergräbern. Sie kommen in vielen Funden in Kombination mit einschneidigen oder zweischneidigen Schwertern und hohen Schildbuckeln vor (u.a. vom Typ „Galgenberg", vgl. Steins Karte, Taf. 100), mit Sporen und häufig auch mit einem oder zwei Messern mit Angel.
2.2. Die Verwendung der Klappmesser
Wozu die Klappmesser speziell dienten, ist immer noch ungewiss. Da sie sowohl im Norden als auch im übrigen Europa sehr oft zusammen mit angelversehenen Messern in den Kombinationen der Gräber vorkommen (die den heutigen Schnitzmessern entsprechen), müsste das Klappmesser ein Spezialwerkzeug gewesen sein.
18. Spinnwirtel
Taf. 115:27-28, 156:14-15 Abb. 63:8 (?)
Greta Arwidsson
1. Die Funde
1.1. Spinnwirtel in der Form eines Kegelstumpfs aus dem Brandgrab Bj 1158, hergestellt aus gebranntem Ton.
Grösse: Durchmesser 3,7 cm, Höhe 2,2 cm.
1.2. Spinnwirtel aus verziertem Bernstein aus dem Sarggrab Bj 642. Scheibenförmig und auf beiden Seiten mit konzentrischen Rillen verziert. Lag abseits von anderen Gegenständen in der Südostecke des Sargs.
1.4. Unsichere Funde von Spinnwirteln
In Bj 824 ist ein Spinnwirtel registriert (Taf. 156:14), der aus einem Oberschenkelkopf hergestellt ist. Wahrscheinlich stammt dieser jedoch aus dem Kulturlager der Schwarzen Erde.
Grösse: Durchmesser 4,1 cm, Höhe 2,4 cm.
Ein fragmentarischer Ring aus Kalkstein (?) (Kreide?) ist auf Abb. 63:8 abgebildet. Seine Bestimmung als Spinnwirtel (?) ist sehr unsicher.
Grösse: Durchmesser ca. 2,3 cm.
Grösse: Durchmesser 3,3 cm, Höhe 0,9 cm.
2. Kommentar
1.3. Spinnwirtel aus Bernstein, ringförmig. Bei der Birka-Ausgrabung von 1934 in Grab 1 gefunden. Der Wirtel lag in einem reich mit Schmuck ausgestatteten Sarggrab, lag aber nicht in der Nähe der Spangen und Perlen, sondern isoliert an der Nordwestwand des Sargs.
Grösse: Durchmesser 3,5 cm, Dicke 1,4 cm.
Die wenigen Funde von Spinnwirteln in den Gräbern von Birka stehen im Gegensatz zu den sehr reichen Funden Stolpes bei Grabungen in der Schwarzen Erde. Die Grabungen von 1872 (Stolpe 1873, 54) erbrachten 38 Exemplare, hergestellt aus Ton, Tonschiefer, Sandstein, Speckstein, Bernstein, Koralle, Blei und Elchgeweih, also hauptsächlich aus Material mit guten Voraussetzungen, auch in Skelettgräbern erhalten zu bleiben.
19. Geräte und Werkzeug1
Taf. 144, 155, 183, 185, 187
Greta Arwidsson
Vorbemerkung Arbeitsgeräte kommen in den Gräbern von Birka nur sparsam vor, abgesehen von Äxten, Nadeln/Pfriemen, Scheren, Feuerstahl, Messern und Schleifsteinen, die in eigenen Abschnitten behandelt werden (s. BIRKA II:2, Kap. 7, BIRKA II:1, Kap. 20, 22 und 17, BIRKA II:3, Kap. 15 und 21). Werkzeugkästen mit mehreren kleinen Werkzeugen gab es nur in zwei Gräbern, Bj 644 und 750, vielleicht auch in Bj 872.
1.1. Die Werkzeuge im Kasten Bj 644 Abb. 183
Im Kasten von Bj 644, einem Kammergrab mit zwei Begräbnissen, Mann und Frau, lagen eine Schere, ein Wetzstein, einer der Feuerstähle, Feuersteinstücke, ein Hammerkopf und ein Webekamm.
Der Hammerkopf besteht aus Eisen Taf. 185:3
Grösse: 4,7 x 1,3x1,6 cm.
Taf. 155:1, Abb. 183:37 Der Webekamm aus Horn ist mit vier ringsum gehenden Liniengruppen und ,,Punktkreis"-Dekor verziert. An dem einen Ende ein plastischer, stilisierter Tierkopf mit Punktkreis-Augen. Im Maul ist die Platte mit den Zähnen festgenietet, von der nur Fragmente erhalten sind, am anderen Ende des Stiels Spuren einer Ose (?) aus Eisen. Vgl. BIRKA III, Taf. 39, oben links.
Grösse: 11,5x1,8 cm.
2.1. Die Werkzeuge im Kasten Bj 750 Taf. 185:1,4-7, 9 und 13 Abb.
218:6-11, 18
In diesem Kasten lagen neben einer Axt mit breitem Blatt, einer Scharnierschere, einem Schlüssel, einem
Messer und einem Feuerstahl mit Feuersteinstücken (s. Vorbemerkung oben) folgende Werkzeuge aus Eisen:
Eisenhammer mit Holzresten des Stiels Abb. 218:6
Grösse: 10,8 X 2,1 X ca. 2,0 cm.
Eisenbohrer, stark beschädigt Taf. 185:5
L. 14,1 cm.
Spatelähnlicher Eisengegenstand Taf. 185:6 Kleine Reste von einer Tülle sind erhalten.
Grösse: 12,3x5,2 cm.
Eisenraspel und Fragmente einer zweiten Raspel. Stark beschädigt. Taf. 185:4 u. 9
Grösse: 17,2 X 1,6-2,2 cm.
Eisenpfriemen Taf. 185:7 von viereckigem Querschnitt, Reste des Holzstiels erhalten.
L. 6,9 cm.
Eisenkeil Taf. 185:13 Stark beschädigt.
L. 8,9 cm.
Vier Eisenfragmente, die nicht bestimmbar sind.
3.1. Die Werkzeuge in einem Kasten (?), Bj 872 Abb. 286
Im Kammergrab Bj 872 lagen folgende Geräte zusammen mit einem Thorshammerring und Waffen:
Eiserner Hammerkopf Taf. 185:2
1 Dies kurze Verzeichnis gründet sich hauptsächlich auf die Beschrei-bungen im Katalogteil von BIRKA I. Grösse: 13,4 X 1,8 x 1,6 cm.
Feuerstahl mit Feuersteinstücken Taf. 144:7
L. 7 cm.
Wetzstein aus grauem Schiefer Taf. 187:9
Grösse: 24,0 x 2,8 X 1,5 cm.
Wetzstein aus Bandschiefer Taf. 187:10
Grösse: 6,5 x 1,5 x 1,6 cm.
4. Tüllenaxtähnliches Gerät aus Eisen Taf. 185:11
aus dem Brandgrab Bj 111 B. Gerät mit Tülle und Schneidepartie, aber ohne Schneide.
Vielleicht eine umgearbeitete Tüllenaxt, wahrscheinlich als Hammerkopf benutzt.
Grösse: 15,0 x 4,7 x 4,2 cm.
5. Gabelförmiges Eisengerät Taf. 185:10
aus dem Frauengrab Bj 739 (Kammergrab mit mehreren Gefässen, einem Kästchen und reichem Schmuck).
Gerät mit Tülle und zwei Zinken von rechteckigem Querschnitt. Spuren eines Holzstiels.
Geräte und Werkzeug 99
6. Pflugschar (?) Taf. 185:12
Aus dem Kammergrab Bj 562. Beschädigt.
Grösse: 13,7 x 9,7 cm.
7. Eisengerät mit zwei Zinken Taf. 185:16
Aus dem Kammergrab Bj 736 stammt ein im Winkel gebogenes Eisengerät mit Resten des Holzstiels, dessen Zweck unbekannt ist.
Grösse: L. 7,7 cm.
8. Punzen aus Eisen Taf. 185:17
Punzen mit viereckigem Querschnitt aus dem Brandgrab Bj 64.
Grösse: 7,1 x0,7 cm.
9. Sichel aus Eisen Taf. 185:18
Sichel aus dem Schachtgrab Bj 728. Beschädigt, die Art der Schaftung nicht bestimmbar.
Grösse: 29 x 6,6 x 3,6 cm. Grösse: L. 12,6 cm.
20. Specksteinkessel
Taf. 218:1-2
Greta Arwidsson
1. Kommentar
Arbman bildet in BIRKA I, Taf. 218, zwei Gefässe aus Speckstein ab und verbindet sie mit den Gräbern Bj 543 und 879. Es ist indessen fraglich ob diese Gefässe überhaupt Gräberfunde sind. Bei Bj 879 sagt Arbman selbst (Birka I, 342), dass das Gefäss nicht zu einem Grab gehört. Der Fundplatz, den Stolpe als Grab 879 bezeichnete, befand sich neben einem Boot, das vom Stadtwall überdeckt worden war. Das sehr unvollständige Gefäss, Taf. 218:2, hatte im nördlichen Teil der Grabkammer, Bj 543, nahe an der einen Längsseite des Grabschachts gelegen. Es war schon bei der Niederlegung unvollständig und auch schon in alter Zeit repariert. Seine Lage im Grab im Verhältnis zu der hier begrabenen Frau erscheint ungewöhnlich. In der Regel gibt es in der entsprechenden Lage in den Skelettgräbern von Birka keinerlei Gebrauchsgefässe. Stolpes Angaben über die Höhenlage und das Vorliegen einer eisernen Pfeilspitze zusammen mit den Specksteinfragmenten bestärken die Vermutung, dass diese Gegenstände sekundär in die Kammer geraten sind.
2. Die Funde
2.1. Der Kessel vom Stadtwall neben den Bootresten (Bj 879)
Ein nahezu halbkugelförmiger Kessel mit Henkel und Haltern aus Eisen. Die Form ähnlich wie Resi 1979, Abb. 5:6-7, vgl. ihre Abb. 126 und S. 156. Die U-förmigen Henkelhalter sind mit je zwei Nieten befestigt. Der Henkel besteht aus einem gedrehten Eisenzain.
Grösse: Durchmesser 23,0 cm, Höhe 12,5 cm, Wanddicke bis zu 1,3 cm.
2.2. Die Fragmente des Specksteinkessels aus Bj 543
Dieser Kessel scheint denselben gerundeten Boden zu haben wie der vorige, aber er war wahrscheinlich niedriger, nach der Anbringung der Henkelhalter zu urteilen. Zwei Löcher, die nahe an den Kanten zwei zusammengehöriger Fragmente aufgebohrt sind, deuten auf eine Reparatur in alter Zeit. Der eine erhaltene Henkelhalter, der mit drei Nieten befestigt ist, lässt sich mit Skjølsvold 1961, 23, Typ E, vergleichen.
Grösse: Durchmesser mindestens etwa 35 cm.
2.3. Fragment aus dem Brandgrab Bj 64
Im Brandgrab Bj 64 lagen in einer Tiefe von 0,3 m ohne direkten Kontakt mit der Fundschicht Stücke eines Specksteingefässes (Vielleicht vom Abfall in der Schwarzen Erde?).
2.4. Scherben und kleinere Geräte aus Speckstein in Birka
Dass Speckstein allgemeiner in Birka gebraucht wurde, als die beiden Kessel vermuten lassen, zeigen die Funde von Scherben aus der Schwarzen Erde und von Spinnwirteln u.a. (s. Stolpe 1873, 54, 56 und Riksantikvarieämbetets rapport C 1, 1973, 234).
3.1. Vergleichsmaterial
Im Gegensatz zu Norwegen (Petersen 1951, 363), wo nicht weniger als 316 Kessel aus norwegischen Grabfunden registriert sind (s. Verzeichnisse bei Resi 1979), gehörten auf den Gräberfeldern von Birka Kochtöpfe aus Speckstein so wenig wie solche aus Metall zur Grabausstattung.
Speckstein 101
Heid Gjöstein Resi (1979) hat eine grosse, systematische Untersuchung der reichen Specksteinfunde von Haithabu ausgeführt und eine grosse Anzahl von Typen klassifiziert. Das Bild der Verbreitung und der chronologischen Verteilung auf Norwegen und Südwestschweden stellt sie auf den Karten, Abb. 122-128, dar, und die Verbreitung in Dänemark, West- und Ostdeutschland sowie Polen zeigt Abb. 132. Auf dieser Grundlage diskutiert sie die Herkunft des Specksteins von Haithabu. Nach ihrer Meinung (s. 131) „weisen archäologische Kriterien innerhalb der drei Regionen Westskandinaviens auf Ostnorwegen/Südwestschweden als das Herkunftsgebiet der Specksteinfunde aus Haithabu hin". Die massenspektrometrischen Untersuchungen, die man an 40 Proben ausgeführt hat (von den ca. 3.400 Fundstücken in Haithabu), sowie an 53 Proben aus sieben Specksteinbrüchen in Norwegen, zwei aus Halland und einem aus Bohuslän (s. Karte bei Alfsen & Christie 1979, Abb. 1), deuten darauf, dass die Haithabu -
Funde aus verschiedenen Steinbrüchen kommen. Aber man darf annehmen, dass die Steinbrüche von Kalsa, Bröndome, Ksp. Vallda in Halland, von Sparrås, Ksp. Ytterby, Bohuslän in Schweden und die von Skakkel-stad, Halden, Östfold, Norwegen, für einen Teil des Specksteins in Haithabu als Lieferanten in Frage kommen.
Eine entsprechende Untersuchung des Specksteins aus Birka wäre natürlich erwünscht, muss aber vorläufig aufgeschoben werden. Eine Specksteinfundstelle in Norduppland, bei Väsby und Löddby, Ksp. Alunda, hat man bisher noch nicht als möglichen Steinbruch für wikingerzeitliche Specksteingegenstände in Betracht gezogen (s. UFT VII, HO und Det medeltida Sverige I, Uppland 4, 1974, 189f.). Ein Versuch, von mir angeschaffte Stücke aus dem Steinbruch von Alunda mit Funden aus dem Hafengebiet der Schwarzen Erde von Birka durch spektrometrische Analysen zu vergleichen, hat vorläufig zu keinem Ergebnis geführt.
21. Schleif- und Wetzsteine
Birka I, Taf. 186-188, Abb. 88, 110, 123, 153, 182, 193, 218:16, 37, 262, 275, 282 Abb. 21:1-6, Diagramm 21:1-3
Karin Sundbergh und Greta Arwidsson
Vorbemerkungen Die Beschreibung der Schleif- und Wetzsteinfunde von Birka ist eine etwas verkürzte Version von Karin Sund-berghs Examensarbeit von 1976 (Ms. im Archäologischen Institut der Universität Stockholm). Inzwischen hat Heid Gjöstein Resi 1979 ihre grosse Untersuchung „Die Wetz- und Schleifsteine aus Haithabu" herausgegeben. Die eindrucksvollen Resultate Resis und ihrer Mitarbeiter lassen erkennen, dass auch eine entsprechende Bearbeitung der Birkafunde gute Voraussetzungen hätte, der Forschung neue Tatsachen zuzuführen. Bisher hat das Birka-Kommittee keine Möglichkeit gehabt, vollständige petrographische Untersuchungen mit Hilfe eines Elektronmikroskops und eines Microcomputers auszuführen. Dennoch erschien uns ein kurzer Bericht über die Funde und ein Vergleich der Funde von Wetz- und Schleifsteinen aus den Gräbern von Birka mit den wesentlich umfassenderen Funden aus der Schwarzen Erde als wertvoll, nicht zuletzt im Hinblick auf den Umfang der handwerklichen Tätigkeit im Birka der Wikingerzeit.
Greta Arwidsson
1.1. Einleitung
In archäologischen Schriften werden die Bezeichnungen Schleifstein und Wetzstein oft ohne genauere Definition gebraucht, und dabei handelt es sich oft um Steine von gleichem Aussehen und gleicher Qualität.
Schleif- und Wetzsteine sind Steingeräte, um die Schneide von Waffen, Messern, Sicheln und anderen Schnittwerkzeugen zu schärfen. Das Schärfen der Schneide geschieht im allgemeinen in zwei Etappen. Zuerst schleift man sie mit einem Schleifstein, um eventuelle Scharten und Unebenheiten auszugleichen. Darauf beginnt die Arbeit, mit Hilfe des Wetzsteins die Schneide zu tadelloser Schärfe zu bearbeiten (Svenska akademiens ordbok 1925, s. 4386).
1.2. Definitionen
Schleifstein: Schleifgerät mit grobkörniger Struktur, häuftig aus Sandstein oder Quarzit. Wird zum Grobschleifen und Richten der
Schneide verwendet. Schleifgerät mit feinkörniger Struktur, häufig aus Tonschiefer.
Wird gebraucht, um die Schärfe der Schneide durch Wetzen zu verbessern.
Die ursprüngliche Form, in die man den Schleif- oder Wetzstein bei der Herstellung
gebracht hat. Die Form, die der Schleif- oder Wetzstein durch Abnutzung beim Schleifen oder Wetzen erhalten hat. Unbearbeitete Gesteinsbrocken, die sich zur Herstellung von Schleif- oder Wetzsteinen eignen (sowie Halbfabrikate).
2.1. Auswahl des Materials. Steinimport
Man hat verschiedene Gesteinsarten zu verschiedenen Zwecken beim Schleifen und Wetzen gebraucht. Man hat sie zurechtgehauen und poliert, um ihnen eine passende Form zu geben, was aber nicht unbedingt notwendig ist, damit ihre schärfenden und schleifenden Eigenschaften zu ihrem Recht kommen.
Die zum Schleifen und Wetzen besonders geeigneten Gesteinsarten waren eine Handelsware. In der Wikingerzeit gab es offenbar einen umfassenden Handel mit Schleif- und Wetzsteinen (Falck-Muus 1956, 285). Dass diese nach Birka importiert wurden, ist offenkundig (Vgl. Resi 1979 und Siri Myhrvoll).
Wetzstein:
Primärform:
Sekundärform:
Rohmaterial d. Schleif-u. Wetzsteine:
Schleif- und Wetzsteine 103
2.2. Ursprung des Rohmaterials
Die häuftigste Gesteinsart unter den Schleif- und Wetz-steinfunden von Birka ist ein grauer bis graubrauner Tonschiefer, der 85 % der Funde umfasst. Weitere Gesteinsarten sind Sandstein, ca. 8 %, Bandschiefer, ca. 5 %, und in einigen Fällen Glimmerschiefer und Quarzit (s. Diagramm 21:1). Diese Gesteinsarten kommen im Felsengrund von Björkö oder dessen Umgebung nicht vor, weshalb die Schleifsteine bzw. das Rohmaterial auf der Insel eingeführt worden sein muss.
Auf den Inseln Ekerö, Pingst und Midsommar im Mälarsee steht ein grobkörniger, rötlicher Sandstein an (Magnusson-Lundqvist-Regnell 1963, 175, 177). Proben dieses Sandsteins habe ich auf den Mälarinseln gesammelt und beim Vergleich mit den Birkafunden festgestellt, dass man in einigen Fällen den Mälarsand-stein zu Schleifsteinen und Gussformen in Birka benutzt hat. Mehrere grosse, unbearbeitete Stücke dieses Sandsteins gibt es auch unter den Funden aus der Schwarzen Erde. Es ist jedoch klar, dass dieser verhältnismässig grobe Sandstein den Anforderungen, die man an einen guten Schleifstein stellte, nicht völlig entsprach. Der überwiegende Teil des Sandsteins unter den Birkafunden ist von einer feinkörnigen, weichen Sorte, die aus anderen Gebieten importiert worden sein muss1.
2.3. Schwedische Sandsteinvorkommen
Um in grossen Zügen mögliche Ursprungsorte der Schleif- und Wetzsteine von Birka angeben zu können, lege ich im Folgenden eine Übersicht über das Ergebnis eines visuellen Vergleichs zwischen Steinen, deren geographischer Ursprung bekannt ist (s. Lundegårdh 1971, 152), und den Funden von Birka vor. Dieser Vergleich geschah mit der sachkundigen Hilfe von Dr. Åman, Sveriges Geologiska Undersökning, und mit der Referenzsammlung von Statens naturhistoriska museum, geologiska avdelningen, Stockholm, als Ausgangspunkt.
Unter den Birkafunden gibt es Schleifsteine aus einem Sandstein, der in der Qualität einem Sandsteintyp aus der Gegend von Hälsingborg entspricht, aber auch in Västergötland bei Lidköping kommt ein Typ vor, dem vielleicht einige Birka-Steine entsprechen (Lundegårdh 1971, 155).
2.4. Schwedische Tonschiefervorkommen
Der für die Wetzsteine von Birka verwendete Tonschiefer ist in der Hauptsache von einem lockeren, grauen bis graubraunen Typ. Diese Art Tonschiefer gibt es auf
dem „Grythyttefält" in Västmanland, wo auch ein dunklerer Tonschiefer vorkommt, der dem schwarzen Schiefer entsprechen kann, der in ein paar Fällen unter den Birka-Funden vorkommt. Simrishamn, Bez. Kristianstad, ist ein weiteres Gebiet, in dem Tonschiefer vom gleichen Aussehen wie die in Birka gefundenen Steintypen vorkommt. In Skållerud, Dalsland, gibt es sowohl Tonschiefer als auch Sandstein, deren Qualität mit den Schleif- und Wetzsteinen in Birka übereinstimmt. Im gleichen Gebiet gibt es auch einen grünlichen Schiefer, zu dem es ein paar Entsprechungen unter den Wetzsteinen von Birka gibt.
Der Bandschiefer ist oft beim Kontakt zwischen Ton-schiefer und Sandstein entstanden und kommt in Schweden in denselben Gegenden vor wie Tonschiefer und Sandstein.
Es ist schwer, die Herkunft der Schleif- und Wetzsteine in Birka nur auf Grund der Vergleiche, von denen ich hier in Kürze berichtet habe, festzustellen. Vielleicht darf man vermuten, dass sie hauptsächlich aus Süd- und Mittelschweden importiert wurden.
3.1. Die Funde aus den Gräbern, Anzahl, Grössenordnung und Gesteinsarten
Diagramm 1
Zahl der Schleif- und Wetzsteine und die Verteilung auf die Gesteinsarten.
Tonschiefer 141 Ex. Sandstein 4 Ex. Bandschiefer 42 Ex.
Summe 187 Ex.
Diagramm 2
Grössenordnung der Schleif- und Wetzsteine.
< 5 cm 27,3 % (= 60 Ex.)
5-10 cm 48,6 % (= 91 Ex.) 10-20 cm 16,7 % (= 31 Ex.)
> 20 cm 5,4 % (= 10 Ex.)
1 Um das Ursprungsgebiet/den Steinbruch bestimmen zu können, müsste man zunächst eine genaue mineralogische Untersuchung ausführen, was bisher nicht möglich war. Dagegen hat man in England eine solche Untersuchung an ca. 200 Schleif- und Wetzsteinen der Völkerwanderungs- und Wikingerzeit mit vielversprechendem Resultat durchgeführt: bis zu einem gewissen Grade brach man die Steine am Ort, aber auch der Handel war offenbar ausgedehnt. So gab es viele Steine aus Norwegen, während andere zur Handelsware innerhalb der britischen Inseln gehörten, wo sie auch oft über weite Strek-ken transportiert wurden (Ellis 1969, 9; s. auch Resi 1979).
Schleif- und Wetzsteine 107
Zahl der unbeschädigten Schleif- und Wetzsteine: 73 Ex. = 39%.
Über die Verteilung der Wetzsteine auf Männer- bzw. Frauengräber können keine zuverlässigen Angaben gemacht werden, solange keine vollständige Analyse der Knochenfunde aus den Brandgräbern vorliegt. Bei den Körpergräbern ist die Verteilung bei allen Gräbern gesichert, deren Skelettfunde osteologisch bestimmbar sind.
Die Grabpläne zeigen, dass die Wetzsteine in den Körpergräbern oft neben einem Eisenmesser lagen (z.B. Bj 660, 750, 752B) und dass sie in elf Fällen (u.a. Bj 544, 561, 605, 746, 831, 985, 949) quer auf einem Messer lagen. Sieben davon waren aus Bandschiefer hergestellt, die übrigen sind gewöhnliche Tonschieferwetzsteine mit deutlichen Abnutzungsspuren.
3.2. Die Funde aus der Schwarzen Erde
Anzahl, Grössenordnung und Gesteinsarten.
Zahl der Schleif- und Wetzsteine nach Gesteinsarten.
Tonschiefer 586 Ex. Sandstein 68 Ex. Glimmerschiefer 9 Ex. Quarzit 5 Ex. Bandschiefer 1 Ex.
Summe 669 Ex.
Grössenordnung der Schleif- und Wetzsteine.
< 5 cm 26,9 % 5-10 cm 44,4 % 10-20 cm 27,2 % der Gesamtzahl von 669 Ex. > 20 cm 1,6 %
Zahl der unbeschädigten Schleif- und Wetzsteine: 21 Ex. = 3%.
Die Schleif- und Wetzsteine der Schwarzen Erde sind vielfach stark abgenutzt und/oder beschädigt. In vielen Fällen sind nur Fragmente des ursprünglichen Steins erhalten. Nur 3 % der Steine können als vollständig betrachtet werden, während die entsprechende Zahl der Steine aus den Gräbern 39 % ist.
Under den Steinen, die bei Ausgrabungen in der Schwarzen Erde zu Tage kamen, gab es auch 15 Sand-steinstücke und 88 Tonschieferbrocken, die keine Spur von Bearbeitung zeigten. Vermutlich sind diese Steine Rohmaterial, das noch nicht in Gebrauch genommen worden war. Solche Rohsteine gibt es in den Gräbern überhaupt nicht.
3.3. Verteilung auf die Gesteinsarten (Vgl. Diagramm 1)
Es ist offenbar, dass im Birka der Wikingerzeit die bevorzugte Gesteinsart für Wetzsteine der Tonschiefer war. Nur in einzelnen Fällen wurden sie aus Mälarsand-stein hergestellt.
Schleifsteine aus Sandstein sind häufiger in der Schwarzen Erde, während Wetzsteine aus Bandschiefer fast ausschliesslich in den Gräbern vorkommen, in der Schwarzen Erde hat man nur ein Fragment eines solchen Wetzsteins gefunden.
3.4. Wetzsteine aus Bandschiefer
Die aus Bandschiefer hergestellten Wetzsteine sehen sehr einheitlich aus. Sie sind gut poliert, vier- oder sechskantig mit aufgebohrtem Loch am schmaleren Ende (Taf. 188:1-18). In dem Loch gibt es in mehreren Fällen Ringe aus Eisen, Bronze oder Silber, oder Reste davon.
Grösse: Die Steine sind 2-9 cm lang, nur zwei sind länger als 10 cm.
An diesen Wetzsteinen sieht man keine oder sehr geringfügige Abnutzung, was darauf deutet, dass sie kaum zum Wetzen gebraucht worden sind. Die Gesteinsart an sich eignet sich auch nicht zum Wetzen, gerade wegen der verschiedenen Qualität und Grösse der Körner in den Schichten, derzufolge ein solcher Stein ungleichmässig geschliffen und abgenutzt würde. Dass man die Bandschiefersteine trotzdem in die Gruppe der Wetzsteine einordnet, liegt an ihrer Lage in den Gräbern (s. oben Abschnitt 3.1.).
Die wirkliche Bedeutung der Wetzsteine aus Band-schiefer ist jedoch ungeklärt. Es ist möglich, dass sie nur eine symbolische Bedeutung hatten (Arrhenius 1973 B, 59 und 1961, 139) und in erster Linie nur als Schmuck dienten. Möglich ist es auch, dass die Wetzsteine rituelle Bedeutung hatten2, und deshalb auch in Form von Miniaturen als Amulett getragen wurden. Darauf deuten die in den Gräbern von Birka gefundenen Bernsteinanhänger, die Miniaturen von Bandschieferwetzsteinen sind: sie sind ca. 2 cm lang und haben ein Loch am schmaleren Ende. Sieben solche Anhänger lagen in folgenden Gräbern: Bj 86, 776, 835 (2 Ex.), 943, 946, 954 (s. Kap. 8, Bernstein, Arwidsson).
2S. Bruce-Mitford 1978, 345ff. und besonders 360ff. mit Abbildungen.
108 Karin Sundbergh & Greta Arwidsson
Die Form sowohl der Bernsteinanhänger als auch der Wetzsteine aus Bandschiefer verbindet sie mit den Ton-schieferwetzsteinen, von denen wir elf Ex. mit deutlicher Abnutzung durch das Schärfen von Metallgegenständen kennen. Sie wurden folglich als richtige Wetzsteine angewendet.
Eine Annahme, dass es unter den Wetzsteinen sog. Probiersteine geben könne (s. Svensk uppslagsbok, Artikel probersten), fand bei der Bearbeitung der Funde keine Bestätigung. Die in Birka gefundenen Steine dürften sich auch nicht zur Metallprüfung eignen.
4.1. Form und Abnutzung
Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den ziemlich gleichförmigen Gräberfunden und den sehr verschiedenartigen Formen der Steine aus der Schwarzen Erde (Diagramm 2 und 3). Zur ersteren Gruppe gehören hauptsächlich kleine Wetzsteine mit quadratischem oder rundem/ovalem Querschnitt und sehr oft mit einem aufgebohrten Loch an einem Ende (s. Taf. 188). An den gleichmässig geschliffenen und zuweilen sogar polierten Flächen sieht man bei 95 % der Steine kaum eine Spur, dass sie zum Schärfen von Metallgegenständen gebraucht worden sind. Die Steine aus der Schwarzen Erde dagegen zeigen starke Variationen hinsichtlich der primären Formen und Grösse, sie haben viele verschiedene Abnutzungsspuren, die dadurch entstanden sind, dass die Steine zu verschiedenen Schleifund Schärfungsarbeiten benutzt worden sind, z.B. um eine gerade Schneide, eine gebogene Schneide oder eine Nadelspitze herzustellen (s. Abb. 21:1-6). Die Schleif- und Wetzsteine aus Birka haben verschiedenartige primäre Formen gehabt. Im allgemeinen sind sie länglich, mit einem Querschnitt von verschiedenen geometrischen Formen, nämlich:
Quadratisch, Rechteckig, Oval, Dreieckig, Unregelmässig kreisförmig/oval.
Ich habe so weit wie möglich versucht, die primäre Form festzustellen, auch bei beschädigten Wetz- und Schleifsteinen. Falls der Stein so fragmentarisch war, dass die Form sich nicht bestimmen liess, oder der Stein ohne vorherige Bearbeitung zum Wetzen verwendet wurde und folglich eine natürlich unregelmässige Form hatte, habe ich sie der Gruppe der unregelmässigen Steine zugeordnet. Manche Schleif- und Wetzsteine haben unregelmässige Abnutzungsflächen. Auf Grund von Gesprächen mit Handwerkern, Untersuchungen wikingerzeitlicher und moderner Werkzeuge und bis zu einem gewissen Grade praktischen Versuchen kann ich
folgende Hypothesen über die Entstehung der Abnutzung an Schleif- und Wetzsteinen vorlegen. Es ergeben sich folgende Abnutzungsgruppen (Diagramm 3):
1. Geschliffener, polierter Stein ohne Wetzspuren. 2. Flache Abnutzungsspuren. Dies ist die häufigste Form
der Abnutzung an den Steinen von Birka. Sie entsteht beim Wetzen von Messern, Scheren, Speerspitzen oder anderen Geräten mit flacher Schneide. Man wetzt die Schneide mit Bewegungen des Wetzsteines parallel zum Arbeitsgerät (Messer, Schere oder dgl.) oder des Geräts zum Wetzstein.
3. Weich abgerundete Aushöhlung, 3 mm tief. Die Abnutzung entsteht beim Schärfen von Werkzeug mit gebogener Schneide, z.B. Hohlmeissel oder Locheisen. {Abb. 21:4). Diese Aushöhlung kann auch beim Abschleifen von Unebenheiten an Metallgeräten nach der Herstellung entstehen.
4. Flache Kerben (Einschnitt), 1 mm tief. Diese können unabsichtlich oder auch beim Wetzen dünner Nadeln entstehen.
5-6. Tiefe Kerben, < 1 mm tief und parallele Kerben. Diese Kerben sind entweder deutlich V-förmig oder unregelmässig. Die V-förmigen Kerben können beim Wetzen von dreieckigen Pfriemen oder Pfeilspitzen entstanden sein {Abb. 21:5). Meistens sind die Kerben aber unregelmässig. Sie sind beim Abschleifen einer Schneide mit Einschnitten entstanden. Das Messer wird dabei mit der Schneide gegen den Schleifstein gehalten und hin und her gezogen, bis die Schneide wieder gerade ist, wonach sie gewetzt werden kann {Abb. 21:6).
7. Aushöhlungen mit Vertiefungen beiderseits einer Erhöhung. Diese Abnutzung kann beim Wetzen einer kurzen, doppelt geschliffenen Schneide entstehen {Abb. 21:1). Werkzeuge mit gerader Querschneide, z.B. Meissel oder Stemmeisen, die beim Wetzen quer zur Längsrichtung geführt und hin und her gezogen werden, ergeben diese Art der Abnutzung.
8. Aushöhlung mit Vertiefungen, die gegen eine gerade oder ein wenig überhängende Kante geneigt sind.
9. Kräftige schalenförmige Vertiefung, 3 mm tief. Hier handelt es sich wohl kaum um Wetz- und Schleifsteine, sondern um Gegenstände, die als Gussformen oder zum Mahlen von Salz/Gewürzen dienten (?).
10. Halbfabrikate (?) und nicht definierbare, unregel-mässige Abnutzung.
Der Gruppe 10 sind die Steine zugeordnet, die so frag-mentarisch sind, dass die Schleiffläche entweder zu
Schleif- und Wetzsteine 109
Abb. 21:1-6 nach Zeichnungen von der Verf.
Abb. 21:1 Pfeilspitze mit doppelt geschliffener Schneide, am Wetzstein geschliffen. 21:2 Messer mit einseitig geschliffener Schneide, am Wetzstein geschliffen. 21:3 Meissel am Wetzstein geschliffen. 21:4 Löffeiförmiger Bohren am Wetzstein geschliffen. 21:5 Pfeilspitze (links) und dreikantige Nadel (rechts) auf dem Wetzstein geschliffen. 21:6 Scharte an der Messerschneide wird ausgewetzt.
klein oder zu sehr beschädigt ist, um sie zu beurteilen. Auch stark verwitterte Steine gehören hierher, wie auch solche, deren natürliche Struktur nicht erkennen lässt, ob ihre Oberfläche Spuren von Schleifen oder Wetzen trägt.
4.2. Verwendungsweise
Wie hat man also die Schleif- und Wetzsteine gebraucht? Steine von verschiedener Qualität dürften verschiedenen Zwecken gedient haben. Der gröbere Sandstein war dabei zum Grobschleifen beschädigter Schneiden u. dgl. geeignet, während die feineren Tonschieferwetzsteine zum Schärfen der Schneide gedient haben. Die Abnutzung ist jedoch bei Steinen verschiedener
Qualität von derselben Art. Bei den Handwerkern, die Schleif- und Wetzsteine
brauchten, darf man sicher voraussetzen, dass jeder Handwerker über mehrere Steine zugleich verfügte. Folglich hat man verschiedene Steine für verschiedene Geräte verwenden können. Die Schärfung eines Hohl-meissels wird z.B. erleichtert, wenn man eine schon vorliegende Vertiefung am Schleif- oder Wetzstein ausnutzen kann. Nur 5 % der Steine aus den Gräbern von Birka zeigen Abnutzung in Form von Aushöhlungen (Typ 3, 7, 8), während ganze 17% der Steine aus der Schwarzen Erde diese Art der Abnutzung aufweisen. In mehreren Fällen hat man ausserdem durch das Schärfen anderer Werkzeuge oder Geräte solche Vertiefungen an den Schleif- oder Wetzsteinen aus den Gräbern fast ganz zum Verschwinden gebracht, was bei den Steinen
110 Karin Sundbergh & Greta Arwidsson
aus der Schwarzen Erde nicht der Fall ist. Das deutet darauf, dass die letzteren spezialisierten
Handwerkern gehört haben, während die Schleif- und Wetzsteine der Gräber persönliches Eigentum waren. Diese wurden von Männern und Frauen bei der tägli-
chen Arbeit benutzt, wenn man die Schneide verschiedener, im Haushalt vorkommender Geräte, Werkzeuge oder Waffen schärfen wollte, wodurch der Stein eine gleichmässige und unbedeutende Abnutzung erhalten hat.
22. Die Eisenbüchse aus dem Grab Bj 542
Taf. 213 a-e
Greta Arwidsson
1.1. Beschreibung
Zylinderförmige Büchse mit Deckel aus Eisenblech, mit drei Füssen aus Bronzestäben und einem Bronzering als Griff auf dem Deckel. Der Ring ist mit einer breiten Bronzekrampe befestigt, deren schmale Schenkel auf der Innenseite des Deckels umgebogen sind. Auf der Oberseite sind sie durch eine vierblättrige Rosette aus graviertem Bronzeblech geschlagen.
Die Büchse ist aus vier Eisenplatten zusammengesetzt, von denen zwei rechteckig, zwei rund sind. Die rechteckigen Platten sind zylinderförmig zusammenge-bogen, die entgegengesetzten Kanten ein wenig über-einandergeschoben und in der senkrechten Fuge zusam-mengehämmert. Die Fuge ist auf dem Röntgenbild schwach wahrnehmbar, sie ist 1,5 cm breit und sitzt genau zwischen den beiden Scharnierbeschlägen. Eine entsprechende Fuge muss es an der Kante des Deckels geben, sie tritt aber auf keinem Röntgenbild hervor.
Boden und Deckel sind mit den jeweiligen Seitenteilen zusammengefügt, indem man einen schmalen Falz über die Aussenkante der Boden- und Deckelkante gehämmert hat. Der Falz ist nur 0,5-0,6 cm breit.
An der Oberkante des Büchsenzylinders hat man einen schmalen „Kragen" ausgehämmert, der durch die Kante des überfallenden Deckels verdeckt wird. Höhe des Kragens ca. 0,5 cm.
Die Büchse ist mit zwei nebeneinander liegenden Scharnieren und einem Bügel auf der gegenüberliegenden Seite (für ein Hängeschloss?) versehen. Die Scharniere bestehen aus je zwei zungenförmigen Eisenbeschlägen, die mit Nieten befestigt sind. Der Verschlussbügel ist fragmentarisch, aber wahrscheinlich von ähnlicher Form wie die Scharniere (Taf. 213: lb und le).
Grösse: Durchm, 15,5 cm, Höhe ca. 7,5 cm, die Füsse 1,1 cm hoch. Höhe der Deckelkante 2,2 cm.
1.2. Verzierung
Die Aussenseite der Büchse zeigt Spuren von Ornamentik. Die beste Auffassung ihrer Details erhält man auf
den Photographien, die für die Veröffentlichung in Birka I, Taf. 213:1a, hergestellt wurden. Auch auf den Röntgenbildern erkennt man das Motiv als Ganzes nicht besser. Arbman (1943, 168) nahm an, dass das Motiv aus zwei konzentrischen Kreisen und einem Vierklee in der Mitte rund um den Mantel zehnmal wiederholt worden sei. Die Kreise erscheinen wie Perlenreihen und Arbman meinte, sie seien von der Rückseite des Eisenblechs getrieben worden. Diese Auffassung ist jedoch zu bezweifeln. Technisch betrachtet ist es wahrscheinlicher, dass die Perlenreihen gepunzt (ziseliert) und daher von der Aussenseite her geschlagen sind1. (Vgl. Birka II:1, Kap. 30:4.3. und in diesem Band Kap. 23:3.4.)
2.1. Vergleichsmaterial
Die Eisenbüchse aus Bj 542 hat man als einen uniken Fund der schwedischen Wikingerzeit betrachtet. Die Frage nach ihrem Ursprung wurde indessen nie diskutiert und auch heute noch ist es schwierig zu entscheiden, ob sie nordischer oder fremder Herkunft ist.
Herstellungstechnisch unterscheidet sie sich von der Mehrzahl der Eisenbehälter, die zu den Funden der schwedischen Wikingerzeit gehören, da die Büchse nicht durch Nieten oder Verzahnungsfugen sondern durch Treiben und Löten zusammengehalten wird (zur Überlapp-/Verzahnungstechnik s. Oldeberg 1966, 125 mit Abb. 353-355). Für das Nieten gibt es zahlreiche Beispiele bei den Eisenkesseln, z.B. dem Kessel des Osebergfundes (Grieg 1928, Abb. 76), mehreren Kesseln der Bootgräber in Vendel (Vendel VI, VII, VIII, IX, s. Stolpe und Arne 1912, Taf. XVIII:3, XXI:11-12, XXII:7-8, XXV: 1) und dem Kessel aus Valsgärde 1 (Fridell 1930, Abb. 89).
Von den kleinen runden Büchsen mit Überfalldek-
1 Ich danke Antiquar Gunnel Werner und Direktor Gustaf Trotzig für ihre Gesichtspunkte zu dieser Frage.
112 Greta Arwidsson
kel, die als Behälter der Silberschätze auf Gotland dienten, sind die meisten aus Bronze- oder Kupferlegierungsblech verzahnt (Stenberger 1958, 239ff. und Abb. 291-297). Ein Fragment eines Bronzegefässes aus Birka (Bj 969) zeigt, dass eine gelappte Fuge auch durch Löten verstärkt werden konnte (Oldeberg 1966,126 und Abb. 355). Stenberger (1958, 240 und 1947, 21ff.) ebenso wie Oldeberg (1966, 125) sind der Ansicht, dass die Technik des Verlappens orientalischen Ursprungs ist, und sie verweisen auf die aus dem Orient importierten Bronzegefässe vom Typ Fölhagen/Björke (Stenber-ger 1947, Abb. 288). Die ganze Gruppe dieser Bronzegefässe in nordischen Funden zeigt die Methode des Verlappens, ausserdem sind sie mit ähnlichen Motiven gemustert, die in Stempeltechnik oder Punzierung ausgeführt sind (s. Stenberger 1947, Abb. im Text 8; zu den orientalischen Bronzegefässen s. ferner Arne 1924, 155 und 1932, Abb. 73; Petersson 1958,134 und Odencrantz 1934, 144).
Hinsichtlich der punzierten Ornamentik auf der Eisenbüchse aus Bj 542 erschien ein Vergleich mit dem kleinen Eimer aus Bj 660 (Taf. 208:1) naheliegend. Stolpe ebenso wie nach ihm Arbman (Birka I, 232) meinten, dieser Eimer sei mit Eisenblech mit getriebener Ornamentik bekleidet gewesen. Auch Arwidsson (Birka II:1, 240) wiederholt diesen Irrtum. Hier bestehen die mit Punktreihen verzierten Bleche jedoch aus Bronze/Kupferlegierung mit getriebener Ornamentik.
Unter den Birkafunden gibt es indessen Beispiele für Eisenbleche mit punzierten Punktreihen. An den drei dreieckigen Beschlägen der Behälter aus Bj 965 und 585 (Taf. 270:1 und 3) sind rundherum an den Kanten doppelte Punktreihen ungleichmässig eingeschlagen, und an den Fragmenten eines Eisenbandes zu dem Kasten in Bj 573 (Taf. 272:1) gibt es ähnliche punzierte Punkte in einfacher Reihe entlang den Kanten. Dies Dekor - das also gerade an Kastenbeschlägen belegt werden kann -kommt auch an Bronzeblech bei dem Kasten aus Bj 639
(Taf. 259 und 261) vor, teils am Handgriff und teils an den Scharnieren. An den Bronzeblechen lässt sich hier unterscheiden, dass man mit dem Punzgerät abwechselnd ungleichmässige runde Vertiefungen und Punktaugen geschlagen hat.
Ein komplizierteres Stempelmuster auf Eisen finden wir am Griff des Eimers aus Bj 624 (Taf. 212:1; s. Birka II:1, 238, Arwidsson & Holmquist). In der Vendelzeit kommen ziselierte Ornamente an Messerschneiden vor. Ungewöhnlich reich verziert ist die Messerschneide von Kylver/Stånga (SHM 13436 A:6, Fv 1908, 239, Abb. 87 = VZG Abb. 473). Auf Gotland gibt es aus der Vendelzeit mehrere Beispiele von Eisenmessern mit einfacheren Verzierungen, Linien, Punktaugen und kleinen Punkten, z.B. an VZG Abb. 469-471, 475 (aus der Periode VII:1), 1652-1654 (aus der Periode VII:3) und 2040 (aus der Periode VII: 4).
Von grosser Bedeutung scheint mir der Vergleich mit dem Behälter aus dem Grab von Ketting auf Alsen zu sein, der bei den Büchsen der Gruppe D herangezogen wurde (s. unten Kap. 23:5.6.). Dieser hat eine Deckelplatte aus Eisen, die mit Pressblechen aus Bronze mit nordischen Motiven bekleidet ist, und wie bei der Eisenbüchse aus Bj 542 gibt es einen Handgriff auf dem Deckel, dessen Krampe durch die Mitte einer kleinen Silberrosette geschlagen ist, die der Rosette auf der Eisenbüchse von Birka sehr ähnlich ist.
2.2. Schlussfolgerung
Auf Grund der Ähnlichkeit in technischen Details, die sich zwischen der Eisenbüchse und anderen Fundgegenständen in Birka und mit Vergleichsmaterial auf nordischem Boden nachweisen lassen, bin ich zu der Annahme bereit, dass die Büchse aus Bj 542 wahrscheinlich nordischer Herkunft ist.
23. Kästen und Schachteln
Birka I: Taf. 259-272, 277-278; Abb. 46, 101, 117, 175-177, 435 Abb. 23:1-3, Tab. 23:1
Greta Arwidsson und Håkan Thorberg
1.1. Einleitung
Als Kästen (auch Kästchen) werden in der Birka-Publikation Verwahrungsbehälter mit einer Länge von weniger als 1 m bezeichnet. Die Mehrzahl der Kästen war jedoch wahrscheinlich weniger als 70 cm lang. Schachteln, auch Büchsen, nennen wir Gegenstände, deren fragmentarische Reste darauf deuten, dass ihr Durchmesser unter 25 cm gelegen hat - oder, wenn es sich um vierkantige Schachteln gehandelt hat, dass ihre Länge höchstens 20-25 cm betragen hat.
Rekonstruktionsversuche der Kästen waren nur dann möglich, wenn Hjalmar Stolpes Grabpläne und Skizzen zusammen mit den von ihm gefundenen Kastenbeschlägen und den Resten von Verschlüssen genügende Anleitung gaben. In vielen Fällen liegen der Identifikation der Kästen nur sehr geringfügige Fragmente von Beschlägen, sowie von leicht bestimmbaren Handgriffen, Scharnieren und Haspen zugrunde.
Das Vorkommen von Holzkästen ohne alle Metallbe-schläge oder Metallteile lässt sich aber in einigen Fällen nachweisen oder vermuten auf Grund der gesammelten Lage des erhaltenen Inhalts. Beispiele hierfür liefern das Doppelgrab Bj 644 (ein Kasten für Spielsteine und Würfel und ein Werkzeugkasten), Abb. 182, das Doppelgrab Bj 750 (ein Werkzeugkasten), Abb. 217, und das Mannsgrab Bj 872 (Werkzeugkasten), Abb. 286.
Da Teile der Verschlüsse und Haspen meistens die am besten erhaltenen Teile der Kästen sind, dürfen wir wahrscheinlich diese Kästen ganz ohne Funde von Metallteilen zu den nicht verschliessbaren Kästen, Gruppe A, rechnen.
Wenn Schlüssel unter den Grabfunden vorkommen, diese aber nicht in direkter Nachbarschaft bei den Resten eines Schlosses oder Kastenbeschlags gelegen haben, verbleibt der Schluss unsicher, ob es sich um einen verschliessbaren Kasten (Gruppe B) gehandelt hat. So hat man in Bj 1083 vier Schlüssel gefunden (zwei auf Taf. 269:3 abgebildet), welche die Frau alle an
einem Band zusammen mit ihren übrigen kleinen Geräten getragen haben dürfte und von denen keiner im Zusammenhang mit dem mit Beschlag versehenen Kasten steht, zu dem keine Schlossfragmente aufgefunden wurden; der Kasten muss als zur A-Gruppe gehörig betrachtet werden, Birka I, 452 und Abb. 420.
1.2. Håkan Thorbergs Bearbeitung der Funde
Im Anschluss an die Katalogangaben und die Abbildungen in BIRKA I hat Håkan Thorberg die erhaltenen Funde in SHM sehr genau beschrieben (Thorberg 1973 A und B). Bei der Behandlung der Funde und auf Grund der Konservierungsmassnahmen, welche die technische Abteilung des Museums gleichzeitig ausführte, konnte Thorberg die Kenntnis der Konstruktionen und der technischen Details bedeutend ergänzen. Bei seiner anschliessenden Bearbeitung der Kastenfunde hat er sich für die wichtigen Fragen der Einteilung in Gruppen, die Grössenverteilung und die Niederlegung der Kästen in Männer- bzw. Frauengräber, sowie die Funktion der Kästen als Grabbeigaben interessiert. Bezüglich der Datierung meint er, „dass die Mehrzahl der datierbaren Kästen aus dem 10. Jahrhundert stammt" (1973B, 50)1.
Den Text und die Tabellen des vorliegenden Kapitels in Birka II:3 hat Thorberg in Übereinkunft mit der Redaktion gegenüber dem Text des Manuskripts von 1973 B und der von ihm 1981 ausgeführten Zusammenfassung verkürzt. Die Tabellen entsprechen vollständig den tabellarischen Zusammenfassungen Thorbergs, nur sind sie entsprechend dem Typ der seit Birka II:1 eingeführten Tabellen umgearbeitet worden.
1 Eine deutliche Veränderung des Vorkommens von Kästen zwischen ÄBS und JBS lässt sich jedoch nicht nachweisen.
114 Greta Arwidsson & Håkan Thorberg
2.1. Einteilung in Gruppen
Wegen der Unvollständigkeit des Materials und der Unsicherheit bezüglich der meisten Konstruktionsdetails war eine Einteilung in Gruppen in erster Linie auf den Unterschied zwischen wahrscheinlich nicht ver-schliessbaren Kästen und solchen mit erhaltenen Schlossteilen zu gründen. In der letzteren Gruppe waren einige Kästen zu unterscheiden, die ganz mit Eisenblech beschlagen (oder mit Bronzeblech überzogen?) waren und die gewölbte Deckel an Stelle von platten Deckeln hatten. Schliesslich Hessen sich einige runde Schachteln mit einem Belag aus Bronzeblech, alternativ eine runde Büchse aus Eisenblech (Bj 542) identifizieren. Folgende Einteilung ergab sich also:
Gruppe A: Mit Metallbändern versehene und/oder mit Nägeln zusammengefügte Kästen ohne Schloss.
Gruppe B: Mit Metallbändern versehene Kästen mit Schloss.
Gruppe C: Ganz mit Metallblech beschlagene Kästen mit Schloss. Schwach gewölbte Deckel.
Gruppe D: Schachteln/Büchsen von runder (oder vier-kantiger?) Form ganz aus Eisenblech oder aus Holz mit Bronzebeschlägen.
Rekonstruktionsvorschläge der Gruppe A (Abb. 23:1) gründen sich auf Hj. Stolpes Gräberplanzeichnungen und erhaltene Teile der Beschläge in Bj 639 (die kleine Schachtel, Abb. 177), und auf die Beschläge in Bj 832.
Der Rekonstruktionsvorschlag der Gruppe B (Abb. 23:2) gründet sich auf den Plan und das Material aus Bj 639 (der grössere Kasten) und auf Arbmans Rekonstruktion, Taf. 259 und Abb. 175.
Die Rekonstruktion der Gruppe C (Abb. 23:3) gründet sich auf Hj. Stolpes Plan und Angaben über Bj 845 und Arbmans Rekonstruktion dieses Kastens (Taf. 263).
Die Gruppe D, bespricht Greta Arwidsson im Abschnitt 5 eingehender.
2.2. Verteilung der Funde
Die Verteilung auf Männer- bzw. Frauengräber, sowie die Verbreitung in den verschiedenen Gräberbezirken geht aus der Tabelle 23:1 hervor, die auch die Verteilung auf verschiedene Gräberformen erkennen lässt.
Abgesehen von den vier Gräbern, bei denen sich das Geschlecht des Toten nicht bestimmen lässt (Bj 328, 353, 367, 407), und den Beschlägen der zur Gruppe D
Abb. 23:3. Gruppe C (Bj 645).
Abb. 23:1-3. Die Kastengruppen. Zeichnung E. L.-A.
gehörigen Schachteln/Büchsen, gibt es auf den Gräber-feldern von Birka 25 Kästen der Gruppe A, 14 davon aus Männergräbern und nur sieben aus Frauengräbern, sowie 35 Kästen der Gruppe B und C zusammen, von denen 29 aus Frauengräbern stammen. Die Tendenz erscheint deutlich: verschliessbare Kästen sind in erster Linie eine Grabbeigabe für Frauen, nicht verschliessbare sind Grabbeigaben für Männer.
2 Die Kastenbeschläge von Bj 967 sind verloren und die oben im Abschnitt 2:2 erwähnten vier Kästen ohne nachweisbare Metallteile (aus Bj 644, 750 und 872) sind nicht in die Tabelle aufgenommen und werden nicht in dieser Zusammenfassung behandelt.
Abb. 23:1. Gruppe A.
Abb. 23:2. Gruppe B (Bj 639).
Kästen und Schachteln 115
In einigen Gräbern lagen zwei oder drei Kästen. In Bj 24 A gab es zwei B-Kästen, in dem Frauengrab Bj 639 einen A-Kasten und einen B-Kasten (mit dem Schlüssel daneben liegend!), und in dem Doppelgrab Bj 644 vielleicht drei Kästen, einer davon ein D-Kästchen (?) aus Eichenholz, in dem eine Bronzeschelle lag, und zwei A-Kästen3 ohne Metallbeschläge für Spielsteine mit Würfeln bzw. eine grössere Sammlung von Geräten.
3.1. Die Konstruktion der Kästen und ihre Schmuckdetails
Nägel und Stifte und die Köpfe derselben hat man vielfach zusammen mit Teilen der Kästen gefunden. Klarheit über die Zusammenfügung der Kästen geben die Nägel jedoch kaum. In einem Fall, bei Bj 639, hat Arbman im Anschluss an Stolpes Detailzeichnungen eine Rekonstruktion ausgeführt (Taf. 259, lc), aus der hervorgeht, wie umgebogene Nägel, Stifte und Beschläge gesessen haben können und die Dicke des Holzes kennzeichnen (vgl. Taf. 261:1 von dem Kasten aus Bj 639). Bandförmige Bronze- oder Eisenbeschläge, die an allen drei Gruppen A-C vorkommen, sind mit Stiften/Nägeln mit gewölbten Köpfen befestigt (s. z.B. Taf. 270:1 und 272:1, 3).
Wie oft diese Stifte ausserdem verwendet wurden, um irgend ein dekoratives Muster zu bilden, lässt sich nicht sagen. Bei dem Kasten aus Bj 845 sind die Stifte jedenfalls in karoförmigen Linien angebracht (Taf. 263), und auch bei den wenigen Fragmenten der bandförmigen Beschläge zu dem Kasten aus Bj 791 (Taf. 265:5) wirkt die Anbringung der Stifte dekorativ, ebenso bei dem rechtwinklig gebogenen Beschlag des Kastens aus Bj 854 (Taf. 264:1).
In manchen Fällen geben die Scharniere und die gebogene oder gerade Form der Beschläge einen deutlichen Hinweis darauf, wie die Kastendeckel ausgesehen haben, d.h. ob es gewölbte, schwach gewinkelte oder flache Deckel waren (s. z.B. Taf. 261:1-2 vom A-Kasten aus Bj 639 und aus Bj 660, sowie Taf. 263 vom C-Kasten aus Bj 845).
3.2. Einige Details der Herstellungstechnik
Bei der Konservierung im Zusammenhang mit der Spe-zialuntersuchung der Kästen waren einige interessante Details der Herstellungstechnik zu erkennen (s. Thorberg 1973 A).
Die neue Rekonstruktion des kleineren Kastens aus Bj 639 {Abb. 23:2 und Abb. 177) gründet sich auf Wahr-nehmungen bei der Konservierung. Die Untersuchung
der Fragmente des C-Kastens aus Bj 850 (Taf. 272:3) hat nach Thorberg ergeben, dass die 3 cm breiten Eisenbänder des Deckels mit Stiften mit breiten, gewölbten Zierköpfen versehen waren, die eine Art Rautenmuster bildeten (vgl. den C-Kasten aus Bj 845, Taf. 263). Ähnliche Stifte mit Zierköpfen gibt es an den bandförmigen Beschlägen auf den übrigen Seiten des Kastens, doch bilden sie hier kein Muster4.
Die gute Qualität des Kastens aus Bj 850 geht am besten aus der sorgfältigen Ausführung der Haspen hervor (nur einer erhalten, Taf. 272:3 b Abb. 23:4). Der Haspen besteht aus zwei, in der Mitte zu Ösen umgebogenen Eisenstäbchen, deren freie Enden in den „Hals" eines eisernen Tierkopfes auslaufen. Die Stäbchen sind mit Metallfäden (aus einer Kupferlegierung) tauschiert, die um die Stäbchen in ihrer ganzen Länge gewunden sind. Ausserdem ist die Kante des Tierkopfes mit parallelen Linien tauschiert und die Fragmente der Eisenblechschlaufe unter den beiden Ösen tragen eine einfache Linie. Die Tauschierung am Kopf besteht ausserdem aus einem Ring an der „Stirn" und wahrscheinlich auch in den markierten Augenhöhlen.
Ein Haspen ganz aus Eisen mit abschliessendem Tierkopf ohne sonstiges Dekor gehört zu Bj 513.
3.3. Die Konstruktion der Haspen
Gewöhnlich scheint man die Haspen selbst aus Eisen hergestellt und sie mit einem Tierkopf aus einer Kupfer-legierung verziert zu haben. Ein gutes Beispiel dafür sind die beiden von dem C-Kasten aus Bj 845 erhaltenen Haspen {Abb. 23:5). Sie bestehen hier aus einem (zusammengebogenen?) gewundenen Eisenzain mit einer ringförmigen Öse am unteren Ende (für den verschiebbaren Riegel des Schlosses) und über dieser einem stark stilisierten Tierkopf aus einer Kupferlegierung.
Eine ähnliche Konstruktion haben die Haspen zu dem grösseren Kasten aus Bj 639 und zu dem aus Bj 845, wo der Kasten drei statt zwei Haspen hatte {Abb. 23:5).
Die Form der Tierköpfe an diesen Haspen zeigt Abb. 23:3, aus der hervorgeht, dass die Variation im Detail gross ist. Es gibt bei einem Teil dieser Köpfe deutliche Ähnlichkeiten mit der Gruppe der bronzenen Bügelfibeln, die in den Birkagräbern vorkommen (s. Arrhenius 1984, Abb. 6:3-5).
3 S. oben Abschnitt 1.1. 4 Die 250 Fragmente dieses Kastens lagen in verschiedenen Schachteln mit der Aufschrift (von Hj. S. ?) ,,Vorderseite", „Rückseite" und „Boden".
116 Greta Arwidsson & Håkan Thorberg
Die Haltbarkeit dieser Haspen oder Bügel ist natürlich ein für die Konstruktion der Schlösser wichtiger Faktor. Die Herstellungsweise liess sich durch Röntgenaufnahmen der Bügel des Kastens aus Bj 845 klären. Man hat offenbar die Enden der Eisenzaine des Bügels in den röhrenförmigen Hals des hohl gegossenen Bronzekopfs hineingeschoben, und zwar so weit wie möglich bis zum unteren Ende des Kopfes. Ungefähr in der Mitte der Bronzehülse hat man zwei viereckige Öffnungen gemacht, durch die man die Enden des Eisenzains, der die Öse bildet, eingetrieben hat. Dann konnte man durch Lötmasse die Eisenteile haltbar miteinander und mit der Bronzehülse verbinden5.
Eine ganz andere Form hat ein Haspen aus Bronze-guss, der zu den Kastenbeschlägen ohne Grabnummer gehört, Taf. 262. Er ist mit gestempelten Punktaugen verziert und am unteren Ende quergeriefelt.
3.4. Dekor, Stempel und abschliessende Tierköpfe u.a.
Stempeldekor gibt es noch an anderen Bronzeteilen der Kästen von Birka: am Handgriff des grösseren Kastens aus Bj 639 (Taf. 259:2) und an den Beschlägen aus einer Kupferlegierung an dem kleineren Kasten desselben Grabes (Taf. 761:1a).
Reihen von kleinen getriebenen Buckeln finden wir an den Kästen aus Bj 573 (Taf. 272:1), Bj 1083 (Taf. 269:3) und an den Fragmenten aus dem Grab ohne Nummer (Taf. 262). Wie das entsprechende Dekor an Eisenblech technisch ausgeführt wurde, ist unklar. Arbman meinte bei den Scharnierblechen zu Bj 660 (Taf. 261:2), dass die Perlenreihen auf einem Weissmetall-blech waren, das auf dem Eisen angebracht war, und er sagt auch, dass die Perlenreihen an den dreieckigen Eisenblechen aus Bj 965 und 585 (Taf. 270:1, 3) von der Unterseite getrieben seien. Ein Weissmetallbelag lässt sich in diesen Fällen jedoch nicht nachweisen und es erscheint als die einzige mögliche Erklärung, dass die Perlen gepunzt waren. Mehr hierüber s. den Abschnitt 5:1 über die Eisenbüchse aus Bj 542 (Arwidsson).
Tierköpfe als Abschluss kommen auch an dem Bron-zehandgriff des Kastens aus Bj 639 vor (Taf. 259:2, vgl. Taf. 262), am häufigsten sind jedoch die Enden der Handgriffzaine, wenn diese aus Eisen bestehen, spiralförmig aufgerollt (Bj 739, Taf. 265:3; Bj 24A, Taf. 267:1; Bj 1083, Taf. 269:3; Bj 978, Taf. 269:4; Bj 212, Taf. 272:2) oder sie sind zu einem einfachen Haspen aufgebogen (Bj 24A, Taf. 267:1; Bj 367, Taf. 269:5).
An dem Fragment des Handgriffs zu dem B-Kasten aus Bj 854 ist ein fazettierter Abschlussknopf erhalten (Taf. 264:1).
Abb. 23:4. Haspen zum C-Kasten Bj 850. Ca 4/5. Zeichnung nach H. Thorberg. C. B.
3.5. Die Schlösser6
Die am besten erhaltenen Schlösser der Kästen sind lange Riegelschlösser mit viereckigen Schlossblechen an der Aussenseite der Kästen und mit zwei oder drei Haspen mit Ösen, in die der Riegelzain des Schlosses eingeschoben werden soll. Beispiele sind Bj 639 (Taf. 260:4a-b), Bj 854 (Taf. 264:2 a-b), Bj 739 (Taf. 265:la-c), Bj 963 und 847 (Taf. 266:2 a-b und 2a-c). Kleinere, quadratische oder dreieckige Schlossbleche gibt es an den Kästen aus Bj 823 (Taf. 267:3), Bj 1081 (Taf. 268:2a-b) und Bj 585 (Taf. 270:3)7.
Ein oder zwei (?) kleine rechteckige Schlossbleche gibt es unter den Fragmenten des Kastens in Bj 980 (Taf. 269:1).
5 G. A. dankt Ingenieur Erik Norgren für die ergiebige Diskussion der Röntgenbilder. 6 Teile von Riegelschlössern gibt es an mehreren Kästen der Gräber von Birka, sie geben interessante Beispiele verschiedener Konstruk tionen. Thorberg hat diese bei seiner Durchsicht des Materials jedoch nicht genauer untersucht. Zu diesen Schlössern verweisen wir auf Almgren 1955, 30ff., und auf den Artikel Lås in KLNM (Homman). 7 Mit Bj 585 sind die dreieckigen Bleche aus Bj 965 (Taf. 270:1) zu vergleichen, von denen Arbman (1943, 192) annimmt, dass eins ein Schlossblech ist, s. Abschnitt 5:2, wo diese Frage diskutiert wird (Arwidsson).
Kästen und Schachteln 117
Abb. 23:5. Haspen zum C-Kasten Bj 845. Ca 4/5. Zeichnung nach H. Thorberg C. B.
4.1. Funktion der Kästen im Grabinventar
Die Funktion der Kästen ist im allgemeinen schwer zu beurteilen, weil man in ziemlich wenigen Fällen Gegen-stände hat bergen können, die in den Kästen verwahrt wurden. Die Niederlegung in den Gräbern zusammen mit Gefässen für Lebensmittel und Getränke, die wir in mehreren Gräbern finden, lassen die Kästen vielleicht als Proviantkästen erscheinen, d.h. als Verwahrungsschreine für Esswaren, aber es ist kaum zu bezweifeln, dass es sich häufiger um einen vermischten Inhalt von Textilien und versschiedenem Kleindungszubehör und von Geräten aus hauptsächlich organischem Material handeln dürfte, der völlig vermodert ist.
Dass ein so grosser Teil der Kästen ohne Inhalt ins Grab gesetzt worden wäre, erscheint unglaubwürdig. Mit Rücksicht auf die Art der Funde in einigen Kästen mit nachweisbarem Inhalt (s. das Verzeichnis unten) und was im übrigen zu den Grabfunden aus leicht zerstörbarem Material in Birka gehört, wäre es denkbar, dass die ganz leeren Kästen einst kleine Holzschalen (Taf. 214:1-3), Trinkkörner aus Holz oder Tierhörnern, Löffel aus Holz oder Horn (Taf. 151), verschiedene Geräte aus Knochen (Taf. 154:1, 156:12-14), Rindenschachteln (s. Abschnitt 5:2, Arwidsson); oder vielleicht Spielsteine aus Bein oder Horn enthalten haben8.
4.2. Inhalt der Kästen
Folgende Kästen enthielten Funde:
A-Kasten aus Bj 834: ein fragmentarischer Gegenstand aus Silber, eine Doppelperle aus Glas.
B-Kästen aus Bj 585: (im zweiten Kasten?) Eisenschere, Messer mit Scheide, Nadelbüchse aus Eisen.
aus Bj 660: Glasgefäss, in starker Auflösung (Hj. Stolpe notiert, dass in dem Klumpen ausserdem Eisenfragmente lagen, doch: „unmöglich festzustellen, was dies war"). aus Bj 823: 1 Fayenceperle, eine Perle aus Glasfluss, 1 Kamm, ein Hornlöffel, 1 Schie-ferwetzstein.
aus Bj 838: 1 fragmentarischer Bronzege-genstand, ein Eisenpfriem mit Holzschaft, 1 Karneol (zum Einfassen in einen Ring?), 3 Gewichte mit Resten eines Beutels, 2 Frag-mente eines DIRHEMS, 1 Stück Harz, 1 Stück Holz, mehrere Haselnüsse, aus Bj 847: (2 Perlen, 1 Stück Feuerstein, 1 Fragment einer Ringspange?). Unsicher, zerstreut.
aus Bj 963: 1 Kamm (stark verwittert?), Glättstein aus Glas, 1 Stück Bernstein, aus Bj 965: (Schlüssel), Feuerstahl (Fragment), Schlacke.
aus Bj 1083: 3 Spiralen einer Kupferlegierung an einem Lederriemen?
8 Man vergleiche die Mengen von Holzschalen, Holzbechern, Holz-löffeln usw., die zu den Grabfunden von Valsgärde 7 und 8 gehören (s. Arwidsson 1954, 82ff. und 1977, 71 ff.).
118 Greta Arwidsson & Håkan Thorberg Tab.
23:1. Kästen (zusammengestellt von G.A.)
1 Wenn nach der Grabnummer ein (?) steht, bedeutet das, dass die Lage des Grabes in dem angegebenen Bezirk unsicher ist. 2 In die Zahl 28 ist ein grösserer Fund von Kästchenteilen einberech net, bei dem die Inventarnummer fehlt (Birka I; Taf. 262). Die Gegenstände dieses Fundes sind auch in die Zahl der Gräber in der Spalte 9 einberechnet. 3 Zu Bj 585 gehört das runde Holzkästchen, Typ D, (Birka I: Taf. 277). 4 Die Fragmente der Kästchen aus Bj 67 und 978 gehören vielleicht zum Typ C.
Kästen und Schachteln 119
Diese Aufzählung ist mit zwei Kästen zu ergänzen, die offenbar ohne Metallteile waren und daher wahrscheinlich als A-Kästen zu rubrizieren sind, nämlich der Kasten mit den Spielsteinen aus Bj 644 und der Kasten mit Geräten aus Bj 750, s. oben, Abschnitt 1.1..9.
4.3. In der Nähe verschiedener Gefässe niedergelegte Kästen
In folgenden Gräbern stand der Kasten in der Nähe verschiedener Gefässe zur Verwahrung von Esswaren und Getränken.
Bj 542: Glasbecher (Taf. 194:1). Bj 539: Grosser Eimer (Taf. 209:2). Bj 624: Grosser Eimer (Taf. 207:3). Bj 639: Fragment eines Glasgefässes, grosses Tongefäss
(Taf. 251:4). Bj 660: Tongefäss (Taf. 240:8), Eimer (Taf. 208:l)10. Bj 735: Glasbecher, Tongefäss (Taf. 234:5). Bj 739: Holzschale, Glasgefäss, kleines Tongefäss, Eimer
(im Grab ausserdem eine grössere Bronzeschale, nicht bei dem Kasten).
Bj 791: Eimer (vom Typ Taf. 207:1), Bronzeschale (Taf. 199:2).
Bj 834: Eimer. Bj 854: Grosse Keramikkanne (Taf. 219), Glasbecher (Taf.
190:4), 2 Eimer (im Grab ausserdem eine grössere Bronzeschüssel, nicht bei dem Kasten; Taf. 197:1-4).
5. Die Gruppe D
Greta Arwidsson Taf. 277-278,215:2 Abb. 144, 182-183,
342 + (Abb. 107)
5.1. In drei Birkagräbern gab es Reste kleiner Holzbüchsen, die ganz oder teilweise mit Bronzepressblechen bekleidet gewesen zu sein scheinen (Bj 585, 644 und 965). Eine kleine Büchse ohne Metallbeschläge gab es vielleicht auch in Bj 523.
5.2. Die Büchse aus Bj 585
Die Büchse aus Bj 585 war ziemlich gut erhalten und konnte von Hj. Stolpe als eine runde Platte mit erhöhter (ca. 3 cm breiter) Kante beschrieben werden, deren Fläche in acht kreissektorförmige Felder eingeteilt war. An der Kante des Grabplans notierte Stolpe „Deckel einer Rindenschachtel?".
Als Arbman die Büchse beschrieb, waren nur noch vier sektorförmige Eichenholzstücke erhalten (Taf. 277), die an allen Kanten dicht angebrachte Bronzestifte hatten. Stolpe hat die Lage der mit diesen Holzfragmenten zusammen verwahrten Pressbleche nicht präzisiert. Es ist zu beachten, dass an den Pressblechen keine Löcher für Stifte wahrnehmbar sind. Wenn sie zu der runden Büchse gehören, könnten sie als Verzierung der Seitenfläche gedient haben.
Eine grösser Büchse aus Valsgärde 8 mit stabilem Deckel aus Ahornholz und der Seitenfläche aus zusammengenähter Lindenrinde und verzierten Spanbändern könnte als gutes Vergleichsobjekt dienen (Arwidsson 1954, 85f., Taf. 30-31). Leider bleibt es trotzdem unerklärlich, dass an den Blechen der Büchse aus Birka nicht Reste von entsprechendem Material durch Grünspanimprägnierung erhalten sind.
Arbman (1943, 192) meinte, dass die bei Stolpe ange-gebenen Fundlagen eines Schloss-Schildes, eines Schlüssels und einiger Eisenfragmente auf der Eichenplatte darauf deuten müssten, dass sie „schon vor dem Zeichnen des Plans ein wenig durcheinander gekommen sind". Zu der runden Büchse gehört das grosse Schlossschild wohl kaum, das im übrigen wegen seiner Ähnlichkeit mit den Eisenbeschlägen aus Bj 965 interessant ist: sie sind von gleicher Grösse, haben dieselbe dreieckige Form und Verzierung (s. 5.4. unten). Das schief auf dem Blech angebrachte „Schlüsselloch" erscheint zweifelhaft und passt nicht zu dem Schlüssel des Fundes.
Grösse: Durchmesser der Eichenplatte ca. 22 cm.
Dagegen erscheint es mir wahrscheinlich, dass die Schlossteile (?) und der Schlüssel zu einem Kasten gehört haben, der unter der runden Büchse mit Eichendeckel gestanden hat. Hier lag nach Stolpe eine fragmentarische Eisenschere, ein Messer mit Resten einer Lederscheide und eine Nadelbüchse, von denen die beiden ersteren ausserhalb des Umkreises der Eichenplatte liegend gezeichnet sind, d.h. Stolpe hat sie nicht als Inhalt der Büchse betrachtet.
5.3. Die Schachtel aus Bj 644
In dem Doppelgrab Bj 644 lagen Reste einer Schachtel, deren Deckel aus Eichenholz bestand, mit Pressble-
9 In Bj 644 bestehen die Spielsteine aus Glas. Spielsteine aus Horn oder Pferdezähnen können zu dem organischen Material gehören, das in einem Kasten völlig vermodert. In dem eisenbeschlagenen Kasten aus Valsgärde 1 z.B. waren die Spielsteine sehr stark oder fast voll ständig zerstört (Fridell I930, 231). 10 In dem Kasten lag ausserdem ein Glasgefäss (s. Abschnitt 4:2 oben).
120 Greta Arwidsson
chen bekleidet (?) (Taf. 278:1, Abb. 182:27 und 183:27), die von derselben Art wie die Bleche aus Bj 585 und Bj 965 waren. Von den Blechen sind hier nur vier grössere Fragmente erhalten, von denen zwei jeweils zwei ziemlich nahe beieinander sitzende runde Löcher für Befestigungsstifte haben. Eins oder zwei der Fragmente mögen Teile von dreieckigen Zipfeln entsprechend denen aus Bj 965 darstellen (s. Abschnitt 5.4.). Stolpe gibt an, dass elf Perlen um die Schachtel lagen, eine Bronzeschelle (verschollen) in der Schachtel und ein eisernes Löffelblatt (Taf. 151:4) daneben. Seine Zeichnung des Fundkomplexes - in dem es nach Birka I, 224, auch eine Büchse mit einer Waage darin gab (Taf. 126:1) - zeigt einen Ring von Perlen um eine runde Schachtel mit einem Durchmesser von ca. 7 cm. Direkt daneben befindet sich auf dem Plan der kleine Glasbecher, Taf. 189:4, und ein Spiegel (Taf. 195:6), sowie eine Anzahl von Perlen. Es wäre wohl möglich, dass auch diese Gegenstände in der Schachtel gelegen haben, deren Durchmesser man in dem Falle auf mindestens 12 cm berechnen könnte.
Grösse: Durchmesser ca. 7 cm oder (vielleicht) mindestens 12 cm.
Bei oder in der Büchse ein eiserner Hohlschlüssel, ein Feuerstahlfragment (?), Schlackenstücke und Knochen (?)■
Die beiden dreieckigen Eisenbeschläge aus Bj 965 (Taf. 270:1) waren mit einem Niet an jeder Ecke auf einer Holzunterlage befestigt. Auf der Rückseite dieser Beschläge waren Spuren von Holz nachzuweisen, dessen Fasern parallel mit den auf der Abbildung nach oben gewendeten Kanten der Beschläge verlaufen. Wahrscheinlich haben sie also an einer Kastenwand mit horizontal verlaufenden Fasern gesessen. Die Perlenreihen an den Kanten entlang sind auf der Rückseite der Bleche nicht wahrzunehmen, sie sind also durch Punzie-ren auf der Vorderseite hergestellt (s. das Vergleichsmaterial, Kap. 22.2.1.).
Die Form der Büchse lässt sich nicht bestimmen: sie kann viereckig oder rund gewesen sein (vgl. unten Abschnitt 5.5.).
Das „Schlüsselloch", das nach Arbmans Rekonstruktion in dem einen dreieckigen Beschlag vorliegt, ist ein sekundär entstandenes Loch.
5.4. Die Büchse aus Bj 965
Die Deutung der verschiedenen Büchsen- und Kastenteile in Bj 585 lässt sich durch ähnliche Funde in Bj 965 ergänzen (Taf. 270:1, 278:2). In einem nur 30x6 cm grossen Bereich fand man hier teils einen Schlüssel und zwei dreieckige Beschläge ähnlich dem „Schloss-Schild" aus Bj 585, sowie eine Anzahl von Bronzepressblechen, die denen aus Bj 585 sehr gleichen (Taf. 278:2). Von diesen Pressblechfragmenten sind vier zu dreieckigen Zipfeln zugeschnitten und die übrigen können Teile von Bändern entsprechend denen aus Bj 585 gewesen sein (Taf. 277). Die schmalen Dreiecke sind nicht grösser, als dass sie auf einem Deckel vom gleichen Diameter wie dem der Eichenplatte aus Bj 585 Platz gehabt hätten (Taf. 277:1, die Skala dieser Abbildung ist 1:2!). Eine genaue Untersuchung zeigt jedoch, dass es an den Kanten der Bleche keine Spuren dichtsit-zender Stifte gibt. Auch Spuren von Holzfasern sind nicht vorhanden auf der Rückseite, dagegen aber Spuren einer graufarbigen Masse (Kleister?). Auf der Unterseite der lose gefundenen Stiftköpfe (Taf. 270:1) sieht man Spuren von Holz, und zwischen dem Holz und dem Eisen des Kopfes eine dünne unbestimmbare Schicht.
Grösse: Das Holz, an dem die Eisenbleche, Taf. 270:1, be-festigt waren (nach einem gebogenen Stift) 0,7 cm dick. Die Bronzezipfel sind max. ca. 9,0 cm lang und 3,3 cm breit.
5.5. Kommentar zu den Büchsen/Schachteln aus Bj 585, 644 und 965
Zwischen den von diesen drei Büchsen/Schachteln erhaltenen Fragmenten bestehen viele Unterschiede. Sehr interessant ist ein Fund, den Arbman (Birka I, 191) zum Vergleich heranzieht, und zwar die Schachtel aus Grab 18 auf dem Gräberfeld von Ketting auf Alsen (Ksp. Ketting, Sønderborg, Dänemark) nach Brøndsted 1936, 133-138. Nach dem Grabplan und der Beschreibung war diese Schachtel 28 cm X 28 cm gross und hatte einen Holzdeckel, der von einem Eisenblech bedeckt war und in der Mitte einen Handgriff hatte, dessen Enden „were fastened through small silver rosettes" (s. Abb. 145:a)11. Über demm Eisenblech waren vier dünne bronzene Pressbleche von rhombischer Form mit Tierfiguren im Jellingestil angebracht (nach Arbman, Birka L 192).
Die Flächen mit dem Tierornament sind jedoch von vier kreissektorförmigen Feldern umgeben, die mit einem flächendeckenden Muster aus Buckeln in geraden Reihen verziert sind. Der Fund lag in einem grossen Holzsarg mit Nieten und Nägeln, der u.a. einen Halb-brakteaten aus Haithabu, Reste einer Silberkette und zwei eiserne Ringe mit je zwei Thorshämmern und einen Hohlschlüssel enthielt.
11 Die Zeichnung ist leider falsch beschnitten und gibt kein richtiges Bild von den Ornamenten im Verhältnis zu den Seitenflächen der Schachtel.
Kästen und Schachteln 121
5.6. Zusammenfassung zur Gruppe D
Konstruktionsdetails Hessen sich nicht festellen. Obwohl in zwei Fällen Schlüssel vom gleichen Typ in der Nähe der Büchsenfragmente angetroffen wurden (Bj 585, 965), ist es nicht sicher, dass diese verschliess-bar waren. Der in Birka I, 192 und Taf. 270:1 als Schlossschild aufgefasste Eisenbeschlag hat jedenfalls kein Schlüsselloch (s. Abschnitt 5.4. oben).
Es besteht grosse Ähnlichkeit zwischen den drei Be-schlägen, Taf. 270:1 und 3 mit ihren punzierten Perlen-
reihen, sowie auch zwischen allen Pressblechfragmenten der drei Büchsen/Schachteln (Taf. 277-278). Als wichtiges Vergleichsobjekt konnte der Fund von Ketting aus Alsen herangezogen werden, zu dem übrigens ein Hohlschlüssel vom gleichen Typ wie die aus Bj 585 und 965 gehörte. Zum Vergleich mit den hier behandelten Büchsen/Schachteln der Gruppe D soll auch die offenbar unike Eisenbüchse aus Bj 542 dienen, die wir in Kap. 22 besprechen, wo diese Möglichkeit näher begründet wird.
24. Schlüssel
Birka I, Taf. 260:3, 264:1, 265:2, 267:1-3, 268:2a, 269:2-3, 270:1-4, 273:3, 274:1-8, 275:1-9. Abb. 10A-B, 327, 417 Abb. 24:1-4. Tab. 24:1
Anna Ulfhielm mit Vorbemerkung von Greta Arwidsson
Vorbemerkung Die in Skandinavien gefundenen Schlüssel der Vendelzeit und der Wikingerzeit sind insofern interessant, als sie zur Gruppe der Gegenstände gehören, die internationale komparative Studien erlauben. Bertil Almgren (1955) wies auf den erstaunlichen Reichtum an Variationen bei den verzierten Bronzeschlüsseln aus Westeuropa und ihren Entsprechungen in den nordischen Ländern hin. In seiner Dissertation 1955 lieferte er auch instruktive Konstruktionszeichungen der sog. Schiebeschlösser und führte aus, wie die Schlüssel zu diesen funktionieren. Das Hauptinteresse Almgrens galt bei der Übersicht über die Bronzeschlüssel dem Stilstudium. Zugleich registrierte er aber auch genau die Variationen der Schlüsselbärte, die er für England und Frisland in neun Typen (Tab. II—III) einteilte, und für das Rheinland in sechzehn Typen (Tab. I). Da die meisten westeuropäischen Schlüssel bei Almgren Einzelfunde sind, lassen sich alle diese Typen nur unsicher zu einem chronologischen System zusammenstellen. Symp-tomatisch ist es jedoch, dass viele Schlüssel aus so wichtigen Zentren wie Dorestad und York stammen. Auf der Tabelle IV sind auch die Eisenschlüssel aus diesen Stadtsiedlungen aufgeführt. Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die bei den Bronzeschlüsseln in England und Friesland sehr gebräuchliche Form des spitzovalen Rahmengriffs ohne Verzierung auch die absolut häuftigste unter den Eisenschlüsseln aus Dorestad und York war.
In geschlossenen Grabfunden von Birka kommen nur acht Bronzeschlüssel vor, deren Typ den bei Almgren verzeichnenten westeuropäischen und skandinavischen Formen entspricht. Sie gehören alle zu Frauengräbern, die durch die Kombination der Grabfunde auf die ÄBS datiert werden können (Bj 24B, 462, 504, 526 /3 Ex./, 1079 und 1083). Sie gehören alle zu Ulfhielms Typ I (s. Tab. 24:1 und Abb. 24:1). Die meisten Exemplare sind deutlich abgenutzt.
Obwohl Almgrens Tabellen deutlich zeigen, dass die Kombination der Barttypen mit der Form und dem Schmuck des Rahmengriffs nicht nach festen Regeln geschieht, und dass die Bartformen offenbar nicht zu chronologischen Differenzierungen beitragen können, haben wir uns bei den Bronze- und Eisenschlüsseln aus den Gräbern von Birka entschlossen, der Einteilung in detaillierte Typen die Bartformen zugrunde zu legen. Auf diese Art haben wir auch versucht, für die Schlüsselfunde ein Bild von der Verteilung auf die verschiedenen Gräberbezirke zu gewinnen {Tab. 24:1), sowie von der Frequenz der Bärte mit Stift bzw. Rohr zu komplizierteren Schlossern, und endlich von der Frequenz und Verbreitung in Birka der schon in römischer Eisenzeit in Schweden auftretenden Schlüsselbärte mit Zapfen (1-4 Zapfen, Ulfhielms Typ IV).
Greta Arwidsson
1. Einleitung
Von den insgesamt auf Björkö gefundenen 143 Schlüsseln lagen 51 in der Schwarzen Erde und 92 in 75 der untersuchten Gräber, das sind 7 % der Gesamtzahl der untersuchten Gräber.
26 Gräber mit Schlüsseln sind Grabkammern (22 % aller Grabkammern). 19 Gräber sind Frauengräber (44 % der Gesamtzahl der Frauengräber vom Kammertyp). Vier Gräber sind Männergräber (7 % der Gesamtzahl der Männergräber vom Kammertyp). Ein Grab ist ein Kindergrab (50 % der Gesamtzahl), das zwei Schlüssel enthält.
18 der Gräber mit Schlüssel sind Sarggräber (8 % der Gesamtzahl der Sarggräber). Zwölf sind Frauengräber, eins ist ein Männergrab und fünf sind Kindergräber (17 %, 3 %, bzw. 11 % der Gesamtzahl der Sarggräber).
Schlüssel 123
Zehn Gräber sind Schachtgräber (5 % der Gesamtzahl der Schachtgräber).
21 Brandgräber haben Schlüssel enthalten (4 % der Gesamtzahl der Brandgräber).
Man ist ziemlich allgemein der Auffassung, dass Schlüssel Beigaben für der Frauen waren (u.a. Stenber-ger, 1962, 85). In Birka gibt es bedeutend weniger Schlüssel in Männergräbern als in Frauengräbern, ihr Vorkommen beweist jedoch, dass Schlüssel nicht ausschliesslich den Frauen zukamen.
Das Herstellungsmaterial der in den Gräbern von Björkö gefundenen Schlüssel verteilt sich ganz anders als das einer ungefähr gleich grossen Gruppe von Schlüsseln aus etwa derselben Zeit, die in Gräbern auf Gotland in Kombination mit tierkopfförmigen Spangen gefunden wurden (Ulfhielm 1986, 20).
Aus reinem Eisen hergestellte Schlüssel sind auf Björkö ganze sechsmal so häufig wie solche ganz aus Bronze. Auf Gotland sind statt dessen ganz as Bronze hergestellte Schlüssel dreimal so häufig wie die aus Eisen.
2. Einteilung in Typen
Bei der Einteilung der Schlüssel in Typen gehen wir von der Form des Bartes aus, da diese die Funktion des Schlüssels bestimmt, die ihrerseits von dem Typ des Schlosses abhängig ist. Jeder Schlüsseltyp wird gemäss den Details des Bartes, des Griffs und des Schaftes in Unterabteilungen eingeteilt. Tab. 24:1.
I. RECHTECKIGER BART. STIFT Abb. 24:1 I A:l Platter Bart, gerade abgeschnitten. Durchbro chener, platter Griff. I A:2 Platter Bart, gerade abgeschnitten. Spitzovaler
Rahmengriff. I A:3 Platter Bart, gerade abgeschnitten. Platter Griff. I B:l Platter Bart, zugespitzt. Durchbrochener Griff, Taf.
269:3 rechts. I B:2 Platter Bart, zugespitzt. Spitzovaler Rahmen-griff. I C:l Bart mit Zapfen, gerade abgeschnitten. Durch-
brochener Griff, Taf. 275:2 rechts u. links aussen, 275:4.
I C:2 Bart mit Zapfen, zugespitzt. Durchbrochener, platter, spitzovaler Griff, Taf. 275:2 Mitte, 275:3, 5.
II. RECHTECKIGER BART. ROHR Abb. 24:1 II A:l Platter Bart, gerade abgeschnitten. Kreisförmi ger Rahmengriff.
II B:l Bart gerade abgeschnitten, mit Zapfen. Kreis-förmiger Rahmengriff.
III. RECHTECKIGER BART MIT LOCH. Schlüssel zum Vorhängeschloss Abb. 24:2
III A:l Platter Bart. Kreisförmiger Ringgriff. III A:2 Platter Bart. Spulenförmiger Griff, Taf. 274:2
Mitte u. rechts. III A:3 Platter Bart. Flacher Griff. III A:4 Platter Bart. Korbförmiger Griff, Taf. 274:3.
IV. BART MIT ZWEI ODER DREI ZÄHNEN Abb. 24:2
IV A:l Schaft einmal rechtwinklig abgebogen. Spitz- ovaler Rahmengriff. IV B:l Schaft zweifach
abgewinkelt. Flacher Griff.
V. SCHLÜSSEL MIT BESONDEREM BART
SCHLÜSSEL, DENEN DER BART FEHLT, oder die so fragmentarisch sind, dass sie in keine Gruppe eingereiht werden können.
VERSCHOLLENE SCHLÜSSEL
3. Beschreibung der Schlüssel
3.1. Gruppe I. Rechteckiger Bart. Stift
Das Hauptkennzeichen dieser Gruppe ist der Stift. Es gibt 16 Schlüssel mit Stift, von denen 14 nach Typen eingeteilt sind, zwei sind nicht sicher in eine Untergruppe einzuordnen. Der rechteckige Bart ist platt oder mit Zapfen versehen, gerade abgeschnitten oder zugespitzt. Die Form des Griffs ist verschieden.
1A:1 Der Schlüssel aus Bj 504 (Taf. 275:1) hat platten Bart, rechtwinklig abgeschnitten. Der durchbrochene Griff stellt zwei gegenständige Vögel dar. Der Schlüssel aus Bronze hat einen schwach ausgebildeten Stift.
IA:2 Diese Unterabteilung unterscheidet sich von der vorhergehenden durch die Form des Griffs, hier ein spitzovaler Rahmengriff. Der Bart ist platt und gerade abgeschnitten. Der Schlüssel aus Bj 759 hat eine Kerbe an der Seite der Kante. Der Bart des Schlüssels aus Bj 954 ähnelt dem eben genannten, aber er hat keinen Griff. Arbman vergleicht ihn mit Taf. 267:3, da aber der Schlüssel einen Stift hat, erinnert er eher an Taf. 274:2 (Bj 759). Er sollte daher in diese Unterabteilung eingereiht werden. Die Schlüssel aus Bj 739 und 759 sind aus Eisen. Der Schlüssel aus Bj 854 hat einen Bart aus Eisen, während der Griff aus Bronze ist. Nach der Zeichnung Birka I, Abb. 275, hat der Bart Kerben, eine
Schlüssel 125 Abb. 24:2.
Schlüsseltypen. III:AI Bj 1044; III:A2 Bj 562; III:A3 Bj 758; III:A4 Bj 1142B; IV:A1 Bj 607; IV:B1 Bj 24B; V: Bj 1083.
Skala 3:4.
126 Anna Ulfhielm
an der Oberkante gleich neben dem Schaft, eine in der Mitte der Unterkante. Der Schlüssel aus Bj 96 ist so fragmentarisch, dass man seinen Typ nicht feststellen kann. Arbman vergleicht ihn mit Taf. 265:2 (Bj 739).
IA:3 Der platte Griff wird nach unten zu schmaler, zu oberst hat er ein Loch. Der Schlüssel aus Bj 971 hat einen platten Bart, der gerade abgeschnitten ist und in der Mitte ein Loch hat. Der Schlüssel besteht aus Eisen.
1 B:l Der Schlüssel aus Bj 1083 (Taf. 269:3 rechts) unterscheidet sich von dem Schlüssel unter I A:l durch den zugespitzten Bart. Der durchbrochene, ovale Griff ist der Länge nach in Hohlmeisselform schwach gebogen. Der Bart hat ein kreuzförmiges Loch in der Mitte. Der Schlüssel besteht aus Bronze.
1 B:2 Platter, zugespitzter Bart. Spitzovaler Rahmengriff ohne Verzierung. Der Bronzeschlüssel aus Bj 820 (Taf. 275:6) hat auf der einen Seite des Bartes fünf eingestanzte Kreuze. Der Schlüssel, Bj 739 (Taf. 265:2 rechts) hat einen Ausschnitt in der Mitte des Bartes, die Öffnung an der Unterkante kann ein Schaden sein. An der Oberkante aussen sitzt ein Zapfen. Der Schlüssel ist aus Bronze hergestellt.
/ C:l Zwei Schlüssel aus Bj 526 (Taf. 275:2) sind identisch. Der Bart hat zwei Zapfen, ein rundes Loch in der Mitte und eine Kerbe an der Unterseite, er ist gerade abgeschnitten. Beide Griffe (beschädigt) sind oval, mit runden Löchern durchbrochen. Der Schlüssel aus Bj 1079 (Taf. 275:4) hat einen ringförmigen, durchbrochenen Griff, der beschädigt ist. Nach Arbman ergab die Durchbrechung ursprünglich eine Tierfigur. Der Bart hat zwei kaum wahrnehmbare Zapfen (nach Arbman ursprünglich drei). Die Schlüssel sind aus Bronze gearbeitet.
/ C:2 Zugespitzter Bart mit drei Zapfen. Der Schlüssel aus Bj 462 (Taf. 275:3) hat ein rechteckiges Loch im Bart. Der Griff ist spitzoval und durchbrochen. Arbman meint, bei Bj 462 könne er zwei gegenständige Vögel erkennen. Der Schlüssel aus Bj 24B (Taf. 275:5) hat zwei Paar am Griffrahmen seitlich vorstehende Ösen, und am Schaft steht beiderseits ein Haken vor. Die Schlüssel bestehen aus Bronze.
3.2. Gruppe II Rechteckiger Bart. Rohr
Hauptkennzeichen der Gruppe ist das Rohr der Schlüssel. Es gibt dreizehn Schlüssel mit Rohr, von denen zehn auf die Typen verteilt sind, während drei keiner Unterabteilung zugeordnet werden konnten, weil vom Bart nicht mehr genug vorhanden ist. Der rechteckige, gerade abgeschnittene Bart ist platt oder mit Zapfen versehen. Die Griffe sind kreisförmige Ringgriffe. Die Schlüssel bestehen aus Eisen.
II A:l Der Bart ist rechteckig, platt und ohne Löcher. Eine Ausnahme bildet der Schlüssel aus Bj 559, er hat ein rundes Loch in der Mitte des Bartes und eine Kerbe an seiner Unterkante. Am Schlüssel aus Bj 733 sieht man die Andeutung einer Kerbe an der Unterkante des Bartes.
Nach Arbman gleichen zwei Schlüssel mit beschädigtem Bart (Bj 825 und 831) dem Schlüssel aus Bj 968 (Taf. 274:7). Da sie ein Rohr haben, gehören sie eindeutig zur Gruppe II, nur kann man sie typmässig nicht näher bestimmen, weil der Bart beschädigt ist.
II B:l Rechteckiger platter Bart ohne Löcher, mit zwei Zapfen an der einen Seite.
Der Schlüssel aus Bj 557 ist mit Rohr versehen. Da ein Stück des Schaftes und der ganze Bart fehlen, kann man ihn typmässig nicht näher als zur Gruppe II gehörig bestimmen.
3.3. Gruppe III Rechteckiger Bart mit Loch. Schlüssel zu Vorhängeschlössern
Kennzeichen dieser Gruppe ist es, dass der Bart mit Löchern versehen ist. Er ist platt, rechteckig, in einigen Fällen fast quadratisch. Die Löcher haben verschiedene Form: kreisrund, quadratisch, rechteckig, T-förmig. Häufig ist ein T-förmiges Loch mit zwei rechteckigen kombiniert (Taf. 274:2, 3). Da der Bart aus Eisen ist, hat er oft bedeutende Rostschäden oder es fehlen Teile. Die Schlüssel Hessen sich nicht auf Grund der Löcher des Bartes in Untergruppen einteilen, da das ursprüngliche Aussehen schwer zu erkennen ist. Die Griffe sind sehr verschieden, es gibt vier Varianten (A:l-4 unten).
III A.1 Kreisförmiger Rahmengriff aus Eisen. Der Bart ist schlecht erhalten. Bei den Schlüsseln aus Bj
212 und Bj 1044 ist gleich oberhalb des Bartes ein Bronzeband um den Schaft gewickelt.
Bei dem Schlüssel aus Bj 985 fehlt der Griff, aber ein Ansatz dazu ist erhalten (Taf. 274:6). Nach Arbman soll dieser Schlüssel einen Griff mit einem Bronzeband am unteren Ende gehabt haben, Typ Taf. 272:2. Dieser fehlt heute. Nach dem Bart ist der Schlüssel mit Sicherheit in die Gruppe III einzuordnen, da aber der Griff fehlt, kann man seinen Typ nicht näher bestimmen. Der Schlüssel aus Bj 308 war schon 1942 verschollen (Birka I). Arbman vergleicht ihn mit Taf. 272:2, in welchem Falle er zur Unterabteilung III A:l gehören würde.
III A:2 Spulenförmige Griffe aus Bronze, verziert oder unverziert, oben mit einer Öse. Das Ornament am Schlüssel aus 562 zeigt drei stilisierte Vögel (Taf. 273:3), die jedoch undeutlich sind (Abb. 134).
Die Schlüsselgriffe aus Bj 797 und 893 gleichen dem aus Bj 562. Auch hier ist die Ornamentik schlecht erhal-
Schlüssel 127
ten. Arbman vergleicht die Schlüssel mit Taf. 273:3. Ein weiterer spulenförmiger Griff aus Bronze liegt vor (Bj 807), den Arbman mit Taf. 274:2 vergleicht, da er völlig glatt ist. Die letzten drei Griffe haben Eisenreste an der Unterkante, was ebenfalls darauf deutet, dass sie zur Gruppe III gehören können. Der Schlüssel aus Bj 738 ist vollständig verrostet, Arbman vergleicht ihn jedoch mit Taf. 273:3.
III A:3 Platter Griff aus Eisen, der nach unten schmaler wird. Am oberen Ende gibt es ein Loch.
Es ist ungewiss, ob der Schlüssel aus Bj 746 dieser Unterabteilung zugeordnet werden kann, da Oberteil und Griff fehlen. Nach Arbman gehört er zum Typ, Taf. 274:5.
III A:4 Korbgriff aus vier Eisenzainen, die oben und unten von einem Eisenband zusammengehalten wer den. Der Griff schliesst oben mit einer Öse ab. Der Schlüssel aus Bj 759 hat am Bart fünf nahezu kreisför mig angebrachte, rechteckige Löcher und ein rundes Loch.
Von den Schlüsseln aus Bj 55 und 449 ist nur der Bart und der Ansatz für den Handgriff erhalten. Der Bart ist rechteckig mit Löchern, und dazu mit Kerben an den Kanten. Da die Schlüssel nicht vollständig sind, können sie in keine Unterabteilung eingeordnet werden, zweifellos gehören sie aber zur Gruppe III. Der Schlüssel aus Bj 777 fehlt. Nach Arbman war der Bart erhalten, sowie ein Bronzeband für den Griff oberhalb des Bartes. Der Bart soll nach Arbman vom Typ der Taf. 274:3 gewesen sein.
3.4. Gruppe IV Bart mit Zähnen
Kennzeichen der Gruppe sind die Zähne am Bart des Schlüssels. Da an mehreren Schlüsseln einer oder mehrere von diesen fehlen, kann man sie nicht nach der Zahl der Zähne in Typen einteilen. Die Schlüssel sind aus Eisen hergestellt.
IV A:l Der Schaft ist einmal abgewinkelt. Der Griff ist ein spitzovaler Rahmengriff, der zur Rückseite des Schlüssels umgebogen ist. Der Bart kann zwei Zähne (Taf. 275:7) oder drei Zähne haben (Taf. 275:9).
Es ist unsicher, ob es sich bei dem Gegenstand aus Bj 625 (Taf. 275:8) wirklich um einen Schlüssel handelt. Er hat keine Zähne, und nichts deutet darauf, dass er welche gehabt hat. Der Schaft hat quadratischen Querschnitt und läuft flach rechteckig aus ähnlich wie ein Schraubenzieher. Er ist einmal gewinkelt, wodurch der Gegenstand einem Schlüssel gleicht.
Von dem Schlüssel aus Bj 623 ist nur der Bart mit zwei Zähnen und ein Stück des Schaftes erhalten. Arbman vergleicht ihn mit dem auf Taf. 275:9. Da der Schaft unvollständig ist und nicht gewinkelt ist, kann er
keinem Typ der Gruppe IV näher zugeordnet werden. -Von dem Schlüssel aus Bj 835 ist nur der Griff und ein Stück des Bartes erhalten. Arbman vergleicht ihn mit dem auf Taf. 275:9.
IV B:l Der Schaft ist zweimal abgewinkelt. Der Griff ist platt, entweder rechteckig, fast quadratisch (Abb. 308, S. 357) oder ellipsenförmig (Taf. 268:2). Der obere Abschluss besteht entweder aus einem Teil mit einem runden Loch (Taf. 267:1) oder aus einer Öse (Abb. 53:4). Der Bart hat zwei Zapfen (Taf. 267:3) oder drei Zapfen (Taf. 267:1).
Vom dem Schlüssel aus Bj 983 ist nur noch der Schaft erhalten, Arbman rechnet ihn aber zum Typ, Taf. 267:3.
Von den Schlüsseln aus Bj 64 und Bj 758 ist nur der Bart und der Schaft bis zum ersten Winkel erhalten. Arbman rechnet sie zum Typ, Taf. 267:3. Da der Schaft in diesen Fällen beschädigt ist, ist die Einordnung in eine Unterabteilung unsicher. Der Schlüssel aus Bj 968 ist abhanden gekommen, Arbman hat ihn dem Typ, Taf. 267:3 untergeordnet.
3.5. Gruppe V. Schlüssel mit besonderem Bart
In diese Gruppe haben wir drei Schlüssel eingeordnet. Der Schlüssel aus Bj 708 (Taf. 269:2) hat ein Rohr mit wesentlich kleinerem Durchmesser als bei den übrigen Schlüsseln mit Rohr. Der Griff ist ein ovaler Ringgriff. Es ist ungewiss, ob der Bart vollständig ist. Er hat auf den einen Seite zwei quer verlaufende Rinnen. Der Schlüssel besteht aus Eisen. - Der Schlüssel aus Bj 860A hat einen ovalen Ringgriff. Der Bart ist gerade abgeschnitten, aber etwas beschädigt, an der Unterkante gibt es wenigstens zwei Kerben. Arbman vergleicht den Schlüssel mit Taf. 274:7, der zur Gruppe II A:l gehört, der Schlüssel hat jedoch weder Schaft noch Rohr, weshalb er nicht in die Gruppen I oder II eingeordnet werden kann. - Der Schlüssel aus Bj 1083 (Taf. 269:3 links) hat einen ovalen Rahmengriff mit einem Band oberhalb des Bartes. Der Schlüssel hat einen Stift. Der Bart unterscheidet sich vollständig von den Bärten aller übrigen Schlüssel auf Björkö. Er hat eine Kerbe in der Oberkante, und zwei in der Unterkante, was dem Bart die Form eines wellenförmigen Zains gibt. Am äusseren Ende ist der Zain vielleicht abgenutzt (?). Der Schlüssel besteht aus Bronze.
3.6. Schlüssel, die keinen Bart haben, fragmentarisch oder verloren gegangen sind
Ausser den Schlüsseln unter 3.1-3.5 gibt es siebzehn weitere Schlüssel in den Funden. Sieben davon fehlen
128 Anna Ulfhielm
(Bj 714, 739, 950 (2 Ex.), 967, 1083 (2 Ex.)). Der einzige von den übrigen zehn Schlüsseln, der so gut erhaltene Details hat, dass er verdient, hier erwähnt zu werden, ist der Schlüssel aus Bj 639 (Taf. 260:3). Er lag auf einem Kasten. Nur der durchbrochene Bronzegriff ist erhalten, er ist mit karolingischen Greiftieren verziert. Der Bart aus Eisen ist verrostet.
4. Die Lage der Schlüssel in den Gräbern
In den drei Varianten der Körpergräber - Kammergrab, Sarggrab und Schachtgrab - ist die Lage des Schlüssels verschieden. Er befand sich auf dem Körper oder an verschiedenen Stellen abseits von demselben. Auf dem Körper ist sein Platz gewöhnlich auf der Brust oder dem Unterkörper. Er muss an einer Kette oder einem Band gehangen haben. Schlüssel mit einer Kette daran hat man nicht gefunden, aber Reste von Ketten lagen in der Nähe von sieben Schlüsseln (Typ III und IV). Auf Gotland kommen Kettenreste an Schlüsseln häufig vor (Ulfhielm 1987:24).
4.1. Gräber mit Kästen
Kästen und Schlüssel zusammen gab es in achtzehn Grä-bern, elf davon sind Kammergräber, drei sind Sarggräber, zwei Schachtgräber und zwei Brandgräber. Insgesamt gibt es 26 Schlüssel in diesen Gräbern, fünf von Typ I, zwei von Typ II, sechs von Typ III, fünf von Typ IV, zwei von Typ V, und sechs, die sich nicht in Typen einteilen lassen. Die Kombination von Schlüssel und Schloss kommt in vier Kammergräbern vor. Alle drei Gegenstände, Kasten, Schloss und Schlüssel zugleich, kommen nur in zwei Kammergräbern vor. - Nur in 11 Fällen lässt sich mit Wahrscheinlichkeit feststellen, dass ein Schlüssel zu einem Kasten gehört.
In den Kammergräbern gibt es meistens Schlüssel von Typ I und IV (jeweils vier Schlüssel von insgesamt fünf). In den Sarggräbern lagen vor allem Schlüssel von Typ III (drei Schlüssel von insgesamt sechs).
14 Gräber sind Frauengräber, zwei sind Männergräber (Kammergräber), zwei Gräber können nicht nach dem Geschlecht bestimmt werden.
Acht Schlüssel aus Frauengräbern und zwei Schlüssel aus einem Männergrab lagen abseits vom Körper, am Fussende oder rechts vom Körper. Sie gehören hauptsächlich zu Typ I und IV. Alle zehn stammen aus Kammergräbern.
Nur drei weitere Schlüssel aus Frauengräbern lagen
abseits vom Körper, diese kommen jedoch aus Gräbern ohne Kästen oder Kastenspuren. Alle drei Schlüssel sind vom Typ II. Einer derselben lag nach Arbman auf einer Eichenplatte zusammen mit einem Schlosschild. Arwidsson hält es für wahrscheinlich, dass der Schlüssel zu einem Kasten gehört hat, der unter einer runden Schachtel mit einem Eichendeckel gestanden hat. Sie stellt fest, dass das auf dem Schlosschild angebrachte, schräge „Schlüsselloch" unsicher ist und nicht zu dem gefundenen Schlüssel passt (s. Kap. 14:5.2.).
Die übrigen vier Schlüssel aus Kammergräbern für Frauen liegen alle auf dem Unterkörper oder auf der rechten Körperhälfte. Auch die Schlüssel aus dem Männergrab, Bj 746 hat diese Lage.
Die Schlüssel aus den drei Sarggräbern (Frauengräber) liegen alle auf dem Körper.
Die Lage der Schlüssel aus Schachtgräbern ist unbekannt.
4.2. Frauengräber
46 Gräber sind Frauengräber. Neun davon sind Brand-gräber, die ich im Abschnitt 4.5. bespreche.
Sechs Frauen sind in Schachtgräbern beigesetzt, in jedem derselben liegt ein Schlüssel, wobei alle Schlüsseltypen vertreten sind. Drei liegen auf der Brust oder auf dem Unterkörper, neben einem Eisenmesser. In zwei Gräbern gibt es auch eine Eisenschere. Der sechste Schlüssel (Typ IV) lag am Fussende zusammen mit Eisenfragmenten.
Zwölf Frauen sind in Särgen beigesetzt. In diesen Gräbern lagen insgesamt siebzehn Schlüssel, zwei davon vom Typ I, drei vom Typ II, sechs vom Typ III, zwei vom Typ IV und zwei, deren Typ nicht bestimmt werden kann. Elf Schlüssel lagen in der Brustgegend, ein wenig nach links. Fünf der sechs Schlüssel von Typ III hatten diese Lage. Drei Schlüssel lagen auf dem Unterkörper und drei weitere zwischen Knie- und Fusshöhe. Die beiden Schlüssel vom Typ IV liegen ca. 0,1 m neben dem Körper am linken Knie, bzw. an der rechten Schulter. Keiner der siebzehn Schlüssel liegt mehr als 0,15 m vom Körper entfernt. Neben sieben Schlüsseln liegen Eisenmesser. Von den beiden Schlüsseln von Typ IV liegt der eine für sich, der andere bei einem Eimerhenkel.
Neunzehn Frauen sind in Kammergräbern begraben, in denen es insgesamt 29 Schlüssel gibt. Von diesen sind sechs unauffindbar und zwei können in keine Gruppe eingeordnet werden. Typ I und Typ II kommen mit je sechs Schlüsseln am häufigsten vor. Kein Schlüssel lag weiter oben als die ovalen Schalenspangen. Ausnahmen sind zwei Schlüssel (Typ II und IV), die auf einem
Schlüssel 129
Kasten oberhalb des Kopfes lagen (Bj 750 und 965). Die Schlüssel liegen in gleichmässiger Verteilung auf dem Körper oder daneben. Fünf der Schlüssel wurden zusammen mit Eisenmessern gefunden, ein lag am linken Oberschenkel zusammen mit einer Eisenschere und einem Eisengewichten.
4.3. Männergräber
Von den fünf Männergräbern mit Schlüsseln sind vier Kammergräber, das fünfte Grab ist ein Sarggrab. In drei Fällen liegen Schlüssel von Typ III auf dem Körper, zusammen mit einem Eisenmesser und einem Wetzstein. Zwei Schlüssel, Typ IV und V, wurden in einem Kasten am Fussende gefunden (Bj 708). Ein Schlüssel lag in einem Doppelgrab (Bj 750) für einen Mann und eine Frau. Der Schlüssel lag oberhalb der Köpfe, rechts vom Mann in einem Werkzeugkasten.
4.4. Kindergräber
Von den sieben Kindergräbern ist eins ein Kammergrab, fünf Gräber sind Sarggräber und eins ist ein Schachtgrab. In einem Grab (Bj 733) lagen zwei Schlüssel (Typ II und IV). Alle vier Typen von Schlüsseln kommen vor. In vier Fällen liegen Teile des Schlüssels auf dem Körper. Drei Schlüssel (Typ I und II) wurden mit einem Eisenmesser zusammen gefunden. Der vierte Schlüssel (Typ IV) lag am Fussende neben einem Eimerhenkel.
4.5. Brandgräber
Es gibt 21 Brandgräber, in denen je ein Schlüssel gefunden wurde. Neun der Gräber sind Frauengräber, eins ist ein Männergrab. Bei den übrigen ist das Geschlecht nicht feststellbar. Am häufigsten kommt der Schlüssel von Typ IV vor, und zwar in acht Gräbern (38%). Schlüssel vom Typ III kommen in fünf Brandgräbern vor (24 %), vom Typ I in vier Gräbern (19 %) und Typ II in einem Grab (5%). Drei Schlüssel (14%) können keinem Typ zugeteilt werden. Eins dieser Brandgräber (Bj 24 A, Schlüsseltyp IV) enthält ausserdem Schlossteile. In Brandgräbern kommen Messer weniger häufig vor (sieben Gräber, 33%), als in den übrigen Gräbertypen (47 Gräber, 87%).
4.6. Zusammenfassung
Schlüssel vom Typ I gehören zu Frauengräbern (Ausnahme: ein Schlüssel in einem Kindergrab) und sie
lagen auf der Brust oder dem Unterkörper. Zwei Schlüssel hat man rechts vom Körper auf je einem Kasten gefunden. Der Schlüsseltyp I ist am häufigsten in Kammergräbern.
Schlüssel vom Typ II gehören zu Frauengräbern (Ausnahmen: zwei Schlüssel in Kindergräbern) und sie lagen auf der Brust oder zur linken Seite des Körpers, von über der Kopfhöhe bis zu Fusshöhe und darunter. Der Schlüsseltyp kommt gleich häufig in Kammergräbern wie in Sarggräbern vor.
Schlüssel vom Typ III hat man bei Frauen, Männern und Kindern gefunden. Von den sechs Schlüsseln aus Männergräbern gehören vier zum Typ III. Bei Frauen lagen diese Schlüssel auf der Brust oder dem Unterkörper. Auch bei den Männern lagen sie auf dem Unterkörper. Der Schlüsseltyp verteilt sich gleichmässig auf die vier Grabformen.
Schlüssel vom Typ IV kommen in Frauengräbern vor (Ausnahmen: ein Schlüssel aus einem Männergrab, zwei aus Kindergräbern). Die meisten Schlüssel wurden auf dem Unterkörper liegend gefunden. Drei Schlüssel lagen rechts vom Körper, zwei von denen auf je einem Kasten. Der Schlüsseltyp verteilt sich gleichmässig auf Kammergräber und Brandgräber.
5.1. Bronzeschlüssel
Von den 92 Schlüsseln aus den Gräbern auf Björkö bestehen 23 (25 %) ganz oder teilweise aus Bronze.
Elf Schlüssel sind ganz aus Bronze hergestellt. Zehn davon gehören zum Typ I, der elfte zum Typ V.
An neun Schlüsseln besteht der Griff aus Bronze, sieben davon gehören zum Typ III, einer ist vom Typ I und einer hat keinen Bart, kann also keinem Typ zugeordnet werden.
Drei Schlüssel haben ein Bronzeband, das um den Schaft gewunden ist, gleich oberhalb des Bartes. Zwei gehören zu Typ III, der dritte kann unter keinen Typ eingeordnet werden.
Von den 23 Schlüsseln, die ganz oder teilweise aus Bronze bestehen, gehören also elf zu Typ I, neun zu Typ III, einer zu Typ V, zwei sind unbestimmbar.
Zehn der elf Schlüssel von Typ I sind vollständig aus Bronze hergestellt, und bei Typ III haben sieben von neun Schlüsseln Bronzegriffe.
Die Verteilung auf die vier Gräbertypen ist ziemlich gleichmässig: die Bronzeschlüssel kommen aus sieben Kammergräbern, vier Sarggräbern, vier Schachtgräbern und fünf Brandgräbern. In den Kammer- und Brandgräbern überwiegen Schlüssel von Typ I und in den Sarg-und Schachtgräbern überwiegt der Typ III.
Von den 75 Gräbern mit Schlüsselfunden sind sechs
Schlüssel 131
auf die ÄBS zu datieren. In drei dieser sechs Gräber lag je ein Bronzeschlüssel vom Typ I (Bj 462, 504, 854), in einem Grab (Bj 526) hat man drei Bronzeschlüssel vom Typ I gefunden. Die ganz aus Bronze bestehenden Schlüssel sind gegossen. An den Schlüsseln, die einen Bronzegriff haben und deren Schaft und Bart aus Eisen besteht, besteht der Griff aus Bronzeguss, während Schaft und Bart aus Schmiedeeisen sind.
Die elf ganz aus Bronze hergestellten Schlüssel reprä-sentieren 12 % der Gesamtzahl der auf Björkö in den Gräbern gefundenen Schlüssel. Von den 103 Schlüsseln, die auf Gotland in Kombination mit tierkopfförmigen Spangen gefunden wurden, waren 55 (d.h. 53%) ganz aus Bronze (Ulfhielm 1986). Schlüssel ganz aus Eisen sind in den Funden von Björkö 69, auf Gotland 17
(75% bzw. 17%). Das Verhältnis von Bronze- zu Eisenschlüsseln beträgt also 0,2 auf Björkö, und nicht weniger als 3,2 auf Gotland. Die Schlüssel von Björkö und Gotland stammen ungefähr aus derselben Periode.
6.1 Die Verteilung der Schlüssel auf die Gräberfeldbezirke Abb. 24:3-4
Die meisten Schlüssel (73 Ex.) hat man in den Gräbern von Hemlanden gefunden (Bezirke 1A-F). Im Gräberbezirk 1A liegen sie innerhalb des Stadtwalls, im Bezirk 1C ausserhalb desselben. In diesen beiden Bezirken zusammen liegt mehr als die Hälfte (16 + 24) der insgesamt 75 Gräber. 58 Schlüssel (63 %) sind hier gefunden.
132 Anna Ulfhielm
Anm. Die Schlüssel aus Bj 902 (IV) und Bj 1102 (III) sind nicht eingezeichnet, da die Lage der Gräber unbekannt ist. Die Schlüssel aus Bj 24A (IV), 24B (I) und 158 (-) sin in 1B oder 1C gefunden. Die Schlüssel aus Bj 1125B (III) und Bj 1142B (III) lagen in 1B. Die Schlüssel aus Bj 758 (III, IV) lagen in 1C. Da die Lage dieser Gräber unsicher ist, sind die Schlüssel auf den Karten nicht eingezeichnet.
Abb. 24:4. Gräber mit Schlüsseln in den Gräberbezirken 1A, 1B und 1C.
25. Die Vorhängeschlösser
Taf. 273:1-7 Abb. 25:1
Jan-Erik Tomtlund
1.1. Einleitung
Für eine Analyse der Verwendung von Vorhängeschlössern dürften die acht Exemplare aus den Gräbern von Birka ergiebig sein. Leider vermitteln die Fundverhältnisse in diesen Gräbern jedoch keine Kenntnis ihrer Verwendung im täglichen Leben.
1.2. Die in Birka und drei mittelschwedischen Bootsgräbern vertretenen Typen
Zwei Typen von Vorhängeschlössern lassen sich unter-scheiden. Beide sind als sog. Bolzenschloss konstruiert, bei dem der Bügel des Vorhängeschlosses mit den zugehörigen Verschlussfedern aus dem Schlossgehäuse herausgezogen wird. Ein solcher Bügel ist auf Taf. 273:7 abgebildet.
Typ 1 ist ein Vorhängeschloss mit einem Drehschlüs-selmechanismus, wie auf Taf. 273:6, bei dem die Drehung des Schlüssels die Feder zusammenpresst, die am unteren Teil des Schlossbügels befestigt ist.
Typ 2 ist ein Vorhängeschloss mit einem Schlüsselme-chanismus zum Verschieben: man steckt den Schlüssel in ein Schlüsselloch in Form eines auf den Kopf gestellten T's und schiebt ihn nach oben. Dadurch werden die Federn des Bügels zusammengepresst und man kann ihn aus dem Schlossgehäuse herausziehen. Zwei Varianten dieses Schlosses sind zu unterscheiden: Typ 2A (Taf. 273:4-5) vertritt eine kleinere, einfache Form, Typ 2B (Taf. 273:1-2) ist die stärkere Variante mit verstärktem Schlossgehäuse und einem komplizierteren Verschlussmechanismus.
1.3. Die Fundverhältnisse in den Gräbern von Birka
In der Grabfüllung von Bj 110 fand man ein kleines Vorhängeschloss ohne Bügel, das wohl aufgebrochen zu sein schien.
Ein weiteres Vorhängeschloss ohne Bügel, das auch aufgebrochen zu sein schien, lag in Bj 737 (Taf. 273:4). Dies Grab enthielt ein Doppelbegräbnis für einen Mann und ein Kind, beide waren Skelettgräber. Sie waren von einer Aschenschicht bedeckt, in der u.a. vielleicht das
Schloss lag, was möglicherweise so zu deuten wäre, dass die Niederlegung des Schlosses zu einer magischen Handlung des Beisetzungsrituals gehört hätte.
Drei der Schlösser lagen in Brandgräbern, bei denen das Geschlecht des Toten nicht bestimmbar war.
Aus dem Grab Bj 187 kommt ein Gegenstand, den Arbman als Sperrfederfragment (?) eines Vorhängeschlosses deutet. In dem Falle wäre die Feder vom Typ 2 (s. Tomtlund 1972, 18, Abb. 6), und zwar die kompliziertere Variante 2B.
Bj 305 (Taf. 273:7) enthielt den kompletten Mechanismus eines Drehschlosses, den Bügel mit einer Verlängerung und einfacher Feder.
Bj 1001 (Taf. 273:6) enthielt ein Schlossgehäuse aus Bronze mit Schlüsselloch für einen Drehschlüssel. Hin-sichtlich der Grösse scheinen der vorige Bügel und dies Schlossgehäuse wie für einander hergestellt zu sein, sie würden zusammenpassen.
Die drei übrigen Schlösser sind mehr oder weniger vollständig. Am besten erhalten ist das aus Bj 523 (Taf. 273:1). Es ist ein grosses und schön gearbeitetes Schloss vom Typ 2B, das mit unbeschädigtem Bügel verschlossen ist. Es wurde in einem Kammergrab für eine Frau angetroffen, wo es abseits, zusammen mit einem nicht mehr vorhandenen Silberbandfragment lag, westlich des Skeletts.
Bj 562 (Taf. 273:2) war ebenfalls ein Kammergrab, aber für einen Mann. Das Schloss vom Typ 2B scheint aufgebrochen gewesen zu sein. Der Bügel war abgebrochen und der Boden des Gehäuses fehlte, sodass man an den Federmechanismus herankam. Das Schloss lag an der Südwand der Kammer. Obwohl es aufgebrochen zu sein scheint, ist dies das einzige Vorhängeschloss von Birka, das mit einem passenden Schlüssel aufgefunden wurde. Der Schlüssel (Taf. 273:3), der neben dem Vorhängeschloss lag, schien in das Schloss zu passen.
In Bj 948, einem Skelettgrab eines kleinen Mädchens, lag ein Schloss. Neben einem Messer lag auf der einen Seite das Schloss, auf der anderen eine Schelle. Der Bügel des Schlosses ist unbeschädigt, aber da die Seite mit dem Schlüsselloch fehlt, ist es möglich, dass man das Schloss einst aufgebrochen hat.
134 Jan-Erik Tomtlund
1.4. Vorhängeschlösser aus Bootgräbern
Dass in drei schwedischen Bootgräbern Vorhängeschlösser gefunden wurden, ist interessant, da man ausserhalb von Birka vergleichsweise wenige Gräber angetroffen hat, die mit Vorhängeschlössern ausgestattet waren.
Ein Schloss der komplizierteren Variante, Typ 2B, bei dem der Bügel weggenommen ist, gab es im Anschluss an Grab III in Tuna, Alsike (Arne 1934, Taf. VII: 3), wo man das Schlossgehäuse im östlichen Teil des untersuchten Schachtes fand.
Aus Valsgärde 121 kommt ein Schloss mit Schlüssel vom gleichen Typ. Das Vorhängeschloss lag im zentralen Teil des Grabes neben dem Henkel und den Beschlägen zu einem Eimer und einem Schrein. Das Schlossgehäuse war beschädigt und der Bügel abgebrochen. Neben dem Toten fand man den Schlüssel zu dem Schloss.
Schliesslich gibt es ein drittes Vorhängeschloss vom Typ 2 B aus einem verbrannten Bootgrab in Järvsta, Ksp. Vallbo, Gästrikland (Bellander 1934, 78ff.).
2.1. Zerbrochene Schlösser
Von den sechs Schlössern aus Birka, die man als Grabfunde bezeichnen kann, war nur eins ohne Zeichen von Beschädigung. Ein Schloss war mit einem Schlüssel ver-sehen, aber es schien trotzdem aufgebrochen zu sein (Bj 562). In den Gräbern gab es nichts, was man mit diesen Schlössern hätte verschliessen können. Unter den Boot-gräberfunden lag nur das Exemplar von Valsgärde in einem solchen Zusammenhang, dass es im Gebrauch gewesen sein kann, aber in Anbetracht der daran vorliegenden Schäden kann es ebenfalls aufgebrochen gewesen sein. Wie in Bj 562 gibt es hier einen zu dem Schloss passenden Schlüssel.
Es scheint, dass Vorhängeschlösser als Grabbeigaben in diesen, wie auch in anderen Fällen symbolische Bedeutung haben konnten2.
Bei den hier behandelten Beispielen hat es sich wahr-scheinlich um Exemplare gehandelt, die für den täglichen Gebrauch nicht mehr taugten. Meistens dürfte es sich um verlorene Schlüssel und deshalb aufgebrochene Schlösser handeln, in zwei Fällen hat man vielleicht den Schlüssel später wiedergefunden und ihn dann ebenfalls ins Grab gelegt.
Der Gebrauch von Vorhängeschlössern scheint sich
1 Ich danke Else Nordahl, die mir dies noch nicht veröffentlichte Schloss gezeigt hat.
2 Für diese Sitte gibt es tatsächlich Belege aus später Zeit. Branden burg 1869, 67, berichtet, dass man im westlichen Ural die Gewohnheit hatte, den Toten Vorhängeschlösser beizulegen. Und bei wiederhol tem Verlust von Kindern in einer Familie legte man ein verschlossenes Vorhängeschloss auf die Brust des verstorbenen Kindes, um den Tod daran zu hindern, weitere Opfer zu holen.
Abb. 25:1. Die Konstruktion eines Vorhängeschlosses mit dazu passendem Schlüssel. Zeichn. Verf. und E.L.A.
keineswegs auf eins der beiden Geschlechter beschränkt zu haben. In den Birkagräbern mit Vorhängeschloss liess sich das Geschlecht des Toten in drei Fällen bestimmen: sie lagen in einem Männergrab und zwei Frauengräbern. Dasselbe Verhältnis ergibt sich für Gräber ausserhalb Birkas, in denen Schlüssel zu Vorhängeschlössern lagen. Von den vierzehn Gräbern, bei denen sich das Geschlecht des Toten bestimmen liess, waren elf Frauengräber, zwei sichere Männergräber und eins ein unsicheres Männergrab.
2.2. Wie wurden die Schlösser verwendet?
Aber wozu wurden die Vorhängeschlösser im täglichen Leben verwendet? Die grösseren und stärkeren Schlösser können sehr wohl zum Verschluss von Truhen und Schreinen gedient haben, aber ihre Funktion muss auch im Zusammenhang mit der Verbreitung der ältesten schwedischen Funde von Vorhängeschlössern betrachtet werden. Unter den Gräberfunden überwiegen die Exemplare von Birka, während die drei Funde in Bootsgräbern zwar interessant, aber doch peripher sind. Bei Ausgrabungen von Siedlungen sind grössere Fundmengen aus der Schwarzen Erde von Birka und auf Helgö zu Tage gekommen (Tomtlund 1970, 244f.), Orte, die beide Hafen- und Handelsplätze waren. Auch von dem Hafen- und Handelsplatz Paviken auf Gotland kommen Teile mehrerer Vorhängeschlösser, die J. P. Lamm mir freundlicherweise zugänglich gemacht hat. Im Hinblick auf diesen Verbreitungsbefund ist es auch denkbar, dass die kleinsten und schwächsten Typen der Vorhängeschlösser, die auf Taf. 273:5-6 abgebildet sind, auch als mehrfach verwendbare Plombierung für bestimmte Warengruppen der Handelsplätze gedient haben können (Tomtlund 1978A, 13).
26. Löffel
Taf. 151:1-8, 166:2 (?) Abb. 26:1
Inga Lindeberg
1. Die Funde
Vollständige Löffel oder Teile davon kommen in neun Birka-Gräbern vor, ferner gibt es in zwei Gräbern, Bj 154 und 818, Fragmente aus Geweihknochen, die schwerer zu bestimmen sind, sie können Teile von Löffelstielen oder Beschläge sein. Löffel lagen sowohl in Skelettgräbern (Bj 644, 807, 823, 959) als auch in Brandgräbern (Bj 11A, 114, 129, 817, 1142B), die alle zu Hemlanden (Bezirke 1A-1D) gehören, mit Ausnahme von Bj 644, das zum Gräberfeld nördlich der Burg (Bezirk 2A) gehört. Männer- ebenso wie Frauengräber sind vertreten, die auf die JBS datiert werden.
Die Löffel sind in der Regel aus Geweihknochen her-gestellt. Auch hier stellt Bj 644 mit einem Löffel aus Eisen eine Ausnahme dar. In den meisten Fällen sind die Löffel verziert.
Nur in sehr wenigen Gräbern gibt es Angaben über die Lage der Löffel. In Bj 823 soll der Löffel jedoch zusammen mit einem Bronzegefäss und einigen Kastenbeschlägen zu Füssen der Toten gelegen haben.
2. Typen
Nach der Form des Löffelblatts können die Löffel aus Geweihknochen in zwei Typen eingeteilt werden, und zwar in Löffel mit rundlichem Blatt und solche mit spachteiförmigem Blatt.
sind so gut wie vollständig erhalten, Bj 823 und 959. Die sparsame Verzierung beschränkt sich bei dem ersteren auf eine auf dem Blatt mitt doppelten Rillen eingeschnittene birnenförmige Figur, bei dem letzteren auf Kerbschnittverzierung am Übergang zwischen Blatt und Stiel.
Die Fläche des birnenförmigen Löffelblatts aus Bj 817 ist mit Pünktchen verziert, es hat eine Flechtbandborte an der Kante entlang und eingeritzte einfache oder gegenständige Bogenmotive. Ähnliche Bogenmotive sind auch auf dem stark beschädigten Blatt aus Bj 807 wahrzunehmen. Ein intrikates Flechtbandmuster aus breiten und schmalen Bändern mit gestrichelten Zwischenräumen ist auf den Stielfragmenten aus Bj 11A zu sehen.
2.2. Spachteiförmige Löffel
Spachteiförmige Löffel haben ein flaches Blatt und einen abgefasten oder schwach gewölbten Stiel. Der Stiel des Spachtels aus Bj 129 hat ein einfaches Flechtbandmuster mit Vertiefungen in den Zwischenräumen. Auch das jetzt abgebrochene Blatt war verziert. Der Spachtel aus Bj 1142 B dagegen trägt keinerlei Verzierungen.
2.1. Löffel mit rundlichem Blatt
Das schwach konkave oder flache Blatt ist mehr oder weniger kreisrund bis birnenförmig. Die Vorderseite des Löffelstiels ist flach oder schwach gewölbt, die Rückseite ist seitlich abgefast oder flach. Zwei Löffel
2.3. Der eiserne Löffel
Der Löffel aus Bj 644 hat ein ovales Blatt mit Spuren von Vergoldung. Das Blatt schliesst mit einem kurzen Zain ab, was darauf deuten kann, dass der Stiel aus einem anderen Material bestand. Eine Parallele zu diesem Löffel kenne ich nicht. Der Löffel lag auf dem Deckel einer Waagendose, die ihrerseits auf einem Holzkasten stand.
136 Inga Lindeberg
3.1. Vergleichsmaterial
Es gibt sehr wenige Löffel aus der Wikingerzeit und den vorhergehenden Perioden. Funde der Wikingerzeit liegen im grossen Ganzen nur aus den Gräbern von Birka und der Schwarzen Erde vor. Die letzteren weisen zum Teil eine sehr variationsreiche Flechtbandornamentik auf dem Blatt und am Stiel auf (schöne Beispiele s. Stolpe 1876, Fig. 6-7, und Holmqvist 1957, Abb. 13). Dagegen hat man spachteiförmige Löffel aus Holz in Gräbern auf Gotland und in Västmanland gefunden (Barshaldershed, Ksp. Grötlingbo, und Tuna, Ksp. Badelunda, nicht veröffentlicht).
Vereinzelte Funde gibt es aus der Völkerwanderungszeit, aber diese Löffel haben eine besondere Form und Verzierung, die vollständig von der der Wikingerzeit abweicht. Im Grabhügel Ottars, „Ottarshögen", Ksp. Vendel, Uppland, lag ein Löffel aus Geweihknochen mit ovalem Blatt und dünnem, schmalem Stiel mit Linienverzierung (s. Lindqvist, 1936, 164f. und 214f. und Holmqvist 1957, 265 ff. mit Angaben über schwedisches und norwegisches Vergleichsmaterial).
3.2. Parallelen zur Flechtbandornamentik
Parallelen zu den Löffeln von Birka findet man in jüngeren Funden. Die frühmittelalterlichen Löffel aus Geweihknochen von Sigtuna stimmen in Form und Ver-zierung völlig mit ihnen überein (s. Holmqvist 1957, 268ff. und Abb. 7). Unter den schwedischen Funden scheinen Löffel mit Flechtbandverzierung also hauptsächlich im Mälartal in der späteren Wikingerzeit und im frühen Mittelalter vorzuliegen.
Kennzeichnend für die Verzierung einiger Löffel aus Birka ist das Flechtband. Dies Motiv kommt an sich allgemein in Skandinavien vor und hat hier alte Traditionen. Bei den Löffeln sind die Bänder jedoch in einer besonderen Form verflochten, die später für die Kunst in Lappland charakteristisch werden sollte. Daher müssen die Funde aus Birka und Sigtuna bei der Diskussion über Ursprung und Verbreitung des samischen Bandflechtmotivs selbstverständlich berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sei auf die neueren Beiträge von Zachrisson 1984 (mit Literaturangaben) und Fjell-ström 1985 hingewiesen.
Abb. 26:1. Zwei Birka-Löffeln. Aus Bj 823 (links) und aus der Schwarzen Erde (rechts). Ca. 3/4. Photo ATA und H. Faith Ell. Copyright ATA.
27. Die Münzen der Gräber von Birka
Birka I, Taf. 131, 137-143
Ein Kommentar von Greta Arwidsson
Nach der Veröffentlichung von Birka, Band I, in den Jahren 1940-1943 hat Brita Malmer die nordischen Münzen der Wikingerzeit bearbeitet und publiziert (1966). Ihr Bericht über die in den Gräbern von Birka gefundenen nordischen Münzen gründet sich auf eine genaue Analyse und Differenzierung der Typen aller bekannten Münzen der Kategorien, die lange als Birka-Münzen, bzw. Haithabu-Halbbrakteaten, bezeichnet wurden. Diese Bezeichnungen verwendete Holger Arbman durchgängig in Birka I (wie u.a. auch in Schweden und das karolingische Reich 1937), sie sollen in Zukunft aber von der von Brita Malmer eingeführten Gruppenbezeichnung ersetzt werden. Die nordischen Münzen der Gräber von Birka hat Brita Malmer in Nordiska mynt före år 1000 (1966, 278f.) zusammengestellt. Aus ihrer Tabelle 37 geht hervor, dass sie versucht hat, die Jahreszahlen der Münzen chronologisch zu bestimmen, wobei sie aber betonte, dass diese Aufstellung nur hypothetisch sei (1966, 245). In einem Kommentar, den sie mir freundlicherweise zugesandt hat, konstatiert sie, dass „sämtliche nordische Münzen der Gräber von Birka also zur ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts gehören, mit Ausnahme von acht Münzen, die etwa hundert Jahre jünger sind (aus den Gräbern Bj 735, 738, 847, 943 und 968).
Die in Birka I publizierten Bestimmungen der orien-talischen Münzen hatte Ulla Linder Welin ausgeführt. Sie setzte ihre Bearbeitung derselben fort, mit der Absicht, sie separat zu veröffentlichen. Es gelang ihr auch, eine grössere Anzahl der früher als „verschollen" oder „unbestimmbar" bezeichneten Münzen zu identifizieren und zu bestimmen.
Nach dem Tode Ulla Linder Welins im Jahre 1983 wurden einige weitere Münzen identifiziert im Rahmen der Bearbeitung aller orientalischen Münzen aus schwedischen Funden, die im Corpus Nummorum saeculorum IX-X qui in Suecia reperti sunt, vorbereitet. Eva Wiséhn hat ein Inventar aller Münzfunde der Provinz Uppland angefertigt, das im Laufe des kommenden Jahre vom Münzkabinett gedruckt werden soll. In die-
sem Inventar sind die Münzfunde aus Birka einverleibt. Die Fundumstanden und Münzbeschreibungen sind von Eva Wiséhn zusammengestellt. Die Münzbestimmungen dieser Arbeit stützt sich hauptsächlich auf ältere Bestimmungen aber, hinsichtlich die orientalische Münzen, mit gewisse Um- und Neubestimmungen von Bengt E. Hovén. Mit der freundlichen Genehmigung kann das Birka-Komitee das Verzeichnis im vorliegenden Band Birka II:3 abdrucken.
Ola Kyhlberg hat in einigen kritischen Vergleichen die Münzfunde aus Birka diskutiert und wichtige Beiträge zur Frage des Wertes der Datierung durch Münzen geliefert (Kyhlberg 1980A, 54ff.). Seine Analysen gründen sich auf die in Birka I publizierten Münzbestimmungen, auf die Untersuchung von Brita Malmer von 1966, auf einen Aufsatz von Ulla Linder Welin von 1974, sowie auf Ingmar Janssons Beitrag zu den Fragen der Münzdatierung (1970). Mit der Methode der Seria-tion, die er für die Münzfunde verwendet, gelangt Kyhlberg zu vorläufigen Ergebnissen, die er in zwei Tabellen zusammenfasst (Kyhlberg 1980A, 80f.). Sie zeigen die Frequenz der Münzen in den verschiedenen Bezirken der Gräberfelder, die er schablonenmässig in Jahresklassen mit 20-, bzw. 25-jährigen Intervallen einteilt1. Die Datierung der Bezirke gründet er auf die jeweils jüngste Münze. Das ergibt für den Bezirk 1D die Zeit von 774-785, während z.B. die Bezirke 2A und 2B zwischen 835 und 940 datiert werden.
Über die Münzfunde der Gräber von Birka haben wir eine Tabelle ausgearbeitet (27:1), vom gleichen Typ wie für die übrigen Übersichten der Fundkategorien, mit der Fundfrequenz auf den verschiedenen Gräberfeldern, der Verteilung auf verschiedene Grabtypen und auf Männer- und Frauengräber. Diese Tabelle der Münzen geht von den Gräberfeldanalysen von Anne-Sofie Gräslund (1980) und dem obengenannten Inventar aller heute identifizierten Münzen aus (Appendix zu Kap. 27).
1 Es ist zu beachten, dass Kyhlberg Bezirk 1C in 1C und lc aufteilt.
138 Greta Arwidsson. Appendix
Tab. 27:1. Münzen (zusammengestellt von G.A.)
Auffällig ist die Verteilung auf Männer- und Frauen-gräber. Auf die Frauengräber entfallen ca 48 % der Gesamtzahl der bestimmbaren Münzen. Diese Verteilung erklärt sich daraus, dass die Frauen nicht selten Münzen als Schmuckanhänger getragen haben, während sie weniger oft kleine Stücke von Münzen mit ins Grab bekamen. Die Münzen in den Männergräbern dagegen sind fast durchgängig zerstückelte Exemplare,
wobei viele Stückchen so klein sind, dass ihre Herkunft sich nur schwer bestimmen lässt. Ausserdem lagen 26 Münzen, von denen sieben bestimmbare Münzen und neunzehn nicht bestimmbare Stücke waren, in Gräbern, die weder osteologisch noch durch die Beschaffenheit der Fundgegenstände geschlechtsmässig bestimmt werden konnten.
Appendix Verzeichnis der in den Birka-
Das vorliegende Verzeichnis der Münzen von Björkö/ Birka enthält nur die in den Gräbern gefundenen prähistorischen Münzen. Weder die Münzenfunde aus der sog. Schwarzen Erde, die Einzelfunde auf der Insel, noch die beiden Schatzfunde, die Hjalmar Stolpe bei seinen Untersuchungen von 1872 und 1873 fand, sind in die Liste aufgenommen.
Die Nummerierung ist dieselbe wie in der Inventarliste des Münzkabinetts, weshalb die Nummerfolge der Münzgruppen stellenweis unterbrochen werden musste.
Im Übrigen sei auf den Kommentar in Kap. 27 mit
zu Kap. 27
Gräbern gefundenen Münzen
der Tab. 27:1 verwiesen, auf der die Verteilung der Münzen auf verschiedene Gräbertypen, auf Männer-und Frauengräber und auf ihre Frequenz in den verschiedenen Gräberbezirken von Birka registriert ist.
Leider ist Tab. 27:1 nicht mehr ganz vollständig, weil die Inventarliste in der ersten Korrektur vom Münzkabinett ergänzt worden ist. Die neuentdeckten Münzen kommen aus den Männergräbern Bj 716 und 842 und aus dem Frauengrab Bj 758, alle drei im Gräberbezirk 1C.
Die Inventarliste des Münzkabinetts wird auf Schwedisch gedruckt. Zu einigen häufig wiederkehrenden
Münzen 139
Einzelworten und Ausdrücken geben wir hier die deutschen Entsprechungen an:
yngsta mynt äldsta mynt ej närmare bestämbart troligen ej bestämbart
4. BJÖRKÖ Borg, Hemlanden, Kärrbacka Tid: Järnålder, vikingatid Fyndår: 1874-1934 Fyndtyp: Gravfynd Antal: Ca 230 mynt
Fyndomständigheter Mynten påträffades vid arkeologisk undersökning av gravfälten utförd av fornforskaren Hjalmar Stolpe på uppdrag av Vitterhetsakademien åren 1874-79, 1881, 1888-90, 1895 samt av Holger Arbman, RAÄ, 1932-34. Sammanlagt undersöktes ca 1.100 gravar.
BESKRIVNING BORG Gravar nr 455-462, 1160
Åtta gravar undersöktes av Stolpe år 1890, varav en innehöll ett mynt.
Grav 457 KALIFATET: idrisid, Idris I/II, Tudgah/Walilah, 793/ 94.
Referens: Arbman 1940-43 s. 129, taf. 138:11.
(Gräberbezirke 2 A-B)
Gravar nr 452-454, 463-660 Av ca 200 gravar har 198 undersökts (196 av Stolpe åren 1876-
78, två av Arbman år 1934), varav 27 innehöll sammanlagt 53 mynt.
SASSANIDISKA RIKET: (1 ex.); KALIFATET1: (34 ex.); BYSANTINSKA RIKET: (2 ex.); SKANDINAVIEN2: (15 ex.); FRANKRIKE: (1 ex.).
510 KALIFATET: 'abbasid, 880-920 (1 ex.). 511 KALIFATET: ej närmare bestämbart, 890-920? (lex.). 513 KALIFATET: 'abbasid? (1 ex.). 517 KALIFATET: samanid, efter 912 (1 ex.). 523 KALIFATET: troligen samanid, efter 892 (1 ex.); ej
närmare bestämbart (1 ex.). 524 KALIFATET: cabbasid, 860/61 (1 ex.); samanid, 909/10 (1
ex.); ej närmare bestämbart (1 ex.). 526 SKANDINAVIEN: Carolus/Dorestad, Malmer CEII/ DII (2
ex.); Carolus/båt, Malmer CEII/båt (4 ex.); båt/hjort, Malmer Al/A (1 ex.); båt/tuppar, Malmer A2/- (1 ex.); båt/?, Malmer Al/-(lex.).
539 KALIFATET: ej närmare bestämbart (1 ex.). 543 KALIFATET: 'abbasidefterprägling, 749-833/864-74,
(lex.). 550 KALIFATET: umajjad (697-718) (1 ex.). 557 FRANKRIKE: Karl den skallige (840-77), denar
(1 ex.); BYSANTINSKA RIKET: Mikael III, Theodora och Thekla (842-56) miliaresion (silver) (1 ex.).
579 KALIFATET: cabbasid, 798/99 (1 ex.). 581 KALIFATET: samanid, 920-21 (1 ex.). 596 SASSANIDISKA RIKET: sassanid (1 ex.). 632/516 KALIFATET: 'abbasid, 777/78? (1 ex.);
BYSANTINSKA RIKET: Theophilos (838-40) miliaresion (silver) (1 ex.).
639 KALIFATET: 'abbasid, 786-809 (1 ex.); SKANDINAVIEN: hjort/strålansikte, Malmer B-/A-(2 ex.).
642 KALIFATET: ej närmare bestämbart, 800-tal (1 ex.). 643 KALIFATET: samanid, 948/49 (1 ex.); ej närmare
bestämbart (1 ex.). 644 KALIFATET: 'abbasid, 749-833 (2 ex.); samanid, efter 892
(2 ex.), efter 908/09 (1 ex.), 920/21 (1 ex.). 646 SKANDINAVIEN: Carolus/hus, Malmer CEII/hus (1 ex.);
båt/tuppar, Malmer A2/- (1 ex.)
Äldsta mynt: Kalifatet, umajjad, 697-718.
Yngsta mynt: Kalifatet, samanid 948/49
Referens: Lindqvist 1926 s. 307-11, 318; Rasmusson 1937 s. 118; Arbman 1940-43; Arne 1946 s. 216-25; Malmer 1966 nr 93; Jansson 1972; Linder Welin 1974 nr 6, 1976 nr 6; Callmer 1976 nr 6, 1977; Jansson 1985 s. 126-29; Malmer m.fl. nr 7 och 8, manuskript.
Söder och sydost om BORG (Gräberbezirke 4 A-D)
Gravar nr 301-451, 1163-66 150 gravar undersöktes av Stolpe åren 1876-77, varav fem
innehöll sammanlagt sju mynt.
Grav 465 KALIFATET: 'abbasid, 805-15 (1 ex.). 467 A KALIFATET: samanid?, Isma'il?, 893-903/04? (1 ex.) 471 KALIFATET: 'abbasid, 903/04 (1 ex.). 475 KALIFATET: samanid, 902-08 (1 ex.). 495 KALIFATET: samanid, 966 (lex.). 496 KALIFATET: samanid, 907/08 (1 ex.). 503 KALIFATET: 'abbasid, 749-833 (1 ex.). 508 SKANDINAVIEN: hjort/strålansikte, Malmer B1/A1 (2
ex.).
1 Das Kalifat Das islamische Reich in der Zeit von 632 bis 1258 (formal betrachtet).. Während seiner grössten Ausdehnung umfasste es den mittleren Osten, den Iran, Afganistan und das Gebiet bis zum Indus, sowie die arabische Halbinsel, Ägypten, Nordafrika und die pyrenäische Halb-insel (Bengt E. Hovén). 2 De nordiska mynten är i denna lista upptagna under beteckningen Skandinavien.
Jüngste Münze älteste Münze nicht näher bestimmbar wahrscheinlich überhaupt nicht bestimmbar
(Gräberbezirke 2A-B, 3, 4A-D, 1A-F, 6,7) SHM/KMK u.nr.
(Gräberbezirk 3)
Norr om BORG
28. Kommentar zu den Knochenfunden aus den Gräbern, mit einem Appendix
Tab. 28:1
Greta Arwidsson
Hjalmar Stolpes grosses Interesse für die Knochenfunde der Gräber und der Probegrabungen in der Schwarzen Erde ist gut belegt, teils durch Stolpes eigene Veröffentlichungen, teils durch seine genaue Registrierung auch sehr unvollständiger Skelettreste auf den Gräberplänen.
1.1. Tierknochen von den Ausgrabungen Stolpes (Stolpe 1872, 1873)
Bei den Untersuchungen des ersten Jahres auf Björkö sammelte Stolpe ungefähr fünfzehn Säcke Knochen (Stolpe 1872, 88). Er sagt, die Knochenfunde aus der Schwarzen Erde seien so gut erhalten, „dass man ... sie mit derselben Leichtigkeit bestimmt wie ganz frische Knochen" (1872, 90). Hjalmar Stolpe, Zoologe mit Ausbildung an der Universität Uppsala, hatte seine Untersuchungen im Oktober/November 1871 begonnen und konnte schon am 10. Januar 1872 der Akademie der Wissenschaften in Stockholm seine Resultate mitteilen: er hatte die fünfzehn Säcke Knochen „Stück für Stück" untersucht und Listen der artmässig bestimmten Säugetiere, Fische und Vögel zusammengestellt. Insgesamt enthält das Verzeichnis sieben Haustiere, sowie Elch (nur Geweihteile), acht Vogelarten und drei Fischarten.
Nach den Ausgrabungen des folgenden Jahres, die 50 Tonnen mit gröberen Knochen und 80 Kästen mit kleineren Knochen erbrachten, konnte er am 16. April 1873 nicht weniger als elf weitere Säugetierarten, zwölf Vogel- und acht Fischarten nachweisen (Stolpe 1873, 73).
Gleichwohl war in dieser kurzen Zeit eine vollständige Bestimmung natürlich nicht möglich. Stolpe bedauerte auch, dass die Untersuchung der Funde eine Diskussion der verschiedenen Rassen, z.B. der Schweine und der Rinder (die Stolpe als zahme Ochsen bezeichnet) oder der Hunde nicht ermöglichte.
1.2. Die Knochenfunde der Gräber
Aus den Körpergräbern kommen unverbrannte Skelettreste von Menschen und Pferden, aus den Brandgräbern verbrannte Reste von Menschen und verschiedenen Arten von Säugetieren, Vögeln und Fischen.
Die unverbrannten Menschenknochen waren sehr viel schlechter erhalten als die Pferdeskelette auch in demselben Grab, - eine Erscheinung, die man oft in Gräbern der Vorzeit wahrnimmt und die sich daraus erklärt, dass die Tiere oft jung waren und erst im Zusammenhang mit der Grablegung getötet wurden (s. Arwidsson 1977, 104).
Stolpe hatte die Knochenfunde aus den Gräbern gewissenhaft gesammelt und sie ordentlich mit Grab-nummern versehen, aber nach etwa hundertjähriger Verwahrung im Magazin des Staatlichen Historischen Museums waren sie leider in schlechtem Zustand. Dennoch erschien es wichtig, eine osteologische Analyse des Materials zu versuchen. Diese Aufgabe übernahmen 1975 und 1979 die Osteologen Berit Sigvallius und Sabine Sten vom Osteologischen Laboratorium der Universität Stockholm.
Die Geschlechtsbestimmungen des Katalogs von Birka I gründen sich ausschliesslich auf die Art der Grabbeigaben: Waffen und bestimmte Schmuckstücke kennzeichnen Männergräber, Perlen und Schmuckkombinationen verschiedener Art Frauengräber. Die Angaben dieses Katalogs liegen auch den Geschlechtsbestimmungen zugrunde, die für die Verteilung auf Männer-, bzw. Frauengräber in den Bänden Birka II:1-3 gelten (s. u.a. die chronologische Tabelle 36:1-3 in Birka II:1).
Für den Band Birka IV (A.-S. Gräslund 1980) führte Berit Sigvallius eigens osteologische Untersuchungen von verbrannten Knochen aus dreikantigen Steinsetzungen und aus Kindergräbern aus (Birka IV, 69 und 82; A.-S. Gräslund 1973, 161ff.).
144 Greta Arwidsson
2.1. Resultate der osteologischen Analysen
Der fragmentarische Zustand der Skelettfunde hat eine vollständige Analyse nicht erlaubt und - jedenfalls vorläufig - ist es nicht möglich gewesen, rassenbiologische Variationen zu unterscheiden oder eventuelle fremde Einschläge in der Bevölkerung und mögliche Verwandt-schaftsverhältnisse zwischen Individuen, die in engeren Gräberfeldbezirken begraben liegen, festzustellen.
Offensichtlich sind die Knochenfunde aus den Birka-gräbern in vieler Hinsicht unzuverlässig. Es sind mit Sicherheit Verwechslungen, falsche Signaturen und Verluste festzustellen, - Verluste sowohl aus Skelettgräbern, in denen nach Stolpe gut erhaltene Skelette lagen, wie auch aus vielen Brandgräbern, bei denen Stolpe wenige verbrannte Knochen notiert.
Eine vollständigere osteologische Analyse des vorlie-genden Fundmaterials an verbrannten Knochen ist zwar möglich, dürfte aber kein sichereres Bild von den Bevöl-kerungsverhältnissen in Birka ergeben.
Die Ergebnisse der Analysen von Berit Sigvallius und Sabine Sten sollen daher vorläufig nicht veröffentlicht werden. Sie werden selbstverständlich in ATA archiviert und sind somit der Forschung in Zukunft zugänglich.
Als Appendix zu diesem Kapitel publizieren wir jedoch einige kurze Auszüge der osteologischen Analysen.
2.2. Hjalmar Stolpes Angaben über die Knochen aus den Gräbern
Holger Arbman hat Stolpes Grabpläne und die Angaben seiner Notizbücher über die Knochenfunde in den Gräbern systematisch durchgesehen und sie in seine Beschreibungen jedes einzelnen Grabes aufgenommen. Bei einer jüngst ausgeführten, genauen Zusammenstellung dieser Angaben konnte ich feststellen, dass nur 49 % der Skelettgräber Reste von solchen Skeletteilen enthielten, dass eine Bestimmung des Geschlechts, des Alters und der Körperlänge möglich war. Zu den Brandgräbern sagt Stolpe, dass mindestens 65 % der 457 untersuchten Gräber nur „wenige verbrannte Knochen" bzw. „Knochensplitter" enthielten1.
2.3. Verwechslungen und falsch signierte Skelettpakete
Bei den jetzt ausgeführten osteologischen Analysen hat es sich leider gezeigt, dass ihr Wert dadurch beeinträchtigt wird, dass in der langen Zeit unter ungünstigen Lagerungsverhältnissen Verwechslungen stattgefunden
haben. In einigen Fällen lassen sich diese mit Sicherheit feststellen, in anderen fehlt auf den Verpackungen die Aufschrift zur Identifikation. So kann z.B. das Sarggrab Bj 566 (Abb. 136) keine vier Schädel und Tierteile enthalten haben, das Brandgrab Bj 598 wohl kaum zwei unverbrannte Menschenskelette zusammen mit den verbrannten Knochen von einem 18 bis 44 Jahre alten Individuum, und die Kammergräber Bj 607 (Abb. 156) und Bj 581 (Abb. 143), die nach Stolpes genauen Zeichnungen je ein Skelett enthielten, können nicht zwei enthalten haben, die jetzt als Mann und Frau zwischen 40 und 80 Jahren, bzw. als Mann und Frau bestimmt werden.
Von den Gräbern, in denen Stolpe vollständige oder fast vollständige Skelette feststellte und im Detail auf seinen Grabplänen einzeichnete, fehlen heute Knochen in mindestens sieben davon: Bj 566: Abb. 136; Bj 567: Abb. 137; Bj 646: Abb. 1852; Bj 959: Abb. 334; Bj 980: Abb. 360; Bj 986: Abb. 366; Bj 1054: Abb. 400.
Die Schachteln 13 und 16 waren mit Grab 15 markiert, sie enthielten eine Sammlung Knochen von mindestens drei Individuen, zwei davon Männer, - unverbrannt, während Bj 15 eine grosse Menge verbrannter Knochen enthalten sollte! Vier Verpackungen tragen keine Nummer, sie enthalten Teile von mindestens fünf Individuen, von denen eins zwischen 30 und 60 Jahre alt war, zwei waren zwischen 40 und 80 Jahren und einer zwischen 50 und 70 Jahren.
Die Knochen aus dem Schachtgrab Bj 481 müssen falsch signiert sein: die Analyse gibt nur verbrannte und unverbrannte Tierknochen, keine Menschenknochen an, und dasselbe gilt von dem Sarggrab Bj 491, in dem nach Stolpe keine Knochen erhalten waren.
Aus mehreren Gräbern liegen nur Zahnreste vor, an denen sich jedoch meistens Altersbestimmungen aus-
1 Bei der Zahl der untersuchten Gräber rechnet man oft mit etwa 1160, was nicht korrekt ist. Von Stolpes letzter Zahl, 1166 (s. das Verzeichnis in Birka I), müssen die Grabnummern abgezogen wer den, die er nicht verwendet hat (vor allem Nr. 230-300, s. Birka I, 87), und die Zahl der Versuchsgrabungen, bei denen keine Grabspuren zutage kamen, die aber ihre Nummer in der Nummerfolge behielten. Dagegen muss man die Zahl der Anlagen hinzurechnen, in denen mehr als ein Begräbnis stattgefunden hat, wenn man die Zahl der Personen errechnen will. Man muss die Zahl der Skelettgräber mit Doppelbegräbnissen kennen, ebenso wie Brandgräber mit Knochen resten von mehr als einem Menschen und Grabanlagen, in denen Stolpe verbrannte und unverbrannte Menschenknochen zusammen gefunden hat. Nach der Durchsicht des Verzeichnisses in Birka I, Katalog, kommt G. A. zu der Endzahl 1098, während A.-S. Gräslund (1980, 4) mit insgesamt 1110 Begräbnissen rechnet.
Die hier vorgelegten prozentuellen Berechnungen gehen von der Gesamtzahl 1098 aus, von denen maximal 541 Skelettgräber und 557 Brandgräber sind. Das von G. A. zusammengestellte Kontrollverzeichnis der Gräber wird zusammen mit den osteologischen Analysen archiviert. 2 Aus Bj 646 liegen nur Zähne vor.
Knochenfunde 145
führen Hessen. Von 21 Zahnsammlungen gibt es Alters-bestimmungen, aber mindestens 35 weitere fehlen (20 davon sind Schädel, 15 Sammlungen von Einzelzähnen nach den Angaben Stolpes).
2.4. Die Knochenfunde der Brandgräber
Grössere Knochensammlungen aus den Brandgräbern wurden nur in einzelnen Fällen analysiert. In dem Brandgrab Bj 369 lagen nach der Analyse von Sabine Sten verbrannte Knochen von mindestens zwei erwachsenen Menschen und einem Embryo, sowie von einem Pferd, einem Schwein, einem Hund und einem Vogel. Mindestens 1,5 kg der Knochenfragmente wurden jedoch nicht analysiert.
In Bj 93 wurden 225 ml verbrannte Knochen gefunden. Davon Hessen sich bestimmen: Knochen eines Menschen zwischen 36 und 65 Jahren, eines Pferdes, und der Zehenknochen (phalanx) eines Bären. 1,1 g. Knochenfragmente wurden nicht artmässig bestimmt.
Nach Angabe von Berit Sigvallius sind die verbrannten Knochen oft sehr fragmentarisch, in einer Grösse der Fragmente zwischen 1 und 2 cm, weshalb der Prozentsatz der Bestimmbarkeit relativ niedrig ist. So gab es z.B. in Bj 414 1,8 kg verbrannte Knochen (sowie eine geringe Zahl von unverbrannten), die in sechs verschiedenen Verpackungen verwahrt wurden. Der Prozentsatz der Bestimmung liegt zwischen 6 und 10%.
2.5. Krankhafte Veränderungen an den Skeletten
In einigen Fällen Hessen sich krankhafte Veränderungen an den Skeletten feststellen. So hatte die Frau in Bj 632 an den Brust- und Lendenwirbeln Schmorische Knoten, die auch am Kreuzbein eines geschlechtlich nicht bestimmten Individuums aus Bj 518 auftreten. In Bj 571 lag ein Skelett mit mehreren krankhaften Veränderungen: drei Lendenwirbel zeigten Osteophyten an den Gliedflächen, das Kniegelenk hatte arthrosis deformans und am Oberschenkelknochen zeigte die laterale Condyle Spuren von Abnutzung.
3.1. Frequenztabellen
Eine Tabelle im Bericht von Berit Sigvallius (s. Appendix) ist von einem gewissen Interesse, obwohl die Statistik nur Funde aus 101 Gräbern berücksichtigt (mit 117 Individuen insgesamt). Bei 54 Erwachsenen Hess sich für 25 % das Lebensalter auf über 48 Jahre bestimmen.
Das Geschlecht dieser 54 Individuen Hess sich nur für 12 Frauen und 14 Männer bestimmen, Tab. 28.1.
Nach Angaben des Berichts von Sabine Sten von 1979 untersuchte sie 49 kg unverbrannte Knochen aus 115 Gräbern. In 32 Fällen Hess sich das Geschlecht bestimmen: 20 Männer und 12 Frauen. In zehn Gräbern gab es Skelettreste von Kindern unter 10 Jahren. Der Prozentsatz der Bestimmbarkeit betrug ganze 93,8%.
Von 18,6 kg verbrannten Knochen (von Sten 1979 untersuchten) Hessen sich nur 15,5% identifizieren. Von dreizehn Individuen, die alle als erwachsen zu bestimmen waren, waren zwei Frauen.
3.2. Die Tierknochen in den Gräbern
In den Brandgräbern wurden verbrannte Knochen vom Pferd, Hund, Rind, Schwein, Schaf/Ziege, Katze, Bär, Fuchs (einmal in Bj 1059) Fisch und Vogel festgestellt.
Es ist bemerkenswert, dass der Hund in den Brandgräbern ziemlich häufig, in 23 Gräbern, vorkommt, während er in den Skelettgräbern von Birka vollständig fehlt3. Auch Pferde wurden bei der Leichenverbrennung mitverbrannt, und zwar in 16 Gräbern, von denen neun zugleich Hunde enthielten. Vom Bären gibt es Zehenknochen (phalanx), einen in Bj 93 und in Bj 326, zwei in Bj 82 und sieben in Bj 676 (dies Grab ist wahrscheinlich falsch signiert, s. oben Abschnitt 2:3). Zu Bärenfellen in den Gräbern vgl. Petré 1980.
An Vogelarten ist vorläufig nur eine bestimmt: das Huhn. Ein unverbranntes Huhn lag nach Stolpe zuoberst in der Knochenurne von Bj 369 und in der von Bj 1148. Ein Zehenknochen (phalanx) mit Spore daran war unter den verbrannten Knochen von Bj 80 als Hahn zu identifizieren, ebenso in Bj 667, in dem es mehrere Skeletteile vom Hahn gab. In Bj 221 lagen Vogelknochen in der Urne.
Aus den Brandgräbern gibt es auch vereinzelte unver-brannte Tierknochen, z.B. in Bj 303, 353 und 929. In einigen Fällen gehören diese Knochen zur Grabschüt-tung. Stolpe notiert aber auch, dass manchmal unverbrannte Tierknochen (vom Rind, Schwein) direkt auf der Brandschicht lagen, z.B. in Bj 11A, 372, 1128 und 1153.
In den Skelettgräbern gibt es selten bestimmbare Reste von unverbrannten Tierknochen, deren Lage im Grab durch die Grabpläne bekannt ist. Ausnahmen sind Bj 823 mit mehreren Knochen vom Rind (?) in dem Kasten, Bj 1097 (Abb. 427), in dem ein grösseres Stück
3 Der Unterkiefer vom Hund (Grösse eines Schäferhundes), der für Bj 1072 registriert ist, gehört nicht zum Grab, sondern zur Schüttung des Hügels.
146 Greta Arwidsson
Tab. 28:2 Ausgearbeitet von Berit Sigvallius
Tabellen är typograferad och satt hos Text & Form AB, Stockholm,
Knochenfunde 147
Tab. 28.1. Das kumulative Diagramm veranschaulicht die Sterblichkeit der ganzen Bevölkerung (gegründet auf eine Stichprobe von 54 Individuen). 50 mm2 bezeichnen ein Individuum. Da die Beurteilung des Alters bei den verschiedenen Individuen stark variiert (s. Tab. 28:2), ist dies die einfachste Methode, alle in einem Diagramm zusammenzufassen.
Kommentar zu Diagramm 28:1 Berit Sigvallius
Auf dem kumulativen Diagramm der erwachsenen Indi-viduen auf Björkö wurde die untere Altersgrenze auf 14 Jahre festgelegt, und zwar deshalb, weil die Ergebnisse dann mit der Bevölkerungsstatistik späterer Jahrhunderte vergleichbar sind.
Obwohl die Sterblichkeit bis zu 35 Jahren sehr hoch liegt, sind dennoch 25 % der erwachsenen Bevölkerung 48 Jahre oder älter geworden. Die obere Altersgrenze, 80 Jahre, ist theoretisch gesetzt, da sich das Alter bei den Altersbestimmungen mehrfach nicht genauer präzisieren liess als z.B. 40-80 Jahre.
Es ergibt sich also, dass die mittlere Lebenslänge in vorgeschichtlicher Zeit zwar sehr niedrig war, es aber dennoch viele Menschen gab, die ein hohes Alter erreichten.
Übrigens zeigte ein Vergleich mit der Bevölkerungs-statistik des 18. Jahrhunderts, dass die Altersverteilung des wikingerzeitlichen Björkö mit der Stockholms im 18. Jahrhundert bedeutende Ähnlichkeit hatte.
148 Greta Arwidsson
vom Speichenknochen (radius) eines Rindes lag, Bj 957, in dem ein Stück eines Schweinekiefers und einige Halswirbel lag, und Bj 628, wo unter dem Schild Stücke von Unterarmknochen von Rind und Schwein, sowie ein Oberarmknochen vom Hahn (?) lagen.
3.3. Eierschalen in den Brandgräbern
In sechs Brandgräbern lagen Fragmente von Eierschalen (Bj 11A, 184, 221, 308, 332 und 352). Die drei ersteren gehörten zum Gräberfeldbezirk 1B, 1D und vielleicht 1E, die übrigen zu den Bezirken 4B-D.
In einigen Fällen gibt es keine Angaben über die genaue Lage der Eierschalen. In Bj 221 lagen die Fragmente in der Urne, in der auch Vogelknochen vorkamen, in Bj 308 waren Eierschalen in der Urne mit den verbrannten Knochen vermischt, und in Bj 332 gab es Eierschalen sowohl zuoberst in der Urne und auf etwa 1,2 m2 um die Urne verstreut. Im letzteren Fall handelt es sich vielleicht um die Schalen von mehreren Eiern. In Bj 352 heisst es, dass es sich um ein Ei handelt.
Die Gräber mit Eierschalen lassen sich oft nicht genauer datieren. Nur Bj 184 ist durch das Vorkommen von u.a. vier mit Ösen versehenen, nordischen Silbermünzen der Gruppe KG 4 Malmer (1966) und einer Perlengarnitur auf die ÄBS zu datieren.
Auch auf Gotland gibt es Gräber der Wikingerzeit mit Hühnereiern. S. Trotzig 1969, 25 und Stenberger 1969, 19.
3.4. Gräber mit Pferdeskeletten
Vollständige Pferde sind in 18 Skelettgräbern von Birka registriert worden. In 17 Fällen lagen die Pferde auf einem erhöhten Absatz am Fussende des Grabes, nur in einem Fall fehlte diese Erhöhung und das Pferd lag auf der Bodenfläche der Grabkammer (Bj 842). 17 der Gräber mit Pferden waren Männergräber, nur eins (Bj 965) war ein Frauengrab. In zwei Gräbern (Bj 581 und 834) waren zwei Pferde nebeneinander begraben, in den übrigen ein Pferd.
Ein Verzeichnis über die Gräber mit Pferdeskeletten enthält Birka II:2, wo auch die zu den Pferden gehörige Ausrüstung analysiert wird (Forsåker 1986, 113ff.).
Eine Analyse der Pferdeskelette ist nicht ausgeführt worden. Bengt Lundholm erwähnt die Pferde kurz in seiner Dissertation von 1947, Kap. VIII:4: Die Björkö-Pferde.
Appendix
Als Beispiel der in ATA archivierten Analysen drucken wir im Folgenden eine Seite von Sabine Stens Bericht ab, ferner ein Diagramm mit einem von Berit Sigvallius zusammengestellten Kommentar, sowie einen Ausschnitt aus den von Berit Sigvallius vorgelegten Bestim-mungsverzeichnissen (Tab. 28:1).
Aus Stens Bericht
GRAB 968 Schachtel 17. Unverbrannte Knochen. Folgende Gattung und Fragmente waren zu identifizieren:
HOMO, ein erwachsenes Individuum (s. Abb. 346). 12 Schädeldachfragmente, 1 os maxilla (vollständig), 5
Schädelfragmente, 2 ossa mandibulae sin und dx, 16 dentes (vollständig), 3 vertebrae cervicales, 3 humeri (medial), 1 femur (dist) dx, 1 femur (medial), 2 tibiae (dist) sin und dx, 1 tibia (prox) sin und 2 calcanei sin und dx.
Geschlecht und Alter können nicht bestimmt werden. Gewicht 392 g, MIND 1 Individuum.
Nicht identifizierte Fragmente: Gewicht 55 g, ca. 50 Frag-mente.
GRAB 985 Schachtel 19. Unverbrannte Knochen. Folgende Gattung und Fragmente waren zu identifizieren:
HOMO, ein Mann adult/maturus 40-60 Jahre. 3 vert, coccyges, 1 os sacrum (zeigt osteoporosis), 1 os
humerus (medial) dx, 1 os radius (vollständig) sin, 1 os ulna (medial dist) sin, 5 ossa pelves, zwei sin und zwei sin, 2 ossa femora (mediales) sin und dx, 3 ossa femora (dist) zwei sin und ein dx, 1 os femur (prox), 2 ossa tibiae (mediales) sin und dx, 2 ossa tibiae (prox) ein sin und 3 ossa fibulae (mediales) ein sin und zwei dx.
Die Geschlechtsbestimmung gründet sich auf die sehr kräfti-gen Schenkelknochen. Die Altersbestimmung gründet sich auf os pelvis dx (Symphys III). Die Körperlängenberechnung (auf os radius sin) ergab ein Individuum von 176 cm Länge.
Gewicht 894 g, MIND 1 Individuum. Nicht identifizierte Fragmente: Gewicht 70 g, ca 20 Frag-
mente von homo.
GRAB 974? Schachtel 33. Unverbrannte Zähne. Folgende Gattung und Fragmente waren zu identifizieren:
HOMO, ein infans IL 8-10 Jahre (s. Abb. 352). 29 dentes (16 vollständig), darunter 8 molares, 6 premolares
und 5 incisives, keine Abnutzung. Zähne, die nicht aus dem Kiefer herausgewachsen sind. Geschlecht nicht bestimmbar.
Gewicht 9 g, MIND 1 Individuum.
Knochenfunde 149
Aus Stens Bericht
Gesamtgewicht der bestimmmten Arten: Verteilung des gesamten Untersuchungsmaterials auf verbrannte und unverbrannte Knochen.
29. Resultate der Birka-Forschung in den Jahren
1980 bis 1988
Versuch einer Auswertung
Tab. 29:1
Anne-Sofie Gräslund
1.1. Einleitung
Beim Abschluss der systematischen Bearbeitung der Gräberfunde von Birka ist es nun an der Zeit eine Zusammenfassung derselben zu versuchen. Die ver-schiedenen Fundkategorien sind in den Bände Birka II:1-3 behandelt worden. Ausserdem liegen grössere Einzelstudien vor: über die Frauentracht (Hägg 1974), über die Formen der Grablegung (Birka IV, Gräslund 1980), über Filigran- und Granulations-Schmuck (Birka V, Duczko 1985) und über die Schalenspangen (Jansson 1985). Auch die Dissertation von Kristina Ambrosiani (1981) ist zu nennen; zwar ist der Abschnitt über die Kämme von Birka nur ein Abdruck von Kapitel 18 in Birka II:1, aber Ambrosianis Gesichtspunkte zur Produktion und Distribution in anderen Teilen der Untersuchung berühren auch Birka. Auch der Bericht über die von Björn Ambrosiani und Birgit Arrhenius geleitete Untersuchung des Hafengebiets von Birka, 1969-71, hat wesentlich zu unserer neuen Kenntnis der vielerlei Gegenstände beigetragen, mit denen sich die Einwohner von Birka umgaben, u.a. durch die Funde von Gussformen und Halbfabrikaten (B. Ambrosiani und B. Arrhenius 1973).
1.2. Die Probleme
Folgende Fragen haben die verschiedenen Verfasser untersucht: die Einteilung der Gegenstände in Typen, ihre Funktion, Chronologie und Chorologie. Einige von ihnen befassen sich auch mit Problemen des Ursprungs, der Produktion und der sozialen Bedeutung.
Die Bearbeitung sollte u.a. folgende Fragen be-leuchten:
- gibt es Möglichkeiten, die Herstellung bestimmter Typen von Gegenständen in Birka zu erschliessen?
- wie verhalten sich die verschiedenen Gräberbezirke
zueinander, überwiegen die Übereinstimmungen oder die Unterschiede zwischen ihnen?
- kann man bei den Unterschieden feststellen, ob sie sozialer, wirtschaftlicher, chronologischer oder ethnischer Art sind?
- konzentrieren sich westeuropäische, bzw. aus dem Osten kommende Gegenstände auf bestimmte Gräberfelder oder Teile derselben?
- gibt es hinsichtlich der Belegung der Gräberfelder Tatsachen, die den Gedanken stützen, dass es sich ursprünglich um Familiengruppen handeln könnte?
- haben sich neue Aspekte ergeben, die das Verhältnis von Christentum und Heidentum in Birka erhellen?
- und endlich: haben sich neue Erkenntnisse über die Rolle und Funktion Birkas im Allgemeinen ergeben?
2. Handwerkliche Produktion in Birka
Bei der Bearbeitung der verschiedenen Kategorien von Gegenständen haben mehrere Verfasser vorgeschlagen, dass bestimmte Typen in Birka hergestellt seien. Dass ein Typ häufig in Birka vorkommt, berechtigt natürlich nicht zu der Schlussfolgerung, dass er hier hergestellt sei. Diese Hypothese muss durch das Vorkommen von Halbfabrikaten, Gussformen, Abfall bei der Herstellung oder dergleichen begründet sein, wozu die Funde aus der Schwarzen Erde wichtige Beiträge liefern. Sie geben uns Belege u.a. für Bronzeguss, Silberschmiede, Textilhandwerk und für die Verarbeitung von Horn und Bein. Man hat Fragmente von Gussformen zur Herstellung von ovalen Schalenspangen, von gleicharmigen Spangen, von Ortbändern, Armreifen und verschiedenen Anhängern gefunden, sowie eine Gussform für kleine Silberzaine (Arbman 1939, 120ff.; Arrhenius
152 Anne-Sofie Gräslund
1973, 104ff.; Jansson 1985, llf., 95; Aagård 1984, 104ff., Birka II:1). Für die Bogenspangen gibt Arrhenius (1984, 42, Birka II:1) Beispiele von Halbfabrikaten unter Stolpes Funden aus der Schwarzen Erde an.
Weitere Schmuckformen, für die man eine Herstellung in Birka vorgeschlagen hat, doch ohne dass direkte Spuren der Produktion belegt wären, sind einfache Ringspangen aus Eisen (Ginters 1984, 25, Birka II:1; Graham-Campbell 1984, 38, Birka II:1). Auch die Gruppe der kleinen Ringspangen aus Silber möchte Ginters als Handwerkserzeugnisse aus Birka betrachten, da von anderen Orten keine gleichzeitigen Entsprechungen bekannt sind (Ginters 1984, 26, Birka II:1).
Für die Anhänger hat man, wie gesagt, einige Gussformen in der Schwarzen Erde gefunden. Callmer erwägt auch die Möglichkeit, dass bestimmte andere Typen von Anhängern, die nur in Birka vorkommen (einige davon ausserdem im Mälargebiet und in Ostschweden), ebenfalls in Birka hergestellt sein könnten (Kap. 3 Abschnitt 3.3.).
Unter den Funden aus der Schwarzen Erde liegt ein Gerät zum Drahtziehen für dünnen (0,1-0,15 mm) Gold- oder Silberdraht vor, wie er zu Stickereien verwendet wurde (Arrhenius 1968, 288ff.) was dafür spricht, dass ein Teil des mit Gold- und Silberdraht gestickten oder gewebten Trachtenschmucks in den Gräbern wirklich am Ort hergestellt sein könnte (Geijer 1938, 127; Arbman 1939, 98; vgl. Hägg 1984A, 215). Geijer hat später (1980, 219) ihre Auffassung geändert und hält es jetzt für höchstwahrscheinlich, dass die Mehrzahl der Arbeiten aus Gold- und Silberdraht aus den Gräbern von Birka Import aus dem Osten ist. Aber auf anderen Gebieten kann man jedoch solchen dünnen gezogenen Draht verwendet haben, nämlich für Filigranschmuck, zur Tauschierung und zum Umwinden (Arrhenius 1968, 290ff.).
Einige kleine Hämmer aus Horn aus der Schwarzen Erde hat man als Werkzeug zum Silberschmieden gedeutet (Arbman 1939, 128). Von den Filigranarbeiten aus Birka hat Duczko viele als nordische Produkte bezeichnet, aber für die Annahme einer Herstellung direkt in Birka fehlen nach seiner Meinung die Unterlagen (Birka V, 1985).
Die Menge der unbearbeiteten Stücke aus Bernstein in der Schwarzen Erde, deren grosse Bedeutung übrigens darin bestand, dass sie Stolpe nach Björkö lockte, hat als Rohmaterial für das Kunsthandwerk gedient, wie z.B. für die kleine Tierfigur (Arbman 1939, Fig. S. 129) und einen schönen Satz Spielsteine und Perlen, vgl. Kap. 8 (Arwidsson) oben.
Es gibt heute etliche Belege dafür, dass in der jüngeren Eisenzeit an verschiedenen Orten im Norden Glasperlen hergestellt wurden (Lundström, A. 1976, 3ff.).
Aus Birka gibt es sowohl Rohmaterial in Form von Mosaikstücken, tesserae, und vermutlich auch Scherben, als auch Halbfabrikate in Form von ungebohrten Perlen, sowie ev. Herstellungsabfall in Form von halben Perlen. Perlen aus Karneol und Bergkristall liegen in vielen verschiedenen Formen des Schliffs aus den Gräbern vor. Man betrachtet sie gewöhnlich als Import aus dem Orient, aber man hat auch die Möglichkeit erwogen, dass sie als Halbfabrikat eingeführt wurden, um hier fertiggestellt zu werden (Danielsson 1973, 69 ff. mit Literaturangaben).
Halbfabrikat und Abfall in der Schwarzen Erde zeigen, dass es in Birka Horn- und Beinhandwerk gegeben hat. U.a. wurden Kämme, Löffel, Nadeln und Messergriffe hergestellt. Dieselben Kammtypen in der gleichen Ausführung kommen in einem grossen Gebiet rund um die Ostsee und die Nordsee vor. Ausgehend von der Idee Ingrid Ulbrichts, die Kammacherei in Haithabu wegen der geringen Menge des bei den Ausgrabungen gefundenen Abfalls als Nebenbeschäftigung zu betrachten, schlägt Kristina Ambrosiani vor, die Kammacherei sei im ganzen Ostsee- und Nordseegebiet von wandernden Handwerkern betrieben worden, die von Markt zu Markt an den grossen Handelsplätzen gereist wären (1981, 32ff.). Das ist eine interessante und durchaus denkbare Hypothese, die aber nach meiner Ansicht noch zu schwach unterbaut ist. Die Annahme gründet sich auf die Tatsache, dass der gefundene Abfall der Kammacherei nirgendwo ausreicht, um daraus die ganzjährige Arbeit eines Handwerkers zu erschliessen. Ambrosiani weist aber selber darauf hin, dass der Abfall ja regelmässig weggeräumt werden muss, was natürlich die Beweiskraft des Arguments verringert. Durch Berechnungen über die Bevölkerung schätzt man den Bedarf an Kämmen im Mälargebiet (d.h. auf dem Markt in oder um Birka) auf 200 bis 300 Kämme pro Jahr. Da dies nach ihrer Meinung gerade der Jahresproduktion eines Kammachers entspricht, erscheint die Erklärung, dass sie von zehn bis fünfzehn Handwerkern innerhalb von zwei Wochen hergestellt wären, nicht ganz überzeugend.
Bei ihrer Analyse der Arbeitsmesser, Typ A1, aus den Gräbern von Birka schlägt Arrhenius vor, dass diese, die sich teils durch ihre ausserordentlich hohe Qualität, teils durch grössere Länge von Messern anderer Provenienz unterscheiden, in Birka geschmeidet sein könnten (Kap. 15, oben, Messer).
Obwohl nur ein sehr kleiner Teil der Schwarzen Erde ausgegraben ist, gibt es also Belege für die Ausübung vieler verschiedener Handwerkszweige. Wir dürfen vermuten, dass eine zukünftige Untersuchung noch mehr von intensiver, gut entwickelter und spezialisierter Produktion erkennen lassen wird.
Resultate der Birka-Forschung 153
3. Die Verbreitung der Artefakte im Verhältnis zu den Gräbertypen
Wir wenden uns nun den Angaben über die Verbreitung der verschiedenen Kategorien von Gegenständen auf die Gräberfeldbezirke zu. Eine Charakterisierung der verschiedenen Bezirke gibt Gräslund 1980, 4ff. mit einer Karte über die Einteilung der Gräberfelder, die auch in Birka II:1-3 im Anschluss an das Vorwort abgedruckt ist1. Detailkarten der Bezirke mit Körpergräbern, wo diese in richtiger Skala und in der von Stolpe angegebenen Orientierung eingezeichnet sind, gibt Gräslund 1980, Map I, S. 10-11 und Map II, Falttafel, am Ende des Buchs.
3.1. Die Gräberfelder
Von den ca. 1100 von Stolpe untersuchten Gräbern sind gut die Hälfte Brandgräber (560) und knapp die Hälfte (544) Körpergräber. Man darf sich natürlich nicht zu der Annahme verleiten lassen, dass die Verteilung auf je 50 % den Tatsachen entspricht. Vielmehr verhält es sich so, dass Stolpe hauptsächlich seine Ausgrabungen im Anschluss an das Stadtgebiet ausführte, wo die Körpergräber liegen, und diese wahrscheinlich ziemlich vollständig untersuchte. Weiter östlich überwiegen die Brandgräber bedeutend und es gibt hier, in Hemlanden, noch eine grosse Zahl von nicht ausgegrabenen Gräbern. Das gilt ebenso von den Gräberfeldern südlich der Burg. Weitere Untersuchungen würden mit Sicherheit die Proportionen zwischen Brandgräbern und Körpergräbern zugunsten der ersteren verändern.
Einzuteilen sind die Körpergräber ihrer Konstruktion nach in Schachtgräber mit und ohne Sarg (gewöhnlich bezeichnet als Sarggräber, bzw. Schachtgräber) und in Kammergräber. Diese sind eine Neuerung, die wahr-scheinlich aus dem Frankenreich und zunächst aus Westfalen kommt. Manche der Körpergräber sind von Grabhügeln bedeckt, und zwar hauptsächlich in Hemlanden, andere dagegen, vor allem auf dem Gräberfeld nördlich der Burg, scheinen flache Gräber gewesen zu sein, d.h. ohne (in später Zeit) sichtbare Markierung über der Erdoberfläche.
Die in den obengenannten Specialuntersuchungen und in Birka II:1-3 analysierten Fundgruppen stammen zu einem sehr grossen Teil aus den Körpergräbern. Folglich betrifft ein Vergleich zwischen Gräberbezirken und Gräberfeldteilen natürlich hauptsächlich die sog. Körpergräberfelder, d.h. die Bezirke 2 nördlich der Burg, sowie die Gräberfeldbezirke 1A, 1B und 1C, (Hemlanden), innerhalb, unter und gleich ausserhalb des Stadtwalls.
Für die Chronologie gilt, dass Körpergräber aus der ÄBS nur in zwei Bezirken liegen, nämlich in grosser Zahl auf dem Gräberfeld 2 und spärlich verbreitet im Bezirk 1B. Die Brandgräber der ÄBS verteilen sich auf verschiedene Gräberfeldbezirke, in grosser Anzahl kommmen sie auf 1B vor, dieser Teil von Hemlanden ist also offenbar mit frühen Gräbern belegt.
Die grossen zusammenhängenden Gräberfelder haben vermutlich ursprünglich aus vielen kleinen Gruppen von Gräbern bestanden, die nach und nach erweitert wurden und allmählich zusammenwuchsen (Gräs-lund 1980, 73; vgl. Kyhlberg 1980A, 62f.). In bestimmten Bezirken liegen die Gräber sehr dicht beieinander, während es in anderen noch Platz zwischen ihnen gibt (vgl. die Karten Birka I, Taf. I—III; Gräslund 1980, Map I—II). Die ursprünglichen kleinen Gruppen könnten dann vielleicht aus den Gräbern einer Familie oder einer Sippe bestehen. Für diese Deutung spricht auch, dass die feststellbaren Kindergräber nicht für sich beisammen liegen, sondern zwischen den Gräbern der Erwachsenen (Gräslund 1973, 176). Auch eine ethnische Gruppierung wäre denkbar, dass z.B. fremde Kaufleute ihre Gräber in einem besonderen Bezirk hatten.
3.2. Ovale Schalenspangen
Jansson (1985, 139ff.) rechnet gemäss seiner Analyse der Spangen in den Frauengräbern mit drei verschiedenen Körpergräberfeldern2: nördlich der Burg und die südlichen, bzw. nördlichen Bezirke des Stadtwalls, zwischen denen grosse Unterschiede bestehen, die teils chronologisch bedingt sind, aber wahrscheinlich auch darauf beruhen, dass sie von verschiedenen Gruppen der Bevölkerung benutzt wurden.
Charakteristisch für das Gräberfeld nördlich der Burg ist es, dass in der Spangenausstattung ausser den ovalen Schalenspangen nur Kittelspangen vorkommen. Hier gibt es zahlreiche Silberspangen, mehrere Spangen karolingischer Herkunft und viele Kleeblattfibeln. Es ist als ein Gräberfeld wahrscheinlich für wohlhabende Geschlechter mit gutem Kontakt im Westen und lokal
1 Jansson hat für die Gräber mit ovalen Schalenspangen eine abwei chende Einteilung der Gräber im Gebiet des Stadtwalls vorgelegt. Im grossen Ganzen kann man jedoch sagen, dass Janssons südlicher Abschnitt des Stadtwalls dem Bezirk 1C, der nördliche Abschnitt dem Bezirk 1A entspricht. Der Vorteil der Einteilung in Birka IV und in Birka II im allgemeinen (mit Ausnahme von Kyhlberg, der die nord südliche Grenzlinie etwas anders zieht) besteht darin, dass die Gren zen hier der alten Einteilung von Hemlanden folgen, auf die sich Stolpe in seinen Aufzeichnungen am Ort bezieht. 2 S. die Anm. unter Anm. 1 oben.
154 Anne-Sofie Gräslund
Tab. 29:1. Verzeichnis über Waffengräber (Körpergräber) auf den verschiedenen Gräberfeldbezirken. Die Tabelle von der Verf. zusammengestellt.
mit dem inneren Mälargebiet zu deuten (Jansson 1985, 139).
Die Schmuckausstattung im südlichen Bezirk des Stadtwalls enthält wesentlich mehr Kittelspangen als das Gräberfeld 2. Zu den Kitteln kommen entweder grosse runde Spangen oder Kleeblattfibeln vor. Silberspangen sind viel seltener (Jansson 1985, 139f.).
Die Grabbeigaben im nördlichen Bezirk des Stadtwalls erscheinen etwas dürftiger, da nur sehr wenige Silberspangen vorliegen und an den ovalen Schalenspangen meistens die Vergoldung und Silberverzierungen fehlen. Die Kittelspangen sind meistens späte gleicharmige Spangen, was darauf deutet, dass die hier beigesetzten Frauen ihre engsten Verbindungen weiter nördlich hatten, da diese Spangen in Uppland und Gästrikland am häuftigsten vorkommen.
Die mit Spangen versehenen Frauengräber sind eine äusserst wichtige Gruppe für das Verständnis der Grä-berfelder, nicht zuletzt wegen der von Jansson ausgear-beiteten Chronologie der ovalen Schalenspangen (Jansson 1985, 174 f.).
3.3. Waffen und Pferdegeschirr
Lässt sich der Unterschied zwischen den Gräberfeldern, der sich aus der Analyse der Spangen ergab, auch in anderer Hinsicht belegen? Die Spangenfunde zeigten, dass sich die Gräberfelder voneinander unterschieden, dass aber die Unterschiede zwischen den Bezirken 2 und 1C kleiner waren als die zwischen 1C und 1A oder zwischen 2 und 1A. Andere anwendbare Fundgruppen sind z.B. die Waffenausstattung, das Zaumzeug der Pferde, Textilreste, wie auch die Form der Gräber.
Eine Analyse der kurzen Darstellung über die Gräber mit Waffen in Birka II:2 zeigt, dass auf dem Gräberfeld
2 die meisten Waffengräber, und zwar 28, vorkommen, gefolgt vom Bezirk 1C mit 23 Gräbern (s. Tab. 29:1). In den Bezirken 1A und 1B sind die Waffengräber weniger häufig: 16, bzw. 10 oder 11 (Thålin-Bergman 1986A-C, Abb. 1:1-4, Tab. 1:1 und die Karten Plan 2:1 und 3:1). Besonders auffällig ist, dass im Bezirk 1A so wenig - nur drei - Schwertgräber vorkommen, von denen eins ein Kindergrab ist (ca. 9 Jahre). Es ist auch zu beachten, dass die beiden einzigen Kammergräber für Kinder (im Alter von 8 bis 10 Jahren) im Bezirk 1A liegen (Gräslund 1980, 28).
Unter den Waffen sind Schwerter, Typ H, und Speere, Typ E, auf dem Gräberfeld 2 am häufigsten, aber auch Schwerter, Typ Y und V, und Speere, Typ C, D und I, kommen vor. Vom Bezirk 1C liegen drei Schwerter, Typ H, und je zwei der Typen X und Y vor. Die häufigste Speerform ist Typ K (8 Ex.), ferner je drei Spitzen, Typ E und I. Aus den wenigen Waffengräbern im Bezirk 1A kommten ein Schwert, Typ H, vier Speere, Typ K, zwei Spitzen, Typ E, und je eine Spitze, Typ C und I. Das Vorkommen der Speere, Typ K, verbindet die Bezirke 1A und 1C. Spitzen vom Typ E und I gibt es dagegen in allen drei Bezirken, ebenso die Schwerter, Typ H. Schwerter vom Typ H und E, sowie zwei vom Sondertyp, und Speere der Typen A, C, E und K sind im Bezirk 1B vertreten. Schwerter vom Typ H und Speere vom Typ E scheinen sowohl in der ÄBS als auch in der JBS vorzukommen.
In der Zahl der Waffen pro Grab besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Bezirken 2A-B und 1C einerseits und 1A und 1B andererseits. Die meisten wirklich reich ausgestatteten Waffengräber gehören zu 1C, aber einige Beispiele gibt es auch auf dem Gräberfeld 2.
Auch hinsichtlich der Zahl der beigesetzten Pferde und des Zaumzeugs (Forsåker 1986, Birka II:2, Tab. 13:1)
Resultate der Birka-Forschung 155
steht der Bezirk 1C an erster Stelle: hier gibt es zwölf Gräber mit einem Absatz für das Pferd, während es auf dem Gräberfeld 2 nur zwei Beispiele hierfür gibt, woraus hervorgeht, dass diese nicht unbedingt mit den reich ausgestatteten Waffengräbern verknüpft sind. Drei Gräber im Bezirk 1A und zwei im Bezirk 1B haben Absätze für Pferde. Im Bezirk 1C liegen auch bei weitem die meisten Gräber mit Zaumzeug und Reiterausrüstung (Forsåker 1986, 114, Birka II:2), so gehören z.B. alle vier Gräber mit Sporen (Nylén 1986, 141, Birka II:2) zu 1C wie auch acht Gräber mit Steigbügeln. Auf dem Gräberfeld 2 gibt es drei solche Gräber, 1A und 1B haben je ein Grab. Das Vorkommen von Absätzen für Pferde, die Ausstattung mit Waffen und Reiterzubehör deuten auf eine Sonderstellung des Bezirks 1C, ihm folgt dann das Gräberfeld nördlich der Burg. Ebenso wie bei den Frauengräbern mit Spangen ist in der JBS der Unterschied zwischen 1A und 1C bedeutend grösser als zwischen 1C und 2.
3.4. Die Textilfunde und Rekonstruktionen der Tracht
Die erneute Durchsicht der Textilreste der Gräber von Birka hat im Vergleich zu der Untersuchung Geijers von 1938 ermöglicht, weitere Kleidungsstücke sowohl der Männer- wie der Frauentracht zu rekonstruieren (Hägg 1974, 1986, Birka II:2). Die Männer trugen entweder eine Tunika oder einen Kaftan/Leibrock, -manchmal beides. Wo sich solche Kleidungsstücke rekonstruieren Hessen, handelt es sich nach Häggs Tabelle (1986, Tab. 8:7) auf dem Gräberfeld 2 stets um einen Kaftan, während die Tunika in den Bezirken 1A und 1B überwiegt, im Bezirk 1C kommen beide gleich oft vor.
Bei den Männern rechnet Hägg mit Kopfbedeckungen von drei verschiedenen Typen, von denen Typ A (eine Zipfelmütze, die schon vor der Wikingerzeit existierte, abgebildet auf der Schwertscheide aus Grab 7, Valsgärde, Arwidsson 1977, Abb. 58-59) und Typ C (Diadem mit gesponnenem Goldlahn) nur auf dem Gräberfeld 2 und in Bezirk 1C vorkommen, - also ein weiteres Beispiel dafür, dass diese beiden Bezirke die meisten Gemeinsamkeiten haben - während in den Bezirken 1A und 1B nur die Mütze vom Typ B vorkommt. Diese ist über der Stirn abgerundet und trägt Schmuckborten aus gezogenem und gesponnenem Gold- und Silberdraht. Lahn ist eine westeuropäische Erscheinung, die letzten Endes auf Byzanz zurückgeführt werden kann, während gezogener Metalldraht eher östlicher Herkunft ist (Geijer 1938, 73, 1980, 215; Hägg 1984A, 208).
Die von Geijer rekonstruierte Frauentracht besteht aus einem Hemd, Trägerrock und Schal/Mantel (Geijer 1938, 134ff.). Nach Hägg (1974) kommen zwei weitere Kleidungsstücke hinzu: eine Tunika (Untertunika) und ein Obergewand (Obertunika). Hägg schlägt einen chronologischen Unterschied zwischen den Kleidungs-stücken vor, dass nämlich die Obertunika ihren Schwer-punkt in der ÄBS hat, während die Untertunika haupt-sächlich zu Gräbern der JBS gehört (Hägg 1984 A, 206). Den gleichen Unterschied findet sie bei den glatten und den gaufrierten Hemden: die glatten gehören vor allem zu der frühen Phase, während die gaufrierten nicht vor dem Übergang zu der späteren auftreten (Hägg 1986, 61, Birka II:2). Ihre Tabelle der glatten und gaufrierten Hemden (1974, 19, Fig. 10) zeigt indessen, wenn man auf die Verbreitung eingestellt ist, einen anderen deutlichen Unterschied: die glatten Hemden sind im 9. aber auch im 10. Jahrhundert eindeutig am häufigsten auf dem Gräberfeld nördlich der Burg. Insgesamt rechnet sie mit 24 Hemden von den Bezirken 2A-2B, von denen 20 glatt sind (10 ÄBS, 5 JBS, 5 undatiert) und vier gaufriert. Im Bezirk 1C gibt es 7 glatte und 5 gaufrierte Hemden und im Bezirk 1A zwei glatte gegenüber zehn gaufrierten Hemden.
Ebenso erscheint mir der angeblich chronologische Unterschied bei den Ober- und Untertuniken in mindestens gleich hohem Maasse ein Unterschied zwischen den Gräberfeldern zu sein. In den Fällen, wo sich die Art des Kleidungsstücks bestimmen lässt, scheint die Untertunika in Hemlanden viel häufiger zu sein, und die Obertunika nördlich der Burg zu überwiegen (1974, 83ff.). Reste von Obertuniken, mit und ohne Seidenbesatz und Brettchenbändern, einige ausserdem mit Pelz, kommen in 22 Gräbern vor: 13 auf dem Gräberfeld 2 (5 davon aus der ÄBS, 8 aus der JBS), 5 im Bezirk 1C, 2 im Bezirk 1A, und eine Tunika in unbekannter Lage (1888). Alle fünf pelzverbrämte Obertuniken stammen aus dem Bezirk 2.
Untertuniken, mit und ohne Besatz aus Seide und Brettchenbändern, kommen in 23 Gräbern vor. Von diesen gehören 6 zum Gräberfeld 2 (je drei aus der ÄBS und der JBS), 7 gehören zum Bezirk 1C, 2 zum Bezirk 1B und 8 zum Bezirk 1A.
Aus der Rekonstruktion der Untertunika ergibt sich wahrscheinlich eine Erklärung der Frauengräber, in denen ovale Schalenspangen fehlen. Hier hat die Tracht wahrscheinlich aus Hemd, Untertunika und Obertunika bestanden. Rätselhafter erscheint es, wenn man in der gleichen Tracht sowohl eine reich mit Brettchenbändern und mustergewebten Seidenbändern verzierte Untertunika, als auch einen Trägerrock getragen hat. Die Tunika sollte doch sicher zu sehen sein und nicht unter einem Trägerrock verborgen werden!
156 Anne-Sofie Gräslund
Auch bei der Frauentracht scheint sich also die Tendenz eines Unterschiedes zwischen den verschiedenen Bezirken zu bestätigen. Ausserdem hat der Bezirk 1C grössere Übereinstimmungen mit dem Gräberfeld 2 als mit dem Bezirk 1A, ebenso wie bei den übrigen Vergleichsgruppen.
3.5. Messer mit gebogener Klinge
Dasselbe gilt für die Arbeitsmesser mit gebogenem Rücken. Arrhenius weist darauf hin, dass sie sehr begrenzt verbreitet sind: von den neun bekannten Exemplaren kommen 7 vom Gräberfeld 2, eins vom Bezirk 1C und eins vom Bezirk B/E (s. Arrhenius, Kap. 15:5.2. oben).
3.6. Grabtypen
Kann man auch bei den Grabtypen (Gräslund 1980, 12ff., 27ff.) diesen Unterschied wahrnehmen? Ein offenbarer Unterschied besteht darin, dass es auf dem Gräberfeld 2 fast ausschliesslich Körpergräber gibt, während die Bezirke 1A, B und C eine Mischung von Körper- und Brandgräbern aufweisen (bei 1C vor allem ausserhalb des Walls). Ausserdem liegt ein chronologischer Unterschied vor: auf dem Gräberfeld 2 gibt es zahlreiche Körpergräber der ÄBS, im Bezirk 1B nur wenige, aber in den Bezirken 1A und 1C gar keine. Diesen chronologischen Faktor muss man stets berücksichtigen, direkte Vergleiche müssen also der JBS gelten, wenn sie einen Sinn haben sollen. Ein weiteres Problem hinsichtlich der Grabform ist es, dass viele der Gräber sich nicht datieren lassen.
Zur Chronologie von Birka sei auf Janssons Untersu-chung hierüber hingewiesen (1985, 176ff.). In späteren Jahren haben manche Forscher den Beginn der Wikingerzeit (und damit der Birkazeit) auf den ältere 8. Jahrhundert zurückverlegen wollen und das Ende der Birkazeit bis zum Jahr 1000 oder den Anfang des 11. Jahrhunderts verschieben wollen. Den ersteren Vorschlag findet Jansson überzeugend, u.a. nach seiner Beurteilung der kürzlich neu bestimmten Münzen aus den Gräbern (vgl. Kap. 27 mit Appendix), während er die letztere Annahme wegen des Mangels an Unterlagen abweist.
Schachtgräber gibt es auf dem Gräberfeld nördlich der Burg in grosser Zahl (59 Ex.), sie dominieren im Bezirk 2A sowohl im Zentrum, als auch im Norden und Osten. Auch in Hemlanden gibt es viele Schachtgräber (104 Ex.), verstreut zwischen den übrigen Grabformen. Ihre dichteste Konzentration haben sie im nördlichen Teil von Bezirk 1A. Die ausgegrabenen Sarggräber sind ziemlich gleich-
mässig verteilt. Auf dem Gräberfeld nördlich der Burg gibt es 76, während in Hemlanden 126 liegen, die sich nicht nur auf die Abschnitte 1A, 1B und 1C verteilen, sondern in kleinerer Anzahl auch in den östlichen Bezirken D und F vorkommen.
Die trapezförmigen Särge überwiegen auf dem Gräberfeld 2 mit 28 Exemplaren, im Vergleich zu 21 im Bezirk 1C, 6 im Abschnitt 1B und 12 im Abschnitt 1A. Bei den mit einem Fuss versehenen Särgen ist die Dominanz von Gräberfeld 2 ebenfalls deutlich: von den zusammen 8 Gräbern liegen 7 hier und nur eins im Bezirk 1B. Beachtenswert ist es auch, dass von den 15 (ev. 17) ohne Eisennägeln zusammengefügten Särgen 9 (ev. 11) auf dem Gräberfeld 2 liegen, während 1 im Bezirk 1A liegt, 3 im Bezirk 1B, 1 im Bezirk 1C und 1 auf dem Gräberfeld 5. In Dänemark hat man versucht, an Hand der Anzahl der Nägel zu jedem Sarg den Reichtum des Grabes zu bewerten (Roesdal 1977, 149), was mir nicht sehr überzeugend erscheint. Es gibt so viele andere Faktoren im Zusammenhang mit dem Begräbnis, nicht zuletzt das Zeremoniell, die eine grössere Rolle spielen, die uns leider nicht zugänglich sind.
Die genagelten Särge von Birka können von einem Nagel bis zu 68 Nägeln enthalten, wenn dies auch Extremwerte sind. Die meisten Särge haben zwischen 6 und 20 Nägel, am häufigsten zwischen 11 und 15. In dieser Hinsicht scheint kein grösserer Unterschied zwischen den Gräberfeldern zu bestehen, so wenig wie hinsichtlich der Ausstattung der Gräber. Die meisten Särge mit vielen Nägeln (21-36) liegen auf dem Gräberfeld 2, worauf Bezirk 1C mit 7 Gräbern folgt. Die Bezirke 1A und 1B haben jeder nur ein Grab mit mehr als 20 Nägeln.
Kammergräber gibt es auf dem Gräberfeld 2 (43) und in den Bezirken 1A, 1B und 1C: 33, bzw. 11 und 29 Gräber. Wie schon gesagt, kommen Kammergräber der ÄBS ausser auf Gräberfeld 2 nur im Bezirk 1B vor. Im Zusammenhang mit der Besprechung der Pferde und ihres Zaumzeugs habe ich schon darauf hingewiesen, dass Absätze für Pferde im Bezirk 1C deutlich dominieren. Andere Konstruktionsdetails sind die Eckpfosten der Kammern, von denen wir die meisten Belege im Bezirk 1A haben, während im Bezirk 1C drei Gräber mit Spuren derselben vorkommen (Bj 752B, 830, 856: Abb. 221, 249 und 279). Der Abschnitt 1B und das Gräberfeld 2 haben nur je ein Grab mit Eckpfosten. Alle Kammergräber mit Eckpfosten dürften zur JBS gehören.
Eine Kategorie von Gräbern, die in den Bänden von Birka II aus natürlichen Gründen nicht erwähnt werden, sind die Gräber ohne Grabbeigaben. Man hat gelegentlich vorgeschlagen, dass die Gräber, die gar keine Funde oder nur ein Messer oder eine Spange enthalten
Resultate der Birka-Forschung 157
(Ringspange, Bogenspange oder eine der Spangenformen für die Tunika), die christliche Bevölkerung von Birka repräsentierten (Arbman 1939, 79f.; Arrhenius 1984, 44, Birka II:1). Das Problem der Gräber ganz ohne Beigaben oder mit nur einem Messer darin besteht in der Schwierigkeit, sie zu datieren. Das Fehlen von Gegenständen in den Gräbern kann religiöse, soziale, wirtschaftliche oder chronologische Gründe haben, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass alle diese Gründe vorliegen. Die Gräber sind Sarg- oder Schachtgräber und sie liegen verstreut auf den verschiedenen Gräberfeldabschnitten, besonders häufig sind sie auf dem Gräberbezirk 2B (sie kommen auf dem ganzen Feld 2 vor, zeigen aber eine deutliche Konzentration auf 2B), und im Bezirk 1A mit einer Konzentration auf dessen nördlichen Teil, nördlich der Terasse mit den reichen Kammergräbern. Die datierbaren Gräber in diesem nördlichsten Teil sind alle spät, sie scheinen der jüngsten Phase der JBS anzugehören. Ausserdem sind Gräber ohne, oder fast ohne Beigaben charakteristisch für Grindsbacka (Gräberbezirk 5) und Lilla Kärrbacka (Bezirk 6A). Es ist unmöglich, im Einzelfall zu entscheiden, welche der oben genannten Ursachen dahinter liegen, es erscheint aber glaubhaft, dass das Fehlen der Beigaben in den Bezirken 5, 6A und 1A chronologisch bedingt ist und damit vielleicht auch religiöse Gründe hat.
4. Importgegenstände
4.1. Westlicher Import
Kann sich vielleicht in der Verbreitung von Importge-genständen ein Unterschied zwischen den Gräberfeldern und ihren Bezirken zeigen? Bei einem Handelsplatz von der Art Birkas muss man natürlich damit rechnen, dass Importgegenstände den Eigentümer wechseln, weshalb man Folgerungen über die Personen, in deren Gräbern die Gegenstände angetroffen wurden, mit grösster Vorsicht ziehen muss. Trotzdem kann es sich lohnen zu untersuchen, ob die Verteilung westeuropäischer, bzw. östlicher/orientalischer Gegenstände allgemein einem Muster folgt. Dass das Gräberfeld 2 nördlich der Burg von besonders guten Kontakten mit Westeuropa zeugt, wird allgemein akzeptiert, u.a. wegen des Vorkommens karolingischer Schmucksachen, nicht nur in Gräbern der ÄBS, sondern auch in denen der JBS (Jansson 1985, 139). Auch karolingisches Glas, vor allem Trichterbecher, zeigt eine sehr distinkte Verbreitung. Es kommt auf den Gräberfeldern 2 und 3 und in Bezirk 1B vor (Arwidsson, Birka II:1, Tab. 24:1). Das lässt sich jedoch dadurch erklären, dass die Trichterbe-
cher zur ÄBS gehören und dass gerade in den genannten Abschnitten die frühen Gräber liegen. Sie enthalten teils karolingischen Schmuck, teils westeuropäische Gefässe aus Glas, Bronze und Keramik.
Eine Gruppe von Gräbern, die im Zusammenhang mit dem Gräberfeld 2 betrachtet werden muss, ist die innerhalb der Burg (Gräberfeld 3). Es handelt sich um neun Brandgräber, von denen mehrere auf die ÄBS datierbar sind, da sie frühe Schalenspangen, Trichterbecher und frühe westeuropäische Keramik enthalten. Was bedeutet es, dass man hier die Toten durchgehend verbrannt hat? Handelt es sich um Personen mit guten westeuropäischen Kontakten, die aber von christlichen Impulsen unbeeinflusst waren?
Klappmesser sind eine weitere Gruppe von Importge-genständen, die aus fränkischem Gebiet stammen und in Gräbern der ÄBS angetroffen wurden (Arbman 1937, 237f, und Kap. 17 und 15 oben, Arwidsson, Arrhenius). Sie liegen aus zwei Gräbern des Gräberfeldes 2 vor, zwei aus dem Bezirk 1C, eins auf dem Gräberfeld 3, und eins im Bezirk 1B/E.
Sellings Untersuchung der Keramik von Birka (1955, Typ A1, vgl. Ambrosiani & Arrhenius 1973, 118) hat ergeben, dass die westeuropäische Ware, die übrigens relativ selten in den Gräbern ist, in zwei Gräbern von Gräberfeld 2 vorliegt, zwei im Bezirk 1C, drei in 1B, und je eins in den Bezirken 1E, 1F, 3 und 4. Die meisten davon gehören zur ÄBS, aber einige zur JBS.
Westeuropäische Gegenstände gibt es also auch in der JBS, wenn auch in geringerem Umfang. Von den drei Schmuckstücken mit Filigranverzierung aus der JBS, die wahrscheinlich als fränkisches Kunsthandwerk zu betrachten sind (Duczko 1985, 90, 91, 94), stammen zwei vom Gräberfeld 2 und eins vom Bezirk 1C. Viele der einheimischen Filigranschmucksachen aus der JBS gehen auf westeuropäische Vorbilder zurück (Duczko 1985,110f.). Ein weiteres Beispiel westeuropäischer Silberschmiedekunst der JBS ist die mit Pflanzenmotiven verzierte Gürtelgarnitur aus Bj 750, Bezirk 1C, die aus einer Schnalle und einer Riemenzunge karolingischer Herkunft besteht.
Nach meiner Ansicht kann man auch die neuen Grab-formen, Sarg- und Kammergräber, von denen die ältesten auf eine frühe Phase der ÄBS datiert werden können, als eine Innovation aus dem Frankenreich, wahrscheinlich aus Westfalen betrachten (Gräslund 1980, 86). Die trapezförmigen Särge sind eine Sonderform, die mit der Verbreitung des Christentums bei den Franken zusammenhängt. In Birka liegen die meisten hiervon auf dem Gräberfeld 2.
Zum westeuropäischen Bereich gehört indessen nicht nur das Karolingerreich, wenn auch der Hauptanteil des Imports von hier kommt, sondern auch die britischen
158 Anne-Sofie Gräslund
Inseln. Dass der Kontakt mit diesen keine Neuigkeit für die Wikingerzeit war, geht deutlich z.B. aus den Funden von Helgö hervor.
Wahrscheinlich unter englischem Einfluss im Norden hergestellt ist die Ringnadel mit der Kugel aus Bj 832 (Bezirk 1C). Ringspangen und Ringnadeln in Birka, die deutlichen Einfluss von Grossbritannien und Irland auf-weisen, sind wahrscheinlich doch nicht in den Inselreichen hergestellt. Diese Formen scheinen vielmehr über Norwegen eingeführt zu sein, wo die Typen geringfügige Veränderungen erfahren haben. Bei einigen Gegenständen darf man annehmen, dass sie in Norwegen hergestellt sind: die sog. Thistle brooches in Bj 905 und 914, Bezirk 1B bzw. 1E (Graham-Campbell 1984, 3, Birka II:1).
Warners hat in seiner grossen Untersuchung des insulären Metallschmucks in den wikingerzeitlichen Gräbern Nordeuropas (1985) folgende Gegenstände aus den Gräbern von Birka behandelt: Bj 348, einen kleinen Silberbeschlag mit Haken, Bj 464, vergoldete Silber-schliesse mit Nielloeinlagen (Arbman bezeichnet sie 1937, 131 ff. als englisch, dagegen 1943, 132 als karolin-gisch), Bj 511, Ringkreuz aus Bronze (Kap. 12:9, Arwidsson), Bj 844, kleiner, vergoldeter, halbrunder Silberbeschlag. Warners verzeichnet auch insuläre Bronzegefässe und Eimer aus Bj 507, 544, 557, 632, 644, 823 und 854.
Der Armreifen aus Jett ist mit Sicherheit brittischer Herkunft. Werkstätten für die Herstellung von Jettarbeiten kennen wir von der Isle of Man und aus York (Arwidsson 1984, 74f. mit Literaturangaben, Birka II:1).
Die insularen Gräberfunde dominieren mit 7 Gräbern deutlich auf dem Gräberfeld 2, und zwar alle im 2A, in den Bezirken 1B und 1C gibt es je zwei Gräber, dazu eins in 4B, dagegen keins im Bezirk 1A. Wiederum bestätigt das Verbreitungsbild den Gedanken eines Unterschieds zwischen Bezirk 1A einerseits und Bezirk 1C und Gräberfeld 2 andererseits.
4.2. Östlicher Import
Von „östlichem Import" spricht man oft als von einem einheitlichen Begriff, obwohl er Gegenstände aus ganz verschiedenen Gebieten umfasst, z.B. Finnland, das Baltikum, sowie die Gebiete der Slawen, Magyaren, Wolga-Bulgaren oder der Chasaren.
Den deutlichsten Einfluss von Osten zeigt die Tracht in Birka. Sie kann indessen auf dem Wege über Westeuropa hierher gelangt sein. Ich komme im Folgenden darauf zurück.
Die orientalischen Gürtel und die Taschen orientalischer Herkunft (Jansson 1986, 81, Birka II:2) fehlen
ganz auf dem Gräberfeld 2 (die Tasche mit der silberbe-schlagenen Klappe aus Bj 644 ist magyarisch, Gräslund 1984b, 151f, Birka II:1). Sie kommen vielmehr aus 2 Gräbern im Bezirk 1B, aus 4 Gräbern im Bezirk 1B/E, aus 3 Gräbern in 1C, 1 Grab in 1A und einem Grab, das entweder in den Bezirken 1A oder 1B lag. Orientalische Gürtelbeschläge aus Silber, die zu Frauenschmuck umgearbeitet sind (vgl. Kap. 4 oben, Jansson), haben dagegen ihre grösste Verbreitung auf Gräberfeld 2, wo sie in 7 Gräbern vorkommen, ferner in 4 Gräbern des Bezirks 1C, in 3 Gräbern von 1B/E, in 2 Gräbern von 1A und in einem Grab in 1A/D. Alle Gräber lassen sich auf die JBS datieren. Interessant ist der Vorschlag, die beiden Gräber mit den vollständigen orientalischen Gürteln, Bj 716 und 1074, so zu deuten, dass die Männer wohl Skandinavier waren, aber eine kürzere oder längere Zeit im russischen Reich zugebracht hatten (Jansson 1985, 105).
Zum östlichen Import sind wahrscheinlich auch Perlen aus Karneol und Bergkristall zu rechnen. Sie kommen in gut hundert Gräbern von Birka vor, von denen jedoch die allermeisten nur einzelne Perlen aus diesem Material enthalten. Zehn oder mehr Perlen aus Karneol und/oder Bergkristall lagen in 10 Gräbern auf dem Gräberfeld 2, in 5 Gräbern im Bezirk 1B oder E, in 4 Gräbern im Bezirk 1E, in 2 Gräbern im Bezirk 1C und in je einem Grab in den Bezirken 1A, 1B, 1F, 3, 4A, 4C und 4D. Ganze Schmucksätze kommen fast nur auf dem Gräberfeld 2 vor, und hier vor allem in Gräbern der ÄBS (Bj 464, 551, 557, 559). Eine Ausnahme ist, ausser den Gräbern Bj 507, 513 und 632, die alle zu einer frühen Phase der JBS gehören dürften, das späte Grab Bj 639 (mit ovalen Schalenspangen vom Typ P51E, vgl. Jansson 1985, Fig. 108). Auch wenn die Zahl der Gräber aus der JBS mit Perlen aus Karneol und/ oder Bergkristall im Ganzen grösser ist als die der ent-sprechenden Gräber der ÄBS (vgl. Danielsson 1973, 80f.), so zeigt doch die Menge der Perlen pro Grab, dass dies Material höchst charakteristisch für die ÄBS ist.
Die sog. slawische Keramik (Selling 1955, Typ A II, vgl. Ambrosiani & Arrhenius 1973, 132) ist in Birka mit Funden in 62 Gräbern, von denen die meisten schwer datierbar sind, reichlich vertreten. 5 der Gräber gehören jedoch zur ÄBS und 18 zur JBS. Da diese „slawische Keramik" so vielfach an so vielen Orten im Umkreis der Ostsee vorkommt, ist es unsicher, ob sie wirklich als Import vom slawischen Ostseegebiet zu betrachten ist. Wahrscheinlich wurde sie an verschiedenen Orten hergestellt. Hulthén (1984, 255f., Birka II:1) betrachtet die Gefässe, Typ A II, in der Probensamling von Birka aus den Tontypen 1, 3 und 5 als am Ort hergestellt, während die aus dem Tontyp 2 und 4 direkte
Entsprechungen in Wollin haben. Hulthén hält daher ihren Import aus dem Kerngebiet für wahrscheinlich. Die Proben aus dem Tontyp 6 endlich haben eine ähnliche Zusammensetzung des Tons wie in Haithabu. Daher meint Hulthén, die Gefässe seien in Norddeutschland hergestellt.
Auch slawische Silbergegenstände kommen in den Gräbern von Birka vor, die meisten aus der JBS, aber wenigstens zwei aus der ÄBS: Perlen in Bj 557 und ein Anhänger in Bj 854 (Duczko 1985, 111). Die Funde konzentrieren sich verblüffenderweise auf das Gräberfeld 2, wo 7 der 9 fraglichen Gräber liegen. Eins der übrigen liegt im Bezirk 1A und eins in 1B.
Hinsichtlich der Begräbnissitten zeigen vielleicht etwa zwanzig Brandgräber slawischen Einfluss, nämlich die über der Erdoberfläche liegenden Brandschichten (Gräslund 1980, 52f.), die hauptsächlich in den Bezirken 1A/D, 1B/E und 4A zu finden sind.
Die grösste Konzentration der sog. finnischen Keramik (Selling 1955, Typ III A; vgl. Ambrosiani & Arrhenius 1973, 146f.) liegt auf dem Brandgräberfeld südlich der Burg (4) mit 9 Gräbern. Von den hier zum Vergleich herangezogenen Körpergräberfeldern ist dagegen das Gräberfeld 2 mit nur einem Grab vertreten, während die Keramik, Typ A III in 5 Gräbern des Bezirks 1C, in 3 Gräbern von 1B und 2 Gräbern von Bezirk 1A vorliegt.
Nur wenige Gegenstände finnischer Herkunft liegen in Birka vor. Eine finnische Form der Ringspangen hat vieleckige Endknäufe mit Zäpfchen. Sie gehört zur JBS und kommt in acht Gräbern von Birka vor (Thålin, 1984, 15, 17; Ginters 1984, 27f., Birka II:1). Sie verteilen sich auf vier Männergräber, drei Frauengräber und ein Doppelgrab. Ein Grab liegt im Bezirk 1A, eins in 1A oder B, eins in 1B, eins in 1D, eins in 1F, und zwei auf dem Gräberfeld 2. Die letzteren sind beide Frauengräber. Auch die runde Schlangenspange aus Bj 104 (Bezirk 1B/E) stammt aus Finnland, sowie der vogel-förmige Anhänger im Sarggrab Bj 759 (Bezirk 1C; Kivikoski 1937, 241 ff.). Zwei Exemplare von Feuerstahl mit Bronzegriff unter den Funden von Birka (Bj 644, Gräberfeld 2 und Bj 776, Bezirk 1C) sind wahrscheinlich auch auf finnländischem Gebiet hergestellt (Hårdh 1984, 159, Birka II:1). Die finnischen Funde verteilen sich gleichmässig ohne eine deutliche Konzentration.
Zu den rein baltischen Gegenständen gehört ein kammförmiger Anhänger in Bj 1162 (Bezirk 1D) und die Prachtkopfgestelle aus Bj 832 und 842 (Bezirk 1C; Arwidsson 1986, 137ff., Birka II:2). Ferner hat Ginters (1984, 28f.; Birka II:1) mehrere Ringspangen vom Typ der mit Flechtbändern verzierten Endknäufe als baltisch identifiziert. Zwei davon lagen in Gräbern des Bezirks 1A, zwei im Bezirk 1C und eine auf dem Gräberfeld 2.
Resultate der Birka-Forschung 159
4.3. Zusammenfassung über das Vorkommen von Import
Es ist schwer, einzelne Gräber anzugeben, deren Inventar in besonderem Maasse von Osten oder Westen be-einflusst wäre. Mehrere östliche Elemente enthalten aber z.B. die Männergräber Bj 716 (Bezirk 1C) mit dem orientalischen Gürtel, einer Tasche mit Überklappdek-kel von orientalischem Typ, orientalischen Knöpfen und einer wahrscheinlich lettischen Ringspange, und Bj 1074 (Bezirk 1A oder 1B) mit orientalischem Gürtel, orientalischen Knöpfen und einer finnischen Ringspange. Das Kammergrab Bj 854 sei als Beispiel eines Grabs mit vielen westeuropäischen Gegenständen gewählt: mehrere Spangen, ein Trichterbecher, Gefässe zum Aufhängen und eine friesische Kanne. Ganz allgemein sieht man eine Tendenz des Vorwiegens westeuropäischer Gegenstände auf dem Gräberfeld 2 und in den frühen Gräbern des Bezirks 1B. Aber auch im Bezirk 1C gibt es Beispiele westlichen Imports, dagegen sind sie im Bezirk 1A sehr spärlich.
In den wirklich reichen Kammergräbern der JBS ist der Inhalt gemischt, so enthält z.B. Bj 832 u.a. eine Ringnadel mit Kugelkopf, die man an sich als nordisches Produkt betrachtet, das aber stark englisch beein-flusst ist, und das baltische Prachtkopfgestell des Pferdes. Die ganzen Fundkombinationen der Doppelgräber Bj 644 (Gräberfeld 2) und Bj 750 (Bezirk 1C) sind in Birka I abgebildet (Arbman 1943, Abb. 183, bzw. 218). Ein Vergleich zeigt die Mischung von Östlichem und Westlichem in beiden deutlich - erstaunlicherweise dominiert in Bj 644 das Östliche - man hätte eher das Gegenteil erwartet!
Die Form der Tracht zeigt sehr starke Einflüsse vom Osten, das gilt ebenso für mehrere der einzelnen Klei-dungsstücke (Hägg 1984A, 206) wie auch für die rang-kennzeichnenden Elemente der Tracht, die in erstaunlich grosser Zahl in den Körpergräbern von Birka vorkommen (Hägg 1984A, 211 ff.).
Die südöstlichen Züge der Tracht aus dem Kulturgebiet von Byzanz-Kiew werden besonders deutlich in der JBS: die Anwendung von Leinen nimmt auf Kosten der Wolle zu, das südslawische gaufrierte Hemd wird eingeführt, ebenso die Verwendung von Seidenapplikationen und Borten mit Silberschuss an der Tunika und der Kopfbedeckung. Diese Elemente betrachtet Hägg indessen nicht als ethnisch bedingt, sondern als Kennzeichnung des Rangs. Sie kommen an der fränkischen Hoftracht vor, die auf die Zeremoniekleidung am byzantinischen Kaiserhof zurückgeht. Seide wurde ebenso hoch bewertet wie Gold, und wer Kleider aus Seide oder mit Seidenbesatz trug oder in ihnen begraben wurde, war eine fürstliche Person (Hägg 1984A,
160 Anne-Sofie Gräslund
206ff.). Hägg meint, dass die reich mit Textilien ausge-statteten Gräber von Birka die höfische Umgebung des Königs von Svealand repräsentieren. Dagegen lässt sich einwenden, dass in dem Falle die mit dem Hof verbundenen Personen, und vor allem die Frauen, unwahrscheinlich zahlreich wären. Dass es sich um eine gesellschaftliche Oberklasse handelt, kann nicht bezweifelt werden, aber kann diese ganze Oberklasse mit dem Hof verbunden gewesen sein? Letzten Endes ist es vielleicht eine Definitionsfrage, ob man die ganze Oberschicht der Kaufleute zum Hof rechnen will, oder nur den engeren Kreis, der den König direkt umgab.
nergrab Bj 643 bei einer Neubestimmung auf 948/49 festgelegt wurde. Der von Kyhlberg angedeutete soziale/ethnische Zusammenhang zwischen Gräberfeld 2 und den Bezirken 1A und 1C (1980A, 81) kann auf Grund der oben gegebenen Übersicht über die Verbreitung verschiedener Kategorien von Gegenständen für die Relation zwischen Gräberfeld 2 und Bezirk 1A mit Bestimmtheit abgewiesen werden, während zwischen Gräberfeld 2 und 1C ein gewisser Zusammenhang zu bestehen scheint.
5. Die Entstehung der Gräberfelder
Der Gedanke, dass die zusammenhängenden Gräberfelder durch die Expansion ursprünglicher Gräberplätze für eine Familie, eine Sippe oder eine ethnische Gruppe entstanden sind, erscheint sehr plausibel. Der deutliche Unterschied zwischen Gräberfeld 2 und bis zu einem gewissen Grade Bezirk 1C einerseits, und dem Bezirk 1A andererseits deutet darauf, dass es sich um verschiedene Bevölkerungsgruppen handeln muss. Um eventuell ein Bild derselben zeichnen zu können, wie sie uns für verschiedene Gräberfelder der Eisenzeit auf Bornholm vorliegen (Jørgensen 1987, 75ff.), wäre eine äusserst genaue Detailanalyse notwendig, die im vorliegenden Zusammenhang nicht möglich ist. Man muss dabei auch das besondere, wahrscheinlich dynamische Milieu eines Handelscentrums wie Birka berücksichtigen, was die Aufgabe sicher im Vergleich zu einer eher statischen Dorfgemeinschaft erschwert.
Kyhlberg hat mit Hilfe der Seriationsmethode, ausgeführt an einer Auswahl von Münzen, Keramik, Kämmen und Perlen, die verschiedenen Gräberfeldbezirke chronologisch gruppiert. Seinem Resultat, dass die Bezirke 1D, 1E und 1F die am frühsten angelegten wären (1980A, 54ff., 81), widersprechen die offenbar sehr frühen Gräber in den Bezirken 1B und 2A (Gräslund 1980, 73f.). Kyhlberg legt die Hypothese vor, dass das Gräberfeld 2 nicht mehr kontinuierlich angewendet wurde zur Zeit, als der Stadtwall gebaut wurde, nach Kyhlberg seit den Jahren 925-935, und dass die Begräbnisse der Bevölkerungsgruppe, die Gräberfeld 2 verwendet hatte, jetzt in die Bezirke 1A und 1C verlegt wurden. Dagegen spricht, dass auf dem Gräberfeld 2 ganze 14 (vielleicht 15 - Bj 505?) Frauengräber mit ovalen Schalenspangen der späten Typen liegen, nämlich P51C, P51 die Snåsavariante, und P52 (Jansson 1985, 174f. und Fig. 108). Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Prägung der Samanidenmünze aus dem Män-
6. Christliche Grabbeigaben
Mit dem Problem, die Christen in Birka zu identifizieren, habe ich mich bereits früher befasst (Gräslund 1980, 83ff.; 1985, 301ff.). Dabei habe ich hauptsächlich vier Fragen behandelt, nämlich die Methode der Beisetzung (Beerdigung oder Verbrennung), die Orientierung der Gräber (bedeutet west-östliche Orientierung immer Christentum?), die Ausstattung der Gräber im allgemeinen, aber auch mit spezifisch christlichen Gegenständen, und die Lage der Gräber (d.h. die Indikationen für einen christlichen Begräbnisplatz im Bezirk 2A). Nach den hier festgestellten Unterschieden vor allem zwischen Gräberfeld 2 und Abschnitt 1A erhebt sich die Frage, ob auch religiös bedingte Unterschiede wahrzunehmen sind. Die Leichenverbrennung, die als heidnischer Gebrauch zu betrachten ist, dominiert stark in den östlichen Teilen von Hemlanden (1D, E und F) sowie auf den Gräberfeldern 3 und 4, während die Beerdigung auf dem Gräberfeld 2 so gut wie ausschliesslich vorkommt und in den Bezirken 1A, B und C dominiert -jedenfalls innerhalb und zunächst ausserhalb des Walls und unter demselben. Die Verbreitung der Kreuze, bzw. der Thorshammerringe, erweist sich bei den erste-ren als ziemlich gleichmässig, sie lagen in 2 Gräbern im Bezirk 1A, in drei Gräbern in 1C und in 4 Gräbern auf dem Gräberfeld 2 (3 davon auf 2A und eins auf 2B). Die Mehrzahl der Thorshammerringe kommt aus den verschiedenen Bezirken auf Hemlanden (1A, B, C, E und F) und vom Bezirk 4A (Ström 1984, 130f., Birka II:1). Bis auf eine Ausnahme fehlen sie ganz auf den Gräberfeldern 2 und 3. Die Ausnahme ist Bj 486, ein Schachtgrab, das im Bezirk 2B peripher ganz im Westen liegt und weder andere Funde noch Skelettreste enthielt. Auch war der Schacht mit Steinen gefüllt, was nicht üblich ist. Im Bezirk 1A lagen 4 der 9 Körpergräber mit Thorshammerringen von Birka (3 Männergräber und 1 Frauengrab), und zu 1B und 1C gehörten je 2 (ein Männer- und ein Frauengrab, bzw. zwei Männergräber).
Ein Element der Begräbnissitten, das wahrscheinlich
Resultate der Birka-Forschung 161
heidnisch ist, ist der Grabhügel, der ja auch später als Symbol des Heidentums galt. Nur bei drei der neun Körpergräber mit Thorshammerringen gibt Stolpe einen Hügel an (Bj 985 und 1081 im Bezirk 1A und Bj 872 in 1C). Auch Bj 858, das unter dem Stadtwall liegt, kann vielleicht einen Hügel gehabt haben, während die übrigen fünf Gräber unter der flachen Erde lagen.
Bei den Gräbern mit Kreuz ist ein ev. Hügel für drei Gräber unbekannt, während bei einem ein sehr flacher Hügel angegeben wird. Zwei liegen unter dem Wall (und können also vielleicht einen Hügel gehabt haben), 2 Gräber liegen unter der Flachen Erde. Allgemein gibt es zahlreiche Gräber unter der flachen Erde auf Gräberfeld 2, wo nur im zentralen Teil von 2 A Hügel angegeben sind, und im Bezirk 1A innerhalb des Walls ebenso, aber in geringerer Anzahl wegen der allgemein dünneren Belegung, im Bezirk 1B und 1C innerhalb des Walls.
Ein Gegenstand von vielleicht heidnischer Bedeutung könnten die Eissporen sein. Sie kommen in vielen Gräbern vor und können entweder ganz rationell als Zeichen eines Winterbegräbnisses gedeutet werden, oder man schreibt ihnen eine symbolische Bedeutung zu als sog. Heischuhe, die in der isländischen Literatur vorkommen, d.h. als ein Hilfsmittel auf dem glatten und schlüpfrigen Weg ins Totenreich Hel (Strömbäck 1961, Sp. 411f.).
Im Zusammenhang mit dem Christentum in Birka taucht häufig die Frage auf, ob die orthodoxe Kirche dort einen Einfluss gehabt hat, was mit Rücksicht auf die Kontakte im Osten nicht unwahrscheinlich wäre. Hägg hat bei der Besprechung der orientalischen Züge der Tracht darauf hingewiesen, dass die goldbestickten Seidentaschen aus Bj 735 und 832 (beide im Bezirk 1C) als Reliquientaschen zu deuten sind, die aus dem griechischorthodoxen Gebiet des Christentums stammen, nicht aus dem mohammedanischen Orient (Hägg 1984A, 213f.). Sonst ist es schwer, Belege für christlichen Einfluss aus dem Osten zu finden. Sog. Auferste-hungseier aus glasiertem Ton aus dem Gebiet von Kiew, die man auf Gotland und in Sigtuna trifft, (Arbman 1946, 73ff.), fehlen in Birka. Direkte Entsprechungen der gepunzten Silberblechkreuze hat man zwar in Kiew gefunden, aber hier zusammen mit ovalen Schalenspangen in den Gräbern (Gräslund 1984A, 116, Birka II:1 mit Literaturangaben).
7. Die Gräberfelder von Grindsbacka und Kärrbacka
Wir sagten schon, dass man die Gräber ohne Beigaben oder fast ohne Beigaben gerne als christlich gedeutet
hat, was vermutlich für viele von ihnen zutrifft. Ausser den früher genannten Gebieten mit solchen Gräbern im Gräberbezirk 2 und ganz im Norden von 1A, müssen auch Grindsbacka (Gräberbezirk 5) und Lilla Kärrbacka (Bezirk 6A) genannt werden.
Die Pläne dieser beiden Bezirke (Birka I, Taf. IV-V) zeigen deutlich, dass es sich um den Typ von Gräberfeldern handelt, die man als spätwikingerzeitlich zu bezeichnen pflegt, nämlich mit Gräbern in Form von ungefüllten, rechteckigen, häufig zusammengebauten Steinsetzungen. Sie unterscheiden sich damit von den Gräbern ohne Beigaben in den Bezirken 2A-2B und 1A.
Unter den ausgegrabenen Gräbern von Lilla Kärrbacka gab es nur ein Brandgrab, fünf Sarggräber und sechs Schachtgräber. Das Brandgrab ist eins der ziemlich wenigen Beispiele in Birka für eine Leichenverbrennung am Grabplatz selbst (Gräslund 1980, 61 f.). Die Sarg- und Schachtgräber zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zur Gesamtheit der Gräber von Birka ungewöhnlich schmal sind und dass sie entweder ganz leer sind oder nur ein Messer, eine Perle oder eine Münze enthalten.
Ungefähr das gleiche Bild ergibt sich bei Grindsbacka. Die Zahl der ausgegrabenen Gräber ist hier grösser: 35 Stück. Zwölf davon sind Brandgräber, alle mit einer Urne in der Brandschicht. Das Grabgut besteht aus einer kleinen Anzahl von Nägeln und Nieten (in einem Fall 40 St.), Krampen, Kammfragmenten, Eissporen, einzelnen Perlen (in einem Grab 40 St.) und in zwei Gräbern aus Thorshammerringen. Eine osteologische Untersuchung der Knochen u.a. von Grindsbacka in den 1970-er Jahren ergab, dass die Knochenfunde in allen analysierten Gräbern ausser vom Menschen auch von Tieren kamen, oftmals mehrere von folgenden Arten: Pferd, Hund, Schwein, Schaf/Ziege, Katze, Hahn (vgl. Kap. 28 oben, Arwidsson). Schon die Lei-chenverbrennung bedeutet ja, dass es sich um heidnische Gräber handelt, was die Tierknochen und die Thorshammerringe bestätigen.
Die Brandgräber von Grindsbacka machen nicht alle denselben späten Eindruck wie die Körpergräber. Leider ist die äussere Form der Gräber in der Mehrzahl der Fälle unbekannt, aber wenigstens in drei Fällen handelt es sich um niedrige (runde) Hügel, in einem Fall um einen runden Steinkreis und in einem um eine vierek-kige Steinsetzung. Ein Kammfragment in Bj 682 vom Typ A 2 deutet wahrscheinlich darauf, dass dies Grab nicht später als auf die frühe JBS anzusetzen ist (K. Ambrosiani 1981, 78f.). Kyhlberg hat auch nachgewiesen, dass die Typen der Keramik vom Grindsbackafeld, die ausschliesslich aus den Brandgräbern kommt, zum grossen Teil mit den Typen der Keramik vom Bezirk 1A
162 Anne-Sofie Gräslund
übereinstimmen (Kyhlberg 1980A, 64, 68). Die Brandgräber sind jedoch nur ein kleinerer Teil der
untersuchten Gräber von Grindsbacka, 23 Körpergräber verteilen sich auf 9 Sarggräber und 14 Schachtgräber. Wie auf Kärrbacka sind beide Grabformen ungewöhnlich schmal, die Särge waren meistens nicht breiter als 40 cm (Gräslund 1980, 15f.). Ganz ohne Beigaben waren drei Sarggräber und acht Schachtgräber, die übrigen enthielten ein Messer, in einem Fall ein Messer und einen Schleifstein und in einem anderen eine Schelle, einen Eisenring und einen kleinen Eisen-zain.
Drei der Schachtgräber waren Kindergräber, ausserdem lagen in Bj 684, dem Schachtgrab mit der Schelle, wahrscheinlich ein Erwachsener und ein Kind begraben.
Die äussere Form der Gräber und das Fehlen oder die Sparsamkeit der Grabbeigaben erlauben den Schluss, dass es sich um sehr späte Gräber, wahrscheinlich aus der letzten Zeit Birkas als Handelszentrum, handelt. Birkas Rolle als wichtigster Handelsplatz im Mälarge-biet sollte von Sigtuna übernommen werden, was wahrscheinlich gegen Ende des 10. Jahrhunderts geschah. Eins der ältesten in Sigtuna bekannten Gräberfelder, der sog. Kalvhagen, auf dem Gustaf Hallström einige Gräber untersucht hat, erinnert stark an das Gräberfeld Grindsbacka mit Brand- und Körpergräbern unter niedrigen Hügeln bzw. viereckigen Steinsetzungen. Hallström betrachtet das ganze Gräberfeld als heidnisch: „dass christliche (Körper-)Gräber Seite an Seite mit heidnischen Brandgräbern angelegt worden wären zu einer Zeit, als der Religionseifer so fanatisch war, ist unglaubhaft. Auch hätte man heidnische Sitten auf geweihter Erde nicht geduldet" (Hallström 1923, 1ff.).
Trotz allem war dies vielleicht nicht so völlig unglaubhaft - teils ist der Synkretismus, der sicher in der Übergangszeit vorkam, zu beachten (dass man Christus und die alten Götter zugleich verehrte), teils wissen wir aus der ältesten christlichen Zeit in Rom und Gallien, dass die Christen keine eigenen Friedhöfe hatten, sondern ihre Toten auf den vorhandenen Begräbnisplätzen bestatteten (Gräslund 1985, 298 mit Literaturangaben; 1987, 256ff.). Nach meiner Ansicht hindert nichts, dass nicht wenigstens die „Halbchristlichen" gerade in der Übergangszeit auf heidnischen Gräberfeldern beigesetzt wurden.
8. Einige Schlussfolgerungen
Die reich ausgestatteten Gräber, vor allem die Kam-mergräber von Birka, gehören sicher einer Oberschicht der Kaufleute, sie liefern deutliche Zeugnisse von den
internationalen Kontakten Birkas. Der klare Unterschied zwischen Gräberbezirken 2A-2B und Bezirk 1C einerseits und Bezirk 1A andererseits, u.a. hinsichtlich der Waffengräber, der Schmuckbeigaben und der Klei-dungssitte, der sich aus der obigen Analyse ergeben hat, zeigt, dass die in den ersteren Abschnitten Bestatteten vor allem in der ÄBS gute Kontakte mit Westeuropa hatten. Auch in der JBS gibt es Belege für diese Verbindungen, aber ausserdem sind dann östliche Anknüpfungen deutlicher zu erkennen.
Vielleicht könnte man die Analyse als eine Bestätigung des Gedankens betrachten, dass Gräberfeld 2 und Bezirk 1C das von Hägg (1984A 206ff.) vorgeschlagene „Hofmilieu" repräsentieren. Die Sitte der Grabkammern an sich scheint jedoch eine Innovation zu sein, die mit dem internationalen Milieu von Birka zusammenhängt; solche Gräber liegen bisher z.B. nicht auf Adelsö oder anderen vermutlichen Königsgüter vor (Gräslund 1980, 81). Der Handel war wahrscheinlich in erster Linie ein königliches Privilegium, was die Verbindung der Oberschicht der Kaufleute mit dem Hofe natürlich erscheinen lässt. Auch die beherrschende Lage von Gräberfeld 2 auf dem Abhang zwischen der Burg und dem Stadtgebiet mag für diese Deutung sprechen. Die deutliche Dominanz der Gräber mit Waffen und Pferden im Bezirk 1C könnte es dann wahrscheinlich machen, dasselbe als den besonderen Gräberfeldabschnitt der Gefolgschaft zu betrachten. Dieser Teil von Hemlanden liegt ja auch Gräberfeld 2 am nächsten. Von der Sitte einer den Häuptling umgebenden Gefolgschaft („hird") von bewaffneten jungen Männern bei den Germanen spricht schon Tacitus. Wenn solche Gefolgsleute starben, wurden sie vermutlich meistens auf die Höfe ihres Geschlechts überführt. Vielleicht waren die Verhältnisse in Birka andersartig. Die Sitte hat sicher während der ganzen Eisenzeit bestanden und ist in den schwedischen Provinzgesetzen (schw. „Landskapslagar") belegt (Wührer 1960, Sp. 89ff.).
Dass eine nahe Verbindung zwischen Birka und der Zentralmacht des Königs vorausgesetzt werden kann, stützt u.a. Rimberts Darstellung. Ein archäologisches Argument hierfür besteht darin, dass die Ausstattung der Körpergräber, mit Schmuck so gut wie mit Waffen, eher mit den Gräbern des mittleren Uppland, dem Zentrum des Svea-Reiches, zusammengehört, während der Hauptteil der Brandgräber, in denen Schalenspangen und Waffen ungewöhnlich sind, eher an die Gräber anschliesst, die in der Nachbarschaft Birkas im Mälartal liegen (Simonsson 1969A, 41 f.; Gräslund 1980, 81 f.; Jansson 1985, 152 ff.).
Eine andere Gruppe von Gräbern, die sich teils durch ihren markanten Reichtum, teils durch ihre ganz besondere Lage auszeichnet, bilden die Gräber auf der
Resultate der Birka-Forschung 163
Terasse, Bezirk 1A. Sie gehören alle zur JBS, die meisten wahrscheinlich zu einer späten Phase derselben. Beachtenswert ist Häggs Hinweis darauf, dass die Män-nertracht in Bj 944 die prachtvollste ist, die wir aus den Gräbern von Birka kennen (1986, 68), sowie Janssons Beobachtung, dass silberverzierte ovale Spangen und Silbergegenstände im Bezirk 1A nur auf der Terasse und konzentriert um Bj 946 vorkommen (1985, 49). Bj
944 und 946 liegen zwar nicht auf der Terasse, aber doch nur 30-40 m südlich von ihr. Die chronologische Spann-weite der reichen Gräber im Bezirk 1A ist wesentlich geringer als die der Gräber auf dem Gräberfeld 2. Sie gehören vielmehr zu einer beschränkten, späten Phase der Existenz von Birka. Vermutlich repräsentieren sie eine Bevölkerungsschicht, die in dieser späten Zeit grosse Bedeutung erlangte.
30. Verzeichnis sämtlicher Beiträge im
Birka II:1-3
Greta Arwidsson
A Trachtzubehör und Schmuck der Männer D Waffen Bügelfibeln, Arrhenius Kugelnadel aus Bj 832, Duczko Penannular Brooches and ringed pins,
Graham-Campbell Ringnadeln, Thunmark-Nylén Ringspangen, Thålin Ringspangen von östlichem Typ, Ginters Gürtel und Gürtelzubehör von orient. Typ,
Jansson Gürtelzubehör, übrige, Mälarstedt
B Trachtzubehör und Schmuck der Frauen Anghänger, Arwidsson, Duczko, Callmer, Jansson II:3 Armringe, Armbügel und Fingerringe,
Aiken und A rwidsson II:2 Bernstein, Arwidsson II:3 Echte Perlen an Anhängern aus Silberdraht,
Arwidsson II:3 Gleicharmige Spangen, Aagärd II: 1 Ketten, Arwidsson II:3 Kleeblattfibeln, Hårdh 11:1 Metallperlen, Arwidsson 11:3 Ovale Schalenspangen, Jansson II: 1 Perlengarnituren, Arwidsson 11:3 Rundspangen, grosse und kleine, Jansson II: 1 Verschiedene Schmuckgegenstände (Männer-
und Frauenfiguren, Pferde- und Vogelfiguren), Arwidsson 11:3
Spangen, Fibeln, Schmuckstücke und Beschläge, verschiedener Einzelformen, Arwidsson 11:3 (Finnländische runde Spange. Gotländische dosen-förmige Spange, Kreuzförmige Bronzespange aus Bj 1079, Bronzespange aus Bj 418, Zungenförmige Bronzespange, Vergoldete Bronzefibeln, Gotländische Silberbrakteaten, Ringkreuzförmiges Schmuckstück aus Bj 511.)
C Die Tracht Die Tracht, Hase II: 2
F Pferdeausrüstung Zaumzeug, Reitausrüstung und Beschirrung,
Forsåker Kopfgestelle aus den Gräbern Bj 832 und 842,
Arwidsson Kumtbeschläge, Strömberg
G Gegenstände des heidnischen und christlichen Kults Kreuzanhänger, Kruzifix und Reliquiaranhänger,
Gräslund Silberkapsel aus dem Grab Bj 464, Arwidsson Thorshammerringe usw., Ström
H Beutel und Taschen Beutel und Taschen, Gräslund
I Toilettengegenstände und verschiedene Kleingeräte, Spielzubehör Feuerstahle, Hårdh Glättsteine und Glättbretter, Arwidsson Glöckchen aus Bronze, Arwidsson Klappmesser, Arwidsson Kämme, Ambrosiani Messer, Arrhenius Messerscheiden, Arwidsson Nadelbüchsen, Mälarstedt
32. Verzeichnis
der Gegenstände, die in den Bänden Birka II:1-3 nicht behandelt werden, die aber auf den Tafeln von Birka I abgebildet und im Katalog dieses Bandes enthalten sind. Gegebenenfalls verweisen wir auf andere Publikationen,
in denen diese Gegenstände beschrieben, erwähnt oder abgebildet werden. Vgl. auch die Literaturangaben in diesen Arbeiten.
Hinweis auf andere Schriften
Anhänger mit Filigran und Granulation siehe Duczko 1985.
Textilien. Siehe Birka III (Geijer 1943) und Geijer 1980 (vgl. Arwidsson 1988).
34. Zu den Fundtabellen in BIRKA, Band II:1-3
Für die Mehrzahl der systematischen Analysen der in Band II behandelten Gegenstände haben wir möglichst einheitlich formulierte Fundtabellen ausgeführt, wobei jedoch inhaltlich bedingte Variationen in der Form vorkommen können. Zweck dieser Tabellen ist es, Fakta wie die Verteilung auf Männer- und Frauengräber, die Fundfrequenz in verschiedenen Gräbertypen und die Verteilung auf die einzelnen Gräberfeldbezirke in übersichtlicher Form zusammenzufassen, sodass sie bei Untersuchungen auf Spezialgebieten leicht zugänglich sind.
Verzeichnis der Fundtabellen in Birka II:1-3
35. Berichtigungen zu Birka I, Textteil und Tafeln, gemäss Kontrollen von
Anne-Sofie Gräslund, 1974-1976
Bj 154 Bronzebeschlag, Taf. 91:3 ist ein Fragment einer ovalen Schalenspange, Typ P52, mit separater Krone (vgl. Taf. 68:3), gemäss I. J.
Bj 464 Perlen, Taf. 115:15 und Taf. 123:7, signiert mit Bj 464 (?) gehören sicher zu Bj 1161 gemäss dem Textteil von Birka I. (Bandförmiges Eisenfragment = Eispickel.)
Bj 502 Bronzeanhänger, Taf. 98:24, fälschlich als zu Bj 504 gehörig angegeben (korrekt im Textteil).
Bj 504 Die Schalenspange, Taf. 61:7, gehört nicht, wie angegeben, zu Bj 504, sondern zu Bj 535 (im Textteil bei beiden Gräbern korrigiert).
Bj 542 Ringnadel, Taf. 42:3, signiert als zu Bj 581 gehörig, gehört zu Bj 542, im Textteil berichtigt.
Bj 639 Anhänger, Taf. 98:17, mit Bj 639 signiert, kann vielleicht zu Bj 844 gehören. Im Textteil bei beiden
Gräbern notiert. Bj 649 Glasbecher, Taf. 189:2, soll heissen: 189:3. Bj 845 Anhänger, Taf. 96:19, 20, signiert „ohne Grabnummer"
gehören vielleicht zu Bj 845 (Bemerkung im Textteil). Zwei Anhänger, Taf. 99:15, 16, und ein Armband, Taf. 110:2, sind Bj 845 signiert, gehören aber wahrscheinlich zu Bj 843 B (im Textteil notiert).
Bj 886 Schildbeschlag ist falsch signiert, er liegt in Bj 628 (Annahme von I. J. nach Mitteilung von G. A.).
Bj 954 Ringspange, Taf. 53:5, gehört vermutlich zu Bj 957. Bj 1069 Ringspange, Taf. 54:4, ist falsch signiert, gehört zu Bj
1062. Bj 1080 Gleicharmige Spange, Taf. 80:1 und ovale Schalenspange,
Taf. 66:6, sind falsch signiert, sie gehören zu Bj 1081 (im Textteil notiert).