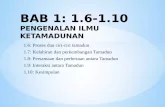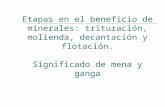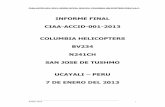Iuvavus-1
Transcript of Iuvavus-1
I ◄
RÖMISCHES ÖSTERREICHJAHRESSCHRIFT DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE
JAHRGANG 33 2010
HANNSJÖRG UBL ZUM
65. GEBURTSTAG
mit einer Druckkostensubvention
des Landes Niederösterreich
WIEN 2010
IM SELBSTVERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE
0000_I-VI_RÖ 33 2010_DRUCKDATEN_Vorspann_03-11-2010.indd 1 03.11.2010 23:14:39
► II
Beiträge werden erbeten an den Herausgeber, Univ.-Prof. Dr. Peter Scherrer, unter der Adresse: Institut für Archäologie, Universität Graz,
Universitätsplatz 3/II, 8010 Graz oder
per E-Mail: [email protected]
Richtlinien zur Publikation: siehe www.univie.ac.at/oega/ oder RÖ 29, 2006, 171 ff.
Sigle: RÖ 33, 2010
Offenlegung gemäß Mediengesetz: Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichische Gesellschaft für Archäologie
Herausgegeben und redigiert vonPeter Scherrer
Satz und Layout: Maria Scherrer, 1160 Wien Lektorat: Mag. Ulrike Zdimal-Lang, 1170 Wien
Druck: Prime Rate Kft., BudapestTitelbild: Balsamarium, Beitrag Lang et aL., Abb. 141
Umschlagbild Rückseite: Altar aus Salzburg, Beitrag HaInzmann, Abb. 2a (© BDA)
Grundlegende Richtung: Römisches Österreich ist eine parteiunabhängige wissenschaftliche Fachzeitschrift, sie bringt Publikationen zur römerzeitlichen Geschichte und Archäologie des österreichischen Raumes
und seiner Nachbargebiete.
0000_I-VI_RÖ 33 2010_DRUCKDATEN_Vorspann_03-11-2010.indd 2 03.11.2010 23:14:39
V ◄
INHALT
w.HR i. R. Dr. Gunter Fitz zum Siebziger ................................................................. III
RobeRt FleischeR
Zu alten und neuen Forschungen in Immurium/Moosham ....................................... 1
ManFRed hainzMann
IUVAVUS – Römischer Stadtgott oder norische Flussgottheit?Teil 1: Die epigraphischen Befunde .......................................................................... 23
chRistoph KleiseR
Zwei Helmkreuzbänder aus Ostösterreich ................................................................ 35
ReinhaRd lang – Mit beitRägen von anja dRacK, gunteR Fitz, René ployeR und alexandRa steineR
Depot- und Siedlungsfunde der späten Römischen Kaiserzeit aus dem Karth im südlichen Niederösterreich ........................................................................ 43
RobeRt poRod
Wo lag Noreia? Eine neue philologische Deutung von Strabon V 1, 8 .............................................. 113
alexandRa puhM – susanne tieFengRabeR Mit eineM beitRag von KaRl peitleR
Die Sammlung Dr. Lopatka aus Lebing, Gem. Eichbach, Steiermark ..................... 117
WolFgang vetteRs
Wo lag das Gold der Norischen Taurisker? Eine Neuinterpretation eines Textes von Strabon/Polybios aus geologischer Sicht ..................................................................................................... 123
isabella WalseR
Überlegungen zum Bodenmosaik der frühchristlichen Coemeterialkirche in Teurnia – Versuch einer Lesart ............................................................................. 141
ingRid WebeR-hiden – MaRita holzneR
Annona Epigraphica 2009 ......................................................................................... 149
güntheR deMbsKi
Collezioni e Musei Archeologici del Veneto: Gemme dei Civici Musei D’Arte di Verona a cura di Gemma Sena Chiesa. Testi di Alessandra Magni – Gemma Siena Chiesa – Gabriella Tassinari .............................................................. 165
0000_I-VI_RÖ 33 2010_DRUCKDATEN_Vorspann_03-11-2010.indd 5 03.11.2010 23:14:40
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
23 ◄
Römisches östeRReich 33, 2010
manFRed hainzmann*
IUVAVUS – RÖMISCHER STADTGOTT ODERNORISCHE FLUSSGOTTHEIT?
Teil 1: Die epigraphischen Befunde**
Bei Grabungen des Bundesdenkmalamtes im Jahre 2008 wurde auf dem Salzburger Resi-denzplatz „westlich des Residenzbrunnens innerhalb der nördlich einer West-Ost verlau-fenden Straße freigelegten römischen Gebäude in Versturzlage mit Schriftseite nach oben“ ein aus grobkörnigem Konglomerat bestehender Weihaltar gefunden, dessen Inschrift mit einem bislang unbekannten Götternamen IUVAVUS aufwartet. Christa Farka hat zu diesem Neufund bereits 2009 sowohl eine erste ausführliche Beschreibung als auch eine Erst-edition der Inschrift vorgelegt.1 Ihrer Einschätzung nach handelt es sich um einen Altar, der „anlässlich eines glücklich überstandenen Flusstransportes eben diesen Göttern [Iuppiter und Iuvavus] geweiht“ wurde.2 Auf die Frage, ob denn mit dem Götternamen vielleicht auch ein Stadtgott gemeint sein könnte, geht sie in ihrem Aufsatz nicht ein. Daher wollen wir uns dieser Frage widmen und hier zunächst einmal die für die Problematik relevanten epigraphischen Testimonien vorstellen. Der umfangreiche Kommentar von Farka behandelt so gut wie alle Aspekte des Römersteines. Trotzdem sind ein paar ergänzende Bemerkungen zur 6-zeiligen Widmungsinschrift unumgänglich. Denn es lässt sich zeigen, dass Farkas Lesung in einem Punkt korrigiert werden muss.
Die in eleganter Capitalis gefertigte Inschrift weicht nur in der letzten Zeile (Z. 6) von der Zentrierung des Textes ab. Aufgrund der allseitigen Verwitterung sind von den tief ein-gegrabenen Buchstaben oft nur mehr dünne Striche erhalten geblieben. Den Absplitterungen an der linken vorderen Schaftkante ist nur der Anfangsbuchstabe von Zeile 3 – ein P – zum Opfer gefallen. Der ungewöhnlich breite Zeilenabstand zwischen dem Götterformular (in Z. 1–2) und der dritten Textzeile ist durch einen großen Einschluss im Konglomerat bedingt. Ansonsten zeigt der Schriftcharakter mit seinen Haar- und Schatten strichen keine Beson-derheiten. Trotz Abwitterung sind an mehreren Stellen noch die Worttrenner in Form von puncta triangularia auszumachen. Unübersehbar sind dagegen die drei TI-Ligaturen, einein Zeile 4, die beiden anderen in Zeile 5. Vom Anfangsbuchstaben der Kopula (Z. 2) haben sich ebenfalls noch deutliche Reste erhalten, desgleichen vom S am Ende der 6. Zeile. Irrig ist einzig die von Farka publizierte Transkription des Gentilnamens MARII in Zeile 4.3 Nur in Ausnahmefällen erscheint in den Monumentalinschriften der Genitiv von Personennamen auf -ius geminiertem Vokal4.
* Anschrift des Autors: Manfred Hainzmann, Karl-Franzens-Universität, Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Universitätsplatz 3/II, 8010 Graz; E-Mail: manfred.hainzmann@uni-graz. at.
** Teil 2 (Die literarischen Quellen und der linguistische Befund) erscheint im nächsten Band.
1 Farka 2009. 2 Farka 2009, 26. 3 Farka 2009, 24. 4 Vgl. die Beispiele in ILLPRON 0535, 1473 und 1819. –
Solcher Schreibung begegnet man verständlicherweise nur im Nominativ Plural.
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 23 03.11.2010 23:18:32
manFRed hainzmann
► 24
5 Sowohl für Zeilenumbruch wie auch für kleinformatige Buchstaben am Rande des Schriftfeldes oder gar auf dem Profilrahmen finden sich Beispiele.
6 ILLPRON 0075: Adnamatu/s; ILLPRON 0491: Secundu/s; ILLPRON 0567: mile/s; ILLPRON 0332: Sinicioni(s); ILLPRON 0510: Surioni(s); ILLPRON 1595: Ittioni(s).
7 Farka 2009, 25 Anm. 6. Den dortigen Beispielen kann ich noch ILLPRON 863 mit gleich zwei Belegen hin-zufügen.
Die mir vom Bundesdenkmalamt freundlicherweise bereitgestellten Fotos von hoher Qualität zeigen im Grunde alle Details. Doch sehe ich mich ohne Autopsie nicht in der Lage zu entscheiden, ob Reinhold Wedenig mit seiner Beobachtung recht behält, nach der das für die Genitivendung von negotiationi(s) erforderliche S am Anfang von Zeile 6 gestanden habe. Jedenfalls vermeint er davon noch rudimentäre Spuren zu erkennen. Fest steht, dass am Wortende von Zeile 5 für diesen Buchstaben nicht mehr genügend Platz vorhanden ist. Man hätte ihn dort bestenfalls im Kleinformat hinzufügen können.5 Ande-rerseits gibt es im norischen Inschriftenfundus gut ein Dutzend Fälle für einen Zeilenum-bruch (-/s) und ebenso viele für den Wegfall des auslautenden S bei Genitivendungen der dritten Deklination.6 Es wäre demnach gar nicht verwunderlich, wenn wir hier auf dasselbe Phänomen stießen. Was die fehlerhafte Vokalgemination bei eiius (Z. 6) angeht, so hat schon Farka auf die heimischen Parallelen verwiesen.7
Somit ergibt sich für uns folgende Transkription:
5
I ▪ O ▪ MET ▪ IVVAVO[P]R?O ▪ SALVTEMARI ▪ ANICET͡IET ▪ NEGOT͡IAT͡IONIEI{I}VS
I(ovi) ◦ O(ptimo) ◦ M(aximo)et ◦ Iuvavo[p]r?o ◦ saluteMari ◦ Anicet͡iet ◦ negot͡iat͡ioni(s)ei{i}us (!)
Übersetzung:
„Dem gnädigsten und mächtigsten IUppIter sowie dem IUVAVUS! Zum Wohle des Marius Anicetus und dem seiner Handelstätigkeit“.
Nebst dem Götterformular überrascht die Inschrift mit dem Umstand, dass sie keinen expliziten Stifternamen ausweist.8 Zum anderen wird als Begünstigter ein Marius Anice-tus sowie dessen Handelstätigkeit (negotiatio)9 genannt. Ein pro salute ... negotiationis war bislang unbekannt. Diese Formulierung verstehe ich als einen Hinweis darauf, dass die genannte Bezugsperson dem Kreis der örtlichen Kaufleute und Händler entstammt. Zudem halte ich es für wahrscheinlich, dass Dedikant und Begünstigter hier in einer Per-son in Erscheinung treten – also identisch sind. Die Dedikation wäre folglich im Sinne eines pro salute sua zu verstehen.10 Salus referiert hier nicht auf die Gesundheit, sondern auf die Sicherheit und Unversehrtheit des vielerlei Gefahren ausgesetzten Händlers, sei er nun mit seinem Transport auf den Fernstraßen oder auf den Wasserrouten unterwegs.
8 Der fehlt beispielsweise auch in den Votivinschriften ILLPRON 0493 und 1655 sowie beim Epona-Altär-chen aus Gleisdorf: AE 1992, 1333.
9 Die einzige – schon von Farka 2009, 27 Anm. 22 zitierte – Parallele bietet die pompejanische Inschrift CIL X 1401 = ILS 6043 (Z. 9).
10 Für Letzteres gibt es genügend Beispiele (siehe EDCS).
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 24 03.11.2010 23:18:32
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
25 ◄
Abb. 1: Weihaltar vom Residenzplatz in Salzburg: Vorderseite mit Weihinschrift (© Bundesdenkmalamt)
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 25 03.11.2010 23:18:33
manFRed hainzmann
► 26
Bei der vorliegenden Motivlage mit Betonung der eigenen, dem göttlichen Schutz und Wohlwollen anvertrauten Handelstätigkeit hätte man vom mutmaßlichen Steinsetzer (Marius Anicetus) gleich die syntaktische Variante pro salute et negotiatione sua erwarten können.
Abb. 2: Weihaltar vom Residenzplatz in Salzburg: a) linke Nebenseite mit Adlerdarstellung, b) rechte Nebenseite mit Blitzbündel
(© Bundesdenkmalamt)
a b
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 26 03.11.2010 23:18:35
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
27 ◄
Womöglich geht aber die Weihung doch nur auf einen mit Anicetus befreundeten Han-delspartner zurück, der – aus welchen Gründen immer – anonym bleiben wollte.11 Doch nur wenn Marius Anicetus tatsächlich über Bootsmänner (gubernatores)12 verfügt hat, wäre Farkas Behauptung gerechtfertigt, dass er seine Güter auch zu Wasser (d.h. auf der Salzach) transportieren ließ. So aber bleibt ihre „Schlussfolgerung“, dass seine getätigten „Handelsgeschäfte in Verbindung mit dem Transport auf dem Wasser zu tun hatten und der Altar anlässlich eines glücklich überstandenen Flusstransportes eben diesen Göttern geweiht“ wurde, letztlich eine Spekulation. Sie erklärt sich aus der vermeintlich sicheren Klassifizierung des IUVAVUS als eines Flussgottes.13 Nicht dass es etwa abwegig erschiene, einem in Iuvavum ansässigen Händler auch den Warentransport auf dem nahegelegenen Wasserweg zuzumuten. Doch wird gewiss nicht jeder negotiator diese Möglichkeit in An-spruch genommen haben, sei es aus fiskalischen Gründen oder aufgrund seines spezifischen Warensortiments.14 Bei Vorliegen des von Farka postulierten Sachverhaltes würde ich davon ausgehen wollen, dass der Stifter wenigstens auf einer der beiden Nebenseiten des Altars ein Reliefbild des (personifizierten) Flussgottes oder auch ein Transportschiff hätte dar-stellen lassen. Der ikonographische Kontext fokussiert einzig auf IUppIter als die zentrale Schutzmacht! Was nun die Fundstelle des Altars betrifft, so liegt diese im Forumsbereich15 und verrät nichts, was auf ein Flussheiligtum hindeuten könnte. Zurecht erinnert Farka in diesem Zusammenhang an den in unmittelbarer Nähe gefundenen Weihealtar eines Bene-ficiariers, der hier vermutlich seine Kontrolltätigkeit ausübte: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et om(nibus) / Dibus M(arcus) Ulp(ius) / Philippus / b(ene)f(iciarius) Egnati Pri/sci proc(uratoris) Aug(usti) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).16
Über die Herkunft des Anicetus ist ebenfalls nichts in Erfahrung zu bringen. War er gleich seinem (binnen-)norischen Namensvetter17 ein Nachkomme einheimischer Kelten oder ein Freigelassener griechischer Abstammung?18 Letztere Annahme mag zwar wahr-scheinlicher sein, definitiv entscheiden können wir es nicht.
Hält man nach weiteren Parallelen zur vorliegenden Weihinschrift Ausschau, so wird man – wenn sich die Suche nur auf die negotiatores beschränkt – innerhalb Noricums nicht fündig. Außerhalb wiederum begegnet man auch nur vier Widmungen dieser Berufs-gruppe, die einmal dem IUppIter (zusammen mit IUno regInA) und dreimal dem IUppIter DolIchenUS dargebracht wurden.19 Der Iuvavenser Weihung noch am nächsten steht, weil mit der Formel pro salute sua ausgestattet, diejenige der beiden (syrischen?) Händler aus Sarmizegetusa. Doch gibt sich diese auch als ein ex voto aus.
Was es noch in unsere Überlegungen mit einzubeziehen gilt, sind die norischen Wid-mungen an IUppIter im Verbund mit einheimischen Stadt-/Landesgottheiten. Dafür liegen zwei Beneficiarierweihungen aus dem Municipium Claudia Celeia20 vor. In beiden wird
11 Auch wenn es in EDCS einige Vergleichsbeispiele für diese ausgefallene Syntax gibt, ist man eher geneigt, dahinter einen anonymen Stifter aus dem Familienkreis oder der Schar der Berufskollegen zu vermuten.
12 Vgl. die Weihung des L. Servilius Eutyches cum s[uis] gubernatori[bus] aus Podkraj (ILLPRON 1874).
13 Farka 2009, 25: „Der auf dem Weihaltar angeführte Name des Flussgottes Iuvavus als Personifizierung der Salzach scheint hier zum ersten Mal auf.“
14 Gedanken über die konkreten Handelsprodukte des Marius Anicetus anzustellen, halte ich angesichts fehlender Angaben und ikonographischer Indizien für müßig.
15 Vgl. Farka 2009, 26. 16 ILLPRON 1127. ― Zu den Beneficiariern in Noricum
siehe nun den Aufsatz von Scherrer 2005. 17 Sohn der Senecia (ILLPRON 0598). Dies ist zugleich
die einzige Parallele in unserer Fundprovinz. 18 Auffallend sind die vielen griechischen Cognomina
bei den norischen Marii – vgl. ILLPRON-Indizes. 19 CIL III 1068 (Dacia / Alba Iulia), CIL III 7761 (Dacia
/ Alba Iulia), CIL III 7915 (Dacia / Sarmizegetusa) und CIL XIII 11812 (Germania Superior / Mainz).
20 ILLPRON 1648: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Cel(eiae) sanct(ae); ILLPRON 1649: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Cel(eiae) et Noreiae sanct(a)e.
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 27 03.11.2010 23:18:35
manFRed hainzmann
► 28
der oberste Schirmherr des Reiches an erster Stelle genannt. Durch Kopula verbunden finden wir dann die Stadtgöttin celeIA21 und einmal an dritter Stelle auch die Landesgöttin noreIA. Diesen Zeugnissen gegenüberzustellen sind (aus dem Fundkomplex der Monu-mentalinschriften) noch teUrnIA, BeDAIUm und AtrAnS als weitere deonomastische, nach hiesigen Siedlungsplätzen benannte Gottheiten.22 Aber auch die den Wassergottheiten (ohne die Nymphen) gewidmeten Inschriften dürfen wir hier nicht übergehen. Es sind dies die Denkmäler für SAVUS et ADSAllUtA sowie für AqUo, von denen vermutlich ADSAllUtA keine (echte) Flussgottheit bezeichnet.23
Für den gemeinsam mit IUppIter überlieferten Götternamen IUVAVUS von Bedeutung sind dann zweifellos auch die epigraphischen Evidenzen des römerzeitlichen Toponyms24
Iuvavum an sich. Denn die Erkenntnis, dass beide Namen in ihrer sprachlichen Bil-dung übereinstimmen, das bedarf keines Spezialwissens. Doch können wir unter diesen Schriftmonumenten diverse Schreibvarianten beobachten, auf die wir dann im zweiten Teil unserer Abhandlung, also in der Gegenüberstellung mit dem literarisch belegten Hydronym als auch Toponym zurückkommen müssen. Nachstehende Tabelle listet als
21 Šašel Kos 1999, 138–140 und 142–144. 22 Teurnia: ILLPRON 0089; Šašel Kos 1999, 41, 139. –
Bedaium: ILLPRON 1499, 1500, 1503, 1504, 1505, 1530, 1536, 1538, 1546, 1550; Hainzmann 2006. – Atrans: ILLPRON 1930; Šašel Kos 1999, 22, 37, 40, 149. – De Bernardo Stempel 2005, 16 f.
23 Savus et Adsalluta: ILLPRON 1859, 1875, 1941, 1950, und AIJ 255; Šašel Kos (1994). – Adsalluta: ILLPRON
1784, 1874, 1938, 1939. – Aquo: ILLPRON 1837, 1839 und ein unpublizierter Altar; Šašel Kos 1994, 112 und 135 f. – De Bernardo Stempel 2005, 16 und 18.
24 Vgl. Wedenig 1997, 48 f., 74 ff. und 161 ff., sowie Kovacsovics 2002, 165 f.
Abb. 3: Verbreitung inschriftlicher Belege für Iuvavum / Iuvavenses im Imperium Romanum:Dalmatia – 1, Germania sup. – 1, Noricum – 19, Moesia inf. – 1, Pannonia inf. – 1, Pannonia sup. – 1, Roma – 4
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 28 03.11.2010 23:18:36
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
29 ◄
Ergebnis eines vor kurzem durchgeführten Suchlaufes in der EDCS insgesamt 28 Be-lege auf, die wir in eine alphabetische Reihung (vgl. Tabelle 1, Spalte 3) gebracht haben. Dabei sind der erhaltene Buchstabenbestand in Fettdruck, die jeweiligen Ergänzungen in Normalschrift wiedergegeben. Den drei komplett ergänzten Belegformen (Nummer 12, 16 und 26) kommt, wie übrigens auch jenen mit partiellen Restitutionen, nur eine be-grenzte Aussagekraft zu. Um dem Leser eine raschere Orientierung zu gewähren, haben wir in diesen Fällen die Belegnummern (Spalte 2) mit Klammern versehen. Spalte 4 ver-zeichnet die jeweilige Fundprovinz. Rein explikatorischen Charakter hat der gelegentlich beibehaltene Kontext zum Keyword (Spalte 1), so etwa bei den Meilensteininschriften und den die Bürgergemeinschaft als solche betreffenden, mit (dem Adjektiv) Iuvavensesumschriebenen „Ortsbezeichnungen“. Der Majuskeltext wurde ungeprüft aus EDCS über-nommen (siehe den Inschriftenkatalog im Anhang).
Das Verhältnis der norischen zu den außernorischen Evidenzen beträgt 19 zu 9 (Abb. 3). Was dabei auffällt, ist die Tatsache, dass sich die Kurzform IVA- für IVVA- mit nur einer Ausnahme in der zweiten Gruppe belegt findet. Die Kontraktion von zwei VV auf eines ist im Lateinischen sehr geläufig. Unstrittig bleibt, dass die Normalform des (kaiserzeit-lichen) Ortsnamens (municipium Claudium) Iuvavum – in Majuskel IVVAVVM – gelautet hat. In diesem erblickt Reifenstein25 einen „nichtlateinischen Namen, den die Römer von der (keltischen) Vorbevölkerung übernommen haben“.
IV(v)A(v)O 24 IVAO PanSI(u)VAV(o) 01 IVAV Dal
MVNICIPI(i) IV(v)AVI 22 IVAVI NorIV(v)AVO 02 IVAVO GerS
CL(audia) I(u)VAVO 27 IVAVO RomaCL(audia) I(u)VAVO 28 IVAVO RomaCIV(itatis) IVV(avensium) 08 IVV Nor
[A IVV(avo) M(ilia) P(assuum)] 11 IVV NorA [IVV(avo)] / M(ilia) P(assuum) [---] (12) IVV NorA IV[V(avo)] / M(ilia) P(assuum) XIII (13) IVV Nor
[AB I]VV(avo) / [M(ilia) P(assuum) X]XXXV (17) IVV NorA(b) IVV(avo) / [M(ilia) P(assuum)] XVIII 18 IVV Nor
A IVV(avo) / [M(ilia) P(assuum)] XX[X]V[I] 19 IVV NorA IVV(avo) M(ilia) P(assuum) / XXXVI 20 IVV Nor
[A IVV(avo) M(ilia) P(assuum)] (21) IVV NorA IVVA(vo) / M(ilia) P(assuum) VIIII 14 IVVA Nor
CLA(udia) IVVA(v)I 25 IVVAI RomaAB IVVA(v)O M(ilia) XXXI 15 IVVAO Nor
IVVA[V(o)] (03) IVVAV MoeIIVVAV(enses) 05 IVVAV NorIVVA[V(o)] (23) IVVAV PanI
DEC(urio) IVVAVE(nsium) 10 IVVAVE Nor[IVVAVENSES] 26 IVVAVENSES Roma
DECVRIONI IVVAVENSIVM 07 IVVAVENSIVM NorCIVIT(atis) IVVAVE(n)S(ium) 04 IVVAVES Nor
[AB IVVAVO] M(ilia) P(assuum) X[---] (16) IVVAVO NorIVVAVO 06 IVVAVO Nor[IV]VAVO (09) IVVAVO Nor
Tab. 1: Die epigraphischen Belege für Iuvavum und Iuvavenses
25 Reiffenstein 1990, 193; vgl. Kovacsovics 2002, 166 mit Anm. 4; Keune 1919; Heger 1974, 19 f.
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 29 03.11.2010 23:18:36
manFRed hainzmann
► 30
Der Vollständigkeit halber sei auch das bislang einzige Beispiel eines davon abgelei-teten Personennamens aus der Regio X – Iuvavia – zitiert.26
INSCHRIFTENKATALOG (NACH EDCS)27
01 = CIL III 14994 Dalmatia – FO: Ivosevci / Burnum : ] Caesius / [3]cla Secu/[ndu]s I(u)vav(o) mil(es) /
[leg(ionis) 3 |(centuria)] Q(uinti) Liga/[ri : 02 = Schillinger 00065 = CSIR-D-02-05, 00141 = AE
1965, 00248 = AE 1978, 00559 Germania superior – FO: Mainz / Mogontiacum : M(arcus) Dippon/ius M(arci) f(ilius) Clau(dia) /
Icco Iu(v)avo / mil(es) leg(ionis) IIII / Mac(edonicae) an(norum) XXVI / [st]ip(endiorum) VI / [h(ic) s(itus) e(st) h(eres) f(aciendum)] c(uravit) :
03 = CIL III 14214 = ILS 09107 = AE 1901, 00040 = AE 1904, 00228 = AE 1965, 00039a = AE 1980, 00794
Moesia inferior – FO: Adamclisi / Tropaeum Traiani : [Imp(erator) Caes(ar) divi Nervae f(ilius)] / [Ner -
va Traianus] / [Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us)] / [pont(ifex) max(imus) tri]b(unicia) pot(estate) [XIII co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae)] / pro re p(ublica) morte occu[buerunt 3] / Cornelius Fuscus c]ol(onia) Pomp(eis) domicil(io) Neapol(i) Italiae pra[e(fectus) praetorio] / [ [in honorem et] memoriam fortis[si- morum virorum qui] / [2]O[3] pro re p(ublica) morte occubu[erunt monumentum fecit] / [C(aius) Titius C(ai) f(ilius) Col(lina) Maximus domo Nea]pol(i) Ponti domicil(io) Neapol[i] Italiae prae[f(ectus) coh(ortis) II Batav(orum)] // [3]VSLS[3] / [6] / [3]IVS C[3]I[1]S[3] / [6] / [6] / [3]ISVI [3]I[1]C[3] / [6] / [3]S PAC[3]A[3] / coh(ors) IV S[1]SI[3] / [3]r[1]nius [3]VLL [3] / [3]C Au[1]rnus Hadri(a) / [3]us Hilarus Se<g=C>usi(one) / [3]vius Reburus Cluni(a) / [1] Norius Priscus Cemen[el(o)] / [3]osicius Secundus Polen(tia) / [3]ius Priscus Hore() / [3]S Masculus Roma // L(ucius) Valerius Sacer Vien(na) / L(ucius) Gavillius Primus Agrip(pina) / L(ucius) Valerius Lunaris Iuva[v(o)] / [3] Octavius Secund(us) For(o) Iul(i) / Sex(tus) [3]us Clemen(s) Ceme(nelo) / L(ucius) Iul[ius] Lollius Agri[p(pina)] / T(itus) Flav[ius 3]ustus Nici / C(aius) Valeri[us S]ecund(us) Cele(ia) / C(aius) Billius [3]cat(us) Dert(ona) / L(ucius) Flavius Cl[3]S V[3] / C(aius) Iulius Gra[3] / C(aius) Cadaric() Allius [3]to() / L(ucius) Cassius Cerma Isind(a) / C(aius) Vitel-lius Seranus Caes(area) / M(arcus) Iulius Annius Agri[p(pina)] / [1] Valerius Primus A[3] // C(aius) Blaesius Varro Aequ(o) / [3]cius Atrect(us) Rom(a) / [3] Capito Her[a(clea)] / [3] Nice / [3]CR[ // [3]C f(ilius) Be[l(lovacus)] / [3] f(ilius) Rae(tus) / [3] f(ilius) Tun(ger) / [3]L() Nor(icus) / [3] Cana(ne)f(as) / [3] Lexov(ius) / [3] Agri(ppinensis) / [3]en() Cas(tulone?) / [3] Agri(ppinensis) / [3] Lusit(anus) /
[3] Nerv(ius) / [3]T() Tung(er) / [3] Tung(er) / [3]T() Agr(ippinensis) / [3]F() Agr(ippinensis) / [3] Batav(us) / [3]F() Afer / [3] Brit(to) / [3] Lusit(anus) / [3]R f(ilius) Luc(ensis) / [3]us Agr(ippinensis) / [3]C() Bat(avus) // Barbarus L() / Carantius Tic(iensis?) / Cristus Ver(ager) / Vasco Ani() / T(itus) Flavius Ca[3] / missici Musa / Veldes Texu(ander) Minicius Minc() / Donico Viro(manduus) / Crescens Senn(onicus) / coh(ors) II Bat(avorum) / Naso Cres() / Saurnus Co[3] / Martial(is) [3] / Mar[3] / Via[ :
04 = CIL III 05527 = ILLPRON 01054 Noricum – FO: Bischofshofen : [D(iis)] M(anibus) / [3]nius Victor (a)edi/[lici]us
civit(atis) Iuvave(n)s(ium) / [3] Q() Dignilla ei{i}us / [3]uri(a)[e M]arcian(a)e fili(a)/[e piiss]im(a)e o(bitae) annor(um) XXX / [et sui]s vivi feceru[nt] :
05 = CIL III 05536 (p 1048, 1050, 1838) = ILLPRON 01105
Noricum – FO: Salzburg / Iuvavum : [Pro salute] / [Imp(eratoris) Cae]s(aris) L(uci) /
Septimi Seve/ri Pii Pertina/cis Aug(usti) Arab(ici) / Adiab(enici) Parthici / max(imi) et Imp(eratoris) Caes(aris) / M(arci) Aurel(i) Antonini / Aug(usti) [[3]] / Iuvav(enses) d(onum) d(ederunt) :
06 = CIL III 05566 (p 1839) = IBR 00006 = ILLPRON 01511
Noricum – FO: Endorf / Bedaium : Ci[3] / Iuvavo et Ve[rati]/ae Verae Metil[ia] / Mar-
ciana ma/rito et filiae / et sibi viva / fecit : 07 = CIL III 05589 (p 2328,201) = ILLPRON 01557 =
IBR 00034 Noricum – FO: Trostberg an der Alz / Bedaium : L(ucio) Bellicio L(uci) f(ilio) Quar/tioni decurioni /
Iuvavensium IIviro / iuris dicundi vixit an(nos) LVIII / Sapliae Belatumarae / coniugi an(norum) LXII Bellicius / Seccio et Bellicius Achilles / cum coniugibus ex testam/ento faciendum curaverunt :
08 = CIL III 05591 = ILLPRON 01555 = IBR 00036 Noricum – FO: Titlmoos / Bedaium : L(ucio) Vir(io) [3 ann(orum) 3] / o(bito) et L(ucius)
Vir(ius) Maximia/nus dec(urio) et IIvir civ(itatis) / Iuv(avensium) et Vir(ia) Modera/ta et sibi vivi fece/runt :
09 = CIL III 05607 = ILLPRON 01139 = IBR 00051 Noricum – FO: Schönberg : ] / [sibi et 3 coniugi] / [obitae ann(orum)] LX v(ivus)
fecit / [et 3 S]atur[ni]no / [f(ilio) caris]simo d[ecu]rion(i) / [Iu]vavo IIvir(o) / [i(ure)] d(icundo) :
26 CIL V 2626 (Ateste): Felici / Iuvavia L(uci) l(iberta) / [---]OEM[ : – Zu keltischen Personen- und Götter-namen mit den Anfangssilben Iuv- und Iv- siehe NPC.
27 Zu den Literaturabkürzungen im folgenden Katalog siehe auch die in EDCS verwendete Liste.
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 30 03.11.2010 23:18:36
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
31 ◄
10 = CIL III 05625 = ILLPRON 00992 = AEA 2005, +00064
Noricum – FO: Mondsee : L(ucius) Cotinius / L(uci) f(ilius) Martialis /
dec(urio) Iuvave(nsium) II(vir) i(ure) d(icundo) / sib(i) et Pecciae Lat/inae uxori v(ivus) f(ecit) :
11 = CIL III 05721 = 11836 = CIL XVII 4/1, 00208 = ILLPRON 01084
Noricum – FO: Radstädter Tauern : [Imp(erator) Caes(ar) L(ucius)] Se[pt(imius)
Severus] / [Pius Pertin]ax [Aug(ustus) Arab(icus)] / [Adiab(enicus) Parth(icus) ma]x(imus) [pontif(ex) max(imus)] / [tr(ibunicia) pot(estate) VIIII i]mp(erator) XII [co(n)s(ul) II proco(n)s(ul)] / [et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius)] / [An-toni]nus [Pius Aug(ustus) tr(ibunicia)] / [pot(estate) IIII pro]co(n)s(ul) e[t P(ublius) Sept(imius) Geta] / [nob(ilissimus) Caes(ar)] miliaria [vetustate] / [con-lapsa r]estitueru[nt curante] / [M(arco) Iuventio Su]ro [Proculo] / [leg(ato) p]r(o) pr(aetore) / [a Iuv(avo) m(ilia) p(assuum) 3] :
12 = CIL III 05723 = 11837 = CIL XVII 4/1, 00212 = ILLPRON 01064
Noricum – FO: Hüttau : Imp(erator) [Ca]e[s(ar)] L(ucius) Septimius /
[Severus] / [Pius] Per[ti]n[ax Aug(ustus)] / [Ar]ab(icus) Adiab(enicus) Pa[rt]h(icus) m[ax(imus)] / [ponti]f(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) [VIIII] / [i]mp(erator) XII co(n)s(ul) II [p(ater) p(atriae) pr]o/co(n)s(ul) et [Imp(erator)] / Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius) Antonin[us] / Pi[us Au]g(ustus) [t]rib(unicia) po[t(estate) IIII] / proc[o(n)s(ul) et] / [[[P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]] milia[ria] / vetust[at]e co[nla]psa / [rest]ituerun[t] cu[ra]nte [M(arco)] / [Iuv]entio Suro [Proc]ulo / leg(ato) pr(o) pr(aetore) a [Iuv(avo)] / m(ilia) p(assuum) [3] :
13 = CIL III 05725 = 11838 = CIL XVII 4/1, 00224 = ILLPRON 01065 = AEA 2005, +00050
Noricum – FO: Jadorf : DD(ominis) nn(ostris) Fl(avio) / Constantino
P(io) F(elici) / [M]ax(imo) victor(i) [s]e[m(per)] A[ug(usto)] / bono generis [hu]man(i) / nato Cris-po et Con/stantino beatis[s]im(is) / Caes(aribus) a Iu[v(avo)] / m(ilia) p(assuum) XIII // ]BYN[3] / [6] /[3]BI / [3]MP :
14 = CIL III 05726 (p 2328,200) = 11839 = CIL XVII 4/1, 00226 = ILLPRON 01079 = AEA 2005, +00050
Noricum – FO: Oberalm : [Imp(eratori) Caes(ari)] / [L(ucio) Septimio Sev]ero
Pio [Pert(inaci) Aug(usto)] / [Arab(ico) Adiab(enico) Part(hico) max(imo)] Brit(annico) [max(imo)] / [pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia) potes(tate) III imp(eratori) VII] co(n)s(uli) II [p(atri) p(atriae) pro]/[co(n)s(uli) et Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurel(io)] Anton[ino] / [Pio Invicto Aug(usto) Part(hico)] max(imo) [Brit(annico) max(imo)] /
[German(ico) max(imo) pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia)] potes(tate) [XVI] / [imp(eratori) III co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) p]roco(n)s(uli) [fortissimo] / [ac Felicissimo p]rincipi domino / indulgentissimo / m(ilia) [p(assuum) VIIII] // DD(ominis) nn(ostris) Fl(avio) Constantino / P(io) F(elici) M[ax(imo)] victori semper / Aug(usto) [bono] gen[eris h]uman(i) / nato Crispo et Con/stantino beatissimis / Caes(aribus) a Iuva(vo) / m(ilia) p(assuum) VIIII :
15 = CIL III 05746 (p 1847) = CIL XVII 4/1, 00089 = ILLPRON 00989 = AEA 2003, +00011 = AEA 2005, +00050
Noricum – FO: Mösendorf : [Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius] Seve/[rus
Pius Pertinax] Aug(ustus) Arab(icus) / [Part]h(icus) max(imus) pontif(ex) max(imus) / [trib(unicia) po]t(estate)] VIIII imp(erator) XII co(n)s(ul) II [p(ater) p(atriae)] / proco(n)s(ul) et / [Imp(erator)] Caes(ar) M(arcus) Aurell(ius!) Antoni/nus Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) IIII / proco(n)s(ul) et P(ubl)ius [[Sep[timius]]] / [[[Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]] miliaria vetus/tate conlapsa restitue/runt curante M(arco) Iuve/ntio Suro Proculo / leg(ato) pr(o) pr(aetore) / ab Iuva(v)o m(ilia) XXXI :
16 = CIL III 05749 = CIL XVII 4/1, 00097 = IBR 00480 = AE 2005, 01175
Noricum – FO: Erlstatt : [I]m[p(erator) Caes(ar) L(ucius) Septimius] /
[Severus Pius Pertinax Aug(ustus)] / [Arab(icus) Parth(icus) max(imus)] / [pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VIIII] / [imp(erator) XII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul)] / [et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius) Antoninus] / [Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) IIII proco(n)s(ul)] / [et [[P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]] / [miliaria vetustate conlapsa] / [re-stituerunt cur]ant[e] / [M(arco) Iu]ventio [S]uro Pr[oculo] / leg(ato) Aug(usti) pr(o) [pr(aetore)] / [ab Iuvavo] m(ilia) p(assuum) X[3] :
17 = CIL III 05751 = CIL XVII 4/1, 00103 = ILLPRON 01548 = IBR 00479 (p VII)
Noricum – FO: Söchtenau : [Imp(erator) C]aes(ar) M(arcus) Au[relius] / [Anto]
ninus Pius [Fel(ix) Aug(ustus) 3] / [3] German(icus) [max(imus) // ] / [ab I]uv(avo) / [m(ilia) p(assuum) X]XXXV :
18 = CIL XVII 4/1, 00096 = AE 1999, 01212 Noricum – FO: Wonneberg : [Imp(erator) Ca]es(ar) L(ucius) Septi[mius Sev]
erus Pius / [Pertin]ax Aug(ustus) Ar[ab(icus) Adiab(enicus) P]arth(icus) max(imus) / [ponti]f(ex) max(imus) tr[ib(unicia) pot(estate) VIIII imp(erator)] XII / [c]o(n)s(ul) p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) [et [Imp(erator)] / Caes(ar) M(arcus) Aure[l(ius) An-toninu]s Pi[u]s / [Au]g(ustus) trib(unicia) pot(estate) IIII pro[co(n)s(ul) [[et P(ublius) Septimius Geta]]] / [[[nob(ilissimus) Caes(ar)]] milliar]ia vetus/[t]ate conlapsa res[tituerun]t curante / [M(arco)] Iuventio Suro Pro[culo] {leg} / [l]eg(ato) pr(o) pr(aetore) a(b) Iuv(avo) / [m(ilia) p(assuum)] XVIII :
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 31 03.11.2010 23:18:36
manFRed hainzmann
► 32
19 = CIL XVII 4/1, 00213 = ILLPRON 01063 = AEA 2005, +00050 = AE 1977, 00602
Noricum – FO: Hüttau : D(ominis) nn[n(ostris) Fl(avio)] Constan[t]i[no] /
P(io) [F(elici) Max(imo) vic]tori [sem]/[per Au]g(usto) bono gene[ris] / [huma]n(i) nato Crispo [et] / [Consta]n{i}tino beatis[simis Caes(aribus)] / a Iuv(avo) / [m(ilia) p(assuum)] XX[X]V[I] :
20 = CIL XVII 4/1, 00214 = ILLPRON 01062 = AEA 2005, +00050 = AE 1977, 00601
Noricum – FO: Hüttau : [Imp(erator) Caes(ar)] / [M(arcus) Iul(ius)] / [Philip-
pus] / [P(ius) F(elix) Inv(ictus) Aug(ustus)] / p(o)nti[fex] / [m]a[x]i[mus] / [tribuni]/[cia] potest(ate) II / [co(n)s(ul)] p(ater) p(atriae) / a Iuv(avo) m(ilia) p(assuum) / XXXVI :
21 = CIL XVII 4/1, 00220 = ILLPRON 01148 Noricum – FO: Werfen : [Imp(erator) Caes(ar)] / [L(ucius) Septimi]u[s
Severus] / [Pius Per]t[inax Aug(ustus)] / [Arab(icus) Adiab(enicus) Parth(icus)] / [max(imus) p]onti[f(ex)] m[ax(imus) trib(unicia)] / [pot(estate) V]IIII imp(erator) [XII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae)] / [pro]co(n)s(ul) [et Imp(erator) Caes(ar)] / [M(arcus) A]urel(ius) An[toninus] / [Pius] Aug(ustus) [trib(unicia) pot(estate) IIII] / [pro]co(n)s(ul) et [[[P(ublius) Sept(imius)]]] / [[[Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]] miliaria] / [ve]tustate [conlapsa] / [restit]uer[unt curante] / [M(arco) Iu]v[e]ntio [Suro Proculo] / [leg(ato) p]r(o) pr(aetore) / [a Iuv(avo) m(ilia) p(assuum) 3] :
22 = ILLPRON 01088 = AEA 1983/92, +00074 = AEA 2001/02, +00039 = AE 1959, 00151
Noricum – FO: Salzburg / Iuvavum : M(arco) Haterio / Luci fil(io) / Claud(ia) Summo /
dec(urioni) municipi(i) / Iu(v)avi / IIviro iur(e) d(icundo) / plebes oppidan(a) / optimo civi / ob annonam / relevatam :
23 = ILJug-03, 03103 = AE 1928, 00157 Pannonia inferior – FO: Osijek / Eszek / Mursa : D(is) M(anibus) / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) / Cl(audia)
Verecund(o) / Iuva[v(o)] mili(ti) leg(ionis) /X Ge[m(inae)] P(iae) Fid(elis) / |(centuria) Pae[t(i)] / stip(endiorum) XX / h(eres) f(aciendum) c(uravit) :
24 = CIL III 04461 = CSIR Österreich I/4, 00509 = LegioXVApo 00173 = MaCarnuntum 00228 = AEA 2003, +00002 = AE 1966, 00288
Pannonia – FO: superior Petronell / Carnuntum : L(ucius) Barbi[us 3] / Cla(udia) Con[stitu]/tus Iu(v)
a(v)o v[et(eranus) leg(ionis)] / XV Ap(ollinaris) ded[uct(icius)] / ann(orum) LX h(ic) s(itus) [e(st)] / Q(uintus) Barbiu[s :
25 = CIL VI 03588 Roma : L(ucius) Cuspius / L(uci) f(ilius) Cla(udia) Iuva(v)
i / Lautus Norico / mil(es) coh(ortis) I Asturum / |(centuria) Macriniana / militavit ann(os) XV / vix(it) ann(os) XXXV :
26 = CIL VI 41216 = 01569 = AE 1998, 00150 Roma : ]NII qua[est(ori) 3] / aed(ili) cur(uli) civitates I[X] /
[V]irunenses Celeienses [Teur]/nenses Ov[ilavenses] / [Lau]r[iacenses Solvenses] / Aguntense[s Iuvaven-ses] / [Ce]tienses [patrono fec(erunt?)] :
27 = Denkm 00186 = AIIRoma-04, 00062 Roma : [D(is) M(anibus)] / [6] / [6] / [nat(ione) Nor]
ic(us) Cl(audia) I(u)vavo / [vix(it) an]n(os) XLVI /[milit(avit) an]n(os) XXVIII / [3] Crescen[s] / [her(es) am]ico [ :
28 = Denkm 00248 = AIIRoma-04, 00094 Roma : [D(is)] M(anibus) / [3]inio / [eq(uiti) sing(ulari)
Aug(usti)] Cl(audia) I(u)vavo / [tur(ma) Sa]bini / [vix(it) an(nos) XX mi]l(itavit) an(nos) VIII / [ :
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 32 03.11.2010 23:18:36
IUVAVUS – RömischeR stadtgott odeR noRische Flussgottheit? teil 1: die epigRaphischen BeFunde
33 ◄
ABGEKÜRZT VERWENDETE LITERATUR
AE L’Année épigraphiqueAIJ V. Hofiller – B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslavien, Heft I: Noricum und Pannonia
Superior (Zagreb 1938)CIL Corpus inscriptionum LatinarumDe Bernardo Stempel 2005 P. De Bernardo Stempel, Die in Noricum belegten Gottheiten und die römisch-keltische
Widmung aus Schloß Seggau, in: W. Spickermann – R. Wiegels (Hrsg.), Keltische Götter im Römischen Reich. Akten des 4. Internationalen F.E.R.C.AN.-Workshops in Osnabrück vom 4.–6. Oktober 2002 (Möhnesee 2005) 15–27.
EDCS Epigraphische Datenbank Clauss SlabyFarka 2009 Ch. Farka, Iupiter und Iuvavus. Ein neuer Weihaltar vom Residenzplatz in Salzburg, in: Der
Residenzplatz. Fenster zu Salzburgs Geschichte. Katalog zur Ausstellung im Salzburger Museum (18. September 2009 bis 15. Jänner 2010), FÖMat A, Sonderheft 10 (Wien 2009) 24–27
Hainzmann 2006 M. Hainzmann, Bedaios und das Sacrum Alo(u)narum, in: M. G. Angeli Bertinelli – A. Donati (Hrsg.), Misurare il tempo, misurare lo spazio. Atti del Colloquio AIEGL, Borghesi 2005 (Faenza 2006) 455–475
Heger 1974 N. Heger, Salzburg in römischer Zeit (Salzburg 1974)ILLPRON Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptionum lapidariarum Latinarum provinciae No-
rici Indices (ILLPRON Indices), edd. M. Hainzmann – P. Schubert I–III (Berlin 1986–87)Keune 1919 J. B. Keune, Iuvavum, RE X/2 (1919) 1349–1355ILS H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae I–III (Berlin 1892–1916; ed. secunda 1954–55)Kovacsovics 2002 N. Kovacsovics, Iuvavum, in: M. Šašel Kos – P. Scherrer (Hrsg.), The Autonomous Towns
of Noricum and Pannonia – Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Noricum, Situla 40 (Ljubljana 2002) 165–202
NPC X. Delamarre, Noms des personnes celtiques dans l’épigraphie classique (Paris 2007)Reiffenstein 1990 I. Reiffenstein, Der Name Salzburgs. Entstehung und Frühgeschichte, MGSLk 130, 1990,
193–199Šašel Kos 1994 M. Šašel Kos, Savus and Adsalluta, Arheološki Vestnik 45, 1994, 99–114Šašel Kos 1999 M. Šašel Kos, Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Situla 38 (Ljubljana
1999)Scherrer 2005 P. Scherrer, Stadtbürger und Militärperson. Herkunft und gesellschaftliche Stellung der
Beneficiarier in Noricum, in: Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen, Aquincum Nostrum II.3 (Budapest 2005) 17–30
Wedenig 1997 R. Wedenig, Epigraphische Quellen zur städtischen Administration in Noricum (Klagenfurt 1997)
023-034_Hainzmann_DRUCKDATEN_01-11-2010.indd 33 03.11.2010 23:18:36

















![1 INCOTERMS 2010 (1)[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631de3d1dc32ad07f3074e54/1-incoterms-2010-11.jpg)