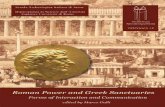Weh mir: Eine Verbindung zwischen Hölderlins "Wie wenn am Feiertage" und "Hälfte des Lebens“
Genießen, Genossen, genießen! Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Genießen, Genossen, genießen! Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
Genießen, Genossen, genießen!
1
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Genießen, Genossen, genießen! Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
Gedankengänge zum Verhältnis von Kirchenverfassung und Kirche sein der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Württemberg
Barmen Anfang oder Episode?
Die Geschichte der Bekennenden Kirche in der Zeit von 1933 1945 ist eine der spannendsten und spannungsreichsten Geschichten der deutschen Kirchen überhaupt. Dementsprechend ähnelt die Literatur aus dieser und über diese Zeit einem literarischen Himalaya. Im Folgenden kann und soll es daher nur um eine kurze, auf das Wesentliche beschränkte Darstellung dieses Zeitraumes gehen, bei der der »rote Faden« einerseits an die oben gestellte Frage anknüpft1, andererseits aber die nachfolgenden Gedanken zur Frage nach der »Verfassungswirklichkeit« und der nach dem Kirche sein von Kirche, genauer gesagt der württembergischen Landeskirche, im Blick hat.2
Das bekannteste und wohl auch entscheidende Datum für die Entstehung der Bekennenden Kirche (BK) ist die sogenannte Bekenntnissynode in Barmen, die vom 29.-31. Mai 1934 stattfand. Allerdings reichen die ersten Wurzeln der Bekennenden Kirche noch ein Jahr weiter zurück. Im Juli 1933 hatte die Glaubensbewegung der Deutschen Christen (DC) bei der Kirchenwahl in den meisten Landeskirchen das Regiment übernommen (Ausnahmen waren die Landeskirchen in Bayern [Bischof Meiser], Hannover [Marahrens] und Württemberg [Wurm]), wobei dies vor allem auf der massiven Unterstützung durch Adolf Hitler und die NSDAP ermöglicht wurde. Entsprechend dem politischen Führerprinzip wurde am 27. September 1933 der Bevollmächtigte Adolf Hitlers, der Marinepfarrer Ludwig Müller, von der Nationalsynode der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) zum Reichsbischof gewählt (Müller war schnell als »Reibi« bekannt und verschrien). Müller stand an der Spitze einer Reichskirchenregierung, von der drei von vier Mitgliedern den DC angehörten.
Allerdings ‚gelang‘ es den DC bereits im November 1933, sich auf äußerst ja, man kann es nicht anders nennen dämliche Weise in das eigene Knie zu schießen. Auf der »Großkundgebung des Gaus Groß-Berlin« der DC am 13. November, wurde eine Entschließung verabschiedet, die »einem wachsenden Teil der evangelischen Christenheit in Deutschland die Augen öffnete und sie ab-schreckte«3. Dort heißt es unter anderem:
»Wir erwarten von unserer Landeskirche, dass sie den Arier-Paragraph schleunigst durchführt …
Wir erwarten, dass unsere Landeskirche als eine deutsche Volkskirche sich frei macht von allem Undeutschen in Gottesdienst und Bekenntnis, insbesondere vom Alten Testament und seiner Lohnmoral.
Wir fordern, dass eine deutsche Volkskirche Ernst macht mit der Verkündigung der von aller orientalischen Entstellung gereinigten schlichten Frohbotschaft und einer heldischen Jesus-Gestalt als Grundlage eines artgemäßen Christentums, in dem an die Stelle der zerbrochenen Knechtsseele der stolze Mensch tritt, der sich als Gotteskind dem Göttlichen in sich und in seinem Volke verpflichtet fühlt.
Wir bekennen, das der einzige wirkliche Gottesdienst für uns der Dienst an unseren Volksgenossen ist, und fühlen uns als Kampfgemeinschaft von unserem Gott verpflichtet, mitzubauen an einer wahrhaften und wehrhaften völkischen Kirche, in der wir die Vollendung der deutschen Reformation Martin Luthers erblicken, und die allein dem Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates gerecht wird.
…
Genießen, Genossen, genießen!
2
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Wir brauchen nur ein Regiment, das Regiment Adolf Hitlers und seiner Ratgeber. Wir brauchen nur eine Jugenderziehung, eine Jugenderziehung im Geiste Adolf Hitlers. Und das Wichtigste: Wir brauchen jetzt eine Mission [!]: Das ist die, unsere deutschen Menschen restlos bis in ihre Seele zu deutschen Nationalsozialisten umzuschmelzen. Unser Kampf geht um nichts weiter als um das seelische Erwachen unseres Volkes. Unsere Religion ist die Ehre der Nation im Sinne eines kämpfenden, heldischen Christentums.«4
Der Erfolg: massenhafte Austritte aus der Bewegung der DC, Krise der Reichskirchenbewegung und Auflösung des geistlichen Ministeriums, und am 30. November erließ der Reichsinnenminister (Frick) eine Anordnung, mit der sich der Staat »aus der Politik einer direkten Einflussnahme auf die evangelischen Kirchenangelegenheiten zurück[zog]«5 In dieser für die weitere Zukunft entscheidenden Kurskorrektur des Innenministeriums heißt es u.a.: »Aus gegebenem Anlass weise ich [= Frick] darauf hin, dass auch kirchliche Stellen nicht befugt sind, ein Einschreiten staatlicher Organe im Kirchlichen Meinungskampf herbeizuführen.«6
Im Gegenzug entstanden »Bekenntnisgemeinden«, »Bruderschaften« u.ä. der »Pfarrernotbund«, der bereits im September 1933 von dem Berliner Pfarrer Martin Niemöller gegründet worden war, und bereits nach einer Woche über 1.500 Mitglieder hatte, wuchs bis Anfang 1934 auf 7.000 Mitglieder an. »Aus den ›Notbundpfarrern‹ wurden die ›Bekenntnispfarrer‹ in den ›Bekenntnisgemeinden‹. Sie erklärten im Januar 1934 dem Reichsbischof ihren Ungehorsam und forderten die Wiederherstellung der schrift- und bekenntnismäßigen Zustände in der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK). Es folgten Disziplinarmaßnahmen und Absetzungen der Pfarrer der BK. Dagegen entstanden in der altpreußischen Union7 eine Reihe von ›Bekenntnissynoden‹, die dem Vorbild der ›freien reformierten Synode‹ in Barmen im Januar 1934 folgten.8 Im Februar übernahm ein ›Bruderrat [!] des gesamten Pfarrernotbundes‹ die Leitung der Bekennenden Kirche (BK).«9
Die scheinbar noch »intakten« Landeskirchen in Bayern und Württemberg, gerieten zu Anfang des Jahres 1934 unter ziemlichen Druck seitens des Reichsbischofs und seines »Rechtswalters« August Jäger. Nachdem die Bischöfe Meiser und Wurm zunächst noch ein ‚Arrangement‘ mit dem Reichsbischof zu vereinbaren, kam es in der Folge zu einer starken Opposition von Bekenntnispfarrern gegen die Kirchenleitung. Anfang April 1934 wurde dann der sogenannte »Nürnberger Ausschuss« gegründet, aus dem sich später der »Reichsbruderrat der BK« entwickelte. Gleichzeitig wurde die »Sache der Kirche« immer mehr zu einer »Sache von Gemeinden mit ihren Pfarrern, Presbytern und Gemeindekreisen. Die BK wurde Gemeindekirche. Die ›Laien‹ übernahmen Mitverantwortung, sie mobilisierten und stabilisierten die bekennenden Christen vor Ort. Sie unterlagen nicht der direkten Gewalt der DC-Kirchenregierungen, sie hatten einen Freiraum, den sie nutzen konnten, um auch ihre Pfarrer zu unterstützen. Man kann in der Tat von einem ›Aufbruch der Gemeinden‹ reden. Der Prozess des Abschieds von der Obrigkeitskirche und der Pastorenkirche hin zur Gemeindekirche neuen Typs dürfte ein entscheidendes Faktum in der Geschichte des Kirchenkampfes gewesen sein.«10
Gebündelt wurde diese Entwicklung am 22. April dieses Jahres, als sich beim Bekenntnistag in Ulm, die »Vertreter der württembergischen und bayrischen Landeskirchen, der freien Synoden im Rheinland, in Westfalen und Brandenburg, sowie vieler bekennender Gemeinden und Christen in ganz Deutschland … zur rechtmäßigen evangelischen Kirche in Deutschland vor der gesamten Christenheit erklärten«11. Das bedeutete nichts Geringeres als die Erklärung des status confessionis.
Ein Begriff und seine Füllung
»Nach der Kirchenverfassung [sind] die Landessynodalen ›Vertreter aller Kirchengenossen‹ … Die Idee Jugendsynodale zuzuwählen nimmt diese selbstverständliche Beauftragung und das Mandat der Synodalen nicht ernst. Die Synode muss auch schon jetzt Anliegen von Menschen vertreten, die nicht personal in ihr vertreten sind. Die Zuwahl von
Genießen, Genossen, genießen!
3
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Jugenddelegierten ist auch deswegen problematisch, da zu befürchten ist, dass auch andere Gruppen die Zuwahl fordern würden.«12
So klingt es, wenn die Synode darüber nachdenkt, was sie mit sich selber anstellen soll. Und man muss zugeben, mit dieser Bemerkung befand sich der Ältestenrat der Synode, der die Zuwahl von Jugendsynodalen ablehnte, durchaus im Recht, nämlich auf dem Boden der Kirchenverfassung der evangelischen Landeskirche in Württemberg (KVG). Dort heißt es nämlich in § 4.1: »Die Landes-synode vertritt die Gesamtheit der evangelischen Kirchengenossen.«
Dass die Synode sich dennoch dafür entschied, 4 Jugendsynodale mit beratender Stimme zuzuzählen, ist zunächst rein formal gesehen aber auch ihr verfassungsmäßiges Recht. Denn im gleichen Paragraphen (§ 4) steht im 5. Absatz: »Die Landessynode kann … bis zu sechs weitere Mitglieder zuwählen, die an den Verhandlungen der Landessynode mit beratender Stimme teilnehmen.«
Also war alles rechtens, die kommenden Jugendsynodalen dürfen sich freuen, und die Synode hat wieder mal allen Kritiken an der unbeweglichen Landeskirche die Luft rausgelassen! …
… Wenn da nicht, ja wenn da nicht dem aufmerksamen Beobachter dieser ominöse Begriff »Vertreter aller Kirchengenossen« irgendwie nicht aus dem Sinn gehen würde.
Also, flugs mal nachgeschlagen in der Verfassung unserer Kirche die sich leider nicht auf deren Internetseiten finden lässt, aber wer will die auch schon lesen …13
… Und was findet der aufmerksame Leser da:
Zunächst mal als kleine Überraschung das Datum »24. Juni 1920«. Aus diesem Jahr stammt nämlich unsere Verfassung, und hat damit bereits ebenso wie eine Reihe anderer landeskirchlicher Verfassungen schon einige Jahre auf dem ›Buckel‹! Natürlich gab es im Lauf der Zeit einige Veränderungen, aber die sind zumeist sprachlicher oder begrifflicher Art. An Inhalt und Aufbau hat sich nichts geändert. Und aufgebaut ist die Verfassung folgendermaßen:
Präambel: § 13
Synode: § 430
Bischof und Landeskirchenausschuss: § 3135
Oberkirchenrat § 3640
Schlussbestimmungen: § 4114
So weit, so kurz. Schon erstaunlich, wie viel in so wenigen Paragrafen (nur 41) Raum findet. Noch erstaunlicher ist allerdings, was nicht in der Verfassung steht! Mit kaum einem Wort, geschweige denn mit einem Paragraphen, werden die einzelne Kirchengemeinde oder der Kirchenbezirk erwähnt! Erst fünf Jahre später (1925) ist das »Kirchliche Gesetz über die evangelischen Kirchengemeinden« in Kraft getreten und zwar nicht, in dem diese Rechtsgrundlage dann mit in die Verfassung aufgenommen wurde, sondern eben als kirchliches Gesetz, als der Verfassung untergeordnet und zwar bis heute!
Hals, die Erste …
Damit nicht genug! Auch die Synode bekommt gemäß der Verfassung ihr »Fett« weg. Sie ist zwar wie oben erwähnt (§ 4.1) die »Vertretung aller Kirchengenossen«; aber eben nicht im Sinne einer von unten nach oben aufgebauten Kirche (einschließlich der Kirchenleitung). Sie besitzt zwar eine kontrollierende und korrigierende Funktion gegenüber dem Kollegium und dem Bischof (§ 4), aber … sie hat keine kirchenleitende Funktion. § 21.3 unserer Kirchenverfassung regelt das sehr deutlich: »In Wahrnehmung der Bedürfnisse der Landeskirche … kann sie [die Landessynode] Anträge, Wünsche und Beschwerden an die
Genießen, Genossen, genießen!
4
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Kirchenleitung [seit 2006: »den Landesbischof oder den Oberkirchenrat«] richten und von ihr [»ihnen«] Auskunft und Akteneinsicht über einzelne Angelegenheiten verlangen.« Weisungsbefugt ist die Synode gegenüber der Kirchenleitung aber nicht!
Die Synode ist also, verfassungsrechtlich gesehen, so etwas wie der »Hals«, auf dem die Kirchenleitung sitzt. Sie muss nicht alles »schlucken«, was von oben kommt, kann auch versuchen, den »Kopf« mal in eine andere Richtung zu drehen, hat und zwar nicht nur theoretisch auch die Möglichkeit, das Kirchenverfassungsgesetz zu ändern. Aber augenscheinlich galt 91 Jahre lang die Devise: »Warum ändern, was sich bis jetzt bewährt hat?« Klar, deshalb sind wir auch alle noch mit dem »Modell T« von Ford unterwegs. Also bleibt es bislang dabei, dass der »Kopf« (Bischof, Landeskirchenausschuss und Oberkirchenrat) letztendlich der Landeskirche sagt, wo es lang geht, und die Landessynode eben nicht »als ihr [d.h., der Landeskirche] Kopf oder ihr Arm«15 verstanden wird und werden kann.
Kritisiert wurde dies immer wieder. So schreibt Siegfried Hermle Prof. für Evangelische Theologie und ihre Didaktik an der Universität Köln in einem Aufsatz:
»In den Händen der Landessynode lag 1920 zwar die volle Kirchengewalt, dies war nach dem Wegfall des Landesherrlichen Kirchenregimentes unumgänglich, aber zugleich dachte die neu eingerichtete Landessynode nicht daran, davon wirklich Gebrauch zu machen. Sie [!] legte durch die Verfassungsurkunde die Kirchenleitung in die Hände des Oberkirchenrats und des Kirchenpräsidenten [ab 1933 lautete die Bezeichnung Bischof].«16
Und für den Kirchenhistoriker Wilhelm Maurer stellt 1954! die Formulierung, dass die Landessynode »die Gesamtheit der evangelischen Kirchengenossen« vertritt, eine im kirchenrechtlichen Sinn »reaktionäre Aussage« dar17, und er fährt fort, dass wenn »eine Synode mit dem hier ausgesprochenen Selbstverständnis in ihrer Praxis ernst machen [würde], so könnte sie nicht geistlich handeln, so wäre sie auch nicht zu einer geistlichen Konkurrenz mit dem Bischofsamte fähig … sondern nur ein in weltlich-politischer Form rivalisierendes Gegenüber; sie muss eifrig auf die Wahrung ihrer und die Beschränkung der bischöflichen Rechte bedacht sein. In einer solchen Lage kann der evangelische Bischof das eigentliche Wesen seines geistlichen Amtes nicht entfalten. Will man den Anteil, den die Synode an der geistlichen Leitung hat, und damit ihr Verhältnis zum evangelischen Bischof richtig bestimmen, dann darf man nicht von ihrer formalen Rechtsstruktur ausgehen, sondern muss sich auf ihren geistlichen Auftrag besinnen, genauso, wie man das Verständnis des geistlichen Amtes nur aus seiner stiftungsgemäßen Funktion gewinnen kann. So sehr jener Grundsatz heute allgemein anerkannt sein dürfte, so wenig hat er sich doch bisher in der kirchlichen Gesetzgebung durchsetzen können.«18
Durch die Anbindung an einen naturrechtlichen, von der Politik übernommenen Repräsentationsbegriff, ist das »theologische Verständnis der Synode völlig überwuchert [worden], sodass der Synode keine geistliche Kirchenleitung, sondern lediglich eine Kontrollfunktion zugestanden wurde«19, so Hermle.
Hals, die Zweite …
Aber unsere Synode bzw. unsere Synodalen leiden nicht nur im Blick »nach oben« unter einem einschränkenden Zuschnitt. Weil die Zuordnung von einzelnen Kirchengemeinden und auch Kirchenbezirken einerseits und den leitenden Organen der Landeskirche auf der anderen Seite seit jeher zumindest verfassungsmäßig nicht geregelt ist, fehlt der Synode auch der notwendige »Unterbau«. Zwar werden die Synodalen als »Vertreter aller Kirchengenossen« bezeichnet, aber der Begriff der Vertretung umfasst im (kirchen)politischen Zusammenhang eher die Bedeutung von gewählten Vertretern einer bestimmten Wählerklientel.
Theologisch betrachtet handelt es sich bei einer Synode bzw. einem/einer Synodalen aber eher »um Entsandte ihrer Gemeinden und damit [um] Amtsträger. Sie haben ihr Amt allein zur Ehre Gottes auszufüllen, haben in Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen
Genießen, Genossen, genießen!
5
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
den Weg der Kirche zu Beraten und die überparochiale Kirchenleitung wahrzunehmen«20. Da dieses eher theologisch bestimmte Verständnis von Synode und Synodaler/Synodalem aber in der derzeitigen Verfassung, so Hermle, »nicht zum Ausdruck« kommt, hält er »eine Revision [der Verfassung, für] dringend angezeigt«, unabhängig davon, ob es in der Praxis anders laufe.21. Dazu er verweist u.a. auf Martin Luthers Schrift »Dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift«, aus dem Jahr 1523, in der Luther heraushebt, dass Christus »den Bischoffen / gelerten / vnd Concilien beyde recht vnd macht tzu vrteylen die lere [nimmt] / vnd gibt sie yderman / vnd allen Christen ynn gemeyn«.22 »Bahnbrechend« nennt Wolfgang Huber diese kleine Schrift Luthers, da »sie der hörenden Gemeinde kirchenleitende Funktionen zuspricht«23 Weil aber »eine Versammlung aller aus pragmatischen Gründen aber wirklich allein aus pragmatischen Gründen nicht möglich [ist] … bestimmen die Kirchenglieder Deputierte, die für sie ihre Erfahrungen in die Diskussion einbringen«24.
Da den württembergischen Kirchengemeinden in der aktuellen Kirchengemeindeordnung (KGO) aber weiterhin keine »kirchenleitende Funktion« zugebilligt wird, sondern diese als »Glied der Landeskirche« bezeichnet werden25, erfüllen sie im Endeffekt eine Filialfunktion im Anschluss und in Abhängigkeit von der Landeskirche.
Diese Zuordnung von einzelner Kirchengemeinde (und auch der Kirchenbezirke) und Landeskirche lässt sich natürlich nur legitimieren, weil und solange die Kirchengemeinden und -bezirke nicht Bestandteil der Kirchenverfassung, sondern obwohl wichtiger nur nachgeordneter Gesetze sind.
Dass es auch anders geht, zeigen die Verfassungen anderer Landeskirchen. So ist z.B. die Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (auch aus dem Jahr 1920) folgendermaßen aufgebaut:
Die Landeskirche / Kirchengemeinde und Pfarramt / Dekanat und Kirchenbezirk / Die Landessynode / Der Landessynodalausschuss / Kirchenpräsident [= Bischof], Landeskirchenrat, Kreisdekane
Und die Verfassung der badischen Landeskirche (1919) bietet folgenden Aufbau:
Die Landeskirche im allgemeinen / Die Gemeinde / Der Kirchenbezirk / Die Landeskirche: Landes-synode, Kirchenregierung, Oberkirchenrat.
Die Kirchengemeinden werden sowohl in der lutherischen Kirche in Bayern als auch in der vereinigten evangelisch-protestantischen Landeskirche in Baden, nicht als »Glieder« bzw. Filialen betrachtet. Im Gegenteil, die »Evangelische Landeskirche in Baden baut sich von ihren Gemeinden her auf« (Baden § 5.2), oder die »Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, ihre Kirchengemeinden, ihre Gesamtkirchengemeinden, ihre Dekanatsbezirke und ihre sonstigen Körperschaften, ihre Anstalten und Stiftungen sowie ihre Einrichtungen und Dienste bilden eine innere und äußere Einheit.« (Bayern § 1.1).
Übrigens lassen sich sämtliche Gesetze dieser beiden Landeskirchen auch über das Internet abrufen (Baden: www.kirchenrecht-baden.de; Bayern: www.bayern-evangelisch.de/ www/ueber_uns/ kirchenverfassung.php)!
Fragt man sich, warum die württembergische Landeskirche ihre Gemeinden und Kirchenbezirke nicht in die Verfassung aufgenommen hat, wurden und werden zunächst historische Gründe genannt. Als das Kirchenverfassungsgesetz im Jahr 1920 in Kraft trat, waren die Kirchengemeinden rechtlich gesehen immer noch eine »halbkirchliche halbstaatliche« Größe, so der Tübinger Kirchenjurist Arthur Schmidt.26 Auch aus diesem Grund forderte er bereits im Jahr 1919, da »bisher weder die Kirchengemeinde, noch ihr kirchlicher Repräsentant, der Kirchengemeinderat, stärker hervorgetreten« seien, müsse der bevorstehende synodale Aufbau »bei den Kirchengemeinden beginnen«27. Eine der Hauptaufgaben der verfassungsgebenden Versammlung sei es, »die Schaffung des rechten
Genießen, Genossen, genießen!
6
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Verhältnisses von ›Einzelgemeinde‹ und ›Synodalkirche‹« herzustellen.28 Allerdings wurden diese Vorschläge bei den Beratungen über die Verfassung zurückgewiesen, u.a. mit der Begründung, dass »gerade in Württemberg seit den Zeiten Herzog Christophs … der Gedanke der Überordnung der Landeskirche immer lebendig gewesen sei« und die Landeskirche »als Ganzes geschichtlich und rechtlich betrachtet vor den Gemeinden und Diözesen da [gewesen] und ihnen rechtlich übergeordnet« sei29. Man entschied sich also »mit voller Bestimmtheit gegen das Prinzip der Gemeindesouveränität«30
»Indem die württembergische Verfassung die Gemeinde übergeht, spiegelt sie die Zeit vor 1918 wider, als die ganze Landeskirche gewissermaßen als ›Landesgemeinde‹ angesehen wurde«, konstatiert Hermle31, wobei es sich allerdings um ein längst obsolet gewordenes Konzept handele.32
Top-down oder was? Die Frage der Leitung
Diese Top-down Strukturierung und die damit zusammenhängenden Befürchtungen, es könne bei einer vielleicht sogar die Kirchenverfassung betreffenden Veränderung zu unübersehbaren Unwägbarkeiten kommen, zeigen sich im Übrigen auch heute noch. So wurde ja bei der letzten Tagung der Landessynode (17.-19. März 2011) der Antrag, künftig nicht mehr den Landeskirchenausschuss, sondern die gesamte Synode über die Ernennung der Prälaten und der übrigen Mitglieder des Kollegiums (des Oberkirchenrates) abstimmen zu lassen, durch den Rechtsausschuss abgelehnt, weil dies einen »gravierenden Eingriff in die Verfassungswirklichkeit« bedeuten und zudem das »Miteinander der Leitungsorgane« verändern würde.33
Die alte »Verfassungswirklichkeit« hat also weiter Bestand. Und auch wenn sich die meisten Synodalen bestimmt und mit Recht! dagegen verwehren würden, dass sie in ihrer praktischen Arbeit nicht (auch) nach den Grundsätzen der geistlichen Leitung arbeiten, und sich durchaus auch als »Delegierte« der Kirchengemeinden um die Vertretung ihrer Interessen mühen betrachtet man das Kirchenverfassungsgesetz auch als geistlich-theologische Grundkonzeption unserer Landeskirche, so sind weder die geistliche Leitung durch die Synode, noch das »Prinzip der Gemeindesouveränität« von unserer derzeitigen Verfassung gedeckt oder erwünscht!
Das hängt auch mit dem Begriff der »Leitung« zusammen. Leitung lässt sich im kirchlichen Raum nicht eindeutig aufteilen in geistliche und verwaltungstechnische Leitung, was zunächst einmal kein Negativum ist. Aber Hans-Jürgen Abromeit, Bischof der Pommerschen Evangelischen Landeskirche (einer lutherischen Kirche, wie unsere), stellt zum Beispiel die Frage, inwieweit die »staatsanaloge, behördenförmige Organisationsform der Kirche [und damit auch die Frage der starken Gewichtung auf eine verwaltungstechnische ›Leitung‹ durch Synode und Oberkirchenrat]… überholt« ist34, da diese Form typisch für die definitiv zu Ende gegangene konstantinische Epoche sei. Auch die gegenwärtige Durchstrukturierung der Landeskirche, bis hin zu den Gemeinden, gehört für Abromeit auf den Prüfstand, da in »einer Gesellschaft, in der sich die Lebenswelten, in denen Menschen heute leben, unwiederbringlich differenziert, individualisiert und damit pluralisiert haben … die strukturelle Gliederung einer Landeskirche in flächendeckende Parochien ein Relikt aus einer vergangenen Zeit [darstellt], in der jeder Mensch als Untertan auch seinen Ort in einer christlichen Gemeinde finden musste … Eine[r] Zeit der unterschiedlichen und miteinander konkurrierenden Angebote würde vielmehr die Zuordnung nach Attraktivität als nach Wohnort entsprechen … Wir stehen seit dem Ende der konstantinischen Epoche vor der Aufgabe, eine Verfassung der Kirche zu entwickeln, die für eine plurale und polyzentrische Gesellschaft passt … Mochte in der zurückliegenden Zeit Leitung der Kirche durch Verwaltung noch funktionieren, so führt in der Gegenwart die Reduktion der Leitungsaufgaben auf Verwaltung der Kirche in den Untergang. Es gilt, strategisch und mutig ganz neue Entscheidungen zu fällen, die unter dem Verwaltungsparadigma von Leitung nicht in den Blick kommen können«35.
Genießen, Genossen, genießen!
7
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Ich habe Hans-Jürgen Abromeit hier so ausführlich zu Wort kommen lassen, weil er zum einen als lutherischer Bischof sehr deutliche Worte hinsichtlich der Befindlichkeit seiner eigenen Landeskirche findet. Zum anderen sieht er, gerade auch im Blick auf seine Kirche die große Chance, die diese Krise darstellt, weil sich »die Pommersche Kirche … als eine Gemeindekirche versteht, also als eine Kirche, die sich von der Gemeinde her aufbaut«36. Von daher ist auch die Leitungsdurchlässigkeit zu verstehen, die sich von der Gemeinde, über die Synode als »Vertretung der Gesamtheit der Kirchengemeinden«37, die den Bischof und die anderen Mitglieder der Kirchenleitung wählt, bis hin zum Bischof führt, der »das leitende geistliche Amt«, entsprechend CA 7, wahrnimmt.38
In unserer Kirchenverfassung heißt es vom Bischof (fast lapidar): »Dem Landesbischof kommt die oberste Leitung der Landeskirche zu« (§ 31). Zwar enthält das Amtsgelübde, das der Bischof abzulegen hat, auch Elemente, die eindeutig der geistlichen Leitung zuzuordnen sind39, aber ein »leitendes geistliches Amt« wird im Rahmen unserer Kirchenverfassung nicht ausdrücklich erwähnt im Gegensatz z.B. zur Pommerschen Landeskirche.
Wie sieht »geistliche Leitung« aus?
»Kirchenleitung«, so wieder Abromeit, »geschieht durch Auslegung des Evangeliums. Zur Wahrung der Evangeliumsgemäßheit des Dienstes der Kirchengemeinden, der Pfarrerschaft und der Mitarbeiterschaft gehört aber auch die Sorge für die Ordnung der Gemeinden und das Pfarrer- und Dienstrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus der primären Aufgabe des geistlichen Amtes, Kirchenleitung durch Schriftauslegung zu üben, entwickelt sich eine sekundäre Aufgabe, für die Voraussetzungen der Evangeliumsverkündigung in Wort und Tat Sorge zu tragen … So beschreibt Art. 119 [der pommerschen Kirchenordnung] als die beiden Schwerpunkte für die geistliche Leitung durch den Bischof:
Erstens: ›Die Fürsorge für die Einigkeit der Kirche im Glauben und in der Liebe.‹ Und Zweitens: ›Die Fürsorge für das Wachstum der Kirche in der Fülle ihrer Ämter und ihrer lebendigen Kräfte‹.«40
Durch den Aufbau der pommerschen Kirchenordnung, mit ihrer verankerten Reihenfolge von Gemeinde, Mittelbau und Kirchenleitung, ist quasi ein Kreislauf konstitutiv geworden, den unsere Verfassung einfach nicht im Blick hat. Hier findet sich nur ein »kleiner« Kreislauf (Synode, Okr, Bischof und Landeskirchenausschuss), der zudem durch Zu, Über und Unterordnungs-»Schleusen« in eine bestimmte Richtung kanalisiert ist (vgl. § 21.3 KVG). Die einzelne Gemeinde ist durch die gesonderte gesetzliche Regelung in der KGO somit nicht direkt in diesen Kreislauf eingebunden, sie ist eben »Glied der Evangelischen Landeskirche« (§ 1 KGO)41, nur Filiale des übergeordneten landeskirchlichen Leitungskreislaufs.
Wenn aber im Rückgriff auf das reformatorische Priestertum aller Gläubigen sowohl das »synodale Handeln, aber auch das kirchenleitende Handeln und das Mithandeln der Gemeinden … in arbeitsteiliger Gemeinschaft und gegenseitiger Verantwortung im jeweiligen Aufgabenbereich« geschehen soll42, welche Auswirkungen hat dann eine getrennte gesetzliche Regelung auf das Miteinander, vor allem auch im Blick auf zukünftige Notwendigkeiten und Entwicklungen? Und welche Folgen hat das dann für das Selbst- und das Fremdverständnis der Synode, die eben nicht »das Kirchenvolk [= die Kirchengenossen], sondern die Gemeinden gegenüber der Landeskirche, die Landeskirche gegenüber den Gemeinden« repräsentiert?43
Diese Fragen mögen aus der Sicht der Erfahrungen und der praktischen Arbeit der Synodalen und auch der Gemeinden in reichlich abstrakte Bereiche weisen. Vielfach »läuft« es ja anders, findet Austausch zwischen Gemeinden und Synode, Synode und Landeskirche auf eine Art und Weise statt, die sich durchaus als »arbeitsteilige Gemeinschaft« und »gegenseitige Verantwortung« bezeichnen lässt. Und liegen nicht genug »Sachfragen« und aktuelle Probleme auf dem Tisch, die es anzupacken gilt? Warum sich dann mit kirchen-juristischen »Spitzfindigkeiten« abgeben?
Genießen, Genossen, genießen!
8
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Anders herum gefragt: Wenn bereits so viel »Miteinander« der verschiedenen Ebenen geschieht, gerade auch in der Beziehung Gemeinde Landeskirche bzw. Kirchenleitung, dann sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass dies zumindest hier bei uns in Württemberg oft ebenfalls der »Verfassungswirklichkeit«44 nicht entspricht, sich, legt man den Rechtsrahmen sehr eng an, quasi sogar im verfassungsfreien Raum bewegt?
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die Bindung an das Bekenntnis in der Kirchenverfassung geregelt ist, und dass von daher »Kirchenrecht, Kirchenverfassung und Bekenntnis aufeinander bezogen sind. Nicht nur so, dass das Bekenntnis sozusagen wie ein Gartenzaun äußere Grenzen kirchlichen Gestaltungsfreiraums markiert, sondern in dem Sinne, dass sich alles Ordnen in der Kirche auf der substantiellen Grundlage des Bekenntnisses zu vollziehen hat, dass die Kirche auch darin ihren Herrn bekennt, wie sie sich ordnet und wie sie in den Formen des Rechts handelt«45.
Ist unsere »Verfassungswirklichkeit« wirklich »grundevangelisch«?
Nimmt man die Aussage des § 1 unseres KVG ernst46 und legt man dann den § 22 KVG zur »Prüfung« an47, so ergibt sich m.E. schon die Frage, ob unsere Kirchenverfassung den Rahmen, den Altes und Neues Testament und die Bekenntnisschriften, die die Grundlage unserer Landeskirche bilden, zwar nicht unbedingt verlässt, aber vielleicht verkürzt bzw. einschränkt. Und was zählt mehr, die »Bekenntnis-« oder die »Verfassungswirklichkeit«?
Das betrifft dann nicht nur allgemein die richtige Zuordnung von Gemeinde Synode Kirchenleitung, sondern ganz speziell die Fragen nach der möglichen Verwirklichung des Priestertums aller Gläubigen, der auch rechtlichen Stellung neuer Gemeindeformen, der Ämterfrage, der geistlichen Leitung, der Zuordnung von Gemeinde, Leitung und (durchaus notwendiger) Verwaltung, bis hin zu den Finanzfragen Themen, die wir uns bei Kirche für morgen allesamt auf die Fahne geschrieben haben!
Luther hat dazu bereits in der schon erwähnten Schrift, »Dass eine christliche Gemeinde …« von 1523 Grundlegendes zu sagen gehabt.48
Um das Rad nicht noch einmal neu zu erfinden, im Folgenden die etwas längere aber prägnante Erklärung der Aussagen Luthers durch Klaus Douglass:
»Martin Luther wollte auch, was die Kirchenverfassung anbetraf, zu den Ursprüngen des Neuen Testamentes zurückkehren. Vor allem der junge Luther träumte von einer Kirche, in der es keine höhere Instanz als die jeweilige Gemeinde selbst mehr geben sollte … Was Luther anstrebte, war ein Kirchensystem, dem zufolge jede Gemeinde eigene Rechtshoheit besitzt und in dem es statt einer hierarchischen Kirchenstruktur nur einen relativ lockeren Verbund der verschiedenen Einzelgemeinden gibt. Luther hatte es sattsam erlebt, welche Folgen eine hierarchisch verfasste Kirchenstruktur, an deren Spitze ein Bischof steht, für die Freiheit der Christen, die Unabhängigkeit der Gemeinden und nicht zuletzt für die Sauberkeit der theologischen Lehre haben kann. Zum anderen lag die Vorstellung von einer wesentlich hierarchiefreien Kirche absolut in der Sachlogik von Luthers Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Wenn jeder einzelne Gläubige in gleicher Unmittelbarkeit zu Gott steht und es keines vermittelnden Priestertums mehr bedarf, um vor Gott zu treten, dann wird jeder Gläubige selbst zu einer Art Priester, zu einem ›freien Christenmenschen‹, der … ›niemandem untertan‹ ist auch und schon gar nicht irgendeiner innerkirchlichen Instanz. Das Gleiche gilt mutatis mutandis (mit den nötigen Abänderungen) auch für die Gemeinschaft der Gläubigen innerhalb der Gemeinde: Prinzipiell gibt es nichts und niemanden, der der Gemeinde von außen sagen dürfte, was sie zu tun oder zu lassen hat. Die Gemeinde untersteht Gott allein. Die Kirche ist ein Zusammenschluss von Gemeinden. Sie steht nicht über der Gemeinde.
… diese Gedanken sind grundevangelisch. Die Frage nach der Autorität der Kirche beantwortete Luther zeit seines Lebens so, dass die Kirche nur eine abgeleitete Autorität habe … Deshalb darf die Kirche nicht Gehorsam ihr gegenüber , sondern nur Christus gegenüber fordern … Der Kirche gebührt [zwar] bei aller Fehlbarkeit Respekt und
Genießen, Genossen, genießen!
9
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Anerkennung für ihre Bemühungen, aber sie hat von den Menschen keinen Gehorsam zu verlangen. Luther träumt von einer Kirchenstruktur, die dem Rechnung trug und die den Menschen dafür Freiheit ließ.
Dass Luther mit seiner Forderung nach einer Kirche, in der es keine der Gemeinde übergeordnete Instanz gibt, nicht durchdrang, hatte vor allem drei Ursachen: Zum einen herrschte an der Basis der einzelnen Gemeinden nach Jahrhunderten, in denen man sie unmündig gehalten hatte, eine erschreckende Unreife … Zum anderen bekam Luther angesichts der immer stärker werdenden Bewegung der Wiedertäufer und der sogenannten ›Schwärmer‹ Angst vor der eigenen Courage. Er hatte seine eigene Reformation nicht mehr im Griff, was ihn mehr und mehr von seinen ursprünglichen Vorstellungen einer ›Kirche von unten‹ abrücken ließ. Schließlich musste Luther unter dem Zwang der politischen Verhältnisse ein Zweckbündnis mit den Landesfürsten eingehen, die sich als die natürlichen Nachfolger der Landesbischöfe ansahen und entsprechende Macht über ihre jeweiligen Territorialkirchen beanspruchten. So wurde aus der Volkskirche, die Luther ursprünglich gewollt hatte bereits kurz nach seinem Tode eine Landeskirche … Zwar ist die evangelische Hierarchie mittlerweile weitgehend demokratisch legitimiert. Aber von der Idee weitgehend selbstständiger Gemeinden, die Luther im Anschluss an das Neue Testament ursprünglich vorgeschwebt hatte, sind wir so weit entfernt wie eh und je.«49
Soweit Klaus Douglass, der hier sowohl die Chancen als auch die Hindernisse zusammenfasst, die sich heute im Blick auf Gemeinde und Kirche zeigen. Und zu deren Verwirklichung bzw. zu deren Überwindung eine entsprechende »neue« Verfassung(swirklichkeit) vielleicht nicht der erste Schritt ist, aber auch nicht ausgeblendet werden kann und darf.
In die Hände gespielt Die Chancen der Synode
Wie der Weg dorthin für die Synode aussehen könnte um derentwillen ich mir diese Gedanken vor allem gemacht habe , dazu hat, pragmatisch wie es sich für ihn gehört, Klaus Douglas sich ebenfalls ein paar Gedanken gemacht und einige Vorschläge parat (darum zitiere ich wieder den gesamten Zusammenhang):
»Aufgabe der Synoden in den nächsten Jahren wird sein, die Gemeinden von ca. 80 % der derzeit gültigen Regeln zu entlasten. In der Zwischenzeit sind die Gemeinden zu zivilem Ungehorsam aufgerufen.
Beim Durchforsten der derzeit in der Kirche vorhandenen Regeln und Strukturen kann man zwischen mehreren Kategorien unterscheiden.
1. Da sind zunächst jene Ordnungen, die für die gesunde Entwicklung der Gemeinden und die weltweite Ausbreitung des Reiches Gottes absolut notwendig sind.
2. Dann gibt es zweitens jene Regeln und Ordnungen, die zu diesem Zweck zwar nicht notwendig, aber doch ganz hilfreich sind.
3. Drittens finden wir Regeln, die dem eben beschriebenen Zweck zwar nicht unbedingt dienen, die ihm aber auch nicht schaden (jedenfalls nicht vordergründig).
4. Und schließlich gibt es Ordnungen und Strukturen, die diesem Zweck geradezu entgegenwirken.
Mein Plädoyer geht dahin, die Gemeinden von allen Regeln, die zu letzteren beiden Gruppen gehören, sofort zu entlasten und bei der zweiten Gruppe genau zu überlegen, ob die betreffenden Ordnungen wirklich hilfreich sind oder ob sie es lediglich einmal waren. Auch hier würde ich vorschlagen, im Zweifelsfall für die Freiheit der Gemeinde zu optieren und die Regelung abzuschaffen. Es gibt so viele Regelungen, die sicherlich irgendwo ihren Sinn haben, aber den Betrieb der Gemeinde unglaublich aufhalten und für die Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt schlichtweg unnötig sind. So brauchen wir beispielsweise kein eigenes Rechnungswesen und kein eigenes kirchliches Arbeitsrecht das weltliche
Genießen, Genossen, genießen!
10
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Recht ist hier und auch in anderen Fällen völlig hinreichend (und in vielen Fällen sogar besser und unkomplizierter als das unsere)! Meiner Schätzung nach könnten wir unsere Gemeinden und überregionalen Dienste bequem von ca. 80 % des derzeit gültigen Regelwerkes entlasten, ohne dabei an Substanz zu verlieren wir würden im Gegenteil an Substanz gewinnen.
Im Grunde müssten wir eine Obergrenze festlegen, über die hinaus es keine kirchlichen Regeln und Bestimmungen mehr geben darf. (Ich gebe zu, das wäre eine weitere Regel.) Für jede neue Regel, die in Zukunft eingeführt wird, müssten wir vier alte ersatzlos abschaffen, bis wir in einigen Jahren endlich unterhalb dieser Grenze angekommen sind.
Dann könnten wir das Verhältnis von neuen und abzuschaffenden Regeln auf 1:1 reduzieren. Nun glaube ich kaum, dass auch nur eine der derzeit in Deutschland agierenden Landessynoden sich mit dem Gedanken anfreunden wird, für jede neu ins Leben gerufene Regel vier alte abzuschaffen. Das sieht nach einer ziemlich mühseligen Arbeit aus. Daher mache ich folgenden (zunächst einmal sicherlich unrealistisch klingenden) Alternativvorschlag, der die ganze Prozedur erheblich abkürzen würde: Statt zu überlegen, welche Gesetze man abschaffen will, sollten wir uns überlegen, welche wir unbedingt beibehalten wollen. Die Synoden könnten eine Arbeitsgruppe beauftragen, eine neue Kirchenordnung zu entwickeln, die dem Umfang nach auf jeden Fall unter der besagten Obergrenze zu bleiben hätte. Die von dieser Arbeitsgruppe erarbeitete neue Kirchenordnung wäre in der Synode eingehend zu diskutieren, gegebenenfalls zu verbessern und löste, wenn sie verabschiedet ist, ersatzlos die komplette alte Kirchenordnung ab. Dabei wäre natürlich darauf zu achten, dass es großzügige Übergangsregelungen gibt und es vor allem in Personalfragen zu keinen sozialen Härtefällen kommt.
In der Zwischenzeit müssen sich die Gemeinden in zivilem Ungehorsam üben (das halte ich für eine grundevangelische Tugend: So ist unsere Kirche entstanden). Das Wörtlein ›zivil‹ signalisiert, dass es um einen nicht-militanten, nicht-zerstörerischen Ungehorsam geht. Der zivile Ungehorsam entspringt vielmehr einer Grundloyalität. Selbst wenn man die von der Kirche vorgeschriebenen Wege hier und dort verlässt, geht es letztlich doch immer um ein gemeinsames Grundanliegen, über das man sich mit seiner Kirche einig weiß. Was mir vorschwebt, ist ein weitgehendes gegenseitiges Verständnis und eine einvernehmliche Lösung. Die Gemeinden müssen Verständnis aufbringen für die Langwierigkeit des Prozesses, dessen es bedarf, um die bestehenden Kirchengesetze zu überprüfen und von unnötigem Ballast zu befreien: Die Kirche ist in vielerlei Hinsicht wie ein großer Tanker, den man erst nach einem Bremsweg von vielen Kilometern zum Stoppen oder auch nur zum Wenden bringt. Die kirchenleitenden Gremien und Personen müssen ihrerseits Verständnis dafür aufbringen, dass die Gemeinden das kommende Recht hier und da schon einmal vorwegnehmen. Sie können es sich einfach nicht leisten, zu warten, bis die neue Kirchenordnung Wirklichkeit geworden ist. Sie müssen in der Zwischenzeit ihre Arbeit tun, und das möglichst gut. Ein ›Gentleman’s Agreement‹ also von beiden Seiten. Und irre ich mich? Ich habe den Eindruck, dass das heute ohnehin schon ziemlich oft so gehandhabt wird. Es würde freilich viel zur Entkrampfung der Lage beitragen, wenn man das auch mal so deutlich aussprechen würde.«50
Steile Sätze, das gebe ich zu, aber wie bei jeder Bergwanderung gibt es auch hier Etappenziele die Douglass ja auch benennt die man im Auge haben kann und muss, um das Ziel wirklich zu erreichen.
Down-top: Gemeinde und Synode stärken
Eines dieser Etappenziele könnte, auch im Blick auf eine Änderung der Verfassungswirklichkeit, in der vertiefenden Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem immer noch »allein seligmachenden Parochialprinzip« innerhalb unserer Landeskirche bestehen. Auch deshalb, so Hans-Richard Reuter, Theologieprofessor und Direktor des IfES51 der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, weil die »Notwendigkeit, ›Gemeinde‹ sozial und räumlich abzugrenzen … nicht (bzw. nur im
Genießen, Genossen, genießen!
11
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Ausnahmefall des status confessionis) theologischer Natur [ist]«52. »Die[se] sozialräumliche Abgrenzung«, so Reuter weiter, »… ist aber vermittels unterschiedlicher Organisationsformen von Gemeinde möglich. Schon aus den beiden ganz elementaren Erfordernissen Erreichbarkeit und Verstehbarkeit ergibt sich, dass unter Bedingungen hochgradiger Mobilität und zunehmend soziokultureller Pluralisierung der Lebensverhältnisse die territorial abgegrenzte Parochie keinesfalls die einzige oder dominierende Organisationsform christlicher Gemeinde sein kann. Zum einen ist die Erreichbarkeit nicht notwendig auf den Wohnort beschränkt … Zum anderen werden Verständigungs-chancen niemals durch territoriale Abgrenzung garantiert, sondern hängen von der Lebenssituation sowie sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen ab«53.
Mit anderen Worten: Weil die Frage nach der »passenden« Gemeindeform keine Angelegenheit ist, die das Bekenntnis unserer Landeskirche berührt oder ins Wanken bringen könnte, bedarf es »nur« einer neuen, allgemeinen und dauerhaften gesetzlichen Änderung (auch als Ersatz für die leidigen Hilfskonstruktionen der bestehenden »Ausnahmeregelungen«), um hier für eine Änderung zu sorgen. Klingt theoretisch gut, aber ich bin mir sicher, dass dies immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen wird, vor allem solange die Gemeinden gesetzlich als »Filialen« der Landeskirche betrachtet werden, die darauf angewiesen sind, dass ihnen ihre »Geschäftsräume« von oben zugewiesen werden. Auch hier ist es Aufgabe einer kirchenleitenden Synode, die gesetzlichen Freiräume zu schaffen, sowohl für die Gemeinden als auch für die Gemeindeformen. Und auch hier wäre es letztlich sinnvoll und geboten, die Gemeinden in den Bereich der Kirchenverfassung aufzunehmen. Deren direkte verfassungsrechtliche Anbindung an das Bekenntnis würde ihnen einerseits den Freiraum und den Schutz unserer gemeinsamen Bekenntnisgrundlagen garantieren, sie nicht mehr als Filialen, sondern als ebenbürtige Teilhaber an der Landeskirche sehen und sie damit echt reformatorisch stärken. Andererseits würde eine solche direkte Verortung der einzelnen Gemeinde auch die Grenzen ihrer Freiheit und die Unumgehbarkeit der Erfüllung ihres Auftrages deutlicher vor Augen halten.
Damit würde aber auch die Stellung der Synode gestärkt, denn sie würde zum Abbild neuer, vielfältiger und starker Gemeinden. Und zwar nicht nur im organisatorischen und rechtlichen Sinn, sondern auch im Blick auf die geistliche Leitung. Die ist zwar nicht verfügbar und durch die Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen herstellbar. Ungünstige Rahmenbedingungen können sich ja durchaus auch auf die Inhalte auswirken; allerdings sollte man dabei nie vergessen, dass mit dem »besser« organisieren nicht alles getan ist oder erreicht werden kann denn »in religiösen Dingen ist es wohl der heilige Geist, der sich nicht wirklich darum scheren dürfte, ob irgendeine Kirchenleitung oder ein kirchliches Gremium dies oder jenes reformierend [oder auch nicht reformierend] entschieden hat. Der soziologische Funktionssinn des heiligen Geistes dürfte nach Paulus (vgl. 2. Korinther 3,6) jedenfalls darin liegen, dass sich Pneuma [= Geist] eben nicht durch Gramma [= Buchstabe] konditionieren lässt.«54
Wenn das synodale Prinzip unserer Landeskirche seinen tiefsten Grund in »der Beteiligung der Gemeindeglieder an den Grundaufgaben kirchlichen Lebens«55 hat, dann kann und darf es nicht dabei bleiben, dass sich die Synode letztendlich selber »die Luft abdreht«, indem die Gemeinden am organisatorischen und rechtlichen Gängelband bleiben.
Ein Schritt auf dem Weg dies zu ändern, war sicherlich die zwar zaghafte aber deutliche Änderung des Pfarrerwahlrechtes. Den Gemeinden wird hier erlaubt und zugetraut, einen Pfarrer auszuwählen, der nach ihrer auch und hoffentlich geistlichen Entscheidung »passt«. Sicher, es mag noch ein weiter Weg sein, bis wir vielleicht auch einmal zu solchen Möglichkeiten finden, wie sie sich in einer holländischen Kirchenordnung zur Frage nach der Zulassung zum Pfarramt finden: »Zunächst werden die normalen kirchlichen bzw. akademischen Voraussetzungen für eine Ausbildung genannt. Doch dann wird auf eine mögliche Ausnahme verwiesen: Wenn eine Gemeinde erkennt, dass der Heilige Geist einen Menschen unmittelbar zu seinem Dienst berufen und dafür ausgerüstet hat, so ist dieser von der Kirchenleitung [!] auch ohne Ausbildung in den Pfarrdienst aufzunehmen … Eine Kirche
Genießen, Genossen, genießen!
12
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
anerkennt, dass Gott durch den Heiligen Geist in ihr unmittelbar handeln und Menschen berufen darf unabhängig von allen kirchlichen Bestimmungen. Dem lebendigen Gott wird durch eine Kirchenordnung Raum für ein eigenständiges kirchenleitendes Handeln eingeräumt!«56
Dieses sicherlich außergewöhnliche Beispiel macht sehr deutlich, was geistliche Leitung bedeutet. Und zwar nicht nur auf der Ebene der Gemeinde, sondern auch im Blick auf Synode, Okr und Bischof. Und wie wichtig auch und gerade im Blick auf eine gegenseitige geistliche Stärkung und/oder Korrektur letztlich auch die rechtliche Gleichstellung der verschiedenen Ebenen unserer Landeskirche ist.
»Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« Oder: »Was ist das Gute am Schlechten?«
Diese Fragen hat der systemische Therapeut Paul Watzlawick (»Anleitung zum Unglücklichsein«) benutzt, um einen Perspektivwechsel bei der Betrachtung einer psychischen Erkrankung zu bewerkstelligen, der dazu führen sollte, zu erkennen, »dass Krankheitssymptome auch einen Sinn haben und nicht bloß als Defizit, sondern auch als Ressource, als Quelle der Kraft, gesehen und genutzt werden können … [Es ging um] Perspektivwechsel und überraschende Interventionen … Die systemische Therapeuten brachten neuen Schwung in ein System, das zuvor in bestimmten wenig nützlichen und daher leidvollen Riten erstarrt war.«57
Keine Sorge, ich will an dieser Stelle weder die Landeskirche noch die Synode, den Okr oder unseren Bischof in die Rolle eines psychisch Erkrankten hineindrängen. Bräuchte ich wahrscheinlich auch gar nicht, denn laut einer ernsthaften Untersuchung leiden heute sowieso 210 % unserer Bevölkerung unter »Angststörungen, Panikattacken, Essstörungen, Depressionen, Schizophrenien, Süchte[n], Demenzen und so weiter«58.
Ich möchte nur zwei Dinge damit verdeutlichen:
1. Es geht bei diesen ganzen Überlegungen nicht darum, ein ganzes System zu stemmen und über Bord zu werfen, weil es »schlecht« ist, und dafür ein völlig neues, »gutes« einzufordern und einzuführen. Wer das ins Auge fasst, der sollte sich mindestens wegen Größenwahn in fachliche Behandlung begeben. Mir geht es hier vielmehr darum, den Blick für mögliche »Perspektivwechsel und überraschende Interventionen« zu schärfen, die auch rechtlich möglich und geboten sind. Manches ist, wie angedeutet, bereits in dieser Richtung schon auf den Weg gebracht (Pfarrerwahlgesetz, Jugendsynodale). Für Anderes lässt sich vielleicht anhand akuter »Symptomatiken« seitens der Landeskirche (Jahr des Gottesdienstes, das scheinbar wieder nur einäugig auf »den einen Gottesdienst«59 hinausläuft; Diakonat und im Zusammenhang damit die Ämterfrage) ein Wechsel der Perspektive, verbunden mit einigen überraschenden Irritationen bewerkstelligen, der den Gemeinden, der Synode, dem Okr und dem Bischof gut tut.
2. Die Krise, in der unsere Gemeinden und unsere Landeskirche stecken, besitzt nicht nur ein negatives Vorzeichen. Wenn die charakteristischen Anzeichen eine Krise, »eine dringende Notwendigkeit von Handlungsentscheidungen, ein durch den Entscheidungsträger wahrgenommenes Gefühl der Bedrohung, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und Zeitdruck und das Gefühl, das Ergebnis sei von prägendem Einfluss auf die Zukunft«60 sind, das Ganze also nicht als »Katastrophe« sondern als »Entscheidung« betrachtet wird, dann stehen eigentlich im Moment für Gemeinden und Synode alle Türen und Tore sperrangelweit offen, um hier wirklich den »neuen Schwung in ein System« zu bringen, das zum Teil auch in verwaltungs- und verfassungsrechtlichen »Riten« erstarrt ist. Wobei zum beraten, bewegen und bewältigen immer auch das »berufen zu« gehört. Vielleicht bietet Gengenbach auch die Möglichkeit, darüber etwas zu entdecken!
Das wir bei dieser ganzen Geschichte immer auch Teil unserer Landeskirche sind, mit zu den fehlbaren und sündigen Menschen gehören, die sie, die »magna peccatris« (die größte aller Sünderinnen, Luther) ausmachen, können und dürfen wir nicht vergessen. Von uns aus
Genießen, Genossen, genießen!
13
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
werden wir die anstehenden Aufgaben nicht erledigen, und auch das nicht: eine Gemeinde- und Kirchengestaltung, eine neue Ekklesiologie zu erarbeiten. Das kann uns nur von Gott her geschenkt werden. Es gibt verschiedene Texte im Neuen Testament, die uns dabei eine Hilfe und Perspektive bieten. Einen dieser Texte möchte ich hier als Abschluss anführen, verbunden mit einer Auslegung von Wolfgang Bittner:
Philipper 2,5-11: Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus
gesetzt hat: Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja,
den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über
alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen – alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter
der Erde; alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist der Herr!« Und so wird Gott, der Vater, geehrt.
»Eine Design-Anleitung aus dem Neuen Testament
Nun meine ich, dass es im Neuen Testament eine grundlegende Design-Anleitung für christliche Gemeindegestaltung gibt, an der niemand von uns vorbeigehen kann. Ich bin überzeugt, dass dies der entscheidende Text einer kommenden Ekklesiologie und praktischen Theologie zu sein hat und auch sein wird. Es ist der Christushymnus, den Paulus im Philipper zitiert (2,5-11).
Sehen wir uns diesen Abschnitt näher an. Hier liegt ein Lied vor, das von Christus spricht, von seinem Weg, den er aus höchster Höhe in die tiefste Tiefe gegangen ist, um dann von Gott selbst überaus erhöht zu werden. Tatsächlich spricht der Text von drei Dingen:
Eine Haltung Er spricht von einer Haltung, die dieser Christus annimmt. Es ist die Haltung einer
unbedingten, ja unglaublichen Freiwilligkeit. Christus hält nichts fest. Zweimal heißt es: Von sich aus gibt er alles hin. Hier handelt einer, der sich bis zum letzten Moment nicht von anderen vorschreiben lässt, was jetzt zu tun sei; der auch nicht, wie es in der Kirche heute nur zu oft geschieht, der Gesellschaft hinterherläuft und sagt: Weil die Gesellschaft so ist und der moderne Mensch solche Erwartungen hat, müssen wir uns heute doch anpassen, um verständlich zu sein. Nein, da steht einer vor uns, der von sich selbst aus die Schritte seines Lebens tut. Das ist zunächst eine grundlegende Lebenshaltung.
Ein Verhalten Aus dieser inneren Haltung der Freiheit kommt es zu einem Verhalten, einem konkreten
Handeln. Er lässt los. Er hält nicht fest, was ihm zu eigen ist. Er gibt hin. Er erniedrigt sich selbst. Er wird gehorsam …
Das Christuslied spricht von einer Gesinnung, die in Einheit mit dem Verhalten steht.
Ein beschrittener Weg Aus diesem Verhalten ergibt sich ein konkreter Weg, der gegangen werden muss und von
Christus auch entschlossen gegangen wird. Die Lebensgeschichte Jesu ist ein vorbildhafter Weg des Loslassens in Freiheit.
Wie ist der Christushymnus zu lesen? Man hat den Christushymnus bis heute fast ausschließlich auf zwei Seiten hin gelesen.
Einmal als Beschreibung der ‚Kenosis‘, also des Weges der Selbsthingabe und Erniedrigung Christi von der Höhe in die Tiefe und dann in seine Erhöhung durch Gott. Damit hat man ihn als einen christologischen Text gelesen. Es ist ein Hymnus, der uns von Christus spricht.
Genießen, Genossen, genießen!
14
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Daneben stand wohl von Anfang an die Variante, die Paulus nahezulegen scheint. Man las den Text als Lebensanleitung für den glaubenden Menschen. ›Ein jeder sei gesinnt, wie Christus …‹. Damit wurde er zu einem Text der Ethik. Das Verhalten des glaubenden Christen sollte sich am Vorbild Christi ausrichten. Damit ist ohne Zweifel etwas von dem getroffen, das Paulus gemeint hat.
Vergessen wurde bis heute jedoch weitgehend, dass Paulus hier zu einer Kirche und gleichzeitig über den Weg von Kirche allgemein spricht. Christologie, Ethik und Ekklesiologie sind bei ihm untrennbar ineinander verschlungen. Die Zielrichtung, die Paulus im Zusammenhang des Textes (von 1,27 an) markiert, ist der Bau der Gemeinde. Damit wir als Kirche gut unterwegs sein können (ekklesiologischer Aspekt), darum haben wir an Christus (christologischer Aspekt) unseren je eigenen Lebensweg (ethischer Weg) zu lernen und unser Verhalten prägen zu lassen. Es ist an der Zeit, dass dieser biblische Text aus der Versenkung der Christologie und der Ethik endlich in den der Ekklesiologie und der praktischen Theologie auftaucht, um dort seinen zentralen Platz einzunehmen.
An Christus den Weg der Kirche buchstabieren Was von Christus gilt, das ist von der Kirche für ihren eigenen Weg zu lernen. Am
Philipperbrief und an der Art und Weise, wie Paulus diesen Abschnitt in seinen Brief einbaut, zeigt sich, dass es Paulus hier nicht um Christologie, sondern um Gemeindepädagogik geht. Wer diesen Text erarbeiten will, der wird eine lange Bibelarbeit anstellen müssen, die mit der Wirklichkeit der Gemeinde (und damit mit 1,2761) beginnt. Hier wird natürlich von Christus gesprochen. Aber so, dass eine Gemeinde am Vorbild Christi ihren eigenen Weg ausrichtet und den Weg Christi entschlossen als ihren eigenen Weg nachgeht. Hier wird von Paulus jedes einzelne Gemeindeglied darauf verpflichtet, die Gesinnung Jesu als eigene Gesinnung zu übernehmen und sich so in die Gemeinde, in die Kirche einzubringen. Was Christus auf seinem Weg wir erinnern uns: Haltung, Verhalten und Weg bestimmt hat, das soll jedes einzelne Gemeindeglied bestimmen. Nur so, meint Paulus, kann eine Gemeinde ›missionarisch‹ in einem Umfeld, dem sie das Evangelium schuldig ist, überhaupt existieren.
Paulus spricht hier von der Art und Weise, wie diese Gemeinde untereinander ihre Beziehungs-strukturen aufbaut und klärt. Er mutet der Gemeinde zu, das Signum Christi, das Signum seiner Haltung, seines Verhaltens und seines Weges als Gemeinde zu leben. Nun wird dieser Text spannend. Es wird aufregend, mit Paulus von der Kirche in der Postmoderne in den Worten dieses Hymnus zu reden. Wie würde das klingen?
Wir wollen eine Kirche sein, die um ihre Gestalt bei Gott weiß. Wir wissen, dass wir Gott gehören. Und doch sind wir eine Kirche, die ihre Erwählung, ihr Geliebtsein, ihr Bewahrtsein in Gott, die den unendlichen Reichtum, den Gott ihr zuschreibt und die auch ihre Privilegien, die sie durch die Geschichte erworben hat, nicht festhält. Was wird das für eine Kirche sein, die es sich leisten kann, nicht mehr an ihrem Besitz festzuhalten! Eine Kirche, die von sich aus und nicht durch gesellschaftliche Umbrüche gezwungen den Weg nach unten hin antritt.
Nun geht es weiter. Christus wurde als Mensch erfunden. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Dieners der Menschen. An Christus erkennen wir, dass nur auf diesem Weg das Menschsein, wie es von Gott her gemeint war, gelebt werden kann. Was bedeutet das für uns als Kirche? Wir wollen eine Kirche sein, an deren Art und Weise, wie hier zwischen Amtsträgern und Gemeindegliedern, zwischen Angestellten und Vorgesetzten umgegangen wird, Menschsein deutlich wird. Der säkulare Mensch, der in seinen Strukturen so viel anderes erlebt, soll an der Kirche erkennen können: Das könnte Menschsein eigentlich heißen.
Der Christushymnus fährt fort: Dieses Menschwerden hängt damit zusammen, dass einer ganz gehorsam wird. Was bedeutet es, wenn eine Kirche gehorsam wird? Gehorsam wurde weitgehend zum Fremdwort in unseren Kirchen. Die Krise der Autorität des vergangenen Jahrhunderts hat im öffentlichen wie im persönlichen Bewusstsein ihre tiefen Spuren hinterlassen. Was wäre eine Kirche, die sich den Luxus leistet, zu hören und entschlossen nur noch diesem Hören gehorchend zu folgen: hinhören, immer tiefer hinhören, immer ärmer werden und immer mehr auch in jenes Fasten eintreten, das sich anderen Stimmen, die ihren Weg bestimmen wollen, verschließt.
Genießen, Genossen, genießen!
15
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
›Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.‹62 Gehorsam heißt: Das erste Gebot hat seinen fröhlichen Widerhall in unserem Leben und im Verhalten der Kirche gefunden.
Der Text des Hymnus führt uns noch eine Stufe weiter: Gehorsam bis zum Tode. Ich merke, dass mein Leben eingesetzt wird, dass Gott über mein Leben verfügt bis zum Tod als dem letzten Einsatz. Nichts wird ausgelassen. Und ich sage Ja dazu. Wir sagen fraglos als Kirche Ja dazu und werden so zu einer Kirche, die es sich leistet, radikal gehorsam zu werden …
Bis zum Tod am Kreuz. Das galt Jesus auf seinem messianischen Weg. Auf diesem Weg aber zieht er seine Kirche nun mit. Der Anstoß Jesu Christi, des Gekreuzigten und Auferstandenen, wird für die Kirche zum einzigen Anstoß, wird aber nun wirklich Anstoß in dieser Welt. Es gibt im Neuen Testament keinen Ruf zur Nachfolge und damit keinen Ruf zur kirchlichen Existenz, der nicht die Bereitschaft zum Martyrium für den Namen Jesu Christi in sich schließt.
Daher hat Gott … Kein menschliches und kein kirchliches Mittel bleibt übrig, das diesen Weg wendet. Nur Gott kann es tun. Nur die Hoffnung kann sich auf Gott verlassen: auf ihn allein. Das heißt auch: nicht mehr auf eigenes Glauben, eigenes Gehorchen, eigenes Erniedrigen und eigenes Sterben. Nur noch Er. Im Klartext biblischen Zeugnisses, das die Kirche auszuhalten und zu bezeugen hat: Es ist der Name Jesu Christi, in dem allein Gott uns endgültig begegnet. Darüber hinaus gibt es kein christliches Wort von Gott.
Christi Weg ist unser Weg Erste Andeutungen sind das, nicht mehr. Ausgedacht, nachgebetet und nachgegangen ist
dieser Text noch lange nicht. An ihm wird die Kirche der Zukunft den untrüglichen Wegweiser zu ihrer kommenden und zweifelsohne vielfältigen Gestalt finden. Es wird ein Weg in äußere Armut und Niedrigkeit sein, der seine Hoheit durch den Gehorsam gegenüber Christus erhält: im glaubenden Hören und Befolgen seines guten Wortes. Zu achten haben wir jedoch darauf: Dieser Bibelabschnitt meint die Gemeinde als Gemeinschaft. Er zeichnet zunächst einen Weg der Gemeinde, der Kirche. Insofern ist er auch ein Weg für den einzelnen Glaubenden, den jeder von uns zu gehen hat, wenn er sich in der Gemeinde vorfindet. Wenn ich den Weg Jesu gehe, dann gehe ich ihn nicht allein. Ich gehe ihn als Glied einer Gemeinschaft, zu der ich verpflichtend gehöre. Ich gehöre mit Menschen zusammen, mit denen ich gemeinsam auf Gottes Wort höre und ihm gehorche. Hören, gehören und gehorchen formen uns zur Gemeinschaft, die fortan auch mich bestimmt. Das macht Kirche Jesu Christi aus.«63
Genießen, Genossen, genießen!
16
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
Anmerkungen
1 »Barmen Anfang oder Episode?, ist eine Formulierung von Jürgen Moltmann, Die Barmer
Theologische Erklärung 19342009. In: Evangelische Theologie, 69. Jahrgang, 6/2009, 409.
2 Von daher habe ich mich auch bei den Literaturangaben auf wesentliche Quellen beschränkt vor
allem, weil viele Bücher und Aufsätze heute zumeist nur noch antiquarisch oder in Bibliotheken zu
finden sind.
3 Moltmann, a.a.O. (siehe Anm. 1), 406.
4 Günter Brakelmann (Hrsg.), Evangelische Kirche im Entscheidungsjahr 1933/1934: Der Weg nach
Barmen. Ein Arbeitsbuch. In: Zeitansage Schriftenreihe des Evangelischen Forums Westfalen und
der Evangelischen Stadtakademie Bochum, hg. von Manfred Keller und Traugott Jähnichen, Band 5.
Berlin 2010, 116-119.
5 A.a.O., 123.
6 Ebd.
7 Die Ev. Kirche der altpreußischen Union bestand von 1922-1953 und war flächen- und
mitgliedermäßig die größte damals bestehende Kirche. Sie bestand aus den Kirchenprovinzen
Preußen (Ost und West), Posen, Pommern, Schlesien, Brandenburg, Sachsen, Westfalen und
Rheinland (mit Hohenzollern, das damals noch zum Rheinland gehörte). Seit 1922 gehörten auch die
»Freie Stadt« Danzig, das unter litauischer Souveränität stehende Memelgebiet, Polnisch-
Oberschlesien sowie die Unierte Ev. Kirche in Polen dazu.
8 Auf dieser »freie reformierten Synode« trafen sich am 3. und 4. Januar 1934 in Barmen 320 Älteste
und Prediger aus 167 reformierten Gemeinden. Initiator war der »Coetus [Versammlung] reformierter
Prediger«, das reformierte »Gegenstück« zum Pfarrernotbund. Begründet wurde der
Zusammenschluss des Coetus mit der »Not der Kirche, insbesondere … [dem] Zustand der
Pastorenschaft, deren theologische Ahnungslosigkeit und charakterliche Brüchigkeit uns tief beschämt
… Wir sind der Überzeugung, dass kirchenpolitisches Handeln nur möglich ist von Seiten der
lebendigen Gemeinde, nicht durch einzelne, auch nicht durch Gruppen … Unser Kampf geht um die
Gemeinde … Unser Kampf geht um den Stand der Diener am Wort« (Quelle: Martin Rohkrämer, Die
Synode von Barmen in ihren zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. In: Jürgen Moltmann (Hrsg.),
Bekennende Kirche wagen: Barmen 1934 1984. München 1984, 26). Diese Synode verabschiedete
ebenfalls eine theologische Erklärung, die erste im beginnenden Kirchenkampf, die aus 17 Thesen
bestand.
9 Moltmann, a.a.O. (Siehe Anm.1), 406 (Hervorhebung von mir).
10 Günter Brakelmann, a.a.O. (siehe Anm. 4), 142.
11 Moltmann, a.a.O. (siehe Anm. 1), 407 (Hervorhebung von mir).
12 Bericht des Ältestenrats zu Antrag 07/10 in der Sitzung der 14. Landessynode am 17. März 2011 zu
TOP 6: Zuwahl von Jugendsynodalen. Download unter www.elk-wue.de/landessynode
13 Ich habe den Text des KVG unter folgender Adresse gefunden: www.verfassungen.de. Ansonsten bleiben nur das Nachschlagen in den allseits beliebten Loseblattsammlungen oder folgende Quelle übrig: Quelle: Konsistorial-Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Württemberg, Band 19, 199. Sammlung der Gesetze der evangelischen Landeskirche in Württemberg, III. Bände, Stuttgart 1921.
14 Siehe Anm. 2.
15 Klaus Scholder, »Wir sind es doch nicht, die da könnten Kirche erhalten …«. In: Worte, Beschlüsse,
Handreichungen. Wichtige Entschließungen der Württembergischen Evangelischen Landessynode
seit 1946, hg. Vom Ältestenrat der Württembergischen Evangelischen Landessynode. Stuttgart 1989,
15.
Genießen, Genossen, genießen!
17
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
16 Siegfried Hermle, Die evangelische Landessynode in Württemberg. Anfrage an ihr
Selbstverständnis. In: Blätter für württembergische Kirchengeschichte, Jg. 105, 2005, 227-243, hier
230.
17 Wilhelm Maurer, Das synodale Bischofsamt seit 1918. Berlin 1955, 45
18 A.a.O., 46.
19 Siegfried Hermle, a.a.O. (siehe Anm. 3).
20 Ebd., 237 (Hervorhebung von mir).
21 Ebd.
22 Martin Luther, Dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre
zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift. In: Martin
Luther Studienausgabe Bd. 3, hg. von Hans-Ulrich Delius. Berlin 1983, 76.22f.
23 Wolfgang Huber, Synode und Konziliarität. Überlegungen zur Theologie der Synode. In: Das Recht
der Kirche. Bd. III: Zur Praxis des Kirchenrechts, hg. Von Gerhard Rau; Hans-Richard Reuter und
Klaus Schaich, Gütersloh 1994,319 (Hervorhebung von mir).
24 Siegfried Hermle, a.a.O., 237.
25 Kirchliches Gesetz über die evangelischen Kirchengemeinden, § 1. In: Kirchengemeindeordnung /
Kirchenbezirksordnung mit Ausführungsbestimmungen. Ausgabe April 2006. Stuttgart 2006,1.
26 Der Verfassungsneubau der Evangelischen Kirche in Württemberg. Tübingen 1919, 10.
27 Ebd.
28 Ebd., 12.
29 Arthur Schmidt: Kirchengemeinde und Diözesanverband. Tübingen 1921, 7.
30 A.a.O.
31 A.a.O., 238.
32 Ebd.
33 Bericht des Rechtsausschusses zu Antrag Nr. 10/10 in der Sitzung der 14. Landessynode am 18. März 2011 zu TOP 16: Wahl der Mitglieder des Oberkirchenrats und der Prälaten durch die Landessynode.
34 Hans-Jürgen Abromeit, Leiten in der Kirche ein noch nicht geschriebenes Kapitel der Praktischen
Theologie? In: DERS.; Claus Dieter Classen; Hans-Martin Hader; Jörg Ohlemacher; Martin Onnasch
(Hrsg.), Leiten in der Kirche. Rechtliche, theologische und organisationswissenschaftliche Aspekte.
Frankfurt 2006, 25.
35 A.a.O., 24-25. Das klingt radikal, aber diese Kritik ist ganz und gar nicht neu, wie folgendes Zitat von
Martin Niemöller aus dem Jahr 1945(!) deutlich macht: »Wir sind eine Behördenkirche geworden, und
dieser Umstand hat es uns erleichtert, nur das traditionell Übliche zu tun und nicht weiter zu fragen,
was denn eigentlich unsere Verantwortung war. Die Kirche der Zukunft wird nie wieder
Behördenkirche sein dürfen. Wir haben als Landeskirche in erster Linie unser Augenmerk darauf
gerichtet, den Bestand zu wahren, und darüber haben wir den Blick für die notwendigen
Entwicklungen und für die drängenden Aufgaben des Augenblicks verloren.« Quelle: Martin Niemöller,
Nachschrift der Ansprache an die Teilnehmer der Kirchenkonferenz (Treysa, 28. August 1945). In:
Gerhard Besier; Hartmut Ludwig; Jörg Thierfelder (Hrsg.), Der Kompromiß von Treysa. Die
Entstehung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 1945. Eine Dokumentation. Weinheim
1995, 290-295, hier 292. Die Kirchenkonferenz in Treysa im August 1945 war sozusagen die
›Gründungskonferenz‹ der EKD.
Genießen, Genossen, genießen!
18
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
36 A.a.O., 17.
37 § 124,1 der Kirchenordnung der Pommerschen Evangelischen Landeskirche (Hervorhebung von
mir).
38 A.a.O., §109,1.
39 Vgl. § 3 der Verordnung der evangelischen Kirchenregierung zum Vollzug des
Kirchenverfassungsgesetzes. Auch in § 4 dieser Verordnung wird nur der Satz aus § 31
Kirchenverfassung wiederholt.
40 Hans-Jürgen Abromeit, a.a.O., 20.
41 Für Freunde der deutschen Sprache: Antonyme (= Gegenbegriffe) für »Glied« sind u.a. übrigens
»das Gleiche«, »Körper« und »Gemeinschaft« … ein Schelm, wer dabei an den biblischen Satz denkt,
»deine Sprache verrät dich« (Mt 26,71).
42 Arno Schillberg, Kirchengemeinden und Landeskirche. Eine Verhältnisbestimmung. In: Zeitschrift für
evangelisches Kirchenrecht, 55. Band 2010, 92-100, hier 99.
43 Christoph Link, Leiten in der Kirche Grundsätzlich Anmerkungen aus juristischer Sicht. In: Leiten
in der Kirche (vgl. Anm. 21), 31-50, hier 39.
44 Vgl. Anm. 20.
45 Christoph Link, a.a.O. (siehe Anm. 30), 34-35.
46 § 1 des KVG lautet: »Die evangelisch-lutherische Kirche in Württemberg, getreu dem Erbe der
Väter, steht auf dem in der Heiligen Schrift gegebenen, in den Bekenntnissen der Reformation
bezeugten Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Dieses Evangelium ist für die Arbeit und
Gemeinschaft der Kirche unantastbare Grundlage.«
47 Er lautet: »Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der kirchlichen Gesetzgebung.«. Das bedeutet,
dass in keinem Gesetz, auch nicht in einem Kirchenverfassungsgesetz, das Bekenntnis rechtlich
festgelegt ist und festgelegt werden darf sowie, dass die kirchlichen Gesetze sich nicht in Widerspruch
zu dem Bekenntnis setzen können und dürfen. Dies gilt auch von den kirchlichen Büchern.
48 Siehe Anm. 9.
49 Klaus Douglass, Die neue Reformation. 96 Thesen zur Zukunft der Kirche. Stuttgart 2001, 282-284.
50 A.a.O., 261-263 (Hervorhebung im Original).
51 Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften.
52 Hans-Richard Reuter, Kirche und Gemeinde. In: DERS., Botschaft und Ordnung. Beiträge zur
Kirchentheorie. Leipzig 2009, 92-98, hier 93.
53 A.a.O., 93-94 (Hervorhebung im Original).
54 Armin Nassehi, Die Organisation des Unorganisierbaren. In: Isolde Karle (Hrsg.), Kirchenreform.
Interdisziplinäre Perspektiven. Leipzig 2009, 199-218, hier 218. Nassehi ist Professor für Soziologie
an der Ludwig Maximilians Universität München. »Soziologisch« meint hier: Im Zusammenhang der
Voraussetzungen, Abläufe und Folgen des Zusammenlebens von Menschen.
55 Wolfgang Huber. In: Wolfgang Bittner, Kirche das sind wir! Von der Betreuungs- zur
Beteiligungskirche. Neukirchen-Vluyn 2003, 7.
56 Wolfgang Bittner, Kirche wo bist Du? Plädoyer für das Kirche-Sein der Kirche. Zürich 1993, 89.
57 Manfred Lütz: Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Eine heitere
Seelenkunde. Gütersloh 2009, 64. Ein Buch, das ich hier jedem/jeder empfehlen kann, auch dem/der
der/die keine »Macke« hat. Hinterher wird er oder sie bestimmt über eine verfügen wahrscheinlich
Genießen, Genossen, genießen!
19
Genießen, Genossen, genießen!
Wenn Kirchenverfassung auf Wirklichkeit trifft
© Michael Josupeit 2011
über die eines gesteigerten und lebens-fördernden Humors … Und den brauchen wir in unserer Kirche
auch dringend!
58 A.a.O., 39.
59 Beraten & beschlossen, Frühjahrssynode 2011, 5.
60 Wikipedia.de.
61 Phil 1,27 lautet: »Das Wichtigste ist: Lebt als Gemeinde so, dass ihr der Guten Nachricht von
Christus Ehre macht, ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne von
euch höre. Steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung! Kämpft einmütig für den Glauben, der in
der Guten Nachricht gründet.«
62 Barmer theologische Erklärung von 1934, aus der ersten These. Vgl. Die Barmer Theologische
Erklärung. Einführung und Dokumentation. Herausgegeben von Alfred Burgsmüller und Rudolf Weth.
Neukirchen ²1984.
63 Wolfgang Bittner, Kirche das sind wir! (Vgl. Anm. 42), 111-116.