Worum geht es, wenn es um nichts geht
Transcript of Worum geht es, wenn es um nichts geht
WORUM GEHT ES, WENN ES UM NICHTS GEHT?
Zum Stellenwert von Niedrigkostensituationen in derRational Choice-Modellierung normkonformen Handelns*
Markus Quandt und Dieter Ohr
Zusammenfassung: Das Handeln in so genannten Niedrigkostensituationen scheint mit Theorienrationalen Verhaltens schwer erklärbar. Manche sehen darin einen entscheidenden Schwachpunktdes Paradigmas rationaler Wahl. Wir zeigen dagegen, dass die Logik der Niedrigkostensituationengerade mit Theorien rationalen Verhaltens überhaupt erst verstanden werden kann. Dabei sind In-formations- und Entscheidungskosten auf der Seite des Akteurs sowie die Erkennbarkeit und Klar-heit der Anreize auf der Seite der Situationsmerkmale die ausschlaggebenden Größen. Die Rolledieser Variablen wird speziell bei der Erstellung von Kollektivgütern diskutiert, da die Kollektiv-gutproblematik in enger Verbindung mit dem Niedrigkostenkonzept steht. In Anlehnung an eineingeführtes Modell routinebasierten Entscheidens wird schließlich gezeigt, wie die Schwelle zurNiedrigkostensituation analytisch bestimmt werden kann.
I. Einleitung
An dem Konzept der Niedrigkostensituation entzündet sich immer wieder eine weitrei-chende Kritik Rational Choice-basierter Handlungstheorien. Als Niedrigkostensituatio-nen werden dabei im Allgemeinen solche Situationen beschrieben, in denen es für dieHandelnden offenbar um wenig geht, in denen sie aber ebenso offenbar gegen ein-fachste Rationalitätskriterien zu verstoßen scheinen. Die Befolgung von Normen auchdann, wenn keinerlei Sanktionen drohen, affektgeleitetes Handeln oder das ,Abfahren‘von Routinen, wo schon kurzes Nachdenken eine bessere Lösung bringen würde undähnliche Verhaltensmuster mehr scheinen dabei jeweils Falsifikationen für Theorien desrationalen Handelns zu bedeuten. Niedrigkostensituationen sollten also geradezu eineAchillesferse der Rational Choice-Modellierung (im Weiteren RC) darstellen.
Statt auf die Kritik im Einzelnen einzugehen, wollen wir in diesem Beitrag einenVorschlag zur theoretischen Integration von Niedrigkostensituationen in einen allgemei-nen RC-Rahmen vorstellen. Der modellhafte Akteur in diesem allgemeinen Rahmen ist„resourceful, restricted, expecting, evaluating, maximising“ (vgl. etwa Lindenberg 1990;Meckling 1976) und durchaus nicht notwendig auf egoistische Präferenzen festgelegt.Wir suchen zu zeigen, dass Entscheidungen in Niedrigkostensituationen prinzipiell aus-
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 56, Heft 4, 2004, S. 683–707.
* Wir danken Annette Schnabel, Hermann Dülmer, Markus Klein, Jörg Rössel und den anony-men Gutachtern der Kölner Zeitschrift für hilfreiche Hinweise zu früheren Fassungen des Ma-nuskriptes.
gesprochen gut mit RC-Modellen analysiert werden können und schlagen darüber hi-naus eine Anwendungsperspektive speziell für das breite Feld der Kollektivgutproblemevor.
Im Weiteren werden wir zunächst die allgemeine Verwendung des Niedrigkosten-konzeptes diskutieren. Es ist dabei zum Einen herauszuarbeiten, welche Rolle demKonzept in RC-Theorien üblicherweise zugewiesen wird (II.). Zum Anderen sind dieoft nur unscharf definierten Kostenbegriffe zu klären, um zu einer analytisch wie all-tagsweltlich nachvollziehbaren Definition der Niedrigkostensituation zu kommen (III.).Sodann ist ein substanzielles Anwendungsfeld zu schildern, nämlich die Erklärungnormgesteuerten kooperativen Verhaltens in Kollektivgutsituationen (IV.). Wir argu-mentieren, dass dem Niedrigkostenkonzept dabei eine zentrale und bisher unterschätzteRolle zukommt. Schließlich wollen wir anhand eines Entscheidungsmodells über dieArt des Entscheidens zeigen, dass sich gerade mit RC-Argumenten gut erklären lässt,wann Akteure scheinbar irrationale Entscheidungskriterien anwenden (V.). Ein wichti-ges Resultat ist, dass das für Niedrigkostensituationen typische Entscheidungsverhaltenauf relativ komplexe Weise von der Höhe verschiedener Kostengrößen abhängt. Nied-rigkostensituationen werden dabei als Spezialfall des allgemeineren Modells erkennbar.
II. Die herrschende Meinung: Niedrigkostensituationenentziehen sich der RC-Modellierung
Gemessen an der Bedeutung, die dem Konzept der Niedrigkostensituation gelegentlichzugeschrieben wird, erscheint die einschlägige Literatur recht schmal. Einige grundle-gendere Beiträge stammen aus der Ökonomie bzw. der Finanzwissenschaft; diese wer-den in der Soziologie aber nur punktuell aufgenommen. Systematische Anschlüsse wer-den eher auf der methodologischen Ebene gesucht (Mensch 1999, 2000; Zintl 1989).Erst in neuerer Zeit wird das Konzept im Hintergrund von Arbeiten zur Handlungs-theorie bedeutsam, ohne jedoch in der Tiefe ausgeführt zu werden (Schräpler 2001).In empirischen Anwendungen taucht der Begriff noch seltener auf, Ausnahmen sindz.B. einige Untersuchungen zum Umweltverhalten (Diekmann 1996; Diekmann undPreisendörfer 1998a, 1998b, 2001).1
Niedrigkostenargumente werden vor allem dann ins Spiel gebracht, wenn es umVerhaltensweisen geht, die den individuellen Interessen der Handelnden zuwider zulaufen scheinen, die also individuell irrational wären. Dabei sind vor allem jene Fällesoziologisch interessant, in denen die Handelnden offenbar ,moralischen‘ Kriterien fol-gen und sich an sozialen Normen orientieren. So sind zum Beispiel das recyclingge-rechte Trennen von Hausmüll, die Teilnahme an Demonstrationen und die Beteiligungan politischen Wahlen Handlungen, die ohne Zweifel normative Einflüsse offenbaren,während nur mühsam zu begründen wäre, dass den Handelnden daraus individuell-egoistischer Nutzen entstehen sollte. Dass solches Verhalten dennoch häufig zu beob-achten ist, bringt RC-Theoretiker in Erklärungsnöte, jedenfalls dann, wenn es ohne
684 Markus Quandt und Dieter Ohr
1 Arbeiten zum Handeln in Alltagssituationen haben oft Berührungspunkte mit der Niedrigkos-tenproblematik, gehen aber entweder nur am Rande auf diese ein oder grenzen die Anwen-dungsgebiete sogar ausdrücklich ab, vgl. z.B. Friedrichs und Opp (2002).
Zweifel freiwillig erfolgt, das heißt, wenn keine zusätzlichen Anreize wie Sanktionenzur Durchsetzung der Norm zum Tragen kommen.
Diese offensichtliche Verletzung eines egoistischen Nutzenmaximierungskalkülswird RC-Theoretikern nun wohl zum Hauptmotiv, sich mit Niedrigkostensituationenzu befassen. Denn wenn man zeigen kann, dass solche Verletzungen der Rationalitäts-annahme nur in Niedrigkostensituationen vorkommen, kann man die Falsifikation die-ser zentralen Prämisse in zweierlei Hinsicht abschwächen. Erstens wäre sie auf eine be-grenzte Klasse von Bedingungskonstellationen beschränkt, die Anwendbarkeit der RC-Theorie auf die übrigen Situationstypen dagegen nicht in Frage gestellt. Zweitensschienen so die Niedrigkostensituationen gewissermaßen zweitrangig, denn es sollendamit ja gerade Lagen abgegrenzt werden, in denen es für den Handelnden um weniggeht. Eine für den Akteur unbedeutende Rationalitätsverletzung wiegt aber auch fürdie Annahme rationaler Akteure insgesamt weniger schwer.
Der zweite Aspekt wird gewöhnlich zur Definition von Niedrigkostensituationenherangezogen. So kennzeichnet Kliemt Niedrigkostensituationen folgendermaßen:„These situations typically arise if either or both of two conditions should prevail:First, the decision and action of an individual decision maker has only a negligibleeffect on expected outcomes of the action. ... Second, the individual decision makerhas no direct interest in the outcome because she or he will hardly be influenced bythe outcome“ (1986: 333). Beide Bedingungen bedeuten für egoistisch-rationale Ak-teure dasselbe: Die Resultate der eigenen Handlungswahl wirken sich in der eigenenNutzenbilanz nur geringfügig oder überhaupt nicht aus. In beiden Fällen ist es für denAkteur unschädlich, sich moralisch – oder auch vollkommen willkürlich! – zu verhal-ten. In dieser Perspektive könnte etwa die Teilnahme an politischen Wahlen als ,expres-siver‘ Akt verstanden werden, der – wie das Anfeuern einer Mannschaft beim Fußball– vor allem wegen des an sich schon befriedigenden Handlungserlebnisses ausgeführtwird, weniger wegen erhoffter Handlungsfolgen wie einem ohnehin nicht zu erwarten-den Einfluss auf das Wahlergebnis (vgl. Brennan und Lomasky 1993). Die Befriedi-gung kann dabei auch aus der Übereinstimmung der Handlung mit moralischen Über-zeugungen entstehen, wie Kliemt (1986) und im Anschluss besonders Kirchgässner(1992, 1996) argumentieren.
In der Umkehrung wird diese Überlegung für soziales Handeln höchst bedeutsam:Denn es ist nach Auffassung mancher Autoren eine „wesentliche Bedingung für dieStabilität moralischen Verhaltens ..., daß es nur in Klein-Kosten-Situationen gefordertwird“ (Kirchgässner 1996: 243; ähnlich Diekmann 1996). Brächte moralisches Han-deln dagegen merkliche individuelle Kosten mit sich, würden die Akteure schnell in ei-gennütziges Verhalten verfallen und damit wieder der ökonomischen Standardtheorieentsprechen.
Hier drängt sich freilich eine Frage an das Niedrigkostenkonzept auf, die zwar be-reits früher deutlich formuliert wurde (Green und Shapiro 1994), die aber selbst vonMensch (1999, 2000) in der bisher einzigen breiter angelegten Auseinandersetzung mitdem Thema recht stiefmütterlich behandelt wurde: Wann eigentlich sind Kosten ,nied-rig‘ zu nennen und wann ,hoch‘? Anders gefragt: Lassen sich Kriterien finden, nachdenen Situationen ex ante als Niedrig- oder Hochkostensituationen eingestuft werdenkönnen, oder ist dies – tautologieverdächtig – erst ex post am mehr oder weniger mora-
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 685
lischen Verhalten der Akteure abzulesen? Von der Antwort auf diese Frage hängt unteranderem ab, ob man mit Mensch und anderen behaupten kann, die RC-Theorie funk-tioniere nur in den eher seltenen Situationen befriedigend, in denen die Kosten ,hoch‘sind – dort genügten dann freilich auch weit einfachere Entscheidungsregeln – oder obumgekehrt die Linie der RC-Theoretiker gilt, dass die RC-Theorie nur in jenen eherseltenen Situationen nicht funktioniere, in denen die Kosten ,niedrig‘ sind.
Unter dem Blickwinkel einer Konkurrenz theoretischer Ansätze dient das Konzeptder Niedrigkosten also häufig dazu, den Anwendungsbereich des ökonomischen Stan-dardmodells individuellen Verhaltens einzugrenzen. Dies leistet es bisher jedoch nicht,wie Green und Shapiro bemängeln: „there is nothing in rational choice theory thatspecifies the level at which costs or benefits are sufficiently small to render the theoryinapplicable“ (1994: 58). Solange dies gilt, ist die Grenze des Anwendungsbereichs derRC-Theorie als höchst willkürlich zu bezeichnen, ganz gleich, ob sie von ihren Kriti-kern oder Befürwortern gezogen wird.
Vor diesem Hintergrund ist die von einigen Autoren erhobene Forderung zwin-gend, dass Niedrigkostensituationen selbst Gegenstand der theoretischen Modellierungwerden müssen (Aldrich 1993; Kirchgässner 1992; Kliemt 1986). Um dem Vorwurfder Immunisierung zu begegnen, müssten zumindest die Grenzen der RC-Theorie exante bestimmbar sein. Besser noch wäre es jedoch, die RC-Logik doch erfolgreich aufNiedrigkostensituationen anzuwenden. Das in Abschnitt V skizzierte Modell kann un-seres Erachtens zu beidem einen Beitrag leisten, indem es zeigt, wann sich rationaleAkteure rationalerweise ,irrational‘ verhalten können. Kommen wir jedoch zunächst zuder Frage, was eigentlich eine Niedrigkostensituation ausmacht.
III. Eine erweiterte Definition der Niedrigkostensituation
Eine Niedrigkostensituation ist nach Kliemt (1986: 333) dann gegeben, wenn die Ent-scheidung und das nachfolgende Handeln eines Akteurs sich kaum oder gar nicht aufdas Ergebnis auswirken, wenn also, mit anderen Worten, kaum Kosten anfallen. Wasaber sind die relevanten Kosten? Wir wollen uns hier zunächst diesem ,qualitativen‘Aspekt zuwenden, bevor wir uns später (Abschnitt V.2) mit der analytischen Bestim-mung der Schwelle zu ,niedrigen‘ Kosten befassen.
Kosten sind, ganz allgemein, negative Folgen einer bestimmten Entscheidung. Da-bei können analytisch drei Aspekte unterschieden werden. Kosten bestehen zuerst indem unmittelbaren Aufwand, der zur Verwirklichung eines bestimmten Handlungszielsnötig ist, den direkten Kosten, wie etwa dem materiellen, zeitlichen, physischen oderkognitiven Aufwand der Handlungen, die zur Umsetzung einer Entscheidung notwen-dig sind oder aus dieser folgen. Zweitens entstehen Kosten dadurch, dass jede Ent-scheidung – wie immer sie ausfallen mag – bedeutet, auf andere Handlungsoptionen,und damit auf deren Nutzen, zu verzichten. Opportunitätskosten werden daher in dermikroökonomischen Theorie dem Wert der am höchsten bewerteten Alternative gleich-gesetzt, auf die man wegen der Handlung oder Entscheidung verzichten muss: „Op-portunity cost ... is a measure of what has been given up when we make a decision“(Samuelson und Nordhaus 1989: 527). Unterstellt wird dabei, dass die jeweils optima-
686 Markus Quandt und Dieter Ohr
le Handlungsalternative gewählt wird. Opportunitätskosten entstehen also immer, auchbei optimaler Entscheidung. Drittens mag man die Kostenträchtigkeit einer Entschei-dung mit dem potenziellen Nutzenverlust assoziieren, falls man nicht die optimaleHandlungsalternative wählte. Die Differenz zwischen dem Nettonutzen der jeweils bes-ten und der zweitbesten Handlungsalternative gibt diesen zusätzlichen Nutzenverlustbei einer nicht-optimalen Entscheidung für die zweitbeste Alternative an. Wir wollendies als Nutzendifferenzial bezeichnen. Kirsten Mensch hat unlängst in dieser Zeit-schrift einem solchen, ausschließlich relativen Kostenbegriff das Wort geredet: „Unter,Kosten‘ dürfen nicht die absoluten Kosten verstanden werden, die aus den verschiede-nen Handlungsalternativen resultieren können, sondern die relativen Kosten, die ent-stehen, wenn ich mich für eine falsche, suboptimale Alternative entscheide: Es gehtalso um die Opportunitätskosten, die mit der Wahl einer Handlung verbunden sind“(Mensch 2000: 248).
An dieser Definition irritiert zweierlei. Zunächst wird dabei die traditionelle Be-griffsbestimmung von Opportunitätskosten in der ökonomischen Theorie ignoriert, in-dem Mensch Opportunitätskosten mit dem Nutzendifferenzial begrifflich gleichsetzt.Des Weiteren, dies ist der wichtigere Punkt, geraten mit dieser Setzung die beiden ers-ten von uns genannten Kostenaspekte der direkten und der konventionell definiertenOpportunitätskosten völlig aus dem Blick. Es scheint uns jedoch nicht ausgemacht,dass unter Kosten nur die relativen, nicht aber die absoluten Kosten gefasst werden,dürfen‘. Ob und auf welche Weise eine Kostenart in eine Entscheidung und die ihrvorausgehende Entscheidungsprozedur eingeht, bedarf der theoretischen Erörterung.
Der Fokus unserer Definition richtet sich dementsprechend darauf, welche Kosten-komponenten bei einer Abschätzung des Kostenniveaus relevant sein werden. Insgesamtsoll die Definition die Intuition abbilden, dass in Niedrigkostensituationen nur Ent-scheidungen zu treffen sind, bei denen es aus Sicht des Akteurs ,um nichts geht‘. Ge-nauer gefasst, liegt nach unserem Verständnis eine vollkommene Niedrigkostensituationdann vor, wenn die direkten Kosten und die Opportunitätskosten niedrig sind undwenn zudem das Nutzendifferenzial unbedeutend ist. Es liegt dann, mit anderen Wor-ten, eine Situation vor, in der man wenig verlieren, aber auch wenig gewinnen kann.Abbildung 1 soll das Konzept veranschaulichen, indem unterschiedliche Kostenkonstel-lationen einander gegenübergestellt werden.
Die beiden Situationen I und II in Abbildung 1 haben darin eine Gemeinsamkeit,dass bei Wahl der jeweils besten Alternative 1 auf den Nettonutzen verzichtet werdenmuss, der mit der jeweiligen Alternative 2 verbunden ist. In beiden Fällen liegen in derHöhe dieses Nettonutzens also gleiche Opportunitätskosten vor, die relativ niedrig sind.Von Nettonutzen ist deswegen die Rede, weil in den in Abbildung 1 dargestellten Nut-zenbeträgen die direkten Kosten des jeweiligen Handlungspfades bereits verrechnetsind. Wir wollen auch annehmen, dass es sich bereits um SEU-Werte (Subjective Ex-pected Utility) handelt, der Akteur die einzelnen Handlungsfolgen jeder Alternativealso schon mit den zugehörigen, von ihm geschätzten Wahrscheinlichkeiten gewichtethat. Unterschiedlich sind die Situationen I und II insoweit, als im ersten Fall Alterna-tive 1 deutlich besser und deshalb das Nutzendifferenzial groß ist. Eine falsche Ent-scheidung wäre hier mit einem relativ großen – zusätzlichen – Verlust verbunden, ganz
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 687
im Gegensatz zu Situation II. Hier entstünde nur ein unwesentlicher zusätzlicher Ver-lust, entschiede man sich für die kaum schlechtere zweite Alternative.
Die beiden Entscheidungssituationen III und IV würden bei der alleinigen Fokus-sierung auf das Nutzendifferenzial in gleicher Weise als Niedrigkostensituationen gel-ten, da das in beiden Situationen gleich große Differenzial fast verschwindet. Gemessenan den anfallenden Opportunitätskosten sind die beiden Situationen aber offensichtlichsehr unterschiedlich. Während Konstellation III mit hohen Opportunitätskosten ver-bunden ist, ist bei IV nicht nur das Nutzendifferenzial, sondern auch die absoluteHöhe der Opportunitätskosten gering. Lägen bei IV auch noch niedrige direkte Kostenvor, so handelte es sich nach unserem Verständnis um eine in allen Belangen idealtypi-sche Niedrigkostensituation. Gilt dies aber auch für Konstellation III? Ist dies tatsäch-lich eine Niedrigkostensituation – in dem Sinne, dass es in der subjektiven Sicht desAkteurs ,um nichts geht‘?
688 Markus Quandt und Dieter Ohr
Abbildung 1: Unterschiedliche Kostenkonstellationen
a. Unterschiedliches Nutzendifferenzial, gleiche Opportunitätskosten
b. Gleiches Nutzendifferenzial, unterschiedliche Opportunitätskosten
1 2 1 2
Nettonutzen (Nutzen – Direkte Kosten)
I
II
1 2 1 2
Nettonutzen (Nutzen – Direkte Kosten)
III
IV
Ein auch von Mensch angeführtes Beispiel zur Illustrierung ebendieser Konstella-tion wäre die Entscheidung eines jungen Mannes, in den Krieg zu ziehen oder abersich der Einberufung zu entziehen. Die direkten Kosten wie die Opportunitätskostenbeider Handlungen könnten aus der Perspektive des Handelnden kaum höher sein,denn bei der ersten steht das Leben auf dem Spiel, bei der zweiten zumindest die so-ziale Existenz. Verhalten sich nun beide Handlungsalternativen so zueinander wie beiKonstellation III dargestellt – ist also eine der beiden Alternativen leicht besser als dieandere –, dann wäre in einer idealen Welt mit perfekter Information und ohne Infor-mationskosten die Entscheidung zugunsten der besseren Alternative einfach. Nicht ein-mal eine falsche Entscheidung müsste größeres Kopfzerbrechen hervorrufen, denn auchdie Wahl der leicht unterlegenen Alternative wäre nur mit marginal höheren Opportu-nitätskosten verbunden. Insoweit läge, gemessen allein am Kriterium des Nutzendiffe-renzials, in der Tat eine Niedrigkostensituation vor. Würde der Rekrut beiden Hand-lungsalternativen sogar vollkommen identische SEU-Werte zuweisen, wäre das Nutzen-differenzial Null und der nutzenmaximale Handlungspfad nicht identifizierbar. Ob-wohl also in dem Beispiel mit dem eigenen Leben und der sozialen Existenz alles aufdem Spiel stünde, ginge es im Kontext rationalen Entscheidens doch um nichts, denndie Entscheidung des jungen Mannes würde sein erwartbares Nutzenniveau nicht be-einflussen. Die Situation des wehrfähigen Mannes vor dem Krieg und des wahlberech-tigten Bürgers vor der Parlamentswahl, dessen Stimme den Wahlausgang ebenfallsnicht wahrnehmbar beeinflusst, haben darin also eine überraschende Gemeinsamkeit.
Es wäre dennoch mehr als kontraintuitiv, Konstellation III in Abbildung 1 mitMensch (2000: 258) einfach deshalb als Niedrigkostensituation zu klassifizieren, weildie geschätzte Nutzendifferenz zwischen den Alternativen minimal ist. Auch dürfte dieFolgerung problematisch sein, dass die Art des Entscheidungsvorgangs des jungen Rekru-ten so sei, als ob es um nichts gehe (Mensch 2000: 258). Es ist zu bedenken, dass dieEntscheidung in der realen Welt unter Unsicherheit und mit Informationskosten erfol-gen muss. Vor diesem Hintergrund verschärft sich das Entscheidungsproblem insofern,als jede Schätzung, die der junge Mann für den SEU-Wert der Kriegsteilnahme macht,von extremer Unsicherheit gekennzeichnet sein wird. Die geschätzten SEU-Werte dereinzelnen Handlungsalternativen könnten weit ab von ihren wahren Werten liegen.Damit lässt sich aber auch das Nutzendifferenzial kaum mehr abschätzen. Einen Hand-lungspfad zu identifizieren, der eindeutig besser ist, wird so fast unmöglich. Diese fun-damentale Entscheidungsunsicherheit wäre nun ohne größeren Belang, handelte es sichum eine triviale Alltagsentscheidung – doch hier trifft das Gegenteil zu. Während beiperfekter Information die absolute Höhe der Kosten den Entscheidungsvorgang unddie Alternativenwahl nicht beeinflusst, wird dies in einer realistischen Situation anderssein. Einigermaßen sicher ist dann in der subjektiven Sicht des Akteurs nur mehr, dasser sich auf einem hohem Kostenniveau befindet, dass er also potenziell viel verlierenkönnte.2
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 689
2 Experimente belegen, dass in Situationen mit Unsicherheit – also bei unbekannten Eintritts-wahrscheinlichkeiten für bestimmte Handlungsfolgen – die Erwartungsnutzen der Handlungs-alternativen die Handlungswahl kaum mehr vorhersagen können. Bei Entscheidungen unterRisiko – wobei die Handlungsfolgen eine bekannte Eintrittswahrscheinlichkeit haben, diese je-doch kleiner als 1 ist – sind SEU-Modelle dagegen prognosefähiger. Vgl. die Übersicht bei Sto-cké (2002: 18, 38).
Insofern könnte man, allgemein, erwarten, dass hohe direkte Kosten und/oder hoheOpportunitätskosten als Signal für potenziell hohe Unterschiede zwischen den SEU-Werten verschiedener Handlungspfade interpretiert werden, und zwar vermutlich unab-hängig von der tatsächlichen Höhe solcher Nutzendifferenziale. Dieser Signalcharakterhoher (Opportunitäts-)Kosten dürfte also auch dann zum Tragen kommen, wenn sichHandlungsalternativen kaum unterscheiden und das Nutzendifferenzial klein ausfällt.In jedem Fall implizieren hohe absolute Kosten stets eine gravierende Veränderung ge-genüber dem Status Quo und dürften allein aus diesem Grund eine erhöhte Aufmerk-samkeit auslösen.
Ob es sich nun um eine Niedrigkostensituation im strengen Sinn handelt, wie beiSituation IV, oder um eine Situation, in der bei hohen Kosten die Alternativen kaumunterscheidbar sind (III), es kann in beiden Fällen der Wert einer RC-Modellierungnicht darin bestehen, eine exakte Handlungsprognose abzuleiten. Die von Mensch mo-nierte Schwierigkeit exakter Prognosen (Mensch 2000: 258) stellt also keine Schwächedes RC-Modells dar, sondern liegt offenbar in der Situationslogik begründet. Vielmehrbesteht eine spezifische Stärke bereits des einfachen RC-Modells gerade darin, diese Si-tuationslogik offen zu legen und die Folgen gleichwertiger Handlungsalternativen sowieder Unsicherheit des Akteurs abzubilden: Wenn sich Alternativen kaum unterscheidenund diese geringen Unterschiede zudem noch in einen Nebel der Unsicherheit einge-hüllt sind, dann ist eine sichere Entscheidung zwischen den Handlungsalternativenkaum möglich – und zwar weder für den Akteur noch für den Forscher.
IV. Eine Anwendungsperspektive der Niedrigkosten-Logik
1. Kollektivgutsituationen als das ,klassische‘ Anwendungsfeld
Den oben angeführten Beispielen für ,irrationales‘ norm-orientiertes Verhalten ist ge-meinsam, dass es aus RC-Perspektive um die Erstellung von Kollektivgütern geht. AnWahlen nimmt man erstens teil, um politische Interessen durchzusetzen, die fast im-mer Großgruppen betreffen, z.B. das Interesse von Arbeitern an einer bestimmten Um-verteilungspolitik oder von Landwirten an einer bestimmten Subventionspolitik; undzweitens, um einer allgemeinen Partizipationsnorm zu genügen, durch die für alle Bür-ger des Landes das Gut der ,funktionierenden Demokratie‘ geschützt wird. Wähler er-stellen also für andere Wähler und auch für Nicht-Wähler Kollektivgüter. Massende-monstrationen sollen die Ziele des Kollektivs der Demonstrationsteilnehmer und meis-tens sehr vieler weiterer Personen fördern. Mülltrennung soll Recycling erleichtern undso zum Nutzen aller die Umwelt entlasten. In ökonomischen Begriffen haben Kollek-tivgüter also positive ,externe Effekte‘: Wer ein Kollektivgut bereitstellt, dessen Hand-lungen betreffen nicht nur sie oder ihn selbst, sondern auch andere.
Die Regulierung von externen Effekten, bei denen es auch um negative Auswirkun-gen auf andere gehen kann, in deren Vermeidung dann das Kollektivgut besteht, wirdin der Ökonomie oft als Frage der ,Moral‘ gesehen (so Kirchgässners [1992] Begriff;die Soziologie hat dafür bekanntlich diverse Wert- und Normkonzepte entwickelt). FürRC-Theorien unproblematisch ist die Lage, wenn Normen eindeutig als sanktionsbe-
690 Markus Quandt und Dieter Ohr
kräftigte Verhaltenserwartungen angesehen werden können, das Verhalten also durchvon außen gesetzte Anreize beeinflusst wird (Coleman 1990b: 92; Weede 1992: 23).Durch positive oder negative Sanktionen werden die Randbedingungen für die Akteureverändert, und so kann etwa bei Gewerkschaftsmitgliedern das Handeln in Überein-stimmung mit Teilnahmenormen bei Streiks allein als egoistisch-rationale Reaktion aufdie Belohnung durch soziale Anerkennung oder die Gefahr von Ächtung bei Nicht-Teilnahme erklärt werden. Diese von Mancur Olson (1965) so genannten selektivenAnreize lassen sich allerdings bei den oben angeführten Beispielen nur schwer ins Spielbringen, denn wer Abfälle unsortiert entsorgt, nicht zur Wahl geht, einer Demonstra-tion fern bleibt, die oder der ist dafür kaum zur Rechenschaft zu ziehen; ebenso wenigkönnen fleißige Recycler, Wähler und Demonstranten auf eine externe (zu internali-sierten Normen unten mehr) Belohnung hoffen. Zusätzlich gilt, dass in diesen Situa-tionen der eigene Beitrag zum Kollektivgut im Gesamtergebnis kaum spürbar ist – wieviel trägt eine einzelne Stimme schon zum Wahlsieg der eigenen Partei bei –, währenddie individuellen Kosten immerhin wahrnehmbar sind. Unter solchen Bedingungendiktiert Olsons „Logik des kollektiven Handelns“, dass man selbst besser keinen Bei-trag leistet (Olson 1965). Wer nicht selbst ins Kollektivgut investiert, hat bei hinrei-chend großen Gruppen eine Chance, in den Genuss eines free ride zu kommen, da derWegfall des eigenen Beitrags die Erfolgsaussichten der Gruppe ja kaum schmälert. Werdagegen beiträgt, muss befürchten, selbst derjenige zu sein, der den anderen Mitglie-dern des Kollektivs die Freifahrt spendiert. Das bekannte Ergebnis aus diesen strategi-schen Überlegungen ist die spieltheoretische Gefangenen-Dilemma-Struktur des Kol-lektivgutproblems: Im Regelfall dürften rationale Akteure den Müll bequemerweisenicht trennen, sie sollten das Demonstrieren anderen überlassen und sich die Mühedes Wählens sparen, sei sie auch noch so gering.
Es gibt zwei Bedingungen, unter denen rationale Akteure dennoch zu Kollektivgü-tern beitragen können: erstens, wenn ein Akteur (oder eine kleine Gruppe) stark genugam Kollektivgut interessiert ist und zugleich genügend Ressourcen hat, um es alleine,das heißt ,auf eigene Rechnung‘ zu erstellen.3 Dieser Fall ist bei den hier genanntenKollektivgütern so gut wie ausgeschlossen, da deren Produktion die Beteiligung vielerzwingend erfordert. Zweitens könnten auch rationale Akteure natürlich beitragen, fallsihnen durch den eigenen Beitrag gar keine subjektiv relevanten Kosten entstehen. Manerinnere sich nun, dass prototypische Kollektivgüter auch dadurch gekennzeichnetsind, dass der eigene Beitrag nur einen geringen Effekt darauf hat, ob man selbst inden Genuss des Kollektivguts kommt. Zusammen genommen entspricht dies genauden von Kliemt (1986) genannten Bedingungen für das Vorliegen von Niedrigkostensi-tuationen, nach denen allein externe Effekte des Handelns erwartet werden.
Damit wird deutlich, welche substanzielle Bedeutung ein Modell der Niedrigkos-tensituationen haben kann: Wenn man ableiten kann, wann bestimmte Handlungskostenunter die individuelle Relevanzgrenze fallen, so erfährt man gleichzeitig, wann es Groß-
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 691
3 Dass Kollektivgut-Erstellung unter komplexeren, aber durchaus realistischen Bedingungenauch in größeren Gruppen rationaler Egoisten möglich ist, haben Oliver und Marwell (zusam-menfassend: Oliver und Marwell 2001) gezeigt. Unser Argument ist vom Oliver/Marwell-An-satz unabhängig, aber damit leicht vereinbar.
gruppen gelingen kann, durch relativ geringfügige Anreizveränderungen auch rationaleAkteure in großer Zahl zu Beiträgen zu Kollektivgütern zu bewegen.
2. Varianten der Überwindung des Kollektivgutproblemsunter Niedrigkosten-Bedingungen
Solche Veränderungen von Anreizen können im Prinzip auf zwei Wegen erfolgen, die,wenn nicht empirisch, so doch analytisch unterschieden werden können: erstens durchdas Setzen spezieller selektiver Anreize durch internalisierte normative Vorstellungen undzweitens durch die Veränderung des Informationsangebotes, das die Gruppenmitgliederihrer Beitragsentscheidung zu Grunde legen. Wir wollen an dieser Stelle die schwierigeFrage, wie es Kollektiven gelingt, ein Angebot an geeigneten Normen und/oder Infor-mationen zu erstellen, ausblenden und vereinfachend annehmen, das Kollektiv verfügebereits über korporative Akteure, die solche Aufgaben übernehmen (Coleman 1990a:325ff.). Damit kann sich die Analyse auf die natürlichen Akteure beschränken, die die-sem Norm- und Informationsangebot ausgesetzt sind.
Der vordergründig sehr plausible theoretische Weg über internalisierte Normen hatunserer Auffassung nach einige Schwächen, die durch eine stärkere Gewichtung deszweiten Weges zu beheben sind. Internalisierung von Normen soll hier bedeuten, dassdie Präferenzen der Akteure sich gegenüber einer gedachten normlosen Situation unter-scheiden: Kollektivdienliche Ziele werden in die Nutzenfunktion der Individuen über-nommen, die Zielfunktion des Individuums wird also um Ziele des Kollektivs erweitert(Coleman 1990a: 295; Horne 2003). Der Sanktionsmechanismus selektiver Anreizewird dabei in das Individuum verlagert, indem als Belohnung für Konformität das guteGefühl eintritt, das ,Richtige‘ getan zu haben und als Strafe für deviantes Verhalten dasschlechte Gewissen erwacht. Selbst wenn man hervorheben wollte, dass demnach dieUmsetzung solcher ,moralischen‘ Ziele immer noch eine interne, persönliche Befriedi-gung bringt, also gewissermaßen auch egoistisch ist, kann anhand der Handlungswahlenzwischen einer egoistischen und einer kollektivistischen Quelle der Motive nicht mehrunterschieden werden. Damit wird zunächst allein auf den evaluativen Aspekt vonNormen abgehoben – man könnte auch von Wertorientierungen sprechen, würde soaber nur den einen schillernden Begriff durch einen anderen ersetzen (Jagodzinski1985). Im Gegensatz zu externen selektiven Anreizen durch soziale Kontrolle, Rechts-normen oder materielle Belohnungen können internalisierte Anreize auch in unserenprototypischen Kollektivgutsituationen funktionieren. Die externe soziale Kontrolle vonNormverstößen ist etwa in der Anonymität politischer Wahlen kaum möglich; genaudieses Problem ist mit der Internalisierung der Kontrolle lösbar, da weder für die Ent-deckung von Normverstößen gesorgt werden muss, noch andere Kollektivmitglieder zumotivieren sind, die Kosten des Strafens und Belohnens auf sich zu nehmen (Coleman1990a: 293ff.).
Die Implikationen dieser ersten Variante der Anreizbeeinflussung sollen exempla-risch anhand der Verwendung des Begriffs der Niedrigkosten bei Diekmann und Prei-sendörfer (1998a, 2001) verdeutlicht werden. Bei den dort diskutierten Umwelteinstel-lungen handelt es sich um die innere Überzeugung eines Akteurs, dass sie oder er aktiv
692 Markus Quandt und Dieter Ohr
zur Erhaltung des Kollektivguts ,intakte Umwelt‘ beitragen solle, also in unserem Sin-ne um internalisierte Normen.4 Für Diekmann und Preisendörfer ist der „Grundge-danke der Low-Cost-Hypothese des Umweltverhaltens ..., dass Umwelteinstellungendas Umweltverhalten am ehesten und bevorzugt in Situationen beeinflussen, die mitgeringen Kosten bzw. Verhaltensanforderungen verknüpft sind“ (2001: 117). Unnöti-ges Heizen der Wohnung wird nur vermieden, wenn damit auch finanzielle Einbußenvermieden werden; Fahrten mit dem PKW werden kaum durch Nutzung des öffentli-chen Nahverkehrs ersetzt, wenn letzteres aufgrund der Wohnlage ungünstiger erscheint(Diekmann und Preisendörfer 1998a, b, c, 2001; z.T. anderer Auffassung sind Kühnelund Bamberg 1998). Dagegen findet die recyclinggerechte Trennung des Hausmülls,mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden, breite Akzeptanz unter ökologisch ge-sinnten Menschen. Die Analysen laufen insgesamt darauf hinaus – vor dem Hinter-grund eines RC-Modells wenig überraschend –, dass auch bei umweltfreundlich ge-sinnten Menschen umweltfreundliches Verhalten umso seltener gezeigt wird, je teureres kommt (Diekmann und Preisendörfer 2001: 119, 120). Die Low-Cost-Hypothesewird so zu einer empirischen Aussage über die relative Anreizstärke von umweltspezifi-schen Einstellungen bzw. Normen: Diese ist im Vergleich zur Anreizstärke etwa der in-dividuellen Bequemlichkeit in der Regel gering.5 Auch bekennende Umweltfreundesind demnach bestenfalls ,Gelegenheitsaltruisten‘.
Doch auch hier wird den Akteuren offenbar ein gewisses Ausmaß an ,echtem‘ Al-truismus zugestanden, selbst wenn dieser nur schwache Anreizwirkung entfaltet – an-dernfalls würde ja nie umweltfreundliches Verhalten gezeigt. Prinzipiell folgt daraus,dass die jeweilige Mischung von egoistischen und altruistischen Motiven erst empirischermittelt werden muss, bevor Verhaltensprognosen in diese oder jene Richtung formu-liert werden können. Die Prämisse des Egoismus der Akteure ist damit ein wenig auf-geweicht, das RC-Modell weniger informationshaltig.
Für substanzielle Anwendungen wichtiger erscheint ein zweites Problem: Ein reinpräferenzbezogener Ansatz kann den Beitrag auch altruistischer rationaler Akteure garnicht vollständig erklären und ist für sich genommen psychologisch unplausibel. Auchrationale Altruisten müssen an die Effektivität und Effizienz eines Handlungspfadesglauben, um ihn zu wählen. Zwar muss nun nicht mehr der individuelle Nutzen alleindie individuellen Kosten der betreffenden Handlungsweise übersteigen, sondern auch
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 693
4 Diekmann und Preisendörfer schließen kognitive Aspekte – die mit dem Begriff der Einstel-lung ja in der Regel ebenso wie evaluative Aspekte verbunden werden – keineswegs aus. Jedochbehandeln sie „Umwelteinstellungen“ im Wesentlichen als individuelle Handlungsmotivatorenund nicht als Teil des Informationsumfeldes. Dies wollen wir hier auf eine Präferenzinterpreta-tion zuspitzen, um unsere Argumente klarer konturieren zu können.
5 Diekmann und Preisendörfer heben als zentralen Bestandteil ihrer Low-Cost-Hypothese eineInteraktion zwischen Verhaltenskosten und Umwelteinstellungen hervor, nach der Einstellun-gen umso geringere Effekte auf das Umweltverhalten entfalten, je höher die Verhaltenskostensind. Die Existenz dieses wiederholt belegten Effektmusters wollen wir keineswegs in Fragestellen, wie wir auch viele Argumente von Diekmann und Preisendörfer teilen. Es fällt jedochschwer auszumachen, was jenseits der bloßen Behauptung eines Interaktionseffektes der theore-tische Kern der Low-Cost-These wäre, der über unsere obigen Aussagen hinausginge. Zudemist bei den vorliegenden Analyseproblemen ohnehin mit nicht-linearen Effektverläufen zu rech-nen, die statistisch von Interaktionen im Sinn multiplikativer Terme schwer zu trennen sind.
die externen Effekte des eigenen Handelns – die Nutzen der anderen Nutznießer desKollektivgutes – erhöhen den eigenen Nutzen, während auf der Kostenseite weiterhinnur die individuellen Kosten stehen. Doch müssen auch rationale Altruisten strategischkalkulieren.
Sie haben einerseits erst dann einen Anreiz, selbst beizutragen, wenn sie vermuten,dass genügend andere beitragen, damit das Kollektivgut überhaupt zustande kommenkann – Mülltrennung wie Demonstrieren sind sinnlos, wenn sie nur von Einzelnenoder kleinen Gruppen betrieben werden.6 Andererseits fordert die Rationalitätsannah-me, dass individuell nicht mehr beigetragen wird, wenn die Beiträge anderer zur Erstel-lung des Kollektivguts bereits genügen, denn auch Altruisten nehmen nicht unnötigKosten in Kauf – wenn meiner Partei die Mehrheit sicher ist, kann ich sonntags ge-trost zu Hause bleiben. Und schließlich kann sich auch unter Altruisten das Trittbrett-fahrer-Problem ergeben, dass man auf Beiträge der anderen wartet, statt selbst beizutra-gen: Selbst wenn ein Akteur am Umweltschutz zum Nutzen aller höchst interessiert ist,wäre es immer noch billiger für sie oder ihn, dieses Gut nur von anderen erstellen zulassen (solange der Ausfall seines individuellen Beitrags nicht das ganze Kollektivgutaufs Spiel setzt).7
Zusammengefasst: Selbst wenn man altruistische Präferenzen einführt und an-nimmt, dass die Kosten eigener Beiträge minimal sind, bleibt es häufig irrational, zureinen Kollektivgütern beizutragen. Vielmehr ist die Beitragsentscheidung für rationalealtruistische Akteure, wie geschildert, konditional, wobei angesichts der Möglichkeitenzu strategischem Verhalten die Bedingungen sogar recht komplex werden können. Da-mit kommen wir zu dem Einwand, dass ein nur evaluativ verstandener Normansatzauch psychologisch unplausibel ist. Wenn nämlich die individuelle Umsetzung einernormativen Präferenz konditional ist, geht sie mit relativ hohen Anforderungen an dieInformationsverarbeitung des Akteurs einher. Dieser muss nicht nur in jeder Hand-lungssituation altruistische gegen egoistische Präferenzen abwägen, sondern auch dieBeitragsentscheidungen anderer Kollektivmitglieder abschätzen und die Produktionsbe-dingungen des Kollektivgutes relativ gut kennen, um selbst eine ,rationale‘ Entschei-dung treffen zu können. Soweit aber die fraglichen Normen schwache Anreize sind,wird ein solcher Informationsaufwand selbst zum relevanten Kostenfaktor. Je höher dieindividuellen Informationskosten sind, desto geringer ist der verbleibende Ertrag ausdem Kollektivgut und desto unwahrscheinlicher letztlich dessen Erstellung.
Insofern ist Mülltrennung nicht nur deshalb Niedrigkostenverhalten, weil es als Tä-tigkeit vom Einzelnen wenig Aufwand und Verzicht verlangt, worauf Diekmann undPreisendörfer hauptsächlich abheben. Hinzu kommt als notwendige Bedingung einpassendes Informationsumfeld: Durch die in Deutschland üblichen rechtlichen Rege-
694 Markus Quandt und Dieter Ohr
6 Hier bildet die Wahlteilnahme eine Ausnahme, denn das Kollektivgut ,Wahlsieg im Interessemeiner Gruppe‘ kann, wenn sonst niemand (eingeschlossen politische Gegner) wählt, natürlichumso leichter durch eine einzelne Stimme gefördert werden. Ausführlich Edlin et al. (2002),die für rationale Altruisten Wahlbeteiligungsquoten in empirisch plausibler Höhe ableiten.
7 In der spieltheoretischen Analyse des Kollektivgutproblems führt die Annahme von Altruismusbeider Spieler an Stelle des Gefangenen-Dilemmas der Egoisten zu einem so genannten,Chicken Game‘. Dieses hat zwei (Nash-)Gleichgewichte und damit keine stabile Lösung.Letztlich kann es daher sogar dazu kommen, dass beide Spieler trotz ihres Altruismus einenBeitrag verweigern (Rasmusen 1989: 72, 73).
lungen zu Recyclingsystemen und durch deren Organisation mit gelben Säcken, grü-nen Tonnen oder öffentlichen ,Wertstoff-Containern‘ ist allen im Groben bekannt,dass und vor allem wie nicht nur sie selbst, sondern auch andere zum Kollektivgut bei-tragen sollen und können. Es kann ohne Aufwand beobachtet oder geschlossen wer-den, dass die Beiträge anderer zumindest nennenswert sind, während über ein ,Zuviel‘an Recycling nicht nachgedacht werden muss. Schließlich mag es sein, dass das unmit-telbare Sichtbarwerden des Mülltrennens im Wachsen der ,Wertstoff‘-Stapel beim ein-zelnen Beitragenden den Eindruck weckt, damit auch individuelle Beiträge zum letzt-lich gemeinten Gut ,Umweltschutz‘ wahrnehmen zu können. All dies ist etwa bei derEntscheidung zwischen PKW und öffentlichem Nahverkehr anders: Es ist bei Wahlder umweltfreundlichen Alternative ÖPNV nicht nur der Verzicht etwa auf Komfortvermutlich schwerwiegender, wie das einfache Niedrigkostenargument besagt, sondernes ist bereits das Wie der ÖPNV-Nutzung oft mit spürbaren Informationskosten ver-bunden (vgl. Kühnel und Bamberg 1998). Koordiniertes Beitragsverhalten anderer istwohl kaum erkennbar; welches Ausmaß von Umweltbe- oder -entlastung mit der Nut-zung unterschiedlicher Verkehrsmittel einher geht, ist selbst unter Wissenschaftlernstrittig; und der eventuell erbrachte Beitrag zum Umweltschutz bleibt hinter der langenWirkungskette vom Abgasausstoß bis zum Klimawandel verborgen. Kurz: Recyclingre-gelungen werden womöglich nicht zuletzt deshalb eher freiwillig befolgt als andereUmweltnormen, weil sie auch dann einleuchtend erscheinen, wenn man nicht allzuviel über ihren individuellen und kollektiven Ertrag nachdenkt.
Wenn also in Niedrigkostensituationen verbreitet Normen gefolgt wird, so wirddies bevorzugt dann der Fall sein, wenn die Akteure sehr leicht von der Wirksamkeitihres individuellen Beitrags zu überzeugen sind – oder wenn sie gar nicht erst überle-gen, ob ihr Beitrag noch wirkungslos oder schon überflüssig sein könnte. Gerade dieMöglichkeit, dass die Wirkungsfrage gar nicht gestellt wird, scheint dem lebensweltli-chen Bild der normtreuen Abfalltrenner, Wähler und Demonstranten gut zu entspre-chen, für die sich die jeweilige Norm als diffuses Gefühl äußert, zu einer bestimmtenVerhaltensweise mehr oder weniger strikt verpflichtet zu sein, wenn sie vor der Wahlzwischen normativ konnotierten Handlungsalternativen stehen. Dass diese Verhaltens-weise das sozial erwünschte Ziel fördert, wird dabei in der Regel nicht in Frage gestellt.Während also für strikt rationale Altruisten die Normanwendung konditional nachstrategischen Erwägungen erfolgen müsste, erscheint es plausibler, dass erfolgreicheNormen von den Akteuren subjektiv unkonditional umgesetzt werden.
Unsere Hypothese ist daher, dass es aus Sicht eines Kollektivs mindestens ebensowichtig ist, den Akteuren bestimmte Informationen zu vermitteln, wie ihre Präferenzenzu formen oder zu erweitern. Es kommt nicht nur darauf an, in Akteuren den Wunschnach Kollektivgütern zu verstärken, man muss ihnen auch die Kosten des Nachdenkensüber die angemessene Handlungsweise ersparen. Wenn eine Norm erst einmal etabliertist, wird ein Kollektiv seine Mitglieder sogar daran hindern wollen, überhaupt über de-ren Anwendung nachzudenken, da einige zu dem Schluss kommen könnten, es gebeeine Überproduktion des Kollektivgutes und ihr Beitrag sei nicht mehr nötig, womitandere sich ausgebeutet fühlen könnten und ebenfalls ihren Beitrag zurückhalten wür-den – eine Abwärtsspirale bis zum Zusammenbruch der Kollektivgutproduktion könn-te entstehen.
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 695
Welche Zusammensetzung ein Informationsangebot haben muss, das kollektivenZielen dienlich ist, ist nun leicht erkennbar. Erstens enthält jede Norm als Verhaltens-vorschrift über die evaluative Komponente hinaus notwendigerweise eine Regel, in wel-cher Situation welche Handlung zu wählen ist (insofern sind Normen natürlich immerkonditional). Zweitens wird die Effektivität ebenso wie die Notwendigkeit der vorgege-benen Handlung fraglos zugesichert. Damit ist drittens die Botschaft verbunden, dassder Akteur sich nicht weiter über das Verhalten anderer zu informieren braucht. Vier-tens werden Informationen über die individuellen Handlungskosten systematisch nichtthematisiert oder aber in einer Weise, die sie als vernachlässigbar darstellt. Die dem In-dividuum zugängliche Information wird weder immer korrekt noch immer vollständig,sondern vielmehr oft so verzerrt sein, dass sie eine Entscheidung für die Teilnahme ander Kollektivguterstellung nahe legt.
Der zweite der beiden oben unterschiedenen Wege, auf denen Kollektive die Hand-lungsanreize ihrer Mitglieder beeinflussen können, besteht also in der Vermittlung vonInformationspaketen, die durchaus auch ,Mogelpackungen‘ sein können. Wir habendiesen Weg bisher als – allerdings notwendige – Ergänzung zum evaluativen Aspektvon internalisierten Normen dargestellt. Dass reale Akteure auch altruistischen Präfe-renzen folgen können, wenn sie an der Erstellung von Kollektivgütern teilnehmen, sollalso keineswegs bestritten werden. Jedoch kann kollektivdienliches Verhalten selten al-lein durch ,fehlenden‘ Egoismus erklärt werden, wie es mit Blick auf Niedrigkosten-situationen oft getan wird. Unter den beschriebenen Bedingungen eines selektiven oderverzerrten Informationsangebotes könnten durchaus auch rationale Egoisten sich überdie wahre Produktionssituation des Kollektivgutes täuschen lassen und daher selbst bei-tragen: Die Möglichkeit eines free ride mag übersehen werden, oder Sanktionsdrohun-gen werden wirksam, auch wenn sie gar nicht umsetzbar wären. So kann der kognitiveAspekt von Normen auch unabhängig vom evaluativen Aspekt zum Tragen kommen –und systematische Täuschung der Akteure über die konkrete Handlungssituation kannsogar als hinreichende Bedingung für die Kollektivgutproduktion gelten.
Muss eine solche Anfälligkeit für kollektiv eingefärbte Täuschungen nicht als Ver-letzung der RC-Annahme der Akteursrationalität gewertet werden (zu dieser Frage vgl.Barry 1978), die für das Paradigma zentraler ist als die Annahme des Egoismus? Derfolgende Abschnitt wendet sich den Fragen zu, warum rationale Akteure einerseits ge-rade in Niedrigkostensituationen geneigt sein können, sich auf kollektiv bereitgestellteInformationen zu verlassen und wann sie andererseits eine Situation nicht mehr alsNiedrigkostensituation empfinden, so dass sie bereit sein sollten, höhere Informations-kosten auf sich zu nehmen.
V. Kosten und Arten des Entscheidens
1. Kostenreduzierende Mechanismen der Handlungswahl
Wir wollen Situationen weiterhin so modellieren, wie sie den Akteuren erscheinen,nicht so, wie sie ,objektiv‘ bzw. aus der Perspektive des Forschers aussehen. Darausfolgt, dass anders als in der mikroökonomischen Standardtheorie die begrenzte Ausstat-
696 Markus Quandt und Dieter Ohr
tung menschlicher Akteure mit Informationsverarbeitungs- und Entscheidungskapazitä-ten zu berücksichtigen ist (Lindenberg 1989; Simon 1955, 1985). Wenn Informatio-nen nur mit begrenzten Mitteln aufgenommen und bewertet werden können, dannverursacht Entscheiden unter Berücksichtigung solcher Informationen Kosten, undzwar im Allgemeinen umso mehr, je mehr zusätzliche Information die Entscheidungerfordert. Erstens fallen Opportunitätskosten an, weil fast immer gleichzeitig oder imnächsten Moment weitere Probleme zur Bearbeitung anstehen, für die ebenfalls Kapa-zität benötigt würde. Deren Bearbeitung fiele bei ausführlicher Reflexion des erstenProblems möglicherweise zu kurz aus; ihre – in isolierter Betrachtung – nutzenmaxi-male Lösung würde verfehlt. Es ist also notwendig, den Entscheidungsaufwand überviele Situationen hinweg zu optimieren. Zweitens ist bewusstes Entscheiden als der Ge-samtprozess des Sammelns, Bewertens und Abwägens von Informationen vor demHintergrund der eigenen Präferenzen ohnehin oftmals aufwendig, denn die physiologi-sche Aktivität des Denkens verschlingt auch andere Ressourcen außer Zeit: So ver-braucht das Gehirn bereits im Ruhezustand ein Fünftel der im Körper verfügbarenEnergie (Gusnard und Raichle 2001: 688). Und auch die Mehrzahl der Leser kenntwohl aus eigener Erfahrung ein Gefühl von Erschöpfung nach konzentrierter geistigerArbeit.
Die ursprüngliche Frage danach, wann Menschen nach ,irrationalen‘ Kriterien han-deln könnten, lässt sich nun umkehren: Wann eigentlich lohnt es sich, den Aufwanddes bewussten Entscheidens auf sich zu nehmen, um zu einer nutzenmaximalen Wahlzu gelangen? Die Antwort folgt der einfachsten ökonomischen Logik: Aktives Entschei-den zahlt sich nur dann aus, wenn der so erreichbare zusätzliche Ertrag die zusätzli-chen Kosten des Entscheidens übersteigt. Diese Umformulierung hat den Vorteil, dassdas Problem nun leicht mit einem bereits aus einem anderen Kontext bekannten In-strumentarium modellierbar ist, in dem auch die Idee des ,unbewussten Entscheidens‘schon eingeführt ist. Diese Idee und ihr Zusammenhang mit einem allgemeinen Kon-zept von ,Situationen‘ sind im nächsten Schritt zu skizzieren.
Wir haben das von Hartmut Esser (z.B. 1996, 2001) propagierte Konzept von Ha-bits und Frames als Ausgangspunkt gewählt, weil es erlaubt, die vom Akteur offenbarte,Rationalität‘ als Neigung zu einer informationsaufwändigen Entscheidungsprozedur alsabhängige Variable eines Erklärungsmodells darzustellen, in dem allgemeine Akteurs-rationalität zugleich auch eine Prämisse ist, ohne dabei zirkulär zu werden.8
Esser hat die Wahl zwischen zwei idealtypischen Modi des Entscheidens, einem ra-tional-kalkulierenden und einem automatisch-spontanen Modus, als Funktion verschie-dener Nutzen- und Kostengrößen dargestellt, die auch mit Situationsmerkmalen ver-bunden sein sollen. Der rational-kalkulierende ,rc-Modus‘ entspricht dem alltagssprach-lich als ,rational‘ beschriebenen informationsaufwändigen, reflektierenden Entschei-dungsverhalten. Der ,as-Modus‘ des automatisch-spontanen Reagierens hält dagegendie Entscheidungskosten extrem gering. In diesem Modus fallen Entscheidungen nicht
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 697
8 Herbert Simon erklärt altruistisches Verhalten ebenfalls als Folge begrenzter Rationalität. Dieseführe in einem evolutionären Prozess zu „Gelehrigkeit“ (orig. docility) gegenüber sozialen Ein-flüssen, selbst wenn diese Einflüsse gelegentlich den eigenen Interessen zuwiderlaufen (Knud-sen 2003; Simon 1993). Simons Argumente sind jedoch weniger gut auf Typen von Hand-lungssituationen zu beziehen.
bewusst, sondern es gibt eine fast unmittelbare Verknüpfung zwischen der Wahrneh-mung von bestimmten Situationsmerkmalen und der Wahl einer der Situation subjek-tiv angemessenen Handlungsweise. Anhand einiger weniger Merkmale wird zunächstdie Situation mit dem Bestand bekannter Situationstypen abgeglichen. Je vertrauter ei-nem Akteur Situationen eines Typs sind, desto wahrscheinlicher sind für ihn damitvordefinierte Sets von jeweils verfolgenswerten und erreichbaren Zielen verbunden, sogenannte Frames. Im Idealfall können die durch den Frame vorgegebenen Ziele zudemmit einem gut eingeübten Handlungsskript (Habit) verfolgt werden, so dass auch überdie Handlungswahl selbst nicht mehr nachgedacht werden muss. Die Handlungsent-scheidung ergibt sich also im Zusammenwirken der konkreten Ausprägung der Situa-tionsmerkmale und des aktuellen Frames und zugehörigen Habits.
Da die Situationstypisierung und die zugehörigen Frames und Habits für wieder-kehrende Alltagssituationen zum Basisrepertoire eines erfolgreich sozialisierten Men-schen zählen, gehen ihre Aktivierung und der Entscheidungs- und Handlungsablaufohne bewusstes Überlegen des Akteurs vonstatten (Esser 2001: 278f.). Insbesondereenthalten Frames und Habits auch kondensiertes kulturelles Wissen. Es sind darinnicht nur individuelle Erfahrungen gespeichert, sondern auch soziale Vorgaben, imSinne von Berger und Luckmann (1987 [1969]) objektivierte und institutionalisierteHandlungsregeln. Ein Akteur, der im as-Modus handelt, hat also häufig die subjektiveGewissheit, dass die durch Frame und Habit nahe gelegte Verhaltensweise sich in sei-nem sozialen Umfeld bereits bewährt hat und zudem gutgeheißen wird.
Durch die nahtlose Verbindung von Frame und Habit zu einer Deutungs- undHandlungsroutine lässt sich ein ,automatisches‘ Entscheiden rekonstruieren: Der as-Modus senkt die Kosten der Handlungswahl unter die subjektive Wahrnehmungs-schwelle, indem ein bewusster Entscheidungsvorgang gar nicht erst ausgelöst wird.Routinebasiertes Handeln im as-Modus kann also ein Werkzeug sein, das es Akteurenin Niedrigkostensituationen ermöglicht, zu einer Handlungswahl zu gelangen, ohnedass von vornherein schon die Entscheidungskosten den Ertrag einer zu wählendenHandlung übersteigen.
Der Normalfall sollte sein, dass automatisches Entscheiden in etwa zu derselbenHandlungsweise führt, die der Akteur nach einem kalkulierenden Entscheidungsverfah-ren gewählt hätte, wenn diese Kalkulation kostenfrei wäre. Ob dies in einer gegebenenSituation der Fall ist, hängt freilich vom Inhalt der handlungsleitenden Routine ab:Deutungs- und Handlungsroutinen, die überwiegend aus einem individuellen Erfah-rungsschatz gewonnen sind, werden je nach ihrer Eignung für eine gegebene Situationentweder rational-egoistisch oder bloß idiosynkratisch anmutende Verhaltensmustervorgeben. Soweit es hingegen Kollektiven gelingt, soziale Normen als Routinen in denKöpfen ihrer Mitglieder zu verankern, werden diese systematisch eher kollektivdienli-che Handlungspfade beschreiten. Dann kann es bei routinegesteuertem Handeln dazukommen, dass die Akteure, statt die fehlende soziale Kontrolle auszunutzen, den Abfalldoch trennen oder an der Wahl doch teilnehmen.
698 Markus Quandt und Dieter Ohr
2. Ein formales Modell der Wahl des Entscheidungsmodus
Bisher wurde die Einteilung in ,niedrige‘ und ,hohe‘ Kosten einfach willkürlich gesetzt.Wann aber sind Kosten überhaupt ,niedrig‘? Und welche Rolle spielen die oben unter-schiedenen Arten von Kostengrößen, also die Höhe des Nutzendifferenzials, das abso-lute Kostenniveau (von Opportunitäts- und direkten Kosten) und die Informationskos-ten, die durch den Umgang mit Risiko und Unsicherheit entstehen?
Die Antworten werden erkennbar, wenn man die unterschiedlich aufwendigenModi des Entscheidens einführt: Es ist keineswegs allein der Umstand, dass der Nut-zenunterschied etwa zwischen einer moralischen und einer nur marginal besseren egois-tischen Handlungsalternative gering ist, der einen rationalen Akteur davon abhält, diebessere, egoistische Alternative zu wählen. Vielmehr wird ein rationaler Entscheider erstdann bereit sein, sich auf Routinen wie etwa normativ geprägte Frames zu verlassen,wenn der Nutzenunterschied so gering erscheint, dass er die Kosten eines bewusstenEntscheidungsverfahrens nicht mehr rechtfertigt. Dies wird wiederum, wie in der er-weiterten Definition der Niedrigkostensituation betont, von verschiedenen Aspektender Situation abhängen. Wie weit reicht nun dieser „veil of insignificance“ (Kliemt1986: 341); wann wird er doch durchsichtig? Die Aufgabe ist, erstens diese Wahr-nehmbarkeitsschwelle theoretisch zu bestimmen und zweitens den Einfluss von unter-schiedlichen Situationsmerkmalen auf die Höhe dieser Schwelle zu untersuchen. Dasvon Esser (1996, 2001) vorgeschlagene formale Modell ist für diesen Zweck etwas an-ders zu interpretieren, ohne dass die formale Darstellung wesentlich geändert werdenmüsste.
Zunächst trennt Esser explizit zwischen der Wahl von Frames und der Wahl einesEntscheidungsmodus, verknüpft diese Wahlen aber auch miteinander (Esser 2001:281ff.).9 Das Interesse liegt an dieser Stelle allein auf dem zweiten Wahlakt zwischenroutinebasiertem Verhalten einerseits und bewusstem, analytischem Entscheiden ande-rerseits. Um die Darstellung zu straffen, werden wir daher die Essersche Unterschei-dung der getrennten Wahl von Frames und Entscheidungsmodus nicht aufrecht erhal-ten. Weiterhin geben wir Essers recht starke Annahme auf, dass Akteure so gut wie im-mer routinegeleitet handelten. Plausibler ist in unserem Zusammenhang, dass ein Ak-teur nach dem Verlassen eines automatischen Entscheidungsverfahrens mindestens imZeithorizont einer einzelnen Situation im rc-Modus der aktiven Informationssuche und-bewertung verbleiben kann. Das Ablegen bestimmter normativer Verhaltensvorgabenheißt dann zunächst nur, dass eine hohe Aufmerksamkeit für die Entscheidung zwi-schen den in der Situation erreichbaren Optionen aktiviert wird – die Wahl eines neu-en Frames ist eine mögliche Folge, der Verbleib in einem Modus rationalen Entschei-dens eine andere.
Ausgangspunkt der formalen Modellierung sei ein Standardfall des Entscheidens:Der Akteur befindet sich in einer vertrauten Situation und verfügt über ein subjektivpassendes Paket aus Frame und Habit, das eine Norm zum kollektivdienlichen Han-deln beinhalte. Diese Konstellation wird dann instabil, wenn der Akteur Anlass zu
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 699
9 Für formale Modellierungen der bei Esser (2001) zunächst unscharfen Verknüpfung der Wahlzwischen Frames und Modus vgl. Schräpler (2001) oder anders Esser (2003). Für eine ausführ-liche Herleitung der weiteren Formalisierungen siehe z.B. Esser (2001: 272ff.).
Zweifeln an der Eignung der Routine bekommt und zudem eine ferne Ahnung hat,dass nach Verlassen dieser Routine erfolgreichere Handlungswahlen möglich wären.
Die Parameter in diesem Kalkül sind die Folgenden: der erwartete Nutzen desHandelns unter der aktuellen Routine i im as-Modus (Ui); der Alternativnutzen derHandlung, die bei Verlassen dieser Routine gewählt werden könnte (Uj); die Kostendes bewussten Entscheidens im rc-Modus (C); die Wahrscheinlichkeit, mit der im rc-Modus die ,richtige‘ alternative Handlung gefunden würde, die den AlternativnutzenUj auch erreicht (p); schließlich das Ausmaß der Sicherheit über die Passung der aktu-ellen Routine (m), das ebenfalls als Wahrscheinlichkeit zu verstehen ist.10
Die wesentliche Modifikation gegenüber dem gewöhnlichen SEU-Modell liegt inder expliziten Modellierung der Sicherheiten m und p. Mit diesen sind die als SEU-Werte ja bereits wahrscheinlichkeitsgewichteten Nutzen der verschiedenen Handlungs-pfade (Ui und Uj) noch einmal zu gewichten. Der Parameter m versieht die subjektiveSchätzung von Ui für die routinebasierte Handlung gewissermaßen mit einem ,Konfi-denzniveau‘. Der zusätzliche Gewichtungsfaktor m ist notwendig, um auszudrücken,dass die in Ui zusammengefassten Schätzungen des mit der Routine erreichbaren Nut-zens und über die Tauglichkeit des Routineverhaltens selbst ebenfalls unsicher seinkönnen. Der Keim des Wechsels in den rc-Modus liegt dann unter anderem in einemfallenden Wert von m, also in der Erschütterung des Glaubens an die zunächst zwei-felsfrei funktionierende Routine. Im Kontext des normgetriebenen Handelns drücktsich in m die subjektive Geltung der Normen aus, die mehr oder eben auch wenigerunhinterfragt das eigene Handeln bestimmen.11
Der Parameter p berücksichtigt analog die unsicheren Erfolgsaussichten einer be-wussten Informations- und Entscheidungssuche: Wird man, falls man die Routine auf-gibt, überhaupt auf alternative Lösungsmöglichkeiten stoßen? p ist also ein zweitesMaß für das Informationsangebot in einer Entscheidungssituation; erfasst wird damitein rudimentäres Wissen über die Welt außerhalb des Routine-Horizontes. Ist also dasGras am anderen Ufer wirklich so grün, wie es scheint? m und p dürften stark negativkorrelieren; wegen ihrer unterschiedlichen Quellen sind sie aber dennoch nur aus-nahmsweise völlig redundant.
Die beiden Wahrscheinlichkeitsgrößen m und p bilden letztlich die Klarheit der An-reize in einer Situation ab. Sie werden nicht nur von den äußeren Merkmalen der Si-tuation abhängen, sondern auch von individuellen Dispositionen, Erfahrungen und Fä-higkeiten zum Umgang mit Informationen. Wie stark sich etwa Zeitdruck oder Kom-plexität als Stressoren auswirken, die subjektiv die Chancen einer erfolgreichen Ent-scheidung im rc-Modus senken und somit zum Rückfall auf ein ,mechanisches‘ Ent-scheiden verleiten können, dürfte auch durch die Stressresistenz des Akteurs bestimmtsein.
700 Markus Quandt und Dieter Ohr
10 Kosten C des Entscheidens fallen nur im rc-Modus an, da die Handlungswahl im as-Modusvereinfachend als völlig kostenfrei angenommen wird.
11 Esser (2003) hat die Größe m inzwischen anders benannt und abgeleitet als noch in Esser(2001). In der Ursprungsversion (1996) tauchte m auf, aber nicht 1–m (s.u.). Grund für diejüngste Revision ist ein Problem bei der Verknüpfung von Frame-Wahl und Modus-Wahl (Es-ser 2003; Rohwer 2003). Da für unsere Zwecke die Frame- und Modus-Verbindung keine zen-trale Rolle spielt und die Version aus Esser (2001) einfacher ist, behalten wir letztere bei.
Im formalen Überblick stellt sich das Problem der Wahl des Modus folgenderma-ßen dar. Mit den Erwartungswerten des Entscheidens in den beiden Modi:
SEU(as) = mUiSEU(rc) = (1–m)pUj + (1–p)mUi – C
und der Bedingung SEU(rc) > SEU(as) für die Wahl des rc-Modus:
(1–m)pUj + (1–p)mUi – C > mUi
ergibt sich durch Umformung die folgende Ungleichung, nach der sich ein Schwellen-wert für den Wechsel des Modus bestimmen lässt:12
(1–m)Uj – mUi > C/p
Erst wenn die Differenz zwischen der Nutzenerwartung Uj des Entscheidens im rc-Mo-dus zum mit der Passung m gewichteten Erwartungsnutzen Ui des Handelns unterRoutine i größer ist als die Kosten des rc-Modus C, gewichtet mit dem Kehrwert derChance p, im rc-Modus einen besseren Handlungspfad zu finden, erst dann lohnt sichfür einen Akteur das Verlassen der ,billigen‘ Befolgung normativer Vorgaben. Je gerin-ger also die Wahrscheinlichkeit p, im rc-Modus zu einer besseren Handlungswahl zukommen, desto stärker werden die Kosten des rc-Modus angerechnet. Je höher die Dif-ferenz zwischen den im as- und im rc-Modus erreichbaren Nutzenwerten, desto höherist aber auch die Bereitschaft, solche Kosten in Kauf zu nehmen.
Die Hyperbel C/p trennt den Bereich unreflektierten und normgesteuerten Verhal-tens (links/unterhalb der Kurve) von dem Bereich bewussten Entscheidens (rechts/oberhalb der Kurve). Bei gegebenem Aufwand C wirkt sich die Variation der Finde-Wahrscheinlichkeit p für eine neue Lösung relativ geringer aus, solange p nahe 1 ist.Die Kurve wird bei steigendem p schnell flacher, der Effekt von p ist in dessen unterenWertebereich also größer. Dies wird umso ausgeprägter, je geringer der zu investierendeAufwand C ist, wie der Vergleich der drei Kurven in Abbildung 2 mit unterschiedli-chen Kostenniveaus zeigt.
Wie lassen sich vor dem Hintergrund dieses Modells Niedrigkostensituationen be-schreiben? Definitionsmerkmale waren das Nutzendifferenzial, die absoluten Niveausder Opportunitätskosten und der direkten Kosten (allgemein: von Nutzenänderungengegenüber dem Status Quo) und als modifizierendes Element die Unsicherheit bei derSchätzung des Nutzendifferenzials. Mit Uj – Ui ist die Höhe des Nutzendifferenzialsdirekt enthalten. Über die Parameter m und p ist die (Un-)Sicherheit bei dessen Schät-zung zu modellieren. Die absolute Höhe der Nutzen und Kosten findet mittelbar Ein-gang in das Modell. Deren vermutete Signalfunktion für eine erhöhte Aufmerksamkeitin der Situation ist über m zu integrieren: Je höher die Opportunitätskosten oder diedirekten Kosten aller Handlungspfade, desto geringer sollte m ausfallen.
Insgesamt sind ,klassische‘ Niedrigkostensituationen mit geringem Nutzendifferen-zial im unteren Bereich der Grafik in Abbildung 2 zu verorten. Mit dem typischen ,ir-rationalen‘ Entscheidungsverhalten ist aber auch zu rechnen, wenn bei hohem Nutzen-
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 701
12 Unsere Beispiele für inhaltliche Implikationen aus der Ungleichung beziehen sich auf nicht-ne-gative Wertebereiche aller Nutzen- und Kostengrößen. Das Modell ergibt jedoch auch für ne-gative Werte plausible Prognosen.
differenzial die Kosten des Entscheidens im rc-Modus hoch wären – was sich durchdie Verschiebung der Kurve C/p nach rechts oben ausdrückt –, oder wenn die Finde-Wahrscheinlichkeit p für eine bessere Lösung im rc-Modus vorab gering erscheint –also im linken Bereich der Grafik. Ist dagegen p nahe 1 und C gering, können auch inNiedrigkostensituationen leicht rationale Kriterien zur Anwendung kommen.
Damit wird deutlich, in welchem Sinne sich Niedrigkostensituationen überhauptals theoretisch wie empirisch brauchbare Konstrukte bestimmen lassen: nicht etwadurch Angabe eines bestimmten Betrags des Nutzendifferenzials, der über alle denkba-ren Handlungskonstellationen hinweg konstant wäre. Es geht vielmehr darum, dieKostenrelationen in einer Situation aus den jeweiligen Randbedingungen zu ermitteln,bevor man Schlüsse über das Entscheidungsverhalten der Akteure ziehen kann. Zwei-fellos werden Operationalisierungen sehr schwierig sein, wobei besonders die diversenWahrscheinlichkeitsschätzungen empirisch schwer zu separieren sein dürften (zur Prü-fung von RC-Modellen vgl. etwa Brüderl 2004). Dennoch kann man bereits aus Plau-sibilitätsüberlegungen nützliche Folgerungen für konkrete Anwendungen gewinnen.
So lässt sich einfach aufzeigen, wie etwa die Entscheidung, Müll zu trennen, einerNiedrigkostenlogik unterliegt. Das individuelle Nutzendifferenzial ist bei Egoisten indieser Kollektivgutsituation bekanntlich minimal, die eigene Teilnahme selbst für Al-truisten nach rationaler Reflektion sehr fraglich. Eine durchgesetzte Norm wirkt sichnun aber in einem hohen Wert von m aus. Zwar ist auch p recht hoch, da die Alterna-tive, den Müll nicht zu trennen, mitsamt ihrem Ertrag relativ leicht erkennbar seinsollte. Bei einem hohen Wert von m geraten die dabei vermiedenen Kosten der Müll-trennung aber gar nicht in den Blick, solange C positiv ist, denn der rc-Modus wird
702 Markus Quandt und Dieter Ohr
Abbildung 2: Unterschiedliche Schwellenwertverläufe für den Wechsel in den rc-Modus
p0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
(1–m
)Uj–
mU
i
hoher Aufwand C=1,0mittlerer Aufwand C=0,5niedriger Aufwand C=0,1
nicht aktiviert und eine vorhandene Norm zur Mülltrennung nicht hinterfragt. Dabeibraucht das Ziel der Norm individuell nicht einmal für besonders wichtig gehalten zuwerden. Damit ist etwa der von Diekmann und Preisendörfer (1998b: 450, 451)„überraschend“ genannte Befund zu erklären, dass die Entfernung zum Recycling-Con-tainer – als Kostenfaktor bei der Mülltrennung – nur einen schwachen (Papierrecyc-ling) oder gar überhaupt keinen (Glasrecycling) Effekt auf die Häufigkeit des Verhal-tens hat. Das hohe Maß an ,Selbstverständlichkeit‘ der Recycling-Norm führt unsererHypothese nach dazu, dass selbst normalerweise spürbare Kosten nicht berücksichtigtwerden. Allgemeiner folgt, dass im subjektiven Niedrigkostenbereich kaum Effekte desSEU-Wertes einer alternativen Handlung auftreten sollten. Würde eine Entscheidungs-routine dagegen – etwa durch eine Verschiebung der Kostenrelationen – erst erschüt-tert und dann verlassen, wäre mit einem recht plötzlichen Einsetzen von solchen Effek-ten zu rechnen.
Die Situation eines potenziellen Deserteurs lässt sich folgendermaßen modellieren:Nimmt man für die beiden Alternativen Kriegsdienst und Flucht gleiche Nutzenwerteund Eintrittswahrscheinlichkeiten eines negativen Ausgangs an, ergäbe sich ein ,objek-tives‘ Nutzendifferenzial von Uj – Ui = 0. Subjektiv ist die Situation jedoch von vorn-herein eine Hochkostensituation, da mit dem Verlust der physischen Existenz eine ex-treme Veränderung gegenüber dem Status Quo des sicheren zivilen Lebens droht. Diesallein sollte m als Geltungsparameter der normativen Vorgabe Kriegsdienst reduzieren.Überdies unterliegt die Schätzung der Erwartungswerte für beide Alternativen extremerUnsicherheit, m und p werden somit beide relativ niedrig ausfallen. Ob nun eine ,ra-tionale‘ Suche nach Möglichkeiten zur Vermeidung des Kriegseinsatzes begonnen wird,hängt auch davon ab, inwiefern m und p sich kurzfristig verändern, etwa verursachtdurch neue Informationen. Fehlen solche Informationen, können Zufall, Instinkt oderAberglauben regieren. Aber bereits das bloße Wissen, dass andere sich dem Kriegsein-satz erfolgreich entzogen haben, würde p steigern und die Schwelle zur aktiven Alter-nativensuche senken. Desertion könnte so sehr ,ansteckend‘ werden.
In Situationen mit geringen Suchkosten C und hoher Finde-Wahrscheinlichkeit füreine Alternative liegt hingegen die Schwelle für einen Moduswechsel recht niedrig. ImExtremfall von p=1 und m=0 sind die Kosten C die einzige Hürde für einen Wechsel.Damit genügt oft ein minimales Nutzendifferenzial, um im rc-Modus entscheiden zukönnen. Wenn bekanntermaßen gleichwertige Produkte im Supermarktregal direkt ne-beneinander stehen – dann ist auch C=0 –, muss auch ein Preisunterschied von nur ei-nem Cent die Kaufentscheidung determinieren. Diese Niedrigkostensituation geht we-gen der perfekten Informationsverfügbarkeit gerade nicht mit ,irrationalem‘ Verhalteneinher, sondern folgt dem Ideal des homo oeconomicus der Mikroökonomie. Werbungüber verborgene Eigenschaften der Produkte (Gesundheitsrelevanz, ,coolness‘ usw.)kann freilich die Transparenz der Situation wieder verringern, also p senken und C er-höhen, und zum Kauf teurerer, stark beworbener Markenprodukte führen.
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 703
VI. Diskussion
Der Begriff der Niedrigkostensituation wurde in der wissenschaftlichen Diskussion bis-lang nur in ausgesprochen unscharfer Weise verwendet. Einerseits konnte er so dieFunktion nicht erfüllen, den Anwendungsbereich konventioneller RC-Modelle abzu-grenzen, weil die Schwelle zur Niedrigkostensituation unbestimmt blieb, andererseitsfügte er dem Grundmodell rationaler Akteure einen willkürlichen Bruch zu, weil dieAnnahme der Rationalität anscheinend nur situationsabhängig gelten sollte. Der Rück-griff auf ein Modell des Entscheidens, das Informations- und Entscheidungskosten ein-bezieht, kann beide Mängel beheben. Die Grenze der konventionellen RC-Logik wirdanalytisch bestimmbar, während zugleich der Verzicht auf bewusstes, ,rationales‘ Kalku-lieren selbst als rationales Verhalten erkennbar wird. Damit werden Niedrigkosten-situationen wieder innerhalb eines allgemeinen RC-Rahmens modelliert.
Dabei zeigt sich, dass ein für Niedrigkostensituationen typisches Verhalten keines-wegs nur dann zu erwarten ist, wenn auch im strikten Sinne unserer Definition einesolche Situation gegeben ist. Es gibt vielmehr ein allgemeines Erklärungsmuster für dieAbweichung von ,rationalen‘ Entscheidungskriterien, in dem die perfekte Niedrigkos-tensituation nur einen Spezialfall darstellt. So können auch Situationen wie die desWehrpflichtigen vor dem Kriegseinsatz subjektiv Hochkostensituationen sein und den-noch – aufgrund der unsicheren Nutzenschätzungen – auf ,irrationale‘ Weise entschie-den werden.
Bei der theoretischen Rekonstruktion scheinbarer Paradoxien wie dem freiwilligenBeitrag zu kollektiven Gütern erbringt die Integration der Entscheidungs- und Infor-mationskosten einen klaren Vorzug gegenüber zusätzlich eingeführten Präferenzen, wiesie etwa die Annahme von Altruismus oder die so genannten Konsumnutzen-Theoriendes Wählens liefern.13 Denn bezogen auf das Wählerverhalten sind etwa konsumtiveNutzen, zu denen auch die innere Genugtuung der Normbefolgung zählt, bisher kaumin eine systematische Erklärung eingebunden. Unser Vorgehen besteht demgegenüberdarin, in Anwendung der üblichen ökonomischen Logik auch Entscheidungskosten zuberücksichtigen. Dann wird erkennbar, dass gerade in Niedrigkostensituationen kollek-tivdienliches Verhalten auch ohne solche zusätzlichen Nutzenargumente erklärt werdenkann.
Was als altruistische Motivation verstanden werden könnte, ist so in bestimmtenFällen als Folge rationaler Ignoranz über die eigene Handlungssituation erklärbar. Um-gekehrt wird bei Betrachtung der Informationsanforderungen in der Kollektivgutbereit-stellung deutlich, dass auch echte altruistische Präferenzen dann am leichtesten zu ver-breitetem kollektiven Handeln führen, wenn typische Niedrigkostenbedingungen vor-liegen. Insgesamt kommt die Heraushebung des Informationsaspektes von Normen derForderung entgegen, dass Normen nicht als Teil der individuellen Präferenzordnungen,sondern als „Bestandteile der Umwelt“ zu modellieren seien (Zintl 1996: 508).
Auf der Ebene sozialer Prozesse wird die Aufmerksamkeit auch für empirische Un-tersuchungen auf die soziale Prägung der Routinen gelenkt, die wir hier als kognitiveSeite eines kollektiven Angebotes von Normen verstanden haben: Kurzfristig gesehen
704 Markus Quandt und Dieter Ohr
13 Prototypisch Riker und Ordeshook (1968: 28).
ist die Frage, unter welchen Bedingungen welche Akteure auf ein gegebenes Norm-angebot reagieren;14 längerfristig gesehen ist die Frage, wie die Zusammensetzung vongesellschaftlichen Normangeboten zu erklären ist.
Literatur
Aldrich, John H., 1993: Rational Choice and Turnout. American Journal of Political Science 37:246–278.
Barry, Brian, 1978: Sociologists, Economists and Democracy. Chicago: The University of ChicagoPress.
Berger, Peter L., und Thomas Luckmann, 1987 [1969]: Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit.Frankfurt a.M.: Fischer Verlag.
Brennan, Geoffrey, und Loren Lomasky, 1993: Democracy and Decision. The Pure Theory of Elec-toral Preference. Cambridge: Cambridge University Press.
Brüderl, Josef, 2004: Die Überprüfung von Rational-Choice-Modellen mit Umfragedaten. S. 163–180 in: Andreas Diekmann und Thomas Voss (Hg.), Rational-Choice-Theorie in den Sozialwis-senschaften. München: Oldenbourg.
Coleman, James S., 1990a: Foundations of Social Theory. Cambridge: Belknap Press.Coleman, James S., 1990b: Rational Action, Social Networks, and the Emergence of Norms. S. 91–
112 in: Craig Calhoun, Marshall W. Meyer und Richard W. Scott (Hg.), Structures of Power andConstraint. Papers in Honor of Peter M. Blau. Cambridge: Cambridge University Press.
Diekmann, Andreas, 1996: Homo ÖKOnomicus. Anwendungen und Probleme der Theorie rationa-len Handelns im Umweltbereich. S. 89–118 in: Ders. und Carlo C. Jaeger (Hg.), Umweltsoziolo-gie. Sonderheft 36 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen: West-deutscher Verlag.
Diekmann, Andreas, und Peter Preisendörfer, 1998a: Environmental Behavior: Discrepancies betweenAspirations and Reality. Rationality & Society 10: 79–102.
Diekmann, Andreas, und Peter Preisendörfer, 1998b: Umweltbewußtsein und Umweltverhalten inLow- und High-Cost-Situationen. Zeitschrift für Soziologie 27: 438–453.
Diekmann, Andreas, und Peter Preisendörfer, 1998c: Zur scheinbaren Widerlegung der Low-CostHypothese. Kommentar zu Steffen Kühnel und Sebastian Bambergs Untersuchung umweltge-rechten Verkehrsverhaltens. Zeitschrift für Soziologie 27: 271–272.
Diekmann, Andreas, und Peter Preisendörfer, 2001: Umweltsoziologie. Eine Einführung. Reinbek beiHamburg: Rowohlt Taschenbuch.
Edlin, Aaron, Andrew Gelman und Noah Kaplan, 2002: Rational Voting. Unveröffentlichter Konfe-renzbeitrag. Working Paper Archive of the Society for Political Methodology. Download unterhttp://web.polmeth.ufl.edu/papers/02/edlin02.pdf (7.9.2003).
Esser, Hartmut, 1996: Die Definition der Situation. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-chologie 48: 1–34.
Esser, Hartmut, 2001: Soziologie. Spezielle Grundlagen, Band 6: Sinn und Kultur. Frankfurt a.M./New York: Campus.
Esser, Hartmut, 2003: Der Sinn der Modelle. Antwort auf Götz Rohwer. Kölner Zeitschrift für So-ziologie und Sozialpsychologie 55: 359–368.
Friedrichs, Jürgen, und Karl-Dieter Opp, 2002: Rational Behaviour in Everyday Situations. EuropeanSociological Review 18: 401–415.
Green, Donald P., und Ian Shapiro, 1994: Pathologies of Rational Choice Theory. A Critique of Ap-plications in Political Science. New Haven: Yale University Press.
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 705
14 Vgl. z.B. Wood und Doan (2003) für eine quantitative Analyse von Informationseffekten undSchwellenwerten mit Aggregatdaten.
Gusnard, Debra A., und Marcus E. Raichle, 2001: Searching for a Baseline: Functional Imaging andthe Resting Human Brain. Nature Reviews Neuroscience 2: 685–694.
Horne, Christine, 2003: The Internal Enforcement of Norms. European Sociological Review 19:335–343.
Jagodzinski, Wolfgang, 1985: Gibt es einen intergenerationellen Wertewandel zum Postmaterialis-mus? Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 5: 71–88.
Kirchgässner, Gebhard, 1992: Towards a Theory of Low-Cost Decisions. European Journal of Politi-cal Economy 8: 305–320.
Kirchgässner, Gebhard, 1996: Bemerkungen zur Minimalmoral. Zeitschrift für Wirtschafts- und So-zialwissenschaften (ZWS) 116: 223–251.
Kliemt, Hartmut, 1986: The Veil of Insignificance. European Journal of Political Economy 2/3:333–344.
Knudsen, Thorbjørn, 2003: Simon’s Selection Theory: Why Docility Evolves to Breed Successful Al-truism. Journal of Economic Psychology 24: 229–244.
Kühnel, Steffen, und Sebastian Bamberg, 1998: Überzeugungssysteme in einem zweistufigen Modellrationaler Handlungen. Das Beispiel umweltgerechten Verkehrsverhaltens. Zeitschrift für Sozio-logie 27: 256–270.
Lindenberg, Siegwart, 1989: Choice and Culture: The Behavioral Basis of Cultural Impact on Trans-actions. S. 175–228 in: Hans Haferkamp (Hg.), Social Structure and Culture. Berlin: de Gruy-ter.
Lindenberg, Siegwart, 1990: Homo Socio-oeconomicus: The Emergence of a General Model of Manin the Social Sciences. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 146: 727–748.
Meckling, William H., 1976: Values and the Choice of the Model of the Individual in the SocialSciences. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 112: 545–559.
Mensch, Kirsten, 1999: Die segmentierte Gültigkeit von Rational-Choice-Erklärungen. Warum Ra-tional-Choice-Modelle die Wahlbeteiligung nicht erklären können. Opladen: Leske + Budrich.
Mensch, Kirsten, 2000: Niedrigkostensituationen, Hochkostensituationen und andere Situations-typen: Ihre Auswirkungen auf die Möglichkeit von Rational-Choice-Erklärungen. Kölner Zeit-schrift für Soziologie und Sozialpsychologie 52: 246–263.
Oliver, Pamela E., und Gerald Marwell, 2001: Whatever Happened to Critical Mass Theory? A Re-trospective and Assessment. Sociological Theory 19: 292–311.
Olson, Mancur, 1965: The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups.Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Rasmusen, Eric, 1989: Games and Information. An Introduction to Game Theory. 2nd ed. Cam-bridge/Oxford: Blackwell Publishers.
Riker, William H., und Peter C. Ordeshook, 1968: A Theory of the Calculus of Voting. American Po-litical Science Review 62: 25–42.
Rohwer, Götz, 2003: Modelle ohne Akteure. Hartmut Essers Erklärung von Scheidungen. KölnerZeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 55: 340–358.
Samuelson, Paul A., und William D. Nordhaus, 1989: Economics. 13th ed. New York: McGraw-Hill.Schräpler, Jörg-Peter, 2001: Spontaneität oder Reflexion? Die Wahl des Informationsverarbeitungs-
modus in Entscheidungssituationen. Analyse & Kritik 23: 21–42.Simon, Herbert A., 1955: A Behavioral Model of Rational Choice. Quarterly Journal of Economics
69: 99–118.Simon, Herbert A., 1985: Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political
Sience. American Political Science Review 79: 293–304.Simon, Herbert A., 1993: Altruism and Economics. American Economic Review 83: 156–161.Stocké, Volker, 2002: Framing und Rationalität. Die Bedeutung der Informationsdarstellung für das
Entscheidungsverhalten. München: Oldenbourg.Weede, Erich, 1992: Mensch und Gesellschaft. Tübingen: Mohr.Wood, B. Dan, und Alesha Doan, 2003: The Politics of Problem Definition: Applying and Testing
Threshold Models. American Journal of Political Science 47: 640–653.Zintl, Reinhard, 1989: Der Homo Oeconomicus: Ausnahmeerscheinung in jeder Situation oder Je-
dermann in Ausnahmesituationen? Analyse & Kritik 11: 52–69.
706 Markus Quandt und Dieter Ohr
Zintl, Reinhard, 1996: Die Kriterien der Wahlentscheidung in Rational-Choice-Modellen. S. 501–523 in: Hans Rattinger, Oscar W. Gabriel und Wolfgang Jagodzinski (Hg.), Wahlen und politischeEinstellungen im vereinigten Deutschland. 2. unv. Aufl. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Korrespondenzanschriften:Dipl.-Volkswirt Markus Quandt, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität zu
Köln, Postfach 41 09 60, D-50869 KölnE-Mail: [email protected]
Dr. Dieter Ohr, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität zu Köln, Postfach 4109 60, 50869 Köln
E-Mail: [email protected]
Niedrigkostensituationen in der Rational Choice-Modellierung normkonformen Handelns 707

























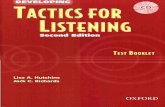









![Û Índice[es ]Instruccion es de uso - BSH CDN Service](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63237c2c117b4414ec0c583b/u-indicees-instruccion-es-de-uso-bsh-cdn-service.jpg)










