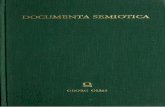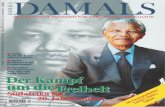Der Himmel auf Erden: Heiligtümer im Alten Ägypten
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Der Himmel auf Erden: Heiligtümer im Alten Ägypten
FORSCHUNGSCLUSTER 4
Heiligtümer: Gestalt und Ritual, Kontinuität und Veränderung
Sanktuar und Ritual Heilige Plätze im archäologischen Befund
Herausgegeben von
Iris Gerlach und Dietrich Raue
VIII, 416 Seiten mit 352 Abbildungen und 2 Tabellen
Titelvignette: S. irwāh. , Άlmaqah-Tempel. Rekonstruktionszeichnung des Vorhofs. Blickrichtung nach Nordwesten. Am nordwestlichen Ende des Vorhofs erstrecken sich weitere Sakralbauten. Zeichnung: DAI, Orient-Abteilung (M. Kinzel)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Iris Gerlach / Dietrich Raue (Hrsg.)Sanktuar und Ritual ; Heilige Plätze im archäologischen Befund. Rahden/Westf.: Leidorf 2013
(Menschen – Kulturen – Traditionen ; ForschungsCluster 4 ; Bd. 10)ISBN 978-3-86757-390-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
Alle Rechte vorbehalten© 2013
Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel
Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.Tel: +49/ (0) 57 71/95 10-74Fax: +49/(0) 57 71/95 10-75
E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de
ISBN 978-3-86757-390-0ISSN 2193-5300
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, BLUERAY, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagentwurf und Standard-Layout: Catrin Gerlach und Jörg Denkinger, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale BerlinRedaktion: Anja Ludwig, Berlin
http://www.dainst.org
Satz, Layout und Bildnachbearbeitung: stm | media GmbH, Köthen/Anhalt
Druck und Produktion: IMPRESS Druckerei Halbritter KG, Halle/Saale
1 s z. B. G. Dreyer, Umm el Qaab 1. Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse, AV 86 (Mainz 1998) Taf. 27; W. S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old King-dom (London 1949) 112 – 123.
2 J. E. Quibell, Hierakonpolis I (London 1900; Nachdruck 1989) Taf. XXV. XXVI a–c; H. Asselberghs, Chaos en beheersing: documen-ten uit aeneolithisch Egypte, Documenta et monumenta orientis antiqui 8 (Leiden 1961) Taf. XCVII–CI.
3 R. Friedman, The Ceremonial Centre at Hierakonpolis Locality HK29A, in: J. A. Spencer (Hrsg.), Aspects of Early Egypt, Papers Presented at the International Colloquium on Early Egypt, Held at the British Mu-seum in July 1993 (London 1996) 16 – 35; R. Friedman, Return to the Temple. Excavations at HK29A, Nekhen News 15, 2003, 4 – 6, Th. Hika-de – G. Pyke – D’A. O’Neill, Excavations at Hierakonpolis HK29B and HK25 – The Campaigns 2005/06, MDAIK 64, 2008, 153 – 188.
4 D. Eigner, Tell Ibrahim Awad. Divine Residence from Dynasty 0 until Dynasty 11, ÄgLev 10, 2000, 17 – 36; D. Eigner, Tell Ibrahim Awad. A Sequence of Temple Buildings from Dynasty 0 to the Middle King-dom, in: Z. Hawass (Hrsg.), Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century. Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists I (Cairo 2003) 162 – 170.
5 Zu Hierakonpolis und Tell Ibrāhīm ʿAwad. s. auch R. Bussmann, Die Provinztempel Ägyptens von der 0. bis zur 11. Dynastie, Probleme der Ägyptologie 30 (Leiden 2010) 42 – 58. 205 – 110. 496 – 498.
6 s. z. B. Smith a. O. (Anm. 1) 122 f. mit Abb. 40. Eine Zusammenstellung der frühen Belege von Götterdarstellungen findet sich bei J. Kahl, Zwei änigmatische Relieffragmente aus Beit Khallaf, in: A. I. Blöbaum – J. Kahl – S. D. Schweitzer (Hrsg.), Ägypten – Münster. Kulturwissen-schaftliche Studien zu Ägypten, dem Vorderen Orient und verwandten Gebieten. Festschrift für Erhart Graefe (Wiesbaden 2003) 160 – 164. Bei den zwei Kolossalstatuen des Gottes Min aus dem Tempel von Kop tos (Oberägypten) handelt es sich um die älteste erhaltene Götterplastik. Sie werden von G. Dreyer ins späte 4. Jt. datiert (Naqada III a), G. Dreyer,
Die Datierung der Min-Statuen aus Koptos, in: Kunst des Alten Reiches. Symposium im Deutschen Archäologischen Institut Kairo am 29. und 30. Oktober 1991, SDAIK 28 (Wiesbaden 1995) 49 – 56.
7 Die älteste inschriftliche Nennung des Horus von Nechen findet sich in den Pyramidentexten des Königs Unas (um 2350 v. Chr.), K. Sethe, Die altägyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums I (Leipzig 1908) § 295 a. b; § 296 a. Die Existenz eines frühen Tempels des Horus in Hierakon-polis wird kontrovers diskutiert, doch lassen die im Tempelbezirk geborgenen Funde (darunter die berühmte Prunkpalette des Kö-nigs Narmer sowie zwei Statuen des Königs Chasechemui) erken-nen, dass dieser Ort seit der 1. Dynastie ein bedeutender Schauplatz von Königs- bzw. Herrschaftsritualen gewesen ist, s. L. McNamara, The Revetted Mound at Hierakonpolis and Early Kingship, in: B. Mi-dant-Reynes – Y. Tristant (Hrsg.), Egypt at Its Origins 2, Orientalia Lo-vaniensia analecta 172 (Leuven 2008) 901 – 936.
8 Aus frühdynastischer Zeit ist nur wenig Reliefmaterial erhalten. Es handelt sich zumeist um Fragmente von Szenen, die den König bei einer Ritualhandlung zeigen oder sich auf eine solche beziehen, Smith a. O. (Anm. 1) 132 – 139; N. Alexanian, Die Reliefdekoration des Chasechemui aus dem sogenannten Fort in Hierakonpolis, in: N. Gri-mal (Hrsg.), Les critères de datation stylistiques à l’Ancien Empire, BdE 120 (Kairo 1998) 1 – 29.
9 K. Jansen-Winkeln, Biographische und religiöse Inschriften der Spätzeit aus dem Ägyptischen Museum Kairo, Ägypten und Altes-Testament 45 (Wiesbaden 2001); J. M. Kruchten, Les annales des prêtres de Karnak (XXI–XXIIImes dynasties) et autres textes contem-porains relatifs à l’initiation des prêtres d’Amon, Orientalia Lovani-ensia analecta 32 (Leuven 1989); K. Jansen-Winkeln, Die Biographie eines Priesters aus Heliopolis, SAK 29, 2001, 97 – 110; B. Haring, Divi-ne Households. Administrative and Economic Aspects of the New Kingdom Royal Memorial Temples in Western Thebes, Egyptologi-sche uitgaven 12 (Leiden 1997).
Der Himmel auf ErdenHeiligtümer im Alten Ägypten
Ute Rummel
Abgegrenzte sakrale Bereiche – Heiligtümer – sind in Ägyp-ten seit vorgeschichtlicher Zeit nachweisbar. Neben frühdy-nastischen Schriftquellen wie Siegelabrollungen oder Anhän-getäfelchen1, in denen Heiligtümer genannt bzw. abgebildet werden, existieren auf einigen Zeremonialkeulenköpfen der ersten Könige Ägyptens auch bildliche Darstellungen von Ritualen und den Orten ihres Vollzugs2. Zwei der ältesten ar-chäologisch nachgewiesenen Sakralbauten Ägyptens sind das oberägyptische Reichsheiligtum (per-wer) in Hierakonpo-lis/Kôm al-Ahmar (Naqada II–III, um 3500 – 3100 v. Chr.)3 und der Tempel von Tell Ibrāhīm ʿAwad. im Delta (älteste fassbare Strukturen Naqada III b, um 3200 v. Chr.)4. Während es sich beim per-wer in Hierakonpolis um eine Holz-Mattenkonstruk-tion handelte, wurde in Tell Ibrāhīm ʿAwad. der bislang ältes-te Lehmziegel-Tempel (Dynastie 0, um 3100 v. Chr.) Ägyptens ausgegraben. Wie anhand der diversen Bauphasen festge-stellt werden konnte, hatte dieser Tempel als Institution bis in das Mittlere Reich (um 2000 v. Chr.) hinein Bestand5.
Bereits in dem vorgeschichtlichen Heiligtum von Hiera-konpolis wird auf Basis der gefundenen Relikte (Tierknochen, Keramikscherben, Flintgeräte) eine Ritualtätigkeit erkennbar.
Die Funde zeugen von einem umfangreichen Opferkult für die dort verehrte Gottheit, von der uns jedoch keine Darstel-lungen vorliegen. Die ältesten anthropomorphen Götterdar-stellungen datieren in die ersten beiden Dynastien und fin-den sich zumeist auf mobilen Bildträgern wie Steingefäßen, Siegelabrollungen, Anhängetäfelchen etc.6. In Hierakonpolis, dem alten Nechen, befand sich der Tempel des falkengestal-tigen Königsgottes Horus, welcher seit der 5. Dynastie als Lokalgott von Nechen belegt ist7. Möglicherweise wurde hier bereits in prädynastischer Zeit eine Falkengottheit verehrt. Nähere Informationen über die theologische Bestimmung eines Heiligtums sind über sein Dekorationsprogramm zu er-halten, das jedoch erst ab dem Alten Reich in entsprechend aussagekräftiger Form vorhanden ist8. Vor allem für das Neue Reich und die nachfolgenden Epochen liegt mit dem Bildpro-gramm der Tempel sowie den zahlreichen religiösen Texten eine große Menge an Quellen vor, die uns Aufschluss über die Mythologie oder das theologische System eines Ortes liefern. Hinzu treten Priesterbiographien und administrative Texte, die zudem über das Tempelpersonal, die wirtschaftliche Ver-sorgung und die Tempelverwaltung Auskunft geben9.
Ute Rummel132
10 Von diesem Ordnungsprinzip zeugen verschiedene kulttopogra-phische Listen wie auf der sog. Chapelle Blanche, einem kleinen Barkenheiligtum des Königs Sesostris I. im Tempel von Karnak, P. Lacau – H. Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak (Kai-ro 1956 – 1969). Eine weitere findet sich im Tempel Ramses’ III. von Medīnet Hābu, The Epigraphic Survey. The University of Chicago, Medinet Habu VII. The Temple Proper 3, OIP 93 (Chicago 1964) Taf. 540 – 555. 558 – 570; s. auch Ch. F. Nims, Another Geographical List from Medinet Habu, JEA 38, 1952, 34 – 45.
11 Heiligtümer wurden nicht nur in den Siedlungen entlang des Niltals angelegt, sondern auch in abgelegenen Wüsten- bzw. Bergbauregi-onen, wie die Hathor-Tempel in Timna und Serābīt. el-H
˘ādim (Sinai)
oder das Heiligtum am Gebel el-Zeit (Rotes Meer). Sie dienten als Kultplatz für die dortigen Minenarbeiter, B. Rothenberg, Researches in the Arabah, 1959 – 1984. 1. The Egyptian Mining Temple at Timna (London 1988); D. Valbelle, Le sanctuaire d’Hathor, maitresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire (Paris 1996); P. Mey – G. Castel – J. C. Goyon, Installations Rupestres du Moyen et du
Nouvel Empire au Gebel Zeit (près de Ras Dib) sur la Mer Rouge, MDAIK 36, 1980, 299 – 318; I. Régen – G. Soukiassian, Gebel El-Zeit 2. Le matériel inscrit. Moyen Empire-Nouvel Empire, FIFAO 57 (Kairo 2008).
12 R. Cottevieille-Giraudet, Rapport sur les fouilles de Médamoud (1930 – 1931). Les monuments du Moyen Empire, FIFAO 9 (Kairo 1933).
13 Satet-Tempel: W. Kaiser – G. Dreyer – G. Grimm, Stadt und Tempel von Elephantine. Fünfter Grabungsbericht, MDAIK 31, 1975, 45 – 51; W. Kaiser – G. Dreyer – R. Gempeler, Stadt und Tempel von Elephan-tine. Sechster Grabungsbericht, MDAIK 32, 1976, 68 – 80. s. auch P. Kopp, »Votive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie« in diesem Band. Chnum-Tempel: M. Bommas, Der Tempel des Chnum der 18. Dynastie auf Elephantine (Dissertation Heidelberg 2000) <http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/3383> (08.01.2012); G. Dreyer – M. Bommas – J. Budka, Stadt und Tempel von Elephantine. 31./32. Grabungsbe-richt, MDAIK 61, 2005, 38 – 57.
Gemäß dem theologischen Ordnungsprinzip, das jedem Gott einen Ort zuweist10, befand sich in jeder Siedlung der Tempel der jeweiligen Ortsgottheit: So waren – um nur eini-ge Beispiele zu nennen – die Göttin Bastet in Bubastis, Ptah in Memphis, Osiris in Abydos, Amun-Re in Theben und Satet auf der Nilinsel Elephantine am ersten Katarakt beheimatet11. An vielen Orten konnte ein Tempel der entsprechenden Lo-kalgottheit auch archäologisch nachgewiesen werden. Nicht überall sind die Überreste so umfangreich und gut erhalten wie in Karnak bei Luxor. Die ausgedehnte Tempelanlage des Amun-Re, Lokalgott von Theben und »König der Götter«, stellt den größten heiligen Bezirk Ägyptens dar (Abb. 1).
Bei vielen Tempelgebäuden, die wir heute in Ägypten vorfinden, handelt es sich um die jüngeren bzw. jüngsten Bauphasen einer Kultstätte, wie z. B. der Month-Tempel in
Medamūd12 oder die Tempel der Satet und des Chnum in Elephantine13. In allen drei Fällen wurden die spätzeitlichen bzw. ptolemäischen Tempelhäuser über den älteren Struktu-ren errichtet. In vielen Tempelbezirken zeugen in großer Zahl geborgene Bauteile von den nicht mehr existenten Vorgän-gerbauten. Diese wurden meist im Zuge des Bauprogramms der nachfolgenden Herrscher abgetragen und im neuen Tempelhaus (oft im Fundament) verbaut, womit sie Teil des Sakralgebäudes blieben. Die frühen Phasen eines Tempels sind an einigen Orten auch archäologisch sehr gut fassbar: In Elephantine, Medamūd oder auch Tell Ibrāhīm ʿAwad. lässt sich die bauliche Entwicklung eines Heiligtums durch die Zeiten hindurch in exemplarischer Weise nachvollziehen. Im Satet-Tempel von Elephantine datiert der älteste Schrein für die Göttin in die 1. Dynastie; hier ließ sich mit der ursprüng-
Abb. 1 Ägypten. Luftbild der Tempelanlage von Karnak bei Luxor. Seit dem Mittleren Reich (um 2100 v. Chr.) lag hier das Hauptheiligtum des Amun-Re, »König der Götter«, welches bis in die frühe römische Kaiserzeit (um 80 n. Chr.) hinein erweitert und umgestaltet wurde. Der Tempel besitzt zwei Achsen: eine von Ost nach West und eine von Nord nach Süd orientierte. Die nach Süden führende Achse stellt eine Verbindung mit dem ca. 3 km entfernt gelegenen Luxor-Tempel her, welcher im Rahmen des jährlichen Opetfestes von der Götterbarkenprozession aus Karnak aufgesucht wurde
Der Himmel auf Erden 133
14 s. Beitrag von P. Kopp, »Votive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie« in die-sem Band.
15 Eine Beschreibung der verschiedenen Tempeltypen findet sich in D. Arnold, Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler (Zürich 1992). s. außerdem Bussmann a. O. (Anm. 5) 115 – 156; G. J. Wightman, Sacred Spaces. Religious Architecture in the Ancient World, AncNearEastSt Suppl. 22 (Leuven 2007) 66 – 143. 964 – 972. Die Terminologie der ägyptischen Sakralarchitektur wurde von K. Konrad, Architektur und Theologie. Pharaonische Tempelter-minologie unter Berücksichtigung königsideologischer Aspekte, Kö-nigtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 5 (Wiesbaden 2006), untersucht.
16 Zu den Bedeutungs- und Funktionsebenen des ägyptischen Tem-pels s. J. Assmann, Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur (Stuttgart 1984) 35 – 50; Arnold a. O. (Anm. 15)
29 – 44; B. E. Shafer (Hrsg.), Temples of Ancient Egypt (London 1997); St. Quirke (Hrsg.), The Temple in Ancient Egypt (London 1997).
17 P. Spencer, The Egyptian Temple. A Lexicographical Study (London 1984) 37 – 55. s. auch M. Bietak, »Götterwohnung und Menschenwoh-nung«. Die Entstehung eines Tempeltyps des Mittleren Reiches aus der zeitgenössischen Wohnarchitektur, in: R. Gundlach – M. Roch-holz (Hrsg.), Ägyptische Tempel – Struktur, Funktion und Programm (Hildesheim 1997) 13 – 22; M. Bietak, Kleine ägyptische Tempel und Wohnhäuser des späten Mittleren Reiches: Zur Genese eines belieb-ten Raumkonzeptes von Tempeln des Neuen Reiches, in: C. Berger el-Naggar (Hrsg.), Hommages à Jean Leclant I (Kairo 1994) 413 – 435.
18 D. O’Connor, The Status of Early Egyptian Temples. An Alternate Theory, Followers of Horus. Studies Dedicated to Michael Allen Hoff-man (Oxford 1992) 83 – 98; St. Seidlmayer, Die staatliche Anlage der 3. Dynastie in der Nordweststadt von Elephantine. Archäologische und historische Probleme, in: Spencer a. O. (Anm. 3) 108 – 117.
lichen Kultstätte in einer natürlichen Felsnische sogar die ›Keimzelle‹ des Tempels feststellen. Auch baugeschichtlich sind die Befunde im Satet-Tempel von großem Interesse, da sich dort der allmähliche Übergang von der Lehmziegel- zur Steinarchitektur fassen ließ. Die ersten in den Lehmziegel-bau integrierten Bauelemente aus Stein konnten hier in den Teilerneuerungen älterer Strukturen nachgewiesen werden, welche durch die Könige Intef II. und Intef III. (11. Dynastie, um 2100 v. Chr.) erfolgten. Das erste vollständig aus Kalkstein gebaute Tempelhaus der Göttin Satet wurde von König Se-sostris I. (12. Dynastie, um 1900 v. Chr.) errichtet.
Die Gestalt eines Heiligtums bzw. Tempels kann durch indivi-duelle Faktoren geprägt sein wie seine Lage ([kult-]topogra-phische Gegebenheiten), die zugrunde liegende Mythologie, die religiösen Traditionen eines Ortes oder die Form des Ri-tualgeschehens. Als besonderes Beispiel sei wiederum das Heiligtum der Kataraktengöttin Satet in Elephantine heran-gezogen. Der Festhof des Tempels Sesostris’ I. weist eine be-sondere Becken- und Rinnenanlage auf, die im Rahmen des Nilfestes für besondere Rituale genutzt wurde. Hier feierte man das Eintreffen der jährlichen Nilflut, deren Quelle mytho-logisch in Elephantine verortet wurde14. Der typische ägyp-tische Tempel, wie er ab dem Neuen Reich vorzufinden ist, besitzt jedoch eine einheitliche architektonische Struktur – auch wenn hier keinesfalls von Gleichförmigkeit gesprochen
werden kann. Typisch ist die Staffelung der Raumeinheiten entlang einer unilinearen Achse, wie am Beispiel des Tempels Ramses’ III. in Medīnet Hābu exemplarisch aufgezeigt werden soll (Abb. 2): Der hohe Eingangspylon gewährt Zugang zu ei-nem offenen Hof, dem ein zweiter Pylon mit angrenzendem Peristylhof folgt. Vom zweiten Hof aus führt eine Rampe zu den erhöht liegenden inneren Räumen, denen eine Portikus vorgeschaltet ist. Es folgen zwei Hypostyle, jeweils mit seitlich gelagerten Kapellen, und schließlich am Ende der Achse das Sanktuar. Um das Tempelhaus herum befinden sich in der Regel Peripheriebauten wie Magazine, Speicher und Verwal-tungseinheiten. Im Gegensatz zum steinernen Tempelhaus sind diese meist in Lehmziegelbauweise ausgeführt15.
Der ägyptische Göttertempel ist der Ort, an dem die Gott-heit wohnt und an dem sie durch die täglichen und zyk-lisch vollzogenen Rituale versorgt wird16. Der Gedanke der Götterwohnung manifestiert sich schon in der ägyptischen Bezeichnung des Tempels als »Haus« der jeweiligen Gott-heit: per-Imen, per-Bastet, »Haus des Amun« bzw. »Haus der Bastet«, oder auch einfach als hut-netjer, »Gotteshaus«17. Der Tempelbezirk ist von einer Umfassungsmauer umschlos-sen, die ihn von seiner Umwelt trennt. Eine Begrenzung des heiligen Raumes ist bereits in den ältesten ägyptischen Kultstätten nachweisbar18. Der sakrale Bereich muss von der Außenwelt abgeschirmt werden, um die Unversehrtheit der
Abb. 2 Ägypten. Der Tempel Ramses’ III. in Medīnet Hābu, Theben-West (M. 1 : 1.000)
Ute Rummel134
19 A. Vauchez, Introduction, in: A. Vauchez (Hrsg.), Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monographiques, CEFR 237 (Rom 2000) 1 – 7; s. auch Wightman a. O. (Anm. 15) 929 – 952.
20 R. Vergnieux, L’organisation de l’espace (I). Du sacré au profane, Bulletin de la Société d’Égyptologie. Genève 13, 1989, 165 – 171; zur »sakralen Hierarchie« innerhalb eines Heiligtums s. Wightman a. O. (Anm. 15) 932 – 952.
21 J. K. Hoffmeier, Sacred in the Vocabulary of Ancient Egypt. The Term d-sr, with Special Reference to Dynasties I–XX, Orbis biblicus et ori-entalis 59 (Freiburg/Schweiz 1985); s. auch J. B. McClain, The Termi-nology of Sacred Space in Ptolemaic Inscriptions from Thebes, in: P. F. Dorman – B. M. Bryan (Hrsg.), Sacred Space and Sacred Func-tion in Ancient Thebes, Studies in Ancient Oriental Civilization 61 (Chicago 2007) 85 – 95.
22 E. Chassinat, Le temple d’Edfou III, Mémoirs publiés par les memb-res de l’Institut français d’archéologie orientale 20 (Kairo 1928) 109; P. Montet, Le rituel de fondation des temples égyptiens, Kêmi. Re-
vue de philologie et d’archéologie égytiennes et coptes XVII, 1964, 74 – 100.
23 Zur Bedeutung heiliger Stätten als »Mittelpunkt der Welt« s. M. Elia-de, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen 3(Frank-furt a. M. 1987) 33 – 40; s. auch R. Bjerre Finnestad, Temples of the Ptolemaic and Roman Periods. Ancient Traditions in New Context, in: B. E. Shafer (Hrsg.), Temples of Ancient Egypt (London 1997) 203 – 226.
24 Arnold a. O. (Anm. 15) 13.25 Vauchez a. O. (Anm. 19) 1 – 7; Wightman a. O. (Anm. 15) 929 – 952.26 N. Alexanian, »Die Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in
Dahšūr/Ägypten« in diesem Band.27 Kruchten a. O. (Anm. 9) passim (s. Index). Das Ach Menu genannte
›Millionenjahrhaus‹ Thutmosis’ III. in Karnak wird z. B. als »Horizont des Himmels« bezeichnet, Kruchten a. O. (Anm. 9) 246. Zur Bedeu-tung des Ach Menu s. P. Barguet, Le temple d’Amon-Rê à Karnak. Es-sai d’exégèse (Kairo 1962; Nachdruck 2006) 283 – 299.
28 Kruchten a. O. (Anm. 9) 59 Zeile 9.
göttlichen Sphäre zu schützen19. Auf diese Weise ergibt sich ein klar definiertes »Innen«, der geordnete Kosmos, und ein davon getrenntes »Außen«, das »Chaos«20. Im Tempel selbst werden wiederum unterschiedliche Zonen des heiligen Raums und damit eine zunehmende Limitierung der Zugäng-lichkeit erkennbar (Abb. 3). Auf das monumentale Pylontor folgt der offene Festhof, die usechet, welcher an den großen Götterfesten nur Angehörigen der sozialen Elite zugänglich war. Das Tempelinnere durfte ausschließlich von der initiier-ten Priesterschaft und dem König selbst betreten werden, wobei das Allerheiligste selbstverständlich den exklusivsten Bereich bildete. Das ägyptische Wort djeser, welches wir mit »heilig« übersetzen, trägt ebenfalls die Notion »abschirmen«, »ausgrenzen«, auch »abwehren« in sich und kann sich auf Dinge, Räume, Gebäude oder auch Landschaften beziehen21.
Die Grenze um das Heiligtum wurde nicht nur baulich definiert, sondern bei der Tempelgründung auch rituell ge-zogen mit dem »Ausstreuen von besen-Gips«. Dieses Rei-nigungsritual dient dem Vertreiben und Ausgrenzen alles Schlechten, das gegen die kosmische Weltordnung Maat verstößt. Nach Fertigstellung des Tempelgebäudes wird die helle, kristalline Substanz des besen um den Tempel gestreut. Der Zweck dieser Handlung wird durch ein Beispiel aus dem Tempel von Edfu deutlich. Dort rezitiert der König dabei fol-genden Ritualtext: »Ich habe dein Haus umstreut, deinen
Thron gereinigt und alles Schlechte entfernt um deinen Tem-pel. Ich habe die Lüge vertrieben in deinem Haus, Herr der Götter (= Horus), und die Klage vernichtet in deinem Tempel (…)«22. Durch das Anlegen der Gipsspur wird gewissermaßen eine Demarkationslinie um den Tempel gezogen, die alles Gefährdende, nicht zur geordneten Welt Gehörige ausgrenzt. Der Tempelneubau selbst wird durch die Reinigung geweiht und in den Kosmos integriert als Mittelpunkt desselben, an welchem die uranfängliche Schöpfung stattfand und sich kontinuierlich wiederholt23.
Aus den ägyptischen Texten geht hervor, dass der Tempel als himmlischer Ort gedacht wurde. Inmitten der profanen Welt stellt er eine »Exklave des Himmels« dar, in welcher die Götter in der Welt anwesend sind24. Er ist der Ort, an dem das Göttliche in die Welt eindringt, und somit die Stelle, an der beide Sphären aufeinandertreffen25. Das gilt für Göttertem-pel ebenso wie für die Pyramidentempel des Alten Reiches bzw. die Pyramidenanlagen in ihrer Gesamtheit: Als Grab- und Kultstätte der göttlichen Herrscher stellen sie ein Sym-bol der Präsenz des Sonnengottes auf Erden dar26. Das Hei-ligtum eines Gottes wird daher generell auch als »Himmel« (pet, heret) oder »Horizont« (achet) bezeichnet27 – ein »Him-mel auf Erden«, wie Karnak z. B. in einer Inschrift des Wesirs Harsiese (um 800 v. Chr.) ausdrücklich genannt wird28. Eine
Abb. 3 Ägypten. Darstellung des Tempels von Karnak im Grab des Neferhotep (TT 49) in Theben-West (Raumzonierung nach Vergnieux a. O. [Anm. 20] 165 – 171)
Der Himmel auf Erden 135
29 Barguet a. O. (Anm. 27) 332 f. Durch die Präsenz des Amun-Re, ma-nifest in seinen monumentalen Tempelbauten, wurde die Stadt Theben in ihrer Gesamtheit als heilig betrachtet und »Himmel/Hori-zont des Amun« genannt, Kruchten a. O. (Anm. 9) 42. 257 f.
30 J. Assmann, Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik, Münchener Universitäts-Schriften. Philo-sophische Fakultät 19 (Berlin 1969) 253 – 255; E. Brovarski, The Doors of Heaven, Or 46, 1977, 107 – 115.
31 Kairo JE 37413, JE 36905; R. El-Sayed, Deux statues de la cachette de Karnak, BIFAO 87, 1987, 172. 178.
32 Assmann a. O. (Anm. 16) 53 – 50; Konrad a. O. (Anm. 15) 16 – 20. Die Umsetzung einer jeweils kulturinternen Vorstellung vom Himmel bzw. vom Kosmos scheint ein wesentlicher Faktor in der Konzeption und Gestaltung von heiligem Raum zu sein. Nach Eliade ist der Tem-pel/das Heiligtum ein Imago Mundi. Als solches »reproduziert es das Universum in seinem Wesentlichen« und stellt zugleich seinen Mittel-punkt dar, s. M. Eliade, Centre du monde, temple, maison, in: R. Bloch (Hrsg.), Le symbolisme cosmique des monuments religieux. Actes de la conférence internationale qui a eu lieu sous les auspices de l’ISMEO à Rome, avril – mai 1955, Serie Orientale Roma XIV (Rom 1957) 75 – 82 ; M. Eliade, Kosmos und Geschichte (Frankfurt 1986) 19 – 32.
33 Daher wurden auch die Tempeltore – wie die Türflügel des Kult-bildschreins – mit den Himmelstoren identifiziert, s. Assmann a. O. (Anm. 30) 153 – 155. 211 mit Anm. 111, 254; Konrad a. O. (Anm. 15) 240 – 243.
34 s. U. Rummel, »Der Tempel im Grab. Die Doppelgrabanlage der Ho-hepriester des Amun Ramsesnacht und Amenophis (K93.11/K93.12) in Drāʿ Abū el-Nagā/Theben-West«, Abb. 8, in diesem Band.
35 An der Decke können auch astronomische Vorgänge abgebildet sein wie im Tempel Ramses’ II. in Theben-West, A. A. Sadek, Le pla-fond astronomique du Ramesseum, Memnonia 1, 1990, 135 – 141, oder im Hathor-Tempel von Dendera, S. Cauville, Le zodiaque d’Osiris (Leuven 1997); Ch. Leitz, Die Sternbilder auf dem rechtecki-gen und runden Tierkreis von Dendara, SAK 34, 2006, 285 – 318.
36 J. P. Allen, The Cosmology of the Pyramid Texts, Yale Egyptological Seminar 3 (New Haven 1989) 1 – 28.
37 M. Shaltout – J. A. Belmonte Avilés – M. Shaltrut – M. M. Fekri, The Ancient Egyptian Monuments and their Relation to the Position of the Sun, Stars, and Planets, in: Kh. Daoud – S. Abd el-Fatah (Hrsg.), The World of Ancient Egypt. Essays in Honor of Ahmed Abd el-Qa-der el-Sawi, ASAE 35, 2006, 93 – 112.
38 L. Gabolde, Canope et les orientations nord-sud de Karnak établies par Thoutmosis III, RdE 50, 1999, 278 – 282 ; L. Gabolde, Mise au point sur l’orientation du temple d’Amon-Rê à Karnak en direction du le-ver du soleil au solstice d’hiver, Cahiers de Karnak 13, 2010, 243 – 256.
39 Barguet a. O. (Anm. 27) 336 – 340.40 Zum täglichen Kultbildritual s. R. David, Religious Ritual at Abydos
(Warminster 1973); Assmann a. O. (Anm. 16) 50 – 65.
Inschrift der Königin Hatschepsut auf einem ihrer Obelisken beschreibt den Amun-Tempel als »Horizont auf Erden, erha-bener Hügel des ersten Males«29. Die Termini »Horizont« und »Himmel« können sich auf den gesamten Tempel beziehen, aber auch speziell das Sanktuar bzw. den Kultbildschrein benennen. So fungierten die Priester, welche die Kultbild-schreine für das tägliche Ritual öffneten, als »Öffner der Tür-flügel des Himmels«30. Im Text der Statue des Amun-Priesters Nebnetjeru richtet dieser seinen Opferaufruf an alle Priester, »die in den Himmel (= das Sanktuar) eintreten«. Der Priester Month-em-mehit wendet sich in seinem Aufruf an alle Pries-ter, »die ein- und ausgehen im Horizont«, und bezeichnet sich als einen, »der die verborgene Gestalt des Horizontes (= das Kultbild in seinem Schrein) schaut«31.
Der elaborierte ägyptische Tempelbau ist in seiner Ge-samtkonzeption ein Abbild des Kosmos32. Dies spiegelt sich zunächst in seiner Architektur wider: Den Zugang zum Tem-pelbezirk bildet der große Eingangspylon, das Horizonttor, als Ein- bzw. Austrittspunkt der Sonne33. Die Säulen stellen ent-weder Pflanzen dar wie Papyrus (Abb. 4) oder Lotus oder bil-den in ihrem Kapitell die Himmelsgöttin Hathor ab34. Das von den Säulen getragene Dach repräsentiert den Himmel, wie aus der Deckendekoration der inneren Räume hervorgeht: goldene Sterne auf blauem Grund35. Die Ebenen des Tempels steigen an, je weiter man ins Innere vordringt. Das Allerhei-ligste liegt somit auf dem Urhügel, der sog. Stätte des Ersten Males, dem Ursprung jeglicher Schöpfung. Die Säulen ragen wie überdimensionale Pflanzen aus dem Urgewässer, das den Urhügel umgibt. In diesem mythischen Raum bewegen sich die Götter auf Barken fort. Auch der Himmel wird, wie es schon die Pyramidentexte (um 2350 v. Chr.) offenbaren, seit frühester Zeit als Gewässer gedacht, auf dem sich der Son-nengott in seinem Boot fortbewegt36. Wie zahlreiche Tem-peldarstellungen zeigen, steht der Kultbildschrein zumeist auf einer Barke (Abb. 5). Der Gedanke der Fortbewegung auf dem Ur- bzw. Himmelsgewässer setzt sich auch in den religi-ösen Festen fort, anlässlich derer die Götterbarken von den Priestern in Prozessionen aus dem Tempel getragen werden.
Der Orientierung des Tempelgebäudes bzw. seiner Prozessionsachse(n) liegen ebenfalls kosmische Vorgän-ge zugrunde, wie der Lauf der Sonne, des Mondes oder der Gestirne37. So ist die Hauptachse des Amun-Tempels von Karnak (Ost-West) auf den Punkt des Sonnenaufgangs der Wintersonnenwende zur Zeit König Intefs II. (um 2100 v. Chr.) ausgerichtet, die Nord-Südachse auf den Untergang des Canopus-Gestirns, das mit Osiris identifiziert wurde38. In die-sen zwei Achsen kommen der solare Tages- und der osiriani-sche Nachtaspekt des Amun-Re – und damit der vollendete Sonnenzyklus – zum Tragen, die im Tempel rituell nachvoll-zogen werden39. Analog zur zyklischen Erneuerung der Him-melskörper durchlaufen auch die Götter vermittels der Ritu-alhandlungen (wie Räuchern und Libieren, Kleiden, Speisen und Salben des Kultbildes) einen Regenerationsprozess40. Das tägliche Kultbildritual wie auch die periodisch wieder-holten, einem Festkalender folgenden Rituale zielten auf die Aufrechterhaltung des Kosmos. Ohne die kontinuierliche
Abb. 4 Ägypten. Papyruskapitell in der Säulenhalle des Ramesseums, dem ›Millionenjahrhaus‹ Ramses’ II. in Theben-West
Ute Rummel136
41 J. Assmann, Der König als Sonnenpriester. Ein kosmographischer Begleittext zur kultischen Sonnenhymnik in thebanischen Tempeln und Gräbern, ADAIK 7 (Glückstadt 1970) 58 – 70; J. Assmann, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten (München 1990) 201 – 236.
42 Zur Initiation der Amun-Priesterschaft s. Kruchten a. O. (Anm. 9).43 A. Schlüter, Sakrale Architektur im Flachbild. Zum Realitätsbezug
von Tempeldarstellungen, Ägypten und Altes Testament 78 (Wies-baden 2009) 452 – 454 (Zitat S. 452); s. auch J. Assmann, Das ägyp-tische Prozessionsfest, in: J. Assmann – Th. Sundermeier (Hrsg.), Das Fest und das Heilige. Religiöse Kontrapunkte zur Alltagswelt, Studi-en zum Verstehen fremder Religionen 1 (Gütersloh 1991) 105 – 122.
44 Assmann a. O. (Anm. 16) 39 – 43. Zur Raumorganisation von Heiligtü-mern s. Wightman a. O. (Anm. 15) 959 – 972.
45 s. z. B. M. Ullmann, Thebes. Origins of a Ritual Landscape, in: Dorman – Bryan a. O. (Anm. 21) 3 – 25. Zu Abydos s. die Beiträge von A. Eff-land, »›Bis auf den heutigen Tag begab sich kein Mensch mehr auf den Hügel von Abydos um zu opfern‹ – Zum Ende der Kulthand-lungen in Umm el-Qaʿāb« und U. Effland, »Das Grab des Gottes Osi-ris in Umm el-Qaʿāb/Abydos« in diesem Band. Die monumentalen Pyramidenanlagen der 4. Dynastie in Dahšūr sind ebenfalls konsti-tuierendes Element einer sakralen Landschaft, s. N. Alexanian, »Die Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in Dahšūr/Ägypten« in diesem Band.
rituelle »Inganghaltung der Welt« würde diese zurück ins un-geordnete Chaos fallen41. Die Maat aufrechtzuerhalten, war die Aufgabe des göttlichen Herrschers, der somit ein festes und notwendiges Element dieser kosmischen Weltordnung ausmachte. Daher erscheint in den Tempeldarstellungen auch nur der König selbst als Ritualaktant, da er der Stellver-treter des Sonnengottes auf Erden ist. Die tatsächliche Aus-übung des Kultes in den zahlreichen Tempeln des Landes erfolgte durch Priester, welche durch Initiation befähigt und ermächtigt wurden, in den sakralen Bereich einzudringen und an der Stelle des Königs zu handeln42.
Der altägyptische Tempel war kein Versammlungsraum für eine gläubige Gemeinde. Der Zutritt zum »Innen« war streng limitiert, und nur Reine bzw. Initiierte, wie der göttliche Herr-scher selbst, durften es betreten. Selbst der öffentliche Be-reich des Festhofes war lediglich einem exklusiven Perso-nenkreis zugänglich. Die Götter erschienen dem einfachen
Menschen einzig im Rahmen von Festprozessionen, anlässlich derer sie die Tempel verließen und »sich die Grenze zwischen Verschlossenem, Verborgenem und Geheimem (…) und der ägyptischen Bevölkerung für eine kurze Zeit aufhob«43. Das religiöse Phänomen des Prozessionsfestes hat die Tempelar-chitektur wesentlich geformt. Der unilineare Grundriss, die Aneinanderreihung von Pylonen bzw. Tordurchgängen, Ram-pen, Prozessionsstraßen und Statuenalleen sowie die damit verbundenen Stationsheiligtümer betonen den Aspekt der Fortbewegung bzw. des Dahinziehens44. Durch den Auszug der raumgreifenden Götterprozession aus dem eigentlichen Tempelbezirk wird ein Teil der Außenwelt in den Ritualraum integriert. Verbindungswege und -kanäle, aber auch Sicht-achsen oder religiöse/rituelle Bezüge definieren eine sakrale Landschaft, wie sie an verschiedenen Orten Ägyptens greif-bar ist. Zwei herausragende Beispiele sind Theben und Aby-dos, wo jeweils besondere lokale Fest traditionen existierten45. Beide Orte verdeutlichen exemplarisch, dass »heiliger Raum«
Abb. 5 Ägypten. Götterbarke des Amun-Re im zentralen Barkensanktuar des Sethos-Tempels in Qurna. Die Widderköpfe an Bug und Heck bilden das heilige Tier des Amun-Re ab. Die Barke ruht auf einem Sockel, vor dem sich verschiedene Opferständer mit Spendenkannen befinden. Das Götterbild selbst ist in dem Schrein an Deck der Barke verborgen
Der Himmel auf Erden 137
46 T. Hölscher hat dies am Beispiel von Olympia aufgezeigt: T. Höl-scher, Rituelle Räume und politische Denkmäler im Heiligtum von Olympia, in: H. Kyrieleis (Hrsg.), Olympia 1875 – 2000. 125 Jahre deut-sche Ausgrabungen (Mainz 2002) 331 – 345.
47 W. Guglielmi, Die Funktion von Tempeleingang und Gegentempel als Gebetsort. Zur Deutung einiger Widder- und Gansstelen des Amun, in: Gundlach – Rochholz a. O. (Anm. 17) 55 – 68; A. Cabrol, Les voies processionnelles de Thèbes, Orientalia Lovaniensia analec-ta 97 (Leuven 2001) 720 – 732.
48 Für eine Zusammenstellung dieser Art von Kultbildern s. P. Brand, Veils, Votives and Marginalia. The Use of Sacred Space at Karnak and Luxor, in: Dorman – Bryan a. O. (Anm. 21) 59 – 83. In Karnak zeugen außerdem zahlreiche Graffiti meist niederer Tempelbediensteter von einer privaten Religionsausübung (der sog. persönlichen Fröm-migkeit), C. Traunecker, Manifestations de piété personnelle à Kar-nak, BSFE 85, 1977, 22 – 31. Äußerungen volkstümlicher Religion sind natürlich nicht auf den thebanischen Raum beschränkt, sondern finden sich in vielen, zumal den bedeutenden Tempeln Ägyptens wie z. B. im Heiligtum des Ptah von Memphis oder am Tempel des großen Sphinx in Giza, s. A. I. Sadek, Popular Religion in Egypt du-ring the New Kingdom, Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 27
(Hildesheim 1987) 11 – 44; Ch. Zivie, Giza au deuxième millénaire, BdE 70 (Kairo 1976) 252 – 256; Guglielmi a. O. (Anm. 47) 55 – 59.
49 Barguet a. O. (Anm. 27) 219 – 242; Ch. F. Nims, The Eastern Temple at Karnak, Festschrift H. Ricke, Beiträge zur ägyptischen Bauforschung und Altertumskunde 12 (Wiesbaden 1971) 107 – 111; Guglielmi a. O. (Anm. 47) 59 f. 65 – 68.
50 Auf zahlreichen Votivstelen aus Memphis ist ein »Ptah, der die Ge-bete/Bitten erhört« belegt, Sadek a. O. (Anm. 48) 16 – 20.
51 z. B. G. Pinch, Votive Offerings to Hathor (Oxord 1993); J. Baines, So-ciety, Morality, and Religious Practice, in: B. E. Shafer (Hrsg.), Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths, and Personal Practice (London 1991) 123 – 200. Zu den Weihegaben im Satet-Tempel von Elephantine s. den Beitrag von P. Kopp, »Votive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie« in die-sem Band.
52 J. Baines, Temples as Symbols, Guarantors, and Participants in Egyp-tian Civilization, in: Quirke a. O. (Anm. 16) 218.
53 Baines a. O. (Anm. 52) 216 – 219.54 Assmann a. O. (Anm. 16) 50. Vgl. auch Baines a. O. (Anm. 52)
216 – 241.
nicht unbedingt baulich, d. h. durch Architektur definiert sein muss. Er wird auch durch das theologische System eines Or-tes konstruiert, genauer: durch das durchdringende, vernet-zende Moment seiner religiösen Praxis46.
Die Festprozessionen boten den einfachen Menschen die Gelegenheit, mit den vorübergehend sichtbaren Göttern zu kommunizieren. Generell konnte die persönliche Religi-onsausübung im bzw. am Tempel nur an den öffentlich zu-gänglichen Stellen stattfinden wie an den Prozessionswegen der Götterbarken, den Statuen vor dem ersten Pylon, am Tor selbst, im ersten Hof oder außen an der Umfassungsmauer47. An verschiedenen Stellen wie der Außenmauer von Karnak oder dem östlichen Tor des ›Millionenjahrhauses‹ Ramses’ III. in Medīnet Hābu können sogar einzelne Götterbilder identi-fiziert werden, die als Fokus einer volkstümlichen Verehrung gedient haben48. Ein besonderes Beispiel einer volksreligiö-sen Gebetsstätte ist der ›temple adossé‹ in Karnak49. Dieser kleine Gegentempel, der unmittelbar östlich des Zentralhei-ligtums außen an die Umfassungsmauer anschließt, war als »Stätte des hörenden Ohres« dem »Amun, der die Gebete erhört« gewidmet. Der Name dieses Platzes und der dort ver-ehrten Form des Amun-Re offenbart die Hoffnung der Men-schen, dass der Gott ihre Gebete und Bitten erhören möge50. Im ›temple adossé‹ und in vielen anderen Heiligtümern zeu-gen zudem Votivgaben von einer volksreligiösen Nutzung des Ortes. Es handelt sich dabei um Weihegaben, die als Aus-druck des persönlichen Anliegens im Tempelbezirk niederge-legt wurden51.
Auch wenn die großen Tempel für die einfache Bevölkerung verschlossen blieben, waren sie dennoch ein wichtiger Teil
der Wahrnehmungswelt des Individuums. Sie dienten als Ori-entierungspunkt im Alltag, als »visions of an ideal wholeness and perfection«52, da sich in ihnen der idealisierte Kosmos manifestierte. Als Modell einer vollkommenen, göttlichen Welt bildeten sie die hoffnungstragende Konstante in der täglichen und zumeist beschwerlichen Lebenswirklichkeit der Menschen53. Jan Assmann hat die Bedeutung des Tem-pels als Materialisierung und somit Träger der ägyptischen Kultur beschrieben und resümiert: »Im ägyptischen Tempel objektiviert sich kulturelles Gedächtnis, ein halb mythisches, halb historisches Bewußtsein von der ungeheuren Vergan-genheit der Kultur. (…) Er ist nicht nur im räumlichen, son-dern auch im zeitlichen Sinne ein Bild des Kosmos«54.
Abbildungsnachweis
Abb. 1: Foto DAIK (D. Polz). – Abb. 2: nach W. J. Murnane, United with Eternity. A Concise Guide to the Monuments of Medinet Habu (Chi-cago – Kairo 1980) 8 Abb. 5 (Courtesy of the Oriental Institute of the University of Chicago). – Abb. 3: nach N. de G. Davies, The Tomb of Nefer-hotep at Thebes, Publications of the Metropolitan Museum of Art. Egyptian Expedition 9 (New York 1933) Taf. 41. – Abb. 4: Foto DAIK (S. Michels). – Abb. 5: Foto DAIK (U. Rummel).
Anschrift der Autorin
Dr. Ute RummelDeutsches Archäologisches InstitutAbteilung Kairo31, Sharia Abu el-Feda11211 Kairo, ZamalekÄ[email protected]
Inhaltsverzeichnis
Hans-Joachim GehrkeEinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wolf-Dietrich NiemeierForschungsfeld 1: Kontinuität und Wandel an Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Volkmar von GraeveDas Aphrodite-Heiligtum von Milet und seine Weihegaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arnd Hennemeyer Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Helmut KyrieleisMythos und Politik. Zur Deutung des plastischen Bildschmucks des Zeus-Tempels von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wolf-Dietrich Niemeier Kultkontinuität von der Bronzezeit bis zur römischen Kaiserzeit im Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai (Kalapodi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nils HellnerKalapodi. Neue Kriterien einer Typologie der dorischen Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Anja SlawischDidyma. Untersuchungen zur sakralen Topographie und baulichen Entwicklung des Kernheiligtums vom 8.–4. Jh. v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stefan LehmannForschungsfeld 2: Ende und Nachleben von Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Christoph B. Konrad – Dorothée SackDie Wiederverwendung von Baugliedern in der Pilgerkirche (Basilika A) und in der Großen Moschee von Resafa-Sergiupolis/Rus.āfat Hišām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Andreas Effland»Bis auf den heutigen Tag begab sich kein Mensch mehr auf den Hügel von Abydos um zu opfern« – Zum Ende der Kulthandlungen in Umm el-Qaʿāb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dietrich RaueHeliopolis – eine Hierapolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Stephan Lehmann – Andreas GutsfeldSpolien und Spoliarisation im spätantiken Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Nils Hellner – Nicole Alexanian – Claudia Bührig – Ute Rummel – Detlev Wannagat – Mike SchnelleForschungsfeld 3: Gestalteter Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Christina LeypoldDie Statuenbasen im Zeus-Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Stefan M. MaulDas Haus des Götterkönigs. Überlegungen zur Konzeption überregionaler Heiligtümer im Alten Orient . . . . . . . . . . . . . 125
Ute RummelDer Himmel auf Erden. Heiligtümer im Alten Ägypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Claudia BührigDas Theater-Tempel-Areal von Gadara. Konzeption und Wandel des gestalteten Raumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
VI Inhaltsverzeichnis
Nicole AlexanianDie Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in Dahšur/Ägypten. Einführende Bemerkungen zum Grabungsplatz von Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Rüdiger GogräfeIsriye (It-rīah)-Seriana. Bemerkungen zur Raumfunktion eines severischen Tempels in Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sophie HelasPunische Heiligtümer in Selinunt. Architektonische Gestaltung und religiöse Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Margarete van EssGestaltung religiöser Architektur in Babylonien. Das Beispiel des Eanna-Heiligtums in Uruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Iris Gerlach – Mike SchnelleSabäische Sakralarchitektur in Südarabien (Jemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ute RummelDer Tempel im Grab. Die Doppelgrabanlage der Hohenpriester Ramsesnacht und Amenophis (K93.11/K93.12) in Drāʿ Abū el-Nagā/Theben-West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Klaus SchmidtDie Gestaltung des sakralen Raums im Frühneolithikum Obermesopotamiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Iris Gerlach – Gunvor Lindström - Dietrich RaueForschungsfeld 4: Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Ulrich DemmerText, Drama und performativer Diskurs. Ethnologische Ritualtheorien der Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Thomas Schattner – Gabriel ZuchtriegelMiniaturisierte Weihgaben: Probleme der Interpretation. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Jan Breder, Julia Budka, Frauke Donner, Ute Effland, Piet Kopp, Gunvor Lindström, Oliver Pilz, Dietrich Raue und Michael Wörrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Gunvor Lindström – Oliver PilzVotivspektren. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Ute Effland, Andreas Effland, Heide Frielinghaus, Iris Gerlach, Piet Kopp, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Martin Bentz – Helga BumkeMahlzeiten in rituellen Kontexten. Basierend auf den Projektdarstellungen von Martin Bentz, Helga Bumke, Ute Effland, Iris Gerlach, Achim Heiden, Ivonne Kaiser, Norbert Nebes, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . 275
Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen Heiligtum von Milet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen (SH III A) bis früheisenzeitlichen (SG) Heiligtum von Kalapodi . . . . . . . . . . . 295
Gunvor LindströmBaktrien – Votive und Votivpraxis in den hellenistischen und kuschanzeitlichen Heiligtümern (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Piet KoppVotive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Ute EfflandDas Grab des Gottes Osiris in Umm el-Qa āʿb/Abydos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Nicole AlexanianSpektrum und Veränderung der Funde aus den Tempeln des Snofru in Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Inhaltsverzeichnis VII
Helga BumkeDer archaische Heiligtumsbefund vom ›Taxiarchishügel‹ in Didyma und sein Zeugniswert für die Rekonstruktion ›ritueller Mahlzeiten‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Oliver Pilz – Michael KrummeDas Heiligtum von Kako Plaï auf dem Anavlochos (Kreta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Martin BentzAttisch rotfigurige Keramik aus Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Susanne BocherAspekte früher Ritualpraxis anhand des geometrischen Votivspektrums im Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Heide FrielinghausBeobachtungen zum Votivspektrum Olympias in archaischer und nacharchaischer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Joachim HeidenDas Artemis-Heiligtum in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Svend HansenBronzezeitliche Deponierungen in Europa nördlich der Alpen. Weihgaben ohne Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Gabriel ZuchtriegelEisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Thomas SchattnerDie Romanisierung einheimischer Heiligtümer im Westen der Iberischen Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung von Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393