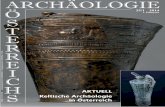\"Die Assassinen sollen aus Ägypten stammen\"
-
Upload
tu-dresden -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of \"Die Assassinen sollen aus Ägypten stammen\"
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 1
C A U
Die Assassinen
sollen aus Ägypten stammen
Diskursivierung von Wissen an der Wende zur Neuzeit
am Beispiel des Bundes der Assassinen
Internationale Fachtagung Unbegreifliches greifbar machen. Sondersprachenforschung im
Spannungsfeld zwischen Arkanem und Profanem.
Karl-Franzens-Universität Graz. 17. bis 20. November 2010.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 2
C A U
Gliederung
1. Linguistik des Arkanen Versuch einer Gegenstandsbestimmung Methodische Vorüberlegungen
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen Ausgewählte Quellen Der Bund der Assassinen in den ausgewählten Darstellungen
3. Das Sprechen über Minoritäten und deren Arkana Modellierung des Prozesses der Diskursivierung
4. Fazit
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 3
C A U
1. Linguistik des Arkanen. Versuch einer Gegenstandsbestimmung
Das ‚Arkanum‘
von lat. arcanus, urspr. ‚verschlossen‘, übertr. 1) ‚verschwiegen‘, 2) ‚geheim‘, ‚heimlich‘. Als Substantiv arcanum das ‚Geheimnisvolle‘, ‚Geheimnis‘, als Adverb ‚im Geheimen‘, ‚heimlich‘. (Georges-LDHW I, 540)
Arkane (Sonder-)Sprachen
„Ziel der Tagung ist, aktuelle Arbeiten und Forschungsergebnisse der Sondersprachenforschung mit ‚arkanlinguistischem‘ Bezug zusammenzuführen, sie kritisch zu diskutieren und zu hinterfragen und durch diese Bündelung explizit eine Linguistik des Arkanen zu konturieren, die über jenen von Gerhard Eis für die Sprache der Alchemie geprägten Begriff der Arkanlinguistik hinausgeht. Hierzu wird der Gegenstandsbereich bewusst weit gefasst. Im Interesse stehen all jene Gruppensprachen, deren Teilhaber einerseits gesellschaftliche Abgrenzung wünschen oder Diskretion suchen und/oder sich andererseits mit einem Mysterium in der einen oder anderen Form konfrontiert sehen.“ (Braun, Tagungsexposé).
Sprechen über Minoritäten und deren Arkana
Die diskursive Auseinandersetzung mit Geheimbünden, der Alchemie, der religiösen Kommunikation (?!), der Magie und des Mysteriums (siehe Tagungsexposé) fasst nicht nur die arkane Sprache einer Minorität an, sondern erfasst die Minorität kommunikativ als Ganzes in ihrer Distanz zur Majorität.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 4
C A U
1. Linguistik des Arkanen. Methodische Vorüberlegungen
Sprechen über Minoritäten und deren Arkana
Arkan sind u.a. Dinge, Wissen, Sprache, Handlungen, Räume und Zeiten, Riten etc., die als komplexe Zeichen
• von einer Minorität hinsichtlich des Form-Bedeutungszusammenhangs arkan (d.i. verschlossen) erhalten werden (damit nicht verfügbar sind) und/oder die
• von einer nicht eingeweihten Majorität, die das Zeichen nur sekundär (z.B. aus Berichten) oder nur in seiner Form wahrnimmt, aber nicht über den Zusammenhang von Form und Bedeutung verfügt, als arkan bewertet werden.
Es sind also nicht die Dinge, das Wissen, die Handlungen, Räume und Zeiten, Riten etc., die selbst (wesenhaft) arkan sind, sondern sie werden dies erst durch die Zuweisung durch eine (eingeweihte) Minorität bzw. von außen durch eine (nichteingeweihte) Majorität. Das Arkane kann also viele Formen haben, das Wesen ist jedoch seine (zugewiesene) Exklusivität, die kommunikativ verhandelt wird.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 5
C A U
1. Linguistik des Arkanen. Methodische Vorüberlegungen
Transtextuelle Ebene
Diskursorientierte Analyse Intertextualität, Schemata, diskurssemantische Grundfiguren, Topoi, Sozialsymbolik, Indexikalische Ordnungen, Historizität, Ideologien / Mentalitäten, allgemeine gesellschaftliche und politische Debatten
Akteure Diskursprägung Interaktionsrollen Autor, antizipierte Adressaten
Diskurspositionen Soziale Stratifizierung / Macht, Diskursgemeinschaften, Ideology Brokers, Voice, Vertikalitötsstatus
Diskursregeln Medialität Medium, Kommunikationsformen, Kommunikationsbereiche, Textmuster
Intratextuelle Ebene
Textorientierte Analyse Visuelle Textstruktur Layout / Design, Typographie, Text-Bild-Beziehungen, Materialität / Textträger
Makrostruktur: Textthema Lexikalische Felder, Metaphernfelder, lexikalische Oppositionslinien, Themenentfaltung, Textstrategien / Textfunktionen, Textsorte
Mesostruktur: Themen in Teiltexten
Propositionsorientierte Analyse
Mikrostruktur: Propositionen
Syntax, rhetorische Figuren, Metaphernlexeme, soziale, expressive, deontische Bedeutung, Päsuppositionen, Implikaturen, Sprechakte
Wortorientierte Analyse Mehr-Wort-Einheiten Schlüsselwörter, Stigmawörter, Namen, Ad-hoc-Bildungen
Ein-Wort-Einheiten
DIMEAN (=Diskursanalytische Mehrebenenanalyse) nach Warnke & Spitzmüller 2008: 44.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 6
C A U
1. Linguistik des Arkanen. Methodische Vorüberlegungen
Exploration, Transfer und Diskursivierung von Wissen
Ausgehend von DIMEAN sind Transfer- und Diskursivierungsleistungen auf der transtextuellen Ebene und der Ebene der Akteure eines Diskurses zu beschreiben. Die Scheidung ist eine analytische.
• Exploration von Wissen
• Transfer von Wissen
• Diskursivierung von Wissen
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 7
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Ausgewählte Quellen
Berichte von Gerard, Wilhelm von Tyrus, Arnold von Lübeck Ende des 12. Jahrhunderts. Hie hebt sich an das puch des edeln Ritters vnd landtfarers Marcho Polo, in dem er schreibt die grossen wunderlichen ding dieser welt. Übers. aus dem Ital. Nürnberg 1477. Bartholomé d‘Herbelot. 1697. Bibliothèque orientale. Art. Assassinier. In: Johann Heinrich Zedler. 1732-1751. Großes und vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Leipzig, Halle: Zedler, Bd. 2, Sp. 1894-1896. Joh. Phil. Lorenz Withof. 1765. Das meuchelmoerderische Reich der Assassinen. Cleve: Hoffmann. Silvestre de Sacy. 1818. Mémoire sur la Dynastie des Assassins. In: Mémoires de l‘Institut Royal 4, 1ff. Zuerst vorgelegt 1809. Joseph von Hammer. 1818. Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen. Stuttgart, Tübingen: Cotta. Weitere Quellen: Lexikoneinträge aus dem Brockhaus Conversations-Lexikon 1809 und 1838, dem Damen Conversations Lexikon von 1834, Herders Conversations-Lexikon von 1854, Pierer's Universal-Lexikon von 1857
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 8
C A U
Gerard, Wilhelm von Tyrus, Arnold von Lübeck u.a.
Hie hebt sich an das puch des edeln Ritters vnd landtfarers Marcho Polo, in dem er schreibt die
grossen wunderlichen ding dieser welt. Nürnberg 1477.
Bartholomé d‘Herbelot. 1697. Bibliothèque
orientale.
Joh. Phil. Lorenz Withof. 1765. Das meuchelmoerderische Reich der
Assassinen. Cleve: Hoffmann.
Silvestre de Sacy. 1818. Mémoire sur la Dynastie des Assassins. In: Mémoires de l‘Institut Royal 4,
1ff. Zuerst vorgelegt 1809.
Joseph von Hammer. 1818. Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen.
Stuttgart, Tübingen: Cotta.
Art. Assassinier. In: Johann Heinrich Zedler. 1732-1751. Großes und
vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Leipzig, Halle: Zedler,
Bd. 2, Sp. 1894-1896.
Brockhaus Conversations-Lexikon 1809 und 1838, Damen Conversations Lexikon
von 1834, Herders Conversations-Lexikon von 1854, Pierer's Universal-Lexikon von
1857.
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Ausgewählte Quellen
Transfer: Initiierung, Fluss & Integration
Transfer: Initiierung, Fluss & Integration
Exploration Exploration
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 9
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Bericht von Gerard (Gesandter Ks. Friedrich Barbarossas, 1175) „*…+ ein gewisses Geschlecht der Sarazenen wohnt, die in ihrer eigenen Sprache ‚Heyssessini‘, im Romanischen aber ‚segnors de montana‘ genannt werden. Diese Menschenbrut lebt ohne Gesetz, verzerrt Schweinefleisch *…+ und verkehrt unterschiedslos mit allen Weibern, die eigenen Mütter und Schwestern eingeschlossen. *…+ Sie gehorchen einem Meister, der alle sarazenischen Fürsten nah und fern in größte Furcht versetzt, ebenso alle christlichen Landesherren. Denn er pflegt auf ungewöhnliche Art und Weise zu töten. Seine Methode ist die folgende: Dieser Herrscher besitzt in den Bergen zahlreiche prächtige Paläste, umgeben von sehr hohen Mauern, die man lediglich durch eine kleine, sehr gut bewachte Tür betreten kann.“ Erziehung und Bildung („Latein, Griechisch, Romanisch, Sarazenisch und andere mehr“) von Jungen aus dem Herrschaftsgebiet, Indoktrination und Einschwörung auf die Gemeinschaft und den Alten zum unbedingten Gehorsam „bis sie vor den Herrscher gerufen werden, um jemanden zu töten. *...+ Auf das Gelöbnis hin überreicht der Herrscher jedem von ihnen einen goldenen Dolch und sendet sie aus, den Fürsten zu töten, den er für jeden von ihnen ausersehen hat.“ (zitiert in Arnold von Lübecks Chronicon Slavorum VII, 8. Übers. bei Lewis 2001, 17).
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 10
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Wilhelm von Tyrus. 1168-1184/1186. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. „Das Band der Ergebenheit und des Gehorsams, das dieses Volk mit seinem Anführer *dem ‚Alten‘+ verbindet, ist so stark, daß es keine Aufgabe gibt *…+, die nicht jeder von ihnen mit größtem Eifer übernehmen würde, sobald der Anführer es befohlen hat. Gibt es zum Beispiel einen Fürsten, der Haß oder Mißtrauen dieses Volkes auf sich gezogen hat, so überreicht der Anführer einem oder mehreren seiner Gefolgsleute einen Dolch. Wer immer den Befehl erhält, begibt sich sofort auf den Weg, um seine Mission auszuführen. Er bedenkt weder die Folgen der Tat noch die Möglichkeit des Entkommens. Begierig, seine Aufgabe zu erfüllen, setzt er so lange wie nötig alle seine Kräfte ein, bis das Schicksal ihm die Gelegenheit gibt, den Befehl seines Anführers zu vollstrecken. Wir wie auch die Sarazenen nennen dieses Volk ‚Assassinen‘; aber die Herkunft dieses Namens kennen wir nicht.“ (XX,31. Übers. bei Lewis 2001, 18)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 11
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Arnold von Lübeck. 1171-1209. Chronicon Slavorum. „Ich werde jetzt Dinge über den Alten berichten, die absurd erscheinen, aber durch Aussagen zuverlässiger Zeugen verbrieft sind. Der Alte hat in seinem Land Menschen durch Hexerei derart verwirrt, daß sie weder beten noch an irgendeinen Gott außer ihn selbst glauben. Überdies verlockt er sie auf seltsame Weise mit Hoffnungen und Versprechungen ewiger Freuden, so daß sie lieber sterben als leben wollen. *…+ Der höchsten Seligkeit, versichert er, werden jene teilhaftig, die Menschenblut vergießen und als Vergeltung für solche Taten selbst den Tod erleiden. Haben sich einige für einen solchen Tod entschieden *…+, so überreicht er selbst ihnen Dolche, die sozusagen dieser Tat geweiht sind. Dann reicht er ihnen einen Gifttrank, der sie in Ekstase und Vergessen stürzt, versetzt sie durch Magie in phantastische Träume voller Freuden und Wonnen *…+ und verspricht ihnen den ewigen Besitz all dessen als Belohnung für ihre Taten.“ (IV,16. Übers. bei Lewis 2001, 18f.)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 12
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Wissensexploration I: Das abendländische Bild von den Assassinen am Ende des 12. Jh. • Gemeinschaft um einen ‚Alten vom Berge‘, deren Mitglieder ‚Assassinen‘ genannt werden. Die
Herkunft des Namens ist unbekannt. • Die Gemeinschaft lebt gesetz- und gottlos im Inzest und ist nur dem ‚Alten‘ zu absolutem
Gehorsam verpflichtet. • Der ‚Alte‘ indoktriniert sie in von hohen Mauern geschützten Palästen in den Bergen Syriens, die
nur durch eine kleine Tür zur Außenwelt geöffnet sind. Hier verhext er sie, gibt ihnen (Gift-) Tränke, versetzt sie in Rausch und Ekstase.
• Zweck der Gemeinschaft ist die Tötung von muslimischen und christlichen Fürsten: Die ‚Assassinen‘ geloben dem ‚Alten‘ die Treue, töten mit einem geweihten, goldenen Dolch und sind selbst bereit zu sterben. Als Lohn versichert ihnen der ‚Alte‘ ewige Teilhabe ‚an allen Freuden und Wonnen‘, mit denen er sie bisher verhexte.
Der ‚Alte vom Berge‘ ist Sinan ibn Salman ibn Muhammad, der 1162 Führer der Assassinen in Syrien wird und 1192/1194 stirbt. Unter seiner Führung werden Anschläge verübt auf Saladin (1174) und auf den König von Jerusalem, Konrad von Montferrat, der 1192 stirbt – dieses Attentat dürfte verantwortlich sein für den breiten Niederschlag in den abendländischen Chroniken.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 13
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Das Buch der Wunder der Welt (um 1410) Französische Hs., in Auftrag gegeben von Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund. Sammlung von illustrierten Texten über den Orient, darunter der Reisebericht des Marco Polo mit 84 Miniaturen.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 14
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Hie hebt sich an das puch des edeln Ritters vnd landtfarers Marcho Polo, in dem er schreibt die grossen wunderlichen ding dieser welt. Nürnberg 1477. 32f. (16r). • Garten des Alten (der den Islam in
Nachfolge Muhammads predigt), der im Inneren einer befestigten Burg liegt.
• Einfältige junge Männer haben Teil an den Freuden dieses Gartens, den der Alte als das Paradies ausgibt – betäubt lässt er die Männer in den Garten hinein- und wieder herausbringen.
• Um an den Freuden des Paradieses ewigen Anteil zu haben, folgen die Männer dem Alten, geloben Gehorsam und töten in seinem Auftrag.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 15
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Hie hebt sich an das puch des edeln Ritters vnd landtfarers Marcho Polo, in dem er schreibt die grossen wunderlichen ding dieser welt. Nürnberg 1477. 32f. (16r). • Der Alte verspricht den Männern das
Paradies: Die, die in seinem Gebot sterben, werden als Engel im Paradies (Muhammads) leben.
• Mit diesen Versprechungen blendet er das Volk und erpresst mit der Furcht vor den Assassinen ‚viele große Herren‘.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 16
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Wissensexploration II: Das Wissen über die Assassinen am Ende des 15. Jh. • Gemeinschaft um einen ‚Alten vom Berge‘, deren Mitglieder ‚Assassinen‘ genannt werden. Die
Herkunft des Namens ist unbekannt. • Die Gemeinschaft lebt gesetz- und gottlos im Inzest und ist nur dem Alten zu absolutem
Gehorsam verpflichtet. Der Alte predigt den Islam nach Muhammad, bedient sich dabei aber gegenüber einfältigen Menschen unlauterer Mittel.
• Der Alte indoktriniert junge Männer in von hohen Mauern geschützten Palästen in den Bergen, die nur durch eine kleine Tür zur Außenwelt geöffnet sind. Die Paläste innerhalb der Mauern sind von einer Gartenanlage umgeben, in denen Bäche aus Milch und Honig fließen und die schönsten Frauen und Jungfrauen leben, die man je gesehen hat. Der Alte nennt diese Gärten das Paradies. Hier verhext er junge Männer, gibt ihnen (Gift-)Tränke, versetzt sie in Rausch und Extase. Durch einen Trick (Schlaftrunk) suggeriert er den Männern, er verfüge über den Zugang zum Paradies.
• Zweck der Gemeinschaft ist die Tötung muslimischer und christlicher Fürsten, die wegen ihrer Furcht vor den Assassinen vom Alten erpresst werden. Die Assassinen geloben dem Alten die Treue, töten mit einem geweihten, goldenen Dolch und sind selbst bereit zu sterben, was oft genug passiert, auch ohne dass sie ihren Auftrag ausführen können. Als Lohn versichert ihnen der Alte ewige Teilhabe ‚an allen Freuden und Wonnen‘, mit denen er sie bisher verhexte, dass sie als Engel ins Paradies Muhammads gehen.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 17
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Joh. Phil. Lorenz Withof. 1765. Das meuchelmoerderische Reich der Assassinen. Cleve: Hoffmann. Der Aufklärung verpflichtete Publikation, die das generierte Wissen über die Assassinen nicht nur zusammenfasst. Withof übt zugleich eine Generalkritik an der eurozentrischen Perspektive:
"Um dessentwillen ließe sie es auch geschehen, daß die Europaer mit ihrem Aberglauben nach Asien reiseten. Sie tummelten sich da eine Zeitlang gewaltig herum. Die Mahometaner jagten sie endlich wieder nach Hause. Sie setzten sich abermals im Schooße des Aberglaubens ruhig hin, und fielen von neuem in Schlaf." (5) "Viele von ihnen [den Kreuzfahrern] fanden ihren Untergang bei des Assassinen." (6) Zusammenschau generierten Wissens:
Wiedergabe des Gartenmythos nach Marco Polo, der allerdings nach Maßgaben vernünftigen Denkens und Argumentierens modifiziert wird. Al Hasan habe die Bäche aus Honig und Milch angelegt, die aber "nicht bestaendig in diesen Baechen geflossen habe, sondern nur nach Belieben des Sheykhs hineingelassen worden sey. In Orient waren dergleichen Baeche recht nach dem herrschenden Geschmacke." (Anm. 51 auf S. 39).
Aufbau des Gartens, Überzeugung der jungen Männer, Versprechen des Paradieses usw.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 18
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Joh. Phil. Lorenz Withof. 1765. Das meuchelmoerderische Reich der Assassinen. Cleve: Hoffmann. Neues Wissen (Wissenstand europ. Historiker im 18. Jh.): • Der Regent wird „Scheykh“ genannt (30), was Fürst oder „Alter“ bedeute (31). • Die Bezeichnung als „Sekte“ ist missverständlich, diese diente den Chronisten der Kreuzzüge,
verschleiert aber das Wesen des Bundes. (10) • Withof druckt das „geheime Gesetz der Assassinen“ ab (49-51). • Withof teilt die Gemeinschaft der Assassinen ein in
• Untertanen, • Armee und • Garde – das sind die „Weißen“, die im Auftrag des ‚Sheykhs‘ Anschläge verüben.
Armee und Garde war gemein, „daß sie in vollkomner Einigkeit lebten; keine Ehrsucht kennten; die Befoerderung ihres Glaubens fuer ihr gemeines Beste achteten; fuer ihr gemeines Beste dem Tode sehnlich entgegen giengen; sich eine besondre mahometanische Heiligkeit anmaßten; die Ermordung ihrer gemeinschaftlichen Feinde, voraus aber den anbefohlnen Selbstmord, fuer das sicherste Unterpfand des Himmels ansahen; und endlich einen blinden Gehorsam gegen ihr Oberhaupt fuer den achten Artikel ihres geheimen Gesetzes hielten." (64)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 19
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Joh. Phil. Lorenz Withof. 1765. Das meuchelmoerderische Reich der Assassinen. Cleve: Hoffmann.
Schließlich kommt Withof zum Schluss, dass die Assassinen den Templern vergleichbar ein Orden gewesen seien. Beide hätten ihre Hoch- und Blütezeit etwa 180 Jahre während der Kreuzzüge von 1090 bis 1271 erlebt und „*b+eyde hatten von dem, was sie Religion nannten, in der That einerley Begriff, und hielten die Ermordung desjenigen, der auf eine andre Weise sich gegen Gott verhaelt, fuer eine grosse Froemmigkeit.“ (181f.) Damit bekräftigt er im Schluss sein Urteil über die Assassinen, das er bereits als These an den Beginn seiner Publikation gesetzt hatte: „*D]ie Assassinen [sind] urspruenglich fuer nicht viel mehr, als fuer eine Gattung mahometanischer Ordensritter gehalten werden muessen." (9)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 20
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Wissensexploration III: Das abendländische Bild von den Assassinen am Ende des 18. Jh. • Differenzierte Gemeinschaft der ‚Assassinen‘. Die Herkunft und Bedeutung des Namens bleibt
weiterhin unklar. • Die Gemeinschaft ist der ismailitischen Lehre verpflichtet, die zur Schia gehört. Sie ist einem
Sheykh, dem Alten, zu absolutem Gehorsam verpflichtet. • Der Sheykh indoktriniert junge Männer in von hohen Mauern geschützten Palästen in den
Bergen, die nur durch eine kleine Tür zur Außenwelt geöffnet sind. Die Paläste sind von einer Gartenanlage umgeben, in denen Bäche aus Milch und Honig fließen und die schönsten Frauen und Jungfrauen leben, die man je gesehen hat. Der Alte nennt diese Gärten das Paradies. Durch einen Trick (Schlaftrunk) suggeriert er den Männern, er verfüge über den Zugang zum Paradies.
• Die Gemeinschaft schaltet muslimische und christliche Fürsten aus, die ihre Existenz (und damit den Fortbestand ihrer Lehre) bedrohen. Sie sind als ein radikal islamischer Orden einzustufen. Die gefürchteten Mörder gehören zur Garde (‚die Weißen‘): Sie geloben dem Alten die Treue („geheimes Gesetz der Assassinen“), töten mit einem geweihten, goldenen Dolch und sind selbst bereit zu sterben.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 21
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Transfer und Integration I – ein Beispiel Art. Assassinier. In: Johann Heinrich Zedler. 1732-1751. Großes und vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. 64 Bde. und 4 Supplement-Bde. Leipzig, Halle: Zedler, Bd. 2, Sp. 1894-1896. Zedlers Artikel gibt genau diesen Stand des Wissens über die Assassinen am Ende des 18. Jh. wieder, ist aber selektiv und transportiert nicht den aufklärerischen Geist seiner Zeitgenossen (integriertes Wissen entspricht nicht dem in der Expertenkommunikation explorierten Wissen): Er bezeichnet die Assassinen nie mit ihrem Namen, sondern als „Canaille“, „Meuchelmörder“, „schändliche Rotte“.
Die Assassinen sind ein Volk in Phönizien mit Burgen und Schlössern in der Gegend von Tyrus. Zedler bedient den Gartenmythos. Die Assassinen sind ein „Mahometanischer Ritter-Orden“. Sie wählen einen König, der der „Alte des Gebirges“ heißt. Sie erziehen junge Männer, die rauben und morden im Auftrag der Gemeinschaft. Diese sind dem
Alten zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Eine von Zedler behauptete Position (‚die Templer hätten den Assassinen versagt, den christlichen Glauben anzunehmen, und damit nicht nur den Ruin des Christentums in Asien sondern auch den Verlust des Königreichs Jerusalem zu verantworten‘), geht vom Schluss her zu weit.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 22
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Silvestre de Sacy. 1818. Mémoire sur la Dynastie des Assassins. In: Mémoires de l‘Institut Royal 4, 1ff. Zuerst vorgelegt 1809. • Auswertung bisher im Westen unbekannter arabischer Kreuzzugsquellen • Herkunft des Namens der ‚Assassinen‘
• von arabisch haschsch, bekannt in den Formen haschsch & haschschsch. • Sektierer werden durchgehend als haschsch bezeichnet, nicht als haschschsch (einem
jüngeren Wort, mit üblicherweise Haschischkonsumenten bezeichnet werden). • Sacy schließt daraus nicht darauf, dass die ‚Assassinen‘ drogenabhängig gewesen wären,
sondern vermutet, dass Haschisch geheim eingesetzt wurde durch den ‚Alten‘ und bestätigt darüber hinaus auch den Gartenmythos.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 23
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Joseph von Hammer. 1818. Die Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen. Stuttgart, Tübingen: Cotta. Nachdruck 2008. Umfangreiche Geschichte des Ordens der Assassinen, die in einen größeren Zusammenhang eingeordnet wird und sich 1) gegen den Missbrauch der Religion durch die Politik und 2) gegen gewalttätige Gemeinschaften, die die hergebrachte Ordnung gefährden, stellt. „Religions-Fanatismus wird von der Geschichte vielfältig als Urheber blutiger Kriege *…+ angeklagt; doch war die Religion niemals das Ziel, sondern meistens nur Werkzeug ehrgeiziger Politik und ungezähmter Herrschsucht“ (Hammer 2008: 19). Hammer zieht Analogieschlüsse zu Templern, Jesuiten, Illuminaten und Freimaurern, denn sie alle treffen in „dem letzten Zweck, alle Könige und Priester überflüssig zu machen, auf einem Punkt wirklich ganz überraschend zusammen.“ (Hammer 2008: 141). „Der politische Wahnsinn der Aufklärer, welche die Völker mündig, dem Schirmbund der Fürsten und dem Gängelband positiver Religion entwachsen glaubten, hat sich wie unter der Regierung des Großmeisters Hassan II. in Asien so in Europa durch die Wirkungen der französischen Revolution auf das persönlichste kundgegeben, und wie damals die Lehre des Meuchelmords und aller staatsauflösenden Verbrechen von Alamut offen ausging, so die Lehre des Königsmordes aus dem französischen Nationalkonvent *…+. Die Mitglieder der Konvention *…+ wären würdige Satelliten des Alten vom Berge gewesen.“ (Hammer 2008: 142)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 24
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Joseph von Hammer. 1818. Die Geschichte der Assassinen aus morgenländischen Quellen. Stuttgart, Tübingen: Cotta. Nachdruck 2008. Hammer bestätigt – im Nachgang der Lektüre und „umständlichen Auseinandersetzung“ Sacys – die unzweifelhafte Glaubwürdigkeit Marco Polos. In seiner Wiedergabe der Erzählung schafft er Tatsachen : „Den Jüngling *…+ lud der Großmeister Großprior zu Tisch und zum Gespräch ein, berauschte ihn mit einem Opiat aus Hyoscyamus (Haschisch), und ließ ihn in den Garten tragen *…+.“ (Hammer 2008: 91)
Hammer geht im Ggs. zur differenzierenden Darstellung Sacys nicht nur in der Übersetzung, sondern auch in der Spekulation weiter. Er vermutet, dass dieser Betrug nicht verdeckt werden konnte und deshalb der Drogenkonsum bald allen Mitgliedern des Ordens möglich gemacht wurde – die Folgen könne man noch heute in Konstantinopel oder Kairo sehen: „Was bisher als Mittel zum Vergnügen gedient, wurde nun selbst Zweck, und die Begeisterung des Opiumrausches wurde Surrogat himmlischer Freuden *…+ und erklärt die Wut, womit jene Jünglinge den Genuss dieser berauschenden Kräuterpastillen (Haschische) suchten, und worin sie durch dieselben versetzt, fähig wurden, alles zu unternehmen. Von dem Genuss derselben nannte man sie Haschischin, das heißt die Kräutler, woraus in dem Mund der Griechen und Kreuzfahrer der Name Assassinen entstanden, der als gleichbedeutend mit Meuchelmörder die Geschichte des Ordens in allen europäischen Sprachen verewigt.“ (Hammer 2008: 92).
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 25
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Wissensexploration IV: Das abendländische Bild von den Assassinen am Anfang des 19. Jh. • Differenzierte Gemeinschaft der ‚Assassinen‘: Man unterscheidet sieben Grade, die Attentäter
werden als fidw bezeichnet. Die Herkunft und Bedeutung des Namens werden etymologisch richtig hergeleitet, aber zu falschen Schlüssel herangezogen: Der Gartenmythos im Reisebericht des Marco Polo wird durch den Namen bestätigt.
• Die Gemeinschaft ist der ismailitischen Lehre verpflichtet, die zur Schia gehört. Sie dient einem Sheykh, dem Alten, in absolutem Gehorsam.
• Der Sheykh indoktriniert junge Männer in von hohen Mauern geschützten Palästen in den Bergen, die nur durch eine kleine Tür zur Außenwelt geöffnet sind. Die Paläste sind von einer Gartenanlage umgeben, in denen Bäche aus Milch und Honig fließen und die schönsten Frauen und Jungfrauen leben, die man je gesehen hat. Der Alte nennt diese Gärten das Paradies. Er verführt die Männer zum Drogenkonsum, der der Motor für ihre verbrecherischen Handlungen wird.
• Die Gemeinschaft schaltet muslimische und christliche Fürsten aus, die ihre Existenz (und damit den Fortbestand ihrer falschen Lehre) bedrohen. Sie sind als ein radikaler islamischer Orden einzustufen und gefährdeten die Ordnung ebenso wie andere Geheimbünde nach ihnen. Die gefürchteten Mörder gehören zur Garde (‚die Weißen‘): Sie geloben dem Alten die Treue („geheimes Gesetz der Assassinen“), töten mit einem geweihten, goldenen Dolch und sind selbst bereit zu sterben.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 26
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Transfer und Integration II – Beispiele Art. Ismaeliten. In: [1838] Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon. Leipzig, Bd. 2, 465.
Ismaeliten (gegründet von „Hassan ben Sabbach el Homairi“) = „Assassinen“ mit dem Zentrum
„Alamût“. Geschichtliche Darstellung der Entwicklung und Zerschlagung der „Sekte“.
‚Wüthendes Verfolgungssystem‘ gegen die Feinde: „Um in offenem Kampfe aufzutreten, fehlte es ihr [der Sekte] an Macht, daher nahm sie zum Morde, geheimem und öffentlichem, ihre Zuflucht. Es wurden nämlich Mörder förmlich erzogen und abgerichtet, welche, um das ihnen bezeichnete Opfer zu erreichen, keine sie selbst bedrohende Gefahr scheuten. Sie hießen Fedâis, d.h. sich Opfernde, standen unter dem Befehle des Beherrschers der Sekte im Schlosse Alamût, welcher der Alte vom Berge genannt wurde, und berauschten sich, um sich zu ihrem schrecklichen Geschäfte zu ermuthigen, mit einem aus Bilsenkraut bereiteten Getränk. Von dem Namen des Bilsenkrauts wurde die ganze Sekte Haschischi genannt, woraus die Abendländer Assassinen machten.“
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 27
C A U
2. Das Bild der Assassinen in abendländischen Darstellungen. Darstellung des Bundes
Transfer und Integration II – Beispiele Art. Assassīnen. In: [1905] Meyers Großes Konversations-Lexikon. Leipzig, Bd. 1, S. 888.
„Der Orden zerfiel in mehrere Grade; an der Spitze stand der Scheich ul Dschibâl, was die Abendländer mit Vetulus de montanis oder der Alte vom Berge übersetzten. Lehre und Organisation waren die der Ismaeliten; nur hatte Hassan, um die Unterwürfigkeit der Genossen unter die Obern zu blindem Gehorsam zu steigern, ein teuflisches Mittel ersonnen. Aus den Blättern der Haschischpflanze (des Hauses) wurde nämlich ein starker Trank bereitet, um damit die Jünglinge zu betäuben, die in diesem Zustand an einen Ort, wo alle Reize des Sinnengenusses ihrer warteten, gebracht, nach wenigen Tagen aber auf dieselbe Weise wieder von dort entfernt worden sein sollen. Sie glaubten dann bereits die Freuden des Paradieses genossen zu haben, und, von Sehnsucht nach ähnlichen Genüssen getrieben, gaben sie gern ihr irdisches Dasein dahin. So waren sie die willenlosen Werkzeuge ihrer Obern und verübten jede blutige Tat auf deren Befehl. Als »Hanfesser« nannte man den Fidawi auch Haschschâschi; daraus haben die Franken Assassin gemacht.“
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 28
C A U
3. Das Sprechen über Minoritäten und deren Arkana. Modellierung des Prozesses der Diskursivierung
„Der Ausdruck haschsch [-- so wissen wir heute --] war auf Syrien beschränkt und wahrscheinlich eine populäre Beschimpfung. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es eher dieser Name, der die Geschichte [von einer drogenabhängigen Sekte im Paradiesgarten des Alten] entstehen ließ, als umgekehrt. Von diversen Erklärungsmodellen, die angeboten wurden, ist das nächstliegende, daß es sich um einen Ausdruck der Verachtung für die phantastischen Glaubensinhalte und das extravagante Benehmen der Sektierer handelte – einen höhnischen Kommentar zur ihrer Aufführung eher denn eine Beschreibung ihrer Praktiken.“ (Lewis 2001: 29) Er scheint zumindest in arabischen Quellen teilsynonym zu den fidw zu sein.
Der Gartenmythos ist ein äußerst stabiles Element im explorierten Wissen über die Assassinen. Gemeinsam über die Herleitung des Namens aus haschischi (und dem Kurzschluss, den Hammer in der historischen Entwicklung zu haschschasch herleitet), wird der Mythos im Transfer beglaubigt: Die Assassinen sind eine Gemeinschaft von bezahlten Meuchelmördern, die sich in paradiesischen Gärten berauschen.
Die Frage nach der Motivation für die Ordensgründung und die Tötung von muslimischen wie christlichen Fürsten, die Schlüsselpositionen im Kampf gegen die ismailitische Sekte einnehmen, bleibt ebenso im Dunkeln wie die fälschliche Benennung der Sekte selbst.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 29
C A U
3. Das Sprechen über Minoritäten und deren Arkana. Modellierung des Prozesses der Diskursivierung
Aus den Beobachtungen möchte ich hinsichtlich der Kommunikation über Minoritäten und deren Arkana folgende Schlüsse ziehen:
1. Nicht die Minorität selbst, sondern die nichteingeweihte Majorität bewertet eine Gruppe als „geheim“ und unterstellt damit zugleich, dass die Minorität Räume, Dinge, Wissen, Handlungsabläufe, Riten usw. verschlossen (d.i. arkan) hält.
2. Als exploriertes Wissen sammelt man (nach Betrand Russell) „Tatsachen des Bewusstseins“, beglaubigt von einer langen Reihe von Beobachtern zweiter und dritter Ordnung, deren Authentizität dadurch bestätigt wird. Das einzige, was jedoch bestätigt wird, ist das Interesse der Majorität am (gemutmaßten) Arkanum der Minorität.
3. Im Fall der Assassinen darf (wegen der kausal gedachten Morde im Anschluss, die man auf andere Weise nicht erklären kann / will) das Schlimmste gemutmaßt werden:
a) gesellschaftliche Tabus werden gebrochen,
b) es werden Eliten gebildet, die sich dem Werte- und Normenkonsens ‚der‘ Majorität entziehen,
c) es werden Beziehungen zwischen Eliten hergestellt werden, deren Verbindung gesellschaftlich als Gefahr bewertet wird, usw.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 30
C A U
3. Das Sprechen über Minoritäten und deren Arkana. Modellierung des Prozesses der Diskursivierung
4. Dass man als Außenstehender das Tabu/die Eliten/die Ziele nicht kennt, von dem man annimmt, dass es durch den Bund und seine Mitglieder gebrochen/verfolgt werde, bietet Spielraum für die meist abenteuerlichsten Spekulationen, die noch gewaltiger werden, um so exklusiver der Zugang zum Bund ist. Besitzt der Bund also keinen gesellschaftlichen Rückhalt, dann wird meist unterstellt, dass er die Ordnung und Gesellschaft unterminiere, sonst wäre er öffentlich -- kein Bund ist geheim wegen des Geheimseins an sich, so lautet der Generalverdacht.
5. Dinge, die arkan, d.i. verschlossen sind, kann die Majorität nicht sehen. Auch wenn diese z.B. in der vorgeführten Wissensexploration alle ‚Geheimnisse‘ einer Gemeinschaft aufdeckt, werden im Prozess der Diskursivierung immer wieder die Heterotopien (hier der Gartenmythos) aufgerufen, die ikonisch stehen für die Abgeschlossenheit der Minorität (auch wenn diese nicht über Arkana verfügt). Diese werden dichotomisch entlang einer deiktischen Dimension (Raum, Zeit, Bewegung, Ritus, Kleidung usw.) sowie der evaluativen Dimension geordnet. Als erfolgreich für den Wissenstransfer erweisen sich Darstellungen, die diesen Dichotomien folgen (Hammer). Darstellungen, die auf diese klare Zeichnung verzichten (Withof), setzen sich nicht durch – ebenso wenig wie die Diskursposition der jeweiligen Akteure.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 31
C A U
3. Das Sprechen über Minoritäten und deren Arkana. Modellierung des Prozesses der Diskursivierung
Frame Kommunikation über Minoritäten und deren Arkana
Deiktische Dimension Raum: Abgeschlossenheit vs. Aufgeschlossenheit
Zeit: Nacht vs. Tag Bewegung: Mobilität vs. Immobilität
Usuelle Codes (Sprache, Ritus, Kleidung usw.): Arkanum vs. Zeichen
Evaluative Dimension
Wissen vs. Nichtwissen Wert vs. Nichtwert
Person vs. Nichtperson Ordnung vs. Nichtordnung
Tabu vs. Tabubruch
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 32
C A U
„Die Stunde der Apokalypse ist da. Gegen Weltuntergangssekten sind moderne Staaten machtlos“. In: DER SPIEGEL 13/1995. 155-158. „Nur mit einem Dolch bewaffnet, Gift und Fernwaffen verschmähend, pirscht sich der Assassine an das Opfer heran; nach der Tat versucht er nicht zu fliehen, sondern läßt sich willig töten. Denn die Seligkeit, das Paradies ist ihm gewiß. Das christliche Abendland, frappiert von der Hörigkeit und Todeslust der orientalischen Terroristen, wob sich erklärende Legenden, mit allen Ingredienzen, die im Morgenland vermutet wurden. Die blumigste geht so: Der Alte vom Berge hatte, um Killer-Nachwuchs heranzuziehen, heimlich einen paradiesischen Garten bauen lassen. Dorthin transportierte er die Adepten, nachdem sie mit Drogen eingeschläfert waren. Sie erwachten in einem Paradies, wie der Koran es verheißt. Bäche von Milch und Honig flossen, die schönsten Frauen beugten sich jedem Wunsch, musizierten auch und tanzten. Brauchte der Alte einen Jüngling als Todesboten, ließ er ihn wieder einschläfern, holte ihn in den Palast und fragte ihn, woher er komme. Antwort natürlich: Aus dem Paradies. Dorthin könne er zurück, versetzte der Alte, wenn er seinen Auftrag ausgeführt habe. Kein Wunder, daß der Mann dann gehorsam und begierig loszog, den Dolch im Gewande. Mittelalterlichen Troubadouren imponierte dieser Treueakt; einer dichtete seiner hohen Frau: ‚Ihr habt mich vollkommener in Eurer Gewalt als der Alte seine Assassinen.‘“
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 33
C A U
Anne-Sophie Fröhlich. 2010. „Mörder aus dem Paradies“. SPIEGEL ONLINE [http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/0,1518,686718,00.html, Stand: 15.11.2010] „Die kleine Sekte, die ihre Lehre und religiösen Schriften geheim hielt, regte die Phantasie ihrer Gegner und auch der Europäer an. Mit Drogen, so wurde kolportiert, machten die Assassinen-Führer junge Männer willenlos und gefügig, versprachen ihnen das Paradies und schickten sie dann zum Morden aus. Marco Polo beschreibt in seinem Reisebericht den damals schon zerstörten ‚größten und schönsten Garten der Welt‘, in den die berauschten Jünglinge angeblich gebracht wurden: ‚In den Brunnen floss Wasser, Honig und Wein. Die schönsten Jungfrauen und Edelknaben sangen, musizierten und tanzten dort.‘
Auch wenn solche Legenden nach dem Urteil des Orientalisten Bernard Lewis ‚fast mit Sicherheit unwahr‘ sind, ging die Geheimgesellschaft doch als ‚Assassinen‘ (‚Haschischkonsumenten‘) in die Geschichte ein. Die mörderischen Eiferer nannten sich selbst Fedajin, die ‚Geweihten‘; sie gehörten der islamischen Minderheit der Ismailiten an.“
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 34
C A U
4. Fazit
Von einer mehrdimensionalen Sicht auf ‚linguistische Arkana‘ erhoffe ich mir, dass die Bedingungen für eine intuitive Bestimmung eines Dingens, eines Raumes, einer Zeit, eines Wissens, einer Person, einer Handlung, eines Ritus usw. als Arkanum genau beschrieben und damit methodisch reflektiert werden.
Es könnte nämlich sonst durchaus sein, dass man den Ergebnissen oder den noch andauernden Diskursivierungen aufsitzt, die Generationen vor uns mühsam als Pfade durch explorierte Wissensbestände gehauen haben.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 35
C A U
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Präsentation ist verfügbar unter
http://snipurl.com/lasch-assassinen
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Alexander Lasch [email protected] 36
C A U
Sekundärliteratur
Gerd Antos & Sigurd Wichter (Hg.). 2005. Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem (Transferwissenschaften 3). Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Albert Busch & Oliver Stenschke (Hg.). 2004. Wissenstransfer und gesellschaftliche Kommunikation. FS Sigurd Wichter. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Bernard Lewis. 2001. Die Assassinen. Zur Tradition des religiösen Mordes im radikalen Islam. Frankfurt am Main: Eichborn.
Bernard Russel. 1912. The Problems of Philosophy.
Oliver Stenschke & Sigurd Wichter (Hg.). 2009. Wissenstransfer und Diskurs. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Ingo Warnke & Jürgen Spitzmüller. 2008. Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik. In: Dies. (Hg.). Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin, New York: de Gruyter. S. 44.
Sigurd Wichter & Gerd Antos (Hg.). 2001. Wissenstransfer zwischen Experten und Laien: Umriss einer Transferwissenschaft. Frankfurt a.M.: Peter Lang.