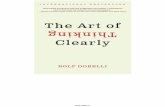Gebote der Gegenwart. Die Transformierung der Management- und Ratgeberliteratur im Roman der...
Transcript of Gebote der Gegenwart. Die Transformierung der Management- und Ratgeberliteratur im Roman der...
Carsten Rohde / Hansgeorg Schmidt-Bergmann (Hgg.)
Die Unendlichkeit des Erzählens
Der Roman in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1989
AISTHESIS VERLAGBielefeld 2013
Sonderdruck aus:
Daniel Lutz
Gebote der Gegenwart
Die Transformierung der Management- und Ratgeberliteratur im Roman der Nullerjahre (Georg M. Oswald, Ernst-Wilhelm Händler, Rolf Dobelli, Martin Walser, Bodo Kirchhoff )
I. Wirtschaftsthematisierung in der Literatur seit 1995
Das verstärkte Auftreten von Ökonomie als Thema in der deutschsprachi-gen Literatur seit Mitte der 1990er Jahre wird in der Forschung zwar allent-halben registriert, hinsichtlich einer genaueren Bestimmung des textmate-rialen Transfers von wirtschaftlichen Sachbezügen in die Literatur bleiben die Analysen bislang jedoch recht oberflächlich. So ist in der Einleitung von Franziska Schößlers Studie Börsenfieber und Kaufrausch zu lesen, dass „Ökonomie ein bevorzugter Gegenstand von Prosa und Dramatik“ in der Gegenwartsliteratur sei.1 Diesem Gegenstand nähern sich Autoren, folgt man der Beschreibung Schößlers, in einem quasi-wissenschaftlichen Ver-fahren: „Meist arbeiten sich die Autoren und Autorinnen mit Akribie in die entsprechenden Fachdiskurse ein, werden zu Börsen- bzw. Investment-spezialisten und versuchen das virulente Problem der Arbeitslosigkeit in literarischen Versuchsreihen zu lösen.“2 Nicht von ungefähr wird hier eine methodologische Nähe von Literatur und naturwissenschaftlicher Labor-forschung evoziert, welche an die Bemühungen erinnert, die Tätigkeit des
1 Franziska Schößler. Börsenfieber und Kaufrausch. Ökonomie, Judentum und Weiblichkeit bei Theodor Fontane, Heinrich Mann, Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Émile Zola. Bielefeld: Aisthesis, 2009. S. 9. Die Studie beschäf-tigt sich mit diskursiven Konstellationen um 1900. In einem neueren Aufsatz behauptet Schößler, dass dieser Diskurs, der Kapitalismuskritik mit misogynen und antisemitischen Elementen verbindet, in der Gegenwartsliteratur fortge-schrieben wird. Vgl. Franziska Schößler. „Ökonomie als Nomos des literari-schen Feldes. Arbeit, Geschlecht und Fremdheit in Theatertexten und Prosa seit 1995“. Transformationen des literarischen Feldes in der Gegenwart. Sozialstruktur – MedienÖkonomien – Autorpositionen. Hg. Heribert Tommek/Klaus-Michael Bogdal. Heidelberg: Synchron, 2012. S. 229-244.
2 Schößler. Börsenfieber und Kaufrausch (wie Anm. 1).
212
Schriftstellers mit „‚auratische[n]‘ Professionen, wie denen des Propheten, Priesters, Sehers, Arztes und Lehrers“ zu verbinden.3 Die Rede vom Schrift-steller als akribischem Spezialisten, der gleichsam als Wissenschaftler aktu-elle gesellschaftsrelevante Probleme mit literarischen Mitteln nicht nur diskutiert, sondern zudem noch eine Lösung für diese Probleme bereithält, ist aber nicht nur empirisch fragwürdig, sie ist auch im Blick auf die mitt-lerweile viel diskutierte Verbindung von Literatur und Wissen zweifelhaft.4 Die Behauptung, die meisten Autoren bildeten sich autodidaktisch zu Spe-zialisten aus, ist m.E. problematisch, da sie ein prinzipiell problemlos ver-fügbares professionelles Fachwissen suggeriert, das dann ebenso problemlos literarisch weiterverarbeitet werden könne. Genau das übergeht die zentrale Frage, welche Textformen ökonomischen Wissens eigentlich in der Gegen-wartsliteratur nachweisbar sind, welche Wissensbestände aufgerufen werden und ob es sich dabei tatsächlich um Fachwissen oder eher um bereits populär aufbereitete Formen und Inhalte handelt.
Vor allem wie sich der Gegenstand Ökonomie literarisch darstellt, ist des-halb erst zu fragen; daran anschließend, ob es sich hier um einen neuartigen Zugang handelt, der sich von bisherigen Traditionen und Konjunkturen der Wirtschaftsthematisierung in der Literatur abhebt. Der Beitrag will im Folgenden eben diesen Zusammenhang zwischen Literatur und Wissen am Beispiel der literarischen Wirtschaftsthematisierung in Form des Ratgeber-zitats aufzeigen. Der wirtschaftsnahe Ratgebertext als spezifischer Modus, in dem Wirtschaftswissen vorliegt, ist für die Literatur der Nullerjahre besonders signifikant. Das Korpus besteht aus fünf Romanen, die den Zeit-raum von 2000 bis 2009 abdecken und somit die sogenannten Nullerjahre
3 Vgl. Rolf Parr unter Mitarbeit von Jörg Schönert. Autorschaft. Eine kurze Sozialgeschichte der literarischen Intelligenz in Deutschland zwischen 1860 und 1930. Heidelberg: Synchron, 2008. S. 14.
4 Vgl. dazu die grundlegende Debatte in der Zeitschrift für Germanistik: Tilmann Köppe. „Vom Wissen in Literatur“. Zeitschrift für Germanistik, N.F., 17 (2007): S. 398-410; Roland Borgards. „Wissen und Literatur. Eine Replik auf Tilmann Köppe“. Ebd. S. 425-428; Andreas Dittrich. „Ein Lob der Bescheidenheit. Zum Konflikt zwischen Erkenntnistheorie und Wissensgeschichte“. Ebd. S. 631-637; Tilmann Köppe. „Fiktionalität, Wissen, Wissenschaft. Eine Replik auf Roland Borgards und Andreas Dittrich“. Ebd. S. 638-646. Zusammenfassend schließlich Fotis Jannidis. „Zuerst Collegium Logicum. Zu Tilmann Köppes Beitrag ‚Vom Wissen in Literatur‘“. Zeitschrift für Germanistik, N.F., 18 (2008): S. 373-377.
Daniel Lutz
213
repräsentieren. Dabei handelt es sich um Georg M. Oswald: Alles was zählt (2000), Ernst-Wilhelm Händler: Wenn wir sterben (2002), Rolf Dobelli: Und was machen Sie beruflich? (2004), Martin Walser: Angstblüte (2006) und Bodo Kirchhoff: Erinnerungen an meinen Porsche (2009). Gemeinsam ist diesen Texten, dass sie in einem weiteren Sinn von Ökonomie erzählen und dazu in unterschiedlicher Ausprägung Management- und Ratgeberlite-ratur – also populäre Handreichungen – verwenden. Die Romane überneh-men entweder ein tatsächlich existierendes Vorbild, inszenieren einen fikti-ven Ratgebertext oder nehmen auf die Ratgeberform strukturell Bezug. Im Blick auf diese Ähnlichkeit kann dann deutlich werden, inwiefern sich in der Transformierung ökonomischer Beratungsliteratur etwas ‚Neues‘ bemerk-bar macht, besser gesagt: inwiefern sich darin ein gegenwartsspezifisches Moment der erzählerischen Darstellung von Wirtschaft aus machen lässt.5 Zu fragen ist, ob die ‚Innovation‘ der Nullerjahre lediglich darin besteht, dass Wirtschaft wieder verstärkt thematisiert wird, oder ob die Romane das Thema Wirtschaft auch auf neue Weise darstellen.
II. Unternehmerische Anrufung
Auffällig ist zunächst der Umstand, dass sich um 2000 in der Fiktion der Romanliteratur eine Ausweitung ökonomischer Aktivität jenseits der tra-dierten Grenzen von abhängig Beschäftigten und selbständigen Unterneh-mern bemerkbar macht. Der Unterschied lässt sich etwa an der Differenz der Angestellten-Darstellung deutlich machen: Dominiert noch in den spä-ten 1970er Jahren, wie etwa in Wilhelm Genazinos Abschaffel-Trilogie oder in Walter Richartz’ Büroroman, der Angestellten-Typus des überwiegend resignativ gestimmten Büroinsassen, der seinem Job gegenüber ein besten-falls entfremdetes Verhältnis pflegt, treten gut zwanzig Jahre später verstärkt Figuren auf, die das Büro staunend als Gelände ökonomischen Agierens wahrnehmen.6 In Rainer Merkels Das Jahr der Wunder (2001) verzweifelt
5 Vgl. Christoph Deupmann. „Narrating (new) Economy: Literatur und Wirt-schaft um 2000“. Literatur der Jahrtausendwende. Themen, Schreibverfahren und Buchmarkt um 2000, Hg. Evi Zemanek/Susanne Krones. Bielefeld: Transcript, 2008. S. 151-161, hier S. 152.
6 Zur diesem Übergang vgl. Susanne Heimburger. Kapitalistischer Geist und literarische Kritik. Arbeitswelten in deutschsprachigen Gegenwartstexten. München:
Gebote der Gegenwart
214
der Angestellte nicht mehr an seiner Arbeit, sondern gibt sich in hohem Maße beteiligt; ja, man könnte fast sagen: engagiert, wäre der Engagement-Begriff nicht für eine dezidiert sozialkritische Literatur reserviert. Die Besonderheit dieses literarischen Zugriffs auf wirtschaftliche Bedingungen liegt nicht zuletzt in der Darstellung unternehmerischen Handelns jenseits des klassischen Unternehmertums, und damit in einer Form ökonomischer Aktivität, die spätestens am Ende der 1990er Jahre zum gesellschaftlichen ‚Leitbild‘ avanciert, das sich durch eine Dynamik der Entgrenzung und Überbietung auszeichnet. „Unternehmer zu sein“, so der Soziologe Ulrich Bröckling,
ist nicht nur ein Beruf oder eine Berufung, nicht nur ein Modus ökonomischer Aktivität oder ein privatrechtlicher Status. Unternehmer zu sein, genauer: Unternehmer sein zu sollen und zu wollen, ist auch eine Subjektivierungsform, eine Art und Weise, sich selbst und andere zu begreifen und zuzurichten. […] Diese Subjektivierungsform ist nicht beschränkt auf selbständig Gewerbetrei-bende oder Kapitaleigner, sondern eine generalisierte Anforderung, die sich an alle und jeden einzelnen richtet. Es handelt sich um eine höchst wirkmäch-tige Realfiktion, die einen Prozess kontinuierlicher Optimierung und Selb-stoptimierung in Gang setzt und in Gang halten soll. Entrepreneur ist man immer nur à venir – stets im Modus des Werdens, nie des Seins.7
In den späten 1990er Jahren ändern sich also nicht die Funktionen des Unternehmerischen, sondern seine Adressierung, die nun tendenziell aus-geweitet wird. Was bislang nur von Wenigen übernommen wurde, nämlich das unternehmerische Denken, soll nun zur allgemeinen Orientierungs-größe werden. Besonders plakativ wird diese Entwicklung beim Begriff der ‚Ich-AG‘. Indem das Verhältnis zur eigenen Person als das zu einer
edition text+kritik, 2010. S. 84-99. Vgl. dazu weiterführend Peter Sloterdijk. Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie der Globalisierung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005. Wonach sich „bei den Populationen der Komfortsphäre gegenwärtig eine tiefgreifende Umstellung von dem herkömm-lichen Denken in Not- und Mangelbegriffen zu einem noch weitgehend unge-wohnten Denken in Optionen vollzieht.“ (S. 331)
7 Ulrich Bröckling. „Enthusiasten, Ironiker, Melancholiker – Vom Umgang mit der unternehmerischen Anrufung“. Mittelweg 36 17 (2008), H. 4, S. 80-86, hier S. 80. Vgl. auch Ulrich Bröckling. Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.
Daniel Lutz
215
Aktiengesellschaft entworfen wird, lösen sich bisher übliche Zuschrei-bungen auf. Diese Neuausrichtung macht sich um das Jahr 2000 auch in Romanen bemerkbar, und zwar weniger als Parteinahme für oder gegen das Unternehmer-Leitbild, sondern vielmehr als neue Aufmerksamkeit für die Wirtschaftswelt im Allgemeinen und die Unternehmerfiguration im Besonderen. Gegenüber verwandten literarischen Konjunkturen, wie dem Kaufmanns- und Unternehmerroman bis 1945, der Angestelltenliteratur der Weimarer Republik oder auch der ‚Literatur der Arbeitswelt‘ der 1960er und 70er Jahre verschieben sich, wie angedeutet, die Aufmerksamkeiten in signifikanter Weise: Statt Szenarien der Resignation und Eintönigkeit ange-sichts redundanter, gleichsam mechanisch bewältigter Arbeitsabläufe sind in der Gegenwartsliteratur verstärkt Faszinationsmomente gegenüber dem positiven Funktionieren wirtschaftlicher Prozesse beobachtbar. Zugleich wird allerdings auch das Scheitern als strukturelle Überforderung durch eine komplexere (Selbst-)Organisation der Arbeit sichtbar. Innerhalb dieses Kon-fliktes – so die These – bewegen und überschneiden sich die verschiedenen wirtschaftsthematisierenden Erzählprojekte seit Ende der 1990er Jahre: Die Steigerung von Komplexität ergibt erhöhte Freiheitsgrade in Form größerer Kombinationsmöglichkeiten, nötigt jedoch gleichzeitig dazu, das erhöhte Kombinationspotenzial auch zu managen, will sagen: die vermehrten Mög-lichkeiten in irgendeiner Weise beherrsch- und kontrollierbar zu halten. Die Figuren (und auch die Texturen) der Romane werden, mit dem Ökonomen Joseph Alois Schumpeter gesprochen, von der unternehmerischen Funktion der Durchsetzung neuer Kombinationen und ihrer Bewältigung bestimmt.8 Entsprechend spielen in diesem Zusammenhang Erwartungsunsicherheit und Risikomanagement eine zentrale Rolle in den Texten.
An die Umwertung des ökonomischen Agierens, der Neudefinition von Eigeninitiative und (Un-)Abhängigkeit, die hier als Komplexitätssteigerung erfasst ist, schließen sich Erzählmuster an, die angesichts der Irritation sozi-aler Semantiken eine „Stabilisierungsleistung im Modus unvollständigen Wissens erbringen“.9 An dieser Stelle des begrifflichen und gesellschaftlichen Wandels bilden ökonomische – und in Korrelation dazu – literarische Nar-rative „einen Welterklärungsbehelf, wo die Einholung vollständiger Infor-mation zu aufwendig oder gänzlich unmöglich ist.“ Erzählen „stellt also eine
8 Vgl. Bröckling. Das unternehmerische Selbst (wie Anm. 7), S. 115ff.9 Albrecht Koschorke. Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen
Erzähltheorie. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2012. S. 300.
Gebote der Gegenwart
216
Kulturtechnik des Umgangs mit Nichtwissen dar“10. Dementsprechend ent-steht nach Rudolf Helmstetter eine „Reaktion auf den Umstand, daß man angesichts der Fülle dessen, was man tun muß und weiß (oder: möglicher-weise wissen könnte), dennoch – chronisch-existentiell oder situativ-akut – nicht weiß, was man (praktisch) tun soll und was (ethisch) richtig ist.“11 Und diese typische Reaktion auf Modernisierungsprozesse nennt man: Ratlosig-keit. Die Bearbeitung der Ratlosigkeit, der Umgang mit dem notorischen Mangel an Informationen, organisiert sich darum in den Romanen der Nul-lerjahre konsequenterweise um den Ratgebertext herum, der dazu berufen scheint, den informatorisch unterversorgten Akteuren zur Seite zu stehen und sie mit „einer Art Bedienungsanleitungsnarrativ für den individuellen Erfolg“12 auszustatten.
III. Normativität des Ratgebertextes
Die fünf Romane enthalten recht unterschiedliche Formen von Manage-ment- und Ratgeberliteratur. Das Spektrum reicht von Selbsthilfe-Literatur und Bewerbungsratgebern bei Oswald und Dobelli über die prophetische Managementliteratur bei Händler und dem Anleger- bzw. Börsenbrief bei Walser bis zum Schreibratgeber bei Kirchhoff. Zusammenfassen will ich diese Ausprägungen des Ratgebertextes unter dem Begriff der ökonomi-schen Anweisungs- und Beratungsliteratur. Damit ist gemeint, dass es sich bei all diesen Formen um wirtschaftsbezogene Texte mit pragmatischer Ausrichtung handelt. Diese pragmatische Ausrichtung ist vor allem aus zwei Gründen zu betonen: Erstens, weil die Ratgeber-Inhalte oft zur Zukunftsbe-schwörung tendieren, sei es, weil sie einen kommenden Zeitraum vor Augen stellen, der noch nicht eingetreten ist, auf den es sich aber schnellstmöglich einzustellen gilt, sei es, weil sie oft utopisch anmutende Ziele formulieren.
10 Ebd., S. 300f.11 Rudolf Helmstetter. „Guter Rat ist (un)modern. Die Ratlosigkeit der Moderne
und ihre Ratgeber“. Konzepte der Moderne. Hg. Gerhart von Graevenitz. Stutt-gart/Weimar: Metzler, 1999. S. 147-172, hier S. 150.
12 Bernhard Kleeberg. „Gewinn maximieren, Gleichgewicht modellieren. Erzäh-len im ökonomischen Diskurs“. Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und Funktionen nichtliterarischen Erzählens. Hg. Christian Klein/Matías Martínez. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2009. S. 136-159, hier S. 152.
Daniel Lutz
217
Zweitens ist die pragmatische Ausrichtung hervorzuheben, da die zeitgenös-sischen Handbücher zur Unternehmenskultur oft von vormodernen Meta-phern und Konstruktionen durchsetzt sind, wie sie sich beispielsweise in der Verwendung von Archaismen und in der Einführung esoterischer Elemente zeigt. So konstatiert Joseph Vogl:
Schon in den 80er Jahren haben Alfred Herrhausen und Gertrud Höhler gruppendynamische Selbsterfahrungen für Bankleute verordnet; und wo ältere Rollen- und Karrieremodelle nicht mehr greifen, rät man zu archaischen Typen, die nun die Geschäftswelt bevölkern: ein Krieger oder Ritter etwa, der von Abenteuer zu Abenteuer loszieht; oder ein Schamane, der Wundertätiges bewirkt; ein Heiland, der immer in größter Not interveniert; ein Zauberer, der stets weisen Rat bereithält usw. […] Man erlebt hiermit Archaismen in aktueller Funktion.13
Wie archaisch, banal oder illusionär auch immer: In jedem Fall geht es darum, die Botschaften stets in ihrem Anspruch auf praktische Anwend-barkeit (aktuelle Funktion) hervorzuheben. Zu diesem Zweck wird vor-zugsweise imperativisch formuliert, was gleichwohl nicht ausschließt, dass man die Vorschläge ignorieren kann. Nach Luc Boltanski und Ève Chiapello zeichnen sich Managementratgeber gegenüber anderen Formen ökonomi-scher Literatur, wie etwa wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen, vor allem dadurch aus, dass es sich bei ihnen um „eine normative Literatur han-delt, die sich weniger mit einem Ist- als mit einem Soll-Zustand befasst.“14 Solche Literatur ist also Ratgeber im buchstäblichen Sinne, denn sie formu-liert Handlungsanweisungen in einem ökonomischen Setting:
Ihre Grundausrichtung ist nicht deskriptiv, sondern präskriptiv. Ähnlich wie Erbauungsschriften oder sittliche Lehrwerke nutzen sie das exemplum. Sie wählen Fallbeispiele wegen ihrer Beweiskraft aus – was zu tun bzw. was zu unterlassen ist – und greifen aus der Wirklichkeit nur diejenigen Aspekte heraus, die sich zur Untermauerung der gewünschten Entwicklungsrichtung nutzen lassen.15
13 Joseph Vogl: „Poetik des ökonomischen Menschen“. Zeitschrift für Germanistik, N.F., 17 (2007): S. 547-560, hier S. 560.
14 Luc Boltanski/Ève Chiapello. Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz: UVK, 2006. S. 92.
15 Ebd.
Gebote der Gegenwart
218
Der normative Aspekt von Managementtexten findet sich grundsätzlich auch in jeder anderen Form von Ratgeber und kann somit auch als Krite-rium für die Ratgeberzitate in den Romanen gelten. Unterscheiden kann man die verschiedenen Beratungstexte nach dem Ausmaß, in dem sie den Vorschrifts-Charakter ausprägen: Auf der einen Seite ist dann von schwach ausgeprägter Normativität zu sprechen, wenn die Anweisungen vorwiegend als eine von vielen Möglichkeiten präsentiert werden, sich also mehrheitlich informierend als Tipps oder Hinweise verstehen. Auf der anderen Seite ist von stark ausgeprägter Normativität zu sprechen, wenn die Anweisungen vorwiegend imperativisch als Gebote präsentiert werden. In irgendeiner Weise wird dann zur Einhaltung der Gebote motiviert, indem deutlich wird, dass ein Ignorieren der Regeln zwangsläufig zum Misserfolg führt. Neben der Normativität des Ratgebertextes ist für den Vorschrift-Charakter in der Romanfiktion zudem ausschlaggebend, ob neben dem Ratgeber-Text noch eine Beraterfigur existiert, die entweder den Rat verstärken oder sogar für die Durchsetzung der Gebote sorgen kann. Die Beraterfigur beeinflusst die meist im Zentrum der Romanhandlung stehende Figur des Ratsuchenden, eine Figur, die der schriftliche „zumal buchförmige Ratgeber […] vorausset-zen, unterstellen, kompensieren und supplementieren“ 16 muss. Dies ist auch deshalb relevant, weil ein in Anwesenheit ausgesprochener Rat eher befolgt wird, als ein Hinweis, den man lediglich irgendwo gelesen hat. Neben der Form der Übertragung der Ratgebertexte in Literatur interessiert hier also auch die Anwendung dieses Rates in der fiktionalen Welt. Anders gesagt: Die Normativität des Ratgeber-Textes wird durch die ihn umgebende Figu-renkonstellation mitbestimmt.
IV. Einzeltextreferenz mit schwacher Normativität: Georg M. Oswald: Alles was zählt / Rolf Dobelli: Und was machen Sie beruflich?
Die ersten beiden Beispiele, Georg M. Oswalds Alles was zählt und Rolf Dobellis Und was machen Sie beruflich?, folgen einer relativ einfachen, repro-duzierenden Form des Ratgeberzitats. Der Ratgeber liegt in beiden Fällen
16 Rudolf Helmstetter. „Ratgeber als Erfolgsflüsterer und der Schatten des Schei-terns“. Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen 7 (2012), H. 1-2: S. 49-56, hier S. 51.
Daniel Lutz
219
als Buch vor, beide Hauptfiguren besitzen ihren jeweiligen Text, ohne dass es dazu einer speziellen Empfehlung seitens anderer Figuren bedurft hätte. Beide Protagonisten zitieren Sätze aus jeweils einem Ratgeber, den sie im Laufe des Romans wiederholt zur Hand nehmen und beide Romane sind darüber hinaus nicht nur ihrem etwa 200-seitigen Umfang nach, sondern auch was ihre kleinteilige Kapitelabfolge angeht, recht ähnlich strukturiert. Gemeinsam ist ihnen auch der Plot: Ein verheirateter leitender Angestellter wird arbeitslos. Zudem folgt in beiden Romanen die Perspektivierung der Darstellung größtenteils der Wahrnehmung des Protagonisten: Der Leser teilt also in beiden Fällen die Sicht der gefeuerten Figur und nimmt dem-entsprechend auch nur Ratgebersätze wahr, die auch dieser auffallen oder in den Sinn kommen.
Die Zentralfigur in Oswalds Alles was zählt ist Thomas Schwarz, der in einer Bank die Position als „stellvertretender Leiter der Abteilung Abwick-lung und Verwertung“ innehat und dessen großes Ziel darin besteht „Leiter der Abteilung Abwicklung und Verwertung zu werden.“17 Seine Tätigkeit sieht konkret so aus, dass er den Kunden, die ihren Bankkredit nicht mehr bedie-nen können, noch möglichst viele verwertbare Gegenstände wegpfändet. Er gerät in seinem Job jedoch zunehmend selbst unter Druck, als ihn seine Vor-gesetzte auf einen nahezu unlösbaren Fall ansetzt. Offenbar will sie damit die Inkompetenz von Schwarz nachweisen, um ihn daraufhin entlassen zu kön-nen. In dieser Krisensituation greift Schwarz zu einem Ratgeber. Der von ihm konsultierte Text wird vom Ich-Erzähler folgendermaßen eingeführt:
Die Bauspargesellschaft unseres Bankhauses schenkte mir letztes Jahr zu Weihnachten das Buch ‚Heute ist ein schöner Tag‘. Jeder Bausparkunde, des-sen Ansparsumme fünfzigtausend übersteigt, bekommt es. Für jeden Tag des Jahres hält es einen Sinnspruch parat. Sie sind simpel und neigen dazu, die Intelligenz des Lesers zu beleidigen. Ich lese sie, wenn es mir schlechtgeht. Einer lautet: ‚Du bist ein außergewöhnlicher Mensch und weißt, daß der heu-tige Tag für dich erfolgreich sein wird. Freue dich darauf.‘ […] Ich gebe zu, es ist purer Masochismus, der mich immer wieder zu diesem idiotischen Buch zurücktreibt. Ich finde es praktisch, daß mich mein Arbeitgeber mit derart erbaulicher Lektüre versorgt, ich finde überhaupt alles daran gut. […] Ich liebe dieses Buch, denn es ist dazu geschaffen, mich von der Bürde der Individualität zu befreien, das spüre ich ganz genau.18
17 Georg M. Oswald. Alles was zählt. Roman. München: Hanser, 2000. S. 7.18 Ebd., S. 37f.
Gebote der Gegenwart
220
Schwarz ist die Naivität der Sentenzen also durchaus bewusst, er bleibt aber dessen ungeachtet ein treuer Leser seines Büchleins – und das auch noch, nachdem er entlassen wird. Der von Schwarz hervorgehobene, entindividu-alisierende Effekt des schmalen Bandes ist zunächst strukturell beschreib-bar, wird darüber hinaus aber auch an die Romanhandlung rückgekoppelt. Zunächst resultiert der Effekt aus der medialen Logik schriftlicher Anwei-sungsliteratur, die auf ein allgemeines Publikum ausgerichtet ist und not-wendigerweise generalisiert, da sie nicht – wie die mündliche Beratung – den Einzelfall im Blick haben kann.19 Die mangelnde Exklusivität, die allen für den Markt produzierten Ratgeberbüchern eignet, wird in Alles was zählt iro-nisiert durch die Verteilung des fiktiven Textes an eine Gruppe, die aus Per-sonen besteht, die eine nicht unerhebliche Anlagesumme überschreiten. Die ‚Mitglieder‘ dieser Gruppe begreifen sich aus eben diesem Grund aber nicht als Gemeinschaft, sondern halten sich für etwas Besonderes, oder wollen zumindest etwas Besonderes aus sich machen, wie uns der Erzähler Thomas Schwarz beständig vorexerziert. Dass Schwarz die von der Bank verteilten Ratgeberbotschaften auch nach seiner Kündigung nicht verwirft, ist in der Anlage des Romans durchaus konsequent, da er nach seiner Entlassung die Seiten wechselt und seine bei der Bank erworbenen Fähigkeiten und Kennt-nisse fortan der organisierten Kriminalität zur Verfügung stellt. Der Textlo-gik nach unterscheiden sich „Drinnen“ und „Draußen“20, Bank und Bordell strukturell nämlich nicht voneinander. Entsprechend sind auch die ‚Denk-positiv‘-Parolen des Ratgebers hier wie dort angebracht. Das wiederholte Zitieren von Spruchweisheiten soll in jedem Fall der Konturierung der eige-nen Individualität dienen und damit der eigenen Karriere auf die Sprünge helfen.21 Die Einsicht, dass es sich mitnichten um persönlich adressierte Bot-schaften, sondern vielmehr um eine allgemeine Anrufung handelt, wird im Verlauf des Romans immer unausweichlicher. Am Ende versucht Schwarz’ „endgültig loszuwerden, was ich ohnehin nie besessen habe: eine Identität“22.
19 Zum medialen Wandel der Beratung vgl. Alfred Messerli. „Eine Entwicklungs-geschichte der Medien und der Rhetorik des Rates“. Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen 7 (2012), H. 1-2: S. 13-26.
20 So die Titel, nach denen der Text zweigeteilt ist. Oswald. Alles was zählt (wie Anm. 17), S. 5 und 103.
21 Zu den Ratgebersätzen, die Schwarz zitiert (ebd., S. 37f., 62, 71, 88, 163), gesellt sich noch ein Werbeslogan des Wall Street Journal, den seine Frau Marianne verwendet: „Success is a daily issue“ (ebd., S. 74, 76).
22 Ebd., S. 199.
Daniel Lutz
221
Das den Roman bestimmende Paradox, nach dem sich alle darum bemühen, ihre je eigene Karriereleiter hochzuklettern – ein Prinzip, das der Ich-Erzäh-ler stets durchschaut und dennoch selbst vollzieht – bestimmt auch die Stra-tegie des Ratgeberbüchleins, ein persönliches Erfolgsversprechen zu formu-lieren, das prinzipiell alle Leser einlösen können. Die „Ausdrücklichkeit, mit der ein (Bescheid-)Wissen als Konkurrenzvorteil in Aussicht gestellt“ wird, weist auch darauf hin, dass es sich nicht um Wissen im strengen Sinne han-delt, denn beim „Bescheid-Wissen“ geht es „um Kompetenz, die im Unter-schied zu Wissen, Können und Tugenden immer kompetitiv ist.“23 Ratge-bertexte eignen sich in dieser Hinsicht für die literarische Darstellung von Konkurrenzverhältnissen in einer marktorientierten Ökonomie, indem über sie das Versprechen eines Wettbewerbsvorteils ins Spiel kommt, und damit eines Vorsprungs vor den Konkurrenten, der immer gefährdet ist, weil eben alle nach diesen Vorteilen und Vorsprüngen Ausschau halten.
In Dobellis Roman Und was machen Sie beruflich? wird eine ähnliche Ratgeberverwendung wie in Alles was zählt inszeniert. Gegenüber Oswalds Roman tritt der Ratgebergebrauch des Marketingdirektors Gehrer bei Dobelli jedoch erst infolge seiner Entlassung auf. Bei dem verwendeten Text handelt sich um den Titel Durchstarten zum Traumjob – „ein Klassiker in seinem Genre“24 –, den Gehrer nach seinem Rausschmiss während eines Karibikurlaubs zur Hand nimmt, um seine Reintegration in die Arbeitswelt voranzutreiben. Damit wird nun ein tatsächlich existierender Bewerbungs-ratgeber zitiert: nämlich der seit Anfang der 1970er Jahre in jährlicher Neu-auflage erscheinende Bestseller What Color is Your Parachute? von Richard Nelson Bolles.25 Der US-amerikanische, ehemalige episkopale Pastor hat seitdem sein ‚Job-Hunting-Book‘ millionenfach verkauft, das in der deut-schen Variante eben mit Durchstarten zum Traumjob betitelt ist.26 Als Mar-kenzeichen des Ratgebers dient, sowohl in der amerikanischen wie auch in
23 Helmstetter. „Ratgeber als Erfolgsflüsterer“ (wie Anm. 16), S. 56.24 Rolf Dobelli. Und was machen Sie beruflich? Roman. Zürich: Diogenes, 2004.
S. 66.25 Richard Nelson Bolles. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for
Job Hunters & CareerChangers [2003 Edition]. Berkeley/Toronto: Ten Speed Press, 2003. Der Umschlag der Ausgabe von 2003 verkündet: „Over 7 million copies in print!“
26 Richard Nelson Bolles. Durchstarten zum Traumjob. Das ultimative Handbuch für Ein, Um und Aufsteiger. 9. akt. und überarb. Aufl. Frankfurt a. M./New York: Campus, 2009.
Gebote der Gegenwart
222
der deutschen Fassung, ein „bunter Fallschirm auf dem Umschlag“27. Trotz oder gerade wegen seines großen Erfolgs wird die pragmatische Ausrich-tung des Handbuchs im Erzählerkommentar von Dobellis Roman skeptisch interpretiert:
Das Buch soll dem Leser helfen, sich selbst zu erkennen. Es folgt getreu der sich hartnäckig haltenden Vermutung, daß so etwas wie Berufung existiere, die irgendwo zu finden sei, im Herzen, in der Schachtel des Unbewußten oder in der eigenen DNA, niemand weiß das so genau. Auf jeden Fall sei es dem Men-schen angezeigt, auf diesen verborgenen Knopf zu drücken, und das Leben würde seine Pracht entfalten wie ein Pfau sein Rad.28
Entsprechend wollen die positiven Botschaften auch bei Gehrer nicht ver-fangen. Die „amerikanische Self-Help-Literatur“29 löst bei ihm keine enga-gierte Reaktion aus, das ‚Durchstarten‘ zu einem neuen Job schlägt folglich fehl.30 Stattdessen geht es mit Gehrers Ambitionen immer weiter abwärts. Mit deutlichen Anleihen beim Spätwerk von Max Frisch wird im weiteren Verlauf die „logische Progression eines Niedergangs“31 erzählt. Die im Rat-geber formulierten Aufforderungen führen denn auch nicht zum eigentlich intendierten Selbstmanagement, sondern Gehrer regrediert zum Haus-mann mit starkem Hang zur existentiellen Selbstbefragung. Symptomatisch reagiert er auf ‚Empowerment‘-Strategien tendenziell konsterniert: „‚Start the life you really want to live.‘ Gehrer ist überrascht, daß mit ihm nichts passiert. ‚Know what you want!‘ Wie soll man das wissen?“32 An diesem Beispiel fällt zugleich die Eigentümlichkeit auf, dass die Ratgeberzitate im Roman dem englischsprachigen Original entnommen sind, wohingegen der Titel nur auf Deutsch vorkommt. Dies ist letztlich inkonsequent, da Gehrer ja nicht englische Sätze aus der deutschen Übersetzung entnehmen kann, denn er besitzt ja explizit den Titel Durchstarten zum Traumjob.33 Es ist aber
27 Dobelli. Und was machen Sie beruflich? (wie Anm. 24), S. 227.28 Ebd., S. 68.29 Ebd. 30 Einen Überblick zu diesem Genre gibt Birgitta Koch-Linde. Amerikanische
Tagträume. Success und SelfHelp Literatur der USA. Frankfurt a. M./New York: Campus, 1984.
31 Dobelli. Und was machen Sie beruflich? (wie Anm. 24), S. 221.32 Ebd., S. 69.33 Vgl. ebd., S. 66f. und 227f.
Daniel Lutz
223
insofern bezeichnend, als hier weder die sprachliche noch die praktische Übertragung der Ratgebermethoden funktioniert, was auch an einer Eigen-heit dieser Art von Selbsthilfe-Literatur liegt: Verlangt wird nämlich, nicht nur die Motivationshinweise zu lesen, sondern auch die im Buch beschrie-benen Übungen zu praktizieren. Das reicht von der bildlichen Skizzierung eigener Wunschvorstellungen bis zur Erstellung von Prioritätenlisten und anderen ‚Aktivitäten‘. Nach zaghaften Durchführungsversuchen ignoriert Gehrer aber gerade diese Übungen ostentativ. Darauf weist ihn am Ende sogar seine Frau hin, die ihm zu seiner Motivation ausgerechnet eben jenes Buch schenkt, das er doch schon längst kennt und für vollkommen nutz-los erachtet hat. Gehrer wird von ihr noch eigens darauf hingewiesen, dass er unbedingt die Übungen machen müsse um Erfolg zu haben. Stattdessen setzt sich in seinen Gedanken ein einzelner Satz aus dem Buch fest: „‚Decide what you really want‘ […] Auch nach Wochen, als das Buch bereits als zer-fleddertes Bündel draußen auf dem Kiesplatz liegt, bleibt der Satz auf seinem Nachttisch, auf seinen Tapeten, auf seiner Haut liegen.“34 Im Blick auf den Umgang mit dem ratgeberischen Bescheid-Wissen heißt dies: Statt eines systematischen Zugriffs auf den Ratgeber wählt Gehrer den kursorischen Zugang, über den er nie hinausgelangt. Statt das Buch als Trainingspro-gramm zu verstehen und dementsprechend Übungen zu absolvieren, sieht Gehrer in dem Text nur eine Ansammlung merkwürdiger Zitate. Dobellis Verfallsgeschichte eines mittleren Managers ist somit nicht nur Kritik an der Selbsthilfe-Literatur, sie zeigt mithin auch eine inadäquate Lektürevariante dieser Literatur auf. Gleichwohl überwiegt wie auch bei Oswald der skep-tische Tonfall gegenüber den Verheißungen der Ratgeber, so dass von einer Verteidigung solcher Texte kaum die Rede sein kann. Wie auch in Alles was zählt ist die Normativität hier nur schwach entwickelt, auch weil der schriftli-che Ratgeber nicht oder zu spät von einer beratenden Figur unterstützt wird, die zur Umsetzung der Botschaften animiert. Beide Romane können daher selbst als Beratung über Ratgeber gelesen werden, als „Lehrbuch der neolibe-ral ideologisierten Lebensform“35, das die Konsequenzen in der Anwendung von Anleitungsformeln in der Arbeitswelt vorführt, ohne selbst ein höheres Bescheid-Wissen in Anschlag zu bringen.
34 Ebd., S. 229f.35 Hubert Winkels. „Turbokapitalismus in Zeitlupe. Georg M. Oswalds Roman
Alles was zählt“. H. W. Gute Zeichen. Deutsche Literatur 19952005. Köln: Kie-penheuer & Witsch, 2005. S. 264.
Gebote der Gegenwart
224
Unabhängig voneinander haben beide Autoren dieses Programm im Rahmen einer Zeitungskolumne fortgeführt. Im Gegensatz zur üblichen Ratgeberliteratur zeigen Oswald und Dobelli darin die Aporien und Para-doxien eines vermeintlichen Regelwissens auf. So können beide Autoren den Beratungsdiskurs skeptisch weiterverfolgen und ihn gleichzeitig mit eigenen Texten bedienen. Oswald publiziert seit 2007 jeden Samstag seine Büroall-tagskolumne Wie war dein Tag, Schatz? auf den ‚Beruf und Chance‘-Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dobelli hat äußerst erfolgreich die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen ‚heuristics-and-biases‘-Forschung popularisiert, die sich mit den Auswirkungen prognostischer Verzerrungen beschäftigt.36 Die zuerst in der FAZ und der ZEIT veröffentlichten Kolum-nen avancierten in Buchform zu Bestsellern, deren Verkaufserfolg sich auch neben Longsellern wie Bolles’ What Color is Your Parachute? sehen lassen kann.37
V. Einzeltextreferenz mit starker Normativität: Ernst-Wilhelm Händler: Wenn wir sterben
Gegenüber der ‚offenen‘ Einzeltextreferenz bei Dobelli ist Ernst-Wilhelm Händlers Wenn wir sterben ein Beispiel für ‚versteckte‘ Intertextualität bei gleichzeitiger Veränderung der Stil-Lage des Vorbilds. Im Zentrum der Dar-stellung steht der Machtkampf von vier Managerinnen um die Vorherrschaft der Firma Voigtländer. In Wenn wir sterben ist ein Text der zukunftsorien-tierten Managementliteratur an zentraler Stelle eingesetzt, indem ein Orga-nisationsdesigner Zitate aus Kevin Kellys New Rules for the New Economy, einer äußerst erfolgreichen New-Economy-Bibel der späten 1990er Jahre, in den Mund gelegt werden.38 Der Einzeltextbezug wird im Roman zwar
36 Vgl. dazu Daniel Kahneman. Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler, 2011.
37 Rolf Dobelli. Die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. München: Hanser, 2011 und Die Kunst des klugen Handelns. 52 Irrwege, die sie besser anderen überlassen. München: Hanser, 2012.
38 Kevin Kelly. New Rules for the New Economy. 10 Radical Strategies for a Connected World. New York u.a.: Viking, 1998. Vgl. auch die Online-Version unter http://www.kk.org/books/KevinKelly-NewRules-withads.pdf (Stand: 01.12.2012).
Daniel Lutz
225
nicht explizit benannt, jedoch wird der Zitatcharakter durch Beibehaltung des amerikanischen Englisch und durch Kursivsetzung im Text signalisiert.39 Die Bezeichnung ‚Bibel‘ ist dabei insofern gerechtfertigt, als das Konzept Kellys auf die zehn Gebote der neuen Ökonomie hinausläuft. Die in zwei Abschnitten einmontierten englischsprachigen Zitate und Paraphrasen aus Kellys New Rules sind als Begründungsrede für die Umstrukturierung der Firma zu verstehen und damit auch als Argumentation für die Entlassung einer Managerin.40 Bemerkenswert an den Übernahmen von Kellys Ratgeber in Händlers Roman ist die sprachliche Verschärfung der präskriptiven Aus-richtung, die sich im Roman – weitaus stärker als in der Vorlage – in einem prophetischen Tonfall niederschlägt. Kellys Buch versucht anhand von eini-gen passenden, möglichst allgemein gehaltenen Beispielen, aus dem Wachs-tum des Internet und der Informationstechnologie einen ökonomischen Paradigmenwechsel abzuleiten, der die ‚alte‘ industrielle und damit produk-tionsorientierte Wirtschaft durch die dienstleistungsorientierte ‚New Eco-nomy‘ ablösen soll.41 Auch mittels äußerst einfach gehaltener Schaubilder werden dabei allgemeine Gebote illustriert, die am Schluss des Buches noch-mals auf einer Seite – als Dekalog der zukünftigen Wirtschaft – präsentiert werden.42
39 Zur Markierung intertextueller Referenzen vgl. Ulrich Broich. „Formen der Markierung von Intertextualität“. Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Hg. Ulrich Broich/Manfred Pfister. Tübingen: Niemeyer, 1985, S. 31-47. Zur Graduierung von Intertextualität nach Markierungsintensi-tät vgl. Jörg Helbig. Intertextualität und Markierung. Untersuchungen zur Systematik und Funktion der Signalisierung von Intertextualität. Heidelberg: Winter, 1996.
40 Ernst-Wilhelm Händler. Wenn wir sterben. Roman. Frankfurt a. M.: FVA, 42002. S. 174-176 und 180-182.
41 Kelly. New Rules (wie Anm. 38), S. 2: „The key premise of this book is that the principles governing the world of the soft – the world of intangibles, of media, of software, and of services – will soon command the world of the hard – the world of reality, atoms, of objects, of steel and oil, and the hard work done by the sweat of brows.“
42 Ebd., S. 161: „1) Embrace the Swarm […] 2) Increasing Returns […] 3) Plenti-tude, Not Scarcity […] 4) Follow the Free […] 5) Feed the Web First […] 6) Let Go at the Top […] 7) From Places to Spaces […] 8) No Harmony, All Flux […] 9) Relationship Tech […] 10) Opportunities before Efficiencies“.
Gebote der Gegenwart
226
Die Art und Weise wie der Roman Kellys Buch zitiert und paraphrasiert, vollzieht sich also nicht einfach in Form einer mehr oder weniger getreuen Wiedergabe oder Zusammenfassung, vielmehr verschärft der Roman die Normativität des Ratgeber zu einer bedrohlichen Größe. Im Wechsel von wörtlicher Zitierung und Paraphrasierung des Inhalts findet sich so in den beiden kurzen Abschnitten ein Parforceritt durch die New Rules.43 Die Zuspitzung von Kellys Text durch Händlers Roman wird beispielhaft an zwei signifikanten Abweichungen vom Prätext deutlich. Die erste Abwei-chung besteht in einer Auslassung: Der Kelly-Satz im Original lautet: „Even-tually technical standards will become as important as laws“44. Er wird in Händlers Roman verarbeitet zu „Wer konnte das auch ahn [!], technical standards will become as important as laws.“45 Allein dadurch, dass das ein-schränkende „Eventually“ nicht zitiert wird, wirkt der Satz bei Händler wie eine Verkündigung, während Kellys Original eigentlich nur eine Vermutung äußert. Der Verkündigungsstil setzt sich bei Händlers Bearbeitung aber auch auf umgekehrte Weise fort. In Wenn wir sterben heißt es: „Information replaces mass, industrial materials will be replaced by nearly weightless hightech knowhow.“46 In Kellys Text handelt es sich dagegen um einen Sachver-halt, der bereits eingetreten ist: „Industrial materials have been replaced by nearly weightless high-tech know-how in the form of plastics and composite fiber materials.“47 Daraus ergibt sich, dass der prophetische Tonfall in bei-den Fällen erst durch die veränderte Einarbeitung in den Roman entsteht und im Prätext so eindeutig nicht vorhanden ist. Die Transformierung dieses ökonomischen ‚Zukunftswissens‘ interpretiert den Ratgebertext Kellys als aggressive und – im Sinne von Boltanski und Chiapello – normative Strate-gie. Entsprechend benutzt der Roman die Ratgebervorlage für eine Macht-demonstration in Form eines Sprechakts: Das Kapitel endet damit, dass die
43 Ein ‚Satz für Satz‘-Nachweis der intertextuellen Bezüge würde hier den Rah-men sprengen und wäre hinsichtlich seiner Aussagekraft auch nicht angemes-sen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zitate und Paraphrasen im ersten Abschnitt (Händler. Wenn wir sterben, S. 174-176) auf die Kapitel 3-8 bei Kelly referieren (Kelly. New Rules, S. 39-117) und im zweiten Abschnitt (Händler. Wenn wir sterben, S. 180-182) auf die Kapitel 9 und 10 (Kelly. New Rules, S. 118-155).
44 Ebd., S. 71.45 Händler. Wenn wir sterben (wie Anm. 40), S. 175.46 Ebd.47 Kelly. New Rules (wie Anm. 38), S. 73.
Daniel Lutz
227
vom Redeschwall des Organisationsdesigners angesprochene Figur namens Bär, die bislang für die Arbeitsplanung der Firma Voigtländer zuständig war, unmissverständlich zum Verlassen der Firma aufgefordert wird. Die Konse-quenzen der neuen Regeln werden also direkt wirksam: Die Verkündigung eines neuen Konzepts geht hier einher mit dem Ausschluss einer nicht-kom-patiblen Figur. Die Auswirkungen auf der Handlungsebene zeigen an, dass Prognosen über wirtschaftliche Veränderungen, wie sie die New Rules for the New Economy zusammenfassen, nicht als unverbindliche Zukunftspro-gnosen gewertet werden, sondern als konkret formulierte Handlungsanlei-tungen. In Form der Verkündigung bestimmt der Organisationsdesigner die ökonomische Erwartung, an der sich wiederum das unternehmerische Han-deln orientiert. Es wird also nicht darauf gewartet, ob die Erwartungen ein-treffen, vielmehr wird entschieden, auf die Erwartungen zu reagieren, indem man dem neuen Paradigma folgt.48 Mit anderen Worten: Die Prognose des Managementratgebers wird bereits verbindlich, wenn man sich entscheidet, ihr zu folgen. Die Erwartung kippt dann gewissermaßen vom Möglichen ins Wirkliche.
Die Transformierung des ökonomischen Ratgeberwissens in Händlers lite-rarischen Text verschärft die normsetzende Wirkung von Vorhersagen. Das Ratgeber-Vorbild wird zudem verschärft, indem die entsprechenden Zitate in eine asymmetrische Kommunikationssituation eingebunden werden. Das Verfahren der stilistischen Nachahmung tendiert somit ins Satirische, insofern Techniken der Übertreibung eingesetzt werden. Allerdings dienen die Über-nahmen von Kellys Buch nicht allein der Entlarvung.49 So weist vor allem die Textorganisation von Wenn wir sterben mit ihrer modularen Struktur ein Ähnlichkeitsverhältnis zu den Thesen der New Rules auf. Wenn Kelly die Formen der Wunschproduktion an die technologische Entwicklung koppelt, ergibt sich darüber hinaus eine ähnliche ‚Logik der Wünsche‘, die hinsicht-lich der ökonomischen Erwartungsstruktur von Bedeutung ist: „Although at some fundamental level our wants connect to our psyches, and each desire
48 Vgl. Niklas Luhmann. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhr-kamp, 1988. Luhmann schlägt vor, „eine Handlung immer dann als Entscheidung anzusehen, wenn sie auf eine an sie gerichtete Erwartung reagiert“ (S. 278).
49 Besonders hervorzuheben ist dabei eine Stelle, die den Kontrast der neuen Regeln zum umfassenden Imitationsverfahren des Romans durch ein einziges Wort markiert: „Innovate, don’t imitate. Hüsteln“. Händler. Wenn wir sterben (wie Anm. 40), S. 175.
Gebote der Gegenwart
228
can be traced to some primeval urge, technology creates ever new opportu-nities for those desires to find outlets and form.“50 Obwohl also, nach Kelly, die Wünsche auf einen Grundtrieb des Menschen zurückzuführen sind, sorgt der technologische Fortschritt dafür, dass diese Wünsche immer neue Gestalt annehmen. Es deutet sich also, trotz der biologistischen Argumentation, eine Umkehrung der Wunschlogik an, die nicht mehr vom Menschen, sondern von der Technologie aus denkt. In Wenn wir sterben ist diese Umkehrung der-gestalt konturiert, dass die Produktion von Wünschen auf dem technologi-schen Stand der Wirtschaft basiert. Die Wunschbilder sind von den Regeln, Verfahren und Machbarkeiten der Produktion geformt, so dass Begierden und Erwartungen keine anthropologischen Konstanten mehr darstellen, son-dern in Abhängigkeit von der Verfasstheit des ökonomischen Subjekts veror-tet werden: „Jetzt sind sie wieder da, diese Wünsche, die zugehörigen Men-schen werden noch gesucht. Wir müssen es ertragen, daß man den Wünschen die Menschen nimmt und gibt.“51 Der Ratgeber funktioniert in diesem Sinne gleichfalls als Begehrlichkeiten produzierende Wunschmaschinerie, welche von den Subjekten als eigener Antrieb wahrgenommen wird.
VI. Normative Notwendigkeit im Beratungsnetzwerk: Martin Walser: Angstblüte
In Martin Walsers Angstblüte eröffnet sich das Feld der Beratung aus der Per-spektive des Beraters. Der Protagonist ist nicht Ratsuchender, sondern selbst Autor beratender Schriften. Karl von Kahn, ein siebzigjähriger Münchner Anlageberater, betreut einen Kundenstamm von sechzig- bis neunzigjähri-gen Anlegern. Für seine Klienten verfasst er regelmäßig ein Blatt mit dem altmodischen Titel KundenPost, dessen Artikel er mit Zitaten und Anspie-lungen aus einem breiten Fundus an literarischen, philosophischen und religiösen Vorbildern ausstaffiert. Von Kahns Schriften verfolgen also eine ratgebertypische Strategie der Pragmatisierung von sogenannter Hochkul-tur: „Das Klassiker-Zitat signalisiert ‚Bildung‘ und führt vor, wie auch die auf ‚Lebens-Praxis‘ gerichtete Beratung die praxisferne ästhetische Litera-tur in Dienst nehmen kann.“52 Als eine Art von Firmenmagazin verfolgt die
50 Kelly. New Rules (wie Anm. 38), S. 152.51 Händler. Wenn wir sterben (wie Anm. 40), S. 37.52 Helmstetter. Guter Rat ist (un)modern (wie Anm. 11), S. 169.
Daniel Lutz
229
KundenPost eine prinzipiell daumendrückende Haltung, da sie die Klienten dahingehend zu orientieren sucht, dass sie mit ihrer bereits eingeschlage-nen Strategie auf dem richtigen Weg sind. Es geht also darum, den Kunden Zuversicht einzuflößen. Obgleich Karl von Kahn diese Zuversicht als Illu-sion durchschaut, hält er sie für unabdingbar. Der durchschaute Zusammen-hang führt wie bei Oswald nicht zu einer Verhaltensänderung. Stattdessen betont von Kahn illusionäres Denken als unumgängliche anthropologische Konstante: „Jeder Mensch ist bereit, sich die Welt schönreden zu lassen. Nicht nur bereit. Er ist dessen bedürftig.“53 Und ähnlich wie bei Oswald affir-miert der Protagonist den Konkurrenzkampf, dem er selbst unterliegt: „Die Schlacht wird vom Besseren gewonnen. Das ist das tautologische Axiom […] Wenn du nicht gewinnst, bist du der Schlechtere. Du kannst aber gewinnen. Denn jeder ist der Bessere. Das ist so paradox wie wahr. Absolut wahr.“54
In diesem Kontext orientiert sich die KundenPost der Form nach am soge-nannten Anlegerbrief, wie ihn auch von Kahns Hausheiliger, der US-ame-rikanische Investment-Guru Warren Buffett, tatsächlich herausgibt. Dieser Anlegerbrief soll den Klienten bei ihren Börseninvestitionen behilflich sein und hält Einschätzungen über die Weltmarktlage bereit, wie man sie auch im Wirtschaftsteil von Zeitungen findet. Im Gegensatz zum Zeitungsbe-richt und vor allem im Gegensatz zur üblichen, generalisierten Adressierung schriftlicher Ratgeber ist der Anlegerbrief aber, wie sein Name schon sagt, der Intention nach persönlich adressiert. Obwohl auch der Anlegerbrief die persönliche Ansprache nur simuliert und so verdeckt, dass es sich um gene-ralisierte Tipps handelt, ist von Kahn an dieser Diversifizierung seiner Kun-denkommunikation gelegen. Durch seinen kleinen Kundenkreis befindet er sich ohnehin in der Lage, seine Beratung sowohl schriftlich wie auch münd-lich zu streuen. Dazu setzt er die rhetorischen Mittel in seinen schriftlichen und mündlichen Ratschlägen gezielt ein: Während er in der KundenPost gerne Bildungs-Zitate verwendet, tut er dies im Kundengespräch nicht, weil das Bildungs-Zitat in mündlicher Kommunikation arrogant wirken würde, was es schon deshalb zu vermeiden gilt, da sein Geschäftsmodell weitgehend auf dem Vertrauen beruht, das ihm seine Kunden entgegenbringen. Im Kun-dengespräch gibt er sich lieber „erfahrungsreich, hell und zukunftsfroh“55.
53 Martin Walser. Angstblüte. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006. S. 27.
54 Ebd.55 Ebd., S. 28.
Gebote der Gegenwart
230
In Angstblüte liegt somit eine Verschränkung von Ratgebertext und bera-tender Figur vor, die den Vollzug von Beratung in den Vordergrund rückt. Walsers Roman vervielfacht das Szenario der Beratung über seinen Protago-nisten hinaus: Es finden sich neben Karl von Kahn und seinem Anlegerbrief noch weitere Beratungsinstanzen, die hier allenfalls angedeutet werden kön-nen. So gibt Amadeus Stengl, ein Kollege von Kahns, ein ähnliches Blatt mit dem vielversprechenden Namen MidasBriefe heraus, die beweisen sollen, „daß man Wirtschaftsnachrichten mit Geist und Witz verkaufen kann“56. Ebenfalls erwähnt wird der tatsächlich existierende Granville Market Letter, den eine Kundin zu ihrer Referenzgröße in Sachen Prognosegenauigkeit erhebt57, und von Kahns Frau Helen ist – um das konsultative Bild zu vervoll-ständigen – auch noch als Ehetherapeutin tätig. Ihr Beruf besteht laut von Kahn darin, die „wissenschaftliche Erforschung der Ehe und die Anwendung des Erforschten in der Eheberatung“ miteinander zu vermitteln. Eines ihrer geplanten Bücher trägt den Titel Der erfolgreiche Patient, und ein Referat, das sie ihrem Ehemann vorstellt, lautet Warum darf der Traum Klartext der Ehe genannt werden?58 Entscheidend für die Beratungsstrategie Karl von Kahns und für alle Konsultationspraktiken, die wir aus seiner Perspektive kennenler-nen, ist die im Allgemeinen wie Besonderen durchweg imitative Anlage der Beratung. Das buchstäbliche Reflektieren auf die Umwelt wird zum Bestä-tigungsprogramm: „Seine Vorschläge waren ganz und gar das Resultat des-sen, was die Kunden ihm erzählten. […] Jeder Mensch muß jedem anderen Menschen gegenüber die Welt preisen. Sonst hört sich alles auf. Verzweifeln darf jeder für sich.“59 Dass niemand verzweifeln muss, ist mithin das Ziel der Beratung. In Walsers Transformierung des Anlegerbriefs wird darüber hinaus die Transformation als solche, die Übersetzungsleistung selbst, thematisiert:
Karl von Kahn übersetzte in seiner immer freitags verschickten KundenPost alles Wirtschaftliche ins Menschliche, verwendete aber soviel Farben aus dem Branchenflor, daß seine Kunden an seiner Zuständigkeit nie zweifeln konnten. Das ganze soziologisch-statistische Alarmierungsgewäsch, also alles, worin Demographie vorkam, ließ er höchstens zu, um seine Sechzig- bis Neunzig-jährigen zum Lachen zu bringen.60
56 Ebd., S. 81.57 Ebd., S. 116.58 Vgl. ebd., S. 295.59 Ebd., S. 28.60 Ebd., S. 25.
Daniel Lutz
231
In der Übersetzung des Wirtschaftlichen ins Menschliche wird der Markt als vitale Sphäre gepriesen, dagegen steht der Komplex von Staat und Experten, die Beschränkung und Kontrolle das Wort reden.61 Von Kahn vermittelt also kein wissenschaftliches Wissen, sondern grenzt sich explizit gegen Statistik ab, indem er sie als ‚Alarmierungsgewäsch‘ abqualifiziert. Auch was seine Vermittlung von Wirtschaftskenntnissen angeht, ist kein spezifisch wissen-schaftlicher Bezug erkennbar. Von Kahn vermittelt stattdessen das bereits Vermittelte: „Dr. Dirks Bericht über die MedTech-Tagung lesen, sich von Berthold Brauch über die neuesten Bloomberg-Nachrichten informieren lassen und die guten alten Zeitungen studieren“, so stellt sich seine Infor-mationsgewinnung dar. Seinen Kunden voraus ist er vor allem, weil er sich schneller als sie informiert, soll heißen, die allen zugänglichen Quellen früher nutzt, und nicht, weil er ein Mehr- oder Besserwissen für sich reklamiert.62 Der Ratgeber ist in diesem Verständnis einer, der möglichst schnell infor-miert ist, einer, der diesen Vorsprung braucht, um kompetent zu erscheinen, und einer, der immer sagen kann, dass er alles schon gehört, gesehen oder gelesen hat, was seine Klienten an ihn herantragen.
VII. Normativität als Formzitat: Bodo Kirchhoff: Erinnerungen an meinen Porsche
Als erster Roman, der auf die Finanzkrise reagiert hat, darf Bodo Kirchhoffs Erinnerungen an meinen Porsche gelten. Nur fünf Monate nach dem Ban-krott von Lehman Brothers am 15. September 2008 erscheint Kirchhoffs Text Mitte Februar 2009 als eine Literarisierung dieses Ereignisses. Nach seinem 2002 erschienen Schundroman hat Kirchhoff abermals ein triviallite-rarisches Handlungsschema umgesetzt: Der Finanzberater Daniel Deserno
61 Vgl. dazu genauer Alexander Preisinger. „‚Wollte man ihr etwas über Geld sagen, mußte man sich bildlich ausdrücken‘ – Literarische Diskursintegration der Ökonomie am Beispiel von Walsers Angstblüte und Timms Kopfjäger“. Finanzen und Fiktionen. Grenzgänge zwischen Literatur und Wirtschaft. Hg. Chris-tine Künzel/Dirk Hempel. Frankfurt a. M./New York: Campus, 2011. S. 217-234, zu Walser S. 219-225.
62 Walser. Angstblüte (wie Anm. 53), S. 10: „Karl von Kahn hatte es zur Lebensbe-dingung schlechthin gemacht, vor seinen Kunden auf zu sein, die Börsenkurse zu studieren, bevor seine Kunden sie studierten.“
Gebote der Gegenwart
232
befindet sich in einem Sanatorium, weil er von seiner Freundin mit einem Korkenzieher entmannt wurde. Vom Sanatorium aus, in dem sich, leicht ver-schlüsselt, ein nicht unerheblicher Teil der zeitgenössischen Medienpromi-nenz einfindet, schreibt er seine Erfahrungen der letzten Jahre auf, die wir, so die Fiktion, wiederum als Roman lesen. Desernos Krankheitsbild wird dia-gnostiziert als „spontan reaktive[] Gangstörung im Rahmen einer persona-len Gesamtkrise“63. Sein zerschundenes Geschlechtsorgan, das er eben Por-sche nennt, löst somit die titelgebenden Reminiszenzen aus.64 Die Anlage des Romans ist jedoch komplexer konstruiert, als es der Plot vermuten lässt. Erinnerungen an meinen Porsche ist, so Peter Sloterdijk, auf die Erzeugung hochliterarischer Trash-Literatur aus: „Das Rezept von Kirchhoffs Prosa […]: Du setzt das Niveau so weit unten an, daß du nur noch positiv überra-schen kannst – der Effekt davon ist: Low erscheint als eine Form von High.“65 Die erzählte Konstruktion geht davon aus, dass der Finanzinvestor durch seine persönliche Krise, die den Zustand der Finanzwelt widerspiegelt, über-haupt erst die Zeit findet, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Der Roman wird also von einem schriftstellerischen Autodidakten verfasst, der eine fol-genreiche Umstellung seiner Prioritäten vornimmt. Statt sich wie bisher vor-wiegend mit der Börse zu beschäftigen, strebt er nun eine Art literarische Therapie an. Wie bei Neuorientierungen üblich, greift er dabei auf vertraute Muster zurück. Explizit weist Deserno darauf hin, dass im Regelwissen auch ein gewisser Trost liegt, „wie in jeder Anleitung, die einem Laien Erfolg ver-spricht, ich denke da auch an die zehn goldenen Regeln für Investoren […] die hier anzuführen sicher langweilig wäre, außerdem überholt.“66 Da die gol-denen Regeln für Investoren durch die Krise obsolet geworden sind, stellt
63 Bodo Kirchhoff. Erinnerungen an meinen Porsche. Roman. Hamburg: Hoff-mann und Campe, 2009. Zitate im Folgenden mit Angabe der Seitenzahlen in Klammern.
64 Mit der unmittelbar einleuchtenden Verbindung von versiegender Potenz und Finanzkrise spielt auch die auf den ersten Blick sehr nüchtern wirkende Umschlagabbildung der Erstausgabe, die ein absteigendes Säulendiagramm zeigt.
65 Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 20082011. Berlin: Suhrkamp, 2012. S. 170. Dort wird auch Kirchhoffs Auftritt zum Thema Finanzkrise im Philosophischen Quartett gelobt: „Bodo Kirchhoff überzeugte deutlich mehr als Beatrice Weder de Mauro, die ‚Wirtschaftsweise‘, die durchweg sehr vorsichtig, unpointiert und ex officio redete.“ (S. 172)
66 Kirchhoff. Erinnerungen (wie Anm. 63), S. 144.
Daniel Lutz
233
Deserno im Laufe des Romans kurzerhand zehn neue goldene Regeln auf, jetzt aber nicht mehr für Investoren, sondern für Schriftsteller. So entwickelt der literarische Laie ein Anleitungswissen für gelungene Belletristik, genauer gesagt: Er renoviert den überholten Finanzratgeber, indem er die Form für einen neuen Inhalt benutzt. Zusammengefasst ergeben sich daraus über den Text verteilt folgende zehn Gebote für Autoren:
Regel Nummer eins: Wer ein Buch schreiben will, muss Zeit und Geld haben und wenigstens einen guten Grund. (7)[…] nur sollte sich einer, der’s ernst meint, nicht gleich bei allen beliebt machen wollen: Regel Nummer zwei für mein Gefühl. (8)Regel Nummer drei: Schreiben heißt sich erinnern, ohne Rücksicht auf Ver-luste (also das Gegenteil von hedging); wer von sich erzählen will und zugleich ein guter Mensch sein möchte, wird nie ein gutes Buch zustande bringen, Punkt. (23)[…] das Buch über mein Leben […], logisch aufgebaut und verständlich geschrieben, aber aus den Eiern heraus, wenn ich das so sagen darf, unter Einbeziehung des Porschewracks und damit frei nach Desernos Regel vier: Schreiben ist Handwerk plus eigener Sumpf, das eine ohne das andere ist nichts. (49)Denn nur Figuren, die man kennt und mag, ergeben eine gute Geschichte; die beste Story dagegen bringt keine guten Figuren hervor, solche aus Fleisch und Blut, essend, scheißend, liebend: Regeln Nummer fünf und sechs, würde ich sagen. (111)Regel Nummer sieben: Es gibt kein keusches Schreiben, außer man ist heilig, und dann hätte man es immer noch mit der Sehnsucht zu tun. Schreiben ist immer auch Sex, und Sex, wenn man ihn ernst nimmt, erfordert Mut: ohne Mut kein gutes Schreiben. (144)Regel Nummer acht […]: Sprache ist ein Instrument wie Klavier oder Geige; beim Schreiben zählt nicht der Stil, es zählt nur der Ton. (167f.)Zeitnah erzählen und dabei zeitlos sein […] (als Nummer neun) (198).Regel Nummer zehn: Für alle Schreibregeln gilt auch das Gegenteil, wenn das Ergebnis reinhaut. (220)
Die Grundstruktur von Erfolgsregeln, wie sie Deserno aus der Investment-branche kennt, bleibt somit bestehen. Das Verfahren der literarischen Anverwandlungen des Finanzratgeber-Genres ist zunächst einmal parodis-tisch, im Sinne der Veränderung des Inhalts bei Beibehaltung der Form: statt der veralteten zehn Regeln für Investoren nunmehr zehn Regeln für Auto-ren. Darüber hinaus wird die Ratgeberform aber nicht abgewertet, vielmehr
Gebote der Gegenwart
234
werden die neuen Ratschläge bestätigt, insofern die Regeln das festhalten, was der Roman zugleich demonstriert. Alle Gebote sind auf das Erzählte anwendbar, sodass wie in einem Lehrbuch Regeln entwickelt werden, die als Ergebnissicherung des Gelehrten zu verstehen sind.67 Die parodierte Vor-lage des Finanzratgebers wird in Kirchhoffs Roman nicht zitiert, sondern lediglich benannt. Jenseits des Verweises kommt ein dezidiert auf ökonomi-sche Belange ausgerichteter Text somit gar nicht mehr vor, es sei denn man verstünde die Anleitung zu einem guten Roman als wirtschaftliches Erfolgs-rezept. Die Art der Bezugnahme, die innerhalb der Diegese eine Einzeltex-treferenz darstellt, wäre daher im Blick auf den gesamten Roman eher als Formzitat beschreibbar, das auf die Dekalog-Form beratender Texte verweist und sie auch selbst gebraucht.68 Erinnerungen an meinen Porsche weist mit dieser Strategie die ökonomischen Anweisungen als unbrauchbar zurück und setzt stattdessen auf literarische Regeln. Der Roman bringt die Trans-formierung des Ratgebertextes während der Nullerjahre damit an einen Endpunkt, der den Folgen der Finanzkrise geschuldet ist. Der Transfer von wirtschaftlichen Anleitungen in Literatur wird im Zeichen der umfassenden Krise systematisch verweigert, der Finanzspekulation wird ein literarisches Regelwissen entgegengestellt.
VIII. Schluss
Die vorgestellten Wirtschaftsromane der Nullerjahre verarbeiten Ratgeber-texte formal und inhaltlich.69 Nicht zuletzt scheinen so die wirtschaftlichen
67 Nur nebenbei sei hier auf Kirchhoffs Schreibkurse am Gardasee verwiesen. Vgl. dazu Moritz von Uslar. „Eros und Ramazzotti“. Der Spiegel Nr. 38 (2007): S. 208: „Kirchhoff sagt gern Riesensätze wie: ‚Das Gefährdetsein ist das A und O der Schriftstellerei.‘“
68 Vgl. Andreas Böhn: Das Formzitat. Bestimmung einer Textstrategie im Spannungsfeld zwischen Intertextualitätsforschung und Gattungstheorie. Berlin: Schmidt, 2001.
69 Zwei weitere Romane der Nullerjahre, in denen Ratgeber – wenn auch nur marginal – vorkommen, sind Ingo Schulze. Neue Leben. Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Vorwort versehen von Ingo Schulze. Berlin: Berlin Verlag, 2005. S. 122f. Dort wird die Publikation eines Finanzratgebers der mephistophelischen Figur Clemens von Barrista verzeichnet. Dazu Hans Graf von der Goltz. Die Erben. Roman. Wien:
Daniel Lutz
235
Verhältnisse auf die Literatur ‚durchzuschlagen‘, generiert doch die generali-sierte unternehmerische Anrufung, die um das Jahr 2000 wirksam wird, ein erweitertes Feld von Beratung und Ratgebung. Als Fazit dieses Überblicks über das Spektrum der Transformierungs-Varianten sind abschließend zwei Ergebnisse festzuhalten. Erstens: Die Übernahmen und Inszenierungsstra-tegien ökonomischer Sachgehalte beziehen sich in den fünf vorgestellten Romanen offensichtlich nicht oder nur am Rande auf die ‚harten Fakten‘. Im Fokus steht nicht wissenschaftliches Wissen, strenggenommen nicht einmal ein Wissen im Sinne konkreter Kenntnisse, sondern die kompetitive Anlei-tung der Ratgeber. In traditioneller Terminologie könnte man auch von Klugheitslehren für den ökonomischen ‚Umgang mit Menschen‘ (Knigge) sprechen. Zweitens: Neuartig ist die Thematisierung von Wirtschaft, insofern sie Wirtschaft als komplexe Wettbewerbssituation zeigt, in der systematische Überforderung und beratende Hilfestellungen einander bedingen. Innovativ sind die Wirtschaftsromane der Nullerjahre nicht, weil sie Wirtschaft gewis-sermaßen auf dem ‚aktuellen Stand der Forschung‘ präsentieren, sondern weil sie den aktuellen Stand pragmatisch ausgerichteter Anleitungsnarrative literarisieren und so ihr Scheitern wie ihr positives Funktionieren darstellen.
Zsolnay, 2000. S. 34f., wo im Rückblick auf 1950 eine Broschüre mit dem Titel Wie gründe ich eine Firma? erwähnt wird.
Gebote der Gegenwart
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung ..................................................................................................
Carsten RohdeUnendlichkeit des Erzählens?Zum Roman um die Jahrtausendwende. Vorwort ...............................
Poetik und Ästhetik
Moritz BaßlerDie Unendlichkeit des realistischen Erzählens.Eine kurze Geschichte moderner Textverfahren und die narrativen Optionen der Gegenwart ................................................
Christian Klein„Günter Grass, du hast unsere Literatur zerstört“.Jan Brandts Roman Gegen die Welt und die Poetik des Manischen Realismus .......................................................
Stefan Neuhaus „Eine Legende, was sonst“.Metafiktion in Romanen seit der Jahrtausendwende(Schrott, Moers, Haas, Hoppe) ................................................................
Carsten RohdeDie mimetische und poietische Linie im Roman der Gegenwart.Ein idealtypischer Beschreibungsversuch am Beispiel von Martin Mosebach ..........................................................
Gattungen, Themen, Motive
Michael RölckeKonstruierte Enge.Die Provinz als Weltmodell im deutschsprachigen Gegenwartsroman
9
11
27
47
69
89
113
Michael BraunDie Erfindung der Geschichte.Fiktionalität und Erinnerung in der Gegenwartsliteratur ..................
Julian PreeceDer versöhnliche Umgang mit dem RAF-Terrorismus in Romanen der Nullerjahre .....................................................................
Jens HobusZur Semantisierung und Inszenierung von Popmusik in der Gegenwartsliteratur (Navid Kermani, Andreas Neumeister) .................................................
Daniel LutzGebote der Gegenwart.Die Transformierung der Management- und Ratgeberliteratur im Roman der Nullerjahre (Georg M. Oswald, Ernst-Wilhelm Händler, Rolf Dobelli, Martin Walser, Bodo Kirchhoff ) ..................
Christoph DeupmannPoetik der Indiskretion.Zum Verhältnis von Literatur und Wissen in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt ....................................
Autoren
Dieter Stolz„Ich begriff, dass es keine veralteten oder obsoleten Erzähltechniken gab“.Zur Poetik des Schriftstellers Ingo Schulze, eine exemplarische Skizze ..........................................................................
Steffen RichterLand und Meer.Die Räume der Felicitas Hoppe ...............................................................
139
163
181
211
237
259
279
301
321
347
375
381
Michaela Kopp-MarxGleichzeitigsein.Patrick Roths Poetik der Verwandlung ...................................................
J. Alexander BareisModerne, Postmoderne, Metamoderne? Poetologische Positionen im Werk Daniel Kehlmanns ......................
Diskussion
In der Werkstatt der Gegenwart oder Über das Romaneschreiben.Carsten Rohde und Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Gespräch mit Thomas Lehr, Sibylle Lewitscharoff und Peter Stamm .....................
Biobibliographische Informationen .............................................................
Personenregister ...............................................................................................