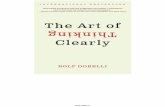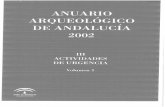Zyklographie der Literatur. Materialistische Variante, in: Jürgen Link, Rolf Parr, Mirna Zeman...
-
Upload
fernuniversitaet -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Zyklographie der Literatur. Materialistische Variante, in: Jürgen Link, Rolf Parr, Mirna Zeman...
1
kultu
RRev
olut
ion
nr. 6
8 m
ai 2
015zyklen / moden
hg. von mirna zeman, jürgen link und rolf parr
zu diesem heft
Jürgen LinkWir haben unseren Freund Burkhardt Lindner (1943–2015) verloren 5
appell
Für eine faire Berichterstattung über demokratische Entscheidungen in Griechenland. Appell von Deutsch-Griechen und Griechen-Deutschen 7
zyklen / moden
Jürgen LinkThesen zu Zyklologie und Evolution 9
Timo KaerleinProduktzyklen / Modezyklen. Ästhetische Obsoleszenz und artifizielle Sterblichkeit im Apple-Design 13
Monique MiggelbrinkVom Holz- zum Kunststoffgehäuse und wieder zurück: Fernsehmöbel-Zyklen 22
Mirna ZemanZyklographie der Literatur. Materialistische Variante 32
Aage A. Hansen-LöveEvolution vs. Genese: Vom Kampf ums Überleben der literarischen Gattung zum Recycling 40
Mikhail EpsteinThe Cyclical Developement of Literature 48
Christian KöhlerZyklogrammatik. Dolf Sternbergers Panorama als mediale Historiographie 52
Hartmut WinklerSpiralen 60
Julia Bertschik»Gehöste Damen«. Die Wiederkehr weiblicher Hosenmoden als Skandalon 63
Moritz BaßlerAugenblickliche Überlieferung. Zu Pop und Mode 71
kultuRRevolution_Heft 68.indd 1 16.04.2015 09:51:19
2
kultuRRevolutionnr. 68 m
ai 2015
anschlüsse /rückkopplungen
Sebastian Sternthal74 Foucaults Iranreportagen. Eine dialektische Unterhandlung zwischen Macht und Widerstand
Claus-Artur Scheier77 Zur Logik der Revolution
Harry Halpin82 Die Philosophie von Anonymous – Ontologische Politik ohne Identität
Thomas LischeidKlingende Ikonen der Großen Krise zwischen Gegenwartskunst und Kunstkanon.
91 Mit einer diskurssemiotischen Spekulation über aktuelle Mediensymbolik und Kunstmarkt
Claus-Artur Scheier99 Rousseaus Supplement und das dramatische Prinzip der Aufklärung
besprechungen
Charis Goer104 Engagement war gestern. Thomas Ernst geht dem subversiven Potenzial von Literatur nach
Heike DerwanzKleidungsmoden, kulturwissenschaftlich. Zu den Modebüchern
106 von Gertrud Lehnert, Gesa Teichert und Barbara Vinken
Peter FriedrichGoethe, Hölderlin und Kleist im Menschenpark.
109 Anmerkungen zu den Begriffen ›Anthropotechnik‹ und ›Anthropoetik‹ bei Kevin Liggieri
service
116 Aus anderen diskurstheoretischen Zeitschriften
kultuRRevolution_Heft 68.indd 2 16.04.2015 09:51:19
32
Zyklographie der Literatur.
Materialistische Variante
mirna zeman
Ein jedes Ding, das Ihr seht oder in Euren Händen haltet, hat ein langes und inter-essantes Leben. Während dieses seines Lebens ist das Ding von Hand zu Hand ge-gangen, ist mit vielen Menschen in Berührung gekommen, hat verschiedene Um-gestaltungen gemacht. Man muß es nur dazu bringen, daß es von sich erzählt.
Sergej Tretjakov
In der Geschichte der Literatur gab es immer wieder Versuche, ›Lebenskurven‹1 der Dinge zu erzählen, und Bemühungen, die für das Auge in toto nicht erfass-baren Trajektorien der Artefakte in sozioökonomischen Kreisläufen dar- und vorstellbar zu machen. Die Grundannahme ist dabei, dass sich durch die Literatur-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte hindurch eine wandelnde Formation aus Verfahren, Methoden, Praxen, Techniken, Genres, ästhe-tischen Formen und ›harten‹ Technologien jeweils historisch situiert, die den Zirkulationen und »Reproduktionszyklen aus Transformationen«,2 in die die materiellen Artefakte verstrickt sind und die sie verschweigen, auf die Spur kommen will. Ich habe an anderer Stelle vorgeschlagen, diese Formation ›dingzyklographische Formation‹ bzw. ›kulturelle Zyklographie der Dinge‹ zu nennen.3 Die literarische Tradition der Zyklographie der Dinge reicht weit in die Geschichte, mindestens bis in die Frühe Neuzeit zurück. Im Folgenden werde ich zu-nächst die retrospektive ›Vita‹ bzw. eine Typologie der literari-schen Zyklographie der Dinge skizzieren. Im zweiten Schritt werde ich dingyzklographische Erzählungen mit Theorie kor-relieren und einige für Literatur konstitutive Zyklen in den Blick nehmen.
1. Typologie der dingzyklographischen Ansätze
1.1. Biographie des Dings: Faktographische Variante
Vor dem Hintergrund einer proletarischen Ge-sellschaft bezieht der LEF-Avantgardist Sergej Tretjakov4 in den späten 1920er Jahre eine Frontstellung gegen die die Romanstruktur dominierende »idealistische« Formel »der Mensch ist das Maß aller Dinge«.5 Ziel-scheibe ist der klassische russische Roman, der private Neurosen, Emotionen und Erlebnisse der Romanhelden schildert, die sich für Sonnen halten, um die herum »gehorsam Personen, Ideen,
Dinge und historische Pro-zesse kreisen«.6 Diesem »ptole-
mäischen System der Literatur« will Tretjakov das kulturrevolu-
tionär-praxeologische Programm der »literatura fakta«7 und eine Me-
thode entgegensetzen, die er »Bio-graphie des Dings« nennt: »Nicht der
Einzelmensch, der durch das System der Dinge geht, sondern das Ding, das
durch das System der Menschen geht – das ist das methodologische literarische
Verfahren, das uns progressiver erscheint, als die Verfahren der klassischen Belletristik.«8
Den Werdensprozess des Dings (bzw. des ma-teriellen Artefakts) im Sinne des dialektischen
Materialismus nennt er »Faktum«.9 Die Biogra-phie des Dings ist eine literarische Technik bzw.
ein Format, das dieses Faktum darstellbar machen soll: »Die Kompositionsstruktur der Biographie des
Dings stellt gleichsam ein Fließband dar, auf dem sich der Rohstoff fortbewegt, der durch die Anstrengungen
der Menschen in ein nützliches Produkt verwandelt wird. Die Menschen treten vom Rand des Fließbandes an das
Ding heran. Jeder Abschnitt führt andere Gruppen von Menschen heran.«10
1.2. Experimentelle Biographik: Formalistische Variante
Ein anderer Strang der »literatura fakta«, die autobiographische Prosa des Formalisten Viktor Šklovs kij, lehnt die sozialökono-
misch-zweckmäßige Literaturpraxeologie und den Realismus der Tretjakov’schen dingbiographischen Methode ab und rückt in einer
Literatur, die »sich selbst als Produktion von Literatur aus literarischen, vor- oder außerliterarischen Fakten«11 versteht, den Konventionen der
monosubjektiven Autonarrative auf den Leib. »Fakt« ist bei Šklovs kij ‒ ähnlich wie bei Tretjakov ‒ die Dynamik, hier allerding nicht der realen
Dinge und Produktionsprozesse außerhalb der »ästhetischen Reihe«, sondern die Prozessualität des literarischen Handwerks und des »Materials«. Šklovs kij
beschäftigt dabei das Problem der Übertragung des Fakts in literarische Form und die Frage der Erneuerung der letzteren.
In Dritte Fabrik erprobt er eine Dynamisierung der Autobiographik durch autobiographisches Erzählen, das mit der Kategorie Stimme experimentiert.12 Der
Formalist zerbröselt die Gestalt des monosubjektiven Helden durch den Einsatz von Stimm-Masken, die zwischen verschiedenen literarischen Persönlichkeiten Šklovs kijs
oszillieren, mal aus der Sicht des Materials ‒ der vorgeformten Prätexte, die erneut umgeformt werden und als fließende im Produktionsprozess wahrgenommen werden
wollen ‒ mal aus der Perspektive der mittels Prosopopöie »vergesichtlichten« Dinge erzäh-len. Das konstitutive Verfahren, das die Erzählung mit-voranbringt, ist – wie Aage Hansen-
Löve zeigt ‒ das Verfahren der metaphorischen Entwicklung, bzw. des Zurück-Lesens (eine Art des ›Psychoanalysierens‹) der im Begriff ›Bearbeitung‹ eingefalteten/verdichteten konnota-
tiven Stränge.13 Der Autor, die Stimm-Masken, das Material und das Verfahren der metapho-rischen Realisierung generieren auf der Sinnesebene des Textes Lebenslinien, die sich als Pro-
zesse des In-Form-und-Norm-Bringens entpuppen, die Menschen, Dinge und Inhalte gleichsam
kultuRRevolution_Heft 68.indd 32 16.04.2015 09:51:23
33
heimsuchen: »Wir sind in verschiedene Formen gestanzt, aber wir haben all dieselbe Stimme, wenn man uns zusam-menquetscht«.14
1.3. Zirkulationsnovelle: Populäre Variante
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-derts ist die Zyklographie der Dinge eine Mode. Vor allem in England häufen sich in Zeitschriften so genannte »it-narratives« oder »novels of circulation«.15 Die narrative Struktur dieser Texte ähnelt dem Fließband der Erzählung, das Tretjakov empfiehlt, mit dem Un-terschied, dass hier zirkulierend-metaphorisierende Dinge das Wort ergreifen, für sich sprechen und die kapitalistische Gesellschaft fokalisieren. Geldmünzen und Scheine, Schreibgeräte, Papierstücke, Kleider und Gebrauchsgegenstände verschiedenster Art, Kutschen und andere Verkehrsmittel berichten in der Ich-Form über Prozesse ihrer Hervorbringung und ihre Zirkulati-on als Ware, Verkehrsmittel oder Objekt in einer sich for-mierenden commercial society. Diese Erzählungen vereinigen in einer Art des Sampling Inhalte, Stile und Genres aus dem Steinbruch des Populären, in Worten Christopher Flints: »[A] single tale may incorporate satire, allegory, anatomy, picaresque, scandal chronicle, roman à clef or secret history, news, propa-ganda, autobiography, moral tale, sentimental romance, Aesopian fable, spy novel, travelogue, and imaginary voyage.«16 Auf den fah-renden Zug der literarischen Mode der »novels of circulation« sprin-gen früh auch die Werber für Quacksalber-Arzneimittel auf und lassen ihr Produkt ‒ eine aller Art Schmerzen mildernde Kette ‒ mit wörtli-chen Anleihen aus literarischer Zirkulationsnovelle für sich sprechen.17 Diese »anodyne neclace« ist ein Vorfahre der tanzenden Kaffeebohnen, der bösen Bakterien in den Toilettenschüsseln und der sich selbst mit »I am Mercedes Benz« vorstellenden Maschine, die unsere Fernsehbildschirme bevölkern.
1.4. Schwank und Predigt: Humoristische Variante
Aus der Perspektive der Frühen Neuzeit ist die Zyklographie der Dinge ein humori-stisches Verfahren. Anfang des 17. Jahrhunderts findet man in der Literatur Scherzre-den der Pflanzen, die verschiedenartige Tätigkeiten, die zur Herstellung der Leinwand, des Papiers und des Biers erforderlich sind, in versifizierten Moralpredigten in Ich-Form und als am eigenen Leib empfundene schildern.18 Die spaßhafte Fiktion entschädigt für Kritik am Sittenverfall, mit der Pfarrer und der Moralist u. a. wider den Missbrauch des Bieres bei den rohen Bauern losziehen.19 Mit dem Verfahren, das qua damals populärer Apuleius-Übersetzungen an die Tradition der antiken Metamorphosen anknüpft, »wirtschaf-ten« auch frühneuzeitliche Schwänke von Hans Sachs, dem bei der Arbeit die Rosshaut ihre mühselige Vita erzählt, und Grimmelshausens Roman Simplicissimus, in dem das Toilettenpa-pier ‒ das sogenannte Schermesser ‒ seine Vita vorstellt.20
2. Zyklen der Literatur
2.1. Das Schermesser: Transformationszyklen
In der Schermesser-Episode21 begibt sich Simplicius an einen Ort, »welchen etliche eine Kanzelei zu nennen pflegen«.22 Gerade ist er dabei, sich einen »Oktav von einem Bogen Papier« herunter-zuziehen, als das Papier das Wort ergreift, in der Absicht, diese peinliche Bedrohung durch eine
autobiographische Rede abzuwenden.23 Die Lebensgeschichte gestaltet sich als eine rückblicken-de Erzählung über kontinuierliche Formveränderungen, Orts- und Besitzerwechsel, die das ge-
sprächige Ding in seinem ›Leben‹ durchgemacht hat. Seinen Lebenszyklus tritt das werdende Schermesser als ein Hanfsamen an. Geerntet, verkauft und gepflanzt muss es zunächst »im
Gestank des Roß-, Schwein-, Kühe- und andern Mists vermodern und ersterben«, um »aus sich selbsten« als ein Hanfstängel wiedergeboren zu werden.24 Als dieser gelangt es in den
Sog der Textilherstellung, in dem es einer langen Kette von Prozessen ausgesetzt wird, die es als höchst qualvolle Marter empfindet. Zusammen mit seinen Artgenossen wird es in eine Grube geschleppt, mit Steinen gepresst, überschwemmt, der Hitze ausgesetzt,
hunderttausendmal klein zerstoßen, zerquetscht, »anatomiert«,25 gehechelt, mehrfach gelagert und eingepackt, verkauft und transportiert, bis seine Verwandlung zum
Garn vollzogen ist, aus dem durch spinnende und webende Weiberhände zunächst Leintuch und schließlich ein Hemd werden.
Das ›soziale Leben‹26 des werdenden Schermessers spielt sich im Wechsel kurzfristiger Interaktionen mit den gewinnsüchtigen Bauern, ArbeiterInnen
und Händlern und setzt sich im körpernahen Kontakt mit einer Magd fort, bis es abgetragen und zu Windeln zerschnitten zum Lumpen verfällt und
weggeworfen wird. Als Lumpenrohstoff gelangt es dann in die Papiermüh-le, wo es zu einem feinen Bogen Schreibpapier gemacht wird. In ein »Buch
oder Journal«27 gebunden, stellt es seinen Leib als Einschreibfläche für gefälschte Einträge einem diebischen Buchhalter zur Verfügung und
ändert als Umzugs-Packpapier wieder einmal Verwendungsort und -form, bevor es zu seinem endgültigen Verbrauch im »Sekret« ver-
urteilt wird. Simplicius wertet die autobiographische Erzählung: »Weil dein Wachstum und Fortzielung aus Fes tigkeit der Erde,
welche die Excrementa der Animalien erhalten werden muß, ih-ren Ursprung, Herkommen und Nahrung empfangen, zumalen
du auch ohnedas solcher Materi gewohnet, und von solchen Sachen zu reden, ein grober Gesell bist, so ist billich, daß du wieder deinem Ursprung kehrest«, und »exequiert[ ]« das Ur-
teil.28
2.2. »Natürliche« und »nicht-natürliche« Reproduktionszyklen
Die Schermesser-Episode zeichnet eine Vielzahl aneinandergekoppelten Zyklen nach, auf die
Jürgen Link in seinem zyklologischen Marx-Aufsatz aufmerksam macht.29 Erzählt wird
der relativ autonom verlaufende Zyklus der »nichtmenschlich-natürlichen«30 Selbstrepro-
duktion (Samen-Hanfstengel-Samen), der davon abhängige Zyklus der »menschlich-
natürlichen«31 Selbstreproduktion (»die Rückkehr der vom Menschen in der
Form von Nahrungs- und Kleidungs-mitteln vernutzen Bodenbestandteile
kultuRRevolution_Heft 68.indd 33 16.04.2015 09:51:23
34
zum Boden«:32 Exkrement-Hanfstengel-Hemd-Exkrement), in die dann verschiedene ökonomische und soziokulturelle Zyklen eingreifen. Zum Beispiel der Zyklus des Kapitals: Die Geldinvestition des Bau-ern wird in den Rohstoff (Hanf ) transformiert, aus dem ein Produkt (Leintuch) hergestellt wird, das als Ware verkauft wird und Geld einbringt, wodurch sich der Zyklus schließt und mit der nächsten Geldinvestition neu anfängt.
In ihrer Gesamtheit ist die Erzählung des Schermessers eine ökologische. Denn aus der Episode geht eindeutig hervor, dass natürliche Zyklen fundamental und allen anderen Zyklen vorrangig sind. Das Schermesser erinnert daran, dass auch die Kunst an die Natur und das Leben ange-koppelt ist und bleibt. Das Scharnier sind die materiellen Träger von Literatur: Immer noch hauptsächlich Papier und Buch.
2.3. Das Buch: maschinell-gesellschaftliche Zyklen
Buchwissenschaftler modellieren die Prozesse der Produktion, Distribution und Re-zeption von bibliographischen Objekten als Zyklen. Darntons Modell sieht einen Kommunikationszirkel vor, der »von Autor zu Verleger […], Drucker, Versand, Buchhandel und Leser verläuft.« Der Zyklus fängt in diesem Modell beim Leser an und kehrt bei diesem zu sich zurück. »Der Leser vollendet den Zirkel«, schreibt Darnton, »denn er beinflußt den Autor sowohl vor als auch nach dem Akt des Verfassens. Autoren sind selber Leser«.33 Ein alternatives Modell von Adams und Barker kehrt die Perspektive um und schlägt ein Lebenszyklus aus der Sicht des Gegenstandes vor, der die Abfolge der Phasen »Publishing«, »Manufacturing«, »Distribution«, »Reception« und »Survival« durchläuft.34
Die vom Wiener Publizisten Franz Gräffer verfasste »Selbstbiogra-phie eines Buches« von 1829 erprobt die letztere Version im Modus der Fiktion. Sie beinhaltet eine dingfokalisierte Vita des bibliographischen Objektes, das im Zeitalter der industriellen Buchproduktion für Le-benszyklen ganzer Serien von Seinesgleichen redet.35 Die Anzahl der Transformationen, die das Artefakt namens »Große encyclopädische Blumenlese« in seiner Produktionsphase durchläuft, ist wesentlich kleiner als bei Grimmelshausen, die dargestellten Martern des Bu-ches in den Wertketten und den »Torturmaschinen« fallen schau-erlicher und beinahe kafkaesk aus:
»Bald darauf befand ich mich in einem Gemache, das wie eine Mörderhöhle aussah. Hier traf ich eine Menge Ver-wandte an, aber in welchem Zustande? Die einen sah ich in einem Meer von flüßigem Leim ersäufen, die andern auf torturähnlichen Maschinen ausgespannt, und mit spitzigen Werkzeugen durchstochen; wieder andern wurden sengende Brandmale aufgedruckt, vorzüglich dauerte mich einer meiner Verwand-ten von sehr ansehnlicher Gestalt, dem an mit einem runden Eisen ganze lange Streifen vom Leibe schnitt. […] Doch kaum hatte ich recht angefangen zu zittern, als einer dieser Can-nibalen mit entkleideten Armen mich faß-te, auf den anatomischen Tisch warf, und mich Glied für Glied auseinander zerr-te. […] Der Barbar ergriff mich, legte mich auf einen Amboß, und schlug mit einem großen eisernen Hammer unbarmherzig auf mich los. Von diesen mörderischen Schlägen nahm ich kaum wahr, daß mich
dieser Mörder gleichfalls in eine der vielen Tortur-
maschinen einspannte, bis mich unaufhörliche Nadel-
stiche wieder zur Besinnung brachten.«36
In der hypothetischen Erzählung der Distributionsphase wird das Buch
durch die Vermittlungsinstanzen Aukti-on, Transportkorb, Paket und Antiqua-
riat materiell im Raum übertragen. Wäh-rend die kommunikative Mobilisierung
durch paratextuelle Referenzen auf das Buch läuft ‒ den Lobreden in Gesellschaften und
Zeitschriften folgen Schimpftiraden ‒ erfährt die »Enzyklopädische Blumenlese« die Up-and-
Down der Rezeption als Wanderung von Haus zu Haus und materialiter als Abnutzung, bis es am
Ende Schermessers Schicksal ereilt.
2.4. Prozessieren: Mediale Zyklen
Autoren sind in Recyclingprozesse verstrickt. Šklovs kij schreibt: »Ich beginne eine Arbeit mit der Lektüre […].
Ich benutze verschiedenfarbige Lesezeichen oder solche von verschiedener Breite. Für den Fall, daß diese Lesezeichen her-
ausfallen, wäre es gut, die Seitenzahl anzumerken, was ich je-doch unterlasse. Dann sehe ich die Lesezeichen durch und fertige
Notizen an. Eine Stenotypistin, dieselbe, die jetzt diesen Artikel schreibt, tippt Auszüge mit dem Seitenvermerk ab. Diese Zettel
[…] hänge ich an den Wänden meines Zimmers auf. […] Es ist sehr wichtig, ein Zitat zu erfassen, es umzukehren und mit anderen zu
verbinden. Die Auszüge hängen lange an der Wand. Ich gruppiere sie, ordne sie nebeneinander und formuliere dann, sehr knapp, verbindende
Übergänge.«37
Ein Autor, der liest, das Ausgangsmaterial in Zitate auflöst, Zitate in Zetteln speichert und nebeneinanderlegt, um sie formulierend zu bearbeiten
und schließlich in seinem Produkt abzuspeichern, ist nach Hartmut Winkler vis-a-vis seinem Produkt und dem Medium in die »Mikrozyklen« des medialen
»Prozessierens« involviert.38 Winkler hat vor allem den Rechner im Blick und den schlichten Umstand, dass man ‒ etwa beim Buchschreiben am Computer ‒
immer einzelne Bestandteile des Manuskripts ‒ mit Šklovs kij gesagt »Trümmer[] der künftigen Arbeit«39 ‒ bearbeitet, danach das vorläufige Ergebnis (eine Textver-
sion) speichert, um diese temporär »stillgestellte« Version in einem nächsten Schritt wieder in die Weiterverarbeitung aufzulösen. Diese Sequenz, die dann unzählige Male
wiederholt wird und in der das Produkt zwischen den Aggregatzuständen »flüssig« und »fest« oszilliert, fasst Winkler als »Mikrozyklus des Prozessierens«. Eingebettet sind die
»kleinen Kreise« in die »großen Kreise« bzw. »Makrozyklen« des Prozessierens. Die letz-teren modelliert der Medientheoretiker mit Bezug auf Jäger/Jarkes Konzept der Transkrip-
tivität40 als eine Interaktion, die sich zwischen Autor/Text und materialem Archiv spannt. Ein Autor entnimmt ein im Archiv stillgelegtes Ausgangsmaterial (Präskript). Dieses wird
mikrozyklisch prozessiert bzw. in vielen Schritten eingreifend verändert und zwischengespei-chert, bis schließlich ein neues Produkt (Transkript) entsteht, das ins Archiv eingeht bzw. dort
»stillgestellt« wird und auf einen erneuten Zugriff und eine nächste Umschrift wartet. Auf zwei
kultuRRevolution_Heft 68.indd 34 16.04.2015 09:51:23
35
Ebenen werden analoge Vor-gänge beschrieben – einmal ein écriture-lecture-Prozess, der sich zwischen einem Autor und seinem Medienprodukt entfaltet und zweitens die produktive Inter-aktion zwischen (einem) Autor und dem Archiv. Diese zweite Ebene peilt eine Vielzahl literaturwissenschaftli-cher Theorien an ‒ darunter Intertextua-litätstheorien und Moritz Baßlers neuhi-storistisches Konzept der Zirkulation41 ‒, anders als bei den letzteren steht im medien-theoretischen Modell die Dynamik des Ma-terials im Vordergrund. Wenn Dallett für die Schermesser-Episode feststellt: »Nun haben die disparaten, vom Verfasser weitgehend verschwie-genen Quellen […] keinen Fürsprecher«, doch man dürfte »diese Quellen als analog zu den bear-beiteten Hanfhaaren betrachten: Grimmelshausen hat sie nämlich so ›separirt‹ und wieder ›conjungirt‹, daß sie sich erst einer sorgfältigen kritischen Analyse zu erkennen geben […]«,42 dann ist das der Ansatz, der bei der Präzisierung hilft. Makrozyklen des Prozessierens sieht Winkler an übergreifende Ketten der Diskurse ange-koppelt, die Frage des Übergangs zwischen Makro zyklen des medialen Prozessierens und der großen Kurven der Medien-geschichte lässt er offen.
2.5. Die Perücke: metaphorisch parodistische Metamorphose
Einen fiktionalen Brückenschlag zwischen Recycling und großen Zy-klen der Literaturgeschichte beinhaltet eine 1773 veröffentlichte Zirku-lationsnovelle von Ignaz von Born. Im Text erzählt eine Perücke gegen-über einem Fan des literarischen Salonlebens und der Werke Alexander Popes verschiedene Etappen ihres Lebens, kurz nachdem er sie zufällig im Sitzpolster seines Sofas, im eigenen Besitz entdeckt hatte.43 Die Erzählerin ist ein »paradoxes Geschöpf«,44 ein Zeichen, das ständig den Referenten wechselt und metaphorisch zwischen Kopfbedeckung, dem rhetorischen Verfahren der Prosopopöie und dem literary speaking object oszilliert. »Du kennest die Ziege, die Esop, Fontaine, und die glücklichen Fabeldichter sprechen hörten: ich bin ein Abstammling davon.«45 Das personifizierte Mischwesen bekennt sich anschlie-ßend auch ausdrücklich zur individualistischen Biographik und spinnt zunächst den Erzählfaden ihrer »persönlichen« Ursprungs- bzw. Herkunftsgeschichte. Diese reicht vom mythologischen Alter der Schäferdichtung bis zum Kopf des Monarchen eines imaginären (für England stehenden) Königreiches Schetura, der sie aus allerlei zusam-mengetragenen Haare, darunter der Bettler und der Elenden, herstellen lässt. Zu einem Gewebe geflochten, »das auch Penelope mit aller ihrer Geduld in zehn Nächten nicht aufgelöset haben würde«,46 kommt die Perücke/die Prosopopöie irgendwann aus der Mode und steigt im ständigen Besitzerwechsel vom Kopf zum Kopf, bis es/sie durch eine neue Perückenrenaissance auf die Glatzen der edlen Ratsherren katapultiert wird und danach den Schauspielern, Rechtsgelehrten und Magistraten dient. Mit dem Verschwinden der Mode gerät es in das Sitzpolster des mittlerweile schon durch die langweilige Autobiographie einnickenden Besitzers und Zuhörers, der sie aus der Hand und der Flamme einer Kerze zum Opfer fallen lässt:
»ein Brandopfer dem guten Geschmacke«.47 Borns gesellschafts- und literatursatirische Novelle wiederholt figurativ verschiedene Kreislaufdiskurse des 18. Jahrhunderts,48 die zunehmende Mobilität der Novelle im neuen Medium Presse und ‒ erzähltechnisch ‒ die modische Dingstimme der it-narratives, die in der
Nachfolge Popes zunehmend Perücken und Locken verliehen wird. Durchaus »zyklogrammatisch«49 erzählt die Perücke im Modus der Mode die Literaturgeschichte als Geschichte der Moden und par-
odiert dabei in „actu“ die neumodische englische Dingzyklographie. Hier gilt: »Das Sujet stößt sich von sich selbst ab und parodiert sich quasi von selbst«.50
2.6. Modezyklen
Moden sind Exzesse der Transkriptivität. Im Falle einer Mode arbeitet zeitnah eine Vielzahl von Produzenten an Umschriften, Übertragungen und anderen Derivaten eines beliebigen
Materials. Man erkennt eine Mode an temporären Ballungen des Gleichartigen. Dies können gleichartige Inhalte, ähnliche Formen und auch Verfahren sein. Heuristisch sind Moden in der Kategorie des Zyklus fassbar. Es handelt sich um Ähnlichkeiten/
Wiederholungen (mit und ohne Varianz51) und Zusammenballungen/Häufungen im Strom der Diskurse; und nicht selten wiederholen sich diese Häufungen noch ein-
mal, insofern Mode wiederkehrt.Im Fall von literarischen Moden52 häufen sich mobilisierende Mikroformate,
die Referenzen auf einen literarischen Text oder einen Bestandteil von ihm wie-derholend multiplizieren.53 Zeitnah ballen sich Rezeptionsereignisse um dieses
Material und schreiben sich als selektive inhaltliche oder formale Wiederho-lung, Fortsetzung, Nachahmung, Adaptation in nachfolgende Transkripte
ein, wobei eine Reihe gleichartiger Text- und Medienprodukte entsteht. In den Schaufenstern von Buchhandlungen können sich zeitnah Bücher
stapeln, die durch gleichartige Buchcover, Titelillustrationen etc. ähn-lich »angezogen« sind und dadurch die Zugehörigkeit zu einer Mode-
welle signalisieren. Die Mode kann von weiteren Artefakten getragen werden, zum Beispiel von Spin-offs – Konsumwaren, Fanobjekten,
Gebrauchsgegenständen – die Fiktionen in den realweltlichen All-tag hineinverlängern. Auch Zeichen, etwa Country-Of-Origin-
Kennzeichen (der südamerikanische »Boom«), Namen (Werther, Yorick, Harry Potter), Labels (»Fräuleinwunder«), Logos und
Brands nehmen qua (identischer) Wiederholung am trafficking in fashion teil. Zeitnah treten gehäuft auch verschiedenste For-men des lebenspraktischen Vollzugs einer Literaturmode in
Erscheinung, etwa Praxen, die die Theorien des Populären in den Kategorien des fandoms oder des Kults beschreiben.
Durch verschiedene Praktiken und Formate arbeiten die Fans am Um- und Weiterschreiben sowie der Reinsze-
nierung und Vereigentlichung der modischen Fiktio-nen in der Realität. All diese und viele weitere Akteure
– Verleger, Kritiker, Buchhändler etc. – sind ein Teil temporärer »communities of practice«,54 die den
Lebenszyklus einer Literaturmode mitbestimmen.Auch die Prozesse des Abebbens einer Lite-
raturmode lassen sich nach den Kriterien Häu-fung und Wiederholung konstruieren. Die
Prozesse der Entmodung machen sich etwa an der Kumulation der Text- und Medien-
produkte bemerkbar, die die Transkripte der ›Epigonen‹ parodieren, das ›nachge-
ahmte‹, schablonisierte Modell wieder-holend entblößen, verschieben und
kultuRRevolution_Heft 68.indd 35 16.04.2015 09:51:23
36
einer Umfunktionierung ursprünglicher rezepti-ver Wertung der Mode zuarbeiten. Der Mode-schwund macht sich an der Kumulation von mobilisierenden Mikroformaten bemerkbar, die den Exitus der Mode ausrufen, indem sie das jeweilige Modethema für ›out‹, ›passé‹, ›vorbei‹, ›altmodisch‹ erklären, kurz: die das Abflauen der Mode zum diskursiven Ereignis machen. Außerdem verdün-nen sich die im Material erkennbaren Häufungen und es kommt zur Ku-
mulation von Paratexten, die durch Referenzen der Stabilisierung einer konkurrieren-den Mode im synchronen System der Literatur zuarbeiten. Hier gilt: Mode »stößt sich
von sich selbst ab und parodiert sich quasi von selbst«.Im Modezyklus sind Strukturierung und Entstrukturierung dialektisch aufeinander
bezogen. Die Strukturierung ist temporär und kann in dauerstabilere Formen – etwa Gen-res – umschlagen oder verliert die temporäre Verklumpung »ihre Gelenke und gerinnt zu
einer einzigen Masse«.55
Literaturmoden lassen sich nicht zu einer »Erscheinungsform« verabsolutieren.56 Viel-mehr sollten verschiedene, historisch variable Realisierungen der Moden zugelassen werden
und müssen jeweils situativ auf Grund beobachtbaren Häufungen und erkennbaren Verklum-pungen im Material isoliert werden.
kultuRRevolution_Heft 68.indd 36 16.04.2015 09:51:23
37
2.7. Zyklographie à la Tracking: Bookcrossing
Gegenwärtig proliferiert eine neue dingzyklographische Variante zum Trend. Anstatt das gebrauchte und verstaubte Buch zu einer Angelegenheit der Müllabfuhr zu machen, versieht man es mit ei-nem Aufkleber und einer so genannten »BuchCrossingIDNumber«, lässt es an einem beliebigen öffentlichen Ort liegen und entlässt es somit »in die Wildnis«, wo es von anderen Lesern gefunden bzw. per Zufall »erjagt« werden kann. Über die Internetseite Bookcrossing.com kann man in Folge online die Reise seines ehemaligen Regal-Gefan-genen im fortlaufenden Besitzerwechsel verfolgen und dem Recy-
cling seiner Inhalte im Akt des Lesens durch Unbekannte virtuell beiwohnen.57 Seitdem sich ein amerikanischer Programmierer-Team von der Aktion der Rückverfolgung der Wege des 1-Dollar-Scheins im Internet dazu inspirieren ließ, das Projekt der ›Freislassung‹ von Büchern zu starten und eine Website zu gründen, auf der die Wege der kostenlos weitergegebenen Lesedinge von Hand zu Hand proto-kolliert werden können, erfreut sich die Praxis der Entsorgung von Büchern auf Wiederlesen von ihren Schicksalen im Netz (mit Op-tion Abschied auf Wiedersehen) einer zunehmenden Beliebtheit. Mittlerweile ist Bookcrossing, das die die Prinzipien der Flaschen-post und der GPS-Schnitzeljagd auf den Konsum von Literatur überträgt, zu einer globalen Bewegung geworden, die vom aktuellen Nachhaltigkeits-Trend ebenso profitiert wie von dem Gegen-Trend zur spätkapitalistischen Ökonomisierung von Literatur, etwa durch Konzentration- und Monopolisierungsprozesse im Buchhandel.
Bookcrossing interessiert indes nicht nur als eine neuartige Form des Social Reading bzw. netzmedial-literarischer Leser-»As-Sociati-on«,58 sondern auch als ein Modus des Literaturkonsums, der selbst Fiktionen generiert. Bookcrossers dichten nämlich dem Buch den Subjektstatus an und versetzen es in die Rolle des Fokalisators der Abenteuer, die ihm in der Operationskette der neuartigen Recy-clingprozedur zustoßen. Die Aufkleber-Texte wie »Ich bin ein Buch auf Wanderschaft. Lies mich und lass mich wieder frei!«, die auf den Umschlägen der ›ausgewilderten‹ Lesestücke prangen, fingieren die Belebtheit und die Erzählfähigkeit der zirkulierenden Drucksache ebenso wie die Online-Tagebücher der Bücher, die gelegentlich Lebenszeichen des Lese-Dings senden und von seinen Zufallsbe-kanntschaften auf Wanderschaft erzählen. Die alte literarische Buch-Zyklo graphie kehrt als eine neue Tracking-Technologie zurück.
Mode – völlig normal. Foto: Hartmut Winkler
kultuRRevolution_Heft 68.indd 37 16.04.2015 09:51:24
38
Anmerkungen
1 Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Göttingen, 5. Aufl. 2013; Rolf Parr: Normalistisches Erzählen in der Gegenwartslitertur, in: Silke Horstkotte und Leonhard Herrmann (Hg.): Poetiken der Gegenwart, Berlin/Boston 2013, S. 99–114, hier S. 111. Vgl. u. a. Ute Gerhard, Walter Grünzweig, Jürgen Link, Rolf Parr (Hg.): (Nicht) normale Fahrten: Faszinationen eines modernen Narrationstyps. Heidelberg 2003; Jürgen Link: Wie kollektiv kann eine biographische Geschichte sein? Facetten des autonarrativen »Wir«, in: Peter Braun, Bernd Stiegler (Hg.): Literatur als Lebensgeschichte. Biographisches Erzählen von der Moderne bis zur Gegenwart. Bielefeld 2012, S. 145–167.
2 Jürgen Link: Wissen und Macht statt Ideologie und Interesse, in: prokla 38 (2008), S. 443–459, hier S. 454.
3 Siehe dazu Mirna Zeman: Literatur und Zyklographie der Dinge. Bookcrossings in simplicianischer Ma-nier, in: David Christopher Assmann, Eva Geulen, Norbert Eke (Hg.): Entsorgungsprobleme: Müll in der Literatur (=Beiheft der Zeitschrift für deutsche Philologie), Berlin 2015, S. 151–173. Zum Thema Dinge in der Literatur vgl. u. a. Gisela Ecker, Claudia Breger, Susanne Scholz (Hg.): Dinge. Medien der Aneignung. Grenzen der Verfügung, Königstein 2002; Gisela Ecker, Susanne Scholz (Hg.): Umordnungen der Dinge, Königstein 2000; Michael Niehaus: Das Buch der wandernden Dinge, München 2009.
4 Vgl. Sergej Tretjakov: Die Arbeit des Schriftstellers. Aufsätze-Reportagen-Porträts, hg. v. Hei-ner Boehncke, Hamburg 1972, darin: Die Biographie des Dings, S. 81–84.
5 Sergej Tretjakov: Die Biographie des Dings, (wie Anm. 4). 6 Ebd. 7 Zu »literatura fakta« vgl. Aage A. Hansen-Löve: Der russische Formalismus. Methodologi-
sche Rekonstruktion seiner Entwick lung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien 1978, S. 502–507. Verena Dohrn: Die Literaturfabrik. Die frühe autobiographische Prosa V. B. Šklovs kijs. Ein Versuch zur Bewältigung der Krise der Avantgarde. München 1987.
8 Tretjakov: Die Biographie des Dings (wie Anm. 4), S. 81, 82, 84. 9 Dohrn: Die Literaturfabrik (wie Anm. 7), S. 37.10 Tretjakov: Die Biographie des Dings (wie Anm. 4), S. 83.11 Dohrn: Die Literaturfabrik (wie Anm. 7), S. 63.12 Viktor Šklovs kij: Dritte Fabrik, Frankfurt a. M. 1988.13 »Kern der metaphorischen Entwicklung in Tret‘ja fabrika‘ ist die Über-
schneidung der gegenläufigen Prozesse der Existentialisierung und der Realisierung im Begriff der obrabotka, der […] sowohl die künstlerische Transformierung der realen Fakten zu ästhetischen meint als auch die ›Umarbeitung‹, Verwandlung und Deformation des Menschen durch die verdinglichende, deformierende, desintegrierende Wirkung der Zeit, der Gesellschaft, des byt im allgemeinen: Beide Transforma-tionsprozesse entwickeln sich in parallelen metaphorischen oder metonymischen Reihen und überschneiden einander in ver-schiedenen Stadien der metaphorischen Metamorphose, deren Subjekt der Autor personifiziert, der gleichzeitig der künstle-rischen und der außerkünstlerischen Reihe angehört.« Han-sen-Löve: Russischer Formalismus (wie Anm. 7), S. 555.
14 Šklovs kij: Dritte Fabrik (wie Anm. 12), S. 11.15 Vgl. Viktor Link: Die Tradition der außermenschlichen
Erzählperspektive in der englischen und amerikani-schen Literatur, Heidelberg 1980; Mark Blackwell: The Secret Life of Things. Animals, Objects and It-Narratives in Eighteenth Century England, Cranbury, NJ 2007; Ders.: British It-Narratives, 1750–1830, 4 Bde., London 2012; Christina Lupton: Knowing Books: The Consciousness of Mediation in Eighteenth-Century Britain, Philadelphia 2012.
16 Christopher Flint: Speaking Objects: The Circulation of Stories in Eighteenth-Cen-
tury Prose Fiction, PMLA 113 (1998), 2, S. 212–226, hier
S. 219.17 Francis Cecil Doherty: A Study
in Eighteenth-Century Advertising Methods: The Anodyne Necklace,
Lewiston, New York 1992.18 Vgl. Andreas Tharaeus: Eine erbermli-
che Klage Der lieben Fravv Gerste, vnd ihres Brudern Herrn Flachs […], Hannover
1619, S. 222–232.19 Vgl. Johannes Bolte: [Einführung], in: An-
dreas Tharäus: Klage der Gerste und des Flach-ses, hg. v. Johannes Bolte, Berlin 1897, S. 35–68.
20 Hans Sachs: Schwanck. Der ellend klagent roß-haut, in: Hans Sachs, hg. v. Albert von Keller u.
Edmund Götze, 26 Bde., Bd. 5, Stuttgart 1870, S. 146–153.
21 Das Recycling der Schermesser-Episode im Folgenden nach Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen: Der
abenteuerliche Simplicissimus Teutsch, Stuttgart 1996; Joseph B. Dallett: Auf dem Weg zu den Ursprüngen: Eine
Quellenuntersuchung zu Grimmelshausens Schermesser-Epi-sode, in: Carleton Germanic Papers 4, 1976, S. 1–36; Mirna
Zeman: Literatur und Zyklographie der Dinge (wie Anm. 3).22 Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimus (wie
Anm. 21), S. 629.23 Ebd., S. 630.
24 Ebd., S. 631.25 Ebd., S. 643.
26 Vgl. Arjun Appadurai: The Social Life of Things: Commodities in Cul-tural Perspective, Cambridge 1986. Vgl. dort Igor Kopytoff: »The Cultural
Biography of Things«, S. 64–94.27 Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimu (wie Anm. 21), S. 639.
28 Ebd. S. 640.29 Jürgen Link: Marx denkt zyklologisch. Mit Überlegungen über den Status von
Ökologie und »Fortschritt« im Marxismus. In: kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie Nr. 4 (1983), S. 23–27.
30 Ebd. S. 26.31 Ebd.
32 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Im Zusammenang ausge-wählt und eingeleitet von Benedikt Kautsky, 7. Aufl., Stuttgart 2011, S. 293. Hinweis auf
die Textstelle bei Link (Anm. 29), S. 27.33 Robert Darnton: Was ist die Geschichte des Buches, in: Ders. (Hg.): Der Kuß des Lamou-
rette, München 1998, S. 66–97, hier S. 71.34 Thomas R. Adams, Nicolas Barker, A New Model for the Study of the Book: in: Nicolas
Barker (Hg.): The Potencie of Life, Books in Society: The Clarke Lectures, 1967–1987, London 1993, S. 5–43.
35 Franz Gräffer: Selbstbiographie eines Buches, in: Ders.: Momus. Nämlich: iocose Geschichtchen, humoristische Erzählungen, phantastische Scenereien und Schwänke, lyrische Seifenblasen und son-
stige Allotria, Wien 1829, S. 12–16.36 Ebd., S. 14.
37 Zitat nach Dohrn (wie Anm. 7), S. 68.38 Hartmut Winkler: Prozessieren. Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion, München: Fink 2015 (im
Druck). Hier das Referat nach unveröff. Manuskript / preprint, 2. Version, September 2013.39 Zitat nach Dohrn (wie Anm. 7), S. 68.
kultuRRevolution_Heft 68.indd 38 16.04.2015 09:51:24
39
40 Vgl. Ludwig Jäger, Matthias Jarke, Ralf Klamma, Marc Spaniol: Transkriptivität. Operative Medientheorien als Grundlage von Informationssystemen für die Kulturwis-senschaften, in: Informatik Spektrum 31, 1 (2008), S. 21–29, Ludwig Jäger: Transkriptivität. Zur medialen Logik der kulturellen Semantik, in: Ludwig Jäger, Georg Stanitzek (Hg.): Transkribie-ren. Medien/Lektüre. München: Fink 2002, S. 19–41. Die Transkriptivitätstheorie fokussiert auf die Prozesse der Übertragung eines Inhaltes aus einem in ein anderes Medium. Unterschieden wird dabei u. a. zwischen Skripturen – einem »in den Sprachspielen oder in den Archiven des kulturellen Gedächtnisses stillgestellte[n] Reservoir möglicher Transkriptionen« und Transkripten, bzw. »Skripturen, die das jeweils transkri-bierende System im Zuge der Transkription hervorbringt, also etwa Kommentare (zu kommentierten Texten), hi-storische Narrationen (zu Quellenkorpora), Remakes (zu Originalfilmen), Variationen zu den variierenden Themen, Samplings (zur verarbeitenden Musik) […].« Zitat nach Ludwig Jäger, Matthias Jarke, Ralf Klamma, Marc Spaniol: Transkriptivität. Operative Medientheorien als Grundlage von Informationssystemen für die Kulturwissenschaften, in: Han-nelore Bublitz, Roman Marek, Christina L. Steinmann, Hartmut Winkler (Hg.): Automatismen, München 2010, S. 299–313, (hier: S. 303).
41 Moritz Baßler: Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine literaturwissenschaftliche Text-Kontext-Theorie, Tübingen 2005.
42 Dallett: Auf dem Weg zu den Ursprüngen (wie Anm. 21), S. 28.43 [Ignaz von Born]: Die Staatsperücke. Eine Satyre, Amberg 1774.44 Ebd., S. 30.45 Ebd., S. 4.46 Ebd., S. 16.47 Ebd., S. 28.48 Vgl. dazu u. a. Harald Schmidt, Marcus Sandl (Hg.): Gedächtnis und Zir-
kulation. Der Diskurs des Kreislaufs im 18. und frühen 19. Jahrhundert, Göttingen 2002; Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München, 2. Aufl. 2003.
49 Siehe den Beitrag von Christian Köhler in diesem Heft.50 Viktor Šklovs kij: Dritte Fabrik (wie Anm. 12.), S. 72.51 Rolf Parr schlägt plausibler Weise vor, im Falle von Mode(n) jeglicher Art zwi-
schen identischer und nicht-identischer Wiederholung zu unterscheiden. ›Zir-kularität‹ als Begriff für identische und ›Zyklizität‹ als Begriff für nicht-identische Wiederholung. Rolf Parr: Sind Mode(n) und Modezyklen Formen von Wieder-holung? Einige unsystematische Überlegungen aus Perspektive der Forschung zu ›Wiederholen‹ und ›Zyklologie‹, Vortrag beim Workshop der Forschergruppe ›Mo-den, Trends, Hypes‹ zum Thema ›Moden – Zyklizität, Zirkularität‹ an der Universi-tät Paderborn
52 Vgl. dazu Mirna Zeman: Literarische Moden. Ein Bestimmungsversuch, in: Maik Bierwirth, Anja K. Johannsen u. Mirna Zeman (Hg.): Doing Contemporary Literature. Praktiken, Wertungen, Automatismen, München 2012, S. 111–131. Dies.: Häufungen des Kleinen. Zur Struktur von Hypes, in: Sabiene Autsch, Claudia Öhlschläger, Leonie Süwolto (Hg.): Kulturen des Kleinen. Mikroformate in Literatur, Medien und Kunst, München 2014, S. 335–352.
53 Unter mobilisierenden Mikroformaten sind Elemente zu verstehen, die im weitesten Sinne eine kommunikative Funktion für das Material übernehmen. Dazu zählen paratextuelle
Elemente im Sinne Gérard Genettes, inklusive materiell unabhängig von der eigentlichen Drucksache zirkulierender Rezensionen, Interviews etc. und weiterer Formen und Formate wie Facebook-Einträge, Buch-Trailer etc. Vgl. Mirna Zeman: Häufungen des Kleinen (wie Anm. 52). Zur Produktion von li-terarischer Relevanz qua Referenz siehe Maik Bierwirth: Wiederholung, Wertung, Intertext ‒ Struk-turen literarischer Kanonisierung, Heidelberg 2015 (in Vorbereitung).
54 Geoffrey C. Bowker, Susan Leigh Star: Sorting Things Out. Classification and Its Consequences. Cambridge/Mass., London 1999.
55 Šklovs kij: Dritte Fabrik (wie Anm. 12.), S. 73.56 Das Analoge gilt für Analysen von Genres. Siehe dazu: Michał Głowiński: Die literarische Gat-
tung und Probleme der historischen Poetik, in: Aleksandar Flaker, Viktor Žmegač (Hg.): For-malismus, Strukturalismus und Geschichte. Zur Literaturtheorie und Methodologie in der Sowjetunion, ČSSR, Polen und Jugoslawien, Kronberg/Taunus 1974, S. 155–185.
57 Vgl. http://www.bookcrossing.com/, letzter Abruf 15.02. 2015.58 Rolf Parr: Interdiskursive As-Sociation. Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur,
Tübingen 2000.
kultuRRevolution_Heft 68.indd 39 16.04.2015 09:51:24