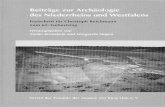1977 Salvini, Eine neue urartäische Inschrift aus Mahmud Abad (West-Azerbaidjan)
Eine späthallstattzeitliche Brandgrube aus dem Hartwald in Graschach
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Eine späthallstattzeitliche Brandgrube aus dem Hartwald in Graschach
Schild von SteierArchäologische und numismatische Beiträge aus dem Landesmuseum Joanneum
19/2006
Landesmuseum Joanneum
Provinzialrömische Sammlung & Antikenkabinett
Michael Raab
Eine späthallstattzeitliche Brandgrube aus dem Hartwald in Graschach
Sonderdruck der Seiten 257-286
Schild von Steier 19/2006, Graz 2006Herausgeber: Landesmuseum Joanneum GmbHAbteilung Provinzialrömische Sammlung & Antikenkabinett mit der Abteilung MünzensammlungEggenberger Allee 90, A-8020 Graz, Österreich
Schriftleitung: Ulla SteinklauberLektorat: Bernhard Hebert, Karl Peitler und Cornelia SchlagbauerGrafik-Design: Andrea WeishauptDruck und Herstellung: Medienfabrik Graz
ISBN 3-902095-08-4
Sigle: SchvSt
Inhalt
Aus dem Antikenkabinett
Tagungsbericht zum Symposium „Antikenkabinette zwischen Vergessen und Neubewertung“ am 21. April 2006 in Graz ErwinM.ruprEchtsbErgEr
Zur Neuaufstellung des Antikenkabinetts am Landesmuseum Joanneum
hannEsD.galtEr
Die altorientalischen Altertümer im Landesmuseum Joanneum – ihre Herkunft und ihre Bedeutung
hErMannharrauEr Ägyptische Totenbücher im Joanneum
ElfriEDEhaslauEr
Das Kleine im Großen. Zur Bedeutung eines kleinen Sammlungsbestandes innerhalb einer großen Sammlung
DaniElMoDl
„...aus den Grabungen des Kaisers Max“ – mesoamerikanische Artefakte sowie Fotografien und Zeichnungen aus der Frühzeit der archäologischen Erforschung Mexikos im Antikenkabinett am Landesmuseum Joanneum
KurtgschwantlEr
Die Neuaufstellung der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien
Katjasporn
Europas Spiegel – Die Antikensammlung im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen
bErnharDhEbErt
VENERANDAE VETVSTATI
Einzelbeiträge gabriElEKoinEr
Die Große Göttin in Graz – Ein weiblicher Kopf mit floralem Kalathos aus Idalion im Landesmuseum Joanneum guDrunglöcKnEr
Glasgefäß in Gestalt einer Maus
In der Münzensammlung
KarlpEitlEr
Der römerzeitliche Münzschatz von Mürzzuschlag aus dem Jahr 1843
11
15
21
25
29
69
75
77
81
91
101
3
Zur Landesarchäologie
Tagungsbericht zum Welterbeseminar „7000 Jahre Salz. Archäologie des Salzkammergutes“ am 21./22. April 2006 in Bad Goisern
ullastEinKlaubEr
Vorbemerkung der Schriftleitung
MichaElKurz
Zur Veranstaltung franzManDl
Urgeschichtliche Almwirtschaft auf dem Dachsteingebirge – Neue Ergebnisse, neue Betrachtungen hEinzgrubEr
Der neu entdeckte prähistorische Goldschatzfund aus Bad Goisern
MariannEpollaK
Die römische Straßenverbindung durch das Trauntal MariawinDholz-KonraD
Ein frühzeitlicher Handelsweg vom Ennstal bis zum Hallstättersee
bErnharDhEbErt
Archäologie im Salzkammergut – Bilanz und Resümee
Archäologische Prospektionen und Grabungen auf dem Burgstall bei Pürgg
bErnharDhEbErt und ullastEinKlaubEr
Vorwort ingoMirsch
Der Pürgger Burgstall – Bemerkungen zum Namen und zur Lokalisierung nach historischen Quellen
bErnharDhEbErt
Topografie und archäologische Erforschung des Burgstalls bei Pürgg und die Prospektionen 2004 und 2006
barbaraporoD
Grabungen am Burgstall bei Pürgg 2005
KarlpEitlEr
Zu den Fundmünzen vom Burgstall bei Pürgg
christophgrill
Tierknochenfunde vom Burgstall bei Pürgg
gEorgtiEfEngrabEr
Das prähistorische Fundmaterial vom Burgstall bei Pürgg
christophhinKEr
Die römerzeitlichen Funde vom Burgstall bei Pürgg
125
127
131
137
139
141
149
155
157
161
165
169
173
175
199
gEorgtiEfEngrabEr
Die mittelalterlichen Funde vom Burgstall bei Pürgg
christophhinKEr und gEorgtiEfEngrabEr
Katalog der Kleinfunde aus den Prospektionen und Grabungen am Burgstall bei Pürgg 2004-2006
Einzelbeiträge
hEinrichKusch,christophspötl,Karl-hEinzoffEnbEchErundjanKraMErs
Der prähistorische Kalksinterplattenabbau im Höhlenabschnitt „Katzensteig“ der Lurgrotte bei Semriach, Steiermark
MichaElraab
Eine späthallstattzeitliche Brandgrube aus dem Hartwald in Graschach bErnharDhEbErt und ullastEinKlaubEr
Zum Ende der Römerzeit – Ein Fallbeispiel aus Wieden in der Weststeiermark
ullastEinKlaubEr
Ein spätrömisches Gehöft am Gößnitzberg bei Maria Lankowitz, Steiermark. Mit einer mineralogischen Magerungsanalyse von Barbara Leikauf
johannaKraschitzEr
Die Ofenkeramik aus der Grabung im „Maurerkammerl“ von Schloss Eggenberg
201
207
241
257
287
293
307
257
Eine späthallstattzeitliche Brandgrube aus dem Hartwald in Graschach
Michael Raab
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung2. Lage der Fundstelle 2.1 Geographische Situation 2.2 Verkehrsgeographische Situation 2.3 Geologische Situation 2.4 Siedlungstopographische Bedeutung3. Fundgeschichte 3.1 Forschungsgeschichte der Tumuli im Hartwald 3.2 Fundumstände und Siedlungsbefunde4. Grabungsmethodik und Befunde 4.1 Die Grabungsmethodik 4.2 Befunde 4.3 Auswertung der Befunde5. Die Funde 5.1 Stratigraphische Zuordnung der Funde 5.2 Fundspektrum 5.2.1 Kragenrandgefäße 5.2.2 Einzugsrandschalen und weitmundige Schalen 5.2.3 Schüsseln 5.2.4 Fassförmige Gefäße 5.2.5 Sonstige Formen und Sonderformen6. Interpretation und Zusammenfassung7. Literatur8. Anmerkungen zum Katalog9. Fundkatalog
1. Einleitung
Das steirische Sulmtal und dessen umliegende Täler spielten in der älteren Eisenzeit zweifelsohne eine bedeutende Rolle. Die Hügelgräberfelder vor allem der Sulmtal- oder Burgstallnekropole, die Fürsten-
hügel von Kleinklein1 und deren herausragende Beigaben lassen eine überregionale Bedeutung des Gebietes vermuten. Die früh, etwa Mitte des 19. Jhs., einsetzende Forschung beschränkte sich lange Zeit weitgehend auf diese obertags sichtbaren Grabdenk-male, während Siedlungen weniger Beachtung fanden. Durch diese Umstände und durch die schwierige Lokalisierung waren lange Zeit keine hallstattzeit-lichen Siedlungen im Sulmtal bekannt2 bzw. wurden nur Vermutungen angestellt, die später teilweise wissenschaftlich verifiziert werden konnten3.
Der seit 1987 bekannte Fundplatz von Graschach stellt eine wichtige Erweiterung der noch kurzen Liste alteisenzeitlicher Siedlungen des Sulmtales dar. Seine Erforschung wurde durch Rettungsgrabungen des Bundesdenkmalamtes ermöglicht und durch die konsequente und rasche Fundberichterstattung von Bernhard Hebert weitergeführt4. Die vorlie-gende Arbeit befasst sich nur mit dem Objekt 7 (auf Grundstück Nr. 600/3), einer Siedlungsgrube, und soll den Beginn einer weiteren Bearbeitung der Siedlung darstellen. Um die Stellung des Platzes innerhalb der hallstattzeitlichen südostalpinen Kultur bewerten zu können, wäre eine Gesamtpublikation unerlässlich.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit5 entspricht jenen Richtlinien, die eine Lehrveranstaltung zur Methodik am Institut für Ur- und Frühgeschichte Wien den Studierenden vermittelte6. Angestrebt wird nicht nur eine Materialvorlage, sondern auch eine kritische geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung, in der Erklärungen gefunden und zu Interpretationen weiterentwickelt werden sollen.
1 Zuletzt Egg-Kramer 2005.2 Kramer 1981, 66.3 Smolnik 1992, 16 f.: Dem Burgstallkogel in Großklein wurde von vornherein ohne eingehende wissenschaftliche Bearbeitung eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Die Bewohner wurden mit den (reichen) Bestattungen der umliegenden Hügelgräber in Verbindung gebracht. Die 1927 von W. Schmid durchgeführte Grabung, die keine reichen Funde hervorbrachte, änderte nichts an dieser Sicht.4 s. Hebert: sämtliche Berichte in den Fundberichten aus Österreich.5 Mein Dank für die Betreuung und das Vorantreiben dieser Arbeit gilt vor allem Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert, Institut für Ur- und Frühgeschichte Wien. Für die Vermittlung der Funde und der Befunddokumentationen danke ich Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert, Bundesdenkmalamt-Landeskonservatorat für Steiermark, und für die Entlehnung des Materials dem ArcheoNorico Burgmuseum Deutschlandsberg mit Anton Steffan, der auch die Restaurierung durchführte.6 Proseminar Einführung in die Methoden der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien, Univ.-Prof. Dr. O. H. Urban WS 2000.
258
2. Lage der Fundstelle
2.1 Geographische SituationDie hallstattzeitliche Fundstelle von Graschach (KG Graschach, OG Sulmeck-Greith, VB Deutschlands-berg) liegt auf einer Terrasse, die nach Süden zum Sulmtal, nach Nordosten zum Otternitztal abfällt, im südwestlichen Teil der österreichischen Steiermark (Abb. 1/ÖK 50, Blatt 190, W ca. 20 mm, S ca. 30 mm).
Dieser Raum, auch als Grazer oder Steirisches Becken bezeichnet, gehört zu den Ausläufern der Zentralalpen und muss korrekterweise der Mittel-steiermark zugerechnet werden, während das Gebiet südlich der Drau im heutigen Slowenien als Süd-steiermark bezeichnet wird. Das Steirische Becken ist durch eine hügelige, von Tälern durchzogene Landschaft gekennzeichnet, die gegen Süden und Osten zur Mur hin verflacht und eine Seehöhe von 600 m kaum übersteigt7. Im Norden und Westen ist das Gebiet durch massive Gebirgszüge, das Steirische Randgebirge, abgegrenzt. Das Bergmassiv im Westen, in Luftlinie nur etwa 25 km entfernt, umfasst die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Koralpe, in der sich Berge wie das Wolscheneck mit 1699 Höhenmetern oder der Große Speikkogel mit 2140 Höhenmetern erheben,sowie die im Norden anschließende Packalpe.
Ein Höhenwert in unmittelbarer Nähe der Fundstelle, etwa 500 m südöstlich und hangabwärts, beträgt 323 m. Das Höhenniveau beim Ort Gleinstätten direkt an der Vereinigten Sulm etwa 5 km südöstlich beträgt 298 m über der Meeresoberfläche8.
Die Fundstelle liegt heute im so genannten Hartwald, einem geschlossenen Forst, der sich seit der Josefinischen Landesaufnahme der Jahre 1764 bis 1787 nur wenig verändert hat. Erst durch den voranschreitenden modernen Lehmabbau mussten größere Flächen gerodet werden9. Ob das Areal in urgeschichtlichen Siedlungsphasen gerodet war, muss zukünftigen paläobotanischen Untersuchungen überlassen werden.
2.2 Verkehrsgeographische SituationWenn man von Graschach aus dem Flusslauf der Vereinigten Sulm gegen Westen folgt, teilt sich diese in die nördliche Schwarze Sulm und in die südliche Weiße Sulm. Diese beiden Flussläufe werden wiederum durch verschiedene kleinere im Koralpen-massiv entspringende Zuläufe gespeist. Das Gebirge bedingte damals – wie auch heute als Grenze der Bundesländer Kärnten und Steiermark – eine gewisse geographische Trennung, nicht aber zwin-gend auch eine kulturelle Verschiedenheit. Über-gänge bilden etwa der Jauksattel (1611 m) oder der Packsattel (1169 m). Das über diese Pässe erreich-bare Lavanttal führt in den Süden ins Drautal. Eine Möglichkeit, die Gebirgshöhen zu umgehen, bietet eine südlichere Route über den Krumbach und den heutigen Soboth-Stausee in das Gebiet des heutigen Lavamünd. Von dort aus gelangt man wieder über das Drautal nach Westen u. a. zu dem späturnen-felderzeitlichen und hallstattzeitlichen Fundort von Frög. Eine weitere Möglichkeit, in das fortbewe-gungsbegünstigte Drautal zu gelangen, ist eine Route über die Saggau, den Pößnitzbach entlang über den Possruck, dem slowenischen Bistricatal folgend bis zur Drava (Drau). In unmittelbarer Nähe dieses Knotenpunktes südlich der Drau liegt das späturnen-felderzeitliche Gräberfeld von Ruše (Maria Rast)10.
7 Dobiat 1980, 38 nach H. Paschinger, Steiermark, Sammlung geographischer Führer 10, 1974, 1 f. 8 Der unmittelbare Meereshöhenwert der Fundstelle lässt sich aus der Grabungsdokumentation nicht eruieren, da nur relative Höhen in Bezug zu einem Grenzstein vorhanden sind.9 Einen guten Überblick geben die im GIS Stmk. verfügbaren Luftaufnahmen: http://www.gis.steiermark.at/.10 Bernhard 2003, 9.
Abb. 1: Ausschnitt aus der Österreichischen Karte 1:25.000 Blatt 190 Leibnitz. Kreuz markiert Fundstelle des Objekts 7.
259
Im Süden das Pohorjegebirge (Bacherngebirge/Slowenien) umgehend, gelangt man in das Savatal (Savetal), welches in südöstlicher Richtung in das ober- und unterkrainische Gebiet und weiter über Zagreb (Agram/Kroatien) nach Beograd (Belgrad/Serbien) leitet. Die Save lässt die Möglichkeit, bei Ljubljana (Laibach) über die Zayer (Slowenien) und die Soča/den Isonzo (Slowenien bzw. Italien) in den Südwesten, in den italischen Raum zu gelangen, offen.
Eine wichtige Verbindung Richtung Süden ist nicht nur die Drau, die über Maribor (Marburg), Ptuj (Pettau) und Ormož in die kroatische Ebene führt, sondern auch die durch die Mittelsteiermark flie-ßende Mur. Zu dieser gelangt man, wenn man der Sulm gegen Osten in das Leibnitzer Feld folgt. Dabei passiert man im Bereich des Zuflusses der Saggau den etwa sechs Kilometer südöstlich der Fundstelle von Graschach entfernt gelegenen Burgstallkogel mit seiner hallstattzeitlichen Besiedlung und die ausge-dehnten Gräberfelder von Kleinklein. Weitere urnen-felder- bzw. hallstattzeitliche Siedlungsplätze entlang der Route sind der Königsberg bei Fresing und der Frauenberg am Rande des Leibnitzer Feldes11.
Die Mur fällt parallel zur Drau Richtung Südosten ab und tritt bei Bad Radkersburg in den slowe-nischen Raum ein, bis sich beide Flüsse südlich von Nagykanizsa (Ungarn) vereinen. Nahe der Mur gelegene Fundorte sind der Hoarachkogel bei Spielfeld, der Königsberg von Tieschen nördlich von Bad Radkersburg und die Siedlung von Poštela im Marburger Becken. Der Drava/Drau folgend gelangt man über Novi Sad (Neusatz/Kroatien) nach Beograd (Belgrad/Serbien).
Die Mur aufwärts gelangt man vom Leibnitzer Feld aus über die frühhallstattzeitlichen Fundplätze von Wildon und Graz in den Norden und letztlich auch ins Aichfeld mit dem berühmten Wagengrab von Strettweg. Von dort können die Niederen Tauern über den Schoberpass (849 m) und den Hohentauern-pass (1274 m) bis zur Enns überwunden werden.
Von der Enns aus gelangt man Richtung Westen der Traun folgend nach Hallstatt und gegen Norden in das Donautal, das weitreichende Verbindungen offen lässt.
Um in das Wiener oder Eisenstädter Becken zu gelangen, hält man sich an die Mürz, die bei Bruck in die Mur mündet, überquert den Semmering und folgt der Leitha. In den ungarischen Raum gelangt man über das Raabtal, das nordöstlich des Leibnitzer Feldes gelegen und über mehrere kleinere Täler, wie das Tal des Saßbachs, zu erreichen ist.
2.3 Geologische SituationDas Steirische Becken wird in der Geologie durch die Abgrenzung der Sausalschwelle, eine vom Plabutsch im Norden zum Sausal im Süden verlau-fende Formation, in ein Weststeirisches und in ein unweit größeres Oststeirisches Becken geteilt12. Dieses Hügelland wird größtenteils von Sanden, Schotter und Lehm durchzogen, vereinzelt treten auch fossilhältige Kalke und vulkanische Gesteine auf. Die Generierung von Boden und Gestein fand großteils im Jungtertiär statt. Ein Richtung Osten zurückziehendes Meer bildete im Weststeirischen Becken, in dem das Sulmtal liegt, die so genannte Florianer Bucht. In diesem ehemaligen Küstengebiet treten zahlreiche Braunkohlevorkommen auf13.
Die tertiären Schotter- und Mergelschichtungen wer-den partiell durch quartäre Niederterrassierungen überdeckt. Diese im Würm entstandenen Terrassen sind bis zu 20 m stark und setzen sich aus Kies-ablagerungen und geringer mächtigen Sandlinsen zusammen14. Im unmittelbaren Bereich der Fund-stelle tritt eine Schichtung mit einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton auf. Dieser Lehm wird ökono-misch genutzt und industriell abgebaut.
Das Gebirge der sich im Westen erhebenden Koralpe ist ein polymetamorphes Grundgebirge und setzt sich aus kristallinem Gestein, aus Gneis und Glimmerschiefer, aber unter anderem auch aus kleineren Marmorvorkommen zusammen15.
11 Bernhard 2003, 9.12 Fuchs 1980, 462.13 Gräf 1977, 14.14 Flügel, Neubauer 1984, Geologische Karte 1:200.000 & Erläuterungen der Karte 14 f.15 Flügel, Neubauer 1984, Geologische Karte 1:200.000 & Erläuterungen der Karte 68 f.
260
Für die früheisenzeitliche Rohstoffgewinnung könn-ten die Eisenerzvorkommen am nahen Burgstall-kogel, die noch im 20. Jh. abgebaut wurden16, eine Rolle gespielt und möglicherweise dem Gebiet zusammen mit der besonderen Verkehrslage seine überregional bedeutende Position in der Hallstattzeit verliehen haben17.
Mineralien wie Basalt, Quarze, Opal, Kalkspat und Braunkohle treten im tertiären Hügelland auf18, sind aber für die urgeschichtliche Gewinnung sicherlich von geringer Bedeutung. In unmittelbarer Nähe der Fundstelle ist ein urgeschichtlicher Abbau des dort anstehenden Lehms als Keramikrohstoff nicht auszu-schließen.
2.4 Siedlungstopographische BedeutungEs ist anzunehmen, dass sich die Fundstelle, eine leicht fallende Terrasse, als Siedlungsplatz gut geeignet hat. Wasserversorgung war durch eine nahe Quelle gegeben19, Brunnenanlagen waren wahrscheinlich nicht vonnöten. Hochwassergefahr konnte aufgrund der Entfernung zur Sulm und zum 900 m weiter östlich gelegenen Otternitzbach und der leichten Hanglage nicht entstehen. Ein weiterer Vorteil der Fundstelle war bei entspre-chender Rodung des Waldes eine weitreichende Sicht auf das Sulmtal.
Die Fundstelle befindet sich also durch die Fluss-nähe und die daher mit Tälern verbundene Lage an einer vor allem Richtung Südosten verkehrs-begünstigten Position. Aus Sicht des heutigen Forschungsstandes ist diese Lage allerdings nicht als zentral zu betrachten, da es sich um keinen besonders hervorzuhebenden oder begünstigten Ort handelt.
3. Fundgeschichte
3.1 Forschungsgeschichte der Grabhügel im HartwaldDie unmittelbare Umgebung ist archäologisch nicht unbekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Grabhügel im Fleischhacker-Wald20, der in der Flur Hart lag, in der Gemeinde Graschach bekannt. So wird von vier dort befindlichen „Hunnengräbern“ berichtet, von denen die drei größeren unversehrt schienen. Im Hartrigler Wald direkt an der Straße, die nördlich von Gleinstätten nach St. Florian führt, beobachtete man drei Grabhügel, bei denen ein Bauer Münzen gefunden haben soll. Weiters wird im „Walde des Teisel“21 bei Hart von 12 weiteren Grabhügeln berichtet22.
Einer der frühen Forscher, Bergdirektor V. Radimský, zählte in seiner 1883 erschienenen Publikation innerhalb der Gemeindegrenzen von Graschach 49 Tumuli23. Ein großer Anteil an Hügelgräbern, nach Radimský ungefähr 28, wurde schon früh meist von Unbekannten „geöffnet“24, die tatsächliche Zahl liegt sicherlich noch höher.
Noch im 19. Jh. rankten sich bei den Sulmtalern zahlreiche Sagen um die obertags sichtbaren Boden-denkmale. Meist wurden sie für Heidenkeller gehal-ten, da man Kohle und „Häferln“ in ihnen fand. Die Sage vom König Adele (Attila) und drei Särgen, von denen einer golden gewesen sein soll, veranlasste Bauern des Sulmtales, die Grabhügel zu zerstören25. Noch Mitte des 19. Jhs. forderte das Antikenkabi-nett in Graz Bauern von Glein auf, Grabanlagen abzugraben und Funde dem Joanneum zu übergeben.
Zu dieser Zeit sollen im Gemeindegebiet von Graschach elf Grabanlagen von Dr. Ferdinand Unger aus Groß St. Florian ergraben worden sein26. Leider
16 Dobiat 1980, 39.17 Bernhard 2003, 11.18 Meixner 1956, 55.19 Hebert 1988, 286: Ein kleiner Quellbach entspringt zwischen Grundstück Nr. 584 und 540/2.20 Die Position dieser alten Waldbezeichnungen konnte nicht mehr eruiert werden.21 s. Anm. 20. 22 Puff 1846, 33.23 Radimský 1883, 58 f.24 Radimský 1883, 61.25 Radimský 1883, 62.26 Radimský 1883, 64.
261
sind die dazugehörigen Funde nicht im Landesmuseum Joanneum zu finden und gelten daher als verschollen. Angeblich wurde eine Plattenkammer in einem der Gräber beobachtet27, was auf eine kaiserzeitliche Bestattung hindeuten könnte. Trotz der vor dem Ackerbau geschützten Waldlage sind die erhaltenen Hügel niedrig (0,2 bis 1,15 m).28
1881 und im darauf folgenden Jahr ergrub Radimský selbst zwei dieser Grabanlagen. Eine weitere wurde 1882 von J. Szombathy geöffnet. Leider wurden bei diesen Grabungen aufgefundene Keramikobjekte nur in einem Vorbericht erwähnt29 und nicht bildlich dargestellt. Steineinbauten waren nicht vorhanden; in einem Hügel fanden sich mit einigen Scherben vermengte Leichenbrandreste, in einem anderen Hügel zwei kohle- und aschehältige Schichten. Die Gefäßformen der wenigen Funde, die leider nicht weiters beschrieben sind, sollen sich in die Formgabe der Burgstaller Beigabengefäße vollständig ein-gliedern lassen30. J. Szombathy setzt die 13 von Radimský kartierten Tumuli31 „im großen Hart von Graschach“ mit großer Wahrscheinlichkeit in die Hallstattzeit32.
St. Pahič ortet 1972 nach R. Puff norisch-panno-nische Grabhügel in Graschach33.
1981 zählt D. Kramer 46 dem Gräberfeld angehö-rende Grabhügel, die alle alt beraubt bzw. ergraben und deren Funde nur teilweise erhalten sind. Zeitlich setzt er das Gräberfeld vorbehaltlos in die römische Kaiserzeit34. Die Annahme, dass alle Gräber zerstört sind, ist wohl nicht zutreffend35. So wurden fünf zwar offensichtlich alt angegrabene, als Bodenkmale aber einigermaßen intakte provinzialrömische Hügelgräber etwa 350 m nördlich der Siedlungsbe-fundkonzentration 1989 unter Schutz gestellt. Eine
weitere Untersuchung in einem grabhügelähnlichen Objekt weiter südöstlich fand 2002 durch W. Artner statt36; nach der Interpretation des Ausgräbers handelt es sich allerdings um einen Überrest mittel-alterlicher Ackerbautätigkeit.
3.2 Fundumstände und Siedlungsbefunde1987 fanden im Hartwald bei Graschach Erweite-rungsarbeiten der Lehmgrube des Ziegelwerks Gleinstätten statt.
Im Dezember 1987 wurde das betroffene Gebiet von den Brüdern Anton und Günther Steffan, Deutschlandsberg, begangen und als archäologische Fundstelle erkannt. Auf dem Grundstück Nr. 600/2 wurden mehrere Gruben gesichtet; weiters konnten einige Keramikfragmente geborgen werden37.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Ziegelwerk Gleinstätten und dank freiwilliger Helfer konnten in einigen Bereichen unter der Leitung des Bundes-denkmalamtes auch archäologische Untersuchungen durchgeführt werden, wogegen man sich bei einigen Flächen wegen der großen Ausdehnung auf Prospek-tionen beschränken musste38.
Insgesamt wurden im Winter 1987/88 acht Fund-stellen erkannt, von denen hier nur die wichtigsten zusammenfassend dargestellt werden sollen. Drei Verfärbungen stellen wahrscheinlich Hüttenreste dar: Die Fundstelle 2 ist durch 1-2 m lange parallele Balkenverfärbungen gekennzeichnet, die Fundstelle 5, durch Baggerarbeiten zur Hälfte zerstört, zeigt eine längliche Verfärbung, während bei der Fundstelle 6 eine Bodenverfärbung vorhanden ist, der ein berg-seitiger Sohlgraben vorgesetzt ist. Die Verfärbung 4 stellt eine intentionelle Kieselpflasterung dar, die eventuell als Bodenkonstruktion für ein Gebäude zu deuten ist39.
27 Radimský 1883, 64.28 Radimský, Szombathy 1885, 166.29 Radimský, Szombathy 1885, 166.30 Radimský, Szombathy 1885, 166.31 Radimský 1883, Taf. IX.32 Szombathy 1890, 171.33 Pahič 1972, 190.34 Kramer 1981, 128.35 Bernhard, Hebert 2000, 91.36 Artner 2002.37 Hebert 1987, 224.38 Hebert 1988, 286.39 Hebert 1992, 89: Plan der Kiesellage.
262
Im Jahr 1989 fanden sich weitere Fundstellen (9-16)40. Unter diesen Objekten ließen sich aber-mals Verfärbungen, die als Hüttenreste gedeutet werden können, ausmachen. Bei der Fundstelle 9, eine Verfärbung mit einem möglichen Entwässe-run-gsgraben, handelt es sich wahrscheinlich um eine ehemalige Behausung, während die um die Verfärbung (9 x 3 m) laufenden Gräben der Fund-stelle 10 wie auch die parallel liegenden Gräben der Fundstelle 11 deutlicher für die Deutung als Hütte sprechen. Da Pfostenlöcher auch im Bereich der ver-mutlichen Behausungen fehlen, sind die Hütten am ehesten in Blockbautechnik (dabei werden Balken waagrecht gestapelt und verkeilt) errichtet worden41. Weitere Befunde stellen meist Gruben (Fundstelle 1, 16) dar, wobei einige Verfärbungen, die teilweise keine gut erkennbaren Grenzen besitzen, als Reste von Kulturschichten angesprochen werden42.
Die Grabungen setzten aufgrund des voranschreitenden Lehmabbaus 1996 wieder ein; dabei wurden einige Objekte (Fundstellen 17-23) freigelegt43, der Umriss zeigte sich jedoch nur klar bei der Fundstelle 1944.
Bis dato sind ein Plan, in dem alle bisherigen Fundstellen kartiert worden sind45 (Abb. 2), einige Befunde46 und Funde47 veröffentlicht worden.
Aufgrund von chronologisch divergierenden Keramik-funden, teilweise innerhalb einzelner Objekte (Fundstelle 6), wurde bald klar, dass die Siedlung nicht nur einer hallstattzeitlichen Phase angehört48. Ob sich diese Zwei- oder Mehrphasigkeit auch stratigraphisch festlegen lässt, kann ohne eine weitere Bearbeitung nicht beurteilt werden.
Mit den ersten Objekten im Winter 1987/88 wurde auf Grundstück Nr. 600/3 die in dieser Arbeit genau
beschriebene Fundstelle 7 entdeckt, die B. Hebert als „Brandverfärbung mit reichlich Holzkohle und zahlreichen Keramikfragmenten“49 beschrieb. Sie blieb für eine genauere Untersuchung aufgespart, die 198950 unter der örtlichen Grabungsleitung von G. Sommer51 durchgeführt wurde.
Die etwa 1 m tiefe und 2 m breite Grube wird in den Fundberichten als schlecht erhaltener Töpferofen angesprochen. Die Keramik datiert Hebert eher in die späte Hallstattzeit52.
Sämtliche Funde der Rettungsgrabungen von Graschach, wie auch jene des Objekts 7, wurden im Burg-museum Deutschlandsberg restauriert und werden bis dato auch dort aufbewahrt, während die (zeich-nerische und fotografische) Befunddokumentation im Bundesdenkmalamt in Graz liegt.
40 Hebert 1989, 197 f.41 Bernhard, Hebert 2000, 91.42 Hebert 1989, 198.43 Bernhard, Hebert 2000, 91 f.44 Hebert 1996, 48 f. – Bernhard, Hebert 2000, 91-99.45 Bernhard, Hebert 2000, 96.46 Hebert 1992, 89. – Hebert, Lehner 1996, 153.47 Hebert 1988, 286 f. mit Abb. 306 ff. – Hebert, Lehner 1996, 139 f., Abb. 154. – Bernhard, Hebert 2000, 91-99.48 Hebert 1988, 286 f.49 Hebert 1988, 287.50 Grabungszeitraum: 8. 5. 1989-31. 5. 1989.51 Grabungsmitarbeiter: Peter Nagele, Claus Kiedl, Anton Steffan.52 Hebert 1989, 198.
Abb. 2: Kartierung der Objekte auf dem Katasterplan. Im Maßstab 1:3000. Grafik nach: Bernhard, Hebert 2000, 96.
263
4. Grabungsmethodik und Befunde
4.1 GrabungsmethodikDie Grabung wurde so angelegt, dass durch die Entfernung einzelner Abhübe53 Dokumentations-niveaus entstanden sind, deren erkenntbare Befunde zeichnerisch ausführlich festgehalten und nivelliert worden sind, wobei auch herausragende Funde bzw. Fundkonzentrationen eingemessen wurden54.
Zuerst wurde über den Bereich der Fundstelle und über deren Grenzen hinausgehend ein in vier Sektoren (NW, NO, SW, SO) geteilter Quadrant (Q I) mit 5 x 5 m Seitenlänge gelegt. Die rundliche Verfärbung mit etwa 2 m Durchmesser lag zur Gänze innerhalb des Quadranten und wurde somit ebenfalls in jene vier Sektoren geteilt.
4.2 BefundeDer NW-Abschnitt wurde offensichtlich im Herbst zuvor bis zu einem Dokumentationsniveau schon teilweise ergraben55, sodass zu Beginn der Grabung ein etwa 20 cm hohes Profil der Grube erhalten war.
Da der NW-Abschnitt tiefer gelegen war, wurde zuerst im NO-Sektor abgegraben. Die Grube war in diesem Bereich nach den ersten Abhüben auf dem Niveau von Planum 1 nur leicht durch einen rotbraunen lockeren Lehm (Abb. 3, Schicht 4), der sich vom ockerfarbenen, kompakten, gewach-senen Lehmboden abhebt, erkennbar. Spärliche Keramikfunde traten auf. Nach einem Abhub auf Planum 2 fanden sich in diesem immer rotbrauner werdenden oberen Bereich der erhaltenen Grube u. a. die Handhabe eines Großgefäßes (Taf. 1/1), Holzkohle und verbrannter Ton.
Nach weiterem Abgraben zeigten sich auf Planum 4 erste divergierende Schichtungen; so erkannte man als Außengrenze der Grube eine rundliche Verfärbung, die sich aus rötlicherem, dunklerem Lehm mit Holzkohleeinschlüssen zusammensetzte. Innerhalb dieser kranzförmigen Verfärbung befand sich rötliche Erde, die nach unten zunehmend mit Steinen und verbranntem Lehm durchsetzt war. Darunter kam ein gebrannter, verziegelter, roter Lehm, auf dem größere Keramikkonzentrationen lagen, zum Vorschein (Abb. 4, Schicht 1).
Im NW-Sektor, der nun dieselbe Höhe wie der NO-Sektor aufwies, fanden sich ebenfalls auf dem verziegelten Lehm Fragmente eines kleinen Kegel-halsgefäßes (Taf. 1.4), Fragmente zweier fassförmi-ger Gefäße (Taf. 5.19 u. Taf. 5.20), ein Bodenfrag-ment (Taf. 5.22) und ein Schalenrandfragment.
Das nächste Planum des gemeinsam betrachteten Sektors NO/NW zeigte nun deutlich eine durchge-hende verziegelte Lehmschicht, auf der größere und kleinere Steine, dazwischen Keramikfragmente in Gruppen, u. a. Fragmente eines größeren Kragen-randgefäßes (Taf. 2.5), einer graphitierten Einzugs-schale (Taf. 3.11), ein Fragment einer Schüssel (Taf. 3.13), weitere Teile einer anderen, bemalten Schüssel (Taf. 4.14) und ein Webgewicht (Taf. 6.25), auflagen.
Im südlichen Abschnitt der Grube fand man in den ersten Abhüben ebenfalls wenig Keramik. Der ocker-farbene Lehm wurde dunkler und rötlicher und auch Steine und Keramikfragmente wie u. a. ein verziertes Einzugsschalenfragment (Taf. 3.12) häuften sich.
Als nächstes wurden auf der gesamten Fläche der Grube Steine bis zur verziegelten Lehmschicht ent-fernt und etwas abgetieft. Im dabei entstandenen Dokumentationsniveau (Abb. 4) wurde die im inne-ren Bereich liegende rote Verziegelung festgehalten (Abb. 4, Schicht 1). Im äußeren Grubenbereich zeigte sich eine immer breiter werdende dunklere, ockerfarbige, lehmige, mit Holzkohleeinschlüssen durchsetzte Schicht (Abb. 4, Schicht 2).
Beim nächsten Arbeitsvorgang wurde die rote Verziegelungsschicht, die im inneren Bereich tiefer reichte und mit zahlreichen Steinen vermischt war, komplett abgetragen. Darunter kam eine dunklere lehmige Schicht (Abb. 3, Schicht 6), die stark mit Holzkohle durchsetzt war, mit wenigen keramischen Funden zum Vorschein.
Darunter folgte eine dunkle, schottrige, lehmige Schicht, in der sich u. a. ein Webstuhlfragment fand. Im anschließenden gewachsenen Lehm ließen sich Holzkohlespuren erkennen, die wohl einge-sickert waren.
53 Ein Abhub entspricht im Durchschnitt etwa 5 cm Erdabnahme.54 Die Dokumentationsmappe beinhaltet insgesamt etwa 15 Pläne, einige Fotografien und ein Grabungstagebuch, das Skizzen und den Verlauf der Grabung wiedergibt. Weiters sind einige Abbildungen in Form von Dias vorhanden.55 Laut Grabungsdokumentation.
264
Abb.
3: S
üdpr
ofil.
Im M
aßst
ab 1
:25.
Dur
chsc
hnitt
liche
Höh
e de
s D
okum
enta
tions
nive
aupl
ans
(Abb
. 4)
Hol
zkoh
le
Lehm
, geb
rann
t
Kera
mik
Schi
chte
nver
lauf
am
Orig
inal
plan
sch
wer
erk
ennt
lich
Lege
nde:
Schi
chte
n:
Schi
cht 1
: W
aldh
umus
, sch
wär
zlic
h, lo
cker
.
Schi
cht 2
: le
hmig
, ock
erfä
rbig
, loc
ker m
it vi
elen
Wur
zeln
.
Schi
cht 3
: le
hmig
, dun
kel o
cker
färb
ig, k
ompa
kt m
it w
enig
Hol
zkoh
le u
nd g
ebra
nnte
m L
ehm
.
Schi
cht 4
: le
hmig
, mit
zune
hmen
der T
iefe
imm
er rö
tlich
er w
erde
nd
lo
cker
mit
wen
ig H
olzk
ohle
und
geb
rann
tem
Leh
m.
Schi
cht 5
: Le
hm, r
ot, g
ebra
nnt.
Schi
cht 6
: le
hmig
, dun
kel o
cker
färb
ig m
it se
hr v
iel H
ohlk
ohle
.
Schi
cht 7
: le
hmig
, dun
kel,
scho
ttrig
.
265
Abb.
4: D
okum
enta
tions
nive
au Q
I, P
l. 4.
Im M
aßst
ab 1
:25.
Schi
chte
n:
Schi
cht 1
: Le
hm, r
ot, g
ebra
nnt,
mit
Schi
cht 5
des
Profi
lpla
ns (A
bb. 3
) kor
relie
rbar
Schi
cht 2
: le
hmig
, dun
kel o
cker
färb
ig m
it se
hr v
iel H
olz-
kohl
e, m
it Sc
hich
t 6 d
es P
rofil
plan
s ko
rrelie
rbar
.
Schi
cht 3
: st
ark
holz
kohl
ehäl
tig =
Sch
icht
2.
Schi
cht 4
: un
rege
lmäß
ige
Verti
efun
gen
in S
chic
ht 1
.
266
4.3 Auswertung der Befunde
Das aus der rundlichen, 2 x 2 m großen Grube gehobene lehmige Material zeigte mehrheitlich Spuren von Brandeinwirkungen; so wurde die Grube erstmals durch rötlichen Lehm und wenig Holzkohle erkennbar (Abb. 3, Schicht 4). Beim weiteren Abtragen wurde diese Schicht zunehmend dunkler und rötlicher, zahlreiche Steine traten auf, bis sich eine verziegelte Lehmschicht zeigte, die gegen die Ränder der Grube hin ausdünnte und im zentralen Bereich der Grube eine Stärke von 10-15 cm auf-wies (Abb. 3, Schicht 5).
Diese gebrannte Schicht weist zumindest auf eine befeuerte Stelle hin oder könnte als der Brandplatz eines Keramikofens gedeutet werden56. Wie schon eingangs erwähnt, erschwert der schlechte Erhaltungszustand die Interpretation des Objekts. B. Hebert nahm an, dass der Ofen nach der Benutzungsphase der Verwitterung zum Opfer gefallen und langsam eingestürzt ist und daher Heizkanal, Tenne und Kuppel schlecht bzw. nicht auszumachen sind57. Allerdings ließen sich in der rot gebrannten Lehmschicht unregelmäßige Vertiefungen (Abb. 4, Schicht 4) erkennen, die eventuell Lochtennenreste darstellen. Diese ver-meintlichen Tennenreste würden in solch einem schlechten Erhaltungszustand die Theorie des langsamen Verfalls des Ofens unterstützen. Weiters konnten Kuppelaufbau oder andere aufgehende Strukturen nicht erkannt werden. Ein Heizkanal und eine Befeuerungsgrube, die für die Beheizung des Grubenofens unerlässlich erscheint, wurden nicht festgestellt. Die schottrige Schicht (Abb. 3, Schicht 7) wies keine Befeuerungsmerkmale auf und könnte laut Ausgräber eventuell die Luft-zufuhr von unten ermöglicht haben58. Solche Kieselunterlagen treten öfters auf; sie wurden aller-dings, da sie den Untergrund des Ofens darstellen, nicht zur Luftzufuhr benötigt, sondern dienten der Wärmespeicherung59.
Eine eventuell vorhanden gewesene Lochtenne und vor allem die Eintiefung des Objekts würden nicht gerade für eine Deutung des Objekts als Backofen sprechen, da Backöfen wohl eher als liegende d. h. ebenerdige Öfen konzipiert waren60.
Eingetiefte Kuppelöfen mit Lochtennen sind gegen-über liegenden Öfen und einfachen Grubenbränden besser kontrollierbar. Hohe Temperaturen werden durch das Brennmaterial und durch die Regulierung der Heizgasströme erreicht.
Dadurch, dass das Brenngut nicht direkt mit dem Feuer in Kontakt tritt und die Befeuerungsflamme durch die Trennung der Heizkanäle geteilt wird, soll die Keramik gleichmäßig und schonend gebrannt werden. Diese Ofenform findet sich in der Latènezeit wie auch bei den Griechen und Römern, während die Grundbauweise kaum verändert wird61, und soll in Mitteleuropa in der Hallstattzeit entwickelt und zum Standard geworden sein62 (Abb. 5).
Die Suche nach Entsprechungen zu der Brandgrube von Graschach in der Hallstattzeit innerhalb der Südostalpinen Gruppe gestaltet sich schwierig, auch aufgrund von bisher selten ergrabenen und publi-zierten Siedlungsbefunden.
Vergleichbare, allerdings ältere Befunde konnten bei Grabungen im Bereich des Karmeliterplatzes in Graz beobachtet werden. Dort fanden sich in einer mehrphasigen Siedlung der Stufe Hallstatt B über 30 Feuerstellen, wobei bei drei Objekten ebenfalls Schotter unter der Herdplatte lag. Einige Gruben wiesen auf der Sohle Steinsetzungen auf, die unter Hitzeeinwirkung standen63. In einer späthallstattzeit-lichen Hütte in Gradišče bei Valiče vas (Slowenien) ist eine Herdstelle mit einer Steinunterlage, auf der sich eine gebrannte Lehmschicht befand, als Backofen anzusprechen.64
56 Erstmals Hebert 1989, 198.57 Hebert 1989, 198.58 Grabungsdokumentation G. Sommer.59 Tuzar, Dell’mour 2000, 51.60 Als Beispiel siehe u. a. Griebl 2004, 66 ff., Objekt 31 wird als Grubenhaus mit einem darin liegenden Backofen gedeutet.61 Weiser 2003, 19.62 Drews 1978/79, 40.63 Hebert 2003, 677. – Feichtenhofer, Roscher 2004, 38. Bisher wurde keine weitergehende Bearbeitung der Befunde und Funde vom Karmeliterplatz durchgeführt. 64 Dular, Breščak 1996, 154, 157.
267
Grubenöfenbefunde konnten im niederösterrei-chischen und bayrischen Raum dokumentiert werden. Zwei eingetiefte Öfen, die als Backofen bezeichnet werden, fanden sich im urnenfelder-zeitlichen und hallstattzeitlichen Siedlungsbereich von Franzhausen, MG Nußdorf ob der Traisen65. Zumindest ein Objekt, das eine Kuppel und Lochtennenreste aufweist, scheint gut erhalten gewesen zu sein.
In der hallstatt- und frühlatènezeitlichen Siedlung „Erdwerk I“ von Niedererlbach, Landkreis Landshut, Bayern, fanden sich zumindest fünf Feuerstellen bzw. Öfen, von denen zwei Objekte ohne Kuppel in Häusern liegen und Kieselsteinrollierungen unter der gebrannten Lehmschicht eine Analogie zu der Brandgrube von Graschach bilden. Diese Befunde und zwei weitere Feuerstellen dürften von einfachen offenen Feuerstellen zeugen. Ein weiteres Objekt, das allerdings in die Frühlatènezeit zu datieren sein dürfte, wies eine Kieselrollierung, Kuppelreste, eine gebrannte Lehmtenne und eine Befeuerungsgrube auf, sodass es als Keramikbrennofen gedeutet wird66.
Ein hallstattzeitlicher Ofen aus Marlenheim/Fessen-heim dürfte laut einem Rekonstruktionsversuch tech-nisch ausgereift gewesen sein, da er eingetieft war, eine Tonsäule als Träger für eine Lochtenne und eine Kuppel besaß67.
Die keramischen Fundstücke helfen bei der Inter-pretation der Brandgrube aus Graschach leider kaum weiter, da der Großteil der aufgefundenen Keramik als fertig produzierte Ware angesehen werden kann, kaum sekundäre Brandspuren aufweist und daher als Siedlungsabfall gedeutet wird, der mit dem Verfall des Ofens in die Grube gelangt war, wogegen nur einige wenige Stücke schlecht gebrannt sind und als Fehlbrandreste angesehen werden können.
5. Die Funde
In der Brandgrube von Graschach fand sich, bis auf gebrannten Lehm und Holzkohle, ausschließ-lich keramisches Fundmaterial. Einige charakte-
ristische Fundstücke wurden wie bereits erwähnt eingemessen und können somit einer Stratifikations-einheit zugeordnet werden.
5.1 Stratigraphische Zuordnung der FundeIm Waldhumus konnten erste, wenn auch wenige Funde beobachtet werden, so u. a. das Randfrag-ment eines auf der Drehscheibe hergestellten Topfes (Taf. 6.36).
In der über der eigentlichen Verfärbung liegenden Schicht 3 (Abb. 3) finden sich wenige Keramik-fragmente, die, auch als sich die Grube deutlich abzeichnet, in der Schicht 4 (Abb. 3) immer noch recht spärlich auftreten, sich aber häufen, je näher man der Lehmplatte gelangt. Direkt auf der verzie-gelten Lehmschicht lagen, wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, Keramikansammlungen, die den Großteil des Fundmaterials ausmachen, sowie ein Web-stuhlfragment (Taf. 6.25). Zu dieser Konzentration zählen Kragenrandgefäßfragmente (Taf. 1.4, Taf. 2.5, Taf. 5.24), Stücke von fassförmigen Gefäßen (Taf. 5.19 u. Taf. 5.20), ein Bodenfragment (Taf. 5.22) sowie Schüssel- (Taf. 3.13, Taf. 4.14 u. Taf. 4.15) und Schalenfragmente (u. a. Taf. 3.11, Taf. 4.16 u. Taf. 4.17). Wenige Funde stammen aus der unter der gebrannten Lehmschicht liegenden Schicht 6 (Abb. 3), u. a. ein Randfragment, das wahrscheinlich einem Kragenrandgefäß zuzurechnen ist (Taf. 1.2)69.
65 Neugebauer et al., 1990, 47, 59 – Nebelsick 1997, 185 f. Bisher wurde keine Bearbeitung der Siedlung von Franzhausen durchgeführt, somit ist eine genauere Datierung der Öfen ungewiss.66 Müller-Depreux 2005, 32-35.67 Drews 1978/79, 49 f.68 Abb. aus Tomanič, Guštin 1996, 276.69 Das Fragment stammt nach einer Anmerkung auf dem Fundzettel aus dem Ofengrund.
Abb. 5: Idealisierter latènezeitlicher Lochtennenofen aus Spodnja Hajdina/Slowenien68.
268
5.2 FundspektrumIn der Grube treten insgesamt 21 eindeutig bestimmbare Gefäße auf, wobei die größte Gruppe Schalen darstellen (Abb. 6). Zu den Sonderformen zählen ein Miniaturgefäß und zwei Webgewichte.
5.2.1 KragenrandgefäßeKragenrandgefäße sind Gefäße von mittlerer bis großer Ausprägung, deren leicht ausladende, an einen aufgestellten Hemdskragen erinnernde Ränder mit einem kurzen, fast senkrechten Hals den Typ charakterisieren. Die Gefäße weisen einen kugeligen bis gedrungenen Bauch auf. Kragenrandgefäße treten innerhalb der Stufen Ha C und Ha D im mitteleuropäischen Raum auf, bemalte Stücke oft in Grabausstattungen der Kalenderberggruppe70, Handhaben sind dagegen eher selten71. Da eine schlüssige Typologisierung von Kragenrandgefäßen bislang fehlt, ist ihre chronologische Aussagefähig-keit eher beschränkt.
Im Fundspektrum von Graschach sind sie mit min-destens drei Stücken vertreten (Taf. 1.3, 1.4 und 2.5), wobei sich eine Zuordnung einzelner Rand-stücke (Taf. 1.2, Taf. 5.24 und Taf. 5.25) oft schwierig gestaltet, da Ähnlichkeiten mit Schüssel-rändern in Form und Qualität vorhanden sind72. Die Machart der Stücke ist hochwertig, sowohl die
sicher bestimmbaren Stücke als auch die unsicheren sind fein geschlämmt, leicht glimmerhältig und mäßig hart bis hart gebrannt. Die Oberfläche wurde geglättet und in einem Fall auch graphitiert. Die Oberfläche des großen Kragenrandgefäßes (Taf. 2.5) ist schlecht erhalten, weist aber Verfärbungsspuren auf, die von einer Graphitierung oder Bemalung stammen könnten. Diese Qualität ist mit den Funden der hallstattzeitlichen Siedlung von Kalsdorf bei Graz vergleichbar, da diese meist eine graphitierte und manchmal geglättete Oberfläche aufweisen.
Der Form nach können in Graschach zwei Stücke voneinander unterschieden werden. Ein Gefäß (Taf. 1.4) weist einen kugeligen, gedrungenen Bauch auf, dessen Schwerpunkt im unteren Drittel des Gefäßes liegt. Auf der Schulter ist ein Knubbenansatz mit einer umlaufenden Kannelur zu erkennen, weiters läuft eine doppelte Fingerstrichkannelur in einem Zick-Zack-Muster vom Bauchumbruch bis zur Schulter. Aus dem Fundmaterial von Kalsdorf bei Graz können lediglich zwei Randfragmente aufgrund ihres leicht ausladenden Randes als Vergleichs-objekte herangezogen werden73. Auch die Größe des Mundsaumdurchmessers (in Kalsdorf 17 und 21 cm, in Graschach 18 und 20 cm) ist ähnlich.
Ein Gefäß74 aus dem Grab 40 der Sulmtalnekropole aus dem Grellwald ähnelt aufgrund einer dreifachen Fingerstrichkannelur und einer Knubbe auf der Schulter dem Kragenrandgefäß von Graschach (Taf. 2.5) und ist in die Phase 2 nach Dobiat zu stellen75. Die Größe der Gefäße ist als mittelgroß zu bezeichnen (Mundsaumdurchmesser von 18-22 cm).
Eine zweite Ausprägung eines Kragenrandgefäßes (Taf. 2.5)76 weist größere Ausmaße (Mundsaum-durchmesser 24 cm, Bauchdurchmesser 44 cm) und einen ebenfalls kugeligen, gedrückten Bauch, bei dem der Bauchumbruch im Gegensatz zu dem mittelgroßen Kegelrandgefäß (Taf. 1.4) im mittleren Bereich des Gefäßes liegt, auf. Eine Knubbenzier mit einer umlaufenden Fingerstrichkannelur ist wieder unter dem Schulter-Hals-Umbruch zu finden.
70 u. a. Preinfalk 2003, Taf. 13.27 und 53. Rebay 2002, Taf. 18.71.71 Tiefengraber 2005, 167.72 Tiefengraber 2005, 167.73 Tiefengraber 2005, Taf. 31.8 und Taf. 32.9.74 Dobiat 1980, Taf. 80.11.75 Dobiat 1980, 169.76 Diese Form der Kragenrandgefäße wird auch als Schüssel bezeichnet; s. Tiefengraber 2005, 175.
Abb. 6: Fundspektrum. Grafik: M. Raab.
269
Ein ähnliches Kragenrandgefäß wurde bei den Grabungen 1996 in Graschach innerhalb des Objekts 19, einer Siedlungsgrube, gefunden77. Es entspricht sowohl in Größe (Mundsaumdurchmesser 26 cm) als auch Verzierung – vier kreuzständige, spitzkegelige Knubben an der Schulter – dem hier angeführten Gefäß.
Auch hier liefert der steirische Fundort Kalsdorf bezüglich der Form und der Maße (Mundsaum-durchmesser 21 und 26 cm) gute Vergleichsstücke78. Ein Stück besitzt im selben Gefäßbereich gegenstän-dige Knubben, allerdings ohne Kannelur, während ein zweites Stück gänzlich unverziert ist.
Weitere Parallelen zu dem größeren Gefäß bietet – obwohl sie niedriger und gedrungener ist – eine mit Leichenbrand gefüllte Urne aus Dietenberg bei Ligist/Stmk., da sie einen ausbiegenden Rand und eine Knubbe auf der Schulter aufweist79.
Im Wiesenkaisertumulus Nr. 4 der Sulmtalnekropole fanden sich unter den Grabbeigaben eines Mannes zwei Kragenrandgefäße, die unmittelbar neben der Grabgrube aufgestellt und nicht verbrannt waren. Eines dieser Kragenrandgefäße besitzt der Form nach große Ähnlichkeiten mit dem Graschacher Stück, der Mundsaumdurchmesser ist aber deutlich geringer (15-16 cm)80. An der Schulter finden sich ebenfalls Knubben, während es zusätzlich am Hals mit Punktreihen und an der Schulter durch vertikale Kanneluren verziert ist. Die Keramik des Grabes lässt sich in die dritte Belegungsphase nach Dobiat einordnen81.
Ein Randfragment mit oben abgestrichenem Mund-saum (Taf. 1.2), das wahrscheinlich einem Kragen-randgefäß zuzurechnen ist, hebt sich aufgrund des horizontal abgestrichenen Mundsaums ab.
Entsprechungen dafür wie auch für einen weiteren schwer zuordenbaren Kragenrand (Taf. 1.3) bietet das Kalsdorfer Fundmaterial82. Die Scherbe fand sich direkt auf dem gewachsenen Lehmboden am Ofengrubengrund.
Zum Typ X wurden die Kragenrandgefäßfragmente des stark zerscherbten Siedlungsmaterial vom Burgstall bei Kleinklein zusammengefasst; sie sind während der Besiedlungsphasen 1-3 nachgewiesen, während sie in der vierten, fundärmsten Phase nicht mehr vertreten sind, was aber laut Smolnik „nicht der historischen Realität entsprechen muss“83. Größenunterschiede lassen sich in der späten Urnenfelderzeit, nicht mehr aber in den jüngeren Siedlungsphasen (Mundsaumdurchmesser ca. 16-22) belegen84.
Kragenrandgefäße der Sulmtalnekropole sind meist mit Zickzackbändern, Dreiecken und Streifen, in roter und schwarzer Farbe gehalten, bemalt oder mit Punkteindrücken, Winkelmustern und Knubben an der Schulter verziert85. Sie datieren in die 2. Phase nach Dobiat und scheinen in Phase 3 nicht mehr in Gräber mitgegeben worden zu sein86.
Aufgrund ihrer Größe und ihrer kugeligen Bauch-ausprägungen könnten Kragenrandgefäße eine Flüssigkeitsbehältnis-, Vorratsbehältnis- oder eine Mischfunktion, wie sie bei Kegelhalsgefäßen ange-nommen wird87, gehabt haben.
5.2.2 Einzugsrandschalen und weitmundige SchalenEinzugsrandschalen stellen mit sieben gesicherten Stücken (Taf. 2.6-3.12) den größten Anteil, nämlich ein Drittel, der Funde der Brandgrube von Graschach dar. Dieser markante Anteil lässt sich in vielen hall-stattzeitlichen Siedlungen auch der Südostalpinen Gruppe verfolgen88.
77 Bernhard, Hebert 2000, 94 und 97 Taf. 1.1.78 Tiefengraber 2005, Taf. 52.1 und 52.2.79 Hebert, Lehner 1996, 138.80 Hack 2002, 159, Taf. 12.1.81 Hack 2002, 131.82 Tiefengraber 2005, Taf. 52.1 bzw. Taf. 33.10.83 Smolnik 1994, 39.84 Ein Stück stellt mit 30 cm Durchmesser eine Ausnahme dar; s. Smolnik 1994, 39.85 Dobiat 1980, Taf. 28.1 und 2, Taf. 48.20.86 Tiefengraber 2005, 168.87 Rebay 2002, 79.88 Schalen stellen in den hallstattzeitlichen Siedlungen von Kalsdorf (s. Tiefengraber 2005, 177) und am Burgstall bei Kleinklein (Smolnik 1994, 46, Typ XIX) den häufigsten Typ dar.
270
Einzugsrandschalen sind in Mitteleuropa seit der Urnenfelderkultur bis zum Auslaufen der Hallstattzeit sowohl in Siedlungen als auch in Gräbern vertreten. Meist sind auch innerhalb einzelner Fundkomplexe große Variationsbreiten bezüglich Durchmesser, Gefäßhöhe und Dekorationen möglich89. Diese Diversitäten sind ebenfalls im Graschacher Material zu beobachten; so ist ein Randfragment (Taf. 2.6) nur ganz leicht nach innen ziehend, während alle weiteren Stücke verzierten oder unverzierten Einzugsrandschalen zuzurechnen sind. Zwei Schalen sind mit senkrechten vom Rand bis zum Bauch ver-laufenden Rillen verziert (Taf. 2.10 und Taf. 3.12), während eine Schale (Taf. 2.9) unter dem Rand beginnende senkrechte Kanneluren aufweist.
Alle Graschacher Schalen sind von hochwertiger Qualität und können zur Feinware gezählt werden. Der Ton ist fein geschlämmt worden und leicht glim-merhältig, während die Oberfläche bei drei Stücken geglättet, bei vier Stücken außen und innen graphi-tiert und poliert wurde. Im Gegensatz dazu sind die Schalen vom Burgstall in vielen Fällen schlecht her-gestellt90, während in Kalsdorf die meisten Schalen fein geschlämmt und gut geglättet sind91.
Die Schalen sind in ihrer Formgebung und Größe (Mundsaumdurchmesser von 18 bis 24 cm) nicht außergewöhnlich, während sich zu den Verzierun-gen, die eine Datierungsmöglichkeit bieten könnten, selten Entsprechungen finden. Aufzuzählen sind eine weitmündige, niedrige Schale mit senkrechten Kanneluren und Graphitbemalung aus Kalsdorf92, wobei sich die Form von den Graschacher Schalen abhebt, und weiters eine mit senkrechten Rillen ver-zierte Schale vom Burgstall93, die einer Schale aus Graschach (Taf. 2.10) besonders ähnelt.
Ein Stück (Taf. 3.12) besitzt einen leicht ausge-prägten Omphalosboden, der bei Schalen der Sulmtalnekropole des Öfteren auftritt94. Während in den ältesten Gräbern Schalen völlig fehlen, gehö-ren sie in der Phase 2 nach Dobiat zur normalen Grabausstattung und häufen sich in Phase 3 aber-mals95. Senkrechte Rillen oder Kanneluren wurden im Gräberfeld allerdings nicht dokumentiert.
Die Möglichkeit, Einzugsrandschalen als Trinkgefäße oder als Teller zu deuten (da auf Schalen in Gräbern Tierknochen gefunden wurden), bleibt offen96.
Eine zweite Schalenausprägung stellen weitmündige, fast halbkreisförmige Schalen dar (Taf. 4.16 und Taf. 4.17). Aufgrund ihrer unebenen, verstrichenen Oberfläche sind sie als einfache Gebrauchsgefäße von mittlerer Qualität zu betrachten, die auch als Deckel benutzt worden sein dürften, da zum Beispiel am Burgstall manchmal Löcher vorhanden sind97.
Vergleichsstücke zu den zwei im Fundmaterial ver-tretenen Objekten sowohl hinsichtlich der Form als auch der Machart fanden sich direkt in Graschach98, in der Siedlung vom Burgstallkogel aus der Schicht Ia99 und in der Siedlung von Kalsdorf100.
5.2.3 SchüsselnSchüsseln oder auch als S-förmig profilierte Schalen bezeichnete Gefäße zählen in Graschach zu einer gehobenen Feinkeramik. Dies ist auch bei ande-ren Fundstellen sowohl in Siedlungen als auch in Gräbern der Südostalpinen Gruppe zu beobachten101. Vielfältige Ausprägungen mit oder ohne Henkel sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Verzie-rungen, die von senkrechten und schrägen Kannelu-ren über turbanartige Dekorationen und Randzipfel reichen, sind möglich.
89 Smolnik 1994, 46 und Tiefengraber 2005, 102 ff. und 171.90 Smolnik 1994, 46 f.91 Tiefengraber 2005, 171.92 Tiefengraber 2005, Taf. 41.3.93 Smolnik 1994, Taf. 3.14.94 Dobiat 1980, Taf. 66.2.6 (Phase 2) und Taf. 38.4, 46.2, 91.8.9, 93.4, 95.3, 105.5. 66.2.6 (Phase 3).95 Dobiat 1980, 76.96 Rebay 2002, 81.97 Smolnik 1994, 49.98 Bernhard, Hebert 2000, 99, Taf. 3.16.99 Smolnik 1994, Taf. 6.14, 7.1.100 Tiefengraber 2005, Taf. 38.4.7.8.101 Kleinklein, s. Dobiat 1980. Kalsdorf, s. Tiefengraber 2005.
271
Die Grundform dieses Gefäßes ist südlich des Haupt-alpenkammes innerhalb der Südostalpinen Gruppe und in Gräbern Westungarns weit verbreitet102.
Eine Entwicklung in der Hallstattzeit von hohen, bauchigen Gefäßen zu niedrigen, gedrückten Körpern mit starkem Bauchumbruch ist zu beobachten103, womit profilierte Schüsseln eine typologische und chronologische Aussagefähigkeit besitzen.
In der Brandgrube von Graschach sind jene Schüsseln mit zwei einander sehr ähnlichen hoch-wertigen Stücken (Taf. 3.13, Taf. 4.14) und einem Randfragment (Taf. 4.15), das wahrscheinlich einer Schüssel zugerechnet werden kann, vertreten. Beide im Profil vollständigen Stücke (Taf. 3.13, 4.14), die stark zerscherbt aufgefunden wurden, haben eine ähnliche Form und die gleichen Verzierungs-elemente. Sie weisen einen gedrückten Körper mit einem markanten Bauchumbruch auf, der an der Außenseite mit einer umlaufenden Rippung versehen ist. Weitere Kennzeichen der Graschacher Schüsseln sind die senkrecht verlaufenden Ränder und ein sehr leicht ausgeprägter Omphalosboden.
Bemalungsreste von zumeist radial verlaufenden Bändern finden sich an der Innenseite der Gefäße. Während bei einer Schüssel zwei Bänder klar erkenntlich sind (Taf. 3.13), bleibt die Anordnung bei einer fast vollständig erhaltenen Schüssel (Taf. 4.14) ungewiss. Weiters verlaufen um den Boden im Inneren beider Schüsseln eingedrückte Kreise; ein eingedrückter Kreis liegt im Mittelpunkt des Bodens.
Der Ton ist fein, die Oberfläche geglättet; sie scheint zumindest teils flächig graphitiert gewesen zu sein.
Vergleichsstücke finden sich im gesamten Bereich der Südostalpinen Gruppe, ohne dass präzise Entsprechungen ob der großen Formen- und Verzierungsvielfalt vorhanden wären. Die örtlich nächstgelegene publizierte Schüssel stammt direkt aus Graschach aus dem Objekt 19, wovon ein unverziertes Stück mit Henkel dokumentiert wurde104. Auf der Siedlung vom Burgstallkogel, unter Typ XV zusammengefasst,105 findet sich eine geringe Anzahl an profilierten Schüsseln, wobei einige in Form106, andere auch in Verzierung107 jenen von Graschach ähneln. Stratifizierte Schüsseln können zu einem Großteil der jüngsten erhal-tenen Schicht des Burgstallkogels und der vierten Besiedlungsphase zugewiesen werden108.In Kalsdorf sind viele verschiedene Verzierungs-elemente vertreten, wobei senkrechte Kanneluren am Bauchumbruch an die Graschacher Schüsseln erinnern109. Auch im Grabhügel unter der Grazer Leechkirche wurden in einer Brandschicht Frag-mente profilierter Schüsseln geborgen, an denen abermals eine große Verzierungsvielfalt, die von Hornaufsätzen bis zu einer Mäanderverzierung reicht, zu beobachten ist110.
Die im Gräberfeld von Kleinklein auftretenden pro-filierten Schüsseln sind in die Phase 3 nach Dobiat zu stellen und unterscheiden sich von den älteren Stücken durch ihre kurze Schulter, einen scharfkan-tigen Bauchumbruch, der durch Riefung verziert ist111. Ähnliche Formen lassen sich in mehreren Gräbern beobachten112, wobei die Schüsseln selten jene Verzierungen der Graschacher Objekte aufweisen.
Kreiseindrücke („Rosettenzier“) finden sich dagegen oft an Fußschüsseln wie in den Gräbern Forstwald
102 Dobiat 1980, 79.103 Dobiat 1980, 78 insb. Abb.11.104 Bernhard, Hebert 2000, 99 Taf. 3.18.105 Smolnik 1994, 43 f.106 Smolnik 1994, Taf. 93.3, 136.10, 143.8.107 Smolnik 1994, Taf. 77.11: schräge Rillenzier am Bauchumbruch, Taf. 104.6: Rippung am Bauchumbruch und Kreiseindrücke am Hals, Taf. 131.4: Rippung am Bauchumbruch, die durch Daumeneindrücke entstanden ist, und Kreiseindrücke am Hals.108 Smolnik 1994, 44.109 Tiefengraber 2005, Taf. 68.2, 69.6.110 Lehner 1996, 48, 125 Taf. 17.1-3.111 Dobiat 1980, 78.112 u. a. Dobiat 1980, 295 Taf. 38.7.9., 310, Taf. 53.4.5., 349 Taf. 92.1.2.4. und Hack 2002, 161 Taf. 14.6.9 sowie Weihs 2003, Taf. 8.2. und Taf. 10.1.
272
51 und Forstwald 59, im Kürbischhansl-Tumulus, an einer profilierten Schüssel im Kürbischbauer-Tumulus 1 sowie an einem Bodenstück im Wiesen-kaisertumulus 1 und Wiesenkaisertumulus 4113. Kreis- bzw. Punkteindrücke werden während der jüngeren Phase der Nekropole oft eingesetzt und gelten als datierendes Verzierungsmerkmal114.
Im slowenischen Raum finden sich sehr ähnliche Schüsseln115, die sich in den dritten Horizont von Poštela einordnen lassen116.
Aus aufgemalten Bändern bestehende Winkelmuster sind in der gesamten Osthallstattkultur ein häufig verwendetes Verzierungselement. In der Sulmtal-nekropole treten sie in der jüngeren Phase in den Hintergrund117 und sind an der Innenseite von Schalen und Schüsseln in jüngeren Gräbern seltener zu beobachten118.
Sowohl eine Gebrauchsfunktion der Schüsseln als Teller als auch eine repräsentative Verwendung auf-grund ihrer reichen Verzierung ist vorstellbar.
5.2.4 Fassförmige GefäßeDiese grobkeramischen, meist mäßig hart gebrann-ten Gefäße sind in Graschach mit mindestens drei Stücken vertreten. Ein Bodenfragment (Taf. 5.21) könnte einem fassförmigen Topf zuzurechnen sein.
Die Töpfe haben eine fassförmige Grundform mit einziehendem Rand, leicht ausgeprägter Randlippe und abgerundeten (Taf. 4.18) oder abgestrichenen Mundsaumvariationen (Taf. 5.19 und 20). Die Qualität des Tons ist entsprechend der alltäglichen Gebrauchsverwendung funktionell gestaltet: Der Ton ist mittelstark gemagert, die Oberfläche ist uneben und einfach verstrichen bzw. bei einem Stück teils
geschlickert (Taf. 5.20). Dieses Stück weist am Be-ginn der Schulter zwei horizontal ovale Knubben auf.
Diverse Variationen fassförmiger Gefäße begegnen uns während der gesamten Hallstattzeit im Ostalpenraum119. In der Steiermark finden sich sowohl in Siedlungen, wie in Kalsdorf bei Graz120 und in der Siedlung am Burgstallkogel121, als auch im Gräberfeld von Kleinklein122 Entsprechungen. Nach einem Schema nach Dobiat, der eine Entwicklung der fassförmigen Töpfe postuliert hat, lassen sich zumindest zwei Stücke (Taf. 5.19 und 20) in die späte Phase der Sulmtalnekropole einord-nen123. Smolnik merkt an, dass auf der Siedlung am Burgstall fassförmige Gefäße ohne Randausprägung ab der dritten Besiedlungsphase auftauchen124. Für eine feinchronologische Zuordnung besitzen die ein-fachen Gefäße keine markanten Merkmale.
Entsprechungen konnten auch direkt in Graschach im Siedlungsmaterial des Objekts 19125 gefunden werden.
5.2.5 Sonstige Formen und SonderformenZu den schwer zuordenbaren Gefäßfragmenten zählen zwei Bodenfragmente (Taf. 5.22 und 5.23), die stark ausladenden Grobgefäßen, eventuell weit-mündigen Schalen, zuzurechnen sind.
Senkrechte Randfragmente mit abgerundetem (Taf. 5.26 und 5.28) oder abgestrichenem Mund-saum (Taf. 5.27) stammen ebenfalls von einer groben Ware, wobei Töpfe oder fassförmige Gefäße in Frage kommen könnten.
Die mit Rillen und Kanneluren verzierten Wandstücke (Taf. 5.29-6.32) sind der Feinkeramik zuzurechnen, da sie fein gemagert sind und zumindest eine geglät-
113 Dobiat 1980, 300, Taf. 51.6., 304, Taf. 47.6., 352, Taf. 95.1., 353, Taf. 96.7. sowie Hack 2002, 163 Taf. 16.5. und Dobiat 1980, 354 Taf. 97.1.114 Dobiat 1980, 121.115 Teržan 1990, 413 Taf. 37.28. und 27.30.116 Teržan 1990, 34.117 Dobiat 1980, 132 f.118 Dobiat 1980, 352 Taf. 95.3., 353 Taf. 96.7. und 354 Taf. 97.1.119 Dobiat 1980, 87.120 Tiefengraber 2005, 170 f.121 Smolnik 1994, 36 Fassförmige Töpfe ohne Randlippe sind unter Typ VI zusammengefasst.122 Dobiat 1980, 85 ff.123 Dobiat 1980, 86.124 Smolnik 1996, 454.125 Bernhard, Hebert 1996, 98 Taf. 2.5. und 2.7.
273
tete, wenn nicht graphitierte Oberfläche aufweisen. Kannelurenverzierungen sind im Osthallstattkreis weit verbreitet126 und stellen innerhalb der Sulm-taler Gruppe die häufigste Verzierung der entwi-ckelten Hallstattzeit dar127. Zu finden sind sie vor allem an Kegelhals- und Kragenrandgefäßen sowie an profilierten Schüsseln128.
Ein der Feinkeramik, wahrscheinlich einem Miniatur-gefäß zuzurechnendes Fragment (Taf. 6.33, Mund-saumdurchmesser 3,5 cm) mit einziehendem Rand und spitz zulaufendem Mundsaum ist schwer einem Gefäßtyp zuzuordnen, da es sich um keine Verkleine-rung eines gebräuchlichen Hallstattgefäßes handelt. Miniaturgefäße der Sulmtalnekropole könnten mit dem Grabritus in Verbindung stehen; die Funktion der Gefäße bleibt aber gänzlich unbekannt129.
Zwei längliche, pyramidenförmige Webgewichte (Taf. 6.34 und 6.35) mit quadratischer Basis und horizontalen Lochungen, von denen eines schlecht gebrannt und daher sehr fragmentiert aufgefunden wurde, deuten auf eine Textilherstellung in Graschach hin. Eine solche Produktion konnte im Sulmtal auf dem Burgstall durch einen Webstuhlbefund, bei dem über 100 Gewichte in zwei Reihen liegend aufgefunden wurden, bewiesen werden130. Diese in die dritte Besiedlungsphase des Burgstalls zu stel-lenden Webgewichte entsprechen ob der zeitlichen Divergenz den beiden Objekten aus Graschach. Einen Teil eines Grabinventars, in dem u. a. auch profilierte Schüsseln auftreten, stellen ähnliche Webgewichte in dem Frauengrab „Grellwald 55“, das in die späte Stufe des Gräberfelds von Kleinklein datiert, dar131. Eine chronologische Aussagefähigkeit ist bei pyramidenförmigen Webgewichten aufgrund der geringen Formenvielfalt in der Hallstattzeit nur beschränkt gegeben132.
Aus dem bisherigen Fundspektrum fällt ein bereits erwähntes drehscheibengedrehtes Randstück eines
Topfes (Taf. 6.36) heraus, der in das frühe 14. Jh.133 gestellt werden kann und eine landwirtschaftliche Nutzung des Areals im Mittelalter nahe legt134.
Weiters hebt sich von dem späthallstattzeitlichen Fundsortiment eine Handhabe eines groben Groß-gefäßes (Taf. 1.1) ab, für die eine Datierung in das Jungneolithikum vorgeschlagen sei. Ein ähnlicher grober Grifflappen fand sich in neolithischen Schichtungen in Rabenstein bei St. Paul im Lavant-tal (Kärnten)135. Die aus dem oberen Bereich der Schicht 4 (Abb. 3) stammende Handhabe deutet eine eventuelle frühere Besiedlung des Platzes an.
6. Interpretation und Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde eine Siedlungsgrube mit hall-stattzeitlichem Fundmaterial aus der KG Graschach, Südweststeiermark, behandelt.
Diese durch den industriellen Lehmabbau gefährdete Grube konnte im Mai 1989 durch G. Sommer ergra-ben und gut dokumentiert werden. In dieser Zeit und in den nachfolgenden Jahren wurden weitere Befunde aufgenommen. Fundberichte und eine parti-elle Bearbeitung sind bereits vorgelegt worden136. Es entstand ein Bild, das den Schluss auf eine mehr-phasige Siedlung möglich erscheinen lässt.
Die Fundstelle liegt begünstigt in leichter Hanglage und bietet bei entsprechender Rodung eine gute Taleinsicht. Wasserzuläufe sind in unmittelbarer Nähe gelegen und leicht zu erreichen. Eventuelles Hochwasser der Sulm hätte keine Gefahr für die Siedlung dargestellt.
Verkehrstopographisch scheint besonders der süd-östliche Raum begünstigt gewesen zu sein, da in allen anderen Himmelsrichtungen Gebirgszüge das Vorankommen erschweren.
126 Tiefengraber 2005, 184.127 Dobiat 1980, 117.128 Tiefengraber 2005, 183.129 Dobiat 1980, 95.130 Dobiat 1990, 46.131 Dobiat 1980, 349.132 Smolnik 1994, 89.133 Für den Hinweis sei Johanna Kraschitzer, Graz, gedankt.134 Hebert 1988, 287. – Vgl. auch Artner 2002.135 Tiefengraber, 2004, 224 f.136 vgl. Hebert 1987, 1988, 1989, 1992, 1996 und Bernhard, Hebert 2000.
274
Die etwa 1 m tiefe und im Grundriss 2 x 2 m große Grube weist zahlreiche Brandspuren und Holzkohlen-reste auf. Eine rundliche, gebrannte Lehmschicht beweist die Existenz von einem oder mehreren Brenn-vorgängen in der Grube. Eine schottrige Schicht, die am Boden der Grube zu finden war, könnte wie bei mehreren Vergleichsfunden dem Wärmeerhalt gedient haben. Der schlechte Erhaltungszustand des Ofens lässt den Schluss zu, dass er der Verwitterung ausgesetzt war, verfiel und daher einem nicht geschlossenen Fund zuzurechnen ist.
Typische Kuppelofenmerkmale wie eine kuppelför-mige Wand, Lochtennen oder Befeuerungszugänge sind nicht dokumentiert. Da in einem Grubenofen hohe Temperaturen möglich sind, scheint für den Verf. das Erhitzen organischen Materials oder das Backen von Lebensmitteln unwahrscheinlich. An die Funktion eines Keramikbrennofens ist zu denken, was aber aufgrund des Fehlens der nötigen Befunde und Funde, wie zum Beispiel Fehlbrände, nicht bewiesen werden kann.
Das hallstattzeitliche Fundmaterial setzt sich aus 21 bestimmbaren Gefäßen zusammen, die eigent-liche Anzahl ist sicherlich noch höher anzusetzen. Der Fragmentierungsgrad ist unterschiedlich. Einige Stücke sind größtenteils erhalten, andere nur in einem oder wenigen Fragmenten.
Die Anzahl der im Katalog festgehaltenen grobkera-mischen Gefäße bzw. der einfachen Haushaltskeramik (58 %) ist etwas höher als die der katalogisierten Feinkeramik (42 %). Kragenrandgefäße, profilierte Schüsseln, weitmündige Schalen und fassförmige Gefäße kommen mehrfach vor, Einzugsrandschalen bilden den häufigsten Formentyp. Ob die vorgefun-dene Keramik lokal und aus dem vor Ort anstehen-den Ton hergestellt wurde, ist unsicher und kann nur durch naturwissenschaftliche Untersuchungen geklärt werden.
Datierungsmöglichkeiten bieten profilierte Schüsseln, da Vergleichsstücke in die vierte Besiedlungsphase
der Siedlung am Burgstall137, im Gräberfeld von Kleinklein in die dritte Phase138 und in den Horizont Poštela III139 zu stellen sind. Ein Verzierungselement der Schüsseln mit Kreiseindrücken, die um den Boden laufen, ist im Gräberfeld von Kleinklein in die jüngere Phase zu stellen140.
Besonders wichtig für eine präzise Datierung erscheint der Wiesenkaisertumulus Nr. 4 (Sulmtal-nekropole, KG Goldes), da zwei in Graschach auftre-tende Gefäßformen in dem Männergrab vorhanden sind. Ein Kragenrandgefäß und eine profilierte Schüssel sowie um den Boden orientierte Kreisein-drücke entsprechen sehr gut den Graschacher Gefäßen bzw. deren Verzierung141. Die Gefäße waren unter anderem mit einer großen Schlangenfibel, kleinen Schlangenfibeln, Drahtbügelfibeln und einer Fibel mit gedrücktem Bügel vergesellschaftet142. Aufgrund dieser Fibelausstattung lässt sich die Grablegung in die frühe Phase der Stufe D1 oder in den Übergang von Stična 1 zu 2 festlegen143. Dies entspricht etwa der Zeit um 600 v. Chr.
Somit kann das Gefäßspektrum der Brandgrube von Graschach in die Spätphase, 3. Phase nach Dobiat, der Sulmtalnekropole gestellt werden. Dies bedeutet eine Einordnung in den Beginn der Stufe Ha D1 und eine absolutchronologische Datierung um 600 v. Chr. (Abb. 7).
137 Smolnik 1994, 44.138 Dobiat 1980, 78.139 Teržan 1990, 34.140 Dobiat 1980, 121.141 Hack 2002, 159, Taf. 12.1., 161, Taf. 14.6. und 163, Taf. 16.4.5.142 Hack 2002, 118-121.143 Hack 2002, 139 f.
Abb. 7: Chronologietabelle. Grafik: M. Raab.
275
Eine Handhabe und ein drehscheibengedrehtes Randfragment deuten auf eine vorhallstattzeitliche und eine mittelalterliche Nutzung des Areals hin.
Hinsichtlich der hallstattzeitlichen Besiedlung von Graschach müssen viele Fragen leider unbeantwortet bleiben.Welche wirtschaftlichen Verbindungen unterhielt die Bevölkerung und welche Bedeutung kann dem Platz zugemessen werden?
Antworten auf die Fragen nach einer Mehrphasigkeit oder einer Siedlungskontinuität sind zumindest bis zu einer Gesamtpublikation der Siedlung von Graschach ausständig und auch die Suche nach einem zugehörigen Gräberfeld bleibt offen.
7. Literatur
aRtneR, Wolfgang, FÖ 41, 2002, 727-728.beRnhaRd, Andreas, hebeRt, Bernhard, Dritter und abschließender Bericht über die Rettungsgrabungen des Bundesdenkmalamtes im Hartwald der KG Graschach in der Steiermark, FÖ 39, 2000, 91-99.beRnhaRd, Andreas, Weihs, Andreas, Neuerforschte Gräber der frühen Eisenzeit in Kleinklein (Weststeiermark), UPA Band 93, 2003.dobiat, Claus, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik, Schild von Steier, Beiheft 1, Graz 1980.dobiat, Claus, Der Burgstallkogel bei Kleinklein I, Die Ausgrabungen der Jahre 1982 und 1984, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 13, 1990.dReWs, G., Entwicklung der Keramik-Brennöfen, Acta Praehistorica et Archaeologica 9/10, 1978/9, 33-49.dulaR, Janez, bReščak, Danilo, Poznohalštatska hiša na Gradišču pri Valiču vasi, Archeološki vestnik 47, 1996, 145-162.egg, Markus, kRaMeR, Diether, Krieger – Feste – Totenopfer, Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein in der Steiermark, Mosaiksteine, Forschungen am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 1, Mainz 2005.FeichtenhoFeR, Christine, RoscheR, Martina, Grabungsbericht 2002-2003. Archäologische Untersuchungen im Zuge des Tiefgaragen- projektes Karmeliterplatz/Pfauengarten, Graz, in: Spannungsfeld Altstadttiefgarage, Stadtplanung, Stadtarchäologie, Schild von Steier. Kleine Schriften 20, 2004, 35-39.FelgenhaueR-schMiedt, Sabine, Niederösterreichische Keramik des 12. und 13. Jahrhunderts, Provek NR 6, 1996, 229-240.Flügel, Helmut W., neubaueR, Franz, Steiermark, Erläuterungen zur Geologischen Karte der Steiermark 1:200.000, Wien 1984.Fuchs, Werner, Das inneralpine Tertiär, in: Der geologische Aufbau Österreichs, Wien 1980.gRäF, Walter, Zeit – zu Stein geworden. Ein geologischer Streifzug durch die Steiermark, Schriften für junge Museumsbesucher. Heft 5, Graz 1977.gRiebl, Monika, Die Siedlung der Hallstattkultur von Göttlesbrunn, Niederösterreich, MAG 54, 2004.hack, Silvia, Der Wiesenkaisertumulus Nr. 4, eine hallstattzeitliche Bestattung aus Goldes, Steiermark, FÖ 41, 2002, 91-165.hebeRt, Bernhard, FÖ 26, 1987, 224.hebeRt, Bernhard, FÖ 27, 1988, 286 f. mit Abb. 306 ff.hebeRt, Bernhard, FÖ 28, 1989, 197 f.hebeRt, Bernhard, Sulmeck-Greith, Graschach, in: Spuren der Vergangenheit. Archäologische Funde aus der Weststeiermark, Austellungskatalog Bärnbach 1992, 89f.hebeRt, Bernhard, FÖ 35, 1996, 48 f.hebeRt, Bernhard, lehneR, Manfred, Neue Funde zur Hallstattkultur aus der Steiermark, in: Jerem, Erzsébet, Lippert, Andreas (Hrsg.), Die Osthallstattkultur, Archaeolingua 7, 1996, 137-169.hebeRt, Bernhard, FÖ 42, 2003, 677. kRaMeR, Diether, Vom Neolithikum bis zur römischen Kaiserzeit, Untersuchungen zur ältesten Besiedlungsgeschichte der Steiermark mit besonderer Berücksichtigung der mittelsteirischen Höhensiedlungen, ungedr. Dissertation Salzburg 1981.lehneR, Manfred, Die Archäologie des Leechhügels, in: Forschungen zur Leechkirche in Graz, FÖ Mat A 4, 1996, 19-156.MeixneR, Heinz, Minerale und Mineralschätze der Steiermark, in: Sutter, Berthold (Hrsg.), Die Steiermark, Graz 1956, 28-35.MülleR-depReux, Anke, Die hallstatt- und frühlatènezeitliche Siedlung „Erdwerk I“ von Niedererlbach, Landkreis Landshut, Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, Reihe A – Fundinventare und Ausgrabungsbefunde 87, 2005.
276
nebelsick, Louis, Die Kalenderberggruppe der Hallstattzeit am Nordostalpenrand, in: Neugebauer, Johannes-Wolfgang (Hrsg.), Hallstattkultur im Osten Österreichs, Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich 106/107/108/109, 1997, 9-128.neugebaueR, Johannes-Wolfgang, gattRingeR, Alois, MayeR, Christian, sitzWohl, Birgit, Rettungsgrabungen im Unteren Traisental im Jahre 1990. Neunter Vorbericht über die Aktivitäten der Abt. für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes im Raum St. Pölten-Traismauer, FÖ 29, 1991, 45-88.pahič, Stanko, Nov seznam noriško-panonskih gomil, Neues Verzeichnis der norisch-pannonischen Hügelgräber, Dissertationes Classis I. VII/2, 1972.paRe, Christopher, Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Jahrb. RGZM 45, 1998, 293-433.pReinFalk, Fritz, Die hallstattzeitlichen Hügelgräber von Langenlebarn, Niederösterreich, FÖ Mat A 12, 2003.puFF, Rudolf, Ausgrabungen und Alterthümer in der Steiermark, Stiria No. 9, Vierter Jahrgang 1846, 33 f.RadiMský, Václav, Urgeschichtliche Forschungen in der Umgebung von Wies in Mittel-Steiermark I, MAG 13 (3), 1883, 41-66, Taf. IX.RadiMský, Václav, szoMbathy, Josef, Urgeschichtliche Forschungen in der Umgebung von Wies in Mittel-Steiermark II, MAG 15 (5), 1885, 117-168.Rebay, Katharina, Die hallstattzeitliche Grabhügelgruppe von Zagersdorf im Burgenland, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 107, 2002.sMolnik, Regina, Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der vorgeschichtlichen Siedlung, Veröffentlichung des vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 9, 1994.sMolnik, Regina, Die Lebenden und die Toten - Das Verhältnis der Siedlung auf dem Burgstallkogel bei Kleinklein zu den Gräbern der Sulmtalnekropole, dargestellt anhand der Keramikentwicklung, in: Jerem, Erzsébet, Lippert, Andreas (Hrg.), Die Osthallstattkultur, Archaeolingua 7, 1996, 446-454.szoMbathy, Josef, Urgeschichtliche Forschungen in der Umgebung von Wies in Mittel-Steiermark IV, MAG 20 (10), 1890, 170-196.tieFengRabeR, Georg, Jungneolithische Funde vom Rabenstein bei St. Paul im Lavanttal, Carinthia I 194, 2004, 185-253.tieFengRabeR, Georg, Untersuchungen zur Urnenfelder- und Hallstattzeit im Grazer Becken, UPA Band 124, 2005. teRžan, Biba, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem - The Early Iron Age in Slovenian Styria, Katalogi in monografije 25, Ljubljana 1990.toManič, Marjana, guštin, Mitja, Keltska lončarska peč s Spodnje Hajdine pri Ptuju, Archeološki vestnik 47, 1996, 267-278.tuzaR, Natalie, dell’MouR, Rudolf W., Der Bau eines liegenden Töpferofens auf der „Schanze“ in Thunau am Kamp, Niederösterreich. Überlegungen zu technologischen Fragen der slawischen Keramik, Anzeiger der phil.-hist. Klasse 135, 2000, 47-59.Weihs, Andreas, Der hallstattzeitliche Grabhügel 31 der Grellwaldgruppe, in: Bernhard, Weihs, Neuerforschte Gräber der frühen Eisenzeit in Kleinklein (Steiermark), UPA 93, Bonn 2003, 214-246.WeiseR, Barbara, Töpferofen von 500 bis 1500 n. Chr. im deutschsprachigen Raum und angrenzenden Gebieten, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 15, Bonn 2003.
8. Anmerkungen zum Katalog
Die Funde sind in erster Linie zeitlich (vom ältes-ten bis zum jüngsten Stück) geordnet, in zweiter Linie nach dem Typ, wobei nach den bestimmbaren Formen (unbestimmbare) Bodenstücke, unbe-stimmbare Rand- und verzierte Wandfragmente und Sonderformen folgen. Unverzierte Wandfragmente wurden nicht katalogisiert.
Zuerst wurde eine Einteilung in Hochform und Breitform (bzw. auch Großgefäßform) vorgenommen. Bei einer Hochform übersteigt die Höhe die maxima-le Breite, während bei einer Breitform der maximale
Durchmesser größer ist als die Höhe. Anschließend wurde eine Einteilung nach steigender Qualität in Grobkeramik, einfache Keramik und Feinkeramik vorgenommen. Die Farbe der Keramik wurde sowohl an den Außenseiten als auch im Bruch mittels des Farbkatalogs nach Munsel beschrieben144. Bei der Härte des Scherbens wird von sehr schlecht gebrannt über mäßig hart gebrannt bis zu hart gebrannt unterschieden. Die Fundnummer ermögli-cht eine Zuordnung zu Befund und Dokumentation.
144 Munsell Color Company, Munsell Soil Color Charts, Baltimore 1954.
277
9. Fundkatalog
Taf. 1.1 HandhabeGroßgefäß. Grobkeramik. 1 Wandfr. mit Handhabe. Starke Wandung mit ausgeprägter, im Querschnitt längsovaler Handhabe, die gebogen ist und in zwei hervortretenden Zipfeln endet, Orientierung ungewiss. Außen und innen mattes gelbliches Orange (10 YR 6/4). Im Bruch helles bräunliches Grau (7.5 YR 7/1) mit schwärzlichen (sekundär angebrannten?) Stellen. Außen und innen verstrichene, raue Ober-fläche. Stark mit größeren Steinchen gemagert (1-5 mm). Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 7,5. FNr. 09.
Taf. 1.2 Kragenrandgefäß oder Topf?Hochform? Einfache Keramik. 1 Randfr. Kragenför-miger Hals in leicht ausladenden Rand übergehend. Horizontal abgestrichener Mundsaum. Außen bräun-liches Dunkelgrau (5 YR 4/1). Innen mattes rötliches Braun (5 YR 4/4). Im Bruch außen mattes Braun (7.5 YR 5/3) und innen helles rötliches Braun (5 YR 5/8). Außen und innen feinkörnige, geschli-ckerte Oberfläche. Wenig mit kleinen Steinchen und Sand gemagert. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 6,0 cm. Ohne FNr., nur Datum (31. 05. 1989) vermerkt.
Taf. 1.3 Kragenrandgefäß?Hochform? Feinkeramik. 1 Randfr. Kragenförmiger Hals in ausladenden Rand übergehend. Horizontal abgestrichener Mundsaum. Außen und innen bräun-liches Dunkelgrau (10 YR 4/1). Im Bruch grau (7.5 Y 4/1). Außen und innen glatte, graphitierte Oberfläche. Fein mit kleinsten Teilchen (u. a. Glimmer, Schamott?) gemagert. Hart gebrannt. Erh. H. 3,5 cm. FNr. 16.
Taf. 1.4 KragenrandgefäßHochform? Einfache Keramik. Etwa 1/3 erhalten, restauriert. Kugeliger Bauch. Nach innen ziehende Schulter. Deutlich abgesetzter Schulter-/ Halsum-bruch. Kragenförmiger Hals in ausladenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen und innen von einem matten gelblichen Orange (10 YR 6/3) bis zu einem dunklen olivfärbigen Braun (2.5 Y 3/3). Im Bruch ebenfalls dunkles olivfärbiges Braun (2.5 Y 3/3). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche. Im Bereich des Bauchumbruches außen oberflächige Absplitterungen. Fein geschlämmt, glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Doppelte Finger-strichkanneluren, die in einem Zick-Zack-Muster vom Bauchumbruch über die Schulter bis knapp unter den Halsansatz laufen. Auf der Schulter ist ein Knubbenansatz mit einer umlaufenden Kannelur noch zu erkennen. Erh. H. 12,0 cm. Bestehend aus mehreren Fundnummern: FNr. 7 und 10.
Taf. 2.5 KragenrandgefäßHochform? Einfache Keramik. Etwa 1/3 erhalten, restauriert. Konisch ausladender, leicht gewölbter Gefäßunterteil in mittelstark gewölbten Bauch übergehend. Deutlich abgesetzter Schulter-/ Hals-umbruch. Kragenförmiger Hals in ausladenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom bräunlichen Grau (10 YR 4/1) bis zum hellen gelb-lichen Orange (10 YR 6/4). Innen im Allgemeinen etwas dunkler: Vom bräunlichen Grau (10 YR 5/1) bis zum matten gelblichen Orange (10 YR 6/3). Ob es sich bei den dunkleren Pigmentierungen an Außen- und Innenseite um Farb- bzw. Graphitie-rungsrückstände handelt, konnte nicht festgestellt werden. Im Bruch außen orange (5 YR 6/6) und innen bräunlich grau (10 YR 6/1). Außen und innen sandige, geglättete Oberfläche, die teilweise schlecht erhalten und rau ist. Im Bereich des Bauch-umbruches außen oberflächige Absplitterungen. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Auf der Schulter befindet sich eine Knubbe mit einer umlaufenden Kannelur. Erh. H. ~30,0 cm. Bestehend aus diversen Stücken.
Taf. 2.6 SchaleBreitform. Einfache Keramik. 1 Randfr. Flach gewölbter Bauch. Rand der Gefäßform folgend leicht nach innen ziehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom matten gelblichen Orange (10 YR 6/4) bis zum matten gelblichen Braun (10 YR 5/3). Innen bräunliches Schwarz (2.5 Y 3/1). Im Bruch mattes Braun (7.5 YR 5/4). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glim-merhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 2,0 cm. FNr. 10.
Taf. 2.7 EinzugsschaleBreitform. Feinkeramik. 1 Randfr. Bruchstelle knapp unterhalb des Bauchumbruchs. Leicht gewölbter Bauch. Rand der Gefäßform folgend nach innen zie-hend. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom matten Braun (7.5 YR 5/4) bis zum bräunlichen Schwarz (2.5 Y 3/1). Innen ebenfalls bräunliches Schwarz (2.5 Y 3/1). Im Bruch gräuliches Gelb-Braun (10 YR 6/2). Außen und innen feine, leicht sandige, geglät-tete Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhäl-tig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 2,5 cm. FNr. 10.
Taf. 2.8 EinzugsschaleBreitfom. Einfache Keramik. 1 Randfr. Bruchstelle am leicht gewölbten Bauch. Rand der Gefäßform folgend nach innen ziehend. Gerade abgestrichener Mundsaum. Außen und innen vom matten gelb-lichen Braun (10 YR 5/3) bis zum bräunlichen Schwarz (10 YR 3/2). Im Bruch bräunliches Grau
278
(10 YR 6/1). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 3,0 cm. FNr. 26.
Taf. 2.9 EinzugsschaleBreitform. Feinkeramik. 1 Randfr. Bruchstelle am Bauch. Rand der Gefäßform folgend nach innen zie-hend. Abgerundeter Mundsaum. Außen und innen anthrazitfärbig (7.5 Y 3/1). Im Bruch gräuliches Gelb-Braun (10 YR 6/2). Außen und innen glatte, polierte, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Außen unter dem Rand beginnende senkrechte Kanneluren. Erh. H. 2,4 cm. FNr. 10.
Taf. 2.10 EinzugsschaleBreitform. Feinkeramik. 1 Randfr. Stark gewölbter Bauch. Rand der Gefäßform folgend nach innen ziehend. Horizontal abgestrichener Mundsaum. Außen und innen hellgrau (10 YR 7/1) bis anthra-zitfärbig (5 Y 3/1). Im Bruch bräunliches Grau (10 YR 6/1). Außen und innen glatte, polierte, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Außen senkrechte Rillen vom Rand bis zum Bauchumbruch verlaufend. Erh. H. 4,0 cm. FNr. 16.
Taf. 3.11 EinzugsschaleBreitform. Feinkeramik. Etwa 1/4 erhalten, restau-riert. Kaum abgesetzter, ebener Boden in gewölbtes, stark ausladendes Gefäßunterteil verlaufend. Stark gewölbter Bauch. Der Gefäßform folgend eingezoge-ner Rand. Abgerundeter Mundsaum. Außen schwarz (10 YR 1.7/1). Innen etwas heller (2.5 GY 2/1). Im Bruch ein bräunliches Schwarz (2.5 Y 1/1). Außen und innen glatte, polierte, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Erh. H. 7,6 cm. Bestehend aus diversen Stücken.
Taf. 3.12 EinzugsschaleBreitform. Feinkeramik. Etwa 1/4 erhalten, restau-riert. Kaum abgesetzter, schwach ausgeprägter Omphalosboden in nach außen gewölbte, stark aus-ladende Gefäßunterteil verlaufend. Stark gewölbter Bauch. Der Gefäßform folgend eingezogener Rand. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom Schwarz (2.5 Y 2/1) bis zum matten hellen Orange (10 YR 6/4). Innen vom Grau (5 Y 4/1) bis zum gräu-lichen Gelb-Braun (10 YR 6/2). Im Bruch ebenfalls gräuliches Gelb-Braun (10 YR 5/2). Außen und innen glatte, polierte, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Außen senkrechte Rillen vom Rand bis unter den Bauchumbruch verlaufend. Erh. H. 6.4 cm. Bestehend aus diversen Stücken u. a. FNr. 26.
Taf. 3.13 SchüsselBreitform. Feinkeramik. Etwa 1/4 erhalten, res-tauriert. Kaum abgesetzter Omphalosboden in nach außen leicht gewölbten, stark ausladenden Gefäßunterteil verlaufend. Scharfer Bauchumbruch. Eingezogene Schulter in senkrecht verlaufenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom Grau (5 Y 4/1) bis zu einem matten Gelb-Orange (10 YR 6/3). Innen vom Grau (N 4) bis zu einem mattem gelblichen Braun (10 YR 5/3). Im Bruch mattes Gelb-Orange (10 YR 6/4). Außen und innen feine, geglättete, teils graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt. Leicht glimmer-hältig. Hart gebrannt. Umlaufende Rippung am Bauch. Innen um den Boden laufende, in kurzen Abständen eingedrückte Kreise. Innen eine nur mehr schwer erkennbare Bandbemalung. Bei den dunkleren Pigmentierungen an der Außen- und Innenseite könnte es sich um flächige Farb- bzw. Graphitierungsrückstände handeln. Erh. H. 6,2 cm. FNr. 13.
Taf. 4.14 SchüsselBreitform. Feinkeramik. Etwa 2/3 erhalten, restau-riert. Kaum abgesetzter Omphalosboden in nach außen leicht gewölbten, stark ausladenden Gefäßunterteil verlaufend. Scharfer Bauchumbruch. Eingezogene Schulter in senkrecht verlaufenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen vom bräunlichen Schwarz (10 YR 3/1) bis zu einem matten Gelb-Orange (10 YR 6/4). Innen von einem gräulichen Gelb-Braun (10 YR 4/2) bis zu einem matten Orange (5 YR 6/4). Im Bruch mattes Braun (7.5 YR 6/3). Außen und innen feine, geglättete, teils graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt. Leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Umlaufende Rippung am Bauch. Innen um den Boden laufende, in kurzen Abständen eingedrück-te Kreise. Im Mittelpunkt des Bodens befindet sich ein weiterer eingedrückter Kreis. Innen eine teils schwer erkennbare, meist radial verlaufende Bandbemalung ohne wiederkehrendes Muster. Bei den dunkleren Pigmentierungen an der Außen- und Innenseite könnte es sich um flächige Farb- und Graphitierungsrückstände handeln. Erh. H. 6,0 cm. Bestehend aus diversen Stücken.
Taf. 4.15 SchüsselHochform. Einfache Keramik. 1 Randfr. Kragen-förmiger Hals in ausladenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen mattes gelbliches Braun (10 YR 5/3). Innen mattes gelbliches Orange (10 YR 6/4). Im Bruch ebenfalls mattes gelb-liches Orange (10 YR 6/4). Außen feine, geglättete Oberfläche und innen leicht raue, sandige (geschli-
279
ckerte?) Oberfläche. Fein geschlämmt, glimmerhäl-tig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 2,0 cm. FNr. 13.
Taf. 4.16 Weitmundige SchaleEinfache Keramik. 1 Randfr. Gefäßoberteil nach außen verlaufend, leicht gewölbt. Nach oben hin gerade abgestrichener Mundsaum. Außen mattes gelbliches Braun (10 YR 5/3). Innen mattes Orange (5 YR 6/4). Im Bruch rötlich grau (2.5 YR 6/1). Außen und innen unebene, verstrichene Oberfläche. Kaum gemagert. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 5,8 cm. Ohne FNr.
Taf. 4.17 Weitmundige SchaleEinfache Keramik. 1 Randfr. Gefäßoberteil nach außen verlaufend, leicht gewölbt. Rand leicht verdickt. Nach oben hin gerade abgestrichener Mundsaum. Außen mattes Orange (7.5 YR 6/4). Innen helles gelbliches Orange (10 YR 6/4). Im Bruch außen mattes Orange (7.5 YR 6/4) und innen helles gelbliches Orange (10 YR 6/4). Außen und innen unebene, verstrichene Oberfläche. Mit grö-ßeren Steinchen gemagert (0,5-5 mm). Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 7,6 cm. FNr. 13.
Taf. 4.18 Fassförmiges GefäßBreit- oder Hochform? Grobkeramik. 1 Randfr. Ausladender Gefäßunterteil in leicht kugeligen Bauch übergehend. Rand der Gefäßform folgend nach innen einziehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen und innen gräuliches Gelb-Braun (10 YR 5/2). Außen schwärzliche sekundär angebrannte Stellen. Im Bruch bräunliches Grau (10 YR 5/1). Außen und innen unebene, verstrichene Oberfläche. Im Bereich des Bauchumbruchs oberflächige Absplitterungen. Mit wenigen Steinchen gemagert (0,5-3 mm), glim-merhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 7,5 cm. Ohne FNr.
Taf. 5.19 Fassförmiges GefäßBreit- oder Hochform. Grobkeramik. 3 Randfr. Rand der Gefäßform folgend, leicht nach innen ziehend. Gerade abgestrichener Mundsaum. Außen und innen mattes Gelb-Orange (10 YR 6/4). Außen schwärz-liche (sekundär angebrannte?) Stellen. Im Bruch bräunliches Grau (10 YR 4/1). Außen und innen unebene, verstrichene Oberfläche. Mittelstark mit Steinchen gemagert. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 6,0 cm. FNr. 7.
Taf. 5.20 Fassförmiges GefäßBreit- oder Hochform, Grobkeramik. 1 Randfr. Gefäßunterteil leicht ausladend. Leicht gewölbter Bauch. Rand der Gefäßform folgend, leicht nach innen ziehend. Gerade abgestrichener Mundsaum.
Außen vom Grau (5 Y 5/1) bis zu einem matten hellen Orange (10 YR 6/3). Innen ebenfalls mattes helles Orange (10 YR 6/3). Im Bruch außen mattes Orange (5 YR 6/6) und innen Schwarz (5 Y 1.7/1). Außen und innen unebene, verstrichene, teils geschlickerte Oberfläche. Mittelstark mit Steinchen gemagert. Mäßig hart gebrannt. Eine Knubbe ober-halb des Bauchumbruchs. Erh. H. 11,0 cm. FNr. 7.
Taf. 5.21 BodenfragmentGrobkeramik. 1 Bodenfr. Flacher Boden in leicht nach außen gewölbten, ausladenden Gefäßunterteil übergehend. Außen gräuliches Braun (7.5 YR 4/2). Innen bräunliches Grau (10 YR 4/1). Im Bruch bräunliches Schwarz (10 YR 3/1). Außen und innen raue, körnige, verstrichene Oberfläche. Stark mit Steinchen (0,5-3 mm) gemagert. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 4,0 cm. FNr. 27.
Taf. 5.22 BodenfragmentGrobkeramik. 1 Bodenfr. Flacher Boden in geraden, ausladenden Gefäßunterteil übergehend. Außen vom Grau (N 4) bis zu einem matten Gelb-Orange (10 YR 7/4). Innen dunkles Grau (N 3). Im Bruch ebenfalls Grau (N 4). Außen und innen raue, unebene, verstri-chene Oberfläche. Stark mit Steinchen (0,5-3 mm) gemagert. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 4,8 cm. FNr. 07.
Taf. 5.23 BodenfragmentGrobkeramik. 1 Bodenfr. Flacher Boden in geraden, ausladenden Gefäßunterteil übergehend. Außen bräunliches Schwarz (2.5 Y 3/1). Innen von bräun-lichem Grau (10 YR 4/1) bis zu mattem Braun (7.5 YR 5/4). Im Bruch ebenfalls bräunliches Grau (10 YR 5/1). Außen und innen raue, unebene, verstri-chene Oberfläche. Mittelstark mit Steinchen gema-gert (0,5-4 mm) gemagert. Erh. H. 3,8 cm. Ohne FNr., nur Datum (22. 05. 1989) vermerkt.
Taf. 5.24 Randfragment (Kragenrandgefäß?)Hochform? Feinkeramik. 1 Randfr. Bruchstelle am Schulter-/ Halsumbruch. Kragenförmiger Hals in ausladenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen und innen anthrazitfärbig (5 Y 3/1). Im Bruch bräunliches Grau (10 YR 5/1). Außen und innen feine, geglättete, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, kleinste Steinchen vorhanden. Hart gebrannt. Erh. H. 3,0 cm. FNr. 13.
Taf. 5.25 RandfragmentEinfache Keramik. 1 Randfr. Hals in ausladenden Rand übergehend. Abgerundeter Mundsaum. Außen und innen gräuliches Gelb-Braun (10 YR 5/2). Im Bruch bräunliches Grau (10 YR 4/1). Außen
280
und innen feinsandige, geglättete Oberfläche. Fein geschlämmt, glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 2.2. FNr. 24.
Taf. 5.26 RandfragmentEinfache Keramik. 1 Randfr. Senkrechter Rand. Abgerundeter Mundsaum. Außen bräunliches Schwarz (10 YR 3/2). Innen gräuliches Gelb-Braun (10 YR 4/2). Im Bruch ebenfalls bräunliches Schwarz (10 YR 3/2). Außen feine, geglättete Oberfläche; innen ursprüngliche Oberfläche nicht mehr erhalten. Fein geschlämmt, glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 1,8 cm. FNr. 13.
Taf. 5.27 Randfragment (Topf?)Einfache Keramik. 1 Randfr. Sehr leicht gewölbte Wandung. Leicht nach außen ziehender Rand. Horizontal abgestrichener Mundsaum. Außen und innen bräunliches Grau (10 YR 4/1). Im Bruch bräunliches Schwarz (10 YR 3/1). Außen und innen raue, unebene, verstrichene Oberfläche. Mittelstark mit Steinchen gemagert (0,5–3 mm), glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 3,0 cm. FNr. 10.
Taf. 5.28 RandfragmentEinfache Keramik. 1 Randfr. Sehr leicht gewölbte Wandung. Leicht nach außen ziehender Rand. Abgerundeter Mundsaum. Außen Schwarz (10 YR 2/1). Innen mattes gelbliches Orange (10 YR 6/3). Im Bruch außen ebenfalls Schwarz und innen eben-falls mattes gelbliches Orange. Außen unebene, geglättete und innen leicht sandige, (geschlickerte?) Oberfläche. Kleinste Steinchen und Glimmer vorhan-den. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 1,8 cm. FNr. 10.
Taf. 5.29 WandfragmentFeinkeramik. 1 Wandfr. Orientierung und Form unge-wiss. Außen und innen bräunliches Grau (10 YR 6/1). Im Bruch ebenfalls bräunliches Grau (10 YR 5/1). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Außen Kanneluren. Erh. H. 4.5. Ohne FNr., nur Datum (22. 05. 1989) vermerkt.
Taf. 5.30 WandfragmentFeinkeramik. 1 Wandfr., Orientierung und Form ungewiss. Außen, innen und im Bruch bräunliches Grau (10 YR 4/1). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Hart gebrannt. Doppelte Fingerstrichkannelur. Erh. H. 3,0 cm. FNr. 13.
Taf. 6.31 WandfragmentFeinkeramik. 1 Wandfr. Form ungewiss. Außen und innen bräunliches Schwarz (2.5 Y 3/1). Im Bruch gräuliches Gelb-Braun (10 YR 4/2). Außen und innen glatte, polierte, graphitierte Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Außen senkrechte Kanneluren. Erh. H. 2,0 cm. FNr. 10.
Taf. 6.32 WandfragmentFeinkeramik. 1 Wandfr. Form ungewiss. Außen und innen mattes Gelb-Orange (10 YR 6/4). Im Bruch außen ebenfalls mattes Gelb-Orange und innen bräunliches Grau (10 YR 5/1). Außen und innen verstrichene, glatte, feinsandige Oberfläche. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Außen leicht gebogene, senkrechte Rillen. Erh. H. 3,4 cm. FNr. 18.
Taf. 6.33 MiniaturgefäßSonderform, Feinkeramik. 1 Randfr. Gefäßunterteil leicht ausladend. Leicht gewölbter Bauch. Rand der Gefäßform folgend leicht nach innen ziehend. Spitz zulaufender Mundsaum. Außen und innen bräunliches Grau (10 YR 4/1). Im Bruch eben-falls bräunliches Grau, aber heller (10 YR 6/1). Außen und innen feine, geglättete Oberfläche mit Absplitterungen. Fein geschlämmt, glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 2,0 cm. FNr. 10.
Taf. 6.34 WebgewichtFast vollständig erhalten, fragmentiert. Länglich, pyramidenstumpfförmig mit rechteckigem Grundriss. Außen rötliches Orange (5 YR 6/8). Im Kern mattes Gelb-Orange (10 YR 6/4). Ursprüngliche Oberfläche nicht mehr erhalten. Sandiger, poröser Ton. Fein geschlämmt, leicht glimmerhältig. Sehr schlecht gebrannt. Erh. H. 11,8 cm. FNr. 29.
Taf. 6.35 WebgewichtFast vollständig erhalten, restauriert. Länglich, pyra-midenstumpfförmig mit rechteckigem Grundriss. Außen mattes Gelb-Orange (10 YR 7/4) mit rötlichen Pigmentierungen. Unebene, sandige, verstrichene Oberfläche. Fein geschlämmt. Leicht glimmerhältig. Mäßig hart gebrannt. Erh. H. 14,0 cm. Ohne FNr.
Taf. 6.36 Topf?Einfache Drehscheibenkeramik. 2 Randfr. Senkrecht verlaufender Hals in waagrecht ausladenden Rand übergehend. Verdickter Mundsaum. Außen und innen mattes Gelb-Orange (10 YR 7/3). Im Bruch helles bräunliches Grau (7.5 YR 7/1). Außen und innen raue Oberfläche mit Drehscheibenspuren. Wenig feinsandig gemagert. Hart gebrannt. Erh. H. 2,0 cm. FNr. 1.