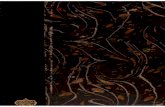1984 Eine Neuere Inschrift von L. Octavius Faustinianus aus Savaria
1977 Salvini, Eine neue urartäische Inschrift aus Mahmud Abad (West-Azerbaidjan)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 1977 Salvini, Eine neue urartäische Inschrift aus Mahmud Abad (West-Azerbaidjan)
ARCHAEOLOG ISCHE .. .
MITTEILUNGEN AUS IRAN
HERAUSGEGEBEN VOM
DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUT
ABTEILUNG TEHERAN
Neue Folge Band 10
1977
VERLAG VON DIETRICH REIMER . BERLIN
EINE NEUE URAR TKISCHE INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD (WEST-AZERBAID]ANY·
- (Tafel 22/1)
Das hier publizierte Schriftdenkmal wurde Anfang Oktober 1975 auf dem Tepe von Mahmud Abadt, einem Dorf im Bezirk Rezaiyeh, gefunden2• Die Inschrift ist auf einem grauschwarzen Stein angebracht, der 90,5 cm Breite, 62 cm Höhe und 22 cm Dicke mißt (s. Tafel 22, I). Jede Zeile ist 4,4 cm hoch.
" Außer den im Archäologischen Anzeiger aufgeführten Abkürzungen und Siglen werden im fol· genden verwendet: AS W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch (Wiesbaden 1962 ff.) AHw W. von Soden - W. Röllig, Das Akkadische Syllabar, 2. Auf!. = AnOr. 42 (Rom
HchI HuU JCS NUNKb Or RA .SPAW SL UKN UKN II.
UPD UPhM
1967) F. W. König, Handbuch der chaldischen Inschriften = AfO Bh. 8 (Graz 1955-57) I. M. Diakonoff, Hurrisch und Urartäisch (München 1971) Journal of Cuneiform Studies N. V. (H)Arutjunjan, Novye urartskie nadpisi Karmir-blura (Jereval1 1966)
Orientalia Revue d'Assyriologie et d'Archeologie prientale Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin A. Deimel, Sumerisches Lexikon (Rom 1925-5°) G. A. Melikihili, Urartskie klinoobraznye nadpisi (Moskau 1960) G. A. Melikihili, Urartskie klinoorbaznye nadpisi 11., VDI 1971, H.3, 229-255, H.4, 267-283 (nach Nrn zitiert) I. M. Diakonoff, Urartskie pis'ma i dokumenty (Moskau-Leningrad 1963) W. C. Benedict, Urartian Phonology and Morphology (University of Michigan, Ph. D., 1958)
USpr. G. A. Meliki~vili, Di~ urartäische Sprache = Studia Pohl 7 (Rom 1971) 1 Das Dorf Mahmud Abad mit dem angrenzenden Tepe liegt in der Luftlinie ca. 22 km südlich
Rezaiyeh bei dem alten natürlichen Weg nach U~naviyeh, und zwar kurz vor den Talengen, die über einen nicht allzuhohen Bergpaß nach U~naviyeh führen. Von Rezaiyeh-Zentrum fährt man über (22 km) Bälänj (entspricht Top Zawa der Karte World I : 500000 Blatt Mosul vom D. Survey War Office and Air Ministry, 1961) am Baranduz Cay, und weiter nach Süden über den SCheideweg Mahabad-U~naviyeh, in Richtung U~naviyeh bis (26 km) Kukia (= Chuche auf der KarteI: 500000). Man biegt dort nach Westen, über einen Nebenfluß des Baranduz Cay, und nach abermals ca. 1,5 km erreicht man das Dorf Mahmud Abad (als Mahmutabat auf der Karte Türkiye I : 800000 Blatt Musul vom Harita Umum Müdürlügü verzeichnet).
2 Den Fund verdanken wir Herrn Ruintan, einem Bewohner des Dorfes, der die Bedeutung dieses beschrifteten Steines sofort erkannte und die Behörden von Rezaiyeh informierte. Die Inschrift ist seitdem im Museum Rezaiyeh ausgestellt. Herzlich möchte ich St. Kroll danken, der mir bald nach einem Besuch im Rezaiyeh-Museum und in Mahmud Abad seine Dokumentation (photoaufnahme, hier abgebildet, und eine Autographie) sowie seine Daten zur Verfügung stellte. Mahmud Abad ist nun als Nr.76 unter den iranischen Fundstellen bei W. Kleiss - H. Hauptmann, Topographische Karte von Urartu = AMI Erg.-Bd. 3 (1976),33 gebucht.
126 MIRJO SAL V1NI
Der Stein war ursprünglich:"'" wie seine Form zeigt - in einem Gebäude eingemauert, von welchem sich aber keine Spur findet. Der Tepe bietet jedenfalls urartäische Keramik3• Es ist aber auch nicht auszuschließen, daß der Stein aus einem vielleicht in der Nähe gelegenen urartäischen . Ort stammt, und daß er möglicherweise, wie St. Kroll vermutet, in Mahmud Abad sekundär verwendet wurde.
Der Stein enthält nur den unteren Teil der ursprünglichen Inschrift; dies geht aus dem Inhalt selbst deutlich hervor. Es fehlt also der obere Stein, dessen Inschrift sicherlich den Anlaß - wahrscheinlich die Errichtung eines Kultgebäudes - und wohl auch den alten Namen der Festung oder Stadt, wo die Inschrift aufgestellt gewesen war, nannte.
Die eventuelle Lokalisierung eines alten Ortsnamens hätte einen guten Beitrag zur historischen Geographie der Gegend westlich vom Urmia-See geboten. Ich denke vor allem an einen möglichen geographischen Anhaltspunkt für die Rekonstruktion des Itinerars der 8. Kampagne Sargons, die die Niederlage und den Tod Rusas 1. zur Folge hatte.
Es ist jedenfalls ein glücklicher Umstand, daß der erhaltene Teil der Inschrift (Z.II-12) den Namen des Königs mit Patronymikon enthält.
EINORDNUNG DER INSCHRIFT
Wir haben es also mit dem ersten schriftlichen Zeugnis Rusas 1., Sohn des Sarduri (ca. 730-7I4/7I3 v. ehr.), auf iranischem Gebiet zu tun. So füllt sich zum Teil eine Lücke innerhalb der lokalen Dokumentation, denn nach Sarduri H., · der die Felsinschrift von Seqende14 V:erfaßt hat, gehören die nächsten schriftlichen Quellen (Felsinschriften von Razliq und Nasteban5) in die Zeit ArgiStis H., des Sohnes Rusas 1.
Von Rusa 1., der uns hauptsächlich in zeitgenössischen assyrischen Quellen entgegentritt, kennen wir nur wenige originale Inschriften, die vorwiegend aus Randgebieten des urartäischen Reiches stammen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Argisti 1. und Sarduri H. hat er in der Hauptstadt Tuspa (Van Kalesi) keine annalenartigen Texte hinterlassen.
Folgende Inschriften gehen mit Sicherheit auf ihn zurück: I. Die assyrisch-urartäische Bilingue von Topzawä, bei Sidekan, im iraqisehen Kurdistan, von der immer noeh keine zuverlässige Edition vorliegt (HchI I22 = UKN 264). 2.-3. Zwei Kriegsinschriften aus Transkaukasien: in Nor-Bajazet/Odzaberd (HchI II9 = UKN 265) und in Govinar /Kolagran (Hehl I I8 = UKN 266). 4. Eine fragmentarische Stele aus Van (HchI I20 = UKN 267). 5. Eine Weihinschrift auf ein~m Bronzeschild aus Karmir-blur (Hehl I 20 a = UKN 269).
3 Cf. W. Kleiss, AMI N. F. 9, 1976, S. 36 ff. 4 UKN II. 417. Eine verbesserte Edition biete ich nun in der Festschrift Piotrovskij (im Druck). 5 W. C. Benedict, JCS 19, 1965, 35-40. In UKN Ir. Nr. 445 sind aus Versehen die letzten 6 Zeilen
ausgelassen worden.
EINE NEUE URARTAISCHE INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD I27
Die übrigen Inschriften, die in HchI oder in UKN Rusa 1. zugeschrieben werden, sind ebensogut auch auf Rusa II. oder Rusa IH. zurückzuführen, weil in jenen das Patronymikon nicht angegeben ist; so in HchI I2I = UKN 268 (Stele vom Ke~i~ Göl), HchI I30 B = UKN 270-274, 274 a-d (auf Bronzeschalen aus Karmir-blur), und UKN H. 443 (auf dem Bronzekandelaber von Hamburg).
Wegen der historischen Folgerungen ist das Problem der Zugehörigkeit der Stele vom K~i~ Göl, die über große Bewässerungsarbeiten berichtet, von Bedeutung. Es handelt sich dabei um die Anlegung eines Stausees (eben des heutigen Ke~i~ Göl) und die Führung eines Kanals zur Wasserversorgung von Rusabinili (Toprakkale). In Zeilen 8-I1 ist zu lesen:
IR V[][11"'lR h" 'l['V] ' d '1"'" [b'] R u-sa-s e a - t t-U u-sa-_ t-t-nt- t s t- u-u- t t-U t-nt ~u-e ta-nu - t ...» usa (ohne Patronymikon!) spricht: als ich (die Stadt) Rusabinili gründete, als ich diesen Stausee anlegte ... «.
Dieser Passus verknüpft - wie bekannt - eindeutig den Verfasser der Inschrift mit dem Gründer von Toprakkale / Rusabinili. Er sollte - gegen die noch gängige, herkömmliche Meinung6 - nicht mit Rusa 1., sondern wahrscheinlicher mit Rusa II. identifiziert werden7• Haben wir hierfür auch keine zwingenden Beweise, so sprechen doch starke Indizien für eine jüngere Datierung. Stammen doch die ältesten datierbaren Urkunden aus Toprakkale von Rusa II., nämlich die Weihinschrift auf dem Bronzeschild HchI 130 = R. D. Barnett AnSt 22 (1972) S.168 Nr.5, und die Tontafel UPD 12. Auf letzterer findet sich ferner eine weitere Erwähnung der Stadt Rusabinili, die sonst nicht belegt ist.
ZUR TEXTGATTUNG
Der erhaltene Teil der vorliegenden Urkunde gehört in die Kategorie der Opferrituale. Es handelt sich um eine kleine Gruppe von Texten, die vom leXikalischen und grammatikalischen Gesichtspunkt aus besondere Schwierigkeiten bieten, so daß · meist auf eine fortlaufende übersetzung verzichtet wird. Bisher verfügen wir nur über eine Studie F. W. Königs8 ; es wäre aber eine systematische Untersuchung dieser Texte im Rahmen der übrigen Inschriften religiösen Inhalts notwendig. Inzwischen sind neue religiöse Texte, vor allem aus Karmir-blur9, bekannt geworden.
Opferrituale enthalten die folgenden Inschriften: HchI 10 = UKN 27 (von ISpuini und Menua), HchI8 = UKN 25 (ISpuini und Menua), HchI 41 = UKN 65 (Menua),
6 Nach C. F. Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt lI/I (Berlin-Leipzig 1926), 42 ff.; cf. a. R. D. Barnett, Iraq 12, 195°,33; G. A. Melikihili, UKN S. 440; B. B. Piotrovskij, Il regno di Van (Rom 1966) 131; Th. Beran in: H. Schmökel, Kulturgeschichte des alten Orient (Stuttgart 1961), 615; R. Labat in: Fischer Weltgeschichte IV. Die altorientalischen Reiche III (Stuttgart 1967), 60.
7 Cf. A. Goetze, Kleinasien2 (München 1957), 198 Anm.2, gegen Lehmann-Haupts Ansicht, ferner z. B. M. N. van Loon, Urartian Art (Istanbul 1966), 19 f.; E. Akurgal, Urartäische und altiranische Kunstzentren (Ankara 1968), 6 f.; O. W. Muscarella, »Expedition« 13 (No. 3-4), 1971, 48; eh. Burney, AnSt.22, 1972, 183; eh. Burney-D. M. Lang, The Peoples of the Hills (London 1971), 162.
8 Ein Festkalendarium aus dem armenischen Alpenland im 9. bis 7. Jahrhundert v. ehr., Fs. J. F. Schütz (Graz-Köln 1954), 59-68.
9 Cf. N. V. (H)Arutjunjan, NUNKb Text I = UKN lI. 448 ist ein neu es kompliziertes Opferritual.
TEi'1EM •
128 MIRJO SA"L VINI
HchI 56 = UKN 89 (Menua), HchI 76 = UKN 96//98 (Menua), HchI 102 Vs. = UKN 156 AU + AI (Sarduri 11.), Mahmud Abad (Rusa 1.), Hehl 126 = UKN 281 (RusaII.), UKNIL 448//HchI 97 = UKN 143 (Rusa II.);unsicher Hehl 51 = UKNSI (Menua) und UKN 11. 449//451 (Rusa II.).
Der eigentliche Opfertext ist häufig nur ein zumeist zentraler Teil der jeweiligen Inschrift, die in erster Instanz der Errichtung eines Kultgebäudes (KA, susi, burganani) oder der Stele (pulusi) selbst, wo die Inschrift eingemeißelt ist, oder der Anlegung von Weingärten (GISuldie) sowie anderen Plantagen (GISzari) gewidmet ist. Das Opfer wird vom König feierlich angeordnet; soweit dies explizit zum Ausdruck kommt, findet sich der Terminus ardise »Anordnung, Befehl«lo als Einleitung der eigentlichen Opfervorschrift. Letztere besteht stets aus zwei Teilen: nämlich aus einer Voraussetzung (Bedingungssatz eingeleitet mit ase »wenn«) und einer Opferangabe. Nach oder anstelle letzterer können auch andere noch unverständliche Wendungen vorkommen, die Opfer- oder Ritualhandlungen beschreiben dürften. Beispiele aus diesen Texten werden unten vergleichsweise im Kommentar verwertet.
Z. o.
~.
2.
3· 4· 5· 6.
7· 8. 9·
10. 11. 12. 13·
TRANSKRIPTION
[IRu-sa-a-se IdSar5-du-ri-hi-ni-se] a-li ~e-el-zu-se is-ti-ni te-ru-bi a-[se] LUGALMES-i KASKAL za-du-li I GUD 1 UDU dSe-bi-tu-e S[UM] 3 UDU dAr-~u-'a-ra-sa-u-e I UDU dSe-bi-tU-i-na-u-e KA qu-du-Ia-ni GIBIL-~i I UDU dSe-bi-tU-e SUM a-se gi-i su-si-ni bi-di har-ha-ru-li ta-nu-li-i-ni me-i e-si-me-si el-mu-se ma-nu-ni a-se-e su-hi ba~at-qi-du-liyA I UDU dse-bi-tU-e SUM IRu-sa-ni dse-bi-tU-i WIR dse-bi-tU-ka-i a,-ni-ia-ar-du-ni IRu-sa-a-ni a-ni-ia-ar-du-nu-li-ni IRu-sa-a-se IdSar5-du-ri-bi-ni-se a-li a-Iu-se i-ni DUB-te ro-li-i-e me-i ar-bi-e
14. u-ru-li-a-ni dUTU-ni-ka-a-i Bemerkungen zur Transkription
Z. 0 läßt sich mit Sicherheit auf Grund von Z. 11-12 und wegen ali »spricht« (Z. I) wieder rekonstruieren.
Z. I: das zweite Wort beginnt mit dem Silbenzeichen AS 122 (NE), das hier am wahrscheinlichsten den Wert te hat. Wegen des daraufkommenden el könnten theoretisch auch die Werte ne und de in Frage kommen. Diese sind in der Tat in den Zeichenlisten von Melikisvili (UKN S. 36 f.) und Diakonoff (UPD S.98 Nr.99: dex ) neben
10 Cf. A. Goetze, RHA 24, I936, 2&0 Anm. 64, ferner Hehl und UKN, Glossare s. v. und G. A. Me-likiSvili, USpr. &0. "
EINE NEUE URARTAISCHE INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD 129
Je gebucht; es handelt sich aber um alte und seltene Silbenwerte des akkadischen Syllabars, die jedenfalls im Urartäischen keine sicheren Belege aufweisen (cf. UPhM S.12-13 und Anm.5). Solche Werte fehlen übrigens auch in der Zeichenliste von König (Hchl, Taf. 103). Der Lautwert te ist dagegen durch alternative Schreibungen wie ku-tee -i)-tu '" ku.-tE-tu, te-ru.-si '" te-ru-si oder IrJ -i-te-ru-bi ,......, KURrJ -i-te-ru-bi- gut gesichert.
Das letzte nicht erhaltene Zeichen dieser Zeile muß, aus Gründen der Analogie, unbedingt se gewesen sein. .
Z. 2: das in Resten erhaltene letzte Zeichen könnte theoretisch ein i sein; die Lesung SUM aber ist nach dem Textzusammenhang, sowie durch Vergleich mit Z. 5 und 8, zwingend.
Z. 7: Die Schreibung a-se-e ist sonst nur in der Bilingue von Topzawä (Hchl 122 = UKN 264: urart. 26) bezeugt.
Z. 8: für die Zeichengruppe zwischen Li und UDU könnte man an die »schräge« Variante des li-Zeichens denken; die Beschädigung zwischen den beiden senkrechten Keilen ist aber - wie ich am Original überprüfen konnte - nicht so tief, als daß ein Winkelhaken anzunehmen wäre. Es sind vielmehr zwei verschiedene Zeichen anzunehmen, nämlich TE (SL II 376) oder LA (SL II 55), die im Urartäischen nicht unterschieden sind, und das Zahlzeichen 1 »eins«.
KOMMENTAR
Zum Zwecke der besseren übersicht habe ich den Text in strukturellen Einheiten unterteilt (s. Tabelle I): die zehn ermittelten Sätze sind - soweit mir möglich - in analytischer Transkription wiedergegeben.
Satz 1: Rusa=se Sarduri=bi=ni=se ale Wir haben hier vor uns die wohlbekannte Einleitung in die Aussagen des Königs : »Rusa, der (Arti
kel -nl) Sarduride (Zugehörigkeitssuffix -bI), [beide im Ergativkasus -Je] spricht (folgendermaßen) «. Zu ali/e »spricht« cf. Verf. TeherForsch. IV (im Druck) mit Lit.
Satz 2: telzuse istini teru=bi Hier liegt die eigentliche und spezifische Einleitung in die Opfervorschrifl: vor: "ich hab~ hier (iJtini)
(ein oder folgendes) ~elzuJe gesetzt/bestimmt (teru=bi) «. Die Bedeutung von teru- ist-Dank der Entsprechung mit akk. sakänu in der Keli~in-Biüngue sichergestellt. Das Wort ~elzuse ist ein Hapax legomenon und nimmt hier die Stellung des sonstigen ardise (s. oben S. 128) ein, und ist somit ebenfalls ein Nornen Abstraktum auf -se. Vgl. folgende Einleitungen in Opfervorschriften: teru=ni ardise (HchI 10 = UKN 27: 2//29; die entsprechenden Zeilen des zweiten Duplikat-Teiles des Textes, nämlich Z.34 und [90] haben die Pluralform tertu; Hchl 8 = UKN 25 : 3//8); teru=bi ardiJe (Hchl 102 Vs. = UKN 156 AI! + AI: 9-10); gun i ardise guni ar[dise teru=bi?] (UKN II. 448 : 6). ~elzuse ist also entweder Synonym von ardise in einer Bedeutung ,.Anordnung, Bestimmung«, oder ein Terminus technicus, der - wegen des dara~ffolgenden Inhalts - die Opfervorschrift bezeichnen könnte.
Sätze 3 bis 6 gliedern sich in vier verschiedenen Voraussetzungen mit den entsprechenden Opferangaben. Die mit einem Bedingungssatz (ase »wenn« usw.) eingeleiteten Sätze sind die typischen Opfervorschriften: im ersten Glied kann aber auch gelegentlich eine Zeitangabe vorkommen: teru=ni/tertu ardise dUTU-ni(-ni) lTU ... ; »hat/haben bestimmt als Verordnung im? Monat des Sonnengottes . .. « (Hchl 10= UKN 27 : 2-311
Allgemeine Einleitung: Spezifische Einleitung:
Opfervorschrift :
Allgemeine Einleitung (in die Fluchformel):
Fluchformel:
I.
2.
3·
4· 5· 6.
7· 8.
9·
10.
STRUKTUR DES TEXTES
Rusa = se Sarduri = bi = ni = se ale ~elzuse istini teru = bi
Voraussetzungen Opferangaben
I I
ase LUGALMEs-i KASKAL zadu=le I GUD I UDU Sebitu=e SUM 3 UDU Ar~u'a-I rasau=e I UDU Sebi~u=i=na=ue KA ,
qudulani GIBIL-~i I UDU Sebitu = e SUM ase gi: susi = ni bidi barbaru = le tanu = lini mei esime~i elmuse manu = ni ase subi batqidu=le~ TEMEN 1 UDU Sebitu=e SUM
(a) Rusa=ni Sebitu=i wIR (b) Sebitu = kai anijardu=ni Rusa = ni anijardunulini Rusa = se Sarduri = bi = ni = se ale
Voraussetzung Fluch -
aluse ini DUB-te tu=le mei arbe uruliani Siuini = kai
----- - - - - --- -----
Tabelle 1
..... .... o
::: ;il o V> > t"' <:
~
EINE N EUE URART1\lSCH E INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD 13 1
34-35). Hchl 51 = UKN 81 : 6 nennt sowohl ase als auch dUTU !TU; allerdings ist der nachfolgende Kontext zerstört. Die dritte bisher feststellbare Variante im ersten Glied ist hier in Satz 4 geboten (s. unten).
Das Verbum der Bedingungssätze ist stets mit dem Suffix -le versehen 11. Außer den im vorliegenden Text belegten Beispielen seien noch folgende Stellen genannt: a-se sa-li me-su-li (Hchl 76 = UKN 96//98 : 4); a-se pi-li ni-ki-du-li (Hchl 126 = UKN 281 : 17); a-se e-si ma-nu-li (UKN 11. 449: 4//451 : 3).
Dieselben Formen auf -le dürften sich in den Fluchformeln finden, die mit aluse »wer« eingeleitet sindl2 , z. B. a-lu-se i-ni DUB-te tu-li-e a-lu-se pi-tu-li-e a-lu-se KITIM me?-pu-li-i-e a-lu-se AMES ba-su-li-e a-lu-se u-li-se ti-u-li-e i-e-se za-du-u-bi a-Iu-se ti-ni-ni tu-li-e . .. (Hchl 126 = UKN 281 : 32-39)13. Hier ist wohl noch die isolierte Form ali/e »spricht« zu stellen.
Diese Formen werden in der Literatur verschiedentlich interpretiert: nämlich als 3. Pers. Sg. Präsensl4 oder Futurum15 oder als Ausdruck des Potentialisl6• Vorzuziehen scheint mir die Analyse von I. I. Me~caninov, der in seiner Arbeit über die Struktur des urartäischen Verbumsi? von einem vollendeten (Aorist = Präteritum der übrigen Grammatiken) und einem unvollendeten (= Präsens-Futurum) Verbalaspekt spricht. Danach wäre das Morphem /le/ keine Personalendung, sondern Kennzeichen der unvollendeten Handlung bei transitiven Verben. Er zieht nämlich die Formen aus den aluseSätzen und ali/e unter Betracht, nicht aber die analogen Formen aus den ase-Sätzen, die uns hier primär interessieren.
Die Erklärung des Suffixes -le als Kennzeichen des unvollendeten Aspektes läßt sich aber m. E. um so mehr auf die ase-Sätze beziehen. Obwohl die ase-Sätze ungleich undurchsichtiger als die aluse-Sätze sind, scheint aber eines festzustehen: die Verbalformen auf -le können sowohl mit einem singularischen als auch mit einem pluralischen Subjekt vorkommen - soweit dieses vorhanden oder bestimmbar ist - wodurch dann eine Bestimmung des Suffixes -le als Personalendung auszuschließen ist. Zwei sichere Beispiele: r. a-se LUGAL-ni dIM-ni URU ma-nu-li, »wenn der König in der Stadt
11 1i.ußerlich entsprechen diese Formen den bipolaren Suffixen des Typs ~ ich-sie(Pl.) « des trans. »Präteritums« (z. B. zadu=li »ich-habe-sie-gemacht«), wie auch der 3. Pers. Plur. des intrans. ,.Präteriturns« (z. B. nuna=li ~ sie kamen«). Vgl. darüber Verf. SMEA 5, 1968,99 ff.
12 Vgl. F. W. KönigS; in beiden Fällen spricht er von Bedingungssätzen. 13 Die Fluchformeln sind von W. C. Benedict, JAOS 81 (1961), 384 f. zusammengestellt und - so
weit möglich - übersetzt. H Von Benedict, UPhM 86 und Anm. 41. Manche Formen aus den ase-Sätzen werden aber S.94 als
passive Partizipien interpretiert. Cf. a. J. Friedrich, HdO II 2, Urartäisch 44, wo zwei Beispiele aus den aluse-Sätzen angeführt sind.
15 Melikihili, UKN S. 71 = USpr. 60 f. 16 Diakonoff, HuU 135; Diakonoff zieht hier aber nur die aluse-Sätze in Betracht, indem er die
analogen Formen aus den ase-Sätzen 133 unterm Optativ bucht. I? Grammaticeskij stroj urartskogo jazyka. Cast' vtoraja. Struktura glagola (Moskau-Leningrad
1962), 8. 33 ff. 68 ff. Auch Diakonoff spricht von einem imperfektiven Aspekt im Urartäischen wie im Hurrischen. Sein Kennzeichen sieht er aber in einem Infix -ed-: s. HuU II6 Anm. 126.
1)2 MIRJO SAL VINI
des Teiseba (d. i. Karmir-blur) ist« (UKN II. 448 : 19); a-se GISMES u-i al-di-ni-i-e gu-du-u-li »wenn die Bäume ... « (HchI 10 = UKN 27 : 29).
Im Gegensatz zu den aluse-Sätzen, wo das Subjekt (alu=se oder alu=se uli=se) im Ergativ-Kasus steht, ist in dieser Hinsicht der Sachverhalt bei den aSe-Sätzen vielfältiger, denn:
1. Wir haben kein einziges Subjekt im Ergativ-Kasus. 2. Wir haben ein sicheres Beispiel eines transitiven Satzes, mit Subjekt und
Akkusativobjekt, wo das Subjekt nicht im Ergativ-Kasus, sondern im sog. »Stammkasus« oder »Nominativ« steht (vgl. Satz 3 vorliegender Inschrift).
3. Wir haben sichere Beispiele von intransitiven Sätzen (vgl. diejenigen mit manu- »sein«).
4. Manche Sätze, wie etwa a-se GISul-di ta-nu-li .(HchI 10 = UKN 27: 30) und a-se GISul-di me-su-li (ebd. Z. 30) scheinen eine passivische übersetzung zu erfordern.
5. Wir haben schließlich sichere Belege von transitIven Verben (a-Je ta-nu-li von tanu- »machen« u. dgl.; a-se si-u-li von siu- »bringen«), wo weder Subjekt, noch Objekt spezifiziert sind. Sollte es sich hier um unpersönliche Passiva handeln? Also etwa »wenn es gemacht, bzw. gebracht wird«, und zwar mit Bezugnahme auf das im Text Vorhergesagte.
Bei diesem anscheinend widerspruchsvollen Befund kann keine endgültige Lösung gefunden werden, zumal das Belegmaterial dieser Verbal formen noch recht einseitig ist.
Ich habe aber den Eindruck, daß ein gemeinsamer Nenner eben in dem imperfektiven Aspekt gesehen werden darf.
Im zweiten Glied det;'_ Opfervorschrift erscheinen meist Formen auf -lini, welche ebenfalls keine einstimmigen Erklärungen gefunden haben; man spricht von passivischen Partizipienl8, passivischen Imperativformenl9, oder aber von Optativen20•
Einige Beispiele: GUD 3 UDU dljal-di-e ur:..pu-u-li-i-ni ba-lu-li as-bu-li-ni (HchI 41 = UKN 65 : 25-27) »ein Rind (und) drei Schafe soll man dem Ijaldi schlachten ... «; MAs.TUR dljal-di-e ni-ip-si-du-li-ni (UKN H. 448 : r r) »ein Zicklein soll man dem Ijaldi zerreißen (?)«; MAs-TUR dljal-di-e ni-ip-si-du-li (ebd. Z. 12).
Aus den letzten bei den Belegen ersieht man, daß -lini mit -li vertauschbar ist. Vgl. auch ur-pu-li dljal-di[ -na KA (HchI 76 B, C, D = UKN 96: 4). Dies läßt den Schluß zu, daß -lini als -li=ni zu analysieren ist. In diesem Fall könnte wiederum das Kennzeichen des Imperfektivs II el zugrunde liegen, und die aus den Kontexten anzunehmenden imperative oder optative Färbung dem Suffix -ni innewohnen. Das aber ist nur eine Hypothese, die die bisher angenommene semantische Bedeutung dieser Formen kaum ändert.
18 Benedict, UPhM 94 ff., wo auch eine Liste dieser Formen zu finden ist. Cf. a. ders., JCS 19, 1965,39.
19 Goetze, RHA 24, 1936, 269 ff.; Melikihili, USpr. 63 f.; Mdcaninov, Struktura glagola, sr, Friedrich, Urartäisch 45.
20 Diakonoff, HuU 133, OLZ 68, 1973, Kol. I1-I2.
EINE NEUE URARTJUSCHE INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD 133
Satz 3, 1. Glied: ase LUGALMES-i KASKAL zadu=le LUGALMELi ist eine bisher nicht belegte gemischte Schreibung für den Plural ··ereli=li »die Könige~ :
vgL die Schreibung LUGALMES-li-li in HchI 23 = UKN 36 : 24. KASKAL, phonetisch bari-, bedeutet" Weg« und »Feldzug«. Nach dem Kontext ist wohl "Feldzug«
anzunehmen, zumal auch eine andere Inschrift das Verbum zadu-21 mit dem Synonym It'Stipte verbindet: [u]s-ti-ip-te za-du-u-b [i] "ich machte den Feldzug« (Hchl 103 § 11 IV = UKN 155 D : 21).
2. Glied: I GUD I UDU Sebitu=e SUM 3 UDU Artu'arasau=e I UDU Sebitu=i=na=ue KA Sebitu=e und Ar~u'arasalt=e sind Dativa sg. von u-Stämmen; vgL ijaldi=e, ettri=e usw., passim. SUM
entspricht akk. tabäbu ~ schlachteo« SL II 126, 17; cf. a. Labat, 1976, 126), und soll hier urpu=lini gelesen werden; s. ein oben S. 131 angeführtes Beispiel. Die phonetische Lesung des Logogramms SUM als urpu»schlachten« geht auf A. Goetze, RHA 24, 1936, S.274, 276 zurück. Eine Bestätigung findet sich bei N. V. Harutjunjan, NUNKb S. 27: SUM-si = urpua!i »Opfer(darbringung)«.
Der Kult der Gottheiten Sebitu und Artu'arasau ist schon ein Jahrhundert vorher ·aus der Nischeninschrift von Meher Kapisi bezeugt (HchI 10 = UKN 27 : 61139 bzw. 14//54). Der ersten, die vage an die akkadischen Sebettu »die Sieben« anklingt22, werden dort 2 Rinder und 4 Schafe, der zweiten aber 2 Rinder und 34 Schafe als Opfer bestimmt. Unser Text zeigt nun, daß es sich um lokale Götter der Gegend von Rezaiyeh gehandelt haben muß.
Die Analyse Sebitu=i(Genit.)=na(Plur.-Art.) cue(Gen. Plur.) KA »dem Tor (im urart. Plur. Tanturn) des Sebitu«, ist nach der Studie G. WilhelmsH nunmehr erforderlich.
Das als "Tor des Sebitu« genannte Heiligtum24 kommt hier zum ersten Mal vor. Bezeugt ist am häufigsten das» Tor des ljaldi«. Die Inschrift von Meher Kapisi nennt aber auch ein Tor des Wettergottes der Stadt Eridiallrdia (Hchl 10 = UKN 27 : 16//59), ein Tor des Sonnengottes der Stadt Ui~ini (ebd . 161/59) und ein Tor des Gottes Ua der Stadt Ni~i (ebd. 201/67).
Den Satz 3 verstehe ich also wie folgt: »Wenn die Könige einen Feldzug unternehmen, soll man ein Rind und ein Schaf für Sebitu opfern, (ferner) 3 Schafe für Ar!U'arasau (und) ein Schaf für das "Tor des Sebitu«.
Satz 4: qudulani GIBIL-~i I I UDU Sebitu=e SUM Das Wort qudulani kommt hier . zum dritten Mal vor: vgl. qu-du-Ia-a-ni su-bi-na-a-~i-e (HchI 8 = .
UKN 25 : 4//9), und qu- [d]u-Ia-ni su-bi-na-[i (UKN II. 448: 7) . Aus diesen Belegen entnehmen wir die Gleichsetzung GIBlL-# = subina!i(e), welche die übersetzung »neu« für subi bestätigt25• Die morphologische Analyse dieses Wortes ist: subi.na(Pluralart.)=!e(Lokativsuffix). Ganz unterschiedlich sind die übersetzungen, die vorgeschlagen werden: F. W. König, a. a. O. »für? die neuen Opfergaben?c; Harutjunjan, NUNKb S. 15 f., 68 .damit wird im? neuen Tempel« (er sieht nämlich eine Entsprechung zwischen qudulani und E. BAR-~i); Diakonoff, HuU S. 133 "an den neuen Mondtagen«. Andere hingegen glauben in qudulani eine Verbalform zu sehen26•
Aufgrund dieser drei Belege scheint es mir sehr schwierig, die genaue Bedeutung von qudulani zu bestimmen. Es ist festzustellen, daß der Ausdruck qudulani subina[i in allen drei Fällen den are-SatZ vertritt; die Wendung könnte deshalb eine Bedingung im weitesten Sinne ausdrücken.
Die beiden Tatsachen, daß diese Wendung den Ausdruck subi- "neu« enthält, Und daß die Inschriften, woher die oben angeführten Belege stammen, in erster Instanz der Gründung von Tempelanlagen gewidmet sind, ermöglichen vielleicht folgende - natürlich nur sinngemäße - übersetzung: "bei Neugründungen (0. ä.) soll man ein Schaf an Sebitu schlachten«.
21 über den Gebrauch von zadu- cf. Verf. Or. 36, 1967,445. 22 Siehe Goetze, Kleinasien2 (München 1957), 197 Anm.2. König, ,.Archiv für Völkerkunde« 8,
1953, 169 spricht sich gegen eine solche Gleichsetzung aus. 23 Zur urartäischen Nominalflexion, ZA 66, 1976, 1°5-119. 24 über das als " Tor« (KA = seStili) genannte Heiligtum s. RLA, Nachträge H, s. v. »tj:aldi-Tor e. 25 Cf. König8 62; ferner Diakonoff, UPD 53, und (H)Arutjunjan, NUNKb 15. überholt ist dem
nach Melikihili, USpr. 31,87: subi = »Einrichtung?, Bau?, Ordnung?«. 26 Goetze, RHA 24, 1936, 279 vermutete für die Formen auf -lani eine finale Bedeutung; Meliki~
viii, USpr.60, bucht qudulani unter den ,.Formen des unvollendeten Aspektes der Vergangenheit«. Benedict dagegen, UPhM 93 c. n. 58 glaubt eher an ein Nomen.
MIRJO SAL VINI
Satz 5: ase gi: susi=ni bidi barbaru=le I tanu=lini mei esime~i elmuSe manu=ni gi-i27 ist hier Indefinitpronomen, »(irgend)etwas«28, und von gi-e »(Wein)keller«29 sicher zu trennen.
bi/edi(m) ist eine Postposition; sie regiert den Ablativ, und wird übersetzt "von Seiten«30. Mit susi, hier Ablativ auf -ni, wird der in Urartu übliche Tempelbau bezeichnet; dies geht aus den in
Arin-berd in situ gefundenen Duplikat-Inschriften UKN 11. 396, 397 hervor3!. In barbaru=le sehe ich den imperfektiven Aspekt eines Verbums barbaru-, das noch einmal, allerdings
ohne Morpheme, in den Annalen des Argihi (Hchl 80 § 14111 = UKN 127 VI: 18, ba-ar-ba-a-ru) belegt ist. In demselben Text und sogar in gleichem Zusammenhang findet sich Z. 20 die unklare Form bar-bar-sa-bi, von batbarsu- "zerstören" o. ä. Ich glaube nun, daß auch der neue Beleg zu jenem Verbum zu stellen ist. Vergleichsweise seien die Varianten qabqaru- '" qabqasu-,..., qabqarsu-, eines Verbums, das eine kriegerische Handlung ausdrückt, zitiert32•
Im zweiten Glied dieses Satzes, nach tanu./ini (etwa "man soll machen«) folgt eine Formel, die typisch für die Texte religiös-rituellen Inhalts ist, jedoch noch unverständlich bleibt. Diakonoff versucht auch hier eine übersetzung: »(und) außerdem (was) man an (den) Himmel Gelübde gemacht hat«33. mei wird als Konjunktion34, manchmal audJ als Verbotspartikel35 interpretiert. Ich neige zur zweiten Meinung und möchte hier einen Verbotssatz36 sehen, der möglicherweise eine negative Vorschrift innerhalb des Rituals ausdrückt.
Den ganzen Satz verstehe ich also sinngemäß so: »wenn etwas amI susi-Tempel verfällt/zerstört wird, soll man machen (und) es soll kein dime!i (und) elmuse sein / stattfinden«. Die Bedeutung dieser beiden Wörter ist, trotz Diakonoff, noch nicht zu ermitteln.
"Man soll machen« könnte entweder heißen, daß man einen verfallenen Teil des susi-Tempels - von dessen Gründung höchstwahrscheinlich im ersten verlorenen Teil dieser Inschrift berichtet wurde -wiedererbauen soll, oder aber; daß man dasselbe Opfer »wie oben« machen soll. Auf die zweite Lösung könnte die Stelle HchI 76 B, C, D = UKN 96 : 6-7 hinweisen, wo von tanu=lini das logische Objekt uTpua~i »Opfer(darbringung) .. ist.
Satz 6: ase subi batqidu=le LA I I UDU Sebitu=e .sUM Zum ersten Glied sind folgende Vergleichs stellen aus leider völlig unverständlichen Texten heran
zuziehen: su-bi ba-at-qi-du-li-ni (Hchl 62 a = UKN 100 : 7; Hchl 62 b = UKN 124 : 5, nach der vorigen ergänzt); su-bi ba-at-qi-a-ni (UKN II. 328 a : 6). Nach Diakonoff, HuU S. II6 Anm. 126, heißt batqidulini "er soll ihn wiederherstellen«. Er isoliert hier ein Kennzeichen /ed/ des imperfektiven Aspektes. Wir haben es aber wohl mit der Stammes erweiterung -d- zu tun37.
·Das darauffolgende Zeichen, das bereits oben S. 129 besprochen wurde, soll m. E. hier eher logographisch als phonetisch interpretiert werden, obwohl es als Logogramm im Urartäischen nicht weiter bezeugt ist. Die von ase »wenn« eingeleiteten Verbalformen enden stets auf -li(-e), und für ein weiteres Silbenzeichen -la oder -te in dieser Position existiert keine analoge Bildung. Als mögliche logographische ~ Lesung bietet sich in diesem Kontext wohl nur' LA: cf. SL II 55,2 = ~i-ka = ba-a~-bi "Ton, Tongefäß«, und AHw. I S. 332 S. v. ba!bu(m) III, Wz. (dug)LA, 3 "kleiner Topf: nA im Kult dugba-a!-bu<t. Das bleibt
27 Meist gi-e-i geschrieben; bezeugt ist aber schon die Schreibung gi-i in HchI 91 = UKN 137 : 7 und UKN H. 448 : 3.
28 Cf. Melikihili, VDI 1951, 4, 30 Anm.9 (von S. 29), UKN 394, USpr. 50; unsere Stelle fügt sich der von Benedict, UPhM 195 f. zusammengestellten Phraseologie hinzu.
29 Cf. Melikihili, UKN 394 und Verf. SMEA 14 (1971) 174 f. 30 Cf. Meliki~vi1i, UKN 392. USpr. 39; Diakonoff, HuU 150. 3! Cf. K. L. Oganesjan (= Hovhannisjan), Arin-berd I. Architektura Erebuni po materialam rasko
pok 1950-1959 gg., Jerevan 1961, 12; ferner Diakonoff, OLZ 68, 1973, KoI. 12. 32 Cf. Verf., Belleten 37, 1973, 282. 33 HuU 97 Anm. 103. Er setzt eJime- (Lokativ-Allativ auf -~e) zu di- »Himmel" und elmuse zu
hurr. elmi- "Eid, Gelübde«; manuni sei Kausativ von manu- »sein«. 34 Benedict, UPhM 185 mit Lit. 35Cf. Goetze, RHA 22, 1936, 165 ff.; Friedrich, ZDMG 105, 1955, 68; ders., HdO II 2, Urartäisch,
45 § SI; Meliillvili, USpr. 71. 36 Cf. Verf. ZA 61, 1971, 249. 17 Ebd.
EINE NEUE URARTli.ISCHE INSCHRIFT AUS MAHMUD ABAD 135
aber sehr fraglich, und nur versuchsweise biete ich folgende Interpretation des ganzen Satzes: »Wenn neu hergestellt?? wird ein Kultgefäß??, soll man ein Schaf an Sebitu schlachten.«
Wir dürfen aber auch für möglich halten, daß sich der Steinmetz verschrieben hat, und -li-la statt -la-li eingemeißelt hat. So hätten wir eine Verbalform batqidlt=lali, die ein analoges Beispiel nur in dem Hapax legomenon ma-nu-u-la-li hätte (Tontafel aus Bastam Nr.2, Vs. 5, TeherForsch. IV, im Druck) .
Satz 7: (a) Rusa=ni Sebitu=i wIR I (b) Sebitu=kai anijardu=ni (a) ist ein Nominalsatz. Der Königsname steht hier im sog. »ni-Kasus«38. Die Wendung »Sklave/Die
ner des Gottes X" kommt im Urartäischen sonst nur in bezug auf ljaldi vor, und zwar in der Bilingue von Topzawä (Hchl 122 = UKN 264: urart. Z. 24-25 IRu-sa-ni dijal-di-e-i [LOIJR entspricht assyr. Z.23-24 ana-ku IRu-sa-a39 ardu. (LOIR) sa dijal-di-a und in Hchl 124 = UKN 276 (Vs. 15 logographisch in der Ergativ-Verbindung dijal-di-ni-se LOIR-se [=ljaldi=i=ni=se *bura=se) , Rs.)I phonetisch dijal-di-e-i LO bu-ra-n[iJ). LOIR kommt sonst im Urartäischen als Berufsbezeichnung (einmal in Hchl 77 a, b = UKN 3II : 1) und im PN Idljaldi-IR (cf. UPD S. 94) vor. ,
Sebitu=kai heißt »vor/gegenüber Sebitu«, wobei -kai als Postposition40 oder aber als »uneigentliches Kasuskennzeichen«41 gehalten wird. ' ,
Das Wort anijarduni kennen wir sonst nur aus folgender Stelle der Annalen Sarduris 11.: IdSar6-duri-se a-li1e1 IKu-us-ta-as-pi-li LUGAL KURQu-ma-ba-al-bi-1e1 a-ni-ia-ar-du-ni ma-nu u-i a-i-ni-i LUGAL is-ti-ni us-tu-ri (Hchl 103 § 9111 = UKN 155 E : 40-43). Es folgen die übersetzungen von F. W. König: ,.Sarduri spricht: Kustaspili, der König des Qumaha-ischen (Landes), war unabhängig (gewesen) [Kö. trennt a-ni-ia von ar-du-ni), kein König war dort (je) beschenkt (= gezinst?) worden«, und von Melikisvili: ,.Sarduri spricht: KuStaspili, König des Landes Qumahalhi, war unabhängig (?), kein König (Urartus?) war dort gewesen (?)«.
Alle sonst vorgeschlagenen übersetzungen der Wendung anijarduni manu sind ähnlich42 und setzen die gleiche Erklärung der in diesem Passus geschilderten Situation voraus.
Unser Textzusammenhang zwingt aber zur gegenteiligen Behauptung, und zwar daß anijardu=ni -eine Nominalform auf -ni - etwa» Vasall« bedeutet. Denn als solcher muß sich Rusa im Verhältnis zur lokalen Gottheit Sebitu erklären, nachdem er sich als ihr Diener vorstellt.
Der zweite Teil (7 b) kann also als Wiederholung desselben Begriffes vom ersten Teil (7 a) angesehen werden.
Satz 8: Rusa=ni anijardunulini Hier soll wieder ein Nominalsatz vorliegen, wo semantisch nochmal dasselbe bekräftigt wird. Die
Morphologie von anijardunulini - eine neue Weiterbildung von anijarduni - ist mir unverständlich.
Satz 10: al~e ini DUB-te tu=le I mei arbi uruliani dUTU-ni=kai (= Siuini=kai) Diese Inschrift bietet Neuheiten bis zur letzten Zeile, denn nach dem mehrmals bezeugten ersten Glied,
,. Wer diese Inschrift zerstört (od. austilgt)«, folgt hier eine verkürzte Variante des von Benedict43 unter Nr.8 (final statement) verzeichneten Fluches: dUTU-ni pene mei arbi uruliani mei inaine mei nara auie ululie.
38 Zum Morphem /ni/ in dieser Position cf. zuletzt G. Wilhelm, ZA 66, 1976, II3 c. n. 36. 39 Die Ergänzung IRu[-sa-a) von M. de Tseretheli, RA 45, 1951, 197 (nach ihm MelikiSvili) wird
nun gegen IRu[-sa-se) von König (nach C. F. Lehmann[-Haupt), SPAW 1900, 631 und ZDMG 48, 19°4,834 Z. 15: ana-ku mRu-sa-Je) durch ein jüngst östlich von Kelisin gefundenes Duplikat, das noch in Bearbeitung ist, bestätigt. In der Tat hätte' nämlich das urartäische Ergativ-Suffix -Je in der, assyrischen Fassung wenig Sinn, zumal hier die urartäische Entsprechung den ni-Kasus bietet!
40 Benedict, UPhM 190 ff.; Melikisvili, USpr. 68 f. 41 Diakonoff, HuU 96. 98. 42 Cf. Goetze, ZA N. F. 5, 1930, 162: aniia-?arduni manu ,.der in Unbotmäßigkeit verharrte«;
ders., RHA 24, 1936, 268 »independent (?) «; Friedrich, ArOr 4, 1932, 64, etwa .. feindselig, untreu «, ders., ZDMG 47, 1940, 196 «unbotmäßig?, unabhängig?«; Melikihili, USpr.79 "unabhängig, selbständig (?) «; Diakonoff, HuU II5 ,.sich feindselig zu machen anfangend, sich als Feind erweisend«.
43 JAOS 81, 1961,385.
MIRJO SAL VINI
mei arbi uruliani ist seit Goetze RHA 22 (1936) S. 193 als Verbotssatz aufzufassen. Für eine übersetzung dieses Teiles, sowie des ausgedehnten Fluches, reichen unsere heutigen Kenntnisse nicht aus. Es ist jedenfalls zu notieren, daß unsere verkürzte Variante - freilich bei einer abweichenden Wortstellung - dUTU-ni.kai "vor der Sonne« statt dUTU-(ni).pene »unter der Sonne" bietet.
ÜBERSETZUNG
Es folgt hier zum Smluß der Versum einer zusammengehörenden übersetzung, und zwar nam der oben auf Tabelle I gebotenen strukturellen Einteilung des Textes.
I. Rusa, der Sohn des Sarduri, sprimt: 2. im habe hier (folgende) Opfervorsmrift (?) festgesetzt. 3 . . Wenn die Könige (d. i. die urartäischen) einen Feldzug unternehmen, soll man
ein Rind und ein Schaf an Sebitu smlamten, (ferner) ein Smaf an Ar~u'arasau (und) ein Smaf an das »Tor des Sebitu«.
4. Bei Neugründungen (??) soll man ein Smaf an Sebitu smlamten. 5; Wenn etwas (= ein Teil?) am(?) susi-Tempel verfällt/zerstört wird, soll man
(dasselbe Opfer ?) mamen, es soll (aber) kein esime# (und) elmuse sein/stattfinden. 6. Wenn ein Kultgefäß (??) neu hergestellt wird (??), soll man ein Smaf an Sebitu
smlamten. 7. Rusa (ist) Diener des Sebitu (und) Sebitu gegenüber (ist er) ein Vasall(?). 8. Rusa ... Vasall(?). 9. Rusa, der Sohn des Sarduri, sprimt:
IO. Wer diese Insmrift zerstört, möge vor der Sonne ... ni mt ...
Rom Mirjo Salvini