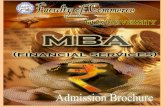Cichy 2015 - Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum - Reichmann FS
Transcript of Cichy 2015 - Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum - Reichmann FS
ffeeäseF? s"ä$ä fä3 r C äx rä sä*6"* fu ffi e ü eäx syeam äe
xv.ßY'ß &5, fi efu u a"äs*ag
i:Y:W.:.!,,i.4:1:e:.ta-t,t .::, .. . , aw#2.;t):::a . . . ::.. :5#t!;#:# .. ..:.:i
. lvt. u '"; P.1dh7. ": :"" :--",'f-ä -- ,*.ä 'r'-
-j 6Yi4';4
'i" p,.*Tffi
4' 'E;"' j
irl.+.r't ijri,r ', "b; ".:.- .".i:1:;.:.'J r,&'J r,;&
t: i r. +::-*-, -4*: --"stz
. ! : 'i::t::. :-::.".' -- . ; ".,t::rj
:. L...:": A
%
W* .*:
oP . ^& **.
,,.,...:..i;a.i:r,:,f.?j.1,:i.l::i::rttEi*.äL.:r;l;
$: x * .\€e*-<=: s=i s:-€ s
Eva Cichy
lm November 201O fand ein ehrenamt-licher Mitarbeiter der Außenstelle Olpe derLWL-Archäologie für Westfalen im Bochu-mer Ortsteil Stiepel auf einer Celändeterrassenördlich der Ruhraue, einer typischen Sied-
lungslage in der Kaiserzeitl, eine fragmen-
Lierte Marsstatuettd (Abb. l und 3.1). Weiterekaiserzeitliche Funde sind von dieser Stellebisher nicht bekannt geworden. Die nächs-
Äl-:s =*= R-r:*se:,:s *=E *{j={=*n.r
ten bekannten kaiserzeitlichen Fundstellenliegen mehr als 4km entfernt im BochumerStadtgeb iet3, d ie bedeutende spätkai serzeit-liche Siedlung von Bochum-Harpena befin-det sich etwa 10km nordwestlich. lm Ruhr-gebiet - und damit auch in Bochum - sinddurch die industrielle Überprägung zahlrei-che archäologische Fundstellen zerstört oderunzugänglich; allerdings ist gerade für
2cm
Abb. 1: Mars-Statuettenfrag,ment aus Bochum (Foto: A. MuttrilLWL)
L MrnsclrNz 12013:23)2Arnsberger Kennziffer 4509,168 (im Folgenden AKZ genannt); Aufbewahrungsort beim Finder. Dem Finder
Ch. Hrnr (Bochum) sei für die Möglichkeit einer ausführlichen Dokumentation und Veröffentlichung des Stücksherzlich gedankt. Vorberichte zum Fund siehe ScHueERr (201 2); MrnscHeNz (201 3: 112); Für anregende Diskussionenund Hinweise danke ich R. FaHB, P. KöreunNN und M. Zrrrec.
3 AKZ 4409,54: Siedlungsscherben der frühen Kaiserzeit, die bei Bauarbeiten in den 1 970er Jahren zutage kamen(Archiv AS Olpe, LWL-Archäologie für Westfalen); AKZ 4509,35: Siedlungskeramik der älteren RömischenKaiserzeit aus einem Einzelgrubenbefund, der bei Straßenbauarbeiten im Bereich des Universitätsgeländes 1 971
zutage kam (EccrNsrrrN 2OO2:290); Brn<e (2009: 43); MrescreNz (2O13:182).4 AKL4409,10116141 ,B*.rc(2OO9:37-39); MrescurNz (2O13:180-181)mitälterem Schrifttum
Eva Cichy I Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum S 77
ss
Bochum eine Häufung kaiserzeitlicher Fund-
stellen feststellbars. Diese ist natürlich durchdie verkehrsgeographisch günstige Lage inder Hellwegzone zu begründen6, sicherlichaber auch durch die langjährige Forschungs-täti gkeit Karl Bn,qNorsT.
Der Fund ist von einer gleichmäßigen,grünlich schimmernden Patina mit kleinenkraterähnlichen Läsionen überzogen, noch4,7cm hoch und wiegt etwa 11g. Eine
Röntgenuntersuchung zeigte, dass er massivgegossen, lunkerfrei und nicht vollständigdurchkorrodiert ist. Es war ein intakterMetallkern erkennbar, der am rechten Bein-stumpf freiliegt und dort metallisch glänzt.Eine Röntgenflou reszensanalyse (RFA) ergabeine Blei-Zinn-Bronze mit hohem BleianteilB.Dargestellt ist eine unbekleidete, männlicheFigur mit waagerecht erhobenem rechtenund herabhängendem linken Arm. VonArmen und Beinen sind jeweils nur Stümpfeerhalten. Cut erkennbar ist ein hoher korin-thischer Helm, dessen Helmbusch jedochbereits antik abgebrochen ist. Details anCesäß, Scham, Cesicht, Haar und Helm sindteils plastisch im Cuss angelegt, teils durchNachbearbeitu ng entstanden. I nsgesamt fal lt
die eher grobe Machart zum Beispiel derKopfpartie auf, die dreidimensional wenigdurchgebildet und ausschließlich auf Fron-talansicht angelegt ist.
Die Statuette zeigt Mars als nackten undbartlosen Jünglinge. Dieser Typus ist vorallem in Callien und den benachbartenCrenzprovinzen des lmperiums im 2. und3. Jahrhundert verbreitetl0. Mehrfach sinddiese Stücke mittlerweile als Votivgaben in
Heiligtümern in der Belgica, wie beispiels-weise im Bereich des Tempels Auf demSpätzrech bei Schwarzenbach (Kreis St.
Wendel)r1 belegt. Aus dem Tempelbezirk vonDhronecken (Kreis Bernkastel-Wittl ich) sindsieben Statuetten bekanntr2; aus einem ver-muteten Tempelareal von Kruishoutem (Bel-
gien), etwa 25 km südwestlich von Cent,stammen 27 Statuetten, die vermutlich lokalproduziert wurdenl3. Der Bochumer Marslässt sich dem für die dortigen Funde vonRoccr & Venrr.reurrN & MoeNs definiertenTypus ,,von einer eher minderwertigen Qua-liIät" zur Seite stellen, unter dem sich mitunserem Stück nahezu identische, nicht so
stark zerstörte Parallelen finden lassenla.
5 M. MtBscrrNz spricht von einem ,,ausgeprägten Cluster kaiserzeitlicher Siedlungen" im Raum Herne - Bochum:MrascHrNz QO1 3 : 22), Fu ndstel len siehe Kata lognu nrrnern 49-55.
{'Zur Frage des kaiserzeitlichen Hellwegs siehe Cnurrrn (2001 : BB), EccrNsr-erN (2OOBa); RrcHvr,NN (2OOB 77-78);Prrprn (201 0: 114-116); Kvnrrz (2014: 179 182) mit älterem Schrifttum
/ Bn,cr\or | 997: 97 -1 42)8 Röntgenuntersuchung und Röntgenfraktionsanalyse-Analyse (RFA) durch E. Müscr, Zentrale Dienste der LWL-Archäologie für Westfalen Cerät: Niton XL 3t980, Messmodus: Metalle- Legierungen/ Standard/niedrig/leicht.
e NEucre^,!e H ('l 942); BoucrEB (1976: 132-134)l0 Trierer Raum: MrNzrr (1 966: B-10); F,qusr (2OOO); Niederlande: Zaoors-Josrrrus Jrrra rr ru. 11967: 40-55); Z,o,ooxs-
JcrsreHus Jtrra er.a,t (1969: B0-89); Znuoxs-Josrerus Jrrr,r rr * (1973 'l 4-15); Belgien: Fr,rore-FryrmrNs ('l 979:52-58); Roccr & VpnururrN & MorNs (1995).Zur Datierung siehe MrnscrgNzl2Ol3:113) mit weiterführendemSchrifttum
r1 Br*crn (2O12:235), vor allem Anmerkung 49I F,qusr (2000: 263)
rr Rcrccr & VrnvrurEN & MoeNs (1995.206)ro Roccr & VrnurureN & MorNs (1995: 195, Abb. 3, 1-5). Man erkennt ebenda, dass die weiteren Attribute (Lanze
und Schild) wohl separat gearbeitet waren und nahezu immer verloren gegangen sind. Nachweise für eineBefestigung auf Sockeln fehlen, auch wenn viele Exernplare unter dem rechten Fufl einen Befestigungszapfenaufweisen.
7B S Eva Cichy : Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochurn
sss
Diskutiert wird, ob es sich bei römischem
Fundgut der mittleren und späten Kaiser-
zeit rechts des Rheins um das Resultat
von Beutezügen, regelrechtem Handel, um
Ceschenke oder Tributzahlungen handeltund inwiefern die StLicke darüber hinausnoch durch innergermanischen Austausch
weitervermittelt wurden15. lm konkreten Fall
der Bronzestatuetten, die keinen unmittelbarerkennbaren inhärenten Nutzen zu haben
scheinen, stellt sich die Frage nach deren
Verwendungszweck im Barbaricum vorallem dann, wenn man bedenkt, dass hierandere provinzialrömische Metallobjektewie beispielsweise Cefäße schlicht ver-schrottet wurden, was nicht verwundert, da
im Vorfeld der Cermania lnferior nach wievor ein Nachweis für eine eigenständigeBuntmetallgewinnung in der mittleren und
späten Kaiserzeit fehlen, die ansässigen Cer-
manen also zur Deckung ihres Rohstoffbe-
darfs auf Material römischer Herkunft ange-
wiesen warenr6. Eine rituelle Weiterverwen-dung von Statuetten provinzialrömischenUrsprungs wird dennoch in vielen Fallen inBetracht gezogenrT.
Für zumindest einen Teil des Materialsder metallreichen Fundkomplexe im Lippe-
und Hellwegraum des im späten 3. und frü-
hen 4. Jahrhundert wie zum Beispiel Kamen-
Westick (Kreis U nna), Castrop-Ra uxellZecheErin (Kreis Recklinghausen)rB oder Bochum-Harpenle ist der Beutegutaspekt durchausnachvollziehbar. Sicher spielten die Hell-wegtrasse und das daran anschließende, ins
lnnere der Belgica und Calliens führendel(unststraßennetz (Abb. 2)eine Rolle im Rah-
men eines grenzüberscheitenden Handels,
über dessen Umfang man streiten mag. Aufl<einen Fall sind sie aber ausschließlich als
Wege des friedlichen Verkehrs zu verstehen,
sondern auch als militärischer Bewegungs-
raum20. Ab der Mitte des 3. Jahrhundertskommen als Nutzer auch und gerade ger-
manische Kriegerverbände in Betracht, deren
Raubzüge links des Rheins vielfach historisch
und archäologisch belegt sind21 und deren
Beutegut nicht ohne Einfluss auf das Fund-
bild im Hellwegraum geblieben sein dürfte22.
Als beim Transport verlorengegangenes Beu-
tegut interpretierte Fundkomplexe aus dem
Rhein bei Neupotz (Kreis Germersheim) und
Hagenbach (Kreis Germersheim) enthaltenFundmaterial, das mit hoher Wahrschein-lichkeit aus dem lnventar von Heiligtümernstammt, des weiteren kann man etliche inder Bed rohungssituation angelegte Verwahr-
horte mit Tempelinventaren anführen23. Die
r5 RrrcrnnNN (2008); Eerr -7przxu.s (2008); Ecce NsrrrN (2008); P rpe n (2010: 11O-112, 118-125); MrBscHrNz (2013:
10-11 ,79,117-118); RrcH,v,qNr (2014:71-76); l(vrrrrz( 2014:158 161,175-176)l6 B,quvrrsrrn (2OO4:94-101); Kvnrz QO|4: 148-162) mit älterem Schriftturn; zu weiteren Hinweisen auf Metallre-
cycling in Siedlungen des Ruhrgebiets siehe MrnscHrNz (20-13: 41-42); Kvp.ttz (.2O14: 171-191) mit Abbildung 9,
Fußnote 694 und Liste 2r7 SrupprnrcH 11995 67); CRr-rNEw,a.ro 11999: 47); Prrprn(2010: 1 38)rB Münsteraner Kennziffer 4109,39 (im Folgenden MKZ genannt), M nscrrNz (201 3) mit älterem Schrifttum1e AKZ 44Og,1Ol1 6/41 , Brnr<r (2009: 37-39); MtnscrrNz (2013:. 180-181) mit älterem Schrifttum20 Cnarrrrn (2001 : 86)2rBLrcxu,rNN (2009); KLTNzL (2009); besonderszu Niedergernranien siehe HrtNrertrc (2006); Rrrcru,qNN (2014: 51-61)22 So finden sich im Fundrlaterial aus Kamen-Westick (Kreis Unna) zum Beispiel auch zahlreiche Bruchstücke von
Buntmetallgefäßen wie beispielsweise ein Halbdeckelbeckenfragment, vergleiche hierzu EccrNsrerN (2008: 40 -eine markante Fundgattung, die gerade auch im Fundkomplex von Neupotz (Kreis Cermersheim) in großer Zahl
vertreten ist, vergleiche KuNzL (2002: I1B); MrrrrNrn (2008)23 KrtNzr (2009); Prrnovszrv (2009) mit älterem Schriftturn, wie Sruppprnrcr (2006: 218) treffend feststellte ,,scheint
man nun (ab dem 2. Viertel des 3. Jahrhunderts) vermehrt Ceschmack an derAusraubung von Heiligtümern ge-
funden zu haben".
s79sss\s
Eva Cichy Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum
\J.a\l\\l-N rJnrrge
i,lI\
-...--.,. -t'-"-'\,t'ii" i: i
-'*,--- *u'""e9Q$1"
i.ld-celllp.:i
Vermutung, dass die Marsstatuetten als un-mittelbares Beutegut aus gallischen Marshei-ligtümern stammen, in welchen diese Stückebei Beutezügen schnell in Massen eingesam-melt werden konnten (und damit trotz ihresgeringen Gewichts aufgrund der schierenMenge einen Metallwert besaßen), scheintdementsprechend möglich. lhr gehäuftesVorkommen in spätkaiserzeitlichen Kontex-ten im Barbaricum muss im Zusammenhangmit den restlichen Metallfunden provinzial-römischen Ursprungs betrachtet werden undhangt vielleicht weniger mit der,,langen Ver-
wendungsdauer und hohen Wertschät-zung//24 der Statuetten als solche zusammen,sondern vielmehr mit gewaltsamen Zugriffs-möglichkeiten auf provinzialrömischesTempelinventar, die in dieser Form vor dem3. Jahrhundert n. Chr. noch nicht bestanden.
Die Statuette aus Bochum Stiepel ergänzteine bereits von R. Srupprnrcu herausgestellteReihung von Funden (Abb. 2) im ,,sonst sehrperipheren Ruhrtal"2s. Alle jetzt vier Mars-statuetten der Region26 sind von geringerCröße und eher minderer Qualität. DerFund aus Breckerfeld (Kreis Ennepe-Ruhd
*! r.
Köln .'iat"t
-'"r--"iiiB!nn. :1r :i
Abb. 2: Kartierung der Fundplätze von Mars-statuetten im Hellwegraum (R. FauB)
2a MrnscHrNz (2013: 113)2s Srupprctcu (1980: 20 und Verbreitungskarte 5). MrnscHeNz (2o13:34\ wirft die Frage auf, inwieweit die Ruhr als
wasserstraße nicht doch eine Rolle als wegeverbindung in der Kaiserzeit gespieli hat.
'z6 Anzuschließen ist diesen nahezu vollständigen Stücken eventuell noch ein Kopffragment, das als Lesefund imBereich der Siedlung Soest-Ardey gefunden wurde. Auf dem unbärtigen Kopf ist ebänfalls ein korinthischerHelm erkennbar, vergleiche Benr<e (2009: 78) mit älterem Schrifttum.
B0ss€*
Eva Cichy : Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum
(Abb.3.2) ist mit einer Höhe von 10cmetwas größer und einem Cewicht von 709deutlich schwerer als der Bochumer Fund,
auch ist die Kopfpartie deutlich plastischer
ausgeführt27. Aus dem umfangreichen, einen
langen Zeitraum abdeckenden Metallfundin-ventar aus Kamen-Westick sind bislang zweiExemplare bekannt2s. Die eine Statuette, ein
Oberflächenfund, ist erwa 6,2cm hoch und
ähnelt sehr stark dem Bochumer Fund2e,
. 1 crn.
Abb.3: Die westfälischen Mars-Statuetten im Überblick: 1: Bochum-Stiepel (H. MrNN;/LWL)
2: Breckerfeld (aus Brlxr 2009, Taf. 53,1.), 3: Kamen-Westick, Oberflächenfund(5. BnrNrrünnrn/LWL), 4:Fttnd aus der Grabung in Kamen-Westick (H. MrNN;/LWL).
27 AKZ471O,B9, AufbewahrunBsort beirn Finder. Die Statuette wurde 1989 von C. BEncrrrr beim Aushub des Fttn-
daments einer Cartenlaube in Breckerfeld gefunden: Brrrcrre (199.1 ); KurrLsonn (2007: l4); Brnrr (2009: 55). Als
einziger weiterer kaiserzeitlicher Fund aus der Umgebung ist der in 3 km Entfernung zutage gekommene römische
Mr,inzschatzfund bei Breckerfeld-Bühren (Ennepe-Ruhr-Kreis) bekannt. Der 15 Münzen umfassende Schatzfund(Schlussrrünze Mittelerz Trebonianus Callus 251/253) war arn Rande eines Hohlwegs vergraben, vergleiche
BrHre (2009: 55). Die Fundregion liegt abseits der vermuteten Zuwegungen vom Rhein zum Hellweg, vergleiche
CnürrEn (2001 : 89 91).)B
^KZ 4411 ,4. Zum Fundplatz Karnen-Westicl<: MrnscrrNz 12013: 45 56) mit älterem Schrifttr-rm. Beide Funde
werden zur Zeit im Rahmen eines Dissertationsprojel<tes an der Ruhr Universität Boclrum von P. KoNr,v,qNN unter
clern Arbeitstitei ,,Die Buntrretallfunde von Kamen-Westick: Eine Str-rdie zu Metallimporten, Umgang mit Metall
uncl Recycl ing" bearbeitet.2'r Das Stück kam als Sondenfund bei den jährlichen Begehungen des ehrenamtlichen Mitarbeiters Ulrich Nrrv'tNtr
zutage: EccrNSrr N (2008: ,tbb. 34); ScHL-rett<t (2012); M r<scrrNz (2013: 112, Abb. 29).
S81
=S
Eva Cichv : Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum
jedoch sind Helmbusch, Arme und Beineetwas besser erhalten (Abb. 3.3). KontextloseLesefunde wie diese drei Stücke tragenjedoch zum Verständnis der Statuetten imBarbaricum weniger bei als die im Folgenden
aufgeführten stratifizierten Funde. Das zweiteetwa 6,.1 cm hohe Stück aus Kamen-Westickrepräsentiert eine andere Variante desjugendlichen Mars (Abb.3.4) 30. Es zeigtjedoch eine gegenüber den anderen dreiFunden andersartige Cestaltung von Brust,
Nabel und Ceschlecht3l; darüber hinauswirkt es insgesamt etwas gedrungener. DieserFund ist als einziger der hier aufgeführtenregionalen Vergleichsfunde bei einer Cra-bung zutage gekommen. Er stammt aus
einem Crubenkomplex, der mögl icherweiseim Zusammenhang mit metallverarbeitendenTätigkeiten steht32. Der Fundkontext ausKamen-Westick scheint anzudeuten, dass
das Stück zumindest zum Zeitpunkt seinerNiederlegung nur noch den Charakter einesAltmetallgegenstandes besaß33. Aus einem
ähnlichen Kontext stammt ein Fund aus derSiedlung des 2.13. Jahrhunderts von Wester-hammrich (Kreis Leer), eine ebenfalls starkkorrodierte mögliche kleinformatige Mars-Statuette. Diese lag zusammen mit Ofenkup-pelbruchstücken in einer Ofengrube, im Um-feld fanden sich kleine Schmelztiegel undPartikel von Bronzeschmelz3a.
Eine Amor-Statuette aus Bad-Salzuflen-Wüsten (Kreis Lippe) wurde früher ebenfallsals Siedlungsfund angesehen. Der Fundzu-sammenhang ist jedoch wohl nicht eindeutig
- sie scheint nicht unmittelbar aus der Sied-lung zu stammen, sondern in einer altenWegespur gefunden worden zu sein3s.
Weitere Statuettenfunde mit sicheremFundkontext stammen aus verschiedenenHortfunden wie zum Beispiel dem in das4. bis frühe Jahrhundert zu datierenden Kom-plex aus Beelen (Kreis Warendorf)36, dem indie 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts datiertenHort von Marren (Cemeinde Lindern, Kreis
Cloppenburg), in dem unter anderem auch
30 Der Fund kam bei Crabungen in Kamen-Westick von 1998-2001 zutage: HöMBEsc (2001); EccrNsrrrN(2008: Abb. 35); M nscrrNz Q013: 112), die von MrnscrrNz für das Stück sowie die zweite Marsstatuette ausKamen-Westick angeführten Reparaturspuren im Halsbereich sind für die Autorin nicht erkennbar. Eisenoxydresteam rechten Fuß der Statuette werden von Ha;ueenc (2001) mit einer ehemaligen Befestigung des Stücks inZusammenhang gebracht. Wahrscheinlicher ist die Lagerung des Stücks unmittelbar an einem Eisenobjekt alsErklärung für diese Korrosionsreste, denn bei einer Befestigung eines Stücks aufeinem bronzenen Sockel (die inWestick ebenfalls vorkommen) dürfte Eisen nicht zum Einsatz gekommen sein.
ri Eine vergleichbare Cestaltung weisen Funde aus dem Trierer Raum auf: MrNzrr (1966: 9, Nr. 18 und 19).12 Der Crubenkomplex lag abseits der eigentlichen Siedlungsbefunde. Aus der Verfüllung konnten Schlackestücke,
mehrere Keramil<scherben, ein Nagel sowie weitere unbestimmte Eisenfragmente geborgen werden (Crabungs-dol<umentation Archiv AS Olpe, LWL-Archaologie für Westfalen).
ir MtnsclrNz(2013:113) sprichtsichgegeneineVerwendungderFigurenimMetallrecyclingaus,dadasmetallischeProfil diesem entgegenspräche. Da die Stücke häufig einen hohen Bleianteil aufweisen, sei eine mechanischeBearbeitung in Kaltarbeit nicht gut möglich. Cleichwohl lassen sich aus den eingeschmolzenen Figuren andereCegenstände gießen. Auch in anderen als Metallhort angesprochenen Ensembles sind Cegenstände mit einemhohen Bleiwert in der Legierung vorhanden und nicht aussortiert worden (vgl. z. B. B,ccHN4nNN ('1993: 14S);Rrrornrn (1 993).
ra BAneNrANcrn (1 998: 60, Abb.2); BAnrNrANcrn 11999:41-42)j5 SrupprBrcr (198O: 2O, Nr. 246, 95); BrBxr (2009: 1 51)j6 ln einem Topf fanden sich eine 'l 1cm große Merkurstatuette, ein goldener Ohrring, sechs Silberringe
und zwei bronzenen Orakelstäbchen: MrnscrrNz (2O13:11 2) und Brer<r (2009: 235) mit weiterführendemSchrifttum.
82sss
Eva Cichy ! Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum
zwei (allerdings viel qualitätvollere) Mars-
Statuetten vertreten sindlT oder auch aus den
niederländischen Fundensembles von Hoge
Loo, (Cemeinde Emmen, Provinz Drenthe/NL)
und dem von Ede-Veldhuizen (Provinz Cel-derland/NL), aus einem gertnanischen Sied-
lungskontext der späten Kaiserzeit3B. DieNiederlegung in einem Hort allein bietet na-
turgemäß Spielraum für unterschiedliche ln-terpretationen, wenn nicht eindeutige wei-terführende Hinweise das Fundbild ergän-
zen. Für das Fundensemble von Ede-Veld-
huizen fuhrt Marjan Calestin zum Beispiel
an, das die Funde sowohl Ergebnis einer ri-
tuellen Deponierung als auch einer gewöhn-lichen Entsorgung von Objekten sein könn-ten, die ihre religiöse Funktion verlorenhaben:re, wobei er die Frage offen lässt, wannund unter welchen Umständen sich letzterer
Vorgang vollzog. Die Stücke von Beelen und
Marren werden wegen der Fundvergesell-
schaftung mit Orakelstäbchen beziehungs-
weise wegen der Deponierung unter einemHügel innerhalb eines Steinkreises als Wei-hefund i nterpretiert4o.
Ein Crabzusammenhang kann für einen
Altfund aus Ceorgsmarienhütte-Holzhausen(Kreis Osnabrück) angenommen werden -die bronzene Merkurstatuette kam imBereich früheisenzeitl icher Crabhügel zutage
und ist eventuell mit einer kaiserzeitlichenNachbestattung in Verbindung zu bringenal.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass Statuettenfunde im Barbaricum in sehr
unterschied I ichen Fundkontexten vorkom-men. Allen Funde gemeinsame Deponie-rungsumstände sind nicht ohne weitereserkennbar, ebenso wenig lässt sich eine ein-heitliche Art der Nutzung erschließen. ln
Einzelfällen sprechen die Fundumstände da-
für, dass die Stücke als Altmetall angesehen
wurden, andere Kontexte legen nahe, dass
den Statuetten als solchen ein Wert zu-erkannt wurde. lnwiefern damit rituelleAspekte verknüpft waren und ob damit tat-
sächlich auch inhaltlich eine ldentifikationmit einer Cottheit einherging, muss dahin-gestellt bleibena2. Ein wichtiger Cesichts-punkt scheint zu sein, dass die Funktion sich
womöglich mehrfach geändert haben kann,
st Der Schatzfund beinhaltet außerdem eine weitere Statuettenbasis mit Inschrift, einen eisernen Dolch, eine Lan-
zenspitze, ein silberner Orakelstab, eine bronzene Phalera in Löwenkopfform, einen Beschlag in Form eines
Creifenkopfes sowie wohl ebenfalls dazu gehörend, wenn auch später entdeckt, eine Larenstatuette. Aufgrund
der lnschrift auf der Statuettenbasis ist zumindest für dieses Fundstück eine Herkunft aus Cermania Superior oder
der Belgica wahrscheinlich - ebenso wird für die Marsstatuetten postuliert, dass sie aus diesem Raum stammen:
FnaNxe (1991), v. Car<Nrp-BoBNHrtu (1999:. 27-29); CnüNrw,r.ro (1999: a5).i8 CarrsrrN (2000)
re CxrrsrrN (2000: 150)a0 CrlBrr, (1995); CeuNrw,cn (.1999,47). Srupprnrcr (l9BO: 20) disl<utiert für beide Befunde auch eine mögliche
Ansprache als Material eines Schmiedes.
" S . ppr r,, r ( l9B0: 20, \r. I I l, bB)a2 Dass im Barbaricum fraglos ein lnteresse an bildlicher Darstellung vorhanden war, belegen Tonfigurenfragmente
aus Dortmund (Silberstraße und Schwieringhausen). Die Cruppe aus Schwieringhausen kam 1988 in einem kai-
serzeitlichen Siedlungsareal zutage und wurde lokal gefertigt, vergleiche Ponarr r (1 990: 74-78); Fundchronik(1988); MLnsclrNz (2013: 183). ln Cröfle und Proportionen erinnern sie an kleinformatige, provinzialrömische
Statuetten aus Kupferlegierung (vor allem das Fragment auf Abb. 2, oben links in Fundchronik (1 9BB) ähnelt be
züglich derArmhaltung den im Text besprochenen Mars-Statuetten) und erfüllten möglicherweise eine ähnliche
Funktion. Vergleichbares ist aus dern Barbaricum nicht bekannt - die bekannten stark stilisierten menschenge
staltigen glermanischen Cötterdarstellungen sind stets aus Holz gefertigt, vergleiche SpcrrpvnNN (l995:122-125)und Marrn QO03:92-93) mit weiterführendem Schrifttum.
Eva Cichy i Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum S 83
ss*
nachdem das Stück durch Handel, Beute Bochum-Stiepel mit ihren direkten Parallelen
oder unter anderen Umständen ins Barbari- in der Callia Belgica. Es ist zu hoffen, dass
cum gelangt ist. Diese Umstände lassen sich durch weitere Funde der Kontext der Statu-
aufgrund von Funden größerformatiger, qua- ette aus Stiepel, welche der der Forschung
litätvoller Statuetten möglicherweise schlech- nur durch die planmäßige Zusammenarbeitter erschließen als durch potentiell häufiger von Bodendenkmalpflege und ehrenamt-zu findende schlichte Massenartikel wie lichen Mitarbeitern bekannt geworden ist,
die Funde aus Westick, Breckerfeld und erweitertwerden kann.
Sch riftenverzeichnis
B,rcHraaNN, H.-C. (1993): Analyse ausgewählter Metallartefakte; in: KrrrNrn, H. J. & ZlHrH,r,rs, C. (Hrsg.): Derrömische Tempelschatz von Weißenburg in Bayern, S. 147-159; Mainz
BAnrNrANcen, R. (1998):,,Mars" an der unteren Ems; in: Archäologie in Niedersachsen, 1, S.59-61;Oldenburg
BAnrNrANcrn, R. (1 999): Hinweise auf Handel und Handwerk der Kaiserzeit an der unteren Ems; in: FeNse,
Mamoun (Hrsg.): Über allen Fronten - Nordwestdeutschland zwischen Augustus und Karl dem Croßen(Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 26), S. 39-44; Oldenburg
Bnur.rrsrre, M. (2004): Metallrecycling in der Frühgeschichte; Untersuchungen zur technischen, wirtschaft-Iichen und gesellschaftlichen Rolle sekundärer Metallverwertung im 1. Jahrtausend n. Chr. (Würzburger
Arbeiten zur Prähistorischen Archäologie, Bd. 3); Rahden/Westfalen
Benr<r, S. (2009): Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Deutschland, Band 7:
Land Nordrhein-Westfalen, Landesteile Westfalen und Lippe; Bonn
Brecru,+.NN, B. (2009): Die Cermanische Bedrohung im dritten Jahrhundert nach Christus - Die Bildungneuer Croßstämme im Lichte der schriftlichen Quellen; in: Konflikt- 2000 Jahre Varusschlacht; S. 192-202;Stuttgart
BrrrcHrn, W. (1991) Die Marsstatuette von Breckerfeld; in: Hohenlimburger Heimatblätter, Heft 52,
5.225-229; lagen
BoucHen, S. (1976): Recherches sur les bronzes figur6s de la Caule pr6romaine et romaine (Bibliotheque des
Ecoles francaises d'Athenes et de Rome, n" 228\; Paris, Rome
Bu.Nor, K. 1997\: Bochum - aus der Vor- und Frühgeschichte der Stadt (Beiträge zu Archäologie und
Ceologie in Rheinland und Westfalen; Bd. 5); Celsenkirchen
Buncrn, D. (2012): Der gallo-römische Umgangstempel ,,Auf dem Spätzrech" bei Schwarzenbach(Lkr. St. Wendel) im Saarland - Ein Pilgerheiligtum für Mars Cnabetius und der Civitas Treverorum; in:
Archäo logisches Korrespondenzb I att, 42, S. 225 -243; Mai nz
v. C,rnNap-BonNHeru, C. (1999): Rom zwischen Weser und Erns; in: F,rNse, Mamoun (Hrsg.): Über allenFronten Nordwestdeutschland zwischen Augustus und Karl dem Croßen (Archäologische Mitteilungenaus Nordwestdeutschland, Beiheft 26), S. 19-32; Oldenburg
Eser-Zrrrzaurn, W. (2008): ZurArchäologie der römischen Kaiserzeit in der Hellwegzone,Ziele und Aufgaben;in: Vom Cold der Cermanen zum Salz der Hanse - Früher Fernhandel am Hellweg und in Nordwest-deutschland, S. BB-92; Bönen
EccrNsrrrN, C. (2002): Das Siedlungswesen der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und der frühen römischenKaiserzeit im Lippebereich (Bodenaltertümer Westfalens, Bd. 40); Münster
EccrNsrerN, C. (2008a): Der Hellweg als Handelsroute schon bei den Cermanen? in: Vom Cold der Cermanenzum Salz der Hanse - Früher Fernhandel am Hellweg und in Nordwestdeutschland,5.71-75; Bönen
84 S Eva Cichy i Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum
ss
EcceNsl N, C. (2008b): Handel, Handwerk und römischer Luxus - der gerrranische Siedlungsplatz Katnen-
Westick; in: Vom Cold der Cermanen zum Salz der Hanse - Früher Fernhandel arn Hellweg und in Nord-
westdeutschland, S. 23-51; Bönen
Farurn-Frvr,vaNs, C. (1979): Les bronzes romains de Belgique; Mainz a. Rheir-r
F,rusr, S. (2000): Figürliche Bronzen und Cegenstände aus anderen Metallen aus Stadt und Regierungsbezirk
Trier in Privatbesitz ll; in: Trierer Zeitschrift, Bd. 63, S. 263-306; Trier
Fn,rN<e , T. (1991): Neue Aspekte zum Votivfund von Marren; in: Archäologische Mitteilungen aus Nordwest-
deutschland, Bd. 14, S. 25-30; Oldenburg
Fundchronik 1988,66 Dortmund-Mengede; in: Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe 1990,
S.9l-93; Mainz
CarrsrrN, M. C. (2000): Ensembles of Roman figural bronzes from the Netherlands; in: Kölner Jahrbuch,
Bd. 33, S. 1 43-1 50; Köln
Crrnrc, U. (1995): Römische Bronzestatuetten; in: Buscl, R. (Hrsg.): Rom an der Niederelbe (Veröffent-
lichungen des Harburger Museums fLir Archäologie und die Ceschichte Harburgs, Nr. 74), S. '125-130;
Neumünster
CnüNer,varu, Ch. (1999): Ein silberner Orakelstab aus Marren; in: FaNse, Mamoun (Hrsg.): Über allen Fronten* Nordwestdeutschland zwischen Augustus und Karl derl Croßen (Archäologische Mitteilungen aus Nord-
wesrdeutsch I and, Bei heft 26), 5. 45 -47 ; O ldenbu rg
Cnr-rrren, H. Th. (2001): Römische Handels- und Heerstraßen in der frühen Kaiserzeit; in: Hoee, D. &Trr.r,r.rerrn, Ch. (Hrsg.): Die frühe römische Kaiserzeit irn Ruhrgebiet - l(olloquiurr des Ruhrlandmuseums
und der Stadtarchäologie/Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit der Universität Essen, S. 79-93; Fssen
Hrrvrernc, U. (2006): Cermaneneinfälledes 3.Jahrhunderts in Niedergermanien; in: Sreoren,J. (Red.): Ceraubt
und im Rhein versunken Der Barbarenschatz, S. 44-51; Stuttgart
Hor,rsrnc, P. R. (2001): ; in: Neujahrsgruß 2001, Jahresbericht für 2000, 4B-49; Münster
KurrLaonN, J. S. (2007): Breckerfeld; in: Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe, Bd. 10 -ArchäologischeBodendenkmalpflege 1 991 -1995, S. 14; Mainz
l(uNzL, E. (2009): Angsthorte und Plünderungsdepots Die Reichskrise des 3. Jahrhunderts n. Chr. aus
archäologischer Sicht; in: Konflikt 2000 Jahre Varusschlacht, S. 203-2.1 1; Stuttgart
Kvnrrz; D. M. (2014): Haffen-Mehr- Die Kontaktzone am niederrheinischen Limesgebiet (Online-Publikationen
an deutschen Hochschulen Bonn, Diss. Univ. Bonn); Bonn
URN: http://hss.ulb.uni-bonn.dc/201al-l6B'+/.36t)4-index.pdf (Stand 09.02.201 5).
Mn rn, B. (2003): Die Religion der Cermanen. Cötter Mythen Weltbild; München
MrNzrr, H. (1966): Die römischen Bronzen aus Deutschland, Bd. ll: Trier; Mainz
MrrHNrn, D' (2006): Die Ausgussbecken mit Halbdeckel; in: sratrren' J (Red ): ceraubt und irn Rhein
versunken Der Barbarenschatz, S. 101-102; Stuttgart
Mrnsr:Herz, M. (2013): Fließende Crenzen, Studien zur römischen Kaiserzeit im Ruhrgebiet (Bochurr-rer
Forschungen zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 6); Rahden/Westfalen.
Nrucrsaurn, K. A. (1 942): über einen gallorömischen Typus des Mars; in: Bonner Jahrbuch, Bd. 147,
S.228-236; Bonn
Prrpcrvsz<v, R. (2009):Hortfunde im Rhein, in: Konflikt 2000 Jahre Varusschlach, S.212-21 9; Stuttgart
Prreen, M (2010): Untersuchungen zum lmport von römischen Waren im mittleren Hellwegraum während
der Römischen Kaiserzeit; in: lmperium Romanum produxit römische Sachgüter in Soest und irn rnittleren
Hellwegraurn (Soester Beiträge zur Archäologie, Bd. 11), S. 105-1 64; Soest
Pon,r1r, A. (1990): Kaiserzeitliche Tonfiguren und ihre lnterpretation unter Anwendung der Röntgendiffrakti-
onsanalyse; in: ANonlsclr<o, F. M. & TecrN, W. R. (Hrsg.): Cedenkschrift für Jürgen Driehaus, S. 69-82;
Mainz
Eva Cichy i Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum S 85
=
Rrrc-Hr.raNN, C. (2008): Der Rheinhafen Celduba (l(refeld-Cellep) als Tor zum Hellweg; in: Vom Cold derCermanen zum Salz der Hanse - Früher Fernhandel am Hellweg und in Nordwestdeutschland,5.76-87;Bönen
RrcHr.r,rNN, C. (20.1 4): Römer und Franken arn Niederrhein; Mainz
Rrrornrn, J. (1993): Die Metallanalyse von Funden aus Silber und l(upferlegierungen; in: KüNzr, E. (Hrsg.):
Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz, S. 407-446; Mainz
Roccr, M.; VenururrN, F. & MorNs, L. (1 995): Ein bemerkenswerter Fund römischer Bronzestatuetten aus
Kruishoutem (Ostflandern); in: Archäologisches Korrespondenzblatt, Bd. 25, S. 193-207; Mainz
ScHueenl A. H. (2012): Doppelgänger gefunden; in: Archäologie in Deutschland 212012, S. 52; Stuttgart
Sercrenr.r.rNN, W. (1995): Cötter und Kulte in Cermanien zur Römerzei| in: Fn,rNzrrLs, C. (Hrsg.): Aspekte
römisch-germanischer Beziehungen in der frühen Kaiserzeit (Quellen und Schrifttum zur Kulturgeschichtedes Wiehengebirges, Reihe B, Bd. 1), S. 119-154; Espelkamp
SrueeenrcH, R. (1980): Rörnische Funde in Westfalen und Nordwest-Niedersachsen (Boreas Beiheft, 1);
Münster
SrueernrcH, R. (1 995): Bemerkungen zum römischen lmport im Freien Cermanien; in: Fn,+Nzrus, C. (Hrsg.):
Aspekte römisch-germanischer Beziehungen in der frühen Kaiserzeit (Quellen und Schrifttum zur Kulturge-schichte des Wiehengebirges, Reihe B, Bd. 1), S. 45-98; Espelkamp
SrueernrcH, R. (2006): Tempelschänder und fromme Stifter Römische Beute in germanischen Heiligtümern;in: Sr,rrrrn, J. (Red.): Ceraubt und im Rhein versunken * Der Barbarenschatz, 5.213-218; Stuttgart
Z,+oo<s-.Joserrus Jrrr,r, A. N; Pere ns, W. J. T. & v,qN Es, W. A. (967): Roman bronze statuettes from the Nether-
lands, l: Statuettes found North of the Lirnes (Scripta Archaeologica Croningana, Bd. l); Croningen
Z,roor<s-JosreHus Jrrn, A. N; Prrrns, W. J. T. & veN Es, W. A. (1969): Roman bronze statuettes from the Nether-
lands, ll: Statuettes found South of the Limes (Scripta Archaeologica Croningana, Bd. Il); Croningen
Z,o.oorsJosrerus Jrrn, A. N; Pr.rrns, W. J. T. & WrrrevrrN, A. M. (1973): The Figural Bronzes Description ofthe Collection in the Rijksmuseum C. M. Kam at Nijmegen; Nilmegen
86 S Eva Cichy ] Eine Marsstatuette aus der Ruhraue bei Bochum