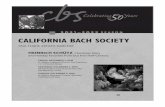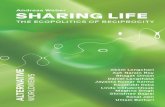Max Schiendorfer: Der Wächter und die Müllerin "verkert, geistlich". Fußnoten zur...
Transcript of Max Schiendorfer: Der Wächter und die Müllerin "verkert, geistlich". Fußnoten zur...
Contemplata aliis tradere
Studien zum Verhältnisvon Literatur und Spiritualität
Herausgegeben von Claudia Brinker, Urs Herzog,Nikiaus Largier und Paul Michel
PETER LANGBern • Berlin • Frankfurt a.M. • New York • Paris • Wien
MAX SCHIENDORFER
Der Wächter und die Müllerin »verkert«,»geistlich«
Fußnoten zur Liedkontrafaktur bei Heinrich Laufenberg
I
Mit "ca. 1390" bestimmt die Forschung üblicherweise das GeburtsjahrHeinrich Laufenbergs, womit wohl eher der spätestmögliche Zeit-punkt markiert sein dürfte.
Urkundlich begegnet Laufenberg freilich erst seit 1421, als er Kaplanund Vizepleban der Pfarrkirche Freiburg im Breisgau ist.1 In Frei-burg wird er auch geboren und aufgewachsen sein. 1424 kaufteLaufenberg in dieser Stadt ein Haus,2 das er neun Jahre später derFreiburger Münsterfabrik vermachte, und zwar zugunsten der vonihm selbst innegehabten Pfründe des St. Katharinen-Altars. Zu diesemZeitpunkt, also 1433, ließ Laufenberg sich in Freiburg allerdingsstellvertreten, da er selber nunmehr als Dekan des St. Mauritius-Stiftsim aargauischen Zofingen amtierte.3 Der Zofinger Dekan rekrutiertesich nicht, wie man gelegentlich liest, aus dem Zwölferkreis der Chor-herren, und er fungierte auch nicht als Stellvertreter des Propstes und
Vgl. Peter Albert: Urkunden und Regesten zur Geschichte des Freiburger Mün-sters, Freiburger Münsterblätter 7, 1911, Nr. 411 (24. Mai 1421) und Nr. 446(5. August 1421).
Ebd., Nr. 462 (1. August 1424); der Verkäufer hieß Konrad Swederus, dasHaus 'Zum Pfannenberg', und der Kaufpreis betrug 9 Pfund zuzüglich l Pfundjährlichen Zinses.
Vgl. J. König: Der Dichter Heinrich Loufenberg, Kaplan am Münster in Freiburgund Capitelsdecan (1429-1445), Freiburger Diözesan-Archiv 20, 1889, S. 302-307, hier S. 302: "Nach einer Urkunde vom 16. Juli 1433 (Archiv der Münster-fabrik) war der Dichter in dieser Zeit Decan des Collegiatstiftes in Zofmgen(Kanton Aargau) u n d Kaplan der St. Katharinen- (oder Rohats-) Pfründe amMünster in Freiburg." Dazu merkt König an: "Nach derselben Urkunde vergabteLoufenberg an die Münsterfabrik das Haus 'zum Pfannenberg' neben dem Haus'zur schwarzen Leiter'." (Mit angesprochen ist hier offenbar das zwecks Lokali-sierung herangezogene Nachbarhaus). Die von König registrierte Urkunde befin-det sich heute nicht mehr im Archiv der Münsterfabrik; vgl. Heinz H. Menge: Das'Regimen' Heinrich Laufenbergs. Textologische Untersuchung und Edition(GAG 184), Göppingen 1976, S. 542, Anm. 6.
274 Max Schiendorfer
Vorsteher des Kapitels.4 Vielmehr war seine Hauptaufgabe die einesLeutpriesters des Stifts und zugleich der Pfarrgemeinde. Da dies miteiner uneingeschränkten Residenzpflicht verbunden war, ist demnachZofingen spätestens ab 1433 vorübergehend Laufenbergs Lebens- undWirkungsraum.5 Tatsächlich läßt er sich hier im folgenden ein paarMal belegen,6 doch hat er offenbar seine Freiburger Kontakte nieabreißen lassen. 1437 überwies er nämlich der Münsterfabrik 20Gulden, mit denen das Kapital der St. Katharinen-Pfründe aufgestocktwerden sollte. Schon vor seinem Wegzug hatte er mit den Pflegernder Pfründe eine entsprechende Vereinbarung getroffen: »[...] hatt ichdenselben minen lichenherren geredt und versprochen all nüz, sodozwüschen von der pfruond gefielen, diewil und ich also dienet,zuosamnent und derselben pfruond ganz ze gebent und an derselbenpfruond nuz ze bekerent.«7 Der Grund lag in der offenbar allzu kärg-lich bemessenen Dotation, welche auch von den Collatoren anerkanntwurde, so daß sie ihrem Kaplan seinerzeit (1430/33) »gegundet hattenanderswa ze dienen. Darumb daz ich mich dester baß möcht begaunund betragen, won dieselb pfruond mich nüt wol mocht herziechen«.8
4 Diese Irrtümer vertreten in letzter Zeit z. B. noch Menge (wie Anm. 3), S. 543,und Hans-Dieter Muck: Laufenberg, Heinrich, in: NDB 13, 1982, S. 708.
5 Vgl. Georges Gloor: Mittelalterliche Altargeistlichkeit des Bezirks Zofingen, Zo-finger Neujahrsblatt 1949, S. 69-80, hier S. 70; Georg Boner: St. Mauritius inZofingen, in: Helvetia Sacra II/2, Bern 1977, S. 538-564, hier S. 544; ChristianHesse: St. Mauritius in Zofingen. Verfassungs- und sozialgeschichtliche Aspekteeines mittelalterlichen Chorherrenstiftes (Veröffentlichungen zur Zofinger Ge-schichte 2), Aarau / Frankfurt / Salzburg 1992, S. 45-47. Als Terminus non antefür Laufenbergs Übertritt nach Zofingen kann übrigens das Jahr 1430 gelten, dadamals noch ein Dr. Conrad Friedbold das Amt des Stiftdekans bekleidete; vgl.Franz Zimmerlin: Die Geistlichen, die Würdenträger und Beamten des Chorher-renstifts Zofingen bis zur Reformation, Zofinger Neujahrsblatt 1922, S. 12 (Nr.200).
6 Vgl. Die Rechtsquellen des Kantons Aargau 1/5: Das Stadtrecht von Zofingen,hg. v. Walter Merz, Aarau 1914, Nr. 74c, S. 109 (22. Juli / 13. August 1433:»dominus Heinricus Louffenberg decanus ecclesie in Zouingen«); Die Urkundendes Stiftsarchivs Zofingen, hg. v. Georg Boner (Aargauer Urkunden 10), Aarau1945, Nr. 348 (20. Sept. 1434: »herr Heinrich Louffenberg, techan von demcapitel«).
7 Peter Albert: Urkunden und Regesten zur Geschichte des Freiburger Münsters,Freiburger Münsterblätter 8, 1912, Nr. 528 (13. Oktober 1437).
8 Ebd.; außerdem bestätigt Laufenberg die Vergabung des Hauses 'Zum Pfannen-berg' an die Pfründe, welches dem jeweiligen Inhaber als Wohnsitz zur Verfü-gung stehen solle. Freilich behält er sich neuerdings das lebenslängliche Nutznie-ßungsrecht vor, und dies auch für den Fall, daß er die Pfründe vorzeitig resignie-ren sollte. Zur ursprünglichen Dotation des 1374 gestifteten 'Beneficium Rohart'
) Der Wächter und die Müllerin 275
Dank Laufenbergs Zuschüssen 'pro domo' scheinen sich die ökono-mischen Voraussetzungen allmählich wunschgemäß entwickelt zuhaben. So konnte er im gleichen Dokument zuversichtlich bekanntma-chen, er werde auf »sant Johans tag zuo sungehte - auf den 24. Juni1438 - die obgenante pfruond anvochen und hinanfür selber besizzenund besingen und darzuo haben kein ander pfruond noch dienst«.9
vgl. Franz Zoll: Beiträge zur Geschichte der Münsterpfarrei in Freiburg, Freibur-ger Diözesan-Archiv 22, 1892, S. 243-288, hier S. 261: "Die Stifter widmeten:10 Pfd. Pfennig jährlich an Zins von einem den Johannitern gehörigen Hof inKenzingen; 10 Muth Roggen von den Klosterfrauen in Güntersthal; 4 Saum Weinvon Oberrothweil." Die ungenügende Dotation wird auch durch die KonstanzerInvestiturprotokolle bestätigt, die Laufenbergs Abwesenheit zweimal mit demTerminus 'indutiae' (für ebensolche Fälle vorgesehene, befristete Freistellung)belegen; vgl. Manfred Krebs: Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz ausdem 15. Jahrhundert, Freiburg 1938ff., S. 265.
9 Ob Heinrich sein Vorhaben einhalten konnte, ist nicht ganz sicher. Vgl. LorenzWelker: Heinrich Laufenberg in Zofingen. Musik in der spätmittelalterlichenSchweiz, Jb. f. Musikwissenschaft N. F. 11, 1991, S. 67-77, hier S. 67. Wel-ker weist darauf hin, daß gerade in jenen Jahren "das ganze Oberrheintal von derPest heimgesucht [wurde]. 1437 trat sie in Heidelberg auf und erreichte zu Ostern1439 auch Basel." Deshalb vermutet er, daß sich Laufenberg in dieser prekärenSituation wohl nicht ins Zentrum der Gefahr begeben, sondern die relativ sichereZofinger Abgeschiedenheit vorgezogen hätte. Der Verdacht ist nicht ganz unbe-gründet, zumal das Jahr 1439 für das Stift von besonderer Bedeutung war, wieaus einer Notiz des Zofinger Jahrzeitbuchs hervorgeht: »A. d. 1439 quatuorcanonici huyus ecclesie sc. dns. L. de Lutishofen, dns. Joh. Dyg, dns. Joh.Ottiman et dns. Bern. Brösemli visitarunt limina sanctorum Thebeorum martyrums'' Mauricii in Agauno [= St. Maurice im Kanton Wallis] et obtinuerunt ab abbateet confratribus de ossibus s1' Mauritii preciosam partem« (Die Urkunden desStadtarchivs Zofingen, hg. v. Walter Merz, Mit dem Jahrzeitbuch des StiftsZofingen, hg. v. Franz Zimmerlin, Aarau 1915, S. 316). Der zitierte Vermerkfindet sich unter den Jahrzeiteinträgen von Ende September, so daß die feierlicheÜbergabe der Mauritius-Reliquien vielleicht gerade am Festtag des Märtyrers,dem 22. September, stattgefunden haben könnte. Jedenfalls ist es sicher keinZufall, wenn Laufenberg gerade 1439 einen lateinischen Text De sancto mauritioet sociis ejus in seine wohl autographe Liederhandschrift *B 121 eingetragen hat(der Text selber ist verloren, nur die zitierte Überschrift wird durch PhilippWackernagels Teilkopie von *B 121 bezeugt; s. u.). Allerdings kann man sichdurchaus vorstellen, daß Laufenberg sich dem Zofinger Stift und seinemSchutzpatron auch noch nach seinem Wegzug verbunden fühlte und das Mauri-tius-Gedicht demnach ebensogut in Freiburg verfaßt haben könnte. Oder sollte essich dabei gar nicht um ein eigenes Werk, sondern um den bekannten TextKonrads von Haimburg gehandelt haben? (Vgl. Analecta hymnica medii aevi, hg.v. Guido Maria Dreves, Clemens Blume und Henry Marion Bannister, 55 Bde.,Leipzig 1886-1922, hier Bd. 3, Nr. 41: De sancto Mauritio et sociis ejus, mitdem Incipit: Salve, sancta beatorum l Thebaeorum legio.) Nachweislich hat jaLaufenberg zwei weitere Gedichte Konrads, das Crinale B. M. V. und den
276 Max Schiendorfer
Als er sich dann im Sommer 1441 erstmals wieder urkundlich inseiner Heimatstadt nachweisen läßt, ist Laufenberg allerdings zumDekan des Landkapitels Freiburg avanciert.10 Wie weit ihm diesesmehr verwaltungstechnische als seelsorgerische neue Amt innerlichbehagte, mag man sich fragen. Jedenfalls bekleidete er es nur wenigeJahre.11 Schon 1445 trat er seinen nächsten und endgültigen Lebensab-schnitt an, wie aus folgendem Vermerk der später noch genauervorzustellenden Liederhandschrift *B 121 hervorgeht: »Diß büechelinhat gedihtet herr heinrich lovffenberg ein priester vnd dechan derdechanye ze friburg in brysgowe der da noh do man zalt M.cccc.xlvjor gieng von der weit in sant Johans orden ze dem grüenen werde zestroßburg. bittend got für in.«12 Die Nekrologien des von Rulman
Annulus B. M. V., bearbeitet (ebd., Nrn. 2 und 3). Laufenbergs Texte vgl. beiPhilipp Wackernagel (Hg.): Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zuAnfang des XVII. Jahrhunderts, Bd. II: Lieder und Leiche bis auf die Zeit derReformation von Otfrid bis Hans Sachs einschl. (868-1518), Leipzig 1867, Nr.727 und 797. Wackernagels Ausgabe wird im folgenden als WKL + Liedzifferzitiert.
10 Vgl. Franz Zell: Bischöfliches Dekret zu Gunsten Heinrich Loufenbergs,Freiburger Diözesan-Archiv 20, 1889, S. 304: »Dilecto in Christo HeinricoLouffenberg decano decanatus et capellano ecclesie parrochialis beate Marie inFriburg Constanciensis diocesis [...]« (13. Juli 1441; vgl. auch Regesta Episco-porum Constantiensium, hg. v. der Badischen Historischen Commission, Bd.IV: Bischof Heinrich von Hewen 1436-1462, bearb. v. Karl Rieder, Innsbruck1928, Nr. 10479). Im selben Jahr vollendete Laufenberg das Buch der Figuren,dessen Frontispiz ein 'Autorporträt' mit der Inschrift »Heinrich ze FriburgDechan / Vohet hie ze dichtend« an zeigte; ein zweites Spruchband lieferte zudemdie Werkdatierung: »M. vier c. vier x. ein i. / Do wart gedieht dis bücheli« (vgl.S. 314, Abb. l, reproduziert nach Christian Moritz Engelhardt: Der Ritter vonStaufenberg, Straßburg 1823, Tafel 19).
11 Vgl. Albert (wie Anm. 7), Nr. 552 (22. Dez. 1441: »Heinrich Louffenbergtechan der techanien ze Friburg« agiert als Rechtsvertreter der vier Münsterherrenund der Kapläne); Nr. 561 (4. Juli 1442: ein Rechnungsregister derMünsterpräsenz nennt u. a. »Louffenberg dechanus« als abgabepflichtigenBesitzer eines Grundstücks); Nr. 563 (6. August 1442: »her HeinrichLouffenberg techan der techanie zuo Friburg« agiert als Rechtsvertreter der vierMünsterherren und der Kapläne). Vgl. femer die im fraglichen Zeitraum (Aug. /Juli 1441 bis Okt. / Nov. 1445) an den Freiburger Dekan gerichtetenAuftragsschreiben des Konstanzer Generalvikars, die eine anschaulicheVorstellung von Laufenbergs neuem Tätigkeitsfeld geben können (RegestaEpiscoporum Constantiensium [wie Anm. 10], Nrn. 10380, 10452, 10523,10578, 10600, 10609, 10808, 10823, 10832, 10836, 10943, 10974, 10998,11006).
12 Wohl aus der abschließenden Bitte um Fürbitte »für in«, wurde verschiedentlichauf eine postume Abfassung des ganzen Eintrags geschlossen (z. B. LudwigDenecke: Laufenberg, Heinrich, 'VL 3, 1943, Sp. 28). Zwingend ist diese An-
Der Wächter und die Müllerin 277
Merswin gegründeten Johanniterkonvents 'Zum Grünen Wörth' notie-ren zum 31. März 1460: »O[bitus] frater heinricus louffenberg con-uentualis huius domus Anno domini .M.cccc.lx. hie sepultus.«^
Werfen wir nun einen Blick auf Laufenbergs GEuvreverzeichnis:
1413 ältestes datiertes Lied Cod. *B 121, f. 96'
1421 (?) Übersetzungen didaktischer Texte Cod. *B 121, f. l'-16'
1425 Henrici Loeffenburg Sermones duplices de Cod. *D 13tempore et sanctis, cum Passione Domini.'^
1429 Regimen sanitatis (ca. 6000 Verse)15 Cod. *B 141
6.Nov. Speculum humanae salvationis Cod. *B 941437 (ca. 15000 Verse)16
1440/41 geistliche Prosa zur Beichtmeditation
1441 Liber figurarum (15370 Verse)'7
1458 mariologische Hohelied-Auslegung
Cod. *B 121,f. 161-238
Cod. *A 80
Cod. *B 121,f. 239-250'
Sämtliche der hier angeführten Handschriften stammten aus derStraßburger Johanniterbibliothek, und das heißt letztlich wohl: ausLaufenbergs persönlichem Nachlaß. Der immerhin 15jährigen Straß-burger Lebensphase kann allerdings nur ein einziger Text zugewiesenwerden, eine 1458 entstandene mariologische Auslegung des Hohen
sieht nicht, zumal die Selbstadresse in dritter Person bei Laufenberg durchgehen-de Regel ist (so in sämtlichen bekannten Kolophonen, Akrostichen, poetischenSelbstnennungen und rubrizierten Autorvermerken).
13 Vgl. Ernst Martin: Litterarhistorische Notizen, in: Straßburger Studien l, 1883,S. 384; Menge (wie Anm. 3), S. 547, Anm. 3.
14 Vgl. Johan Jacob Witter: Catalogus codicum manu scriptorum in bibliotheca sacriordinis Hierosolymithani Argentorati asservatorum, Argentorati [= Straßburg]1749, S. 41: "Henrici Loeffenburg Sermones [...]" Da Witter alle deutschenHandschriften als solche kennzeichnet, handelte es sich hier offenbar umlateinische Predigten Laufenbergs.
15 Zu Laufenbergs Bearbeitung des Regimen sanitatis vgl. die kritische Texteditionvon Menge (wie Anm. 3).
16 Zu dieser Handschrift vgl. vor allem Engelhardt (wie Anm. 10), S. 15-25 etpassim.
17 Vgl. Engelhardt (wie Anm. 10), S. 25-28. Zusammenfassende Übersichten überLaufenbergs Gesamtoeuvre bieten im weiteren Menge (wie Anm. 3), S. 551-556,sowie die Verfasserlexikon-Artikel von Ludwig Denecke ([VL 3, 1943, Sp. 27-35) und Burghart Wachinger (2VL 5, 1985, Sp. 614-625).
278 Max Schiendorfer
Liedes. Sie findet sich, ebenso wie das älteste datierte Lied von 1413,in der erwähnten Handschrift *B 121.
Die Bestände der Johanniterbibliothek sind nach der Säkularisationder Straßburger Klöster in die Bibliotheque de la ville übergegangen,die 1870 im Deutsch-französischen Krieg zerstört wurde. Der Verlustist gerade im Falle Laufenbergs katastrophal, da es sich bei seinenautographen oder zumindest äußerst autornahen Aufzeichnungen fastdurchwegs um Unikate gehandelt hatte. Einzig Laufenbergs Gesund-heitslehre, das Regimen sanitatis, ist auch heute noch in mehrerenHandschriften ganz oder teilweise zugänglich. Die übrigen Werke sindfür immer verloren, von Kurzbeschreibungen in Bibliothekskatalogenund wenigen von der frühen Forschung exzerpierten Zeilen einmalabgesehen. Bezüglich Laufenbergs lyrischem (Euvre kann man danoch von Glück im Unglück sprechen: Sozusagen am Vorabend desBibliotheksbrandes, 1867, hatte Philipp Wackernagel den Mittelalter-band seiner monumentalen Kirchenlied-Anthologie veröffentlicht, inwelchem Heinrich Laufenberg zurecht eine prominente Stelle ein-nahm.18 Dank Wackernagels Abschrift sind uns von den insgesamt 114Lied- und Gedichttexten nicht weniger als 97 im vollständigenWortlaut erhalten geblieben, und auch von den restlichen Stückengewinnen wir aufgrund der von ihm mitgeteilten Textproben (und inwenigen Fällen auch aufgrund von Parallelüberlieferungen) einerelativ klare Vorstellung.19
18 Die von Wackernagel (wie Anm. 9) als "echt" taxierten Lieder HeinrichLaufenbergs stehen unter den Nrn. 701-798; weitere Lieder aus *B 121 druckteer als anonymes Gut oder als Werke anderer Autoren ab (Mönch von Salzburg,Konrad Lesch): Nrn. 443,480, 554, 556, 574, 580, 585, 587; außerdem hatte erschon früher das Goldene ABC des Mönchs von Salzburg nach der StraßburgerQuelle ediert: K. E. Pfhilipp] Wackernagel (Hg.): Das Deutsche Kirchenlied vonMartin Luther bis auf Nicolaus Herman und Ambrosius Klauer, Stuttgart 1841,Nr. 769.
19 Sämtliche Stücke aus *B 121, von denen Wackernagel lediglich Textprobenmitteilt oder es gar bei ihrer bloßen Erwähnung bewenden läßt, waren offenbarnicht für den Gesangsvortrag bestimmt. Es handelt sich überwiegend umLesegebete, besonders um Mariengrüße, z. T. eigentliche Glossierungen des AveMaria und des Salve regina, z. T. in Form von Reimpaargedichten oder Abece-darien konstruiert (vgl. WKL 728, 733, 768, 769, 772, 797, 798 sowie dieAnmerkungen zu WKL 734, 741, 743, 760, 783). Diese Texttypen begegnen beiLaufenberg auch sonst mehrfach, so daß der ja ohnehin primär am gesungenen'Kirchenlied' interessierte Wackernagel sie offenbar als Dubletten glaubtevernachlässigen zu dürfen. Bedauerlicher ist sicher der weitgehende Verlust jenererwähnten, rund tausendzeiligen Hohelied-Auslegung (unter WKL 768 sindsechs von insgesamt 88 Strophen mitgeteilt) sowie möglicherweise der Verlustdes lateinischen Mauritius-Gedichtes (nur in Wackernagels Manuskript erwähnt;
Der Wächter und die Müllerin 279
Ferner erlauben Wackernagels kommentierende Anmerkungen, dieGesamtanlage der verlorenen Handschrift weitgehend zu rekonstru-ieren (vgl. die tabellarische Aufstellung, S. 30l).20 Mindestens 36 der114 Texte waren mit einer Jahrzahl versehen, mindestens 32 mitLaufenbergs persönlicher Autorsignatur (rubrizierte Namensüber-schrift, Selbstnennung im Text, Akrostichon).21 Am Anfang derHandschrift standen drei kürzere didaktische Reimpaardichtungen; aufden Blättern 161 bis 238 war ein umfangreicher Prosateil einge-schoben, in welchem sich Laufenberg in der Rolle eines Beichtvatersan eine ungenannte »biht dohter« wendet.
Aus den datierten Stücken läßt sich leicht der chronologische Gesamt-aufbau der Handschrift ersehen. Wahrscheinlich wurden die Textemeist bald nach ihrer Abfassung hier eingetragen. Aus irgendwelchenGründen - möglicherweise, um die didaktischen Gedichte an denAnfang zu rücken - erfolgte dann allerdings eine teilweise Umschich-tung der Lagen, vielleicht 1421. Das erste Lied der Handschrift trägtjedenfalls diese Jahrzahl, welche dann viel weiter hinten, auf Blatt124, wieder begegnet. Vor Blatt 124 finden sich ältere Stücke, die bisins Jahr 1413 hinunterreichen (oder noch weiter zurück, was jedochnicht durch handschriftliche Datierungen belegbar ist). Andererseitslautet die erste nach Blatt 124 (nämlich auf Blatt 138b) begegnendeJahrzahl 1436. In dieser Region ist demnach die eine der Nahtstellen
vgl. Eduard R. Müller: Heinrich Loufenberg, eine litterar-historische Unter-suchung, Diss. Straßburg, Berlin 1888, S. 21).
20 Vgl. Müller (wie Anm. 19), S. 9-22, und dazu die Korrekturen und Ergänzungenbei Burghart Wachinger: Notizen zu den Liedern Heinrich Laufenbergs, in:Medium Aevum deutsch. Festschrift für Kurt Ruh, Tübingen 1979, S. 349-385,hier S. 351-357.
21 Datierungen und Autorsignaturen kumulieren sich nur in 7 Fällen, so daß fürinsgesamt 61 Lieder mindestens einer der beiden redaktionellen Zusätze verbürgtist. Wie vollständig die Liste damit erfaßt ist, bleibt unsicher, da Wackernagel indieser Sache offenbar nicht ganz konsequent zitiert. So gibt es Fälle von Autor-signaturen, die nicht in der gedruckten Ausgabe, wohl aber in Wackernagelshandschriftlicher Druckvorlage notiert sind. Einige weitere Signaturen könnenaus der knappen und lückenhaften Handschriftenbeschreibung von Massmannergänzt werden (Hans F. Massmann: Mannigfaltiges. 3.: Heinrich von Loufen-berg, Anz. f. Kunde des dt. Mittelalters l, 1832, Sp. 41-48). Zudem vermutetWackernagel selber, daß durch späteren Randbeschnitt der Handschrift gelegent-lich auch rubrizierte Namen- oder Datumvermerke weggefallen sein könnten (vgl.seine Anmerkungen zu WKL 776 und besonders 783). Als eine Art 'Negativ-probe' können ferner jene wenigen Fälle gelten, in denen Wackernagel explizitdas Fehlen einer Autornennung notiert; zum ganzen Fragenkomplex vgl. auchWachinger (wie Anm. 20), S. 351 f.
280 Max Schiendorfer
zu erblicken. Die andere liegt wohl irgendwo zwischen Blatt 55 undBlatt 79.22 Trotz dieser Unscharfe lassen sich einige Schwerpunktbil-dungen der Handschrift (in ihrer ursprünglichen Anlage) hinreichenddeutlich ausmachen: In der ältesten Abteilung mit den Texten bis 1421standen auffallend viele Übersetzungen lateinischer Gesänge und dazuca. ein Dutzend sicher oder wahrscheinlich von anderen Autoren
22 Durch einen Vergleich der z. T. abweichenden Folioangaben bei Massmann undWackernagel glaubt Wachinger, die Hauptbruchstellen der sekundären Umord-nung der Handschrift am ehesten bei Blatt 78/79 bzw. Blatt 133 lokalisieren zukönnen (Wachinger [wie Anm. 20], S. 352 und 357). Die von Massmanngebotenen Vergleichsdaten sind aber zum einen doch recht lückenhaft und lassendaher einen entsprechenden Interpretationsspielraum offen. So bietet er z. B. fürdie Blätter 74b bis 78b (nach Wackemagels Zählung) keine Vergleichswerte, sodaß von daher die gesuchte Nahtstelle auch etwa zwischen Blatt 75 und 76 liegenkönnte. Möglicherweise wurde im Bereich der Blätter 76 bis 79 ein Einzelblattherausgetrennt und daraufhin die ursprüngliche Foliierung korrigiert, aber nichtgetilgt. Dann könnte Wackernagel der Korrektur, Massmann weiterhin der altenZählung gefolgt sein. Auf diese oder ähnliche Weise kam es in der Handschrift zuzwei, weiter hinten dann gar zu mehreren konkurrierenden Blattzählungen, vondenen sich offenbar vor allem Massmann irritieren ließ. Gerade im 'Vorfeld' derzweiten von Wachinger postulierten Bruchstelle ist Massmanns Unsicherheit mitHänden zu greifen. Vgl. die folgenden Entsprechungen / Differenzen:Bis wilkomen, maria, maget rein (WKL 796): Wackernagel Bl. 125a =Massmann Bl. 127a.Ich weiß ein lieplich engelspil (WKL 710): Wackernagel Bl. 127a = MassmannBl. 127a(!).Es taget minnencliche (WKL 788): Wackernagel Bl. 128b = Massmann Bl. 130bAch döhterlin, min sei gemeit (WKL 708): Wackernagel Bl. 129b = MassmannBl. 130b(!).Daß hier an Massmanns Zählung einiges nicht stimmen kann, ist offenkundig.Während Wackernagels Angaben kontinuierlich fortschreiten, bietet er gleichzweimal eine identische Blattzahl, so daß sich Divergenzen von 0, l und 2 erge-ben. Auf diesen wenigen Seiten scheint Massmann zwischen drei handschriftli-chen Foliierungen hin- und her zu irren. Wenn die Differenz ab Bl. 133 dann eineZeitlang konsequent auf 3 ansteigt, könnte dies vielleicht mit dem offenbarbeidseitig leer gebliebenen Bl. 132 zusammenhängen. Als 'Bruchstelle' in dieserHandschriftenregion kommt daher m. E. nicht nur Bl. 132/133 in Betracht, son-dern ebenso gut - vielleicht zusätzlich - Bl. 124/125 (vgl. die merkwürdigeJahrzahl [?] 28 auf Bl. 124b). Die Datierung der von dieser Vorverlegung der'Bruchstelle' betroffenen Stücke hätte sich dann nicht an der voraufgehendenJahrzahl 1421, sondern an dem nachfolgenden 1436 zu orientieren; und in diesespätere Dichterperiode Laufenbergs passen die vier Kontrafakta denn auchwesentlich besser: Das mit Bis wilkomen, maria, maget rein tongleiche Woluffmit andaht alle crystenheit (WKL 795) datiert von 1428/29; Ach döhterlin, minsei gemeit hat die gleiche Melodie wie Sjch het gebildet in min hercz (WKL 787)von 1434/35.
Der Wächter und die Müllerin 281
stammende Stücke beisammen.23 In den Einträgen der Dekade von ca.1425 bis 1435 häufen sich dann ebenso auffallend jene Lieder, diesicher oder wahrscheinlich als Kontrafakta zu gelten haben; auchstammen aus dieser Periode nicht weniger als 13 der insgesamt 17Melodieaufzeichnungen, die wiederum fast ausnahmslos zu 'kontrafak-turverdächtigen' Stücken notiert wurden.
II
Ein Kontrafakt als solches sicher nachzuweisen, ist nur allzu oft »einswaerez spil«, es sei denn die Autoren oder Schreiber geben unsdankenswerterweise gleich selber den entsprechenden Wink.
Ein solcher Fall liegt vor in Laufenbergs Lied Es taget minnencliche(WKL 709; vgl. S. 305, Textanhang l A). Diesem ca. 1435 entstande-nen Lied hatte Laufenberg die Rubrik Id daget in dat osten überge-schrieben, welche offensichtlich auf das benützte weltliche Vorbildverweist.24 Tatsächlich findet sich in Uhlands Volksliedersammlungeine melodramatische Ballade - von der Forschung mit demKennwort Totenamt etikettiert - mit eben diesem niederdeutschenIncipit (Textanhang l B);25 ferner kennen wir u. a. aus dem Ant-werpener Liederbuch von 1544 eine damit im großen und ganzenübereinstimmende niederländische Redaktion (Textanhang l C).26
23 Zu den als Fremdwerke geltenden Stücken vgl. Wachinger (wie Anm. 20), S.354f. Übrigens ist keinem dieser Texte eine Jahrzahl oder LaufenbergsAutorsignatur beigeschrieben (zu WKL 585 lautet der Vermerk sogarausdrücklich »Jtem Salue mater. alterius editoris«), was die Glaubwürdigkeit derindirekt bezeugten Vermerke gewissermaßen ex silentio weiter stützen kann.
24 Friedrich Wilhelm Arnold datiert das Lied auf 1421 (vgl. Das Locheimer Lieder-buch nebst der Ars Organisandi von Conrad Paumann, Jahrbuch für Musikali-sche Wissenschaft 2, 1867, S. 1-224, hier S. 37; nach ihm auch Franz MagnusBöhme: Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 1877, S. 70, 71). Darauf ist aber reingar nichts zu geben, da Arnold hier wie in einer Reihe analoger Fälle einfach diein der Handschrift voraufgehende Jahrzahl übernommen hat. Die Jahrzahl 1421stand zwar tatsächlich vier Blätter weiter vorne (Bl. 124a) als das hier besproche-ne Lied, doch wie oben (wie Anm. 22) schon gesehen, dürfte es sich dabeigerade um das 'Schlüsseldatum' bzw. um die Bruchstelle der handschriftlichenLagenumschichtung handeln.
25 Ludwig Uhland: Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder, mit Abhandlungenund Anmerkungen, 2 Bde., Stuttgart 1844/45, Nr. 95A.
26 Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544, Nach dem einzigen noch vorhandenenExemplare hg. v. Hoffmann von Fallersleben (Horae Belgicae XI), Hannover1855, Nr. LXXIII; vgl. besonders auch den monographischen Artikel zumTotenamt von John Meier (Hg.): Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, hg. v.
282 Max Schiendorfer
Allerdings zeigt die von Uhland mitgeteilte Fassung außer derAnfangszeile keine nennenswerten Berührungspunkte mit LaufenbergsText. Sollte unser Kontrafakteur sich also minimalistisch mit demZitat der zwei nicht sonderlich aussagekräftigen Anfangswörterbegnügt haben? Oder wie weit entspricht Uhlands Textfassung des 17.Jahrhunderts überhaupt noch der zweihundert Jahre früher gängigenVorstufe? Damit sind wir bereits auf einen besonders wunden Punktder Kontrafakturforschung gestoßen: Sehr oft stützen sich die geistli-chen Bearbeiter auf Volkslieder, die generationenlang mündlichtradiert und dabei in mannigfaltiger Weise 'zersungen' bzw. kreativumgestaltet wurden, ehe sie endlich - wenn überhaupt - den Weg indie Verschriftlichung fanden. Für unzählige weltliche Lieder des aus-gehenden Mittelalters sind rubrizierte Melodieverweise wie Laufen-bergs Id daget in dat osten die weitaus frühesten oder schlechtweg dieeinzigen Existenzbelege. Theoretisch wäre es im Extremfall durchausmöglich, daß Uhlands Fassung ihrerseits lediglich ein Initialzitat derursprünglichen Ballade bewahrt hat. Oder es könnten im 15. Jahrhun-dert mehrere, markant divergierende Vortragsvarianten existierthaben, von denen gerade die 'richtige' nicht überlebt hätte.
Im vorliegenden Fall dürfen wir mit der Überlieferungslage füreinmal recht zufrieden sein. In einer noch aus Laufenbergs Lebenszeitstammenden St. Blasier Handschrift27 findet sich ein oberdeutschesLied mit dem Initium Es tagt in Osterriche (Textanhang l D). Gegen-über der niederdeutsch-niederländischen Ballade wird hier in dervierten Strophe neu eine Wächterfigur eingeführt. Dahinter könnteman auf den ersten Blick eine Assoziation der klassischen Tagelied-gattung vermuten, die sich aufgrund der Eingangszeilen des Lieds jatatsächlich anböte. Im vorliegenden Fall liegt aber vielmehr dieKontamination des Totenamts mit einer ändern Ballade vor, demsogenannten Abendgang; und diese zweite Ballade ist es, die u. a. die(hier wohl tatsächlich aus dem Tageliedmodell entliehene) Wächterfi-
Deutschen Volksliedarchiv, Band III.: Balladen, Dritter Teil, Berlin 1954, S.154-165
27 Heute Landesbibliothek Karlsruhe, Cod. mscr. St. Blasien Nr. 77, f. 311. DasLied trägt die Überschrift Purengesangk. Vgl. Meier (wie Anm. 26), S. 155f.,und Hans Joachim Moser / Fred Quellmalz: Volkslieder des 15. Jahrhunderts ausSt. Blasien, in: Volkskundliche Gaben. Festschrift für John Meier, Bern / Leipzig1934, S. 146-156, bes. S. 148-150 und Tafel 8 (Faks. der Melodie samt Strophe1). "Wie aus den Datierungen der Handschrift einwandfrei hervorgeht, entstandsie zwischen 1439 und 1442" (ebd., S. 146). Der Purengesangk wurde also nurwenige Jahre nach Laufenbergs Kontrafakt aufgezeichnet.
Der Wächter und die Müllerin 283
gur zum resultierenden Mischprodukt beigesteuert hat.28 Das Grund-gerüst der Schauermäre Totenamt schimmert jedoch auch in dersüddeutschen Fassung noch einigermaßen durch: Ein zudringlicherRitter buhlt um ein Mädchen, das sich offenbar in der Schlafkammeraufhält. Da die Umworbene bereits einen ändern liebt, versucht sie,den Werber mit der Schutzbehauptung abzuwimmeln, daß eben jetztihr Freund bei ihr liege. Der Ritter weiß dies allerdings besser, hat erden Geliebten doch kurz zuvor erschlagen.29 In der niederdeutsch-
28 Uhland (wie Anm. 25), Nr. 90; John Meier (Hg.): Deutsche Volkslieder mitihren Melodien, hg. v. Deutschen Volksliedarchiv, Band III: Balladen, ErsterTeil, Berlin 1935, S. 179-196. Vgl. etwa Strophe 4 des St. Blasier Textes mitStrophe 2 des Abendgang (zit. nach Meiers "Edition l"): »Die junckfraw die wasedel, / sie thet ein abentgang, / sie gieng gar traurigkJichen, / do sie den wechterfand.« Vgl. ferner auch unsere Strophe 9, die gar als Musterfall einer soge-nannten Wanderstrophe gelten kann. Sie findet sich in teilweise wörtlicher Über-einstimmung nicht nur im Abendgang wieder (Strophe 9: »Er nam sie bey derhende, / bey jr schneweyssen hand, / Er fürt sie an das ende, / do er seyn muoterfand«; wieder aufgenommen in Strophe 11: »Er nam sie bey der hende, / bey irschneweyssen hand, / er fürt sie an das ende, / do er sie genumen hat«), sondernauch - und durchaus naheliegenderweise - in einem pastourellenhaften Lied des16. Jahrhunderts mit dem Incipit Es wolt ein jeger jagen (hier Strophe 5: »Er namsie bey der hende, / bey ir schnee weissen handt, / er fuort sie an ein ende, / da erein Bettlin fandt«; Text eines 1568 von Samuel Apiarius in Basel gedrucktenFlugblatts, zitiert nach Charles Allyn Williams: Zur Liederposie in FischartsGargantua, Diss. Heidelberg, Halle 1909, S. 26; mehrere z. T. ältere Fassungendes Stücks, jedoch mit stärker abweichendem Wortlaut der zitierten Strophe, vgl.bei Ludwig Erk und Franz Magnus Böhme: Deutscher Liederhort III, Leipzig1894, S. 296-302). Zu diesem Jägerlied wiederum kursierte gleichfalls noch im16. Jahrhundert ein auf Maria Verkündigung umgedeutetes anonymes Kontrafakt(Uhland [wie Anm. 25], Nr. 338), und Orlando di Lasso scheint 1576 dieStrophenvariante aus dem apiarischen Druck in ein - ebenfalls pastourellenhaftes- Stück mit dem Incipit Mit lust tet ich ausreifen eingebaut zu haben (Strophe 4:»Er nam sie bei der hende, / bei ir schneweißen hand, / er fürts des walds einende, / da er ein bettle fand«; zitiert nach Karl Goedeke und Julius Tittmann:Liederbuch aus dem sechzehnten Jahrhundert, Leipzig 1867, S. 11 1). Zu einemweiteren Beleg der Wanderstrophe vgl. auch unten (wie Anm. 50).
29 Eine ganz eigene, auf die Rekonstruktion der 'Urform' zielende Deutung desHergangs bietet Selma Hirsch: Zur Urform der Ballade Totenamt, Nieder-deutsches Jahrbuch 54, 1928, S. 75-80; wieder abgedruckt in: Das Volkslied imspäten Mittelalter. Zwanzig spätmittelalterliche Balladen und Lieder aus ihren zer-sungenen Formen wiederhergestellt und erläutert von Selma Hirsch, Berlin 1978,S. 95-103. Zu diesem Aufsatz notierte John Meier lakonisch (wie Anm. 26), S.165, Anm. 6: "Die Arbeit beruht auf unhaltbaren Konstruktionen und ist hierunberücksichtigt geblieben." Dem bleibt nichts hinzuzusetzen. Als wenig ergiebigerweisen sich auch die neuerlichen Behandlungen des Themas durch Doris Sittig:Vil wonders machet minne. Das deutsche Liebeslied in der ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts (GAG 465), Göppingen 1987, S. 315-317, und Stefania Bellicanta:
284 Max Schiendorfer
niederländischen Version offenbart der Mörder nun selbst den Tatort;im St. Blasier Codex ist es der kraft seines Amtes Bescheid wissendeWächter, der dem Mädchen den Weg weist. Es findet daraufhin denToten und begräbt ihn eigenhändig.
Ein Textvergleich zeigt sehr bald, daß die (im Textanhang doppeltunterstrichenen) wörtlichen Anklänge an die St. Blasier Fassung inLaufenbergs Strophen l bis 6 derart massiert auftreten, daß jederZufall ausgeschlossen ist. Laufenberg muß eine weltliche Bearbeitunggekannt haben, die der vorliegenden - fast zeitgleich aufgezeichneten- sehr nahegestanden hat.30 Ebenso sicher kannte er aber auch, lautder handschriftlichen Rubrik, eine niederdeutsche Fassung. Und esmacht nun ganz den Anschein, als ob er sich dieser zweiten Vorlage inden Schlußstrophen seines Kontrafakts näher angeschlossen hätte. Diesscheint mir vor allem aus den Übereinstimmungen von LaufenbergsStrophen 7, 9 und 10 mit den Strophen 9 bis 11 der AntwerpenerFassung hervorzugehen. Ebenso mag denn auch Laufenbergs Strophe8 noch Restspuren des von ihm benutzten (verschollenen) niederdeut-schen Textes konserviert haben.
Wenn diese Annahmen nicht völlig fehlgehen, ist also bei Kontrafak-ten mit der Möglichkeit einer kontaminierenden Bearbeitung zweieroder mehrerer Vorlagefassungen zu rechnen, die wiederum in einemmehr oder minder (un)durchsichtigen Interferenzverhältnis zueinan-der stehen können. Und gegebenenfalls kann man solche Vorlage-fassungen ihrerseits als kontaminierende Bearbeitungen bezeichnen,wenn sie etwa zwei vorgegebene Balladentraditionen miteinanderverschmelzen oder literarische Versatzstücke wie das Tageliedmodellals zusätzliches Baumaterial heranziehen.
Eine letzte Randnotiz zu Laufenbergs Kontrafakt soll vorläufig imRaum stehenbleiben: Jesus wird in diesem Text als »lieb gemeit« und»trut geselle« bezeichnet; das lyrische Ich möchte in seinem Arm
Die Liebe-Tod-Thematik in den Volksliedern des späten Mittelalters. Eine Unter-suchung zur Liederbuch- und Flugblatt-Tradition des XV. und XVI. Jahrhun-derts (GAG 586), Göppingen 1993, S. 90-95.
30 Die St. Blasier Aufzeichnung dürfte aber kaum das 'Original' bzw. die vonLaufenberg unmittelbar benutzte Fassung der süddeutschen Balladenredaktiondarstellen, da ihr Reimschema vor allem in den Strophen 2 und 3 sichtlich gestörtist. Der Bearbeiter (vielleicht mit dem Scriptor identisch) legte offenbar viel Wertauf eine Strophenverknüpfung in der Art der coblas capfinidas und dürfte aus die-sem Grunde mehrfach umformuliert haben. Etwa in Zeile 2,4 kommen die nddt.-ndl. Fassungen mit dem Reimwort »waerdicheyt« (vgl. Laufenbergs »staeti-keit«!) dem ursprünglicheren Wortlaut der süddeutschen Bearbeitung zweifellosnäher.
Der Wächter und die Müllerin 285
liegen und seinen Mund küssen. Diese stark erotisch gefärbte Jesus-minne sollte man doch eigentlich eher aus Frauenmund, aus demMund einer sponsa Christi erwarten, und dies umso mehr, als dannder kontrafaktive Bezug auf das Liebespaar der Ballade um einigespointierter oder - da es sich dort ja um ein tragisches Liebespaarhandelt - vielmehr 'kontra-pointierter' wäre ...
III
Wenden wir uns nun einem zweiten, ähnlich gelagerten Beispiel zu:Auch Laufenbergs Es stot ein lind in himelrich (WKL 789) istzweifelsohne ein Kontrafakt (vgl. S. 309, Textanhang 2 A). Auch hierkann kein weltliches Lied als die unmittelbare Vorlage bestimmtwerden. Und auch hier finden wir stattdessen eine ganze Reihe spätüberlieferter Liedvarianten, die alle irgendwie untereinanderzusammenhängen und insgesamt wenigstens einen phantomhaftenEindruck des gesuchten Vorbilds hinterlassen.
Unser Hauptinteresse gilt diesmal aber den Strophenformen.31 Diemeisten der in Textanhang 2 auszugsweise zusammengestellten weltli-
31 Nur soviel sei zu den Texten angemerkt: Im Unterschied zum ersten behandeltenBeispiel fehlt hier der handschriftliche Verweis auf eine weltliche Vorlage.Dennoch glaubte Franz Magnus Böhme, das im Textanhang 2 B abgedruckteLied als diese Vorlage bezeichnen zu dürfen ([wie Anm. 24], S. 693). Abgesehenvon den übereinstimmenden Anfangswörtern läßt sich dafür das übereinstimmen-de Botenmotiv als Argument anführen: Die Nachtigall als Liebesbote wird beiLaufenberg durch den Himmelsboten Gabriel substituiert. Doch darf nicht unter-schlagen werden, daß wir hier eine ähnlich problematische Situation wie vorhinantreffen. Sämtliche erhaltene Fassungen des weltlichen Lindenliedes sindwesentlich jünger als Laufenbergs Bearbeitung und divergieren untereinanderz. T. ganz beträchtlich. Vor allem wäre aber erneut zu fragen, ob Laufenbergsich wohl wirklich mit einem ziemlich dürftigen Initialzitat begnügt hätte und obdas Lindenlied demnach als Nachweis für "die freie Art des L[aufenberg]'sehenParodirens" herangezogen werden darf (Müller [wie Anm. 19], S. 90). Daß einsolches Exempel jedenfalls nicht generalisierbar wäre, wie Müller meint, ist ausdem bisher Gesehenen schon hervorgegangen. Auch für den vorliegenden Fallvermute ich aber weit eher, daß wir es wieder mit undurchsichtigen Kontamina-tionen zu tun haben und daß die erhaltenen Texte wohl nur noch entfernt demWortlaut des 15. Jahrhunderts entsprechen (vgl. das im Textanhang 2 F stehendezehnstrophige Lied, das mit den Texten B und C einzig und allein in derIncipitzeile übereinstimmt; es könnte ohne weiteres noch andere Lieder mitgleichem Anfang und unabhängiger Fortsetzung gegeben haben). Kleine Reliktedieses Wortlauts glaube ich in einem Lied mit dem Init ium Dar licht ein stat inOsterrik ausmachen zu können (Textanhang 2 D) bzw. in dessen niederländischerSpielart Daer staet een clooster in oostenrijc (Textanhang 2 E). Zwar fehlt indiesen Anfangszeilen das wichtige Erkennungswort 'Linde', stattdessen finden
286 Max Schiendorfer
chen Lieder bestehen aus schlichten Vierzeilern, einzig die niederdeut-sche Fassung C schiebt jeweils nach zwei Versen eine Refrainzeile»van gold dre rosen« ein.32 Nochmals eine andere Variante findet sichbei Laufenberg mit einem Binnenrefrain in der Strophenmitte.Wieder besteht natürlich die Möglichkeit, daß ein verlorengegangenesweltliches Lied bereits dieser Bauform entsprochen haben könnte.Oder - und dies wäre die andere Möglichkeit - Laufenberg hat seineVorlage metrisch-musikalisch umgearbeitet. Diese zweite Möglichkeitscheint mir durchaus nicht von der Hand zu weisen, aus folgendenGründen:
Erstens muß es ins Auge fallen, daß die weitaus meisten der insgesamt17 in die Handschrift eingetragenen Musiknotationen ausgerechnet beiKontrafakten oder doch stark 'kontrafakturverdächtigen' Stückenstehen. Wenn Burghart Wachinger (wie Anm. 20, S. 360) mit Blickauf die Hymnen- und Sequenzenübersetzungen zurecht festgestellt hat,daß sich hier die Aufzeichnung der allgemein bekannten Melodien fürLaufenberg erübrigte, so müßte dies doch eigentlich auch für die
wir hier mit »rieh« Laufenbergs Reimwort wieder. Mag dies noch als Zufallangesehen werden, so doch wohl kaum die weiteren Anklänge: Strophe 5 von Dbringt an den gleichen Stellen wie Laufenberg die zentralen Stichwörter »linde,este, besten«. Ansonsten bleibt freilich auch bei diesem Text höchst unklar,wieviel originäre Substanz des 15. Jahrhunderts er noch enthält. Die Eingangs-strophe gehört jedenfalls nicht ursprünglich zum Kern des Linden-Nachtigallen-Liedes, sondern bildet den Anfang einer eigenen Ballade (Uhland [wie Anm. 25],Nr. 125: Es ligt ein schloß in Oesterreich; vgl. dazu auch Paul Alpers: Untersu-chungen über das alte niederdeutsche Volkslied, Niederdeutsches Jahrbuch 38,1912, S. 1-64, hier S. 47-50). Erneut besteht der begründete Verdacht, daßLaufenberg zwei seinerzeit kursierende Redaktionen des Volksliedes gleichzeitiganvisierte oder daß er eine verlorene Fassung kannte, welche die genanntenPunkte bereits auf sich vereinigte. Merkwürdigerweise erscheint Es stet ein lindin jenem tal ist oben breit vnd vnden schmal auch unter Fischarts Geuchliedern;man wird das Zitat schwerlich auf die uns heute bekannten Texte beziehen dür-fen, gehören diese laut Williams doch "zu den schönsten und unschuldigsten, diewir aus dem 16. jh. kennen" ([wie Anm. 28], S. 29). Just das von Fischartgemeinte, offenbar verloren gegangene - bzw. nie aufgezeichnete - Geuchliedkönnte in einer älteren Form vielleicht schon von Laufenberg ins Auge gefaßtworden sein.
32 Einen ganz ähnlichen, mit dem vorliegenden vielleicht irgendwie zusammen-hängenden Refrain hat auch ein geistliches Trinklied aus dem Liederbuch derAnna von Köln: »Laist ons syngen ind vroelich syn, / in gen rosen, / mit Jhesusind den vrunden syn; / wer weis, wie lange wir hie sullen syn? / in gen rosen«;zit. nach Johannes Bolte: Das Liederbuch der Anna von Köln, ZfdPh 21, 1889,S. 129-163, hier S. 160, Nr. XVI A.
Der Wächter und die Müllerin 287
Kontrafakta bzw. die dahinter stehenden weltlichen Gassenhauergelten.
Zum zweiten läßt sich Laufenbergs souveräner Umgang mit Strophen-formen und Melodien auch aus der Handschrift selber belegen. ImJahre 1430, wohl auf Maria Verkündigung, entstand das Lied Es sassein edly maget schon (WKL 705; vgl. S. 311, Textanhang 3 A),höchstwahrscheinlich wieder ein Kontrafakt. Es ist ebenso wie dasgleich anschließende Weihnachtslied In einem krippfly lag ein kind(WKL 706; Textanhang 3 B) mit einer Melodie versehen, und zwarmit der identischen Melodie, auf die Laufenberg dann gleich nocheinen dritten Text - Ach, lieber herre, Ihesu Christ (WKL 707;Textanhang 3 C) - geschrieben hat. Es handelt sich um eine fastdurchgehend syllabische, schlichte - man darf wieder sagen: volks-liedhafte Melodie. Fast zehn Jahre später greift Laufenberg dasgleiche Strophenmuster nochmals auf, diesmal für die deutsch-lateinische Montagedichtung Puer natus ist vns gar schon (WKL 777;Textanhang 3 D), mit welchen Formen er in dieser Zeit öfters experi-mentiert hat.33 Die auch zu diesem Text ausnotierte Melodie weichtnun aber von der früheren vollständig ab; sie ist um einiges kunstvol-ler und melismatischer und entspricht damit der elaborierteren Text-gestalt. Identische Strophenformen müssen also auch beim gleichenAutor nicht musikalisch gleich realisiert worden sein.34
Es wird aber noch interessanter, denn kurz darauf verfaßt Laufenbergden Text Ein adler höh han ich gehört (WKL 767; Textanhang 3 E),zu dem er erneut eine Melodie mitliefert. In diesem Text haben diebeiden Refrainzeilen kein Gegenstück, und er scheint überhaupt mitden früheren vier Liedern formal nicht zusammenzuhängen. Verblüf-fenderweise wurde er aber dennoch auf die - cum grano salis -gleiche Melodie wie Puer natus ist vns gar schon gesungen. Laufen-berg hat ganz einfach auf die Stollenrepetition verzichtet und statt-dessen den ursprünglich dem Refrain unterlegten Melodieabschnittneu den Zeilen 3 und 4 zugewiesen. Hinzu kommen einige Nuancenund (besonders in der Schlußzeile) Erweiterungen des melodischenVerlaufs sowie die Transposition der ganzen Melodie um einen Tonnach unten. Daraus resultiert ein markant veränderter tonaler
33 Vgl. dazu Wachinger (wie Anm. 20), S. 377.
34 Hingegen ist anzunehmen, daß der hier wie schon im frühesten der genanntenLieder begegnende Anfangsreim - »schon:contemplation« bzw. »schon:ton« -wohl ebenso auf das zugrundeliegende weltliche Original zurückverweist wie derdurchgehend beibehaltene Reim der beiden Refrainzeilen. Vielleicht bilden Zeile lsowie der Refrain von WKL 705 sogar ein wörtliches Zitat aus der benutztenVorlage.
288 Max Schiendorfer
Charakter, worin zweifellos eine bestimmte künstlerische Absicht zumAusdruck kommt. Es sei darum nochmals die Vermutung geäußert,daß Laufenberg auch an den weltlichen Volksliedmelodien in
ähnlicher Weise weitergearbeitet haben könnte und daß ihm geradedeshalb etwas an ihrer schriftlichen Fixierung liegen mußte.35
Mehrfachverwendung der gleichen Melodie begegnet bei Laufenbergauch sonst. So bei dem 1425/27 entstandenen 'Zwillingspaar' Wolufin
andaht allgemein (WKL 721) und Woluf, du boese weit gemein (WKL
722),36 ebenso auch bei den auf 1434/36 zu datierenden Liedern Sich
het gebildet in min hertz (WKL 787) und Ach, döhterlin, min sei
gemeit (WKL 708), zwei weiteren Kontrafakten.37 Endlich erinnere
35 Zu Laufenbergs musikalischer Bearbeitungstechnik vgl. Josef Müller-Blattau:Heinrich Laufenberg, ein oberrheinischer Dichtermusiker des späten Mittelalters,Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 17, 1938, S. 143-163; ders.: Kontrafakturen imälteren geistlichen Volkslied, in: Festschrift für K.-G. Feilerer, Regensburg1962, S. 354-367, hier S. 355-358.
36 Zum ersten Stück ist die Melodie aufgezeichnet, das zweite trägt die (auf diemusikalische Form bezogene) Überschrift aliud ad idem. Erneut handelt es sichohne Zweifel um Kontrafakta, obwohl sich in diesem Falle leider noch gar keineSpur des weltlichen Vorbildes finden ließ. Dabei läge gerade diesmal einausnehmend präzises Robotbild vor: Die beiden Texte stimmen in den Reimen derersten zwei Strophen und in den Anfangswörtern sämtlicher fünf Strophen über-ein, was mit Bestimmtheit auf das benutzte Original zurückverweist. Hinzu trittder ausgesprochen individuelle Strophenbau mit den stakkatoartigen Wortwieder-holungen der Zeilen 5 und 6. Ich hege die allerdings eher intuitive Vermutung,daß am ehesten nach einem Trink- und Zechlied zu suchen wäre, und ich würdemich durchaus nicht wundern, wenn man dann in Zeile 7 nicht »Sant Mary« wieim ersten Kontrafakt, sondern »sant Martin« zu lesen bekäme (vgl. LaufenbergsMartinslied-Kontrafakt WKL 796 [wie Anm. 38] mit eben dieser Umdeutung vonMartin auf Maria; vgl. ferner auch etwa das Incipit des von Franz JoachimBrechtel 1594 herausgegebenen Trinklieds Frisch auffjhr Brüder all gemein unddazu Max Steidel: Die Zecher- und Schlemmerlieder in deutschen Volksliede biszum Dreißigjährigen Kriege, Diss. Heidelberg, Karlsruhe 1914, S. 37; denansonsten ganz abweichenden Text dieses Trinklieds siehe bei Lutz Röhrich undRolf Wilhelm Brednich: Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien, 2 Bde.,Düsseldorf 1967, hier Bd. II, Nr. 62b).
37 Die weltliche Vorlage des erstgenannten (und älteren) Stücks hat sich offenbarnicht erhalten, ist jedoch immerhin im Liederregister einer Handschrift aus demersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nachgewiesen. Die dort zitierten beidenEingangszeilen lauten: »Sich hat gepilt jn mein hercz /jr liplich gestalt nach jrfigur« (vgl. Manfred Zimmermann: Das Liederregister im cgm 5919, ZfdA 111,1982, S. 281-304, hier S. 287; nach Zimmermann ist dieses Lied "anderweitignicht bekannt"). Wie man sieht, ließ Laufenberg es auch in diesem Falle nicht beieinem Zitat der Incipit-Zeile bewenden, sondern behielt darüber hinausmindestens noch den zweiten Reimklang der Eingangsstrophe bei. Doch auch imfolgenden Verlauf erinnern manche Wendungen an weltliche Liebesdichtung. Wie
Der Wächter und die Müllerin 289
ich en passant daran, daß Laufenberg das bekannte Martinslied desMönchs von Salzburg Wol auff, lieben gesellen unverczait ebenfalls
zweimal kontrafaziert und dabei naheliegenderweise die sinnenfroheVerherrlichung von Wein und Speise auf den Wein der göttlichenMinne bzw. auf die geistliche Himmelsnahrung umgemünzt hat.38
IV
Dem Motiv der geistlichen Nahrung sei im folgenden etwas weiter
nachgegangen, genauer gesagt: der bildhaften Vorstellung von Chri-
stus, dem Weizenkorn. Sie findet sich bei Laufenberg des öfteren:
Es ist ze bethleem gebornin einer hütten cleyne,
ein süesses edel weissen körn,
daz über morn
für vns all stirbt gemeine,
(WKL 702, Strophe 6, l-5)
so heißt es an einer Stelle, und anderswo mit ganz ähnlicher, nun aber
Maria etwas mehr in den Vordergrund rückender Formulierung:
Die het hinaht, magt rein, geborn
daz weissen körn,
daz über morn
weit im übrigen auch das Parallelkontrafakt Ach. döhterlin noch von derweltlichen Vorlage zehrt, ist natürlich ungewiß. Vor allem die Strophen 5 bis 7könnten Reminiszenzen eines Liebes- oder Tageliedes bewahrt haben. Manbeachte etwa Zeile 5,3: »[Got] seczt dich in der mynne band«, zu der Laufenbergdie korrigierende Variante »[...] in daz vatter land« nachtrug, verräterischerweise,wie ich meine, denn es mag ihm die zunächst wortgetreu geborgte Minneband-Formel später suspekt geworden sein, da sie ja auch in der weltlichen Traditionzumindest von zwiespältiger Natur ist.
38 Das Martinslied des Mönchs vgl. bei Franz V. Spechtler et al. (Hgg.): Der Mönchvon Salzburg, ich bin du und du bist ich. Lieder des Mittelalters, München 1980,Nr. 25; Horst Brunner / Hans Ganser / Karl Günther Hartmann: Das Winds-heimer Fragment einer Musikhandschrift des 15. Jahrhunderts, in: Jahrbuch derOswald von Wolkenstein Gesellschaft l, 1980, S. 185-222, hier S. 188-194,215f., 220. Laufenbergs Kontrafakta (WKL 795 und 796) zeigen wieder seineoffenbar typische Manier, die benutzte Vorlage zu zitieren (in den Anfangszeilensämtlicher Strophen sowie in einer Reihe weiterer Reimwörter bzw. -klänge) undgleichzeitig formal zu variieren (in WKL 795 sind die Strophen 2 und 4umgestellt, der Tenor überhaupt weggelassen; in WKL 796 weisen die Strophenunterschiedliche Zeilenzahlen auf).
290 Max Schiendorfer \h sinen tot wendet des vatters zorn
(WKL751, Strophe 1,13-16).39
Neben solche eher beiläufig-punktuelle Erwähnungen tritt nun einLied, welches Laufenberg durchaus zurecht mit dem programmati-schen Titel Christus das weißenkörnlin überschreiben konnte (WKL704a). Nach den ersten vier Strophen, die sich auf die VerkündigungGabriels und die Empfängnis des Heiligen Geistes beziehen, folgt eineauf fünf Strophen ausgedehnte Behandlung des Weizenkorn-Motivs:Maria mahlt das göttliche Weizenkorn Christus zu reinem Semmel-mehl, aus dem zuletzt das edle Himmelsbrot gebacken wird.
Offenkundig nimmt Laufenbergs Text auf die Allegorie der sogenann-ten geistlichen oder mystischen Mühle Bezug, die sich in Literatur wieBildender Kunst des Spätmittelalters vielfach belegen läßt. Ichskizziere diese (letztlich auf Joh. 12,24 zurückgehende) Tradition inwenigen Strichen und nur soweit sie dem deutschsprachigen Raumzuzuweisen ist, der hierin eine weitgehende Sonderentwicklunghervorgebracht hat.40
Literarisch tritt das Mühlengleichnis erstmals in einem Rätselgedichtdes 13. Jahrhunderts unter dem Namen König Tirol und Fridebrantsin sun auf. Allerdings liegt hier eine ganz andere Ausprägung derAllegorie vor, von der keine Fäden zu Laufenbergs Weizenkorn, alsozum Thema der Menschwerdung des Gottessohnes führen. Vielmehrgeht es dem Rätselsteller darum, die Ablösung des Alten durch dasNeue Testament zu verbildlichen.41
39 Vgl. außerdem die Belege WKL 729, Strophe 2; WKL 737, Strophe 27; WKL770, Strophe 6.
40 Ausführlicheres zum Thema vgl. bei Heinrich Schulz: Die mittelalterlicheSakramentsmühle, Zeitschrift für Bildende Kunst 63, 1929/30, S. 207-216; AloisThomas: Die Darstellung Christi in der Kelter, eine theologische und kulturhi-storische Studie, Düsseldorf 21981 ('1936), bes. S. 163-169; Hans Vollmer:Bibel und Gewerbe in alter Zeit. Kelter und Mühle zur Veranschaulichung kirchli-cher Heilsvorstellungen (Deutsches Bibelarchiv 7), Hamburg 1937; Harald Rye-Clausen: Die Hostienmühle im Lichte mittelalterlicher Frömmigkeit, Stein amRhein 1981.
41 Winsbeckische Gedichte nebst Tirol und Fridebrant, hg. v. Albert Leitzmann,Dritte, neubearbeitete Aufl. von Ingo Reiffenstein (ATB 9), Tübingen 1962, S.79-82; vgl. dazu Walter Blank: Zu den Rätseln in dem Gedicht von Tirol undFridebrant, PBB (West) 87, 1965, S. 182-199; Christoph Gerhardt: Zu denRätselallegorien in Tirol und Fridebrant, Euph. 77, 1983, S. 72-94. Bei denMeistersängern wurde das Mühlenrätsel offenbar namengebend für den Tirol-Ton, doch gilt ihnen Wolfram von Eschenbach als Erfinder der 'Mühlweise'; vgl.Gisela Kornrumpf: Die Kolmarer Liederhandschrift, Bemerkungen zur Prove-
Der Wächter und die Müllerin 291
Die nächsten literarischen Mühlenallegorien kommen unseremBeispieltext viel näher, doch gehören sie wohl allesamt, ebenso wieLaufenbergs Weizenkornbelege, erst ins zweite Viertel des 15.Jahrhunderts (Laufenbergs ältester Beleg, WKL 702, datiert von1423). Dies gilt für ein kunstfertiges Meisterlied Muskatblüts Ich rewtvnd wül nach einer mül42 ebenso wie für eine wieder in Rätselformpräsentierte Spruchreihe in Regenbogens Grauem Ton.43 In beidenTexten wird Gott in der Rolle des Müllers vorgestellt, doch zeigt sichdie relative Eigenständigkeit der zwei Ausführungen schon darin, daßMaria bei Tseudo'-Regenbogen als des Müllers Magd erscheint,während Muskatblüt sie als das von Gott gezimmerte Bauwerk derMühle auffaßt. Endlich wäre das ursprünglich wohl niederdeutsche,bald aber auch ins Hochdeutsche und Niederländische übertragene'geistliche Mühlenlied' zu nennen: Eine mole ik buwen wil.44 Vondiesem anonymen, im 15. Jahrhundert äußerst populären Text führennun wiederum handfeste Verbindungslinien zu verschiedenen bildli-chen Darstellungen des gleichen Zeitraums. Eine Federzeichnung auseiner Mettener Handschrift von 141445 (vgl. S. 315, Abb. 2) zeigt inden oberen Bildecken die Verkündigungsszene. Darunter schütten dievier Evangelisten das Korn in den Mühltrichter; die Apostel setzen dasMahlwerk mittels einer Handkurbel in Gang,46 und unten schließlichfangen die vier Kirchenväter das menschgewordene Wort Gottes ineinem Kelch auf. In anderen Darstellungen trägt Maria einen Korn-sack zur Mühle, oder sie gesellt sich hilfreich zu den vier Evange-
nienz, in: Ja muoz ich sunder riuwe sin, Festschrift für Karl Stackmann, Göttin-gen 1990, S. 155-169, hier S. 157f.; Frieder Schanze / Burghart Wachinger:Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts,Bd. 5, Tübingen 1991, S. 436f. und 582.
42 Eva und Hansjürgen Kiepe (Hgg.): Epochen der deutschen Lyrik 2, 1300-1500(dtv 4016), München 21982 S. 210-213; WKL 651.
43 Friedrich Heinrich von der Hagen (Hg.): Minnesinger, Bd. III, Berlin 1838, S.347-349; WKL 419.
44 Vgl. den Artikel 'Geistliches Mühlenlied' von Eva Kiepe-Willms, in: Verfasser-lexikon Bd. 2, 1980, Sp. 1169-1172, und die dort angeführte Literatur.
45 Bayerische Staatsbibliothek München, clm 8201; das Mühlenbild findet sich auff. 37r. Vgl. Rye-Clausen (wie Anm. 40), S. 50f.
46 Neben dieser Stenographisch durchaus vorherrschenden Variante mit der alter-tümlichen Handmühle begegnen gelegentlich auch technisch aktuellere Umsetzun-gen, in denen die Apostel stattdessen die Schleusen einer Wassermühle bedienen.Vgl. etwa das um 1450 entstandene Hostienmühle-Fenster des Berner Münsters;dazu Luc Mojon: Die Stadt Bern. Das Münster (Die Kunstdenkmäler derSchweiz, Bern, Bd. IV), Basel 1960, S. 304-317. Auch Laufenberg stellt sichallem Anschein nach eine Wassermühle vor.
292 Max Schiendorfer
listen, wie beispielsweise auf einem Altarbild des Ulmer Münsters vonca. 1470 (vgl. S. 316, Abb. 3).47
Im wesentlichen treffen die eben gemachten Aussagen auch auf das'geistliche Mühlenlied' zu, wo allerdings das Personal um die gegen-wärtige Priesterschaft aufgestockt ist. Sie soll die Mühle 'bewahren',sprich: die Menschwerdung Christi im Sakrament der Eucharistie stetsaufs neue nachvollziehen. Hier zeichnen sich also unterschiedlicheMöglichkeiten der Schwerpunktbildung ab. Ein Künstler konnte dasGewicht seiner Aussage mehr auf den einmaligen heilsgeschichtlichenVorgang oder auf dessen Vergegenwärtigung im Meßopfer legen.Ebenso konnte die Rolle Marias verschieden interpretiert werden. Siekann als Spenderin oder 'Lieferantin' des edlen Weizenkorns auftreten- was sicher in Verbindung mit dem Topos Maria im ÄhrenkJeid zusehen ist -; sie kann aber auch die mehr dienende und instrumentaleFunktion der Mühle übernehmen, durch die das Korn Christushindurchgeht und zum Mehl seiner zweiten, menschlichen Naturgemahlen wird.
Den glühend-pathetischen Marienverehrer Laufenberg scheint keineder beiden Auslegungen ganz befriedigt zu haben. Die zweite viel-leicht deshalb nicht, weil er der Gottesmutter keine derart subalterne,buchstäblich 'mechanische' Rolle zumuten wollte. Und die erste, weilsie mit der intendierten Deutung des Mühlenbildes auf den heilsge-schichtlichen Vorgang der Inkarnation mehr oder weniger in Konfliktgerät: Das auf dem Acker Maria gewachsene Korn i s t ja bereits dermenschgewordene Gottessohn. Der Mahlvorgang bezeichnet in denAllegorien dieses Typs also nicht mehr die Menschwerdung, sondernviel eher die Offenbarung des göttlichen Wortes in den Evangelien;oder die Allegorie wird um sekundäre Erweiterungen bereichert, indenen der Mahlprozeß auf Christi Erlösertod und/oder auf daseucharistische Sakrament umgedeutet wird (vgl. den ikonographischenSondertypus der Hostienmühlen, dem auch das Ulmer Altarbild zuge-hört). Aber auch diese Lösungsversuche führen unter anderem unwei-gerlich dazu, daß für Maria nur mehr eine Nebenrolle übrigbleibt.
Ganz anders bei Laufenberg (vgl. S. 312, Textanhang 4 A), der offen-bar das eine tun und das andere nicht lassen wollte: Er stellt dieGottesmutter quasi gleichberechtigt an die Seite Gottvaters. Gottvaterist - wie üblich - der Müller, der (Zeile 6,2) »sin gnade malt«.Ebenso hat aber auch Maria (Zeile 5, l f.) »daz edel weissen körne [...]gemalet wol«. Eigentlich ist sogar sie es, die die ganze Mühle in Stand
47 Heute im Ulmer Museum befindlich (Inv. Nr. 2150); vgl. Rye-Clausen (wieAnm. 40), S. 97-99.
Der Wächter und die Müllerin 293
setzt und aktiv betreibt: »Sy kan den stein wol byllen« (Zeile 5,5), »Sykan die müli rihten« (Zeile 6,1), und sie soll »daz wasser fliessen«lassen (Zeile 7,1), womit das antreibende Wasser des Mühlbacheszweifellos mitgedacht ist. Das heißt, Maria übernimmt hier zugleichauch die sonst den Aposteln zugedachte Verantwortung, und neben ihrbleibt schlechterdings kein Spielraum für weitere Akteure.
Daß der Mahlvorgang tatsächlich die Menschwerdung bezeichnet, istam deutlichsten in Strophe 8 ausgedrückt, wo das reine Semmelmehlin die Schale der Menschheit aufgefangen wird. Es folgt der Verweisauf »mittendag ze none«, den Erlösertod, den Laufenberg in Strophe9 mit dem Backen des edlen Himmelsbrotes versinnbildlicht. Undwenn der Autor zuguterletzt dieses Himmelsbrot als die Speise seinerSeele »byß in daz ewig leben« apostrophiert, so ist damit gewiß derGedanke an das Sakrament der Eucharistie angesprochen. Übrigens istes vielleicht kein Zufall, wenn ein Traktat des 15. Jahrhunderts, derdie Passionsgeschichte "unter dem Bild des Weizenkorns von der Saatbis zum Backen und Verspeisen" darstellt,48 gerade in einer Freibur-ger Handschrift des, Jahres 1487 überliefert ist. Das literarischeWeizenkorn-Motiv scheint regional auch über Laufenberg hinausbekannt und beliebt gewesen zu sein.
Doch zurück zum Thema der Kontrafaktur und zu Maria, derMüllerin: Offensichtlich wurde Laufenberg zu dieser charakteristi-schen Umakzentuierung einer damals wohl 'modischen' Allegoriemaßgeblich von einem Volkslied über eine stolze, schöne und gewißnicht allzu sittenstrenge Müllersfrau inspiriert. Wiederum ist zwar der
48 Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., Cod. 253, f. 30v-7 lv, mit der rubriziertenVorbemerkung: »passion gezogen vf daz weiszen körn, wie man das büwen,seyen, eren, schniden, tröschen, rittren, werffen, malen, bütlen vnd bachenmuosz, vntz daz brot dor vsz wirt«; vgl. Albert V. Schelb: 'Geistliches Weizen-korn', in: Verfasserlexikon, Bd. 2, 21980, Sp. 1181f. Ferner findet sich dasWeizenkom-Motiv gegen Mitte des 15. Jahrhunderts in einer Mystikerhandschriftder Colmarer Stadtbibliothek; vgl. Karl Bartsch: Beiträge zur Quellenkunde deraltdeutschen Literatur, Straßburg 1886 (S. 311-333, Kapitel 'Lieder derMystiker'), S. 323: »Wer wil nun bevinden / des weyssen kornes val, / der solbald begünnen / und swingen überal«. Auch die gegen 1480 im Elsaß entstandenePfullinger Liederhandschrift enthält Ein winacht Lied mit dem gleichen Motiv:»Woluff gon Bethleem behend [...] Dz weissen körn / ist kusch geborn / Jhesus,den sönd ir minnen«; vgl. WKL 815 und Volker Kaiisch: Die sogenanntePfullinger Liederhandschrift, Württembergische Blätter für Kirchenmusik 49,1982, S. 3-19 und 51-57, hier S. 11; die gleiche Handschrift bietet übrigens aucheine Parallelquelle zu Laufenbergs Weihnachtslied WKL 706 In einem kripfflylag ein kind (vgl. WKL 706, rechte Spalte; Kaiisch, S. 17) und daneben eineganze Reihe weiterer Kontrafakta.
294 Max Schiendorfer
von ihm benutzte Originaltext nicht erhalten, doch läßt sich aufgrundeiner ganzen Reihe von Vergleichsquellen wenigstens die ersteStrophe einigermaßen sicher rekonstruieren:
Ich weiss ein stolze mülnerin,die ist gar hübsch und fin;ich weiss in allen landenkein hübschre mülnerin.Vnd soll ich bi ir malen,min körnlin zuo ir tragen,das wer der wille min.
Fortsetzung kann man sich leicht hinzudenken, zumal das Stück auchin Fischarts Repertorium frivoler Geuchlieder vertreten ist.49 Wieschon im Falle des Totenamt-Kontrafakts auffiel, wählt Laufenbergalso auch hier wieder zielsicher die größtmögliche 'Amplitude' zwi-schen Original und geistlicher Umdichtung: Dort wurde der tragisch-
49 Die nur im Sinne einer ungefähren Annäherung verstandene Rekonstruktion gehtaus von der Fassung Johannes Otts von 1534 (Textanhang 4 B; zit. nach Müller[wie Anm. 19], S. 81), die mit verkürzter Strophenform im Bergliederbüchleinvon 1700 wiederkehrt (hg. v. Elizabeth Mincoff-Marriage [Bibliothek desLitterarischen Vereins in Stuttgart 285], Tübingen 1936, Nr. 127; vgl.Textanhang 4 C); letztere liefert die Bestätigung für Laufenbergs Schlußzeile »dazwer der wille min«. Das Attribut »stolz« in Zeile l läßt sich ebenfalls sicher-stellen, zum einen aus einer Parallelüberlieferung zu Laufenbergs Kontrafakt(Landesbibliothek Karlsruhe, St. Georgen Pap. Germ. 74, f. 13; datiert auf1448) mit der Melodieangabe »Jn die wisse Div stolze müllerin« (WKL 704b),zum ändern aus Fischarts Geuchliederkatalog »Ich weiß mir ein stoltze Müllerin,vnd solt ich bei jr malen« (Williams [wie Anm. 28], S. 29f.). Fischarts »vnd sollich bei jr malen« - gleichlautend auch zitiert in Georg Forsters Quodlibet 60/11von 1549 - dürfte der von Laufenberg benützten Vorlage ebenfalls näherkommen als Otts »Wolt Gott [...]«. Weniger Sicherheit besteht bei Zeile 2. Vgl.immerhin die niederländische Melodieangabe der Veelderhande liedekens von1569, »Het was een Molenarinne, si was huepsch en daer to fijn« (PhilippWackernagel: Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit derVerfolgung im 16. Jahrhundert, Frankfurt 1867, S. 101), sowie die folgendezum roienamf-Komplex gehörende 'Wanderstrophe' aus einer HeidelbergerHandschrift von 1582: »Das megdlein, das ich meine, / das ist gar hübsch undfein, / und solt ich bei jhr schlaffen, / schlaffen, / das wer der wille mein« (ArthurKopp: Volks- und Gesellschaftslieder des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Liederder Heidelberger Handschrift Pal. 343 [Deutsche Texte des Mittelalters 5], Berlin1905, S. 139, Str. 8). Zur typischen Rolle der im Volkslied als begehrenswertund oft genug als ungetreu dargestellten Müllerin vgl. neben demwiedergegebenen Beispiel aus dem Bergliederbüchlein auch etwa die Texte beiErk / Böhme (wie Anm. 28), Bd. I, S. 494-499, sowie Siegfried Grosse: DieMühle und der Müller im deutschen Volkslied, Jahrbuch des ÖsterreichischenVolksliedwerkes 11, 1962, S. 8-35, bes. S. 28f.
Der Wächter und die Müllerin 295
definitive Verlust des Geliebten umgedeutet in die »allzit« währendeLiebesvereinigung, die unio mystica mit dem sponsus Christus; hiertritt die geradezu gottähnlich gezeichnete Himmelskaiserin an dieStelle der sprichwörtlich verrufenen Müllerin (die zudem ein vieler-orts als 'unehrlich' geltendes Gewerbe repräsentierte). Und wie schondort bezieht Laufenberg sich erneut auf mehrere Inspirationsquellen.Diesmal assoziierte und kombinierte er das Geuchlied von der stolzenMüllerin mit der Allegorie der geistlichen Mühle, die ihm ausaktuellen literarischen und eher noch bildlichen Umsetzungen bekanntgewesen sein dürfte.50
Zur weiteren Illustration dieser für Laufenberg offenbar typischenKontrafakturtechnik sei endlich noch sein vielleicht bekanntestes Liedherangezogen, Ich wölt, daz ich doheime wer (WKL 715). Zu diesemhat Ruberg zutreffend notiert, daß der 'Auslegegestus' der zweitenStrophe - »ich mein, doheim in himelrich« - meist ein recht zuver-lässiges Erkennungssignal für Kontrafakta hergibt.51 Und tatsächlichdürfte Laufenbergs Lied erneut einer weltlichen Vorlage nachgebildetsein. Einen weiteren Anhaltspunkt liefert dafür die Melodie, die mitjener der Ballade Es hat ein Bauer braun Annelifein eng verwandt ist
50 Wie schon angedeutet, dürfte ihm dabei eine allegorische Darstellung einerWassermühle vorgeschwebt haben, welche zudem (wie die Mettener Zeichnung)das Mühlengleichnis um die 'Vorgeschichte' von Maria Verkündigung erweiterte.Damit sei die Möglichkeit natürlich nicht von vornherein ausgeschlossen, "daßLaufenberg im weltlichen Lied eine durchgeführte verschlüsselnde Allegorievorfand, in der die müllerischen Verrichtungen und vielleicht auch die Bestand-teile der Mühle für Sexuelles stehen" (Uwe Ruberg: contrafact uff einengeistlichen sinn - Liedkontrafaktur als Deutungsweg zum Spiritualsinn?, in:Geistliche Denkformen in der Literatur des Mittelalters, hg. v. Klaus Grubmülleru. a. [Münstersche Mittelalter-Schriften 51], München 1984, S. 69-82, hier S.78; Ansätze zu einer solchen Allegorisierung vgl. übrigens im abgedruckten Textaus dem Bergliederbüchlein). Aber auch dann wäre am hier postulierten, vonRuberg außer acht gelassenen Bezug auf die geistliche Mühlenallegorie mitBestimmtheit festzuhalten. Ja man müßte sich dann wohl eher umgekehrt dieFrage stellen, ob Rubergs hypothetisch erschlossene Sexual-Allegorie nichtihrerseits die 'geistliche Mühle' parodiert. Übrigens sieht Ruberg vor allem inLaufenbergs Strophe 4 den Text "aus dem weltlichen Müllerin-Lied" noch relativunversehrt durchscheinen (S. 79). Dies dürfte sicherlich zutreffen und wäre nurdahingehend zu präzisieren, daß es sich dabei um einen weiteren Beleg der oben(wie Anm. 28) erwähnten Wanderstrophe handelt.
51 Ruberg (wie Anm. 50), S. 77; vgl. etwa das oben (wie Anm. 28) schon beiläufiggenannte Kontrafakt Es wolt ein Jäger jagen (Uhland [wie Anm. 25], Nr. 338),dessen zweite Strophe lautet: »Der Jäger den ich meine / der ist uns wol bekant, /erjagt mit einem engel: / Gabriel ist er genant.«
296 Max Schiendorfer
und sicherlich genetisch zusammenhängt.52 Auch mit dem Thema die-ser Ballade - die unfreiwillig vermählte Bauerstochter stirbt, kaum imHaus ihres Gatten angekommen, vor Heimweh - würde Laufenbergsmystische Jenseitssehnsucht 'kontrapunktisch' wieder ausgezeichnetzusammenpassen. Allerdings müßte dann wohl (einmal mehr) um1430 eine Balladenversion kursiert haben, deren Wortlaut von denerst wesentlich später überlieferten Fassungen gravierend abwich undstattdessen mit demjenigen Laufenbergs zumindest punktuell - vorallem in den Strophenanfängen und exponierten Reimwörtern - über-einstimmte.53
Auf einige weitere von Laufenberg geistlich »verkette« Wächterliederkann ich nur noch summarisch verweisen: auf WKL 702, Stand vf, dusünder, laß din dag (mit der Überschrift Ein tagwiß meisterlied);WKL 710, Jch weiß ein lieplich engelspil (dessen Strophenbauvielleicht eine Reduktionsform jenes 'Meisterlieds' darstellt); WKL
52 Vgl. John Meier (Hg.): Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, hg. v.Deutschen Volksliedarchiv, Bd. III: Balladen, Zweiter Teil, Berlin 1939, S. 240-254 (Die erzwungene Braut), bes. S. 242 und 251.
53 Übrigens fand Laufenbergs Lied noch im 15. Jahrhundert einen sekundärenBearbeiter, der die zweizeilige Strophe zu einem Dreizeiler umformte. AusLaufenbergs Schlußstrophe »Alde, weit! got gsegen dich, / ich var do hin genhimelrich wurde auf diese Weise Got gesegen dich, weit, ich far da hin, / Gotgesegen dich, weit, ich far da hin, / ich far da hin gen himelrich« (WKL 716,Strophe 6). Fast könnte man denken, Laufenberg selbst sei hier am Werkgewesen, doch dürfte es wohl eher zutreffen, daß ein etwas jüngerer Anonymussich die 'typisch' laufenbergsche Kontrafakturtechnik in wesentlichen Punktenzueigen gemacht und Laufenbergs Vorarbeit gleichsam mit dessen eigenenMethoden fortgesetzt hat: metrisch-musikalische Umgestaltung unter Einbezugweltlicher Sekundärquellen. Im vorliegenden Falle handelt es sich bei derSekundärquelle erneut um eine Ballade - Peter Unverdorben -, die das formaleDreizeilenmodell beisteuerte. (Vgl. Meier [wie Anm. 28], Nr. 26. Einzige Quelledieser Ballade ist übrigens die oben [wie Anm. 27] erwähnte St. BlasierHandschrift, aus der auch die von Laufenberg kontrafazierte Totenamt-Versionstammt!) Aber auch inhaltlich betrachtet erfolgte die Kontamination keineswegszufällig, ist dieser Peter Unverdorben doch ein zum Tode verurteilter Straftäter(oder politischer Gefangener?), der nach abgelehntem Begnadigungsgesuch sichauf seine Hinrichtung vorbereitet: »Gott gesegen dich, sunn, gott gesegen dich,mon, / gott gesegen dich, schönes lieb, wa ich dich hon: / ich muos mich von dirschaiden« (Str. 12). Die Situation des Abschieds von der Welt ist die gleiche wiebei Laufenberg, nur eben wieder unter gegenläufigem Blickwinkel beurteilt. Dieshatte der sekundäre Bearbeiter ebenso zu berücksichtigen wie die in der drittenZeile abweichende Reim- und Kadenzform. So lautet denn das Ergebnis fastzwangsläufig: »Got gesegen dich, sun, got gesegen dich, man, / Got gesegendich, sun, got gesegen dich, man, / ich will zuo minem schöpffer gan« (WKL716, Strophe?).
Der Wächter und die Müllerin 297
723, Stand vf vnd sih ihesum vil rein (von Wackernagel mit Wählergot übertitelt) sowie vor allem auf die beiden Lieder WKL 717 und720, in denen der Tageliedwächter zu einem geistlichen Lehrermutiert hat, der die zehn Gebote bzw. die zwölf Glaubensartikel inkatechetischer Manier ausbreitet.54
In der älteren Forschung wurde die Technik der Kontrafaktur oftetwas leichtfertig als eine besondere Spielart der schulmäßigen Alle-gorese bezeichnet. Uwe Ruberg hat demgegenüber zurecht nachgrößerer terminologischer Disziplin verlangt. Tatsächlich dürfte esschwer fallen, auch nur einen überzeugenden Beispieltext beizubrin-gen, der in strengem Sinne exegetisch angelegt ist und die weltliche"Vorlage Punkt für Punkt mystice oder moraüter 'ausdeutet'."55 Dastrifft auch auf Heinrich Laufenbergs Kontrafakta zu.
Andererseits erweist sich Laufenbergs Umgang mit dem Originaltextals durchaus nicht gar so frei und unverbindlich, wie Eduard Müllerzu erkennen meinte: "Er begnügte sich damit, in den Anfangsstrophen(oft sogar nur in den Eingangsworten) einen Anlass zu finden, um dieVorzüge des geistigen Lebens denen des irdischen Lebens in einersozusagen antithetischen Form gegenüberzustellen. Dann aber fuhr erfrei fort, unbekümmert um weiteren Anschluss an das Volkslied."56
54 Beim letztgenannten Kontrafakten-Paar ist die geistliche Umdeutung allerdingsnicht Laufenbergs eigener Einfall. Vielmehr benutzte er ein niederdeutsches (!),im Kern siebenstrophiges Kontrafakt, das er 1429 ins Hochdeutsche übertrug(WKL 717: Ein lerer ruoft vil lut vs hohen sinnen), formal und stilistischüberarbeitete sowie um neun eigene Zusatzstrophen vermehrte. (WachingersFormulierung, WKL 717 stamme "sicher nicht von Laufenberg" - [wie Anm.17], Sp. 619 -, ist zumindest mißverständlich.) Es handelt sich also um einSekundär- oder 'Parallelkontrafakt' auf ein letztlich zugrundeliegendes, nichterhaltenes, höchst wahrscheinlich ebenfalls niederdeutsches Wächterlied. Beidem 1438/39 entstandenen Text WKL 720, Vil lut so ruoft ein lerer hoher sinnen,wäre demnach gar von einem 'Tertiärkontrafakt' zu sprechen. Diese beideninsbesondere rezeptionsgeschichtlich hochinteressanten Stücke hoffe ich bald ananderer Stelle ausführlicher würdigen zu können.
55 Ruberg (wie Anm. 50), S. 71; den Verweis auf ältere Äußerungen zum Themavgl. dort, ebenso das angeführte Zitat von Michael Curschmann: Typeninhaltsbezogener formaler Nachbildung eines spätmittelalterlichen Liedes im 15.und 16. Jahrhundert. Hans Heselloher: 'Von üppiglichen Dingen', in: Werk -Typ - Situation. Festschrift für Hugo Kühn, Stuttgart 1969, S. 305-325, hier S.315.
56 Müller (wie Anm. 19), S. 79.
298 Max Schiendorfer
Nach dieser Ansicht käme dem (isoliert bleibenden) Initialzitat alsoungefähr die Funktion einer rubrizierten Melodieangabe zu, wie z. B.»Jn die wisse Div stolze müllerin«. Freilich beruhte Müllers Urteil aufungenügenden Voraussetzungen, da er zum einen in manchen Fällendie weltlichen Vorlagen Laufenbergs nicht oder jedenfalls nicht in denihm am nächsten stehenden Fassungen kannte, während er zum ändernden vom Wortlaut des 15. Jahrhunderts längst abgekommenen spätenDerivaten - wie Es stet ein lind in jenem tal - einen Zeugniswertunterstellte, der ihnen mitnichten zukommt. Die Kontrafakta WKL709, 721, 722, 795, 796, deren Vorlagen in voller Länge vorliegenoder erschließbar sind, zeigen vielmehr, daß Laufenberg seineAnknüpfungspunkte an das weltliche Lied zwar tatsächlich in denEingangsstrophen mit erhöhter Konzentration plaziert, daß er aberauch, gleichsam nach dem Gießkannenprinzip, sämtliche übrigenStrophen mitberücksichtigt. Nicht daß es sich dabei immer umbesonders aussagekräftige oder spiritualiter auslegungswürdige Zitatehandeln würde; auch ziemlich triviales und banales Wortmaterial kannsich mitunter ins Kontrafakt einschleichen, denn sehr oft scheinteinzig die exponierte Stellung am Strophenanfang für die Selektionentscheidend zu sein. Schon daraus erweist sich, daß eine strengsystematische Allegorese nicht Laufenbergs Anliegen war. Hingegenhat es sehr wohl System, wenn er in regelmäßigen Abständen immerwieder den Wortlaut des Originals in Erinnerung ruft. Mit densporadisch eingestreuten Erkennungssignalen will er die im weltlichenLied vorgegebenen Konstellationen und Vorgänge offenbarfortwährend im Bewußtsein der Rezipienten wachhalten, und dieswohl im Sinne einer hintergründigen Kontrastfolie, vor der dieeigenen Aussageabsichten sich desto schärfer profilieren sollen.
Es ließe sich mithin auch schwer plausibel machen, daß Laufenbergmit seinen Kontrafakten primär die weltlichen Vorlagetexte zuersetzen und von der Bildfläche zu verdrängen beabsichtigt hätte.57
Wie alle mit innerliterarischen Verweistechniken operierendenGattungen - Parodie, Travestie, Pastiche, Cento, Quodlibet u. ä. -bezieht die Kontrafaktur ihren spezifischen Reiz ja gerade aus dem
57 Diese in der älteren Forschungsliteratur leitmotivisch wiederkehrende Ansichtvgl. etwa - mit speziellem Bezug auf die Tageliedkontrafakta - bei RichardKienast: Die deutschsprachige Lyrik des Mittelalters, VII. Die geistliche Lyrik des13. bis 16. Jahrhunderts (bis zu Luther), in: Deutsche Philologie im Aufriß, hg.v. Wolfgang Stammler, Bd. 2, Berlin 21960, Sp. 129: "Die Kontrafaktur istüberhaupt nur zu verstehen aus dem Bestreben, die sittlich gefährdenden undverderblichen Tagelieder durch Umsetzen ins Geistliche unschädlich zu machen."Vgl. dagegen Ruberg (wie Anm. 50), S. 77, und Max Wehrli: Literatur imdeutschen Mittelalter. Eine poetologische Einführung, Stuttgart 1984, S. 282.
Der Wächter und die Müllerin 299
Spannungsverhältnis, das sie zwischen sich und dem »verkerten«Ausgangstext auflädt, und ist demzufolge auf Gedeih und Verderbdavon abhängig, daß ihre Rezipienten dieses Verhältnis auch zudurchschauen und zu würdigen vermögen. Die vollständige Verdrän-gung des Originals träfe das Kontrafakt am eigenen Lebensnerv, eswürde sich sozusagen wesensmäßig selbst aufgeben und aufheben.
Die oben vorgestellten Kontrafakta Heinrich Laufenbergs machen sichdas angesprochene Spannungsverhältnis in geradezu forciertem Maßedienstbar. Als Basistexte haben wir Melodramen, verschiedene Eroti-ka (Tagelieder, Müllerin-Schwank) oder die Freß- und Sauforgie desMartinslieds kennengelernt, also vorzugsweise solche Texte, welchedie durch Liebe und Tod schicksalhaft verursachten Leiden dieserWelt wie andererseits auch ihre sinnlich-animalischen, sub specieaeternitatis natürlich ganz und gar 'kranken' Freuden thematisieren.Laufenberg scheint bewußt mit möglichst polarisierenden Ausgangs-bildern zu arbeiten, um dadurch die anvisierte Kehrseite der Medailleumso effektvoller hervortreten zu lassen:
Die Mädchenfigur der Totenamt-Battade verliert nicht nur ihrenGeliebten auf grausame Weise, sondern gerät gerade dadurch inextreme gesellschaftliche Isolation, wird sie doch - aus nicht mehrganz durchsichtigen Gründen - offenbar von ihrer väterlichen Sippeund deren Freundeskreis im Stich gelassen, wenn nicht garverstoßen;58 im mit involvierten Abendgang folgt das Mädchen, demein ähnliches Schicksal droht, seinem Geliebten gar lieber freiwillig inden Tod. Ebenso erfährt die 'erzwungene Braut' ihre Hochzeitanscheinend primär als soziales »eilend«, als Verbannung aus demfamiliären Geborgensein, auch hier mit letalem Ausgang.
Die von Laufenberg damit in Bezug gebrachten Gegenentwürfemüssen für ein christliches Publikum des Spätmittelalters von schlicht-weg schlagender Überzeugungskraft gewesen sein: »leben one tot /vnd gantzi fröiden one not« (WKL 715, Strophe 5), ewigesHimmelsbrot (WKL 704, Strophe 9) samt dem Wein der göttlichenMinne (WKL 796, Strophe 1), ewige Liebesgemeinschaft mit Jesus,dem »trut gesellen« (WKL 709, Strophe 5), der uns dieses künftigeHeil im übrigen gerade dadurch erwirkt hat, daß er um unseretwillenden Tod erlitt und ihn zugleich überwand (WKL 709, Strophe 6). Dasirdisch-kreatürliche, in jeder Hinsicht limitierte Dasein wird so insinnfälliger Weise überformt und abgelöst durch die überzeitliche,
58 Vgl. Textanhang l B und l C, jeweils Strophen 9 und 10. Der anschließendeEntscheid des Mädchens, ins Kloster einzutreten, mit dem beide Fassungenenden, dürfte dagegen wohl eher eine sekundäre Zutat sein.
300 Max Schiendorfer
wahre und endgültige Geborgenheit des himmlischen Jerusalem in derGemeinschaft Gottes und seiner »engel schar« (WKL 715, Strophe 3).Das Diesseits findet sich im Jenseits buchstäblich 'aufgehoben'.
So kann man denn in der Tat davon ausgehen, daß die Kontrafakturmit ihrem "Umkippen des Sinns in den Gegensinn einen prickelndenReiz und sogar einen Trost gewährt."59 Wohlgemerkt gerade keinenTrost 'von dieser Welt', wie ihn etwa Liebes- und Gaumenwonnenvorgaukeln - »Jch wölt, daz ich doheime war, / vnd aller weite trostenber«, heißt es unmißverständlich genug (WKL 715, Strophe 1) -,sondern einen von weit höherem Wert und dauerhafterem Bestand.Auf diese Botschaft läuft es bei Laufenberg letztlich immer wiederhinaus, und man meint allmählich zu begreifen, daß ihm nebenanderem gerade auch die Kontrafaktur - dieses wohl mehr auf dieemotionalen als auf die rationalen Regungen des (am Vortrag aktivteilnehmenden!) Publikums zielende subtil-suggestive Mitteilungs-verfahren - ein prädestiniertes Medium schien, um seine contemplataaliis tradere.60
59 Wehrli (wie Anm. 57), ebd.
60 Wundersamerweise trägt die letzte meiner Fußnoten zu den 'Fußnoten zurLiedkontrafaktur bei Heinrich Laufenberg' ausgerechnet die dem Anlaß dieserFestschrift so trefflich anstehende Zahl 60! Eine solche Koinzidenz ist, wie mirscheint, schwerlich dem blinden Zufall, sondern doch wohl eher einer höherenweisen Fügung zu verdanken. Gerne komme ich dem sanften Wink von obennach und wünsche Dk, lieber Jubilar, an dieser symbolträchtigen Stelle nochmalsaus ganzem Herzen alles Gute und many, many happy returns!
*B •3l
cs
l
•§••§^ ig« ^2r-< J5T3
ss
rte
rgkeh
IIS l £
^,^:^
i«
Jx
II
m — »«^
S l l
-1
l*l|:^l|||fl°l*i'fl>|s^|slr?il-S T, g = » 1 1 " 1 1 1 « 1 1 S = 1 ? ̂ 2 1 2 § 1 1« *
i'j-illifr:!i!l| I'
XXK•XXX•XXXIxxxnxxxm•XXXIV•XXXV•XXXVI•XXXVIIxxxvraXXXKXLXUxmxunXLJVXLVXLVIXLVHxLvmxuxLumunUVLV•LVILVDLVffluxLXLXI•LXHLXffl
uavLXVLXVILxvnLXVfflLXKLXXLXXILxxn
^ LxxmLXXTVLXXVLXXVILxxvnLXXVfflLXXKLXXXLXXXILxxxnLxxxmLXXXIVLXXXV•LXXXVILXXXVH•LXXXVIII•LXXXIXxcxaxcnxanxcwxcvXCVIxcvnxcvm
Bl. 50: Wiltu menschen art (fehlt WKL)Bl. 50b: Es sass ein edly maget schon (WKL 705)Bl. 51b: In einem krippfly lag ein kind (WKL 706)Bl. 52: Ach, lieber herre ihesu Christ (WKL 707)Bl. 52: Got sy gelobet ewenclich (WKL 784)Bl. 52b: Ich wBlt, dz Ich do heime wer (WKL 715)Bl. 53: Es ist ein ingendig jor (WKL 724)Bl. 53b: Sjch het gebildet in min hercz (WKL 787)Bl. 54: Ich weiß ein stolze maget vin (WKL 704)Bt. 55: Biss grüest, du edly yerarchy (fehlt WKL)Bl. 57: Aue, gegrilesset, sigestu wol (WKL 776)Bl. 60b: Ach hoher got, herre ihesu crist (WKL 783 A.)Bl. 74: Adeler schön, maria aue (WKL 736)Bl. 74b: Gegrüsset siest du ane we (WKL 443)Bl. 75b: Regina celi, terre et maris (WKL 780)Bi. 76: Hjn zuo dir, megde vin (WKL 760)Bl. 76b: Aue, grilesset küscher schrin (WKL 760 A.)Bl. 77: Aue, muoter one we (WKL 760 A.)Bl. 77b: Maria, honigsüesser nam (WKL 712)Bl. 78: Sjch fröwent der engel schar (WKL 762)Bl. 78b: Bekenn nun alle weite schon (WKL 754)Bl. 79: Vs hohem rat vs vatters schos (WKL 725)Bl. 82b: Aue, bis grüest, du himels port (WKL 734 A.)Bl. 83: Aue, benedicti cederbluost (WKL 734)Bl. 84: Glich als ein griieni wis ist gziert (WKL 711)Bl. 85b: Ave, ballsams creatur (WKL 580 A.)Bl. 88: Bjs griiest, maria, schöner merstem (WKL 763)Bl. 89b: lam in Irena (WKL 737 A.)Bl. 90b: Man siht lovber (WKL 737 A.)Bl. 92: Wjlkom, muoter vnsers herren (WKL 758)Bl. 93: Aller weite reinikeit (WKL 574)Bl. 93: Ich grües dich, muoter vnsers heilantz (WKL 585)Bl. 94: Aller weite nüwerung (WKL 574 A.)Bl. 94b: Bjs grüest, maget reine (WKL 764)Bl. 95b: Frölich erclingen (WKL 765)
Bl. 95b: Kum har, erlöser Volkes schar (WKL 755)Bl. 96: Verr von der sunne vfegang (WKL 756)Bl. 96b: Bjs griiest, du himelfarwer schin (WKL 772)Bl. 104: Ave, grüesset müessest sin (WKL 727)Bl. 109: Griiest syest, maget adellich (WKL 797)Bl. 111: Gedenk, maria, maget vin (WKL 713)Bl. 1 13: Aue, got griiez dich, reine magt (WKL 798)Bl. 1 15b: Hymels port, verrigeltz schlosS (WKL 741)Bl. 1 15b: Maria seldericher nam (WKL 741 A.)Bl. 1 17b: Wolluff, im geist hin vber mer (WKL 587)Bl. 118: Wer lyden kan vnd dultig sin (WKL 793)Bl. 1 18: Bjs griiest, stern im mere (WKL 757)Bl. 1 18b: Maria, küschi muoter zart (WKL 554)Bl. 121b: Ich weiß ein vesti gross vnd klein (WKL 480)Bl. 122b: Ich wölt aller weit erwünschet han (WKL 794)Bl. 122b: Got vatter in der trinitat (WKL 701)Bl. 123: Mjr ist in disen tagen (WKL 790)Bl. 123b: Gedenk an vns hie (WKL 790 A.)Bl. 124: Got het ein edel maget zart (WKL 745)Bl. 124b: Jch wünsch vs mines herzen grund (WKL 791)Bl. 124b: Ach arme weit, du trügest mich (WKL 786)Bl. 125: Bjs wilkomen, maria, maget rein (WKL 796)Bl. 127: Ich weiß ein lieplich engelspil (WKL 710)Bl. 128: Kvm, helger geist, erfüll min hercz (WKL 788)Bl. 128b: Es taget minnencliche (WKL 709)Bl. 129b: Ach Döhterlin, min sei gemeit (WKL 708)Bl. 130: 0 Mary, du berendes zwy (WKL 743 A.)Bl. 133b: Ave, bis griiest, du himels port (WKL 775)Bl. 138b: Alde, alde, vos sponse rein (WKL 783)Bl. 138b: Bjs griiest, künginn der erbarmherzikeit (WKL 773)Bl. 140: Aue, bis grüesset maget ein (WKL 735)Bl. 141: Aue, bis grüesset one we (WKL 770)BI. 143: Jhesu, weg der warheit ein (WKL 714)Bl. 146b: Ave, bis grüest, du edler stam (WKL 729)Bl. 149: Salue, bis grüest, sancta parens (WKL 779)
Mügeln1430(1430)
(h'.)1434
(H'.)
HeinricusHeinricus
FremdtextFremdtext
fh'j Übersetzung
(Heinrich)eiusdemHeinrich(7,'j Übersetzung(h'.) 1418 Übersetzung
(Heinrici)
Heinrici ÜbersetzungMönch
(fc-j ÜbersetzungPmmHtPYtrIcIIiUlCAl
Fremdtext/^' i Übersetzung
V4Xrt/\ivionc.nFremdtext Übersetzung
fit' 19 Ubersetzunß
• , UbersetzunB
*'• Übersetzung*'• Übersetzung
1413Heinricus 1415 Übersetzung
ÜbersetzungHeinricus
HeinricusHeinrich
Fremdtext
1419 ÜbersetzungMönch
1420
Übersetzung1421
(28?)
Heinrich.
Heinrici143614371437
h '• Übersetzung1438
00
>: Bjs grüest, on bluom ein megtlich cle (WKL 731)>: Vjl lut so ruoft ein lerer hoher sinnen (WKL 720): Got si gesungen lob und eer (WKL 742)Got geb den zarten fröwlin heer (WKL 753)Ejn kind ist gborn ze bethleem (WKL 759)
): Puer natus ist vns gar schon (WKL 777)Ejn adler höh han ich gehört (WKL 767)De sancto mauritio et sociis ejus (fehlt WKL)Ave maria, gegrüesset syest (WKL 744)
S J S S S S S K S S( B c o c a c Q m a a c Q o a c n
g ü ö g g g ? g g
J2 -C
kolorierte Federzeichnung-192b:Prosadialog zwischenbiht uatter vnd biht dotuer238: 77 Ermahnungen an das Beichtkind,
*Ö JrJ O^
Cfl 03 03
§33 33
"C "C
33 X
Ich grober tumb (WKL 768)Ave maria, bis griiesset (WKL 730)Ave maris stella, bis grüest (WKL 778)
b: Ejn verbum bonum et suaue (WKL 782)Maria, höhste creatur (WKL 728)
b: Got geb, daz aller menschen heil (WKL 743)Ave, biß grüest, du meygen cle (WKL 733)
irt in v) w"J "n >5 voCS (N CS CS <N (S CS
03 n 03 (O 03 CQ n
|gdBl!§
Textanhang
l A) WKL [Anrn. 9], Nr. 709
Id daget in dat osten
l Es taget minnenclichedie sünn der gnaden vol,Jhesus von himelrichemueß vns behueten wol.
War wiltu mich nun wisen,Jhesus, min lieb gemeit,Daz ich din lob mög prysenmit ganzer staetikeit?
Leg dich an minen armein niwens bitterkeitVnd lass mich din erbarmen,min sünd sind mir gar leit.
Daß jar hab niemer ende,bis ich din gnad erwerb.Jhesus, von mir nit wende,daz ich niemer verderb.
Jhesu, min trat geselle,nun send din gnad zuo mir.Huet min vor grymer helle,min sünd, die clag ich dir.
Hastu dich selb gegebenfür mich in lidens not.So gib mir dinen segendurch dinen helgen tot.
Ach, Jhesu, herre guote,sich mich in gnaden an,Daz ich in hercz vnd muotedich allzit möge han.
Nach diner suessen guetihilf mir, herr, werden gah,Daz ich in hercz gemuetidir allzit frage nah.
l B) Uhland [Anm. 25], Nr. 95 A(17. Jh.)
1 It daget in dat osten.de maen schint averall;wo weinich wet min leveken,wor ick benachten schal.
[wo weinich wet min leveken,ja leveken!]
2 Weren dat alle mine fründe,dat nu mine viende sin,ick förde se ut dem lande,min lef und minnekin.
3 'All wor hen scheide gi mi vören,stolt rüter wolgemeit?ich ligge in leves armenin so groter werdicheit.'
4 Ligge gi in juwes leves armen?bi lo! gi segget nicht war:gat hen to der linden gröne,vorschlagen licht he dar.
5 Dat medeken nam ere mantelunde se gink einen gankall to der linden gröne,dar se den doden vant.
6 'Wo ligge gi hir vorschlagen,vorschmort in juwem blot!da hefft gedan juw römentdarto juwe hoge mot.
7 Wo ligge gi hir vorschlagen,de mi to trösten plach!wat hebbe gi mi nagelaten?so mengen bedröveden dach!'
8 Dat megdeken nam ere mantelund se ging einen gankall na eres vaders porten,de se togeschlagen vant.
306 Max Schiendorfer
10
Ker min hertz vmb vnd vmbereht nach dem willen din,Daz ich, herr, dahin kumme,da ich bi dir sol sin,
Daz ich dich minnenlicheküss, herr, an dinen munt.Ach, Ihesu gnadenriche,ich lob dich tusent stund!
9 'Got gröte juw heren alleminen vader mit im falle!unde is hir ein hereeffte ein edel man,de mi dissen dodenbegraven helpen kan?'
10 De heren schwegen stille,se makeden nen gelut:dat megdeken kerde sich umme,unde se gink wenent ut.
11 Mit eren schnewitten hendense der erde upgroef,mit eren schnewitten annense en to grave droech.
12 'Nu wil ick mi begevenin ein klein klösterlinund dragen schwarte klederund werden ein nünnekin.'
13 Mit crem hellen stemmense em de misse sank,mit eren schnewitten hendense em de schellen klank.
Textanhang 307
l C) Antwerpener Liederbuch[Anm. 26], (1544)
l D) Meier [Anm. 26], Nr. 61/2(ca. 1440)
10
Het daghet inden oosten,Het lichtet oueral;Hoe luttel weet mijn liefken,Och war ick henen sal.[Hoe luttel weet mijn liefken]
Och warent al mijn vrienden,dat mijn vianden zijn,Jck voerde v wten lande,Mijn lief, mijn minnekijn.
'Dats waer soudi mi voeren,Stout ridder wel gemeyt?ic ligge in myns liefs armkensMet grooter waerdicheyt.'
Ligdy in ws liefs armen?bilo, ghi en secht niet waer!Gaet henen ter linden groene:versleghen so leit hi daer!'
Tmeisken nam hären mantel,ende si ghinc eenen gancAI tot der linde groene,daer si den doden vant.
'Och, lichdi hier verslaghen,versmoort al in uw bloet!Dat heeft ghedaen uw roemenende uwen hoghen moet.
Och, lichdi hier verslaghen,die mi te troosten plach!Wat hebdi mi ghelatenso menighen droeven dach!'
Tmeisken nam hären mantel,ende di ghinc enen gancAI voor haers vaders poorte,die si ontsloten vant.
'Och, is hier enich hereoft enich edel man,Die mi nu minen dodenbegraven helpen kan?'
Die heren sweghen stille,si en maecten gheen gheluit;Dat meisken keerde haer omme,si ghinc al wenende uit.
10
Es tagt in Osterriche,die sun schint liberal,So waist min wunderschön lieb,wa es mich füeren sal.
'War sol ich dich füeren,guot ritter hochgemeit?Jch lig an liebes armeund bins beslossen in.'
Und liest an liebes armeund bist besloßen in,Es möcht dich wol gerüwen,das jar ein ende hat.
Dasjar, das hat ein ende,die jungfraw tet einen gangFür ires vaters bürge,da si den wachter fand.
'Wächter, trüt geselle,trit her, ein wort zuomir!Jch hon min lieb verloren,das leid, das klag ich dir!'
Hast du din lieb verlorenund klagest mir dm ndt:ich sach in nachte spatezerhowen üf den tot.
'Wächter, du muost lügen,darzuo seist du nit war:Jch sach in nachte spatevor minem betlin stan!'
Sachst du in nachte spatevor dmem betlin ston,So müeß es got erbarmen,daß ichs erlogen hon.
Er nam si bi der hende,bi ir snewißen hand,Er fuort si Qf die strässe,do si in zerhowen fand.
Mit ir snewißen hendemacht si im ein tiefes grab;Mit iren heißen tränensi im den segen gab.
308 Max Schiendorfer Textanhang 309
11 S i nam hem in hären armen,si custe hem voor den montIn eender corter wilentot also menegher stont.
12 Met sinen blanken swaerdedat si die aerde op groef,Met haer snewitten armenten grave dat si hem droech.
13 'Nu wil ic mi gaen beghevenin een cleen cloosterkijnEnde draghen swarte wijlen.Ende worden een nonnekijn.
14 Met haer ciaer stemmeDie misse dat si sanckMet haer snee witten handendat si dat belleken clanck.
2 A) WKL [Anm.9], Nr. 789
1 Es stot ein lind in himelrich,do blueyend alle este-- gang Ihesu nohDo schryend alle engel glich,daz Yesus si der beste.
2 Es kam ein bott von himel vinhar vfdise erden— denk Yesu nohEr gieng zuo bschlossen türen invnd gruoste die vil werden.
'Gruesset syest, Maria,ein krön ob allen wiben— denk Yesu nah —,Du soll ein kind geberen javnd soll doch magt belyben.'
'Wie kan ich gbem ein kindelinvnd sein ein maget lyse?-- denk Yesu noh —Nie mans begert das hercze min.des soltu mich bewisen.'
'Dez wil ich dich bewisen wol,du edle küniginne— denk Yesu noh --:Der heiig geiste komen sol,der mag daz wol vollbringen.'
Gabriel kert wider hinzuo der himel porten— denk Yesu nah —,'Ich bin ein dirn des herren min,mir gscheh nach dinen Worten.'
2 B) Uhland [Anm. 25], Nr. 15 A
1 Es stet ein lind in jenem tal,ist oben breit und unden schmal.Jst oben breit und unden schmal,darauf da sitzt fraw Nachtigal.
2 Du bist ein kleines waldvögelein,du fleugst den grünen wald auß
und ein.Fraw, Nachtigal, du kleines
waidvögelein,ich wolt, du sollst mein botte
sein...
2 C) Uhland [Anm. 25], Nr. 15 B
l
2 D)
l
Dar steit ein lindboem an jenemdal,
is bawen breit und neddenschmal.
van gold dre rosen.Darup sitter fruw Nachtigal,is bawen breit und nedden
schmal,van gold dre rosen.
Gott gröte die, fruw Nachtigallhübsch und fien!
will du des leveken bade nichtslen?
van gold dre rosen...
Uhland [Anm. 25], Nr. 17 A
Dar licht ein stat in Osterrik,de is so wol geziretall mit so mannigem blömlin
blaw,mit marmelsten gemüret.
Und wenn de linde er loef verlüst,so behölt se men de este,daran so gedenkt, gi megdelin
junk,und holdet juw tom besten!...
310 Max Schiendorfer
Gabriel kam wider in,er seit gar guote mere— denk Yesu nah --,Daz Maria maget vingottes muoter were.
Gabriel kam wider abvnd behuotz vor allem
schmerczen- denk Yesu nah -:Maria, die vil reine magt,truog got in irem herczen.
2 E) Uhland [Anm. 25], Nr. 17 B
1 Daer staet een clooster inoostenrijc,
het is so wel ghecieretmet silver ende rooden gout,met grauwen steen doormoeret.
2 Daer in so woont een joncfraufijn,
die mi so wel bevallet,rijc god, mocht ic haer dienaer
sijn,ic soudese met mi voeren!...
2 F) Uhland [Anm. 25], Nr. 27
l Es stet ein lind in disem tal,ach gott! was tuot sie da?sie will mir helfen trauren,daß ich kein buolen hab...
Textanhang 311
3 A) WKL [Anm. 9], Nr. 705(Anno 1430)
I Es sass ein edly maget schonin hoher contemplation,Jn tieffer andaht sy betraht,wie got der menschen heil
volbraht.R° 5 Ein edly kunigin,
die waz daz megetin.
3 B) WKL [Anm. 9], Nr. 706(eiusdem anni)
I In einem krippfly lag ein kind;do stuond ein esel vnd ein find,Do by waz ouch die maget clar,Maria, die daz kind gebar.
R" 5 Jhesus, der herre min,der waz daz kindelin.
3 C) WKL [Anm. 9], Nr. 707(1430/31)
l Ach, lieber herre, Ihesu Christ,sid du ein kind gewesen bist,So gib ouch disem kindelindin gnod vnd ouch den segen din.
R° 5 Ach, Jhesus, herre min,behüet diz kindelin.
Melodie A/B/C
3 D) WKL [Anm. 9], Nr. 777 (1439)
I Paer natus ist vns gar schon,woluf mit suessem engel ton!Transeant in Bethleem,jm geist biß gon Iherusalem.
5 Jhesus daz kindelinlyt in eim kripfelin.
3 E) WKL [Anm. 9], Nr. 767(1439/40)
I Ein adler höh han ich gehört,der spricht: 'im anuang waz daz
wort,Vnd daz wort waz vor got behuot,vnd got, der waz daz worte guot.
(1) Es sass ein ed-ly ma-get schon (2) in ho-her con-tem-pla-ti-on,
(3) Jn üef-fer an-daht sy be-lräht, (4) wk g« der men-schen heil vol-braht.
(5) Ein ed-ly ku-ni-gin, (6) die waz daz me-ge-tin.
Melodie D
(1) Pu - er na-tus ist vns gar schon, (2) wol- uf mit sües-sem en-gel ton!(3) Trans- e - am in Beth-le - em, (4) jm geist biß gon Ihc-ru-sa- lern.
(5) Jhe-sus daz kin-de-lin (6) !yt in eim krip- fe- lin.
Melodie E
(1) Ein ad-ler höh han ich ge-hort, (2) der spricht: 'im an-uang waz daz wort,
(3) Vnd daz wort waz vor got be-huot, (4) vnd got, der waz daz wor-te guot.
312 Max Schiendorfer
4 A) WKL [Anm. 9], Nr. 704
Christus das weißenkörnlin
l Ich weiß ein stolze maget vin,ein edli künigin,Ich weis in hymels lanndenkein höher keyserin.
5 Sölt ich ir lob nun sagenvnd all geschrift erfragen,dz wer der wille min.
4 B) Johannes Ott [Anm. 49], Nr. 16(1534)
Ich weiß nur eine Mülnerin,ein wunderschönes Weib,Jn allen diesen Landen,kein hübschre Mülnerin.
Wolt Gott, ich soll ir malen,mein Körnlein zu ir tragen,so mal ich, wenn ich mag.
Got grüeß üch, edli keiserin, 4 C) Bergliederbüchlein [Anm. 49], Nr.got hat üch vserwelt!Ein muoter, maget reine,jr zuht im wol geuelt,
5 Jr edler magetuome,ein wisser gilgen bluome,zuo dem sich got gesell.
3 Dz wort des vatters einevom himel vsse drangJn dich, du maget reine,din kusch in dar zuo zwang,
5 Dz er vs vatters schössewolt werden min genösse:jch hatz begeret lang.
4 Got nam si gar behendeby siner gnaden hand,Er fuort sy an ein ende,do sü all tugent vant.
5 Herr Gabriel sy pryset,der heilig geist si wisetmit siner mynne band.
5 Dz edel weissen körnehet sy gemalet wol.Die maget höh geborneist aller gnoden vol:
.5 Sy kan den stein wol byllennach irem liebsten willen,der vns behalten sol.
127(1700)
Jch weiß mir eine Müllerinein wunderschönes weib
wolt Gott ich soll bey ihr mahlenmein Kömlein zu ir tragendas war der Wille mein.
Der Müller aus dem Holtze kahmvon Regen war er naß
steh auffFraw Müllerin stoltzemach mir ein Feuer von Holtzevon Regen bin ich naß
Jch kann dir nicht aufstehensprach sie des Müllers Weib
ich hab die Nacht gemahlenmit einem Reuthers-Knabendaß ich so müde bin.
Hast du die Nacht gemahlensprach er der Müller stoltz
die Mühle will ich dir verstellendes Kampf-Rad und die Wellendaß du nicht mahlen kanst.
Textanhang 313
6 Sy kan die müli ryhten,da got sin gnade malt,Vnd vnser sünd vemihten,won si het sin gewalt.
5 Ach, edli maget guote,güss über vns sin bluote,wesch, wz im misseualt.
7 Löß an dz wasser fliessender edlen gnade din,Zöig Jhesum, den vil süessen,wan ich ein sünder bin.
5 Ach, keiserin gar stolze,der für mich hieng am holcze,den bit mir gnedig sin.
Wilst du mir die Mühle verstellensprach sie des Müllers Weib
ein ander will ich mir bauenauffeiner grünen Auenauf einen grünen Zweigauf meinen eignen Leib.
Wilst du dir eine andre bauensprach er der Müller stoltz
die Mühle will ich dir verkauffendas Geld will ich versauffenbey Bier, bey kühlen Weinbey zarten Jungfräulein.
! Dz körnli ward gemalenze reinem simel melAll in der menscheit schalen,do es ward bleich vnd gel:
5 Vf mittendag ze nonedz weissen körnli fronegab für vns hut vnd vel.
' Dar vs so ward gebachendz edel himel brot:Min sei, des soltu lachen,wan ez wz dir gar not.
s Dz sol dir spise gebenbyß in dz ewig leben,da als din leid zergat.