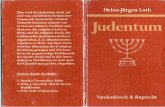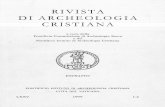Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit und ihr Fortleben in Judentum, Christentum und Islam, in...
Transcript of Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit und ihr Fortleben in Judentum, Christentum und Islam, in...
Thomas Staubli
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit und ihr Fortleben in Judentum, Christentum und Islam,
in palästinischer Volkskultur und säkularer Staatsemblematik. Neue Einsichten aus der
Ikonographie der Südlevante
I. Zwei hermeneutische Vorbemerkungen1
I.1 Kanaan als eigenständige Hochkultur
Die Beschäftigung mit den Kulturen und Geistesbewegungen, die aus Kanaan her-vorgegangen sind, war immer ein hauptsächlich von TheologInnen bzw. Alttesta-mentlerInnen oder ReligionswissenschaftlerInnen betriebenes Geschäft.2 Das hatte – insbesondere im evangelischen Bereich ab dem Aufkommen der dialektischen Theologie als Gegenposition zur liberalen Theologie – ein bibliozentrisches, Israel-fixiertes, bilderfeindliches Vorgehen mit oftmals christlich-theologisch verengtem Blickwinkel zur Folge.3 Anders als in der Ägyptologie, der Hethitologie, der As-syriologie und der klassischen Antikenwissenschaft wurden die Hinterlassenschaf-ten aus Kanaan weniger gleichberechtigt und wertfrei ins Puzzle der historischen Kulturrekonstruktion eingefügt, sondern durch eine antikanaanäische Brille gefil-
1 Am Ende meines Vortrages „Die Pflanzenwelt in der Ikonographie der Südlevante“ in
Koblenz wurden einige sehr grundsätzliche Fragen gestellt. Meine damals extemporierten Antworten finden sich hier in etwas erweiterter Form als hermeneutische Vorbemer-kungen. Auch im Rahmen dieses Aufsatzes sind natürlich nur knappe Hinweise zu diesen großen Themen möglich. Für die Einladung nach Koblenz anlässlich der dortigen Bundes-gartenschau 2011 danke ich Prof. Michaela Bauks.
2 Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Eigene Lehrstühle für Ugaritologie bzw Ugaritistik oder Archäologie der Levante sind äußerst rar (vgl. z.B. The Oxford Levantine Archaeology Laboratory des Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies). Einen Lehrs-tuhl für Kanaanologie gibt es m.W. nicht.
3 Exemplarisch lässt sich der Umschwung von der kulturell offenen liberalen Theologie zur bibliozentrischen dialektischen Theologie am sog. Babel-Bibel-Streit ablesen, der einen kirchlichen Konservativismus an den Tag brachte, „der angesichts veränderter biblischer Horizonte an einem starren Offenbarungsbegriff festzuhalten versuchte“ (Lehmann 1994, 273), also den Mut nicht aufbrachte, den Tatsachen in die Augen zu sehen. Dasselbe Pro-blem äußert sich heute drastisch in der Auseinandersetzung zwischen fundamentalistischen Kreationisten, die sich selber „Schöpfungswissenschaftler“ nennen, und Evolutionisten. Zum Ganzen Keel/Schroer 20082, 15-22.
74 Thomas Staubli
tert.4 Durch die unkritische Perpetuierung des durchschlagenden biblischen Anta-gonismus zwischen Israel und Kanaan5 und die teilweise daraus resultierende Mar-ginalisierung Kanaans als Grenzgebiet der Assyriologie, der Ägyptologie und der Bibelwissenschaft, blieb der Blick auf Israels Mutterland, Muttersprache und Mut-terkultur lange Zeit verstellt. Dies erklärt die Problematisierung von Kanaan als Be-zeichnung einer Kultur6, zugespitzt in der Frage, ob denn Kanaan überhaupt eine eigen-ständige Kultur sei. Tatsächlich wird bis heute in kulturhistorischen Darstellungen Kanaan als Randregion der großen Hochkulturen im Zweistromland und im Niltal betrachtet, die unter dem Einfluss beider Kulturen stand7. Demzufolge wird Ka- 4 Natürlich gab und gibt es auch in jenen Wissenschaften ideologische Scheuklappen und
Vereinnahmungen, insbes. während des Faschismus (DNP 13,1085-1105), sie sind aber weniger grundsätzlich als im Falle Kanaans und nicht oder weniger stark mit jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubensvorstellungen verquickt.
5 Zum biblischen Antikanaanismus siehe Staubli 2010. Der Antikanaanismus ist keine jü-dische Ursünde. Dass er in der samaritanischen Tora genauso eingeschrieben ist wie in der jüdischen, belegt sein Alter. Außerdem gibt es im jüdischen Kanon der Schrift Gegen-stimmen: Ezechiel (5,5-8; 16,3) stellt den Antikanaanismus ausdrücklich in Frage. Rezep-tionsgeschichtlich ist er außerdem im Christentum viel virulenter geworden als im Juden-tum.
6 Smith (2002) sieht es als ein Problem, dass „kanaanäisch“ sowohl für eine Kultur als auch für eine Sprache benutzt wird, obwohl sich die beiden Verbreitungsgebiete nicht genau decken und empfiehlt daher für den wissenschaftlichen Gebrauch den künstlichen und, wie er selber findet, sperrigen (“cumbersome”) Begriff „westsemitisch“. “As long as these two uses continue and crisscross one other, the term Canaanite will remain problematic as a heuristic term for the purposes of modern scholarly analysis, until there are texts ostensibly by Canaanites providing information about themselves or other Canaanites.” Aber wird damit die Latte nicht zu hoch gesetzt? Es gibt zum Beispiel keinen außerbiblischen Text, in dem sich ein Israelit ausdrücklich an Israeliten wendet… Komplexe Überschneidungen zwischen Kulturgebiet und Sprachgebiet gibt es außerdem für viele Nachbarkulturen Kanaans, zum Beispiel für die Griechen. Ein Gegenbeispiel ist der Archäologe Jonathan N. Tubb (2005), der den Begriff Kanaan in einem weiten Sinne braucht und positiv füllt.
7 Noch in der zur Zeit differenziertesten Darstellung der Ikonographie der Mittelbronzezeit Palästinas/Israels in IPIAO 2 klingt dieses Konzept nach, wenn sie das kanaanäische Ma-terial unter „Kontakthorizont Ägypten“ und „Kontakthorizont Vorderasien“ aufführt, wo-bei der zweite Begriff mindestens vier Kulturräume, den hethitischen, syrischen, assy-rischen und babylonischen umfasst. Die exogenen Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen, doch gibt es sie in jedem Symbolsystem. Im kanaanäischen werden sie über Ge-bühr betont bzw. als eine Schwäche der kanaanäischen Kultur ausgelegt. Stattdessen könnte man die Aufnahmefähigkeit von Fremdem und den eigenständigen Umgang mit diesen Einflüssen stärker wertschätzen und entsprechend gewichten, also zum Beispiel die Elemente, die ein Stempel- oder Rollsiegel sofort als kanaanäisch identifizieren lassen, auch wenn seine Bildsprache vordergründig ägyptisch, syrisch oder babylonisch ist. Die vitale Eigenständigkeit des Kanaanäischen ist umso höher zu veranschlagen, als es sich zu Beginn der Mittelbronzezeit IIB (in der zweiten Hälfte des 18. Jh. v. Chr.) bereits gegen eine starke ägyptische Dominanz im Land durchsetzen muss, was ihr auch gelingt. Sprachlich ist die Eigenständigkeit des Westsemitischen, zu dem das Kanaanäische gehört, durch die Archive
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 75
naan gerne als sekundäre Mischkultur, die kein eigenständiges Kultursetting aufzu-weisen habe, verstanden. Die Problematik dieser Auffassung kann an dieser Stelle nur durch skizzenhafte Hinweise widerlegt werden: a) Die Levante wurde in der Steinzeit von Menschen besiedelt, die dort eine der ältesten bäuerlichen Kulturen der Welt entwickelten. Diese Bevölkerung wurde nie ausgetauscht, aber (wie andere lebendige Kulturen auch) immer wieder mit exogenen Elementen bereichert (vgl. Tubb 2005, 13-15). Kanaan ist die wichtigste Selbst- und Fremdbezeichnung für die Levante und die dort lebenden Menschen in der Antike, auch wenn das so bezeichnete Gebiet nicht immer gleich groß war bzw. nicht alle, die von Kanaan sprachen, dasselbe darunter verstanden (Am ausführlichsten immer noch Keel/ Küchler/Uehlinger 1984, 239-253). b) Es gibt in Kanaan ein lebendiges Sprachkon-tinuum (mit vielen lokalen Dialekten wie Israelitsch, Judäisch, Ammonitisch, Moa-bitisch, Philistäisch, Phönizisch etc.), das jenes der Hethiter, des Zweistromlandes und des Niltales sogar überdauert hat8. c) Kanaan hatte eine starke Resorptions-fähigkeit für exogene Kulturen, wie am Beispiel der Philister gezeigt werden kann, die sich sprachlich und kulturell innert kurzer Zeit in Kanaan inkulturieren ohne sich dabei vollständig zu assimilieren (Yasur-Landau 2010). d) Zu Kanaans Identität gehört eine Jahrtausende lange Tradition des Föderalismus, die Multikulturalität integrieren konnte und eine differenzierte Kultur des Bundesschlusses hervorge-bracht hat. Gerade diese Eigenart wurde den Kanaanäern bei der Rezeption durch die geschichtsbeflissenen europäischen Nationen im 19. Jh. zum Verhängnis, da diese ihr zentralistisches Staatskonzept in die Antike zurückprojizierten und damit nur zentralistisch verfasste Kultursysteme als eigene Kulturen zu identifizieren in der Lage waren9. e) Kanaan hat wichtige Kulturleistungen hervorgebracht, die Teil der westlichen Kulturen geworden sind. Dazu gehören nebst grundlegenden Bei-
von Ebla und Mari sehr gut bezeugt. Kurz gesagt: Es gibt zwischen Euphrat und Nil spä-testens seit der Mitte des 3. Jt. v. Chr. eine durch die Sprache ausgewiesene Kultur, die sich von der Ägyptischen, Hethitischen, Assyrischen und Babylonischen unterscheidet. Hier hätte eine künftige Kulturgeschichte Kanaans wohl einzusetzen.
8 Es sei auf die neuwestaramäischen Sprachrefugien im Antilibanon hingewiesen, in welchen die letzten lebendigen Formen des Westsemitischen bis heute überlebt haben. Demgegen-über ist Assyrisch als Sprache sehr früh ausgestorben, nämlich kurz nach dem Fall Assurs 612 v. Chr. Das Koptische hat als lebendige Sprache Altägyptens bis ins 17. Jh. n. Chr. überlebt.
9 Eine Ausnahme ist Max Freiherr von Oppenheim (1939-67), der die lange dauernde osma-nische Herrschaft über den Vorderen Orient als eine der glücklichsten Phasen seiner Ge-schichte bezeichnet hat, weil sich unter der relativ schwachen türkischen Oberherrschaft die lokalen Stämme und ihre Föderationen entfalten konnten.
76 Thomas Staubli
trägen zur Domestikation von Vieh (Vigne 2005) und Pflanzen10 sowie zu Vorrats-haltung und Handelswesen (Staubli 2011) das Alphabet11, die Demokratie12, eine universale Gottesvorstellung13, sowie die bekennende Glaubensgemeinschaft und ihr heiliges Buch, das die Götterstatue und den Kultbetrieb, dessen Zentrum sie darstellt, ablöst. Das intensive Fortleben der kanaanäischen Kulturleistungen in den westlichen Kulturen und Institutionen (vgl. auch Hallo 1996, 314-333) macht, dass ihnen im Gegensatz zum Assyrischen, Hethitischen und besonders zum Ägyp-tischen das Fremde nicht anhaftet, das diese Kulturen in der Forschung offenbar bis heute viel selbstverständlicher als etwas Eigenständiges wahrnehmbar macht. Zugespitzt formuliert: Die Frage, ob es denn eine eigene kanaanäische Kultur über-haupt gebe, beruht darauf, dass wir selber viel kanaanäischer sind, als wir von uns wissen, weil Kanaan von allen altorientalischen Kulturen die langlebigste und für das Abendland die einflussreichste war, aber zugleich die verdrängteste geblieben ist.
I.2 Die Lesbarkeit und Bedeutung kanaanäischer Bilder
Immer wieder wird gefragt, woher wir denn wissen, was bronze- oder eisenzeitliche Bilder aus Kanaan bedeuten. Wir wissen vieles, wenn auch noch längst nicht alles, dank der Anwendung analytischer Methoden, die helfen, Semantik und Syntax von Bildern zu verstehen, dank einer möglichst sorgfältigen, d.h. selbstkritischen Un-terscheidung von Bildbeschreibung (Ikonographie) und Bilddeutung (Ikonologie) und vor allem dank dem Vergleich von Bildmaterial aus verschiedenen Zeiten und
10 Der älteste Beleg für domestizierte Gerste stammt aus Abu Hureyra, 120 km östlich von
Aleppo (Jacomet/Kreuz 1999:275), für Nacktweizen aus Anatolien, und dem nördlichen fruchtbaren Halbmond (ebd. Abb. 11.19), für Lein aus Jericho (ebd. 280). Für weitere Details siehe Zohary / Hopf 2000.
11 “The origin of the Phoenician letters in the Proto-Canaanite and Proto-Sinaitic scripts, and the borrowing of most, if not all, letter forms in the latter script from Egyptian hieroglyphs on the basis of acrophony are now seen as indubitable facts” (Sass 1988, 161; für weitere Studien siehe ders. 1991 und 2005; Hervorhebung T.S.).
12 Diese „athenische“ Erfindung verdanken die Athener den phönizischen Einwanderern, die den letzten athenischen Tyrannen gestürzt haben und damit den Weg für die politische Mitbestimmung der männlichen Stadtbevölkerung nach „kanaanäischem“ Vorbild ermög-lichten; vgl. Sommer 2000.
13 Diese Vorstellung, die im Westen über die Septuaginta populär geworden ist, lässt sich schon im Reisebericht des Wenamun nachweisen, wo der Fürst von Byblos mit den Wor-ten zitiert wird: „Sieh, Amun donnert am Himmel, nachdem er Seth eingesetzt hat in seinen Bereich. Amun hat gegründet alle Länder…“ (nach Schipper 2005, 106f). Universa-listische Tendenzen gibt es außer im JHWH-Kult von Jerusalem auch in anderen Kulten der Levante, so im IHWH-Kult von Samaria, im Jupiter Heliopolitanus-Kult von Baalbek oder im Elagabal-Kult von Homs.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 77
Räumen innerhalb Kanaans. Das aus den Vergleichen resultierende Informations-netz wird mit fortschreitender Forschung immer dichter. Die materielle Grundlage dafür ist im Übrigen mindestens um den Faktor 1000 höher als im Fall der Texte. Das heißt: Die Archäologie fördert für den Raum Kanaan tausend Mal mehr Ikoneme als Lexeme zu Tage. Daher sind Bilder eine Hauptinformationsquelle für die Rekonstruktion der kanaanäischen Kultur.
Im Falle der Pflanzenfrömmigkeit sind wir darüber hinaus in der glücklichen Lage, das beibringen zu können, was textgläubige Exegeten so sehnlichst wün-schen: Ein Bild mit erklärender Beischrift (Abb. 1). Auf einem mit stilisierten Bäu-men bzw. Zweigen und Capriden dekorierten Krug aus Lachisch steht die Wid-mung: „Gabe (mtn): ein Geschenk für meine Herrin, die Göttin (ʾlt)“. Das Wort „Göttin“, das in der hebräischen Bibel auch für die Eiche verwendet wird (Gen 35,4; Ri 6,11.19; Hos 4,13; Ez 6,13; 1Chr 10,12), steht sorgfältig platziert direkt über einem stilisierten Baum. Es kommt in drei weiteren kanaanäischen Inschriften vor. Auf einer Beschwörung aus Arslan Tasch (Nordsyrien) wird die Heiligkeit der Göttin durch einen Kerub angezeigt (vgl. KAI 27,1; ANEP Nr. 662). Eine Fluch-tafel von Karthago bezeichnet ḥwt als Herrin und Göttin (vgl. KAI 89,1; Keel/ Schroer 2010, 10f.136f). Um eine sublimierte Form dieser Göttin Chawwat dürfte es sich bei Eva (ḥawwāh) handeln, die in Gen 3,20 als „Mutter alles Lebendigen“ bezeichnet wird. Die beiden Begriffe „Herrin“ und „Göttin“ finden sich schließlich ohne weiteren Namen auch auf einer Weiheinschrift von Sulei (Sardinien) (vgl. KAI 172, 3).
Abb. 1: Fragment eines rot bemalten Tonkruges aus dem Grabentempel von Lachisch, um 1300 v. Chr.
78 Thomas Staubli
Die kanaanäische Bildkunst zeigt kein Interesse an Formenvielfalt. Ein quasi le-xikographisches botanisches Wissen scheint zwar in der Elite vorhanden gewesen zu sein (1Kön 5,13), doch ikonographische Zeugnisse dafür fehlen und sind auch für Ägypten nur mit dem berühmten botanischen Relief Thutmosis’ III. in Karnak bezeugt (vgl. Wreszinski 1923-38, Taf. 31). Im Fokus des Kunsthandwerks steht vielmehr die wirkungsvolle Inszenierung von ganz wenigen Typen (Zweig, Lotos, Papyrus stilisierter Baum), wobei Stilmittel wie Aspektive, Symmetrie und Paral-lelismus eine wichtige Rolle spielen. Der Effekt dieser Bilder war ein magischer: es geht um die Beschwörung der Lebenskräfte, die in dem aus dem Erdboden sprießenden Grün in einzigartiger Intensität erfahrbar werden.
II. Kanaanäische Pflanzenfrömmigkeit als ikonographisch dokumentiertes Kulturkontinuum
Pflanzliche Ikoneme (Bildelemente) auf kunsthandwerklichen Bildwerken Kanaans sind so gut wie nie reines Dekor, sondern Bestandteil einer Pietas, die ich als „Pflanzenfrömmigkeit“ bezeichnen möchte. Diese Frömmigkeit glich nicht der eines engagierten Grünen oder einer Greenpeace-Aktivistin aus dem Mitteleuropa des 21. Jh. n. Chr. Umweltverschmutzung war kein Thema, ebenso wenig der Schutz von Wildnis-Refugien. Die Natur wurde als etwas Bedrohliches wahrge-nommen (Hos 2,14; Mi 3,12; Jer 26,18), der Wald – in Palästina eine Eichen-Wacholder-Macchia – konnte wegen seiner kulturfeindlichen Natur als Menschen-fresser bezeichnet werden (2Sam 18,8; Keel 1993). Andererseits fehlen in Kanaan Hinweise auf eine bewusste Ideologie der Herrschaft des Menschen über den Wald, wie sie im mesopotamischen Gilgameschepos vorliegt, das davon handelt, wie die beiden Helden Gilgamesch und Enkidu gemeinsam Humbaba, den Beschützer des Zedernwaldes im Libanon bezwingen: „Im Wald wohnt der reckenhafte Humba-ba/ ich und du, wir wollen ihn töten, / aus dem Lande tilgen jegliches Böse! / Lass uns fällen den Zedernbaum!“ (Gilg II 96-99, assyrische Fassung). Zwar haben sich auch die Herrscher Judas libanesische Zedern für Tempel und Paläste liefern lassen und mit diesen aufwändigen Aktionen hoch verschuldet (1Kön 5,20-25; 9,10-14), doch die Empathie der Propheten für die Pflanzen und Tiere, die dem rücksichts-losen assyrischen Imperialismus zum Opfer fielen (Hab 2,14; Jes 14,5-8), zeigt ein Bewusstsein für die Grenzen der Ausbeutung, und im Psalm werden auch die menschenfeindlichen Wälder und das gefährliche Meer als Teile der Schöpfung gepriesen, die von Gottes Königtum künden (Ps 92,12-13; vgl. Ps 104, 148). Das
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 79
sind Textzeugnisse, die in der uralten kanaanäischen Pietas gegenüber Pflanzen und Tieren gründen.
II.1 Die Anfänge
Wildziegen sind seit dem Rückzug der Gletscher in der Levante heimisch. Hier wurden sie vor ca. 12‘000 Jahren domestiziert. Der Nubische Steinbock hat in seinen Refugien in der zerklüfteten judäischen Steppe bis heute überlebt. Die auf den Bildträgern meist biologisch nicht klar bestimmbaren Capriden verkörpern wie kein anderes Tier Vitalität. Sie sind mit der Sphäre der Göttin verbunden, der sie heilig sind. Die Wachstumskraft der Pflanzen wurde in Kanaan durch den Zweig zum Ausdruck gebracht. Offenbar wurde früh eine assoziativ-magische Beziehung zwischen dem Wachstum der Hörner von Capriden und dem Wachstum von Zweigen hergestellt. Diese Kombination ist auf Motiven der Samarra-Keramik (150km nordwestlich von Bagdad) dokumentiert (Abb. 2a), die ihrerseits stark von den vorkeramischen Steinzeitkulturen der Levante beeinflusst sind (vgl. Aurenche / Kozlowski 1999, 93f; IPIAO 1, 66). Von dort gingen möglicherweise Impulse weiter in den Iran, wo die Kombination ebenfalls bekannt ist (Abb. 2b). Sie findet sich aber auch im berühmten chalkolithischen Kupferschatz vom Nahal Mischmar am Westufer des Toten Meeres, wo die Capriden über einem als Zweig stilisierten Stabaufsatz den Abschluss bilden (Abb. 2c). Aus dem frühbronzezeitlichen Bab edh-Dhra am Ostufer des Toten Meeres stammt ein Krug, der Zweige und stark stilisierte Frauen mit erhobenen Armen – vielleicht Tänzerinnen oder Klagende (vgl. Garfinkel 2003, 91-94; IPIAO 1, 204) – zeigt (Abb. 2d ).
a b c d
Abb. 2: Zweige in der frühesten Kunst des Vorderen Orients: a Tonschale, Samarra, 6200-5700 v. Chr.; b Stempelsiegel, Luristan, um 4000 v. Chr.: Nr. 7; c Standartenaufsatz aus Kupfer, Nahal Mischmar, 4500-4000 v. Chr.: Nr. 60; d Tonkrug, Bab edh-Dhra, 3200-3000 v. Chr.
80 Thomas Staubli
II.2 Zweig mit Capride
Die Kombination von Capriden und Zweigen ist eine Superlativform für Lebens-fülle und damit für Segen, die in der Blütezeit Kanaans sehr beliebt war und in der Südlevante weit darüber hinaus bezeugt ist. Abb. 3a zeigt den Capriden mit drei Zweigen, Abb. 3b mit zwei. Sechs Skarabäen aus Bet Schean (Abb. 3b-g) belegen beispielhalber eine mindestens sechshundertjährige lokale Bildtradition, die sich aber bis ins 7./6. Jh. v. Chr. weiterverfolgen lässt (Abb. 3h). Fast immer wird der Zweig stark linear schematisiert. Selten wird er ägyptisierend als Lotos oder Papyrus stilisiert (Abb. 3f). Auf einem luxuriösen Karneolsiegel (Abb. 3e) werden die Blätter von einem geübten Steinschneider etwas naturalistischer stilisiert. Die Darstellung des Wurfs (hebr. ʿaštǝrōt; Astarte ist zugleich ein Name der Göttin in Kanaan) der Capriden wie in Abb. 3h unterstreicht noch den Bezug zur Sphäre der Göttin.
a b c d
e f g h
Abb. 3 : Zweig mit Capriden als Segenssuperlativ : a Skarabäus, Bet Mirsim, um 1600 v. Chr. ; b Skarabäus, Bet Schean, um 1600 v. Chr. ; c Skarabäus, Bet Schean, um 1600 v. Chr. ; d Skarabäus, Bet Schean, um 1400 v. Chr. ; e Skarabäus, Bet Schean, um 1350 v. Chr. ; f Skarabäus, Bet Schean, um 1200 v. Chr. ; g Skarabäus, Bet Schean, um 1000 v. Chr. ; h Scheibenförmiges Siegel, Rabbat Moab, 7. Jh. v. Chr.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 81
II.3 Zweig und weiblicher Schoß
Auf einer Alabasterplatte aus Mari wird das Capriden-Zweig-Motiv mit der weib-lichen Scham in aspektivischer Symmetrie kombiniert. Im Wachsen und Gedeihen der Pflanzen, des Wurfs der Ziegen, dem Nachwuchs aus dem weiblichen Schoß, wurde dieselbe Lebenskraft erfahrbar. Die Kombination von Schoß und Zweig findet sich – wie die Capriden mit dem Zweig (vgl. Abb. 2b) – auch im Nordiran (Abb. 4c). Auf Skarabäen der kanaanäischen Blütezeit finden wir die Zweige haltende Göttin zusätzlich mit Zweigen, die aus ihrer Scham wachsen (Abb. 4d) und einen Verehrer von Schoß und Zweig (Abb. 4e). Ein spätbronzezeitlicher Krug aus Lachisch bezeugt die Capriden an einem Lebenszweig oder Lebensbaum, der die Form einer weiblichen Scham hat (Abb. 4f). Das Motiv findet sich aber auch noch viel später (Abb. 4g).
a b c d
e f g
Abb. 4: a-g Zweig und weibliche Scham als Segenssuperlativ: a Beritzter Knochen, Hagosherim, um 6000 v. Chr. (vgl. Getzov 2008, 1760; ders. 2011); b Alabasterplatte, Mari, frühes 3. Jt. v. Chr.; c Terrakotta, Turang Tepe, 1. Hälfte 3. Jt. v. Chr.; d Skarabäus, um 1600 v. Chr.:Nr. 6; e Skara-bäus, En Samije, um 1600v. Chr.; f Krugmalerei, Lachisch, um 1300 v. Chr.: Abb. 14; g Fels-ritzung, Vaschta (Libanon), 1. Jt. v. Chr.
82 Thomas Staubli
II.4 Herrschaft im Dienste des sich regenerierenden Lebens
Die Göttin war keine kulturferne Naturgöttin, sondern zugleich eine Schutzmacht der Städte. Die Ausübung einer gerechten Herrschaft, die Pflicht jedes lokalen Dynasten, war daher auch ein Dienst an der Göttin und damit an den Mächten der Lebenserneuerung. Daher finden wir Zweige auch regelmäßig in Kombination mit Emblemen der Herrschaft: mit dem Falken in der unverwechselbaren Darstellungs-weise der höfischen nordlevantinischen Werkstatt, die in grünem Jaspis gearbeitet hat (Abb. 5a); mit dem falken- oder menschenköpfigen Wettergott, dessen Segen in einer Art Zweigzepter Gestalt annimmt (Abb. 5b-c); mit dem Greif (Abb. 5d ) und der Sphinx (Abb. 5e), die beide königliche Herrschaft vergegenwärtigen, mit dem Löwen (Abb. 5f), der kryptographisch auf einigen Siegeln auch als Teil des Amun-Namens gelesen werden kann (Abb. 5g) und mit dem Stier (Abb. 5h).
a b c
d e f
g h
Abb. 5: a-f Herrschaftsmächte im Dienste des Gedeihens der Vegetation: a Skarabäus, Bet Schemesch, um 1600 v. Chr.; b Skarabäus, Dotan, um 1000 v. Chr.; c Skarabäus, Emmaus, 1700-1550 v. Chr.; d Skarabäus, Bet Mirsim, 1650 v. Chr.; e Skarabäus, Elad Masor, 1550 v. Chr.; f Skarabäus, Bet Schean, um 1000 v. Chr.; g Skarabäus, Bet Schean, um 900 v. Chr.; h Skarabäus, Bet Schean.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 83
II.5 Ptah und Amun-Re als kanaanaisierte Götter mit Zweigen
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit war in der Lage, dominante ägyptische Kulte wie jene des memphitischen Gottes Ptah und des thebanischen Gottes Amun zu inkulturieren. Beide Gottheiten wurden in Ägypten mit der Schöpfung in Verbindung gebracht.
Von Ptah heißt es im Denkmal memphitischer Theologie: „So traten die Götter in ihren Leib aus allerlei Holz, allerlei Mineral, allerlei Ton und allerlei an-deren Dingen, die auf ihm (Ptah-Tatenen) wachsen… (nach Junker 1940)“ Ptah als göttlicher Urgrund des Wachstums wird auf kanaanäischen Stempelsiegelamuletten durch ein Zweiglein vor der verehrten Gottheit verdeutlicht (Abb. 6a) oder durch das Was-Zepter Ptahs, das sich in seinen Händen in eine sprießende Blume ver-wandelt (Abb. 6b). Das Motiv des erblühenden Stabes findet sich auch in der bib-lischen Literatur, die den sprießenden Stab Aarons (Num 17,23) kennt, der seiner-seits den Araceae aufgrund ihres stabähnlichen Blütenstandes mit auffälligen, roten Früchten Pate stand für die volkstümliche Namensgebung.
In spätramessidischer Zeit (12.-10. Jh. v. Chr.) wird Amun-Re in der Süd-levante, wahrscheinlich ausgehend von Tanis, stark propagiert. Die männliche Hauptgottheit von Theben wurde fast nie als Kultbild dargestellt, sondern meistens mit dem Namen vergegenwärtigt. Dieser wurde sehr oft kryptographisch, d.h. in einer Art Rebussystem, geschrieben, um den rätselhaft-verborgenen Charakter der Gottheit anzuzeigen (dazu ausführlich Keel 1995, §§472-481. 642-650). Levan-tinische Siegelschneider haben einen Zweig in diese Schreibungen integriert und damit die Amun-Schreibungen visuell inkulturiert. Der Vergleich zwischen einem Siegel aus Dor (Abb. 6c) und einem aus Horvat Erav (Abb. 6d) zeigt, dass es fixe Typen gab, die nur leicht variiert wurden, jedoch immer so, dass der Zweig die Mitte der Komposition bildet. Ein weiteres Siegel aus Dor (Abb. 6e) mit einer an-deren Variante der Amun-Schreibung hat ebenfalls den Zweig in der Mitte. Es ist 400 Jahre jünger und belegt damit eine jahrhundertelange Werkstatttradition des Zweiges als Kompositionsmitte von Amun-Siegeln.
84 Thomas Staubli
a b c
d e
Abb. 6: Durch den Zweig kanaanisierte Ptah- und Amun-Re-Frömmigkeit: a Skarabäus, En Samije, um 1600 v. Chr.; b Skarabäus, Tell el-Ağğūl, um 1600 v. Chr.; c Skarabäus, Dor, um 600 v. Chr.; d Skarabäus, Horvat Erav, um 1000 v. Chr.; e Skarabäus, Dor, um 1000 v. Chr.
II.6 Zweige als kanaanäische Marker in persisch-hellenistischer Zeit
So wie die Kanaanäer jahrhundertelang ägyptisches Bildgut mit dem Zweig inkultu-riert haben, verfuhren sie auch mit der ab spätpersischer Zeit ins Land strömenden griechischen Bilderwelt. Dies belegen sowohl die Bullen aus einem lokalen Archiv in Samaria als auch die samaritanische Münzprägung. Erstere zeigen Hermes (Abb. 7a) und einen Satyr (Abb. 7b) in der für Griechenland untypischen Weise mit je einem Zweig in der Hand. Letztere kombiniert die athenische Eule, die in der Süd-levante zu Beginn der Münzprägung zusammen mit dem neuartigen Transaktions-medium aus Attika übernommen wurde, mit Zweigen (Abb. 7c). Auf der Münzprä-gung der Hasmonäer und selbst noch in römisch-byzantinischer Zeit lebt die Zweig-Ikonographie munter fort (Belege bei Staubli 2005, 20).
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 85
a b c
Abb. 7: Zweige als kanaanäische Inkulturationsikoneme zusammen mit hellenistischen Motiven in spätpersischer Zeit: a Bulle, Wadi ed-Dalije, 375-335 v. Chr.; b Bulle, Wadi ed-Dalije, 375-335 v. Chr.; c Münze aus Samaria, um 400 v. Chr.
II.7 Lotos
Die einzige Pflanze, die in der Kunst Kanaans Bedeutung erlangt hat und einer bestimmten Gattung zuzuordnen ist, ist die Seerose bzw. der Lotos (hebr. šošannah, davon abgeleitet der Name Susanna). Der blaue (Nymphaea caerulae Sav.) und der weiße Lotos (Nymphaea alba L.) waren in den Gewässern der Levante verbreitet, heute sind sie sehr selten. Die Besonderheit der Pflanze, den Kelch abends zu schließen und unterzutauchen und anderntags in neuer Frische aufzugehen, hat sie zum Regenerationssymbol schlechterdings gemacht. Der zudem künstlerisch sehr leicht zu stilisierende Lotos ist nebst dem Zweig eine weitere Form der kunsthand-werklichen Vergegenwärtigung von Segen, die sich über Jahrhunderte hinweg er-halten hat. Im Gegensatz zum Zweig ist sie aus Ägypten entlehnt, wurde in Kanaan aber eigenständig verwendet. In der kanaanäischen Blütezeit kann der Lotos Teil eines künstlichen Bouqets sein, das die Mitte einer kultischen Szene markiert (Abb. 8a). Der Wettergott kann in Kanaan mit einem Lotosstab dargestellt werden, um seine regenerierende Kraft präsent zu setzen (Abb. 8b). Dasselbe gilt für seine Verehrer (Abb. 8c). Wie der Zweig wird auch der Lotos gerne mit ägyptischen Leihmotiven kombiniert. Auf einem Siegel aus der Zeit Thutmosis III. (1479-26 v. Chr.) umgeben zwei Lotosknospen tête-bêche den Namen Amun-Re (Abb. 8d), der hier sich hier aus dem akrophonisch zu lesenden Mond (äg. j˓ḥ), dem mn-Zeichen und der Sonnenscheibe für Rʿ ergibt. Die Kombination von Amun-Name und Lotosblumen ist häufig. Die Namenssiegel, die in verschiedenen Gebieten Kanaans im Verlauf der ersten Hälfte des 1. Jt. v. Chr. überall dort aufkamen, wo städtische Verwaltungsapparate entstanden, wurden gerne mit floralen Elementen, besonders
86 Thomas Staubli
mit dem Lotos, dekoriert (Abb. 8e).14 Wahrscheinlich stellen diese Bildelemente Zitate aus dem lokalen Tempeldekor dar. Die biblische Beschreibung des Salomo-nischen Tempels weiß von Kapitellen in Lotosform zu berichten (1Kön 7,19.22) und vom Ehernen Meer, einem riesigen Wasserbehälter, der die gebändigte Chaos-flut symbolisierte, dessen Rand wie ein Lotosblumenbecher gestaltet gewesen sei (1Kön 7,26; 2Chr 4,5).
Das in der Levante beliebte Motiv vom Sonnenkind in der Lotosblume, das sich auch unter den Elfenbeinen Samarias und auf israelitischen Namenssiegeln findet (vgl. GGG Nr. 240-241c), erfreut sich in Phönizien noch in persischer Zeit großer Beliebtheit. Das abgebildete Beispiel (Abb. 8f ) zeigt Horus gleich zweimal: Als Kind über der Lotosblüte, beschützt von seiner Mutter Isis und als erwach-sener Mann, der seine Mutter beschützt. Die Sonnenbarke über der ganzen Szene versinnbildlicht die heile Welt.
Nebst dem Kunsthandwerk hat sich auch die Liebeslyrik gerne der beleben-den Symbolkraft des Lotos bedient. Im Hohenlied wird die Geliebte mit einer Lotosblume unter Dornen verglichen (Hld 2,2), die Frau schwärmt von der bele-benden Wirkung der Küsse ihres Liebhabers als von „Lotoslippen“ (Hld 5,13), der Mann umschreibt die Wirkung der Brüste seiner Freundin mit dem äußerst un-natürlichen, in der Kunst aber verbreiteten Bild von Gazellen, die im Lotos weiden. Der Genuss der Liebesfreuden wird hyperbolisch gerne als ein Weiden in Lotos-blumen umschrieben (Hld 2,16; 6,2f). Ein weiterer Superlativ ist die Metapher vom Leib der Geliebten, der ein von Lotosblumen umsäumter Weizenhaufen ist (Hld 7,3) (vgl. jeweils Keel 1984 zur Stelle).
14 Zum Lotos auf Namenssiegeln siehe Hübner 1993, 146, 5.A und Sass 1993, 203f, A3.1.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 87
a b c
d e f
Abb. 8: Lotos auf südlevantinischen Stempelsiegelamuletten: a Skarabäus, Tell Abu Sureq, 1750-1550 v. Chr.; b Skarabäus, Afek, um 1600 v. Chr.; c Skarabäus, Afek, um 1650 v. Chr.; d Skara-bäus, Afek, 1479-26 v. Chr.; e Zylindrisches Elfenbeinsiegel, Amman, 7. Jh. v. Chr.; f Skarabäus, Phönizien, 530-330 v. Chr.
II.8 Palme, Palmette, stilisierter Baum
Man könnte meinen, die stolze Palme mit ihrem graden Wuchs und den auffälligen, adrett gefiederten Blättern sei wie geschaffen für eine künstlerische Darstellung. Allerdings kam der Oasenbaum in der Lebenswelt der kanaanäischen Bauern – im Gegensatz zu den Flussoasen am Euphrat und am Nil – nur selten vor. In der be-rühmten Jotamfabel fehlt er unter den königlichen Bäumen (Ölbaum, Feigenbaum, Weinstock; Ri 9,8-15). Hingegen wird hebr. tamar auch als Frauenname verwendet (Gen 38; 2Sam 13f). Die für Kanaan exotische Palme weckte offenbar erotische Konnotationen (Hld 7,9). In der Kunst ist die Palme sehr selten (vgl. Abb. 4g). Bezeichnenderweise taucht sie im 5. Jh. v. Chr. in der philistäischen Münzprägung zusammen mit einem Stadtemblem auf (Abb. 9d). Die Palme ist ein Kulturbaum, der in Kanaan nur dort wächst, wo er künstlich bewässert wird. Häufiger sind ägyptisch inspirierte Palmettenamulette, die als Massenprodukte hergestellt worden sind (Abb. 9e).
88 Thomas Staubli
Ob der im Kunsthandwerk fast omnipräsente stilisierte Baum (vgl. auch Abb. 1) auf die Palme zurückgeht, wie manchmal behauptet wird (vgl. Keel/Küchler/ Uehlinger 1984, 63f), ist fraglich. Es ist ein Baum, „der sich jeder botanischen Zuordnung entzieht“ (vgl. Winter 1986, 172 und die in Anm. 2 ebd. aufgelistete Literatur). Darstellungen von stilisierten Bäumen sind in Kanaan älter als solche von Palmen. Der stilisierte Baum wurde als Lebensbaum (hebr. ʿeṣ[-]ḥaijim ) ver-standen und konnte mit der Weisheit identifiziert werden (Spr 3,18; 11,30; 13,12; 15,4) bzw. mit der Tora (Sir 24). Seine Heiligkeit kann zum Beispiel durch Uräen, äsende Capriden und die geflügelte Sonnenscheibe angezeigt werden (Abb. 9a-b). Stilisierte Bäume gehörten zum Wanddekor des Jerusalemer Tempels. Auf einigen Stempelsiegelamuletten werden die Tempel- oder Palastsäulen möglicherweise imitiert (Abb. 9c) (vgl. GGG, 413).
a b c
d e Abb. 9: a Knochensiegel, Juda, 8./7. Jh. v. Chr.; b Abdruck eines Stempelsiegelamuletts mit Ca-priden am stilisierten Baum; c Bulle, Jerusalem, 6. Jh. v. Chr.; d Münzbild, mit Stadtemblem und Palmen, philistäisch, 5. Jh. v. Chr. ; e Palmettenamulett, Tell Serʿa, 1300-1100.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 89
II.9 Papyrus und weitere Pflanzen
Der Vollständigkeit halber seien hier noch weitere Pflanzen erwähnt, die in Gestalt von Amulettanhängern vorkommen, meistens, wenn auch nicht ausschließlich, in den Küstenstädten der Levante. Am häufigsten ist darunter der Papyruspfeiler (Abb. 10a). Papyrus kam massenhaft in den Sümpfen des Nildeltas vor. Er ist das Emblem Unterägyptens, so wie der Lotos jenes von Oberägypten. Die Verknotung der beiden Pflanzen ist ein Symbol für die Vereinigung der beiden Länder. Außerdem sind Amulette in Gestalt von Trauben (vgl. Herrmann/Staubli 2010, 136), Mimusops, die Frucht des Persea-Baumes (Mimusops Schimperi; ebd. 139), Granatapfel (ebd. 140), Kornblume (ebd. 141), „Lilie“ (eine stilisierte Blume, teilweise nicht von der Palmette zu unterscheiden) (ebd. 141f), Dattel (ebd. 142) und ein lanzettförmiges „Blatt“ (ebd. 143).
Besonderer Hervorhebung bedarf schließlich die Rosette, die ebenfalls in großen Mengen aus Amulettmodeln produziert wurde. Zeitweise erscheint sie als Emblem auf Stempeln der judäischen Administration (Abb. 10b). Möglicherweise hatte die Blüte (ṣīṣ) am Kopfbund des Hohenpriesters mit der Inschrift „Heilig für JHWH“ eine ähnliche Gestalt (Ex 28, 36).
a b
Abb. 10: a Papyruspfeileramulette aus einem Friedhof von Atlit, 5. Jh. v. Chr., b Rosettenstempel, Jerusalem, 7. Jh. v. Chr.
III. Die Numinosität von Erde und Pflanzen in der Bibel
Es besteht – besonders unter ExegetInnen der Hebräischen Bibel, die einer zu dua-listischen Opposition von Mythos und Offenbarung anhängen – die weitverbreitete Vorstellung, die Jahwesierung der kanaanäischen Kulttraditionen in Israel habe deren konsequente Entmythologisierung zur Folge gehabt. Dem ist nicht so (zum Folgenden vgl. Keel/Schroer 2008, 52-61).
90 Thomas Staubli
Es ist nicht JHWH, der die grünen Pflanzen hervorbringt, vielmehr soll die Erde (Gen 1,11 ʾæræṣ; Gen 2,8 ʾadamāh) sie hervorbringen bzw. gebären. Das mythologisch-fruchtbare Zusammenspiel von Himmel und Erde setzen noch Texte voraus, die bereits eine ethisch-moralische Auslegung im Blick haben (Hos 2,23; Jes 45,8). Aus Respekt vor der Heiligkeit der Erde legen sich die Menschen Schon-zeiten, ganze Brachjahre, auf (Lev 25,1-7), die indes teilweise sozialethisch begrün-det werden (Ex 23,10-12). Zwischen dem Mutterleib und dem mythischen Schoß der Erde wird ein Zusammenhang hergestellt (Ijob 1,21; Ps 139,15; Sir 40,1), auf dem die Hoffnung beruht, das die Erde die Toten dereinst ein zweites Mal gebiert (Jes 26,19).
Magische Praktiken, bei welchen Pflanzen eine Rolle spielen, liegen offen zu-tage: Jakob führt mit Zweigen einen Analogiezauber vor dem Kleinvieh (bestehend aus Schafen und Capriden!) an der Tränke durch, um dessen Fellfärbung zu be-einflussen (Gen 30,37-41). David empfängt JHWHs Orakel im Gewisper von Sträuchern (2Sam 5,24) (vgl. KTU 1.3 III,22-23; Gen 12,6; Ri 9,37). JHWH erscheint Mose (Ex 3,1-5; Dtn 33,16), Abraham und Sara (Gen 13,18; 18,1.8) sowie Gideon (Ri 6,11) in Bäumen und vergleicht sich noch bei Hosea mit einer grün-denden Konifere (Hos 14,9). Bäume gehören zu Heiligtümern (Jos 24,26), sind Orte der Rechtsprechung (Ri 5,4; 1Sam 14,2; 1Sam 22,6) und werden legendarisch mit den Erzeltern in Verbindung gebracht (Gen 21,33).
Diese Pflanzenfrömmigkeit in Juda und Israel wird zwar von prophetisch-rationalistischen Reformkreisen kritisiert (Hos 4,12f; Jes 1,29; Ez 20,28), die Kritik in geltendes Recht umgemünzt (Dtn 16,21f), und durch gewalttätige Aktionen ge-gen heilige Bäume und Haine auch in die Tat umgesetzt (2Kön 23,6f; Josephus, Contra Apionem I §199), doch in anderen Passagen des Rechts, wo es um Karenz-zeiten für Bäume (Lev 19,23-25), Totalernte- (Ex 23,10-12; Lev 19,9f; 23,22; 25,1-7; Dtn 24,19-22) und Baumfälltabus (Dtn 20,19f) geht, sowie im weisheitlichen Gedankengut, wenn Jesus Sirach im zentralen Lehrgedicht (24,12-19) seiner im 2. Jh. v. Chr. entstandenen Lehre die Weisheit JHWHs in Gestalt der Tora mit einem mächtigen Baum vergleicht, der in Jerusalem Fuß gefasst habe, lebt sie dennoch weiter.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 91
IV. Wirkungsgeschichte
IV.1 Das Fortleben der kanaanäischen Vegetationsfrömmigkeit im Lulav des Laubhüttenfestes
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit war nicht auszumerzen, sie musste ins neue, monotheisierte Symbolsystem des Judentums integriert werden. Bevorzugter Ort dafür wurde das im Zeithorizont des Herbstäquinoktiums gefeierte Laubhüt-tenfest (Sukkot), das einerseits mit dem Dank für die Sommerernte verbunden war, andererseits mit der Bitte um neuen Regen. Das alte kanaanäische Erntedankfest wurde nur sehr oberflächlich historisiert und damit judaisiert, indem man es mit der Landnahme und der Sesshaftwerdung – dem Wohnen in Hütten – in Verbindung brachte. Zur Zeit des Zweiten Tempels bestand der Brauch, mit dem Festtags-strauß Wasser zu verspritzen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine ma-gische Beschwörung des Herbstregens.15 Die Sadduzäer anerkannten den archai-schen Brauch nicht, den die Rabbinen verteidigten. Diese Libation war von Licht-zeremonien und akrobatischen Tänzen begleitet und stellte den eigentlichen Fest-höhepunkt dar (bSuk 5). Schmückende Zweige gehörten seit jeher zu Festen (Ps 118,27). Nehemia versuchte die alte lokale Zweigtradition, und die damit verbun-dene Vorschrift in Lev 23,40 aus seinem antipaganen Affekt heraus strikt an den historisierenden Laubhüttenbau zu binden (Neh 8,15). Die Rabbinen folgten dieser Praxis jedoch nicht, sondern schrieben den Festtagsstrauß nebst der Laubhütte als Festpflicht vor (bSuk 3) und bestimmten, dass er aus vier Arten zu bestehen habe: Etrog (der ursprünglich aus China stammende Citrus medica cedra), Myrte, Palme und Bachweide. Auf den unter Eleazar anlässlich des ersten jüdischen Aufstandes gegen die Römer geprägten Münzen finden wir die ältesten Lulav-Darstellungen (Abb. 11a) und damit bezeichnenderweise genau da, wo die Hasmonäer auf ihren Münzen einen Zweig prägen ließen, der sie als Spross Davids ausweisen sollte (vgl. Staubli 2005, 20f). Der bis heute (Abb. 11c) übliche Feststrauß mit den „Vier Arten“ finden sich in byzantinischer Zeit auf vielen Synagogenmosaiken (Abb. 11b).
15 Das Johannesevangelium (7,37) knüpft an die Sitte ein Jesuswort: „Am letzten, dem großen
Tag des Festes aber stand Jesus da und rief: Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke!“
92 Thomas Staubli
a b c
Abb. 11: arba’a haminim, die vier (Pflanzen-)Arten (für Sukkot): a Etrog und Lulav, Münze, Eleazar, 68 n. Chr.; b Lulav und Etrog, Fußbodenmosaik, Synagoge von Tiberias, 350-400 n. Chr.; c Etrog und Lulav mit Myrte, Palme und Bachweide.
IV.2 Das Fortleben der kanaanäischen Vegetationsfrömmigkeit in den Palmsonntagszweigen
Im Gegensatz zu Pessach (Ostern) und Schawuot (Pfingsten) gibt es bei Sukkot keine Festtransformation ins Christliche hinein und damit auch kein direktes Fort-leben der Lulav-Tradition. Hingegen spielen Zweige beim Palmsonntagsfest eine Rolle, das die Karwoche eröffnet und des triumphalen Einzugs Jesu in Jerusalem gedenkt. Drei Evangelien erwähnen, dass das Volk Zweige von den Bäumen riss und vor dem Messias auf den Weg streute. Es handelt sich um einen damals üblichen Ausdruck von Freude bei Siegesfeiern, dem wahrscheinlich die oben (2.4) erwähnten Zusammenhänge zwischen gerechter Herrschaft und Zweigen zugrunde liegen. Simon Makkabäus wird nach der Rückeroberung der Akra in Jerusalem mit Musik und Palmzweigen empfangen (1Makk 13,51).16 Die ältere Darstellung dieser Ereignisse in 2Makk 10,6-7 stellt allerdings eine auffällige Parallele zu Sukkot her: „Voll Freude veranstalteten sie eine achttägige Feier wie am Laubhüttenfest […] Nun trugen sie deshalb efeubekränzte Stäbe, grüne Zweige und Palmen…“ Es ist also nicht auszuschließen, dass die Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem von Anfang an – vielleicht intuitiv – Elemente des Sukkotfestes aufgegriffen hat. Auffällig ist, dass Markus von grünen Zweigen spricht, die das Volk auf den Feldern abschnitt (11,8), Matthäus von Zweigen, die sie den Bäumen abhieben (21,8) und Johannes von Palmzweigen (12,12). Widerspiegelt diese Vielfalt bereits frühe liturgische
16 In ähnlicher Weise wird nach Tg Est 8,15 Mordechai von den Juden geehrt. Auch Agrippa
legten die Juden aus Dankbarkeit Zweige aus (Philo, Leg Gai 297).
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 93
Sitten in den Gemeinden der Evangelisten? Eine Palmsonntagsprozession am Ölberg wird dann im Itinerar der Egeria (um 380 v. Chr.) ausdrücklich erwähnt.
Die Zweige werden als Teil der Palmsonntagsfeierlichkeit immer wichtiger17. Ihre Bedeutung als konnotatives Zeichen für messianischen Triumph tritt dabei in den Hintergrund zugunsten ihrer viel ursprünglicheren, direkteren Symbolik für das neue Leben, das im Frühling, wenn das Fest gefeiert wird, überall im Abendland aus dem Boden zu sprießen beginnt. So wie die Rabbinen den Spross des Laubhüt-tenfestes näher zu definieren versuchten, entstehen nun auch für „den Palm“, d.i. der Palmsonntagsstrauß, fixe lokale Bestimmungen zu seiner Zusammensetzung. Dabei spielen vorchristliche Bedeutungen der Pflanzen eine wichtige Rolle. Die Weide, der giftige (abtreibende!) Sade- oder Sevenbaum bzw. Stinkwacholder (Juniperus sabina) und die Haselnuss waren besonders beliebt (vgl. Marzell 20004, 1365-67). Spätestens ab dem 7. Jh. ist die Weihe der Zweige bezeugt18, was die An-bindung weiterer lokaler vorchristlicher Sitten und Gebräuche im Palmsonntags-brauchtum zur Folge hatte (vgl. Stapper 1935, 1367ff). die in der frühen Neuzeit teilweise als abergläubisch kritisiert, verboten und verfolgt wurden. Mancherorts werden die Zweige zu kunstvollen Gebinden arrangiert (Abb. 12c). Dem geweihten Palm (Palmsonntagsstrauss) wurde weitherum und für viele Zwecke magische Kraft zugeschrieben. Am interessantesten für unseren Zusammenhang ist das sog. „Palmen“ oder „Maien“, nämlich das Einstecken des Palms in den Acker zur För-derung des Wachstums und zum Schutz vor Hagel und Getreidebrand, entweder bereits am Palmsonntag oder an Ostern oder am Johannistag (ebd. VI 1374f). Da-mit drückt ein Anliegen der Zweigfrömmigkeit durch, die zur kanaanäischen Tiefenschicht des Palmsonntagsfestes gehört. 17 Auch in der christlichen Ikonographie, wo die Perikope vom Einzug anfänglich immer mit
jener von Zachäus auf dem Baum kombiniert wurde, die im Lukasevangelium (19,1-10) dem Einzug vorausgeht, und zwar so, dass bei Unkenntnis des Textes der Eindruck ent-steht, es handle sich um einen, der Jesus beim Einzug zujubelt. So schon auf dem Junius-Bassus-Sarkophag (Wehrhahn-Stauch 1990, 593), ebenso in der Geburtskirche von Be-tlehem (Abb. 12a) und in Giottos Scrovegni-Kapelle zu Padua. Demgegenüber finden sich in jüngeren Darstellungen, insbes. nördlich der Alpen, meistens jubelnde Menschen mit Zweigen in den Händen (Abb. 12b).
18 In Rom vielleicht zur Resorption des Kultes zu Ehren der Pales am 21. April (Stapper 1935, 908), einer altitalischen Weidengöttin. Das Frühlingsfest wurde sekundär mit der Gründung Roms in Verbindung gebracht.
94 Thomas Staubli
a b
c
Abb. 12: a Einzug in Jerusalem, Wandmosaik, Geburtskirche Betlehem, 12 Jh.; b Einzug in Jerusalem, Lüneburger Meister, 1420.; c Palmsonntagsfeier mit kunstvollen Gebinden in Bad Saulgau, Oberschwaben.
IV.3 Das Fortleben der kanaanäischen Vegetationsfrömmigkeit im Khidr- und Georgskult
Khidr ist eine komplexe, kryptoislamische Gestalt, in der sich verschiedene alte legendarische Überlieferungen sublimiert haben.19 Die Christen verehren ihn unter dem Namen des Hl. Georg. Vielerorts in Palästina, z.B. in Lot und in el-Khadr
19 Dazu gehören die Melchisedek-Legende, die Lebensquellsage, die arabische Jeremia-Le-
gende, die koranische Erzählung von Mose und dem Gottesknecht (Sure 18,60-82), Elija und Elischa-Überlieferungen (Franke 2000, 41-161).
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 95
befinden sich Khidr-Moschee und Georgskriche in unmittelbarer Nachbarschaft (Abb. 13a-b). Khidr hat im Volksglauben des Vorderen Orients viele Bedeutungen. Am offensichtlichsten ist Khidrs Beziehung zur Vegetation, die schon sein Name, „der Grüne“, zum Ausdruck bringt. Dazu erklärt der Hadith: „Er wird nur des-wegen al-Ḫaḍir genannt, weil er sich auf einen weißen Pelz (farwa) setzte, worauf hin dieser unter ihm in Bewegung geriet und ergrünte (vgl. Ṣaḥīḥ al-Buḫārī §160d)“. Dieser Pelz wird in den Auslegungen u.a. als trockenes Gras oder nackte Erde ge-deutet. Wo immer Khidr sich zeigt, ergrünt die Erde. Khidr ist eine Art Personi-fikation des jährlich neu erwachenden Grüns, wie aus einer Erklärung des osma-nischen Sufi Ismail Ḥaqqī deutlich wird:
„Khidr kommt von ḫuḍra, was ‚Grün‛ bedeutet. Es ist der Beiname von Balyān (sic!) b. Malkān…, der von der Lebensquelle getrunken hat. Balyā setzte sich eines Tages auf die trockene Erde. Da dieser Ort unter die Wirkung seines Lebens geriet, ergrünte und sich mit Frische erfüllte, gab man ihm den Beinamen Khidr. Später ist es um des Segens willen ein Personenname geworden, und dass man den wohlbekannten Tag mitten im Frühling Rūz-i Ḫıżır (,Khidr-Tag‛) nennt, kommt ebenfalls daher. Denn in diesen Tagen werden die grünen Pflanzen stark, die Blüten öffnen sich, und die trockene, tote Erde findet neues Leben (vgl. Silsile-i ṭarīqat-i Ğelvetiyye 75, zit. nach Franke 2000, 83).“
Der Khidr-Tag ist der 6. Mai, was dem 23. April des julianischen Kalenders ent-spricht, und damit dem Georgstag. Zusammen mit dem Qasım- bzw. Demetriostag am 7. November (26. Okt. nach dem julianischen Kalender), bilden die beiden Tage ein komplementäres Paar. Sie entsprechen dem Frühaufgang der Plejaden am Osthorizont und dem Spätaufgang am Westhorizont, die nach Hesiod (Erga 383) dem Bauern den Beginn der Ernte anfangs Mai und den Beginn des Pflügens gegen Ende Oktober anzeigten. Tatsächlich finden sich in der Kirche von al-Khadr beide Heiligen als Beschützer des Lebens in der Pose der Chaosbändigung: Georg mit einem Drachen, Demetrios mit Dämonen der Unterwelt, hinter ihnen ersprießt das Land in saftigem Grün (Abb. 13c).
Die Pose des Drachenkämpfers führt die altorientalische Ikonographie von Baal bzw. Baal-Seth fort (Keel 2001; vgl. Staubli 2010, 191f). Die Archaik der Khidr- bzw. Georgsfrömmigkeit in der Südlevante kommt auch darin zum Aus-druck, dass bis heute bei sehr alten Georgskirchen Schlachtungen im Rahmen von kirchlichen Festen, mehr noch aber von familiären Feiern stattfinden (Abb. 13d-e).
Das vielleicht bedeutendste Khidr-Heiligtum des Vorderen Orients befindet sich an der Orontesmündung, dem Ort, wo Khidr und Musa sich begegnet sein sollen (vgl. Sure 18,65). Ganz in der Nähe dokumentierten Kriss und Kriss-Hein-rich vor fünfzig Jahren eine qubba, die inmitten eines heiligen Haines liegt und de-ren First mit Ölzweiglein dekoriert war (vgl. Kriss/Kriss-Heinrich 1960, 291 mit Abb. 165).
96 Thomas Staubli
a b
c
d e
Abb. 13: Khidr- und Georgsfrömmigkeit in al-Khadr und Taibeh: a Al-Khadr, südlich von Be-tlehem, mit Moschee (grüne Kuppel) und Georgskirche (Silberkuppel und Bäume) (Aufnahme Juni 2011); b Emblem des Hl. Georg über dem Eingang der Georgskirche von Al-Khadr; c Hl. Georg und Hl. Demetrios als Reiterheilige an der Rückwand der Georgskirche von al-Khadr, 20. Jh.; d Opferstätte hinter der Georgskirche von Al-Khadr mit zwei gefällten Bäumen (Aufnahme Juni 2011); e Opferstätte in der alten Georgskirche von Taibeh (Aufnahme Juli 2011).
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 97
IV.4 Das Fortleben der kanaanäischen Vegetationsfrömmigkeit in der palästinischen Volkskultur
Auf arabischen Amuletten sind in der Regel nebst Texten aus heiligen Schriften nur noch abstrakte Zeichen und Formen zu finden. In Palästina macht auch hier der Zweig wieder eine Ausnahme. Er taucht sowohl als Randbemerkung des Amulett-herstellers auf (Abb. 14a)20 als auch als zentrales Symbol einer sorgfältigen, symme-trischen Komposition (Abb. 14b). Noch auf Glücksbringern der jüngsten Gene-ration findet sich der Ölzweig neben der Bismillah (Abb. 14c). Der Zweig sym-bolisiert auf diesen intimen Utensilien den Wunsch nach Prosperität, Wohlergehen und Leben in einem umfassenden Sinn. Konkreter als auf den Amuletten ist der Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem auf Vorratsgefäßen, wo stark stilisierte Zweige – teils an Ähren, teils an Palmen erinnernd – andeuten, dass der Behälter leibhaftigen Segen in Gestalt von Gersten- oder Weizenkörnern enthält (Abb. 14d-e). Nicht weniger konkret ist der Segen in Gestalt von Wasser, doch auch auf Wasserkrügen wird er als Zweig angezeigt (Abb. 14f-g). Vielgestaltig gegenwärtig sind vegetative Elemente schließlich in der palästinischen Stickerei (Abb. 14h-i). Bis in die Gegenwart hinein werden zum Teil ganze Kleiddekors aus diesen Elementen heraus entwickelt, so dass seine Trägerin wie ein lebendiger Baum erscheint oder – kanaanäischer und biblischer ausgedrückt – als „Mutter alles Lebendigen“ (Gen 3,20), aus der heraus Leben sprießt.
a b c
20 In auffälliger Parallele zu judäischen Siegelamuletten der ausgehenden Eisenzeit (vgl. GGG:
Abb. 349a-b).
98 Thomas Staubli
d e f
g h
i j
Abb. 14: a 98 Silberamulett, Südpalästina, Frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit; b ḥeğāb 98 Silberamulett, Jenin, frühes 20. Jh.; c Goldamulett, Werkstatt Hroub in Dēr Samit, 21. Jh.; d ḫābie /somaʾa (Getreideschrein) aus luftgetrocknetem, häckselgemagertem Ton mit Zweigdekor, Südpalästina, frühes 20. Jh.; e ḫābie /somaʾa (Getreideschrein) aus luftgetrocknetem, häckselgema-gertem Ton mit Zweigdekor, Südpalästina, frühes 20. Jh.; f-g Zweigdekor auf einem Wasserkrug, Deckel und Schöpfgefäß, Jerusalem, frühes 20. Jh.; h ğabʾa, Detail eines bemalten Hochzeits-krugs, Jenin, Mitte 20. Jh.; i Detail eines Tabakbeutels mit Zweig und Lebensbaum, Südpalästina, frühes 20. Jh.; j Zweigdekor auf einem Frauenkleid, Beit Mirsim, frühes 21. Jh.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 99
IV.5 Das Fortleben der kanaanäischen Vegetationsfrömmigkeit auf säkularen Staatsemblemen
Selbst die Staatsemblematik konnte sich dem uralten Traditionsdruck nicht entzie-hen. Die seit 1943 offizielle Flagge des Libanon (Abb. 15a) zeigt eine grüne Zeder auf weißem Grund zwischen zwei horizontalen, roten Streifen. Der größte in der mediterranen Antike bekannte Baum steht für den sagenhaften Waldreichtum des Landes in der Antike, der die Aufmerksamkeit der Bauherren aller benachbarten Reiche auf sich zog, wie die Felsreliefs vom Wadi Brisa und vom Nahr el-Kelb bezeugen (vgl. Börker-Klähn zu Nr. 260). Zugleich ist die Zeder ein Symbol für Wachstum, Wohlergehen, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vom Gerechten heißt es in Ps 92,12, dass er wachsen wird, wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Zeder führten bereits die Maroniten des 18./19. Jh. in ihrer weißen Flagge. Der christliche Bankier und Politiker Henry Pharaon (1901-1993), wie viele im Nahen Osten ein Bewunderer der österreichisch-habsburgischen Monarchie, empfahl das heutige Design, nachdem die Zeder in der Zeit Groß-Libanons (1920-1943) im weißen Mittelfeld der französischen Trikolore gestanden hatte.
Die Staatsflagge Israels wurde infolge der großen Bedeutung der zionistischen Bewegung für die Gründung des jungen Staates mit dem Davidschild (magen david) besetzt, obwohl es sich dabei weder um ein sehr altes, noch um ein sehr typisches jüdisches Emblem handelt (Scholem 1963). Jüdisches und kanaanäisches Erbe tritt dafür auf dem 1949 proklamierten Staatssiegel (Abb. 15b) in Erscheinung, das eine siebenarmige Menora zwischen zwei Ölzweigen zeigt. Die Ölzweige werden als Symbole des demokratisch-säkularen Israel gedeutet, während die Menora die reli-giöse Tradition repräsentiere. Die Konstellation „Leuchter zwischen Ölbäumen“ findet sich aber schon in Sacharjas Februarvision (Sach 4,1-14), wo sie auf Gott, den königlichen und den priesterlichen Gesalbten gedeutet wird. Sacharja wie-derum dürfte von dem in seiner Zeit weitverbreiteten Bild des Neumondes bzw. der Neumondstandarte zwischen zwei Bäumen inspiriert gewesen sein (Abb. 15c; vgl. Keel 1977, 274-327; zum Zusammenhang von Mond- und Baumkult siehe ausführlich Keel 1998.).
Die Menora wird ebenfalls oft als stilisierter Baum verstanden. Die israelische Sondermarke zum Unabhängigkeitstag von 1958 zeigt eine Menora, aus deren mitt-lerem Arm ein Ölzweig wächst. Ulrich Schwemers Meditation über die große Me-nora von Benno Elkan vor der Knesset beginnt mit den Worten: „Als würde er aus tiefem Grund sich heben, / so steht der Leuchter machtvoll da / scheint himmel-wärts sich hoch zu strecken / mit Armen Baumzweigen gleich“ (vgl. Brumlik et al. 1999, 30).
100 Thomas Staubli
a b c
Abb. 15: a Staatsflagge des Libanon mit einer Zeder im weißen Feld; b Staatssiegel Israels mit einer Menora, flankiert von Ölzweigen; c Stempelsiegelamulett von Tawilan, 7. Jh. v. Chr.
V. Schluss: Eine vertikale Ökumene der Sakramentalität der Pflanzen
Dieser Durchgang durch 8000 Jahre Kulturgeschichte Kanaans belegt nicht nur eine erstaunliche Konstanz der Vegetationsmotive, noch eindrücklicher ist viel-leicht die Beobachtung der Resistenz des Themas gegenüber ideologischen Umbrü-chen religiöser oder politischer Art bzw. seine jeweilige Integrierbarkeit in die über-geordneten jüdischen, christlichen und muslimischen Symbolsysteme. In Kanaan, dieser Region zwischen Meer und Wüste mit ihren heiß-trockenen Sommern und den unregelmäßigen Jahresniederschlägen, ist die jährliche Erfahrung des Grüns, das aus der Erde hervorbricht, intensiv und grundlegend für das Leben. Der in den Pflanzen konkret werdende Segen nimmt bis heute einen zentralen Platz in der Frömmigkeit jener Gegend ein und wird ihn noch lange behalten. Er ist die Basis einer vertikalen Ökumene quer durch die religiösen und politischen Transforma-tionen und damit in seiner hier herausgearbeiteten Prägnanz zugleich auch eine Relativierung religiöser und politischer Dogmen und Fundamentalismen.
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 101
Literaturverzeichnis
ANEP J. B. Pritchard, The Ancient Near East in pictures relating to the Old Testament, Princeton 1954
Aurenche/Kozlowsky 1999
O. Aurenche / St. Kozlowski, La Naissance du Néolithique au Proche Orient ou le Paradis Perdu, Paris 1999
Börker-Klähn 1982 J. Börker-Klähn, Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Fels-reliefs, BF 4, Mainz 1982
Brumlik 1999 M. Brumlik, et al. (Hgg.), Die Menora. Ein Gang durch die Geschichte Israels. Eine Medienmappe für Schule und Gemeinde (Israelitisch denken lernen 5), Knesebeck 1999
CSAJ J. Eggler / O. Keel, Corpus der Siegel-Amulette aus Jordanien. Vom Neolithikum bis zur Perserzeit, OBO. A 25, Freiburg (Schweiz) / Göt-tingen 2006
CSAPI O. Keel, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina / Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Einleitung, OBO.SA 10, Freiburg (Schweiz)/ Göttingen 1995
CSAPI 1 O. Keel, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Katalog Band I: Von Tell Abu Far‛a bis ‛Atlit. With Three Contributions by Baruch Brandl, OBO.A 13, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1997
CSAPI 2 O. Keel, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Katalog Band II: Von Bahan bis Tel Eton. Mit Beiträgen von Daphna Ben-Tor, Baruch Brandl und Robert Wenning, OBO. A 29, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 2010
Franke 2000 P. Franke, Begegnung mit Khidr, Beiruter Texte und Studien 79, Beirut 2000
Garfinkel 2003 Y. Garfinkel, Dancing at the Dawn of Agriculture, Austin 2003 Getzov 2008 N. Getzov, Art. Ha-Gosherim, in: NEAEHL 5 (2008), 1759-61 Getzov 2011 N. Getzov, Seals and Figurines from the Beginning of the Early Chal-
colithic Period at Ha-Gosherim, in: Atiqot 67 (2011) [1 =11;26 (hebr.), 81* (engl.)]
GGG O. Keel / Ch. Uehlinger, Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen, Fribourg 20106
Gitler/Tal 2006 H. Gitler / O. Tal, The Coinage of Philistia of the fifth and fourth Cen-turies BC. A Study of the Earliest Coins of Palestine, Collezioni Numis-matiche 6, Milano 2006
Hallo 1996 W. B. Hallo, Origins: the ancient Near Eastern background of some modern Western institutions, SHCANE 6, Leiden / New York / Köln 1996
Hermann 1994 Ch. Herrmann, Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel. Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament, OBO 138, Frei-burg (Schweiz) / Göttingen 1994
Hermann/Staubli 2010
Ch. Herrmann, / Th. Staubli, 1001 Amulett. Altägyptischer Zauber, monotheisierte Talisman, säkulare Magie, Freiburg (Schweiz) / Stutt-gart 2010
Hübner 1993 U. Hübner, Das ikonographische Repertoire der ammonitischen Siegel, in: B. Sass / Ch.Uehlinger (Eds.), Studies in the Iconography of the
102 Thomas Staubli
North-West-Semitic Inscribed Seals, OBO 125, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1993, 130-160
IPIAO 1 S. Schroer / O. Keel, Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern. Bd. 1: Vom ausgehenden Mesolithikum bis zur Frühbronzezeit, Freiburg (Schweiz) 2005
IPIAO 2 S. Schroer, Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern. Bd. 2: Die Mittelbronzezeit, Frei-burg (Schweiz) 2008
IPIAO 3 S. Schroer, Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern. Bd. 3: Die Spätbronzezeit, Frei-burg (Schweiz) 2011
Jacomet/Kreuz 1999 S. Jacomet / A. Kreuz, Archäobotanik, Stuttgart 1999 Junker 1940 H. Junker, Die Götterlehre von Memphis (Schabaka-Inschrift), APAW
1939, Phil.-hist. Klasse 23, Berlin 1940 KAI H. Donner / W. Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften,
Wiesbaden 1962-1964 Keel 1995 O. Keel, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von
den Anfängen bis zur Perserzeit. Einleitung, OBO.A 10, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1995
Keel 1997 O. Keel, Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine neue Deutung der Majestätsschilderungen in Jes6, Ez 1 und Sach 4, SBS 84/85, Stuttgart 1997
Keel 1984 O. Keel, Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des Hohen Liedes, SBS 114/115, Stuttgart 1984
Keel 1993 O. Keel, Der Wald als Menschenfresser, Baumgarten und Teil der Schöpfung in der Bibel und im Alten Orient, in: Daphinoff, D. (Hg.), Der Wald. Beiträge zu einem interdisziplinären Gespräch, Seges NF 13, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1993, 47-71
Keel 1998 O. Keel, Goddesses and trees, new moon and Yahweh: ancient Near Eastern art and the Hebrew Bible, Sheffield 1998
Keel 2001 O. Keel, Drachenkämpfe noch und noch im Alten Orient und in der Bibel, in: Sanct Georg, der Ritter mit dem Drachen, Freising / Lin-denberg 2001, 14-26
Keel 2010 O. Keel, Antike Vorläufer der Engel. Von den heidnischen Ahnen einiger jüdisch-christlicher Engel-Vorstellungen, in: K. P. Franzl / S. Hahn, (Hg.), Engel. Mittler zwischen Himmel und Erde. Katalog zur Ausstellung im Diözanmuseum Freising, Freising 2010, 226-249
Keel/Küchler 1984 O. Keel / M. Küchler / Ch. Uehlinger, Orte und Landschaften der Bibel. Bd. 1: Geographisch-geschichtliche Landeskunde, Zürich / Ein-siedeln / Köln 1984
Keel/Schroer 2008 O. Keel / S. Schroer, Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext altorientalischer Religionen, Göttingen / Freiburg (Schweiz) 20082
Keel/Schroer 2010 O. Keel / Schroer, Silvia, Eva – Mutter alles Lebendigen. Frauen- und Göttinnenidole aus dem Alten Orient, Freiburg (Schweiz) 20103
Kriss/Kriss-Heinrich 1960
Kriss R. / Kriss-Heinrich H., Volksglaube im Bereich des Islam. Bd. I: Wallfahrtswesen und Heiligenverehrung, Wiesbaden 1960
Lehmann 1984 R. G. Lehmann / F. Delitzsch und der Babel-Bibel-Streit, OBO 133, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1984
Marzell 2004 H. Marzell, Art. Palm, in: Bächtold-Stäubli, H. (Hg.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens VI, Berlin 20004 (=1935), 1365-81
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 103
Meshoder/Qedar 1999
Y. Meshorer / S. Qedar, Samarian Coinage, Jerusalem 1999
Oppenheim 1939-67 Max Freiherr von Oppenheim, Die Beduinen. Bde. 1-4, Wiesbaden 1939-67
Sass 1988 B. Sass, The genesis of the alphabet and its development in the second millennium B.C, ÄAT 13, Wiesbaden 1988
Sass 1991 B. Sass, Studia alphabetica. On the origin and early history of the Northwest Semitic, South Semitic and Greek alphabets, Freiburg (Schweiz)/ Göttingen 1991
Sass 1993 B. Sass, The Pre-Exilic Hebrew Seals: Iconism vs. Aniconism, in: B. Sass / Ch. Uehlinger (Eds.), Studies in the Iconography of the North-West-Semitic Inscribed Seals, OBO 125, Freiburg (Schweiz) / Göt-tingen 1993, 194-256
Sass 2005 B. Sass, The alphabet at the turn of the millennium. The West Semitic alphabet ca. 1150-850 BCE. The antiquity of the Arabian, Greek and Phrygian alphabets, Tel Aviv 2005
Scholem 1963 G. Scholem, Das Davidschild. Geschichte eines Symbols, in: ders. Judaica 1, Frankfurt 1963² [1997], 75-118
Schroer 1987 S. Schroer, In Israel gab es Bilder. Nachrichten von darstellender Kunst im Alten Testament, OBO 74, Freiburg (Schweiz) / Göttingen 1987
Smith 2002 M. S. Smith, Ugaritic Studies and Israelite Religion: A Retrospective View, NEA 65, 2002, 17-29
Sommer 2000 M. Sommer, Europas Ahnen. Ursprünge des Politischen bei den Phö-nikern, Darmstadt 2000
Stapper 1935 R. Stapper, Art. Palmsonntag, in: LThK VII, 1935, 907-908 Staubli 2005 Th. Staubli, Land der sprießenden Zweige, BiKi 60, 2005, 16-22 Staubli 2010 Staubli, Thomas, Christliche Amulette, in: 1001 Amulett. Altägyptischer
Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, Freiburg (Schweiz) 2010, 189-198
Staubli 2011 Th. Staubli, Art. Stock, storage, in: Encyclopedia of the Material Cul-ture of the Biblical World (i.D.)
Tubb 2005 J. N. Tubb, Völker im Lande Kanaan, Darmstadt 2005 Vigne 2005 J.-D. Vigne, First steps of animal domestication. New Archaeozoo-
logical approaches, Oxford 2005 Wehrhan-Strauch 1990
L. Wehrhahn-Stauch, Art. Einzug in Jerusalem 1990 (=1968), in: LCI 1, 593-598
Winter 1986 U. Winter, Der stilisierte Baum. Zu einem auffälligen Aspekt altorien-talischer Baumsymbolik und seiner Rezeption im Alten Testament, BiKi 41, 1986, 171-176
Wreszinski W. Wreszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte, 3 Bde., Leipzig 1923-38
Yasur-Landau 2010 A. Yasur-Landau, The Philistines and Aegean migration at the end of the late Bronze Age, Cambridge 2010
Zohary/Hopf 2000 D. Zohary / M. Hopf, Domestication of plants in the Old World. The origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley, Oxford 20003
104 Thomas Staubli
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Fragment eines rot bemalten Tonkruges aus dem Grabentempel von Lachisch, um 1300 v. Chr., IPIAO 3: Nr. 852 Abb. 2: Zweige in der frühesten Kunst des Vorderen Orients: a Tonschale, Samarra, 6200-5700
v. Chr., IPIAO 1: Nr. 7; b Stempelsiegel, Luristan, um 4000 v. Chr., IPIAO 1: Nr. 7; c Standartenaufsatz aus Kupfer, Nahal Mischmar, 4500-4000 v. Chr., IPIAO 1: Nr. 60; d Tonkrug, Bab edh-Dhra, 3200-3000 v. Chr., IPIAO 1: Nr. 100
Abb. 3: Zweig mit Capriden als Segenssuperlativ: a Skarabäus, Bet Mirsim, um 1600 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Mirsim Nr. 54; b Skarabäus, Bet Schean, um 1600 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 77; c Skarabäus, Bet Schean, um 1600 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 163; d Skarabäus, Bet Schean, um 1400 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 140; e Skarabäus, Bet Schean, um 1350 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 82; f Skarabäus, Bet Schean, um 1200 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 182; g Skarabäus, Bet Schean, um 1000 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 9; h Scheibenförmiges Siegel, Rabbat Moab, 7. Jh. v. Chr., CSAJ: Rabbat Moab Nr. 1
Abb. 4: a-g Zweig und weibliche Scham als Segenssuperlativ: a Beritzter Knochen, Hagosherim, um 6000 v. Chr., Israel-Museum (vgl. Getzov 2008, 1760); b Alabasterplatte, Mari, frühes 3. Jt. v. Chr, IPIAO 1: Nr. 106; c Terrakotta, Turang Tepe, 1. Hälfte 3. Jt. v. Chr., IPIAO 1: Nr. 105; d Skarabäus, um 1600 v. Chr., Geser, Schroer1989:Nr. 6; e Skarabäus, En Samije, um 1600v. Chr., CSAPI 2: En-Samije Nr. 12; f Krugmalerei, Lachisch, um 1300 v. Chr., Schroer 1987: Abb. 14; g Felsritzung, Vaschta (Libanon), 1. Jt. v. Chr., Schroer 1989: Nr. 44
Abb. 5: a-f Herrschaftsmächte im Dienste des Gedeihens der Vegetation: a Skarabäus, Bet Schemesch, um 1600 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schemesch Nr. 105 ; b Skarabäus, Dotan, um 1000 v. Chr., CSAPI 2: Dotan Nr. 20; c Skarabäus, Emmaus, 1700-1550 v. Chr., CSAPI 2: Emmaus Nr. 1; d Skarabäus, Bet Mirsim, 1650 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Mirsim Nr. 16; e Skarabäus, Elad Masor, 1550 v. Chr., CSAPI 2: Elad-Masor Nr. 1; f Skarabäus, Bet Schean, um 1000 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 10; g Skarabäus, Bet Schean, um 900 v. Chr., CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 71; h Skarabäus, Bet Schean, CSAPI 2: Bet-Schean Nr. 225
Abb. 6: Durch den Zweig kanaanisierte Ptah- und Amun-Re-Frömmigkeit: a Skarabäus, En Samije, um 1600 v. Chr., CSAPI 2: En Samije Nr. 7; b ; b Skarabäus, Tell el-Ağğūl, um 1600 v. Chr., CSAPI :Abb. 376; c Skarabäus, Dor, um 600 v. Chr., CSAPI 2: Dor Nr. 14; d Skarabäus, Horvat Erav, um 1000 v. Chr., CSAPI 2: Horvat Erav Nr. 1; e Skarabäus, Dor, um 1000 v. Chr., CSAPI 2: Dor Nr. 21
Abb. 7: Zweige als kanaanäische Inkulturationsikoneme zusammen mit hellenistischen Motiven in spätpersischer Zeit: a Bulle, Wadi ed-Dalije, 375-335 v. Chr., CSAPI 2: Wadi ed-Dalije Nr. 4; b Bulle, Wadi ed-Dalije, 375-335 v. Chr., CSAPI 2: Wadi ed-Dalije Nr. 24; c Münze aus Samaria, um 400 v. Chr., Meshorer / Qedar 1999: Abb. 206
Abb. 8: Lotos auf südlevantinischen Stempelsiegelamuletten: a Skarabäus, Tell Abu Sureq, 1750-1550 v. Chr., CSAPI 1: Tell Abu Surek Nr. 3; b Skarabäus, Afek, um 1600 v. Chr., CSAPI 1: Afek Nr. 52; c Skarabäus, Afek, um 1650 v. Chr., CSAPI 1: Afek Nr. 1; d Skarabäus, Afek, 1479-26 v. Chr., CSAPI 1: Afek Nr. 53; e Zylindrisches Elfenbeinsiegel, Amman, 7. Jh. v. Chr., CSAJ: Amman Nr. 1; f Skarabäus, Phönizien, 530-330 v. Chr., Keel 2010: 238 Nr. 2:40
Abb. 9: a Knochensiegel, Juda, 8./7. Jh. v. Chr., GGG: Abb. 270 b Abdruck eines Stempel-siegelamuletts mit Capriden am stilisierten Baum, Akko, CSAPI 1: Akko Nr. c Bulle, Jerusalem, 6. Jh. v. Chr., GGG: Abb. 353a d Münzbild, mit Stadtemblem und Palmen, philistäisch, 5. Jh. v. Chr., Gitler / Tal 2006: 398 e Palmettenamulett, Tell Ser‛a, 1300-1100, Hermann / Staubli 2010:143 Abb. 4
Die kanaanäische Vegetationsfrömmigkeit 105
Abb. 10: a Papyruspfeileramulette aus einem Friedhof von Atlit, 5. Jh. v. Chr., Herrmann 1994:785f b Rosettenstempel, Jerusalem, 7. Jh. v. Chr., GGG: Abb. 342b
Abb. 11: arba’a haminim, die vier (Pflanzen-)Arten (für Sukkot): a Etrog und Lulav, Münze, Eleazar, 68 n. Chr., Madden 1964:164,4 Rev. b Lulav und Etrog, Fußbodenmosaik, Syna-goge von Tiberias, 350-400 n. Chr. c Etrog und Lulav mit Myrte, Palme und Bachweide. Foto: yonidebest/public domain
Abb. 12: a Einzug in Jerusalem, Wandmosaik, Geburtskirche Betlehem, 12 Jh. b Einzug in Jerusalem, Lüneburger Meister, 1420. c Palmsonntagsfeier mit kunstvollen Gebinden in Bad Saulgau, Oberschwaben, ©Touristeninformation Bad Saulgau, Oberschwaben
Abb. 13: Khidr- und Georgsfrömmigkeit in al-Khadr und Taibeh: a Al-Khadr, südlich von Betlehem, mit Moschee (grüne Kuppel) und Georgskirche (Silberkuppel und Bäume) (Aufnahme Juni 2011). b Emblem des Hl. Georg über dem Eingang der Georgskirche von Al-Khadr. c Hl. Georg und Hl. Demetrios als Reiterheilige an der Rückwand der Georgskirche von al-Khadr, 20. Jh. d Opferstätte hinter der Georgskirche von Al-Khadr mit zwei gefällten Bäumen (Aufnahme Juni 2011). e Opferstätte in der alten Georgskirche von Taibeh (Aufnahme Juli 2011). – Fotos des Autors
Abb. 14: a māskah, Silberamulett, Südpalästina, Frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit b ḥeğāb zeineh, Silberamulett, Jenin, frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit c Goldamulett, Werkstatt Hroub in Dēr Samit, 21. Jh. d ḫābie /somaʾa (Getreideschrein) aus luftgetrocknetem, häckselgemagertem Ton mit Zweigdekor, Südpalästina, frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit e ḫābie /somaʾa (Getreideschrein) aus luftgetrocknetem, häckselgemagertem Ton mit Zweigdekor, Südpalästina, frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit f-g Zweigdekor auf einem Wasserkrug, Deckel und Schöpfgefäß, Jerusalem, frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit h ğabʾa, Detail eines bemalten Hochzeits-krugs, Jenin, Mitte 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit i Detail eines Tabakbeutels mit Zweig und Lebensbaum, Südpalästina, frühes 20. Jh., Sammlung I. Hroub, Dēr Samit j Zweigdekor auf einem Frauenkleid, Beit Mirsim, frühes 21. Jh. – Alle Fotos vom Autor, mit freundlicher Genehmigung des Sammlers I. Hroub
Abb. 15: a Staatsflagge des Libanon mit einer Zeder im weißen Feld. b Staatssiegel Israels mit einer Menora, flankiert von Ölzweigen. c Stempelsiegelamulett von Tawilan, 7. Jh. v. Chr., CSAJ Tawilan Nr. 2