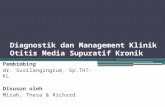Diagnostik dan Management Klinik Otitis Media Supuratif Kronik4
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
-
Upload
setmarburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Med. hist. 3. 36(2001) 247-266 ?2001 URBAN & FISCHER VERLA6
http://www.urbanfischer.de/journals/medhistj
MEDIZIN HISTORISCHES
JOURNAL
Nils P. Heefiel
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Schlusselwbrter: mesopotamische Medizin - babylonisches Diagnosehandbuch
- Ab lauf der Patientenuntersuchung
- Krankheitsklassifikation
Key words: mesopotamian medicine - babylonian diagnosdc handbook - course of exa
mining the patient - classification of diseases
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Schriften der antiken Auto
ren die einzigen Quellen fur unser Wissen iiber die wissenschaftlichen Lei
stungen der Babylonier.1 Mit den spektakularen Entdeckungen der assyri schen Hauptstadte und ihrer Tontafelbibliotheken in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts kamen neben vielen Dokumenten des taglichen Le
bens auch Tausende von akkadisch-sprachigen, in Keilschrift geschriebe nen Tontafeln ans Licht, die uns einen genauen Einblick in die religiosen und politischen Vorstellungen, aber auch in die wissenschaftlichen Bemii
hungen der Babylonier und Assyrer ermoglichen. Allein in der Bibliothek des assyrischen Konigs Assurbanipal (669
- ca. 629 v. Chr.) fanden sich
iiber 22000 zumeist bruchstiickhafte Tontafelf ragmen te, von denen iiber
1000 medizinischen Inhalts sind. Seit der Entzifferung der Keilschrift und
den Fortschritten in der Erforschung der akkadischen Sprache,2 in der die
iiberwaltigende Mehrzahl der medizinischen Texte abgefafit ist, wurde
auch an der Edition von medizinischen Texten gearbeitet.3 Besonders die
247
1 Zwar priesen Strabo, Diodor, Cicer? und andere die Kenntnisse der Mesopotamier in der
Astronomie und Astrologie sowie in der Kunst der Divination, von den medizinischen Er
rungenschaften des Alten Orients berichteten die klassischen Autoren dagegen kaum et~
was. Siehe dazu St. M. Maul, ?Die Heilkunst des Alten Orients", Medizinhistorisches
Journal 36, 2001, 3-22. 2 Zur Entzifferungsgeschichte der Keilschrift siehe M. T. Larsen, The Conquest of Assyria, London/New York 1996, 293-316. 3 Gute Einfuhrungen in die babylonisch-assyrische Medizin finden sich bei R. D. Biggs, Medizin, in: D. O. Edzard (Hrsg.), Reallexikon der Assyriologie, 7. Bd., Berlin/New York 1987-1990, 623-629; ders., Medicine, Surgery, and Public Health in Ancient Meso
potamia, in: J. M. Sasson (Hrsg.), Civilizations of the Ancient Near East, Bd. 3, New
York 1995, S. 1911-1924 mit weiterfiihrender Literatur und bei St. M. Maul, Die babylo nische Heilkunst. Medizinische Keilschrifttexte auf Tontafeln, in: H. Schott (Hrsg.),
Meilensteine der Medizin, Dortmund 1996, 32-39.
0025-8431/01/36/3-4-247 $15.00/0
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nib P. Heefiel
nach unserem Verstandnis sehr rational anmutenden therapeutischen Tex
te, die vor allem Behandlungsanweisungen und Rezepte enthalten, standen
im Mittelpunkt des Interesses der Gelehrten des spaten 19. und friihen 20.
Jahrhunderts. Texte zur babylonischen Diagnostik wurden dagegen erst
relativ spat in den Tontafelsammlungen entdeckt. Es ist das Verdienst des
Arztes Felix von Oefele, der um die Jahrhundertwende in Bad Neuenahr
praktizierte und sich intensiv mit der babylonischen und altagyptischen Medizin befafite, die Existenz eines babylonischen Handbuchs zur Dia
gnostik und Prognostik erstmals bekannt gemacht zu haben.4 Im Jahre 1951 wurde durch Rene Labat eine Edition des babylonischen Diagnose handbuchs zuganglich, in der die damals bekannten Texte zusammenge stellt waren.5 Seit dieser grundlegenden Bearbeitung sind nicht nur eine
grofie Zahl neuer Texte, die unser Wissen iiber die babylonische Diagno stik vermehren, sondern vor allem zwei Kataloge zum Diagnosehandbuch bekannt geworden, welche den Umfang und Aufbau des Diagnosehand buchs beschreiben und denen es zu verdanken ist, dafi heute ein recht ge naues Bild der babylonischen Diagnostik gezeichnet werden kann.
Zur Beziehung von Krankheitsdtiologie und Diagnostik
Das Ziel der Untersuchung des Kranken war fur die Babylonier ungleich mehr als die reine Benennung der Krankheit zum Zwecke der therapeuti schen Linderung, da eine Krankheit grundsatzlich auch als Stoning des
sonst guten Verhaltnisses zwischen dem Erkrankten und einer Gottheit
wahrgenommen wurde. Es gait daher, zunachst die Gottheit zu identifizie
ren, die ihren Zorn den betroffenen Menschen in Form der Krankheit spii ren liefi, um dann diese Gottheit zu versohnen und damit die vollstandige
Genesung des Kranken herbeizufuhren. Grundlage der babylonischen
Diagnostik war daher folgerichtig der Glaube, anhand der verschiedenen
Symptome am Korper des Patienten nicht nur auf die Krankheit selbst, sondern vor allem auf die die Krankheit verursachende Gottheit zuriick
schliefien und auch den weiteren Verlauf der Krankheit vorhersagen zu
konnen. Die Symptome am Korper des Patienten waren direkt von der sie
verursachenden Gottheit abhangig, und jeder gute Heiler, der die kausalen
Zusammenhange zwischen den Symptomen und den Gottern kannte, war
durch das sorgfaltige und genaue Inspizieren der Symptome in der Lage, die verursachende Gottheit zu benennen.
4F. von Oefele, Ein Handbuch der Prognostik in Keilschrift, in: Deutsche Medicinische Presse 5, 1901, 27. Zu den Werken F. von Oefeles siehe M. Stol, Felix von Oefele and Ba
bylonian Medicine, in: Janus 72, 1985, 7-16. 5 R. Labat, Traite akkadien de diagnostics et pronostics medicaux, Paris 1951. 248
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Als Krankheitsverursacher wirkten nach den atiologischen Vorstellungen der Babylonier neben den Gottern auch die verschiedensten Damonen, die
sich dem Menschen entweder im direkten Auftrag einer Gottheit in unheil
voller Absicht nahern konnten oder aber zuschlugen, wenn der Mensch
nicht mehr unter gottlichem Schutz stand, weil sich seine Schutzgottheit von ihm abgewendet hatte. So wurde z. B. die hohe Mortalitatsrate von
Neugeborenen und Kleinkindern auf die Rankespiele der Damonin La
mastu zuriickgefiihrt, die sich etwa der Mutter als Amme anbot, um den
Saugling mit ihrer unreinen Milch zu vergiften. Oder es wurden bestimmte
Formen der Epilepsie mit dem Wirken eines Totengeistes in Zusammen
hang gebracht, der, nicht korrekt bestattet, die Welt der Lebenden heim
suchte und Krankheit und Unheil mit sich brachte. Aufierdem konnten
auch Menschen Krankheiten durch Zauberei und magische Praktiken her
vorrufen, indem sie den Betroffenen durch verschiedene Arten von Kon
taktzauber infizierten. All dies konnte geschehen, wenn sich der Mensch
durch eine bewufke oder unbewufite Tat den gottlichen Zorn zugezogen hatte und nicht mehr im sozial-religiosen Aquilibrium stand. Ganz selten
finden solche Vergehen seitens des erkrankten Menschen in den diagnosti schen Texten Erwahnung: Im Vordergrund stehen dabei sexuelle Ubertre
tungen wie Inzucht, Verkehr mit der Ehefrau eines anderen Mannes oder
auch unsittliche Annaherungen an zur Keuschheit verpflichtete Priesterin
nen. Aber auch Tabuverletzungen wie der Genufi unreiner Speisen oder
nicht eingehaltene Eide sowie Diebstahl und Mord werden hier als letztli
che Ursachen von Krankheit angefuhrt.
Uber diese allgemeinen Ansichten hinaus konnen wir heute feststellen,
dass Krankheiten nach babylonischen Vorstellungen nur sehr selten aus
sich selbst heraus wirkten. Damit jemand erkrankte, war ein aggressiver Akt seitens der Gottheit, eines Damons oder eines Zauberers als Ausloser
der Krankheit notwendig. Die Krankheit wurde verursacht, so glaubte man, indem die Gottheit oder
(Jer Damon den Betreffenden in irgendeiner
Form beriihrte und damit die Krankheit auf ihn ubertrug, ja sogar in seinen
Korper einpflanzte. Diese Beriihrung durch die Gottheit wurde als ?Schla
gen", ?Packen", ?Ergreifen" oder ?Beruhrenct des Menschen ausgedriickt. Zumeist jedoch erfolgt die Benennung des Krankheitsverursachers durch
die stereotype Formel ?Hand der Gottheit soundsow, die auch eine Beriih
rung impliziert. Als Beispiele mogen dienen:
249
1. Wenn sein Gesicht voll von weifilichen Blaschen ist: Hand des (Sonnengottes) Samas, er wird gesunden.
2. Wenn sein Nacken und seine Hiiften ihn gleichzeitig schmerzen: Hand des (Wetter gottes) Adad.
3. Wenn er am Morgen heift, am Abend dagegen kalt ist und zittert: Hand des (Mond gottes) Sin.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nik P. Heefiel
4. Wenn funf, zehn, fiinfzehn oder zwanzig Tage seine Finger und Zehen ganz zusam
mengezogen sirid und herunterhangen, und er sie weder offnen noch offen halten kann: Die Hand der (Liebes- und Kriegsgdttin) Istar. Es wird in Ordnung kommen, und er wird gesunden.6
Arzt und Beschwdrer: Die mesopotamiscben Heiler
Schon der alteste bekannte diagnostische Text aus der ersten Halfte des
2. Jt. v. Chr. zeigt dieses Interesse der Heiler nicht nur am Ausgang und
Verlauf der Krankheit und an ihrer Benennung, sondern auch an der Iden
tifizierung des Krankheitsverursachers in Form der ?HandM einer Gott
heit.7 Daneben zeigen therapeutische Texte und Briefe dieser friihen Zeit, dafi die Behandlung des Kranken nicht in der Hand einer Person allein lag. Beim Heilungsprozefi wirkten Vertreter zweier Berufsgruppen, der dsipu ?Beschw6rer" und der asu ?Arzt", zusammen. Diese Ubersetzungen der
babylonischen Termini sind jedoch nicht so zu verstehen, dafi der Be
schworer auf - nach heutiger Sichtweise - rein magische Weise, durch Be
schworungen und Gebete, versuchte, die Krankheit zu heilen, wahrend
der Arzt ^rationale" Therapien, durch Herstellung von heilkraftigen Sal
ben, Verbanden oder Zapfchen, durchfiihrte.8 Sowohl der Beschworer als
auch der Arzt bedienten sich aus heutiger Sicht magischer und rationaler
Behandlungsmethoden. Es hat vielmehr den Anschein, dafi der asu ur
spriinglich ein Wundarzt war, sich also vornehmlich mit aufierlichen Ver
letzungen beschaftigte, wahrend der dsipu sich mehr mit aus dem Inneren
des Korpers wirkenden Erkrankungen befafite, die auf der Haut sichtbar
wurden oder sich durch Schmerzen bemerkbar machten. Wahrend der
Arzt sich ausschliefilich der Medizin widmete, hatte der Beschworer ein
weit grofieres Betatigungsfeld, denn er war der Fachmann fur die Bezie
b Die Textstellen aus dem babylonischen Diagnosehandbuch (SA.GIG) werden im folgenden nach Tafel und Zeile zitiert. In Klammern wird als Literatur R. Labat, Traite akkadien de diagnostics et pronostics medicaux, Paris 1951 (= TDP) und N. P. Heessel, Babylonisch assyrische Diagnostik, Alter Orient und Altes Testament 43, Minister 2000 (= BAD) ange geben. 1: SA.GIG 9/48 (TDP 74/48); 2: SA. GIG 10/9 (TDP 80/9); 3: SA.GIG 17/93 (BAD 204, 210); 4: SA.GIG 16/59,-60> (BAD 177, 183f.). 7 Dieser Text ist in Keilschriftkopie publiziert in Tabulae Cuneiformes de Liagre Bohl II, Leiden 1957, Nr. 21. Eine Teilbearbeitung der sehr abgeriebenen Tafel findet sich bei N. P. Heessel, Babylonisch-assyrische Diagnostik, 97f.
8 Eine solche Sichtweise findet sich vereinzelt immer noch in der Fachliteratur. Sie ent
stammt einer Zeit, in der man versuchte, eine rational-empirische Medizin, die mit dem asu
?Arzta zusammengebracht wurde, von einer magisch-religiosen Medizin, die vom dsipu ?Beschw6rera reprasentiert wurde, streng zu unterscheiden. Siehe E. Ritter, Magical-Ex pert (=Asipu) and Physician (~Asu). Notes on Two Complementary Professions in Baby lonian Medicine, in: H. G. Guterbock und T. Jacobsen (Hrsg.), Studies in Honor of Benno Landsberger on his Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965, Assyriological Studies 16, Chicago 1965, 299-321. Eine solche neopositivistische Beurteilung lafit sich heute nicht
mehr halten. 250
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
hung zwischen den Menschen und der Gotterwelt und mufite dieses deli
kate Verhaltnis mittels Divination sowie Ritualen und Beschworungen im
Gleichgewicht halten bzw. wiederherstellen. Da auch Krankheiten neben
allgemeinen Ubeln und Unglucksfallen als Folge von Problemen und Ver
stimmungen zwischen dem Erkrankten und den Gottern angesehen wur
den, war es die Aufgabe des Beschworers, das sozial-religiose Aquilibrium wiederherzustellen, denn nur dadurch konnte der an einer Krankheit Lei
dende genesen. Es war daher auch der Beschworer und nicht etwa der
Arzt, der die diagnostische Untersuchung durchfuhrte und die Diagnose und Prognose stellte.
Es ist wichtig, sich zu vergegenwartigen, dafi die Untersuchung der Sym
ptome des Patienten nicht das einzige den Babyloniern zur Verfugung ste
hende Mittel war, um zur Diagnose und Prognose einer Krankheit zu ge
langen. Besonders im 2. Jt. v. Chr. bediente man sich zur Diagnose- und
Prognosestellung der Olweissagung, bei der Ol in Wasser gegossen wurde
und aus den Verlaufsformen des Ols der Wille der Gotter ebenso ablesbar
war wie aus der Deutung von Traumen - eine Konzeption, die uns durch
die biblische Josephsgeschichte vertraut ist.9 Aufierdem bestand jederzeit die Moglichkeit, mittels einer Opfer- oder Leberschau, bei der ein Schaf
geschlachtet und die Schafsleber inspiziert wurde, eine Anfrage an die Got
ter zu richten. Dabei, so glaubte man, legten die Gotter Samas und Adad
die Wahrheit in das Aussehen der Leber des Schafes, und eine Anfrage, et
wa ob der Patient die Krankheit uberleben werde, konnte durch das kundi
ge ?Lesen" der Schafslebern beantwortet werden.10 Im 1. Jt. v. Chr. wurde
dem assyrischen Konig niemals ein Medikament gegeben, ohne dafi man
zuvor eine Leberschau durchfuhrte, um die Vertraglichkeit und Ungefahr lichkeit des Medikaments fur den
Konjg sicherzustellen.
Wahrend diese Techniken jedoch vor allem zur Prognostik herangezogen wurden, bildete die Untersuchung der Krankheitssymptome des Patienten
durch den Beschworer den eigentlichen Kern der Diagnostik. Die ver
schiedenen Symptomgefuge und Krankheitsbilder, denen die Arzte bei ih rer Arbeit begegneten, und die von ihnen getroffenen Diagnosen und Pro
gnosen wurden bald auch aufgeschrieben und ebenso wie Rezepte und the
rapeutische Mafinahmen den nachfolgenden Generationen uberliefert.
251
9 Vergleiche dazu G. Pettinato, Die Olwahrsagung bei den Babyloniern, Studi Semitici 22, Rom 1966, und allgemein zur Traumdeutung S. A. L. Buttler, Mesopotamian Concepti ons of Dreams and Dream Rituals, Alter Orient und Altes Testament 258, Minister 1998.
10 Zur Verwendung der Leberschau bei der Diagnostik siehe J. Nougayrol, Presages medi
caux de Pharuspicine babylonienne, in: Semitica 6, 1956, 5-14. Allgemein zur Leberschau
siehe U. Jeyes, Old Babylonian Extispicy, Leiden 1989, R. Leiderer, Anatomie der Schafsleber im babylonischen Leberorakel, Munchen 1990 und U. Koch-Westenholz,
Babylonian Liver Omens, Kopenhagen 2000.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
Das babylonische Diagnosehandbuch
Die verschiedenen diagnostischen Texte wurden in der Mitte des 11. Jh. v.
Chr. von dem babylonischen Gelehrten Esagil-kin-apli redigiert, in ein ver
bindliches Schema gebracht und somit serialisiert.11 Die neu geschaffene Se
rie umfalke mehr als 3000 diagnostische Eintrage und wurde akkadisch sa
kikku genannt, was wohl am treffendsten mit ?Symptomea iibersetzt wer
den kann. Wir nennen das Werk heute das babylonische ?Diagnosehand buch". Esagil-kin-apli verteilte die Eintrage auf 40 Tafeln von durchschnitt
lich etwa 80 Eintragen, wobei es zu grofieren Schwankungen kommen
konnte (zwischen 24 und 280 Eintragen), da die einzelnen Eintrage zum ei
nen erhebliche Langenunterschiede aufwiesen und zum anderen die Eintra
ge einer Tafel immer eine Sinneinheit bilden, die nur selten auseinanderge rissen wurde. Die einzelnen Tafeln ordnete der Gelehrte dann zu Gruppen, die praktisch Kapitel oder Unterserien bilden. So zerfallt die gesamte Serie von 40 Tafeln in 6 Unterserien von unterschiedlicher Lange. Diese Unterse
rien tragen auch jeweils einen eigenen Titel, mit dem programmatisch der
Inhalt der Unterserie beschrieben wird. Die Form, die Esagil-kin-apli den
Texten damit gegeben hatte, wurde allgemein akzeptiert und bis zum Unter
gang der Keilschriftliteratur fast unverandert immer wieder abgeschrieben.
Nr. Tafeln Titel des Kapitels Inhalt des Kapitels
1 1-2 ?Wenn der Beschworer zum Beobachtungen allgemeiner Art auf Haus des Kranken geht" dem Weg zum und im Haus des Kran
ken durch den Beschworer oder einen anderen Menschen
2 3-14 ?Wenn du dich dem Kranken Symptombeobachtungen an den einzel naherst" nen Korperteilen des Kranken vom
Kopf zum Fufi
3 15-25 ?Wenn er einen Tag krank ist" Beriicksichtigung des Erkrankungszeit punkts und der Erkrankungsdauer so wie Beobachtung allgemeiner Sympto me am Korper des Kranken
4 26-30 ?Wenn ein Schlag ihn befallt - Symptombeschreibungen bei Symptome der Epilepsie" verschiedenen Epilepsieformen
5 31-35 ?Wenn Sonnenglut ihn erhitzt" Voraussagen iiber die Dauer von Fie
bererkrankungen, Verbindung von
Symptombeobachtungen und der Iden
tifizierung des Krankheitsverursachers mit Krankheitsbezeichnungen
Schwangerschaftsprognosen, Beobach
tungen von Erkrankungen wahrend der
Schwangerschaft sowie Symptombe obachtungen bei Frauen- und Klein
kinderkrankungen
6 36-40 ?Wenn eine gebarfahige Frau schwanger wird"
Ubersicht iiber die Kapitel des babylonischen Diagnosehandbuchs
11 Zur Serialisierung des Diagnosehandbuchs siehe N. P. Heessel, Babylonisch-assyrische Diagnostik, 104-110. 252
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Der Aufbau des Diagnosehandbuchs orientiert sich am Verlauf der diagno stischen Untersuchung und spiegelt die planvolle Vorgehensweise des Be
schworers wider. Die Diagnosestellung begann fiir ihn keineswegs erst bei
der Untersuchung des Patienten selbst. Schon auf dem Weg zum Haus des
Kranken achtete er auf ungewohnliche Vorkommnisse, auffallige Tiere,
Gegenstande oder Menschen und, am Haus des Kranken angekommen, schenkte er selbst den Gerauschen, die die Tur des Hauses erzeugte, Be
achtung. Weiterhin liefi er sich auch von anderen Besuchern ungewohnli che Ereignisse berichten, die diesen auf ihrem Weg zum Haus des Kranken
widerfahren waren oder die sie und die Angehorigen des Kranken im Haus
beobachtet hatten. Dazu konnten der Flug von Vogeln oder der Schrei von
Tieren genauso wie Spinnen, Geckos und Mause an der Schlafstelle des
Kranken gehoren. Einige Beispiele:
5. Wenn der Beschworer zum Haus des Kranken geht und auf der Strafie eine aufrecht stehende Tonscherbe sieht, so ist der betreffende Kranke schwerkrank, du sollst dich ihm nicht nahern.
6. Wenn er eine Katze sieht: Die Kranke leidet an der Hand der Istar. 7. Wenn die Tur des Haushalts, in dem der Kranke liegt, knarrt: Dieser Kranke wird
sterben.12
Aus unserer Sieht erscheint diese Vorgehensweise magisch und irrational; in einer Kultur jedoch, deren hervorstechendstes Merkmal die Divination
war - der Glaube, dafi keine Erscheinung auf der Erde und am Himmel zu
fallig war, sondern immer auf das zukiinftige Schicksal der Menschen und
die geheimen Ratschlusse der Gotter verwies - konnten auch solche
Omenbeobachtungen liber die Diagnose der Krankheit und den weiteren
Krankheitsverlauf Aufschlufi geben. Sie entsprachen damit durchaus dem
?wissenschaftlichen" (Selbst-)verstandnis der Babylonier. So erinnert etwa
die aufrechtstehende Topfscherbe an den zerbrochenen Krug und steht da
mit durch Analogie fiir das zerstorte Leben des Patienten, wodurch die ne
gative Ausdeutung erklarbar wird.13
Diese Beobachtungen von Omina bilden die aus zwei Tafeln bestehende
erste Unterserie. Mit der dritten Tafel des Diagnosehandbuchs beginnt dann der zweite, mit iiber 1000 Eintragen auf 12 Tafeln umfangreichste Teil des Diagnosehandbuchs, der sich schon eher mit modernen westlichen
Vorstellungen von Diagnostik in Einklang bringen lafit. In dieser Unter
serie mit dem Titel ?Wenn du dich dem Kranken naherst" werden die
253
12 5: SA.GIG 1/1-2 (TDP 2/1-2; A. R. George, in: Revue Assyriologique 85, 1991, 142/
1-2); 6: SA.GIG 1/29 (A. R. George, in: Revue Assyriologique 85, 1991, 144/29); 7: SA.GIG 1/50 (TDP 2/6, A. R. George, in: Revue Assyriologique 85, 1991, 144/50).
13 Zur babylonischen Ausdeutung solcher Beobachtungen siehe A. R. George, Babylonian Texts from the Folios of Sidney Smith. Part Two: Prognostic and Diagnostic Omens, Tab
let I, in: Revue Assyriologique 85, 1991, 137-163.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
Symptome am Korper des Patienten aufgelistet und einer Diagnose und/
oder Prognose zugeordnet. Die Eintrage sind streng systematisch ?vom
Kopf zum Fufi" angeordnet und zeigen damit, dafi das diagnostische Ord
nungsprinzip a capite ad calcem nicht erst von den Griechen verwendet
wurde. Als Beispiele mogen dienen:
8. Wenn seine rechte Schlafe ihn schmerzt und sein rechtes Auge ein Pterygium bildet
(wdrtl.: einen Schatten baut): Hand des Sulpaea (der Stern Jupiter), es wird gelost werden, und er wird gesunden.14
9. Wenn sein Bauch brennend heifi ist, seine Zehen dagegen aber ganz kalt: Drei Tage, vier Tage wird es anhalten, aber er wird gesunden, alternativ: er wird sterben.
10. Wenn sein Oberschenkel ihn von seinem Hiiftknochen bis zu seinem Knochel schmerzt, er aber aufsteht und umherlaufen kann: maskadu ist ihr (= der Krank
heit) Name. 11. Wenn seine Fiifie krampfartig zusammengezogen sind und er sie nicht mehr aus
strecken kann, aber sein Verstand nicht gepackt ist: Er wird sterben.15
Jeweils eine Tafel befafit sich mit Symptomen an einem Korperteil. Nach
einander werden so die Schadeldecke, die Schlafen, die Augen, die Nase, die Zunge, die Ohren und das Gesicht und schliefilich der Nacken und die Arme, die Hande, die Brust, der Bauchbereich und, in der letzten Tafel
dieses Abschnitts, der ganze Bereich abwarts der Huften abgehandelt. Die
Tatsache, dafi sieben Tafeln dem Kopf und nur fiinf dem restlichen Korper gewidmet sind, zeigt die Bedeutung, die den am Kopf gewonnenen Sym
ptombeobachtungen zukommt. Bei der Abhandlung der Korperteile a ca
pite ad calcem wird nur der mannliche Korper beschrieben. Der weibliche
Korper war, soweit bekannt, nicht Gegenstand einer systematischen Sym
ptomauflistung. Die anatomischen Kenntnisse der Babylonier waren, was
die aufieren Teile des menschlichen Korpers betrifft, ausgezeichnet. Ob
wohl die in Babylonien weit verbreitete Opferschau mit ihrer detaillierten
Beobachtung von tierischen Organen, vor allem des Schafes, zu einem ho
hen Kenntnisstand der inneren Anatomie von Tieren gefiihrt hatte, blieb
die Kenntnis der inneren Anatomie des Menschen jedoch sehr gering.
Das dritte Kapitel des Diagnosehandbuchs, mit elf Tafeln fast ebenso um
fangreich wie das zweite, behandelte entsprechend seinem Titel ?Wenn er
einen Tag krank ist" vor allem Zeitbeziige, also den Krankheitsverlauf, da
neben aber auch alle andern Aspekte, die den ganzen Korper des Kranken
in Mitleidenschaft zogen und daher nicht im vorherigen Kapitel abgehan delt wurden. So wird zuerst die bisherige Lange der Krankheit, von einem
Tag bis zu mehreren Monaten, berucksichtigt. Bevor dann der Erkran
kungszeitpunkt (morgens, mittags, abends) folgt, werden noch geriatri
14 Zum Symptom Pterygium vergleiche R. L. Miller, Nouvelles Assyriologiques Breves et
Utilitaires, Paris 1989, Nr. 10. 15 8: SA.GIG 4/28 (TDP 36/28); 9: SA.GIG 13/6061 (TDP 116/2-3); 10: SA.GIG 33/99
(BAD 357, 363); 11: SA.GIG 14/216' (TDP 142/11'). 254
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
255
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
sche Beschwerden eingeschoben, also das hohe Alter des Patienten beriick
sichtigt. Schliefilich werden Symptome beschrieben, die am ganzen Korper
auftreten, wobei es sich vor allem um Temperaturbeobachtungen handelt.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit Betrachtungen zur Diat des Kranken.
Das nachste Kapitel des Diagnosehandbuchs beschaftigt sich ausschliefilich
mit der Epilepsie. Neben den entsprechenden Symptombeobachtungen
(Krampfe, Anfalle, Speichelflufi, etc.) wird hier auch, nach einer neuge fundenen Tafel, das Alter des Kranken beim ersten Auftreten der Epilepsie
berucksichtigt (die genannten Altersstufen sind bei Geburt, mit 3, 7, 10, 20, 30 und 50 Jahren). In ethischer Hinsicht ist besonders interessant, dafi
Neugeborene, die an schweren Epilepsieformen litten, nicht behandelt, sondern getotet werden sollten, wahrend bei alteren Kindern eine Behand
lung versucht wurde. Das funfte Kapitel ist schweren Fiebererkrankungen
gewidmet, aber leider noch zu wenig bekannt, um es hier genauer zu eror
tern.16 Das letzte Kapitel schliefilich ist gemafi seinem Titel ?Wenn eine ge
barfreudige Frau schwanger ist" hauptsachlich geburtshilflichen und gyna
kologischen Fragen gewidmet. Die erste Tafel dieses Kapitels beschaftigt sich mit schwangeren Frauen, die aber nicht krank sind. In dieser Tafel
geht es darum, aus normalen Schwangerschaftssymptomen, etwa der Ver
anderung der Brustwarze, auf die Anzahl, das Geschlecht und den zukiinf
tigen sozialen Status der ungeborenen Kinder zu schliefien. Dann folgen
Symptombeobachtungen bei tatsachlich erkrankten schwangeren Frauen, wozu unter anderem auch eine Inspektion des abgehenden Fruchtwassers
gehorte. Die allerletzte, 40. Tafel des Diagnosehandbuchs behandelt
schliefilich noch die Padiatrie - genauer: Symptome bei Sauglingen; hier wird vor allem das Saugen der Muttermilch thematisiert.
Die Untersuchung des Patienten
Dieser stringente Aufbau des Diagnosehandbuchs und weitere Angaben in
diagnostischen und auch therapeutischen Texten erlauben es uns, eine de
taillierte Vorstellung der Untersuchung zum Zweck der Diagnosestellung zu gewinnen. Wie schon aus dem Titel der ersten Unterserie ?Wenn der
Beschworer zum Haus des Kranken geht" ersichtlich wird, machten die
babylonischen Heilkundigen vornehmlich Hausbesuche. Uber etwaiges
Vorsprechen von Kranken im Hause des Beschworers ist uns nichts be
kannt, jedoch wissen wir, dafi an den Tempeln der Heilgottin Gula, vor al
lem in der Stadt Isin, in der sie in Babylonien hauptsachlich verehrt wur
16 Die Problematik der inhaldichen Beschreibung dieses Kapitels liegt vor allem in der Tatsa
che, daft von den funf dem Kapitel zugehorigen Tafeln bisher nur zwei entdeckt wurden. Diese beiden Tafeln (die 31. und 33.) sind zu heterogen, um inhaltliche Gemeinsamkeiten herausarbeiten zu konnen.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nik P. Heefiel
256
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
1 cm
Abb. 1 und 2: Foto und Handkopie der Vorderseite einer babylonischen Tontafel aus dem
letzten Drittel des ersten Jahrtausends v. Chr. Der Text enthalt Beobachtungen zum Alter
des Kranken beim ersten Auftreten von Epilepsie (BM 56605, Vorderseite - publiziert mit
freundlicher Erlaubnis der Trustees des British Museum, London).
257
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
de, Arzte und Beschworer beschaftigt waren und Kranke dort Behandlung und wohl auch stationare Aufnahme erfahren konnten.17 Wie oben schon
ausgefiihrt, achtete der Beschworer auf seinem Weg zum Haus des Kran
ken genauestens auf etwaige ominose Vorzeichen, die ebenso wie die Sym
ptome Aufschlufi fiber den Krankheitsverursacher und den Krankheitsver
lauf geben konnten. Am Haus des Kranken angekommen, begann er die
Untersuchung des Patienten, der dazu sicherlich unbekleidet war. Doch
bevor der Beschworer sich ganz in diese systematische Beobachtung der
Korperteile vertiefte, hatte er sich, wie die erste Zeile der zweiten Unterse
rie zeigt, einer Reinigungszeremonie zu unterziehen:
12. Wenn du dich einem Kranken nahern willst, so nahere dich ihm keinesfalls, bis du eine Reinigungszeremonie an dir vollzogen haben wirst.18
Vermutlich geht eine solche hygienische Anweisung zur Vermeidung von
Ansteckung auf empirisch gewonnene Erkenntnisse zuruck. Nach seiner
Reinigung begann der Beschworer die Untersuchung mit Reaktionstests.
Dazu spritzte er dem Kranken Wasser ins Gesicht, schuttete es auf seinen
Kopf und flofite es ihm in den Mund ein, um aus der Reaktion des Kran ken Riickschlusse zu ziehen. Schliefilich wurde der Korper des Kranken von der Schadeldecke bis zu den Zehen inspiziert. Dabei wurden bei paarig vorhandenen Korperteilen immer erst der rechte, dann der linke und zu
letzt beide zusammen betrachtet. Der Beschworer begann seine Untersu
chung also mit der eigenen Wahmehmung der Symptomatik und verschaff
te sich so zuerst selbst ein Bild fiber die Krankheit, bevor er zur Eigen- und
Fremdanamnese iiberging.19 Hatte sich der Beschworer anhand der selbst
beobachteten Symptome iiber die Erkrankung informiert, begann er mit
den Erkundigungen beim Patienten und seinen Angehorigen zur Kranken
geschichte. Hierbei interessierten ihn vor allem Beginn und Dauer der Er
krankung sowie das Auftreten von Symptomen zu bestimmten Tages- und
Nachtzeiten und was der Patient zu sich genommen hatte.
Der Beschworer bediente sich bei der Untersuchung des Patienten wie alle
Heilkundigen der Antike und des Mittelalters ausschliefilich seiner Sinne.
Genaugenommen konnen wir allerdings nur vier Sinne bei der Untersu
chung mit Sicherheit belegen: Zur visuellen und auditiven Untersuchung kommen noch haptische und olfaktorische Untersuchungen; dies belegen
17 H. Avalos, Illness and Health Care in the Ancient Near East, Atlanta 1995, 196-216. 18SA.GIG 3/1 (BAD 20). 19 Natiirlich ist es schwierig, den Ablauf einer Untersuchung ausschliefilich anhand des Auf baus des Diagnosehandbuchs zu erschliefien. Die Wahrnehmung der Symptomatik durch den Beschworer und die Eigen- sowie Fremdanamnese sind teilweise sicher zeitgleich er
folgt. Dennoch spiegelt m.E. die Reihenfolge des Diagnosehandbuchs den konzeptionel len Ansatz der babylonischen Gelehrten wider. 258
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Phrasen wie ?wenn die von der Krankheit befallene Stelle beim Beriihren
hart wie Stein ist" oder ?wenn es aus den Ohren eines Patienten schlecht
riecht". Der Gebrauch des Geschmackssinns ist bisher noch nicht bei der
Diagnosestellung nachgewiesen. An Untersuchungsverfahren bediente
sich der Beschworer der Inspektion und der Palpation, die Auskultation
und die Perkussion sind dagegen nicht mit Sicherheit zu belegen. Bei der
Inspektion wurde der Patient im Liegen, Gehen und Stehen, von hinten
und vorne sowie von oben bis unten untersucht. Bei der Palpation wurden
anscheinend alle Korperteile abgetastet, um kein Symptom zu iibersehen.
Eine Messung nach Gewicht, Grofie und Umfang (Mensuration) ist in Ba
bylonien sicherlich nicht durchgefuhrt worden.
Die bei der Untersuchung beachteten Symptome sind so zahlreich, dafi
hier nur eine kleine Auswahl beispielhaft genannt werden kann. Grund
satzlich wurde bei den einzelnen Korperteilen zuerst auf Verfarbungen und
dann auf etwaige Entziindungen oder Anschwellungen geachtet. Weiterhin
wurde die Temperatur der Korperteile sorgfaltig registriert, auch wenn da
zu dem Untersuchenden nur sein subjektives Empfinden zur Verfiigung stand: So unterschied man die Temperatur in vier Kategorien ?kalt
- nicht
sehr heifi - heifi - brennend heifi". Uberaus zahlreich sind Symptome, die
an bestimmte Korperteile gebunden sind. Besonders das Auge wurde ge nauestens inspiziert, etwa ob die Pupille weit oder eng wird, die Augen verklebt sind oder gar Eiter aufweisen oder ob Aderchen im Auge geplatzt sind etc. Dieses ophthalmologische Interesse diirfte sicher auf die im Vor
deren Orient haufig auftretenden Augenleiden zuruckgehen.20
Neben den am Korper auftretenden Symptomen werden auch allgemeine Faktoren wie Laute und Gerausche, mehr psychologische Symptome wie
Depressionen, Aufregung, Schreckhaftigkeit, und naturlich auch die Efi
und Trinkgewohnheiten des Patienten bei der Untersuchung beriicksich
tigt.
Wahrend die Kenntnis der inneren Anatomie in Babylonien im allgemei nen sehr gering war, wurden bestimmte innere Korperteile bei der dia
gnostischen Untersuchung berucksichtigt. Hierzu gehoren vor allem die
blutfiihrenden Arterien und Venen, die Nerven sowie die Muskeln und
Sehnen, die jedoch nicht einzeln bezeichnet, sondern zusammenfassend
iefdnu genannt wurden. Dieser Begriff umschliefit alle diinnen, lang lichen Teile im Korper und ist am besten als ?Strange (des Korpers)" zu
259 20Vergleiche M. Stol, Old Babylonian Ophthalmology, in: M. Lebeau und P. Talon
(Hrsg.), Reflets des deux fleuves, Festschrift Finet, Akkadica Suppl. VI, Leuven 1989, 163-166.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heeflel
ubersetzen.21 In einigen Fallen gelingt es, den genauen Korperteil zu
identifizieren, der sich hinter dem Begriff ser'dnu verbirgt. So sind z. B.
die Bfutgefafie gemeint, wenn die blauliche Verfarbung der Strange oder ihre Grofie und Lage unter der Haut thematisiert werden. Dariiber hinaus
war aber auch der Pulsschlag bekannt und wurde haufig beobach
tet:22
13. Wenn die Adern (ser'dnu) seiner Fiifie stark hin- und hergehen, an seinen Handen
dagegen die Adern ganz still stehen: Von unten ist die Krankheit in ihn eingetreten, er wird Schmerzen haben, aber gesunden.23
Aus der Wahrnehmung des Zusammenhangs des Pulses an verschiedenen
Korperteilen wie den Handen und Fiifien darf sicher nicht geschlossen werden, dafi die Babylonier den Blutkreislauf gekannt haben.24 In einem
weiteren Eintrag des Diagnosehandbuchs konnte der Begriff ser'dnu den
Nerv bezeichnen:
14. Wenn seine Oberschenkelstrange ihn gleichzeitig schmerzen und er nicht aufstehen und umherlaufen kann: s<*gd//?-Krankheit.25
Nattirlich wurde nicht nur der Korper, sondern es wurden auch seine Aus
scheidungen genaustens untersucht. Die Uroskopie und die Koproskopie wurden dabei fur so wichtig erachtet, dafi diese Symptombeobachtungen in das zweite Kapitel des Diagnosehandbuchs
- die Auflistung der Korper teile - nach dem Penis bzw. dem After eingeschoben wurden, bevor mit
den nachsten Korperteilen fortgefahren wurde. Untersucht wurden diese
Ausscheidungen, ebenso wie der Speichel und auch das Blut, auf Farbe, Geruch und Konsistenz.
Hatte der Beschworer die Symptomatik erkannt, konnte er hieraus auf die
Krankheit und auch auf den Krankheitsverursacher zuriickschliefien und
die Diagnose sowie die Prognose stellen. Einige Symptombilder wurden
jedoch als so gefahrlich eingestuft, dafi vor einer Diagnose- und Prognose
stellung zuriickgeschreckt wurde:
21 Siehe St. M. Maul, Die babylonische Heilkunst. Medizinische Keilschrifttexte auf Ton tafeln, 34.
22 Zur Betrachtung des Pulses in Mesopotamien siehe A. L. Oppenheim, On the Observati on of the Pulse in Mesopotamian Medicine, in: Orientalia 31, 1962, 27-33.
23SA.GIG 14/260,-26r (TDP m/S^-M'). 24 Hier zeigt sich, wie vorsichtig man bei Ubersetzungen sein mufi. Aus einer sehr freien
Ubersetzung des agyptischen medizinischen Papyrus Ebers wurde lange Jahre geschlos sen, dafi die Agypter den Blutkreislauf entdeckt hatten. Mittlerweile ist klar, dafi dies nicht der Fall ist und das Verdienst dieser Entdeckung allein William Harvey gebuhrt. 25 SA.GIG 33/98 (BAD 357, 363). A. L. Oppenheim, On the Observation of the Pulse in Mesopotamian Medicine, 32 Anm. 2 hat diese Textstelle als Beleg fur die Kenntnis des Ischiasnervs gedeutet. t !60
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
15. Wenn er sechs Tage krank ist und sich am siebten Tag auf dem Weg der Besserung befindet, er am achten Tag wieder krank wird, aber am neunten Tage gesundet, am zehnten wiederum erkrankt und dann am elf ten Tag gesund erscheint: Seine Krank heit ist in ein gefahrliches Stadium getreten, der Beschworer soil fur seine Genesung keine Diagnose (oder Prognose) abgeben.26
Naturlich konnte die Symptomatik einer Krankheit anderen so ahnlich
sein, dafi eine Differentialdiagnose vonnoten war, wie der folgende Eintrag
zeigt:
16. Wenn er wahrend seiner Krankheit seine Augen nicht hebt, aus seinen Augen, sei ner Nase, seinem Mund, seinen Ohren und seinem Penis gleichzeitig Blut austritt: Hand der Plejaden, (wenn es aber) am 31. Tag (seiner Krankheit geschieht): Hand (des Sternbildes) der Zwillinge.27
Reaktionstests wurden nicht nur am Beginn der Untersuchung durchge fuhrt, sondern vereinzelt auch erst nach der Diagnosestellung, um zu einer
genauen Prognose zu gelangen. So spritzte man etwa dem Kranken Wasser
ins Gesicht, um zu beobachten, ob er darauf reagierte, was als positives Zeichen gedeutet wurde; eine fehlende Reaktion wurde als Hinweis ver
standen, dafi der Kranke wohl nicht uberleben werde.
Einmal diagnostizierte Krankheiten konnten sich auch verandern. Vor al
lem bei der Epilepsie wurde das Umschlagen einer Krankheitsform in eine
andere beobachtet und wiederum prognostisch ausgedeutet.
Weiterhin finden sich im Diagnosehandbuch hin und wieder auch Behand
lungsanweisungen. Diese zielen jedoch nicht darauf, die Krankheit direkt zu heilen, sondern zu vermeiden, dafi ein Patient langer als den vorherbe stimmten Zeitraum krank bleibt. Ein Beispiel:
17. Wenn (der Kranke) infolge zuviel Sonneneinstrahlung iiberhitzt ist und ganz dun kel wird und sie (die Hitze) ihm Krampfe? bereitet? und er brennend heifies Fieber bekommt: Dieser Mann wird 14 Tage krank sein. Um seine Krankheit nicht langer dauern zu lassen, wirfst du ihn (nach dieser Zeit) in kaltes Wasser, bis sein Bauchbe reich richtig zittert, lafit ihn dann stehen, und (erst) dann salbst du ihn wiederholt
mit warmem 01, dann wird er gesunden.28
War die Diagnose einmal gestellt, schritt der Arzt zur Behandlung des
Kranken. Tausende von therapeutischen Texten sind uns erhalten, die ver
schiedene Rezepturen und Behandlungsmethoden fur Krankheiten ver
zeichnen. Therapeutische Texte zitieren manchmal die Symptomatik, be
vor sie zur Rezeptur ubergehen; zumeist jedoch nennen sie nur die Krank
heit und listen dann mehrere Rezepte auf.
261
26SA.GIG 16/73'-74' (BAD 178, 184). 27SA.GIG 17/25-26 (BAD 197, 207). 28 SA.GIG 31/6-8 (BAD 342, 345).
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
Diagnostik und Therapeutik
Doch wie verbindet sich nun die Diagnostik, die in ihren getroffenen Dia
gnosen allem Anschein nach mehr an der sozial-religiosen Einordnung der
Erkrankung interessiert ist, mit einer Therapeutik, die auf Linderung von
Krankheitssymptomen abzielt? Zwischen den therapeutischen und den
diagnostischen Texten klafft nach unserem Verstandnis eine Liicke, die vor
allem in der Forschung der 1950er und 60er Jahre zu einer strikten Tren
nung dieser zusammengehorigen Zweige der Medizin gefiihrt hat. Die
Diagnostik sei demnach rein religios-magisch ausgerichtet und versuche, auf diesem Wege dem Patienten zu helfen, wahrend die Therapeutik einem
rational-empirischen Ansatz folge, der allein als Vorlaufer der griechischen - und damit letztlich der abendlandischen - Medizin zu gelten haben. Aus
geblendet wurde hierbei die Tatsache, dafi sich zum einen in den diagnosti schen Texten rationale und systematische Ansatze finden, die die griechi sche Medizin massiv beeinflussen sollten, und dafi zum anderen auch die
therapeutischen Texte nicht frei von nach unserem Verstandnis ?magi schen" EmfKissen sind. So enthalten beispielsweise Rezepte haufig magi sche Praktiken, die die Wirksamkeit eines Medikamentes erhohen sollten, und bei Behandlungsanweisungen wird das Rezitieren von Beschworungs formeln vorgeschrieben. Noch immer bestimmt das Bild der Dichdtomie
von Rationalitat und Magie die heutige Sichtweise der babylonischen Dia
gnostik und Therapeutik und verbunden damit auch der schon eingangs er
wahnten Berufsgruppen der Heilkundigen -
dsipu und asu: der Arzt {asu) heilt demnach den Patienten mit der rational-empirischen Therapeutik, wahrend der Beschworer (dsipu) mittels der Diagnostik ausschliefilich fur die magisch-religiose Verortung der Krankheit und das Wiederherstellen
des sozial-religiosen Aquilibriums verantwortlich ist. Pragnant wurde die se Sichtweise in den 1990er Jahren auf den Punkt gebracht: ?Der Beschwo
rer gebraucht nur die Formulierung ,Hande der Gotter', der Arzt benutzt
den Krankheitsnamen in seiner Diagnose".29
Diese Sichtweise kann mittlerweile endgiiltig durch eine jiingst publizierte Tontafel widerlegt werden.30 Der Text gehort als 33. Tafel zum Diagnose handbuch des Beschworers, ordnet den Krankheitssymptomen jedoch erstmals durchweg eine Krankheitsbezeichnung zu, anstelle einer Identifi
zierung des Krankheitsverursachers. Der Text folgt der Phraseologie ?Wenn der Befund der befallenen Stelle" - darauf folgt die Beschreibung der Symptomatik
- ?dann ist x der Name der Krankheit". Einige Beispiele:
29 M. Stol, Diagnosis and therapy in Babylonian medicine, in: Jaarbericht - Ex Oriente Lux
32, 1991-1992, 64. 30
Erstmals publiziert von E. von Weiher, Spatbabylonische Texte aus dem Planquadrat U 18, Ausgrabungen in Uruk-Warka, Endberichte 12, Mainz 1995, Nr. 152. Eine Neube
arbeitung findet sich bei N. P. HeeAel, Babylonisch-assyrische Diagnostik, 353-374. 262
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
18. Wenn der Befund der befallenen Stelle wie die Schuppenhaut eines Fisches ist, sein Leib rot wird und er den Befund eine festgesetzte Zeitspanne aufweist: risutu ist der Name der Krankheit.
19. Wenn der Befund der befallenen Stelle heifl wie Fieber und wafirig ist: bubu'tu ist ihr Name.
20. Wenn der Befund der befallenen Stelle heift wie Fieber, aber nicht wassrig ist und dafiir voll mit kleinen Blaschen ist: isitu ist ihr Name.
21. Wenn der Befund der befallenen Stelle rot ist, der Mensch andauernd heifi wird und sich iibergibt: sdmdnu ist ihr Name.
22. Wenn der Befund der befallenen Stelle hart wie Stein ist und sie sich entweder an seinem Hals oder in seiner Achselhohle oder in seiner Leiste befindet: Innerhalb von drei Tagen [wird er sterben, saddnu ist ihr] Name.31
Die Tatsache, dafi dieser Text zum Diagnosehandbuch gehort, macht deut
lich, dafi die Identifizierung der Krankheit keineswegs vom Arzt, sondern
vom Beschworer vorgenommen wurde und die Diagnostik damit sowohl
eine nach unserer Sichtweise magisch-religiose als auch rationale Seite auf
weist. Einzelne Zitate dieses Textes finden sich auch in therapeutischen Texten und zeigen damit die Verbindung von Diagnostik und Therapeutik auf.
Es war demnach die Aufgabe des Beschworers, sowohl die Krankheit
selbst als auch den Krankheitsverursacher zu identifizieren. Mit diesem
Wissen konnte er dann einerseits die Krankheit mit therapeutischen Mit
teln behandeln, andererseits aber auch die Ursache fur die Erkrankung, die
Verargerung einer Gottheit iiber den Patienten, mittels Reinigungsritualen und Beschworungen beseitigen und so zu einer Entfernung des von der
Gottheit durch die Beruhrung des Patienten in ihn gepflanzten Krankheits
herdes gelangen.
Die 33. Tafel des Diagnosehandbuchs zeigt aber noch mehr. Denn nach ei
nem Strich folgt am Ende der iiber 100 Eintrage, die Krankheiten benen
nen, eine zweispaltige Liste, in der den Krankheitsbezeichnungen jeweils die ?Hand" einer Gottheit zugeordnet ist. So wird die Krankheit sdmdnu
auf die ?Hand" der Heilgottin Gula zuriickgefuhrt oder die diksu-Krznk
heit auf die ?Hand" des Gotterkonigs Marduk. Hiermit besafi der Be
schworer ein Instrument, den Krankheitsverursacher sofort anhand der
identifizierten Krankheit zu ermitteln.
263
3118: SA.GIG 33/11 (BAD 353, 359); 19: SA.GIG 33/14 (BAD 353, 359); 20: SA.GIG 33/ 15 (BAD 354, 359); 21: SA.GIG 33/24 (BAD 354, 360); 22: SA.GIG 33/32 (BAD 355, 360). Beim letzten Eintrag (22) handelt es sich, wie F. Kocher (in: R. M. Boehmer et al: Uruk - Die Graber, Ausgrabungen in Uruk-Warka, Endberichte 10, Mainz 1995, 212) ange merkt hat, um die klassische Symptomatik der Beulenpest. Ob auch die anderen Sym
ptombeschreibungen der Krankheit saddnu zu dieser Diagnose passen, mufi in einer ge naueren Untersuchung geklart werden.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
Ein weiteres diagnostisches Hilfsmittel, das etwa in der Mitte des 1. Jt. v.
Chr. erstmals belegt ist und daher noch nicht in das altere Diagnosehand buch inkorporiert war, ist eine Krankheitsliste, welche die Krankheiten
den Organen, aus denen sie entstehen, zuordnet. So werden dem Herzen, dem Magen, der Lunge und den Nieren jeweils zwischen 6 und 12 Krank
heiten zugewiesen.32
Im einzelnen konnen wir die babylonischen Krankheiten mit Ausnahme
einiger weniger Falle kaum mit heutigen Krankheiten korrelieren. Fur die
Epilepsie hatten die Babylonier mindestens sechs verschiedene Bezeich
nungen, die jeweils ein bestimmtes Krankheitsbild beschreiben.33 Die lan
ge Jahre geltende Gleichsetzung der Krankheit sabarsubbu mit der Lepra kann heute nicht mehr aufrecht erhalten werden.34 Bezeichnend fur die Si
tuation ist, dafi die einzige wirklich als ?identifiziert" geltende Krankheit, der Ikterus, bekanntermafien heute nicht als Krankheit, sondern als Sym
ptom klassifiziert wird. Dieser mafiige Erfolg bei der Identifizierung heuti
ger Krankheiten unter den babylonischen Krankheitsbezeichnungen ist na
tiirlich einerseits auf die Schwierigkeit der kulturspezifischen Klassifikati on von Krankheiten zuriickzufiihren, andererseits aber auch auf die Un
moglichkeit, eine exakte retrospektive Diagnose anhand von antiken
Krankheitsbeschreibungen zu stellen. Man kann und sollte die Schwierig keiten bei der Identifizierung antiker Krankheitsbezeichnungen auch als
Chance begreifen, weniger nach Krankheitsidentifizierungen zu suchen als
vielmehr das medizinische System einer Kultur zu untersuchen, das auf ih ren ganz speziellen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und - vor allem -
religiosen Ansichten aufgebaut ist. So konnte es erfolgversprechender sein, die Kriterien zu bestimmen, nach denen die Babylonier Krankheiten
klassifizierten, anstatt zu versuchen, sie nach heutigen Klassifikationssche
mata zu identifizieren.
32 Siehe zu diesem Text die Bearbeitung und Deutung von F. Kocher, Spat-babylonische medizinische Texte aus Uruk, in: C. Habrich et al. (Hrsg.), Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart, Festschrift H. Goerke, Miinchen 1978, 17-34, bes. 23-25.
33 Zu den verschiedenen babylonischen Krankheitsbildern, die der Epilepsie zugeordnet werden, siehe M. Stol, Epilepsy in Babylonia, Cuneiform Monographs 2, Groningen 1993, S. 5-21. Zu den Schwierigkeiten, verschiedene Krankheitsbezeichnungen unter dem
Begriff Epilepsie zusammenzufassen, siehe die Diskussion von H. Avalos, Journal of Cu
neiform Studies 47, 1995, 119-121 und N. P. Heessel, Babylonisch-assyrische Diagno stik, S. 33 Anm. 56.
34 Siehe dazu F. Kocher, Saharsubbu - zur Frage nach der Lepra im alten Zweistromland, in: J. H. Wolf (Hrsg.), Aussatz -
Lepra - Hansen-Krankheit: Ein Menschheitsproblem
im Wandel, Wiirzburg 1986, 27-34 und zuletzt M. Stol, Leprosy. New Light from Greek and Babylonian Sources, in: Jaarbericht Ex Oriente Lux 30, 1987-88, 22-31. 264
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Diagnostik in Babylonien und Assyrien
Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung der babylonischen Diagnostik
In Babylonien bildete sich mit einer peinlich genauen Untersuchung des
Patienten und der wohldurchdachten Anordnung von Tausenden von ge wonnenen Symptombeobachtungen erstmals in der Menschheitsgeschichte eine systematische Diagnostik heraus, die auch auf die griechische Medizin
wirken sollte.35 Die Bedeutung des babylonischen Diagnosehandbuchs
liegt jedoch nicht allein in seinem systematischen Aufbau durch die Anord
nung von Symptomen a capite ad calcem. Dieses Anordnungsschema liegt
implizit auch schon dem in der Mitte des 2. Jt. v. Chr. niedergeschriebenen
agyptischen chirurgischen Papyrus Edwin Smith36 zugrunde und - noch
friiher, am Ende des 3. Jt. v. Chr. - der sumerischen Liste der Korperteile mit dem Namen ugu-mu ?Meine Schadeldecke". Entscheidend ist viel
mehr, dafi in einem fur diese Zeit vollig aufiergewohnlichen Text, in dem der Redakteur des Diagnosehandbuchs sich selbst vorstellt und seine Be
weggriinde fur die Redaktion darstellt, das Schema - akkadisch istu muhhi
adi sepe ?Von der Schadeldecke zu den Fiifien" - explizit als Anordnungs
schema genannt wird und der Autor durch die Offenlegung seiner Metho
dik seine redaktionelle Tatigkeit uberpriifbar macht. In diesem Text, der
einer Art Katalog zum Diagnosehandbuch angehangt ist, berichtet der Ge
lehrte Esagil-kin-apli von dem unbenutzbaren Zustand der diagnostischen Texte, die - so schreibt er - ?seit alters her niemals in einer Serie zusam
mengefafit waren", und wie er sich ?aufgrund von widerspruchhchen Tra
ditionen, fur die keine Textduplikate verfugbar waren", genotigt fand, eine
Neuedition zu erstellen. Dann nennt er seine zahlreichen Titel und be
schreibt seine Stellung als der Gelehrte seiner Zeit. Schliefilich berichtet er:
(Daher habe ich) die Neuedition des Diagnosehandbuchs geschaffen, istu mul&i adi se
pe ?Von der Schadeldecke zu den Fiifien", und es fur die Wissenschaft etabliert. Sei vor
sichtig! Pafi auf! Sei nicht nachlassig in deiner Bildung! Wer kein Wissen erwirbt, der soli die Eintrage des Diagnosehandbuchs nicht lesen. Die Serie sakikku (das Diagnose handbuch) betrifft alle Krankheiten und jede Form von Depression ... Moge der Be schworer, der die Entscheidungen fallt, der iiber das Leben der Menschen wacht, der die Serie sakikku ganzlich kennt, den Patienten untersuchen und die Texte uberpriifen, moge er alles griindlich erwagen und erst dann seine Diagnose ... treffen!
265
35 Vergleiche hierzu R. Labat, Traite akkadien de diagnostics et pronostics medicaux, S.
XXXV-XLV und J. Filliozat, Pronostics medicaux akkadiens, grecs et indiens, in: Jour nal Asiatique 240, 1952, 299-321. 36 Der Papyrus wurde am Beginn des Neuen Reiches niedergeschrieben, der Text soil aber
aufgrund von altagyptischen Sprachformen um die Mitte des 3. Jt. v. Chr. entstanden sein, siehe dazu W. Westendorf, Handbuch der altagyptischen Medizin, Bd. 1, Leiden 1999, 16. Fur die Abfolge der einzelnen Rezepte des Papyrus ist aber der Zeitpunkt der Nieder schrift entscheidend, da nicht ausgeschlossen werden kann, daft vorhandene altere Rezepte bei der Anfertigung des Papyrus in eine neue Reihenfolge gestellt wurden.
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Nils P. Heefiel
In diesen Ermahnungen, zu lernen und die Texte zu studieren, die Sym
ptome genau zu beobachten und erst nach griindlicher Erwagung die Dia
gnose zu treffen, darf man vielleicht den Beginn einer Diagnostik sehen, die in ihrer Systematik und Methodik schon wissenschaftlich genannt zu
werden verdient.
Anschrift des Verfassers: Dr. Nils P. Heefiel Seminar fur Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients
Assyriologie Hauptstr. 126 D-69117 Heidelberg
266
This content downloaded from 193.54.110.35 on Wed, 4 Jun 2014 11:07:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions