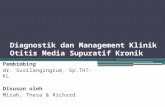Mykologische Diagnostik - Normamed
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Mykologische Diagnostik - Normamed
Der Autor
Prof. Dr. med. Dr. med.vet.h.c.Hans Rieth, Hamburg
Geboren am 11.12.1914 in Limburg/Lahn. Studium der Medizinund Naturwissenschaften in Würzburg, Prag und Hamburg.1939-1941 Assistent am Tropeninstitut Hamburg. 1951 Ein-richtung eines Labors an der Universitäts-Hautklinik unterProf. Kimmig in Hamburg. 1972 Habilitation für medizinischeMykologie in Hamburg. Ernennung zum Ehrendoktor der Tier-ärztlichen Hochschule 1974 in Hannover. MykologischeSeminare auf nationaler und internationaler Ebene, über600 Veröffentlichungen, mykologische Lehrfilme. Stifter derEmst-Rodenwaldt-Medaille, des Gustav-Riehl-Preises und desRudolf-Lieske-Preises. Hauptschriftleiter von Notabene mediciund Pilzdialog. Arbeitsgebiete: Humane, animale und Geo-Mykologie, Antimykotika.
Vorwort
Das Interesse an mykologischer Labordiagnostik wächst rapide. Ärztein Klinik und Praxis erwarten in zunehmendem Maße vom PilzlaborHilfestellung bei der Sicherung der Diagnose, vor allem bei der diffe-rentialdiagnostischen Klärung.
Das Wort „Phänokopie" hat in die Diskussion Eingang gefunden. Esbesagt: Mykosen ahmen andere Krankheiten nach und werden - um-gekehrt — von anderen Krankheiten nachgeahmt.
Das A und O der richtigen Diagnose schließt die geglückte Isolierungund einwandfreie Identifizierung der Erreger mit ein. MykologischeGrundkenntnisse sind hierbei eine unabdingbare Voraussetzung.
Der Nachholbedarf auf diesem noch unterentwickelten Gebiet ist im-mens, seitdem klar geworden ist, daß die medizinische Mykologie keinealleinige Domäne der Dermatologie sein kann, sondern nach und nachweitere Fachgebiete erfaßt.
Wer sich mit der Pilzdiagnostik im Labor befaßt, wird schon nach kurzerEinarbeitungszeit die Faszination spüren, die von den Pilzen ausgeht.
Die vorliegende Schrift will mithelfen, die ersten Schritte zu bewältigen,und Anregungen geben, um mit vertretbarem Aufwand an Zeit undMaterial exakte Befunde zu erstellen, die es dem Arzt ermöglichen, sichfür oder gegen eine antimykotische Therapie zu entscheiden.
Hans Rieth
3
Inhaltsverzeichnis
Vorwort - 3Einleitung 6
Allgemeiner Teil 7
Berechtigung zur Durchführung mykologischer Untersuchungen 9Keine Meldepflicht für Mykosen 9Einrichtung und Ausstattung eines Pilzlabors 9Materialgewinnung 11Einsendung von Untersuchungsmaterial 19Mikroskopische Untersuchung von Frischpräparaten 20Pilzkulturen 25— Nährböden 26— Beimpfung 28— Bebrütung 28— Mikroskopische Untersuchung der Kultur 28— Mikrokultur 29— Interpretation der kulturellen Befunde 29— Abtötung und unschädliche Beseitigung von Pilzkulturen 29Glossarium 30
Spezieller Teil 35
Dermatophyten 36— Trichophyton 36— Mikrosporum 36— Epidermophyton 37— Keratinomyces 37Hefen 38— Ascomycotina ; 39— Basidiomycotina 38— Deuteromycotina 39— Hefedifferenzierung 40Schimmelpilze 42
Bildteil 43
Dermatophyten 45— Trichophyton rubrum 45— Trichophyton mentagrophytes 46— Trichophyton tonsurans 47— Trichophyton schoenleinii 48— Trichophyton verrucosum 48— Trichophyton concentricum 48— Trichophyton violaceum ——-— 49— Trichophyton soudanense —-— 50
515151525354545556575757585859
606061626263646465
6666666667676768686969707071717272727374
75
— Trichophyton gallinae— Trichophyton megninii— Trichophyton equinum— Trichophyton terrestre— Keratinomyces (T.)ajelloi —— Mikrosporum audouinii— Mikrosporum rivalieri— Mikrosporum canis— Mikrosporum gypseum— Mikrosporum fulvum— Mikrosporum cookei— Mikrosporum ferrugineum —— Mikrosporum nanum— Mikrosporum distortum— Epidermophytonfloccosum-
Hefen- Candidaalbicans —- Candida stellatoidea- Candida tropicalis —- Candida parapsilosis~ Cryptococcus neoformans- Torulopsis (C.) glabrata- Torulopsis (C.) candida (famata)~ Trichosporon cutaneum
Schimmelpilze —~ Geotrichumcandidum~ Penicilliumcamemberti~ Penicillium roqueforti~ Penicillium expansum- Penicillium notatum~ Penicillium griseofulvum~ Scopulariopsisbrevicaulis- Verticillium cinnabarinum~ Cephalosporium acremonium -~ Chrysosporium pannorum~ Aspergillusfumigatus~ Aspergillus niger~ Sporothrixschenckii- Fonsecaea pedrosoi —- Alternaria alternata~ Cladosporium herbarum- Mucorspecies- Rhizopusnigricans •~ Piedraia hortae ~
Produktinformation
Einleitung
Die augenblickliche Situation ist dadurchgekennzeichnet, daß allenthalben Bestre-bungen im Gang sind, die Diagnose einerdurch Pilze verursachten Erkrankung nichtdem „klinischen Blick" allein zu überlassen,sondern durch wissenschaftliche Laborme-thoden zu sichern oder überhaupt erst zu er-stellen.
Bei der Durchforstung der mykologischenLiteratur stellen sich zwangsläufig siebenFragen:
1. Was ist wirklich neu?
2. Was davon ist tatsächlich praxisrelevant?
3. Was ist inzwischen obsolet und sollte ausder routinemäßigen Weiterverbreitungherausgenommen werden?
4. Was ist zu Unrecht in Vergessenheit ge-raten und muß mit Nachdruck erneut ge-lehrt werden?
5. Was wird besonders häufig falsch ge-macht?
6. Welche Verbesserungen sind in naher Zu-kunft für Klinik und Praxis zu erwartenoder zu verlangen?
7. Wie steht es mit der Kosten-Nutzen-Rela-tion bei herkömmlichen Gepflogenheitenund bei Verbesserungsvorschlägen?
Die Antworten auf diese sieben und weiteresich nach und nach ergebende Fragen sindzwar ausführlich, aber dennoch so knappformuliert, daß kein mykologisches Lehr-buch dadurch überflüssig wird.Dies gilt nicht nur für die sichere Erkennungder Dermatophyten, sondern erst recht fürdie Hefediagnostik, die sich — im Gegen-satz zur Dermatophytendiagnostik — aufAssimilation, Gärung und andere physiolo-gische Kriterien stützt, aber offenbar selbstnoch in einem wissenschaftlichen Gärungs-prozeß steckt und mitunter einen unausge-gorenen Eindruck vermittelt.Die in der medizinischen Mykologie bedeut-samen Schimmelpilze richtig zu diagnosti-zieren wird zunehmend wichtiger, da diesePilze in mancher Hinsicht das Immunsystemschwächen oder Abwehrschwächen nutzen,um dem Menschen in Form von Mykosen,Mykoallergosen oder Mykotoxikosen zuschaden.Dem entgegenzuwirken ist das Ziel der my-kologischen Fortbildung. Ziel der folgendenAusführungen ist es, möglichst viele Ärzte,aber auch Biologen und M.T.A.'s für denEinstieg in die medizinische Mykologie zugewinnen.Zum Thema Kosten-Nutzen-Relation ist fest-zustellen, daß verkannte Mykosen infolgeder ausbleibenden Heilung hohe Kosten beisehr geringem Nutzen verursachen. Der ver-gleichsweise geringe Aufwand für die ex-akte mykologische Diagnostik dagegen hilftArzneikosten sparen.
Motto:Sparen an Gesundheitskosten kann auch die Gesundheit kosten.
Berechtigung zur Durchführungmykologischer UntersuchungenAlle Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sind zumArbeiten mit Krankheitserregern berechtigt,soweit sie sich auf diagnostische oder thera-peutische Maßnahmen für die eigene Pra-xis beschränken.
Wer eine solche Tätigkeit aufnehmen will,hat dies der zuständigen Behörde unter An-gabe der Art und des Umfanges der beab-sichtigten Arbeiten mitzuteilen.
Darüber hinausgehende Arbeiten und derVerkehr mit Krankheitserregern sind ge-regelt in den §§ 19 und 20 des Gesetzes zurVerhütung und Bekämpfung übertragbarerKrankheiten beim Menschen (Bundes-Seu-chengesetz) vom 18. Juli 1961 (BGBI. I S.1012,ber. S. 1300) in der Fassung der Bekannt-machung vom 18. Dezember 1979 (BGBI.I S. 2262, ber. 1980 I S. 151), geändert durchGesetz vom 18. August 1980 (BGBI. IS. 1469,ber. S. 2218).
Keine Meldepflicht für MykosenDie Meldepflicht für Mikrosporie wurde am18. Dezember 1979 aufgehoben.Eine Meldepflicht für Favus gab es weder indem Bundes-Seuchengesetz von 1961 nochin der Bekanntmachung vom 1979 und auchnicht in der Änderung vom 18. August 1980.Der Favus - dies sei ausdrücklich hervor-gehoben - ist nicht meldepflichtig.Anderslautende Behauptungen beruhen aufIrrtum.
Einrichtung und Ausstattungeines PilzlaborsIn jedem mikrobiologischen Labor läßt sichohne allzu großen Aufwand ein mykologi-scher Arbeitsplatz einrichten.Das gleiche gilt auch für niedergelasseneÄrzte verschiedener Fachrichtungen.Zweckmäßig ist ein Labortisch mit Strom-und Gasanschluß. Tischplatte und Fußbo-den müssen abwaschbar und desinfizierbarsein. Vorzusehen ist eine Gelegenheit zumReinigen und Desinfizieren der Hände.
Pilzfressende Milben
Im Hausstaub befinden sich sehr häufig Mil-ben verschiedener Gattungen, z.B.Tyropha-gus (Abb. 1) und Tarsonemus, die durch Pilz-gerüche angelockt werden. Sie wandern inRöhrchen und Petrischalen ein, fressen diePilzrasen ab, hinterlassen Unmengen vonMilbenkot und verimpfen auf ihre Weise,was sie so rumschleppen, meist Bakterien,aber auch Hefezellen und Konidien vonSchimmelpilzen. Von Milben befallene Plat-ten sehen nach einiger Zeit sehr charakte-ristisch aus (Abb. 2).Man muß ständig auf der Hut sein, um diePilzkulturen vor Milbenfraß zu schützen. Ver-dächtig aussehende, am Rande angefres-
Abb. 1 : Pilzfressende Milbe - Tyrophagus lintneri -
mit je vier Vorder- und Hinterbeinen und spitzen Freß-
werkzeugen
Abb. 2: Agarplatte mit charakteristischen Milben-
spuren und von Milben verimpften Bakterien und
Pilzen
9
sene Kolonien sucht man bei schwacherVer-größerung ab, um ruhende oder wanderndeMilben zu entdecken.Insektenspray, der auch gegen Milben wirkt,muß stets vorrätig und griffbereit sein.
Luftturbulenzen vermeiden
Um weitgehend keimarm zu arbeiten, ist essehr wichtig, eine Verunreinigung des Unter-suchungsmaterials und der Nährbödendurch Anflugkeime sorgfältig zu vermeiden.Das öffnen von Fenstern und Türen ist aufdas unbedingt nötige Maß zu beschränken.Ventilatoren gehören nicht ins Pilzlabor.
Schränke und Regale
Schränke — am besten mit Glastüren — undRegale werden für die laufend zu beobach-tenden Pilzkulturen in einer Anzahl benötigt,die von der Menge des zu untersuchendenMaterials abhängt.
Dabei ist folgendes zu beachten: Was beiBakterien Stunden und Tage dauert, dasdauert bei Pilzen Wochen und Monate. Fürdie Primärkulturen mit dem Patientenmate-rial und für die Identifizierungskulturen sindalso ausreichende Stellmöglichkeiten erfor-derlich.
Mykothek
In jedem Pilzlabor wird eine Pilzsammlung— eine Mykothek — benötigt, um ständigVergleichsmöglichkeiten bei der Identifizie-rung zur Verfügung zu haben.
Geräte
Was an Geräten gebraucht wird, ist derTab. 1 zu entnehmen.
Tab. 1
Geräte - Wattetupfer, steril— Impfhaken — Tesafilm— Impfösen — Abfallbehälter— ösenhalter — Bunsenbrenner oder— Ablage für Ösen- Spiritusbrenner
halter (am besten - Brutschrank oderangebohrte Holz- Bruttopf oder Heiß-blöckchen) luftschrank mit Ein-
— evtl. auch sterile Stellmöglichkeit aufPlastikösen 37°C
— Präpariernadeln — Sterilisiermöglichkeit— Skalpelle 2 Stunden bei 180°C— scharfe Löffel — Schrank unbeheizt,— Pinzetten zum Anzüchten bei— Epilationspinzette Raumtemperatur— Scheren — Regale— Meßpipetten — Mikroskop
(10 ml, 5 ml, 1ml) -Objektträger— Spatel — Deckgläschen— Glasstäbe - Färbebank— Reagenzgläser — Kurzzeitmesser— Petrischalen - evtl. Dampftopf— Erlenmeyer-Kölbchen - Autoklav
(200 ml, 100 ml) - Fotoeinrichtung
Reagenzien und Nährböden
Diegebräuchlichsten Reagenzien und Nähr-böden sind in Tab. 2 aufgeführt.
Tab. 2
Reagenzien- Desinfektionslösung,z.B.ca. 10%igeFormalin-
lösung- Isopropanol, 70%- Kalilauge 10%, 15% oder 20%- Physiologische Kochsalzlösung, steril- Ringer-Lösung, steril- TMOH-Lösung, ca. 10%- TEOH-Lösung, ca. 20%- Immersionslösung- Insektenspray
Färbereagenzien- GRAM's Karbolgentianaviolettlösung für die
Mikroskopie- Lactophenolblaulösung zur Pilzfärbung- LÖFFLER's Methylenblaulösung für die Mikro-
skopie- Nigrosinlösung- Perjodsäure krist. zur Analyse- SCHIFF's Reagenz für die Mikroskopie
Nährböden- Candida-Elektivagarnach NICKERSON- Dermatophyten-Selektivagar (DTM)
nach TAPLIN- Pilz-Agar nach KIMMIG- Reisextrakt-Agar- SABOURAUD-2% Glucose-Agar- SABOURAUD-3% Pepton-Agar- Selektivagar für pathogene Pilze
10
MaterialgewinnungDie Entnahme von Untersuchungsmaterialfür mykologische Untersuchungen ist eineganz besonders wichtige Tätigkeit. Sie un-terliegt in vielen Fällen anderen Vorschriftenals in der Bakteriologie.
Es geht vor allem darum, alle störenden An-flugkeime, seien es Bakterien oder aus derUmgebung stammende Pilzsporen und Pilz-fäden, gewissenhaft und sorgfältig zu be-seitigen, bevor man mit der Materialab-nahme beginnt.
Wo der Zustand des Krankheitsherdes es zu-läßt, werden alle Auflagerungen, alle Kru-sten und grobe Schuppen mit Pinzette, Skal-pell oder scharfem Löffel entfernt, sodannwird die Entnahmestelle mit 70%igem Alko-hol unter Verwendung eines Mulltupfers ge-reinigt. Durch den Alkohol sollen oberfläch-lich liegende Keime, insbesondere Bakte-rien, abgetötet werden.
Einzelheiten sind den Tab. 3 bis 8 zu ent-nehmen.
Krankheitsbilder mit Verdacht auf Hautmy-kose sind in den Abb. 3-15 dargestellt. Esmuß immer wieder betont werden, daßreichlich Material zu entnehmen ist, stets mitsterilen Instrumenten (nicht mit „abflambier-ten", da mit Abflammen keine Sterilität zuerzielen ist).
Abb. 3: Mykoseverdächtige Herde an Wange undKieferwinkel, randbetont, leicht schuppend
Abb. 4: Verdacht auf Fußmykose. Die Materialgewinnungoder scharfen Löffels. Kratzrichtung zum gesunden Gewebe hin
11
seitlich vom kleinen Zeh mit Hilfe eines Skalpellserfolgt
Abb. 5: Handmykose durch Mikrosporum gypseum
Abb. 6: Unterarmmykose durch T.verrucosum
Tab. 3: Vorgehen bei Verdacht auf oberflächlicheHautmykose
- Herdrand mit 70%igem Alkohol und Mull-tupfer kräftig reinigen, grobe Auflagerun-gen, Krusten, Hautlamellen entfernen undverwerfen
- einige Minuten warten, bis Alkohol ver-dunstet ist
- mit Skalpell oder scharfem Löffel in Rich-tung auf das gesunde Gewebe 30-50 kleineHautschüppchen abkratzen und in sterilemGefäß, am besten in einer sterilen Petrischale
'auffangen
- 10-15 kleine Schüppchen in 15%iger Kali-lauge auf einem Objektträger nach Auf-legen eines Deckglases und vorsichtigemErwärmen etwa 30 Minuten weichen lassen(am besten in einer feuchten Kammer), danndurch sanften Druck auf das Deckglas wei-ter aufhellen; überschüssige Kalilauge mitFließpapier absaugen, etwas destl. Wasserseitlich am Deckglasrand zufließen lassen,damit die Kalilauge nicht auskristallisiert
- zunächst bei schwacher Vergrößerung (Ob-jektiv lOfach) auf Pilzfäden absuchen, an-schließend mit Objektiv 25-40fach kontrol-lieren, ob es sicher Pilzelemente sind
- für die Pilzkultur die restlichen Schüppchenauf Kimmig-Agar oder Sabouraud-2% Dex-trose-Agar verimpfen (mit mykologischemHaken) und 3 Wochen bei Zimmertemperaturauf Pilzwachstum beobachten
- Pilze identifizieren, eventuell nach Verimpfenauf Spezialnährböden
Abb. 7: Oberschenkelmykose durch E.floccosum
12
Erläuterung zu den Abbildungen 5-7
Vom Handrücken in Abb. 5 wurde Materialsowohl vom Rande des großen Herdes wieauch von der Blasendecke entnommen.
Die kokardenförmigen Herde am Unterarmin Abb. 6 waren sehr ergiebig. Entnommenwurden Schuppen und Haarstümpfe sowieEiter aus den Haarfollikeln.
Die Rundherde am Oberschenkel in Abb. 7wurden zunächst von den groben Schuppenbefreit, erst dann wurden vom Rande derHerde etwa 40 kleinste Schüppchen abge-kratzt.
Tab. 4: Vorgehen bei Verdacht auf tiefe Hautmykose
mit Haarbefall
- Verdächtigen Herd, soweit ohne Schmerzenmöglich, mit 70%igem Alkohol reinigen, vonKrusten, groben Schuppen befreien, dadurchAnflugkeime reduzieren
- wenige Minuten warten, bis der Alkohol ver-
dunstet ist
- mit einer Epilationspinzette 20-30 Haarstümpfeherausziehen und in einem sterilen Gefäßauffangen
- 3 - 5 Haarstümpfe nur etwa 5 Minuten in15%iger Kalilauge zwischen Objektträger undDeckglas aufhellen lassen und zunächst mitObjektiv "lOfach, dann mit Objektiv 25-40fach auf Pilzfäden absuchen, insbesondereaber auch auf Pilzmanschette um den Haar-schaft, auf Sporenhaufen am Haar oder umdas Haar herum und auf Pilzfäden im Innerendes Haares
- die restlichen Haarstümpfe auf Kimmig-Agaroder Sabouraud-2% Dextrose-Agar verimp-fen, bei Zimmertemperatur bebrüten undwöchentlich auf Pilzwachstum kontrollieren.Bis zu 3 oder auch 4 Wochen beobachten
Abb. 8: Geschwulst am Hinterkopf mit Verdacht aufPilzinfektion. Zu entnehmen sind mit steriler Epila-tionspinzette vom Rande des Herdes etwa 20-30Haarstümpfe und ebensoviele kleinste Schüppchen
13
Abb. 10: Mikrosporieherd auf einem Kinderkopf. DieHaare sind abgebrochen. Der Herd sieht aus wie eine„abgemähte Wiese". Zu klären ist, ob Mikrosporumaudouinii, M.canis oder eine andere Art der Erregerist
Abb. 11: Der Herd aus Abb. 10 im Woodlicht fluores-zierend. Die grünlich fluoreszierenden Haarstümpfesind leicht zu erkennen; etwa 30-40 sind mit der Epi-lationspinzette zu entnehmen
Abb. 12: Verdacht auf narbigen Favusherd auf demKopf. Einige Inseln noch nicht befallener Haare sindstehengeblieben. Nicht diese Haare, sondern nurHaarstümpfe und Schuppen entnehmen!
Abb. 13: Verdacht auf „Perleche" an den Mundwin-keln eines älteren Mannes mit Diabetes. Zu untersu-chen ist, ob Pilze aus der Mundhöhle in die Haarfol-likel eingedrungen sind. Haarstümpfe entnehmen!
14
Abb. 14: Verdacht auf Pilzbefall der Haarfollikel an beiden Unterschenkeln emer Frau Zu entnehmen s.nd nachReinigung der verdächtigen Herde mit 70%igem Alkohol sowohl alle abkratzbaren klemen Schuppchen sow,ealle in den geröteten Follikeln kaum erkennbaren Haarstümpfe. Am besten „heraushebeln !
15
Nagelmykose vorliegt, die durch Antigenstreuung ein Mykid als allergische Reaktion verursacht
sind 40—50 kleinste Schüppchen mit Skalpell oder, ob eine vaginale oder intestinale Mykose oder eine
Abb. 15: Mykose oder Mykid am Unterarm. In erster Liniescharfem Löffel abzukratzen. Zusätzlich muß geklärt werden
Abb. 16: Verdacht auf Zehennagelmykose, insbesondere an dem einen Großzeh und den kleinen Zehen. Vor derMaterialentnahme bedarf es einer sorgfältigen Vorbereitung, um die unter der Nagelplatte sitzenden Pilze sicherzu erreichen. Die lebenden Pilzelemente befinden sich am Übergang vom kranken zum gesunden Gewebe
Abb. 17: Die mykoseverdächtigen Zehennägel sind für die Materialentnahme gründlich vorbereitet, d.h. allesichtbar kranken Teile der Nagelplatten sind entfernt. Jetzt wird mit 70%igem Alkohol weiter gereinigt. Erst dannwerden mit einem kleinen scharfen Löffel unter dem Nagelstumpf 40—50 kleinste Späne herausgekratzt
16
Tab. 5: Vorgehen bei Verdacht auf Nagelmykose
- Nagel mit 70%igem Isopropylalkohol undMulltupfer abreiben
- warten, bis der Alkohol verdunstet ist- mit Schere, Skalpell oder am besten mit einem
kleinen scharfen Löffel alle sichtbar erkranktenTeile der Nagelplatte entfernen und verwerfen;ein Teil des Nagelbettes muß freigelegt sein
- zwischen dem übriggebliebenen Teil der Na-gelplatte und dem Nagelbett mit dem scharfenLöffel oder mit einem Skalpell reichlich Horn-material abkratzen und in einem sterilen Ge-fäß auffangen
- mit sterilen Instrumenten das entnommene Ma-terial weitgehend zerkleinern
- Frischpräparat wie in Tab. 3 anlegen, jedochlänger erweichen lassen, etwa 1 Stunde; in einefeuchte Kammer legen, um Austrocknung zuverhindern
•*- vor dem Mikroskopieren vorsichtig auf dasDeckglas drücken und herausquellende Kali-lauge am Rande mit Fließpapier absaugen
- reichlich kleinste Teilchen auf Nährboden ver-impfen und etwa 3 Wochen bei Raumtempera-tur von 20-25°C beobachten, bei sehr lang-samem Wachstum auch noch länger
- Pilze zunächst nach D, H und S differenzieren,dann nach Gattung und Art
-wenn Schimmelpilze wachsen, immer darandenken, daß in der Tiefe des Nagels auch nochein Dermatophyt sitzen kann, der den Nagelbefallen hat, bevor der Schimmel hinzukam
Tab. 6: Vorgehen bei Verdacht auf Vaginalmykose
— Materialabnahme ohne vorherige Desinfek-tion; bei Ausfluß mittels Öse, aber auch direktvom Spekulum auf einen Objektträger bzw.Pilzagar bringen
- einige Tropfen Untersuchungsmaterial auf ei-nem Objektträger mit Deckglas abdecken undungefärbt bei mittelstarker Vergrößerung aufPilzfäden und Sproßzellen durchmustern
— zum Färben kann ein Tropfen gesättigter alko-holischer Methylenblaulösung dem Materialauf dem Objektträger zugesetzt werden. Fär-bedauer 30 Sekunden
- Pilzagar mit reichlich Material beimpfen undbei Zimmertemperatur bebrüten. Hefen sindmeist schon nach 2-3Tagen gewachsen, Schim-melpilze brauchen mitunter etwas länger. Der-matophyten verursachen keine vaginalen My-kosen
— von der Primärkultur ein wenig auf Reisextrakt-Agar sehr dünn in Schlangenlinien oder in ge-raden Linien ausstreichen, mit Deckglas ab-decken und - sehr wichtig! - bei Zimmertem-peratur 1-2 Tage bebrüten.Nicht bei 37°C bebrüten!
- Candida albicans erkennt man an den auf Reis-agar gebildeten typischen Chlamydosporen,die Differenzierung der anderen Hefen erfor-dert physiologische Untersuchungen, z.B. mit-tels Vergärung verschiedener Zucker und Assi-milation von Zuckern und organischem und an-organischem Stickstoff
Abb. 18: Grotesk zerstörter Großzehnagel. Bevorman Material entnimmt, muß zunächst die zerstörteNagelplatte weitgehend entfernt werden. Dann wirdmit Alkohol gereinigt und weiter mit sterilen Instru-menten gearbeitet
Abb. 19: Pilzfäden, runde und ovale Zellen im Vagi-nalsekret. Im Mikroskop ist nicht erkennbar, ob essich um lebende oder schon abgetötete Pilzelementehandelt, auch nicht, ob es Candida albicans ist oderBierhefe
17
Abb. 20: Soorbelag auf Zunge und Unterlippe mitsterilem Spatel oder mit sterilem Watteträger ab-streichen, reichlich Material entnehmen, Frischprä-parat anlegen und Nährboden sofort beimpfen
Mundsoor und Windeldermatitis
Mundsoor und mykotische Windeldermatitissind vermeidbar, wenn für „pilzfreie Ge-burtswege" gesorgt wird. Dies wird in derNeufassung der „Mutterschafts-Richtlinien"vom 10. Dezember 1985 ausdrücklich emp-fohlen.
Das Abwehrsystem der Säuglinge ist in denersten drei bis vier Lebensmonaten nochnicht imstande, den Organismus vor patho-genen Pilzen zu schützen.
Tab. 7: Vorgehen bei der Gewinnung von Sputum fürmykologische Untersuchungen
- Intensives Mundspülen mit fungizidem Mund-wasser
- Lösung sorgfältig ausspucken- den Vorgang des Mundspülens und Ausspuk-
kens wiederholen- durch Räuspern, Hauchen oder Hustenstöße
Sputum hochbringen- Sputum in einem sterilen Gefäß auffangen.
Spucken unter Mitwirkung von Zunge und Lip-pen vermeiden
Abb. 21: Verdacht auf mykotische Windeldermatitis. Nicht nur reichlich Hautschüppchen entnehmen, sondernauch Analabstrich und Harnröhrenabstrich vornehmen. Stets auch Mundhöhlenabstrich und Stuhlprobe auf Pilzeuntersuchen, bei Husten auch Sputum. Daran denken, daß die Herde von innen kommen können, über Lymph-und Blutbahn
18
Tab. 8: Vorgehen bei der Gewinnung von Urin fürmykologische Untersuchungen
- am besten Urin durch Punktion gewinnen- sonst Mittelstrahlurin in sterilem Gefäß auf-
fangen- Urin in einem sterilen Zentrifugenröhrchen zen-
trifugieren- Urin abgießen und verwerfen- die letzten zusammenlaufenden Tropfen direkt
auf Pilzagar auftropfen- bebrüten bei Temperaturen von 20-27°C oder
auch bei 37°C- sind verdächtige Kolonien gewachsen, dann
auf Reisextrakt-Agar und eventuell physiolo-gische Identifizierung
Hinweis für die Entnahme einer Stuhlprobe
Da Pilze im Darminhalt nicht gleichmäßigverteilt sind, sondern in Kolonien oder Ne-stern angesiedelt sein können, ist es zweck-mäßig, mit dem kleinen Löffel des Stuhlver-sandröhrchens an verschiedenen Stellen derStuhlportion jeweils sehr wenig Material zuentnehmen, insgesamt eine etwa haselnuß-große Menge, und diese ins Laborzugeben.Auch dort wird erst nach guter Durchmi-schung die mykologische Untersuchung vor-genommen.
Vermeidbare Fehler
~ Verzicht auf die Vorreinigung des Krank-heitsherdes
~ zu wenig Material entnehmen~ zu große Schuppen untersuchen oder ein-
senden~ ein Stück Nagel abschneiden, um es un-
tersuchen zu wollen oder einzusenden~ Hautherde mit einem Wattetupfer abstrei-
chen, um Material zu gewinnen
~ Sputum gewinnen,ohnevorherdieMund-
höhle von Speichel zu befreien- Urinsediment in unsterilen Gefäßen auf-
fangen- Stuhlproben entnehmen, die nicht ausrei-
chend gemischt sind- Haarbüschel ausreißen oder Haare ab-
schneiden, anstatt die Haarstümpfe zuentnehmen.
Einsendungvon UntersuchungsmaterialDas sorgfältig und korrekt entnommeneMaterial muß in sterilen Gefäßen aufge-fangen und bruchsicher ins Labor geschicktwerden. Glasgefäße sind in Holz oder festePappe zu verpacken, aber auch Plastikge-fäße dürfen nicht in gewöhnlichen oder wat-tierten Umschlägen verschickt werden, dasie durch anderes Versandgut mit Ecken undKanten leicht eingedrückt werden.Weil es sich um Krankheitserreger handelnkann, hat der Absender die Pflicht, zuverläs-sig dafür zu sorgen, daß die Sendung unbe-schädigt im Labor ankommt.
Kein Formalin zusetzen!
Im allgemeinen wird das Material für myko-logische Untersuchungen ohne Zusätze ver-schickt, insbesondere ist streng darauf zuachten, daß niemals Formalin dem Materialzugesetzt wird, da sonst keinerlei Möglich-keit besteht, eine kulturelle Untersuchungvorzunehmen.
Reichlich Material einsenden!
Sehr wichtig ist auch, daß ausreichend undzweckmäßig Material eingesandt wird, z.B.30-40 sehr kleine Hautschüppchen oderfeinste Nagelgeschabsel und nur Haar-stümpfe, nicht abgeschnittene Teile der Na-gelplatte oder Haarbüschel oder Krustenund grobe Schuppen.
Zweckmäßige Gefäße verwenden!
Die Gefäße sollen weithalsig oder flachsein. Einige wenige Hautschüppchen in einlanges Reagenzglas zu geben ist ganz undgar zwecklos, das Ergebnis der Untersu-chung - falls man die paar Schüppchenüberhaupt herausbekommt - wäre nichtverwertbar, da der Materialeinsender offen-sichtlich über die richtige Handhabung nichtinformiert ist.
Sterile Papiere oder Folien
Bei Versand über weite Entfernungen lassensich auch sterile Papiere oder Folien ver-wenden.
19
Mikroskopische Untersuchung vonFrischpräparaten (Nativpräparaten)
Ungefärbte Präparate
Hautschuppen
Die Aufgabe besteht darin, nicht mit einergewissen Wahrscheinlichkeit, sondern si-chereindeutige Pilzelemente nachzuweisen.In den meisten Fällen handelt es sich dabeium Fäden. Im allgemeinen sieht man einem
Pilzfaden nicht an, ob er von einem Derma-tophyten stammt, von einem Hefepilz odereinem Schimmelpilz. Erst die Kultur gibt Auf-schluß darüber.Einige Beispiele sind in den Abb. 22-27 dar-gestellt. Man muß sich unbedingt davor hü-ten, den Nachweis eines Pilzfadens als Be-weis anzusehen, daß es sich um einen Fa-denpilz — und schon gar nicht um einen Der-matophyten — handelt.Auch Hefepilze bilden echte Fäden, ohnedaß auch nur eine einzige Sproßzelle sicht-bar ist.
Abb. 22: Pilzfäden in einer Kopfschuppe. Die Kulturergab Candida albicans
Abb. 24: Verzweigte Pilzfäden in einer Hautschuppe.Phasenkontrastpräparat
Abb. 23: Sporenhaufen und versporte Pilzfäden ineiner Hautschuppe
Abb. 25: Sehr eng septierte Pilzfäden in einer Haut-schuppe von einem Rennpferd
20
Sproßzellen in Hautschuppen sicher nach-zuweisen ist fast unmöglich, da Hautfett,Creme- und Salbenreste sowie Artefakteverschiedener Art Sproßzellen vortäuschenkönnen. Auch Dermatophyten- und Schim-melpilzfäden, die in Arthrosporen zerfallen,gequollen und abgerundet sind, werdenleicht mit Sproßzellen verwechselt.Schließlich sind Ansammlungen von Schim-melpilzkonidien, wie sie leicht aus demStaub auf die Haut gelangen, sehr schwerund von weniger Geübten überhaupt nichtvon Sproßzellen sicher abzugrenzen.
Abb. 26: Pilzfäden mit Vakuolen in einer Hautschup-
pe, mit Braunfilter aufgenommen
Abb. 27: Neben einer Hautschuppe liegende Pilzfä-den. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme
Haare
Prinzipiell werden in erster Linie die Haar-stümpfe untersucht, an denen noch ein StückHaarschaft erkennbar ist.Pilzelemente lassen sich außen um das Haarherum nachweisen und auch im Innern desHaares (Abb. 28,29). Einige Strukturen sindsehr charakteristisch, wenn sie voll ausge-bildet sind, z.B. die sogenannte „Sporen-manschette" um das Haar bei Mikrosporiedurch Mikrosporum audouinii, M.canis(Abb. 92) und enge Verwandte, z.B. M.lan-geronii und M.rivalieri.
Abb. 28: Pilzbefallenes Haar. Die äußere Schicht istfreipräpariert. Das Innere ist pilzfrei
Abb. 29: Schwarzes Kuhhaar, von dicken Sporen um-
geben. In Kultur: Trichophyton verrucosum
21
Bei noch nicht lange infizierten Haaren istkeine Sporenmanschette zu entdecken, al-lenfalls einige Rundzellen oder nur Fäden.
Man unterscheidet auch kleinzellige undgroßzellige Sporenhaufen, dünne und dickeFäden, kurze, lange, unverzweigte und ver-zweigte, doch lassen sich daraus keine si-cheren Schlüsse auf die Art des Pilzes ziehen.Die Auffassung, nur Dermatophyten würdendas Haar befallen, wäre grundfalsch. Einige
Beispiele zeigen die Abb. 30-32. Besondersinteressant ist, daß Candida albicans einganzes Gespinst von Fäden um das Haarherum bilden kann, sowohl um Lanugohaarwie auch um Kopf- oder Barthaar.
Die Hefe Trichosporon cutaneum bildetKnötchen am Haarschaft als Piedra alba(Abb. 33) und der Schimmelpilz Piedraiahortae als Piedra nigra (Abb. 164, 165 amSchluß des Bildteiles).
Abb. 30: Barthaar mit Fäden von Candida albicans,zunächst mit Dermatophytenfäden verwechselt
Abb. 32: Rundzellhaufen an einem von Mikrosporumgypseum befallenen Haar
Abb. 31: Barthaar aus Abb. 30, stark vergrößert, miteinem Gespinst von Candida-albicans-Fäden
Abb. 33: Fäden und Sproßzellhaufen von Trichospo-ron cutaneum an einem Piedra-alba-Haar
22
Nägel
Im Nagelmaterial werden vor allem Fädengesucht, wobei es offenbleibt, ob es sich umFäden von Dermatophyten, Hefepilzen oderSchimmelpilzen handelt. In allen Fällen istdas Ergebnis der Kultur von Bedeutung, umsicher zu sein, worum es sich handelt.
Pilzfäden in Nagelmaterial zeigen die Abb.34,35.
Vorsicht vor Fehlinterpretation
Es ist nicht empfehlenswert, die Behandlunglediglich auf das Ergebnis der mikroskopi-schen Direktuntersuchung zu stützen. DemPilzfaden - auch wenn er zweifelsfrei nach-gewiesen ist — kann niemand ansehen, ober noch lebt oder bereits abgetötet ist. Eskommt auch vor, daß Pilzfäden aus der Um-gebung in Untersuchungsmaterial gelangtsind und nichts mit den Krankheitserschei-nungen zu tun haben.
Mosaikpilze
An die Verwechselung mit „Mosaikpilzen"sei erinnert. Es sind Reaktionsprodukte ausKalilauge und Interzellularsubstanz, des-halb findet man diese Strukturen entlang denZellgrenzen. Auch Baumwollfäden, Pflan-zenfasern, Fusseln und Gewebestrukturenkönnen Pilzfäden vortäuschen.
Bakterienfäden
Zu wenig bekannt ist, daß Strahlenpilze zuden Bakterien zählen. Einige Gattungen bil-den echtes septiertes Luftmyzel mit Konidienund sogar mit Sporangien. Sie sehen aus wieSchimmelpilze und werden auch oft dafürgehalten, insbesondere wenn es sich um An-gehörige der sehr umfangreichen GattungStreptomyces handelt. Siehe hierzu die Abb.36. Gelegentlich wird in diesem Zusammen-hang von „Schimmelbakterien" gesprochen,analog zu Schimmelpilzen.
Abb. 34: Pilzfäden in der Nagelplatte
Abb. 35: Pilzfäden in der Nagelplatte
Abb. 36: Fäden von Streptomyces fradiae
23
Abb. 38: Pseudomyzel in Urinsediment
Sputum
Aus dem Sputum werden einzelne Flöckchenmit einem Haken oder einer Präpariernadelentnommen und in einem Tropfen Kalilaugedirekt oder nach kurzem Erhitzen bei schwa-cher bis mittelstarker Vergrößerung unter-sucht (Abb. 37). Sproßzellen, Arthrosporen,Konidien und Pilzfäden müssen kulturellidentifiziert werden.
Sproßzellen nicht nur bei liefen
Werden Sproßzellen gefunden, muß kultu-rell geklärt werden, ob es sich um eine Hefehandelt oder um etwas anderes, z.B. um denSchimmelpilz Aureobasidium pullulans.
Urin
Im Urinsediment können Sproßzellen, Koni-dien, Arthrosporen und Pilzfäden gefundenwerden (Abb. 38). Nur die kulturelle Iden-tifizierung erlaubt eine Beurteilung des Be-fundes.
Faeces
Stuhlausstriche lediglich mikroskopisch zubeurteilen ist nicht zu empfehlen, da sichkaum oder gar nicht feststellen läßt, ob essich um Sproßzellen oder Konidien, um Fä-den von Käseschimmel oder um Fäden vonpathogenen Hefen handelt (Abb. 39). Auchmit falsch negativen Präparaten muß jeder-zeit gerechnet werden.
Vaginalsekret
In Tab. 6 ist ausführlich angegeben, woraufzu achten ist.
Liquor
Im Sediment können Sproßzellen gefundenwerden, doch ist die Identifizierung nachGattung und Art nur kulturell möglich.
24
Abb. 39: Stuhlausstrich mit Sproßzellen und Bakterien
Abb. 37: Sproßzellen und Pilzfäden im Sputum
Gefärbte Präparate
Färbungen mykologischer Frischpräparatesind in vielen Fällen entbehrlich. Mituntersind die Ergebnisse aber zur Demonstrationgut geeignet.
Dünne Hautschüppchen und sehr dünne Na-gelspäne können direkt gefärbt werden.Wurde das Material vorher mit Kalilauge,mit TMOH (Tetramethylammoniumhydro-xid) behandelt, muß zunächst neutralisiertwerden. Als erstes wird die überschüssigeLauge mit Fließpapier abgesaugt. Dannwird Wasser zugegeben oder - besser -10%ig e Milchsäure und wiederum abge-saugt. Dann erfolgt die Färbung.
Lactophenolblaufärbung
Einige Tropfen der „Lactophenolblaulösungzur Pilzfärbung" werden auf das Materialgegeben, wodurch sich vor allem die Pilz-fäden blau anfärben, aber auch Mikro- undMakrokonidien und andere Pilzelemente.
MethylenblaufärbungDiese Färbemethode wird für die Anfärbungvon Pilzen im Vaginalsekret empfohlen.1 Tropfen der „Löffler's Methylenblaulösungfür die Mikroskopie" wird auf dem Objekt-träger mit 1 Tropfen Vaginalsekret ver-mischt, ein Deckglas wird aufgelegt und so-fort mikroskopiert. Die Pilzelemente färbensich innerhalb von 30 Sekunden blau.
Darstellung der Schleimkapsel von Crypto-coccus neoformans
Hierfür eignet sich Nigrosinlösung. Mankocht 10g Nigrosin 10 Minuten lang in 100 mlWasser, läßt erkalten, gibt 0,5 ml Formalde-hydlösung hinzu und filtriert. 1 Tropfen dieserLösung wird auf dem Objektträger mit demverdächtigen Material, z.B. Liquorsediment,vermischt und sofort mikroskopiert. DieSchleimkapsel von Cryptococcus neofor-mans verhindert, daß die Lösung bis an diePilzzelle herankommt. Dadurch entsteht einheller Hof um die Zelle.
PilzkulturenFür die Identifizierung der meisten Pilze istdie Isolierung auf entsprechend geeignetenNährböden unentbehrlich (Abb. 40-43).Als Universal-Agar sind Pilz-Agar nachKimmig und Sabouraud-2% Dextrose-Agaram weitesten verbreitet.Die Beimpfung muß unter sterilen Bedingun-gen erfolgen. Die Bebrütung erfolgt beiHautschuppen, Haaren und Nagelgeschab-sel stets bei Zimmertemperatur (etwa 20-22°C). Die Bebrütungsdauer hängt von denmöglicherweise zu erwartenden Pilzen ab.Selbst wenn schon nach 2Tagen ein Hefepilzgewachsen ist, kann es immer noch 2-3 Wo-chen dauern, bis außerdem noch ein Der-matophyt zum Vorschein kommt.Die zuverlässige Beachtung der Beipack-zettel zu den Fertignährböden schützt vorIrrtümern und Fehlern.
NeuFertignährböden in Schrumpffolien erleich-tern die Handhabung der Platten und sorgenfür Schutz vor Verunreinigung. Wird einePlatte entnommen, schützt die Folie die üb-riggebliebenen. Nach der Beimpfung wirddie Platte mit einem Klebeband vollständigbanderoliert und ist so vor Milben und An-flugkeimen geschützt. Jeder Packung Pilz-nährböden ist eine Klebebandrolle bei-gelegt.
Abb. 40: Kolonien von Candida albicans und Can-
dida tropicalis auf Fertignährboden
25
Merckoplate® Fertignährböden* undTrockennährböden in GranulatformFür den mykologischen Anwendungsbe-reich führt das Haus Merck die wichtigstenNährmedien im Verkaufsprogramm. Siesind als Merckoplate® Fertignährböden undals Trockennährböden in Granulatform lie-ferbar. Die Auswahl der Nährböden richtetsich nach der Art des Untersuchungsmate-rials und nach der Fragestellung. Bei Ver-wendung von Selektivnährböden sollte manimmer zusätzlich einen Universalnährbodenmit beimpfen. Im folgenden sind die wich-tigsten Nährböden und ihre Zusammen-setzung beschrieben.
Abb. 41: Abklatschkultur einer Zahnprothese mitKolonien von Candida albicans
Pilzagar nach KIMMIG
Dieser Nährboden dient zur Züchtung, Iso-lierung, Identifizierung und Stammerhaltungvon Pilzen. Als Universalnährboden ermög-licht er gutes Wachstum aller Dermato-phyten, Hefen und Schimmelpilze. Er fördertdie Entwicklung der für die Diagnostik wich-tigen charakteristischen Wuchsformen.
Zusammensetzung (g/Liter)
Pepton aus Fleisch 9,3; Pepton aus Casein 4,3; Na-triumchlorid 11,4; D(+)-Glucose 10,0; Agar-Agar 15,0.Zusätzlich: Glyzerin 5,0 ml.
* Vertrieb nur in der BR Deutschland
SABOURAUD-2% Glucose-Agar
Dieser universelle Nährboden eignet sichzur Züchtung, Isolierung und Identifizierungvon Pilzen. Die hohe Konzentration (2%) anKohlenhydrat ermöglicht optimales Pilz-wachstum. Da der Nährboden keine selektivwirkenden Substanzen enthält, ist der pH-Wert auf 5,6 eingestellt, um das Wachstumvon Bakterien zu hemmen.
Zusammensetzung (g/Liter)
Pepton aus Fleisch 5,0; Pepton aus Casein 5,0; D(+)-Glucose 20,0; Agar-Agar 17,0.
Dermatophyten-Selektivagar (DTM) nachTAPLIN
Der Nährboden dient zur Isolierung und invielen Fällen der schnellen Differenzierungvon Dermatophyten, auch aus mischinfizier-tem Untersuchungsmaterial. Er enthältaußer selektiven Hemmstoffen, die dasWachstum von Bakterien, Hefen und Schim-melpilzen teilweise unterdrücken, Phenol-rot als pH-Indikator. Intensive Rotfärbungdes Agars weist auf Dermatophyten hin.
Zusammensetzung (g/Liter)
Pepton aus Sojamehl 10,0; D(+)-Glucose 10,0; Cyclo-heximid 0,5; Gentamycinsulfat 0,1; Chlortetracyclin0,1; Phenolrot 0,2; Agar-Agar 17,0.
Selektivagar für pathogene Pilze
Zur Selektion von Dermatophyten enthältdieser Nährboden Cycloheximid und Chlor-amphenicol, wodurch Bakterien und Schim-melpilze weitgehend unterdrückt werden.Da gelegentlich auch pathogene Pilze ge-hemmt werden können, sollte stets einhemmstofffreier Nährboden mitbeimpftwerden (z.B. Pilzagar nach KIMMIG oderSABOURAUD-2% Glucose-Agar).
Zusammensetzung (g/Liter)
Pepton aus Sojamehl 10,0; D(+)-Glucose 10,0; Cyclo-heximid 0,4; Chloramphenicol 0,05; Agar-Agar 12,5.
26
Candida-Elektivagar nach NICKERSON
Dieser Nährboden dient zur Isolierung undDifferenzierung von Pilzen der GattungCandida und anderen Hefen. Er enthältWismut-Sulfit-Indikator zur weitgehendenHemmung der Begleitflora. Außer Candidawachsen auch Vertreter anderer Hefe-gattungen, manchmal sogar Dermato-phyten, Schimmelpilze oder Bakterien aufdiesem Nährboden.
Zusammensetzung (g/Liter)
Hefeextrakt 1,0; Glycin 10,0; D(+)-Glucose 10,0;Wismut-Sulfit-Indikator 7,0; Agar-Agar 15,0.
Reisextrakt-Agar
Testnährboden zur Differenzierung vonHefen, insbesondere von Candida albicansgegenüber anderen Candida-Arten auf-grund der für sie typischen Chlamydo-sporen. Auch einige andere Hefegattungensind anhand mikromorphologischer Krite-rien auf dem Reisextrakt-Agar differenzier-bar. Der Nährboden enthält als einzigeNährgrundlage Reisextrakt. Die Nährstoff-armut schafft, zusammen mit sauerstoff-armen Kulturbedingungen, ein Mangel-
milieu, das bei einigen Hefen die Bildungspezifischer morphologischer Formen, ins-besondere Chlamydosporen und Pseudo-myzelien, induziert.
Zusammensetzung (g/Liter)
Reisextrakt 5,0; Agar-Agar 10,0.
Herstellung und Lagerung
Trockennährböden sollen trocken, lichtge-schützt und stets in gut verschlossenen Pak-kungen gelagert werden. Unter einwand-freien Bedingungen können sie in originalverschlossenen Packungen ab Herstellungmindestens fünf Jahre (siehe Verfalldatum)gelagert werden.
Zur Herstellung von Fertignährböden wirdeine bestimmte Menge (Summe der ange-gebenen g/Liter der Inhaltsstoffe) in einemLiter destillierten Wassers gelöst, im Auto-klaven sterilisiert und anschließend in Petri-schalen ausgegossen, wo die Lösung zufesten, beimpfbaren Agarplatten erstarrt.
Merckoplate® Fertignährböden sind in Petri-schalen steril ausgegossen. Eine Packungenthält 20 Platten. Davon sind jeweils 5 Plat-ten mit einer Schrumpffolie versiegelt. Die
Abb. 42: Blutstropfen mit zwei Kolonien von Candida
albicans
Abb. 43: Stuhlkultur mit Hefen und Bakterien
27
enganliegende Schrumpffolie schützt diePlatten und verhindert Fremdkontamination.Die Entnahme einzelner Petrischalen istdurch vorsichtiges öffnen an der Folien-naht möglich. Die restlichen Platten bleibentrotzdem geschützt.
Die fertigen Platten, gleich ob selbst herge-stellt oder Merckoplate® Fertignährböden,sollen im Dunkeln, bei Temperaturen von12-15°Cmitdem Deckel nach oben gelagertwerden. Lagertemperaturen unter dem Ge-frierpunkt sind strikt zu vermeiden, da sonstder Nährboden durch Ausfrieren des Was-sers unbrauchbar wird. Für einige Wochenist auch die Lagerung bei Raumtemperatur(20-25°C) möglich.
Die Aufbewahrung der beimpften Plattenrichtet sich nach der Dauer der Bebrütung.Wird nicht länger als 2 Wochen bebrütet,können die Platten, mit dem Deckel nachoben, ohne weitere Schutzmaßnahmen auf-bewahrt werden (z.B. Candida-Elektivagar,Reisextrakt-Agar). Dauert die Bebrütunglänger, erfordert dies zusätzliche Schutz-maßnahmen. Am praktischsten ist die voll-ständige Banderolierung der Platte miteinem Klebeband. Merckoplate® Fertig-nährböden (Dermatophyten-Selektivagarnach TAPLIN, Pilzagar nach KIMMIG,SABOURAUD-2% Glucose-Agar, Selektiv-agar für pathogene Pilze) enthalten in derPackung jeweils eine Klebebandrolle. Nachder Beimpfung wird die Petrischale mit demKlebeband vollständig banderoliert. So istausreichender Schutz, z.B. gegen Schimmel-pilzkontaminationen und pilzfressende Mil-ben, gegeben.
Haltbarkeit
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung sindMerckoplate® Fertignährböden, soweitnichts anderes angegeben, etwa 7 Monatehaltbar. Das Verfalldatum ist auf den Pak-kungen aufgedruckt. Selbstbereitete Nähr-bodenplatten sind ebenfalls längere Zeithaltbar, wenn sie vor Austrocknen geschütztwerden, z.B. in Plastikbeuteln.
Zeigt der Nährboden während der Lage-rung auffallende Veränderungen, wie etwarunzelige Oberfläche oder Schrumpfungder Nährbodenschicht infolge Wasserver-lust, Ablösen von der Wand der Petrischaleoder auffallende Farbänderung, so ist dievolle Verwendbarkeit nicht mehr in jedemFalle gesichert. Garantie wird bei vor-schriftsmäßiger Lagerung bis zum Verwen-dungsdatum gewährt.
Beimpfung
Die Beimpfung der Platte erfolgt nach denin der medizinischen Mykologie bewährtenRegeln, jeweils von der Art des Materialsabhängig.Hautschüppchen und Nagelspäne müssengut zerkleinert sein, bevor sie auf den Nähr-boden verimpft werden. Die Übertragungdes Materials mit der Spitze eines mykolo-gischen Hakens ist besonders empfehlens-wert. Etwa 20—30 Impfstellen sind erforder-lich, um eine Chance zu haben, daß die ne-sterweise ungleich verteilten Pilzelementemit auf den Nährboden gelangen.Vaginalsekret, Urinsediment, Liquorsedi-ment und ähnliches Material wird mit derÖse verimpft oder aus dem Sedimentröhr-chen auf den Nährboden getropft.
Bebrütung
Die Bebrütung von Hautschuppen, Haarenund Nagelspänen erfolgt grundsätzlich beiZimmertemperatur von etwa 20—25°C. BeiVerdacht auf Mykosen innerer Organe wirdam besten parallel bei Zimmertemperaturund im Brutschrank bei 37°C bebrütet. Reis-extrakt-Agar wird nur bei Zimmertempera-tur bebrütet.
Mikroskopische Untersuchung der Kultur
Das Luftmyzel von Dermatophyten undSchimmelpilzen wird am Rande der Kolo-nien bei schwacher bis mittelstarker Ver-größerung auf Mikro- und Makrokonidien
28
und andere Strukturen abgesucht. Nur sel-ten sind Zupfpräparate erforderlich, z.B. umeinzelne Makrokonidien zu suchen. DasZerzupfen einer kleinen Menge Luftmyzelerfolgt mit 2 Präpariemadeln.Von Hefekolonien entnimmt man mittels Ha-ken oder Öse eine winzige Probe und ver-mischt sie auf dem Objektträger mit einemTropfen Kalilauge oder steriler physiologi-scher Kochsalzlösung.
MikrokulturIn vielen Fällen ist es erforderlich, die Frukti-fikation eines Pilzes zu studieren, um Gat-tung und Art zu bestimmen.Aus einem Fertignährboden kann man einAgarblöckchen herausschneiden und aufeinen sterilen Objektträger legen, an denSeiten beimpfen, ein Deckglas auflegen undin einer feuchten Kammer tagelang be-brüten.
Gut geeignet ist auch ein anderes Verfah-ren: Ein Fertignährboden in einer Petri-schale wird an mehreren Stellen „gefen-stert", indem man ein Agarstück von etwa5 mal 10 mm mit einem Skalpell heraus-schneidet und verwirft. An drei Seiten wirdder „Fensterrahmen" beimpft, ein Deckglasso aufgelegt, daß ein Luftloch bleibt, und beiZimmertemperatur bebrütet. Diese Methodehat den Vorteil, daß nichts austrocknet, selbstwenn täglich durchs Mikroskop beobachtetwird.
Empfehlenswert ist vor allem Reisagar, daes sich um einen sehr nährstoffarmen Nähr-boden handelt, auf dem die Pilze wenigervegetatives Myzel, aber um so mehr Fruchtebilden.
Interpretation der kulturellen BefundeZunächst wird festgestellt, ob tatsächlichPilze gewachsen sind und nicht Bakterien,die leicht mit Pilzen verwechselt werden, z.B.Gaffkya tetragena wird mit Hefen verwech-selt, Streptomyces wird mit Schimmelpilzverwechselt.
Sind Hefen gewachsen, muß geklärt wer-den, ob es pathogene oder apathogenesind; Candida albicans ist pathogen, Candi-da kefyr ist apathogen. Bäckerhefe undBierhefe sind apathogen, auch wenn sie aufCandida-Agar braunschwarz wachsen.
Dermatophyten sind nach Gattung und Artzu differenzieren, vor allem aus epidemio-logischen Gründen. Die genaue Kenntnisder Pilzart kann dazu beitragen, die Infek-tionsquelle zu ermitteln und auszuschalten,z.B. pilzkranke Tiere durch den Tierarzt be-handeln zu lassen.
Inwieweit der Nachweis von Schimmelpil-zen Bedeutung hat, muß von Fall zu Fallsorgfältig erwogen werden. Hierbei helfendie Erklärungen im BILDTEIL dieser Bro-schüre.
Abtötung und unschädlicheBeseitigung von PilzkulturenVerschiedene Methoden lassen sich verwen-den, um eine zuverlässige Entsorgung zu ge-währleisten.Desinfektionsmittel, die in der Liste der vomBundesgesundheitsamt geprüften Mittel auf-geführt sind, sind einfach anzuwenden. Manüberschichtet die Pilzkulturen so, daß ihreOberfläche völlig bedeckt ist. Ausreichendfür eine Petrischale von 9 cm Durchmessersind etwa 10 ml. Man läßtdas Desinfektions-mittel mindestens 6 Stunden einwirken.1»Autoklavieren in hochschmelzenden Plastik-beuteln21 zur Vernichtung der Pilzkulturen istebenfalls ein geeignetes Verfahren. Die Ab-tötung kann auch durch Verbrennung vorge-nommen werden.Die abgetöteten Pilze werden wie Müll be-
seitigt.
n~7jltedirvorn Bundesgesundheitsamt geprüften und anerkanntenDesinfektionsmittel und -verfahren. - Bundesgesundheitsblatt 21,255-261 (1978). Erhältlich beim Bundesgesundheitsamt, Robert-Koch-Institut, A-Verw„ 1000 Berlin 65, Nordufer 20.
2) Spezial-Vernichtungsbeutel der Firma CA. Greiner und Söhne,
7440 Nürtingen.
29
GlossariumActidion-ZusatzActidion (= Cycloheximid) ist einaus Streptomyces nourseigewonnenes Antibiotikum miteinem vor allem gegen bestimmteschnell wachsende Schimmelpilzegerichteten Wirkungsspektrum.Allerdings werden auch einigeHefen von Actidion im Wachstumunterdrückt, so daß ein generellerZusatz zu Nährböden dazu führenkann, daß die Krankheitserregernicht entdeckt werden.
aerobNur in Gegenwart von freiemSauerstoff lebend.
AflatoxineGiftstoffe, die von dem Schimmel-pilz Aspergillus flavus (A- vonAspergillus, fla- von flavus)gebildet werden, z.B. Aflatoxin B],B2a, B2b, Gi, G2a, G2b, Mi, M2. Amgiftigsten und krebserzeugend istAflatoxin Bl7 z.B. in verschimmeltenNüssen.
AleurienMeist als Synonym für Mikro-konidien gebraucht.
anaerobIn Abwesenheit von freiem Sauer-stoff lebend.
antimykotischGegen Mykosen wirksam; dieseWirksamkeit läßt sich nur in vivoprüfen.
antimyzetischGegen Myzeten (Pilze) wirksam;in vitro läßt sich diese Wirksamkeitprüfen.
ArtFeststehender Begriff aus derbotanischen und zoologischenSystematik; kleinste selbständigeEinheit der Klassifizierung. DieArten werden zu Gattungenzusammengefaßt.
ArtbezeichnungNaturwissenschaftlicher Namefür Lebewesen, z.B. für Pilze;besteht immer aus zwei Wörtern.Das erste Wort benennt dieGattung (z.B. Candida), das
zweite die Art (z.B. albicans). Istdie Art nicht differenziert wordenoder sind irgendwelche, nichtnäher bezeichnete Arten einerGattung gemeint, dann verwendetman „species", abgekürzt „sp.",also z.B. Aspergillus species.
ArthrosporenGliedersporen; sie entstehen,wenn ein Pilzfaden in Glieder-stücke zerfällt, also keine Sporenim Sinne sexueller Fruktifikation.Typische Arthrosporenbildner sindTrichosporon (Arthrosporen+ Blastosporen) und der Milch-schimmel Geotrichum candidum(nur Arthrosporen, keine Blasto-sporen).
AscomycetenPilzklasse; umfaßt alle Pilze, diesich sexuell durch Ascosporenvermehren.
AscosporenSexualsporen von Pilzen derKlasse Ascomyceten, werden imAscus gebildet.
AscusBedeutet Sack oder Schlauch, einBehälter für Sexualsporen bei denAscomyceten. Die Asci befindensich meist in charakteristischenFruchtkörpern, z.B. in Perithezien;bei den perfekten Hefen jedochwerden bestimmte Hefezellenselbst zum Ascus, in dem sich dieAscosporen entwickeln.
BasidiomycetenPilzklasse; umfaßt alle Pilze, diesich sexuell durch Basidiosporenvermehren, z.B. Hausschwammoder Hutpilze.
BasidiosporenSexualsporen von Pilzen derKlasse Basidiomyceten. Sie ent-stehen durch Ausstülpen aus derBasidie (Sexualzelle).
BlastomykosenTypische Erkrankungen durchverschiedene Pilze, die im GewebeSproßzellen bilden. 1. Crypto-coccose, Erreger: Cryptococcusneoformans, ein Hefepilz; 2. Nord-amerikanische Blastomykose,Erreger: Blastomyces (Ajello-myces) dermatitidis, ein biphasi-
scher Schimmelpilz; 3. Paracocci-dioidomykose (SüdamerikanischeBlastomykose), Erreger: Para-coccidioides (Blastomyces)brasiliensis, ebenfalls ein bipha-sischer Schimmelpilz. - DieChromomykose (früher: Chromo-blastomykose) ist keine Blasto-mykose, da die Gewebsformenkeine Sproßzellen sind - wie mananfangs fälschlicherweise ange-nommen hatte —, sondernfumagoide Zellen, die als Dauer-formen fungieren. 4. Keloidblasto-mykose, Erreger: Loboa loboi.
BlastomyzetenKein eindeutiger Begriff, da inverschiedenem Sinne gebraucht.1. Mehrzahl von Blastomycesdermatitidis, dem Erreger derNordamerikanischen Blasto-mykose; 2. früher den Erreger derSüdamerikanischen Blastomykosemit einbeziehend, den Paracoc-cidioides (früher: Blastomyces)brasiliensis; 3. wörtliche Über-setzung von Sproßpilze. Das Di-lemma besteht darin, daß dieunter 1. und 2. genannten Pilze,Blastomyces und Paracoccidioideskeine Hefen, sondern biphasische(dimorphe) Schimmelpilze sindund daß die reinen Hefen - mitAusnahme von Cryptococcusneoformans — keine Blastomy-kosen verursachen.
BlastosporenKeine Sporen im Sinne sexuellerVermehrung, sondern nichts weiterals Sproßzellen. Hefen vermehrensich ungeschlechtlich, indem dieMutterzelle durch Sprossung eineTochterzelle bildet, aus der wie-derum eine oder mehrere Blasto-sporen hervorgehen. WennBlastosporen fadenförmig anein-ander hängen bleiben, spricht manvon Pseudofaden; ein Netzwerkdieser Pseudofäden heißt Pseudo-myzel.
BrandpilzeWichtige Erreger von Pflanzen-krankheiten; wirtschaftlich vonsehr großer Bedeutung beiGetreide. Die befallenen Pflanzen-teile sehen wie verkohlt aus.
30
BrandsporenDunkelbraun, violett bis schwarzgefärbte, für Brandpilze charak-teristische Sporen, zerstäuben beiReifung der Sporenlager; infolgedes Gehaltes an TrimethylaminGeruch von Heringslake.
CandidaGattung der imperfekten Hefen,umfaßt nach Kreger-van Rij (1984)196 verschiedene Arten, z.T. eßbar(Candida kefyr), Z-T- pathogen(Candida albicans).
CandididAllergische Reaktion durch Aller-gene von Hefen der GattungCandida; meist feine kleieförmigeSchuppung, z.B. über den Augen-brauen bei vaginaler Candidose.
CandidomPilzgeschwulst (Myzetom) durchHefen der Gattung Candida,insbesondere C. albicans, aberauch C. tropicalis u.a.
Candidose (Candidosis)Erkrankung durch Candida.Veraltete Bezeichnung: Moniliasis(bis 1923 hieß Candida albicans„Monilia" albicans). ÜberholteBezeichnung: Candidiasis(auf -iasis enden heute Erkran-kungen durch Würmer undProtozoen). Eindeutig falscheBezeichnungen: Candidiosis,Candidiose, Candidasis, Candi-dase.
ChlamydosporenVon zahlreichen Pilzen gebildetedickwandige Dauersporen, mit-unter sehr charakteristisch;deshalb für die Artbestimmungverwertbar, z.B. bei Candidaalbicans.
CleistothecienAllseits geschlossene Fruchtkörperder Pilze, die zur Klasse der Asco-myceten gehören. In den Cleisto-thecien befinden sich die Asci mitden Ascosporen (Sexualsporen);durch Platzen der Cleistothecienwerden die reifen Sporen frei.
Coccidioides immitisErreger der Coccidioidomykose,hochinfektiöser Schimmelpilz,bildet im Gewebe Sphärulen undin der Kultur Arthrosporen.
CoccidioidomykoseDurch Coccidioides immitis her-vorgerufene Systemmykose, dievorwiegend in Wüstengebietenvorkommt und auch Wüstenrheu-matismus, Sankt-Joachims-Fieber,Morbus Posada-Wernicke, Cocci-dioidales Granulom und Talfiebergenannt wird. Zwei Formen:1. Akute, gutartige, von selbstheilende Erkrankung des Respira-tionstraktes; 2. chronische,maligne, disseminierte System-erkrankung mit Befall des Atem-und Verdauungstraktes, der Haut,der Knochen und andererGewebe.
DermatophytenZusammenfassende Bezeichnungaller Pilze der Gattungen Tricho-phyton, Mikrosporum, Epidermo-phyton und Keratinomyces.
DermatophytidMykid durch Dermatophyten-
antigene.
DermatophytieDermatomykose durch Dermato-phyten. Man unterscheidet Tricho-phytie, Mikrosporie und Epider-mophytie, selten auch Keratino-mykose. Der Favus gehört zurTrichophytie.
DermatophytoseIm Deutschen ursprünglich alsBezeichnung für eine Dermato-phyteninfektion mit Allgemein-symptomen gebraucht (z.B. mitFieber); heute - vom Englischenher — gleich Dermatophytie.
DeuteromycetenSynonym für Fungi imperfecti.
DHS-SystemIn der medizinischen Mykologieübliche Unterteilung der Mikro-pilze in Dermatophyten, Hefen undSchimmelpilze.
DifferenzierungBestimmung der Pilze nach Gat-tung und Art aufgrund morpho-logischer und (vorwiegend beiHefen) physiologischer Eigen-schaften.
EktothrixPilzwachstum in der Haarrinde.
EndoektothrixPilzwachstum in inneren undäußeren Schichten des Haares.
EndokonidienIm Innern von Pilzzellen gebildeteungeschlechtliche Sporen.
EndothrixPilzwachstum in den innerstenSchichten des Haares.
EpidermophytonDermatophytengattung mit typi-schen keulenförmigen Makro-konidien. Dagegen werden keineMikrokonidien gebildet.
Eumycotina(auch Eumyzeten): Unterabteilungder Pilze (Mycota, Myzeten),gekennzeichnet durch Hyphenund/oder Sproßzellen mit Zell-wänden.
fadenbildende HefenHefen, die außer Blastosporen(Sproßzellen) auch septierte Fädenbilden, z.B. Candida albicans oderTrichosporon cutaneum, und sichdamit als Sproßpilz und Fadenpilzzugleich erweisen. Die früherverbreitete Gleichsetzung vonFadenpilz mit Dermatophyt istinzwischen als falsch erkannt, daauch eine Reihe von Hefen undalle Schimmelpilze Fadenpilzesind.
FadenpilzeBezeichnung für Pilze, die Fädenbilden, z.B. Schimmelpilze undDermatophyten.
FamilieZusammenfassung von Gattungen,Endung -aceae, z.B. Saccharomy-cetaceae.
FaviformAussehen der Pilzkultur wie beimFavuserreger.
FavusFrüher auch „Erbgrind" genannt.Erreger: Trichophytonschoenleinii,ein Dermatophyt, der vor allemKopfhaar und Nägel befällt.
FilamentLanggestreckte, fadenförmigePilzzelle.
31
FruchtkörperAm fruchtbildenden Myzel ent-standene Gebilde, in denen sichdie Sexualsporen der Pilze ent-wickeln, z.B. Perithezien.
Fungi imperfectiZusammenfassung der Pilze, diesich ungeschlechtlich vermehrenoder deren Sexualformen nichtbekannt sind.
fungistatischPilzhemmend.
fungizidPilztötend.
Fungus(pl. Fungi): Pilze, chlorophylloseThallophyten. In der botanischenSystematik in der Abteilung Mycota(mit den Unterabteilungen Myxo-mycotina und Eumycotina) zu-sammengefaßt.
fusiformSpindelförmig, z.B. Makro-konidien von Mikrosporum canis.
Fußmykosen bei PflanzenPilzerkrankung im Niveau der Erd-bodenoberfläche zwischen Wurzelund Halm, vorwiegend bei Ge-treide; die fußpilzkranken Halmeknicken um und sterben ab.
FußpilzeVerursachen Fußmykosen undandere Mykosen.
GattungFest umrissener Begriff der natur-wissenschaftlichen Systematik,dem Begriff der Art übergeordnet.Die Gattungen sind in Familienzusammengefaßt.
GenusGattung, enthält Arten (Species).Gattungsnamen werden immergroß geschrieben.
Geotrichum candidumAls „Milchschimmel" bekannt, inQuark, Harzer Käse, Camembertusw., bildet typische Arthrosporen,aber keine Sproßzellen(Blastosporen).
GrauschimmelGrauer Schimmelüberzug aufzahlreichen Früchten, die dadurchungenießbar werden; bekannt bei
Erdbeeren, wenn es nach der Blüteviel regnet. Erreger: Botrytiscinerea; cinerea heißt aschgrau.
HyphenPilzfäden; teils septiert (mit Quer-wänden versehen), teils unseptiert(ohne Querwände).
imperfekte HefenHefen, die keine Sexualsporenbilden, sich also nur ungeschlecht-lich vermehren, z.B. Candidaalbicans.
interkalärIm Verlaufeines Pilzfadenswachsend oder vorkommend.
KeratinomycesDermatophytengattung, die voneinigen Autoren in die GattungTrichophyton eingegliedert wurde.
Kerion Celsi(kerion = Honigwabe): EitrigePilzgeschwulst des behaartenKopfes.
Kimmig-AgarFester Nährboden, auf dem sichDermatophyten, Hefen undSchimmelpilze besonders gut ent-wickeln. Als Fertignährboden imHandel erhältlich.
knotige OrganeVerknotung oder Verknäuelungvon Pilzfäden, möglicherweiseRudimente von nicht fertig ausge-bildeten oder entwickelten Frucht-formen. Bedeutung unklar.
KonidienUngeschlechtliche Sporen vonPilzen, direkt an den Pilzfädenoder an besonderen Konidien-trägern gebildet; kleine, ein- biszweizeilige heißen Mikrokonidien,größere, mehrzellige nennt manMakrokonidien.
KormophytenPflanzen, die aus Wurzel, Sproßund Früchten bestehen. Gegensatzdazu: Thallophyten (Pilze sindThallophyten).
KugelhefenBei einigen Schimmelpilzen in(vorwiegend) zuckerhaltigenFlüssigkeiten vorkommendeWuchsform, z.B. bei Mucor oder
Rhizopus. Typisch sind aneinanderhängende Rundzellen.
lateralSeitlich an Pilzfäden wachsendoder vorkommend.
LevuroseErkrankung durch Hefepilze, auchals Hefemykose bezeichnet(levure = Hefe).
LuftmyzelPilzfäden, die sich aus flüssigenoder festen Nährböden frei in denLuftraum erheben; dadurch bildetsich auf dem Nährmedium ein Pilz-rasen von schimmeligem Aus-sehen. Am Luftmyzel bilden sichdie Konidien und die Fruchtkörpermit den Sexualsporen.
LuftsporenkonzentrationDie Menge von Pilzsporen, die sichin einer bestimmten Luftmengebefindet. Die Messung erfolgt inSpezialbehältern durch Filternbestimmter Luftmengen und Aus-zählen der im Filter eingesam-melten Pilzsporen.
MakrokonidienMehrzellige ungeschlechtlichePilzsporen mit Querseptierung undz.T. auch mit Längsseptierung.
MikrokonidienKleine, meist einzellige, manchmalzweizeilige rundliche bis ovaleoder birnenförmige Konidien.
MikrosporidAllergische Reaktion durch Aller-gene von Dermatophyten derGattung Mikrosporum; Auftretenauf der Haut in Form von Flecken,Knötchen, Bläschen, Pusteln oderSchuppen. Gehört zur Gruppe der„Id-Reaktionen".
MikrosporieDurch Pilze der Gattung Mikro-sporum verursachte Mykose derHaut, Haare und Nägel.
MikrosporoseIdentisch mit Mikrosporie.
MikrosporumDermatophytengattung. Typischsind rauhwandige Makrokonidien.
MonilienSchimmelpilze, die die Pflanzen-krankheit Monilia hervorrufen.
32
Irrtümlicherweise früher auch fürdie Hefepilze der Gattung Can-dida gebraucht.
MoniliomSynonym für Candidom. Da dieBezeichnung Monilia albicans1923 in Candida albicans abge-ändert wurde, istMoniliom nichtmehr korrekt.
MykotoxikosenDurch Mykotoxine verursachteKrankheitserscheinungen; beiTieren schon weiter erforscht alsbeim Menschen.
MykidAllergische Reaktion, meist auf derHaut in Form von Flecken, Knöt-chen, Bläschen, Pusteln oderSchuppen, bei Pilzbefall an ande-rer Stelle, z.B. im Nagel oder in derVagina.
MykotoxineGifte einer Reihe von Pilzarten;am bekanntesten sind die Afla-toxine aus Aspergillus flavus undAspergillus parasiticus. Sub-toxische Dosen wirken bei Forellenund anderen Tieren karzinogen.
_ Mehr als 80 Mykotoxine sind ausverschiedenen Schimmelpilzenbisher isoliert worden.
MyzelFlechtwerk aus Pilzfäden; vegeta-tives Myzel dient der Ernährung,fruktifizierendes Myzel der Ver-mehrung.
MyzelsporenDurch Hyphensegmentierungentstehende ungeschlechtlicheSporen.
MyzetomPilzgeschwulst, meist durchSchimmelpilze, seltener durchHefen, in verschiedenen Bereichendes Körpers.
NativpräparatAuch Frischpräparat genannt oderDirektpräparat. Untersuchungs-material, z.B. Hautschuppen, wirddirekt - eventuell in Kalilaugeaufgehellt - mikroskopisch unter-sucht.
Nickerson's MediumNährboden, der Wismut-Sulfit-
Indikator enthält, wodurch Hefen,aber auch manche Bakterien,braunschwarze Kolonien bilden.
OnychomykoseNagelmykose. Erreger: Dermato-phyten, Hefen oder Schimmelpilze.
parasitisches StadiumWenn der Pilz ein anderes Lebe-wesen zur Ernährung nutzt, alsolebende organische Substanz ver-wertet. Es gibt obligate Parasiten(die nur parasitisch leben) undfakultative Parasiten, die zeitweiseauch saprophytisch leben können.
perfekte HefenHefen, die Sexualsporen bilden,sich also geschlechtlich vermehren,z.B. Saccharomyces-Arten.
PerithecienFruchtkörper der Ascomyceten, indenen sich die Ascosporen in denAsci entwickeln. Allseits geschlos-sene Perithecien, die bei der Rei-fung platzen, nennt man Cleisto-thecien.
PhycomycetenIn der älteren Systematik ge-bräuchliche Pilzklasse, in derneueren Systematik aufgegebenund durch andere Bezeichnungenersetzt, z.B. durch Zygomyceten.
PhykomykosenFrüher gebräuchliche Bezeichnungfür Mykosen durch Phycomyceten.Jetzt vorwiegend durch Zygomy-kosen ersetzt.
PhytomykosenPflanzenkrankheiten durch Pilze.
ProtochlamydosporenZellen, aus denen Chlamydo-sporen hervorgehen, z.B. beiCandida albicans vorkommend.
pleomorphFlaumiges Wachstum des Luft-myzels von Pilzen unterteilweisemoder völligem Verlust der Frucht-körperbildung.
PreßhefeBackhefe, gepreßt (um über-schüssige Flüssigkeit zu entfernen)und in Pakete verpackt.
PromyzelAus einer Spore, z.B. einer Brand-spore, entstehender Keimschlauch,
aus dem sich ein Sproßmyzelentwickeln kann.
PseudofädenIn Fadenform gebildete, anein-ander hängende, meist langge-streckte Sproßzellen, einen echtenPilzfaden vortäuschend.
PseudomyzelAus Pseudofäden gebildetes Pilz-geflecht, bei imperfekten undperfekten Hefen vorkommend.
RaquettehyphenAn einem Ende tennisschlägerartigaufgetriebene Pilzzellen.
ReisagarSehr nährstoffarmer fester Pilz-nährboden aus Reiskörnerdekoktund Agar; sehr gut für die Differen-zierung von Hefen geeignet, insbe-sondere für die Chlamydosporen-entwicklung bei Candida albicans.Begünstigt auch die Konidien-bildung bei Dermatophyten undSchimmelpilzen.
ReiseextraktagarKein Nährboden, um auf ReisenPilzkulturen anzulegen. Vielmehrimmer wieder vorkommenderDruckfehler.
ReisextraktagarSiehe Reisagar.
RhizoidePilzfäden in Form wurzelartigerAusläufer, von verschiedenen Pilz-arten gebildet, z.B. von Rhizopusnigricans.
Sabouraud-NährbödenVerschiedene, von Sabouraud inseinem Buch „Les teignes" 1910angegebene Pilznährböden,z.B. Glucose-Agar, Pepton-Agar,Maltose-Agar usw.
SaprophytenLebewesen, die abgestorbeneorganische Substanz als Nahrungverwerten, z.B. Pilze, die auf künst-lichen Nährböden wachsen oderin Schmutz schmarotzen. Sapro-phytisch und pathogen sind keineGegensätze. Auch Saprophytenkönnen Krankheiten verursachen.
SchimmelpilzeMikropilze, die auf einem Substrat- meist sehr rasch - einen schim-
33
meligen Überzug bilden. Schim-meln ist von schimmern abgeleitet.
SchwärzepilzeVerursachen die sogenanntenSchwärzekrankheiten beiPflanzen, z.B. schwarze Fleckenauf Gurken, Bohnen usw., häufigCladosporium und Alternaria.
septierte FädenPilzfäden, deren Innenraum durchQuerwände (Septen) unterteilt ist.
Septum, Septa (Septen)Querwände im Verlauf von Pilz-fäden. '
SexualsporenPilzsporen, die sich aus der Ver-schmelzung von Geschlechtszellenentwickeln, z.B. Ascosporen,Basidiosporen, Zygosporen.
SklerotienMehrzellige, meistdunkel gefärbteDauerorgane bei Pilzen, dick-wandig, sehr auffällig und charak-teristisch bei Botrytis cinerea.
SphärulenKugelige Fruchtkörper bestimmterPilze, z.B. Coccidioides immitis,vor allem im Wirtsgewebe vor-kommend.
SpindelsporenSpindelförmige Makrokonidien.
SpiralhyphenSpiralig gedrehte Pilzfäden desLuftmyzels, bei verschiedenenPilzen vorkommend, verhältnis-mäßig häufig bei Trichophytonmentagrophytes.
SporangienFruchtkörper von Pilzen, in derenInneren sich die Sporangiosporenentwickeln. Auch der Ascus ist einSporangium.
SporangienträgerPilzfaden, an dem sich ein Spor-angium entwickelt.
SporangiophorenTrägerhyphen für ein Sporangium.
SporangiosporenIn Sporangien gebildete Pilzsporen,z.B. bei Mucor oder Rhizopus.
SporenPflanzliche Keimzellen, Oberbe-grifffür Pilzzellen, die der Ver-mehrung dienen, im engeren Sinneinsbesondere für Sexualsporengebraucht, während die asexuellenSporen Spezialbezeichnungentragen, z.B. Konidien.
SprossungWuchsform bei Pilzen; aus derMutterzelle quillt nach lokalerAuflösung eines Teiles der Zell-wand ein Teil des Zellinhaltes undwächst zur Tochterzelle heran, dieder Mutterzelle gleicht; dannentsteht die Enkelzelle usw.;typische Wuchsform für Hefen,aber auch bei anderen Pilzen vor-kommend.
SproßpilzePilze, die Sproßzellen bilden, vorallem - aber nicht nur - Hefepilze.
SproßzellenBlastosporen, typisch für Hefe-pilze, aber auch bei zahlreichenanderen Pilzen vorkommend,z.B. bei Schimmelpilzen.
StolonePilzfäden, die als Ausläufer - wiebei Erdbeeren - neue Vegeta-tionspunkte setzen, z.B. bei Mucorund Rhizopus.
terminalAm Ende eines Pilzfadenswachsend oder vorkommend.
ThallophytenPflanzen, die nur aus vegetativemund fruktifizierendem Anteil be-stehen (Pilze, Moose, Flechten,Algen). Gegensatz dazu: Kormo-phyten.
TineaVieldeutiger klinischer Begriff,meist für oberflächliche Pilz-erkrankungen der Haut ver-wendet. Im Sinne von Götz mit demfrüheren Begriff der „Epidermo-phytie" identisch, unabhängig vonder Art des Erregers.
TorulopsidoseFrühere Bezeichnung für Erkran-kungen durch Hefen der Gattung
Torulopsis, heute gleichgesetzt mitCandidose.
TorulopsisBisher selbständige Hefegattung;seit 1984 in die Gattung Candidaeingegliedert.
TrichophytidÄhnlich wie Mikrosporid.Allergische Reaktion.
TrichophytieDurch Pilze der Gattung Tricho-phyton verursachte Mykose derHaut, Haare und Nägel.
TrichophytoseHeutzutage identisch mit Tricho-phytie.
TrichosporonHefepilzgattung mit Bildung vonBlastosporen und echtem Myzel,das in Arthrosporen zerfällt.
ubiquitärüberall vorkommend; jedoch nichtwörtlich zu nehmen; mehr im Sinnevon ,weit verbreitet" zu verstehen.
WelkePflanzenkrankheit, bei der dieBlätter vorzeitig welken und diePflanze abstirbt; durch verschie-denartige Pilze verursacht.
Wood-LichtDurch Schwarzfilter aus Kobalt-glas austretendes UV-Licht, in demHaare, die von bestimmten Mikro-sporum-Arten befallen sind, grün-lich fluoreszieren.
ZygomycetenPilzklasse, die durch die Bildungvon Zygosporen charakterisiert ist,das sind sexuelle Dauersporen. Indiese Klasse gehören u.a. Mucorund Rhizopus.
ZygomykoseErkrankung durch Zygomyzeten.
Zygosporen„Jochsporen", typische Sexual-sporen der Zygomyzeten.
34
Dermatophyten
Als Dermatophyten werden die Pilze derGattungen Trichophyton, Mikrosporum undEpidermophyton bezeichnet. Einige Autorenrechnen Keratinomyces hinzu. Es sind „Haut-pilze" im engeren Sinne. Sie befallen auchdie Hautanhangsgebilde Haare und Nägel.Man darf Dermatophyt und Hautpilz nichtgleichsetzen, da auch Hefen und Schimmel-pilze als „Hautpilze" vorkommen.Botanisch gehören die Dermatophyten, so-weit sie keine sexuellen Fruchtformen bil-den, zu den „Fadenpilzen" (Hyphomyzeten).Auch in diesem Falle ist die Gleichsetzungvon Dermatophyt und Fadenpilz fehl amPlatz, da die Schimmelpilze ebenfalls Fa-denpilze sind.Pilzfaden und Fadenpilz darf man ebenfallsnicht gleichsetzen, da die in Hautschuppen,am Haar und im Nagel nachweisbaren Pilz-fäden sogar von Hefen stammen können,die aber nicht zu den Hyphomyzeten gezähltwerden.Wesentliches Unterscheidungsmerkmal derDermatophytengattungen ist das Aussehender Makrokonidien: Bei Trichophyton undEpidermophyton sind sie glattwandig, beiMikrosporum rauhwandig.Trichophyton hatwalzenförmige Makrokonidien, Epidermo-phyton keulenförmige.Da nicht immer Makrokonidien gebildetwerden, müssen weitere Unterscheidungs-merkmale für die sichere Identifizierung derDermatophyten herangezogen werden, ins-besondere das Aussehen der Makrokulturauf speziellen Nährböden.
1. Trichophyton
Die Oberfläche der Kultur ist meist von sam-tigem, watteartigem oder wolligem Luftmy-zel bedeckt, selten ist sie gummiartig glatt;wenn große Mengen von Mikro- oder Ma-krokonidien gebildet werden, ist die Ober-fläche der Kultur fein- oder grobgranuliert,sandig, pulvrig oder gipsig. Außer den mit-unter üppig vorhandenen, meist aber nursehr spärlichen glattwandigen, walzenför-migen Makrokonidien werden oft große
Mengen rundlicher bis birnenförmiger 1-2-zelliger Mikrokonidien gebildet, je nach Artmehr entlang den Hyphen oder in Trauben-form. Gelegentlich kommen auch Über-gangsformen zwischen Makro- und Mikro-konidien vor.Die Pigmentierung istgelblich, rötlich, violett,bräunlich, gelegentlich grau oder bläulich.Am häufigsten ist die Pigmentierung sehrschwach oder fehlt ganz, insbesondere beiStämmen, die längere Zeit als Sammlungs-kulturen gehalten werden. WeißflaumigeKolonien können infolgedessen zu unter-schiedlichen Arten gehören.Die Unterseite der Kolonien kann verschie-den pigmentiert sein.Das perfekte Stadium der Trichophyton-Arten gehört zu den Askomyzeten, in dieOrdnung Eurotiales, Familie Gymnoasca-ceae, Gattung Arthroderma. Die Artbe-zeichnungen sind jeweils unterhalb der Na-men für das imperfekte Stadium in Klam-mern angegeben.
Arten
1. T. concentricum2. T. equinum3. T. erinacei4. T. gallinae5. T. georgiae
(A. ciferrii)6. T. gloriae
(A. gloriae)7. T. gourvilii8. T. megninii9. T. mentagrophytes
(A. benhamiae)10. T. quinckeanum11. T. rubrum
2. Mikrosporum
12. T. schoenleinii13. T. simii
(A. simii)14. T. soudanense15. T. terrestre
(A. quadrifidumA. lenticularumA. insingulare)
16. T. tonsurans17. T. vanbreuseghemii
(A. vanbreuseghemii)18. T. verrucosum19. T. violaceum20. T. yaoundei
Die Oberfläche der Kultur ist samtig, flaumigoder wollig infolge der Entwicklung von Luft-myzel. Am Luftmyzel entstehen die Mikro-konidien entlang den Hyphen oder in Hau-fen sowie die mehrfach septierten Makro-konidien. Die Anzahl der Septen (Quer-wände) beträgt bei M.nanum nur 1-2, beiden übrigen Arten meist 3-5-8, selten 10 odermehr.
36
Die Mikrokonidien sind rundlich bis birnen-förmig, gelegentlich auch länglich. Die Ma-krokonidien sind rauhwandig, spindelför-mig mit zugespitzten Enden oder ellipsoid.Die Oberseite der Kolonien ist meist weiß,gelblich, ockerfarben, bräunlich, pfirsich-farben, rötlich bis rostfarben oder gold-farben.Die Unterseite ist je nach Art unterschiedlichpigmentiert, meist gelblich bis rötlich oderbräunlich, zum Teil auch tiefrot.Das perfekte Stadium der Mikrosporum-Ar-ten wird ebenfalls in die Familie Gymnoas-caceae der Ordnung Eurotiales der Asko-myzeten eingeordnet, jedoch in die GattungNannizzia. Die Artnamen sind in Klammemangegeben.
Arten
1- M. amazonicum(N. borellii)
2. M. audouinii3. M. boullardii4. M. canis
(N. otae)5. M. cookei
(N. cajetanii)6. M. distortum7. M. ferrugineum8. M. fulvum
(N. fulva)
9. M. gypseum(N. incurvataN. gypsea)
10. M. langeroniiU .M. nanum
(N. obtusa)12. M. persicolor
(N. persicolor)13. M. racemosum
(N. racemosa)14. M. rivalieri15. M. vanbreuseghemii
(N. grubya)
3. Epidermophyton
Zwei Merkmale sind für diese Gattung be-sonders charakteristisch: Typisch sind diekeulenförmigen, glattwandigen, meist nurmit 2 oder 3 Septen versehenen Makroko-nidien, und von großem diagnostischen Wertist auch die Tatsache, daß niemals Mikro-konidien gebildet werden. Die Kulturober-fläche ist sehr zartflaumig, gelblich-grau-grünlich, gelegentlich erinnert sie an Wild-leder. Anfangs ist die Oberfläche flach, spä-ter entstehen hirnwindungsartige Furchen.Oft treten nach einigen Wochen weißeFlaumflöckchen auf, die allmählich größerwerden. Werden davon Subkulturen ange-fertigt, dann entstehen völlig weiße, flau-
mige Kolonien, an denen aber — im Gegen-satz zu Trichophytonarten — keine Mikro-konidien vorkommen.Die Unterseite ist farblos bis gelblich.Es gibt Stämme, die ein rötliches Pigmentbilden, das in den Nährboden diffundiert.Ein perfektes Stadium wurde bisher nichtbeschrieben.
Art
1. E. floccosum
4. Keratinomyces
Diese Gattung wird von einigen Autoren mitder Gattung Trichophyton zusammengelegt.Vanbreuseghem, der die Gattung 1952 neuaufgestellt hat, ist bei der Abgrenzung ge-blieben.Die Oberflächen der Kulturen sind sehr va-riabel, sowohl in ihrer Struktur wie auch inder Pigmentierung: flach, kraterförmig, er-haben, gefurcht, weiß, gelblich, rötlich,bräunlich, orange, auch mehrfarbig, Unter-seite farblos, gelblich bis bräunlich undgrauschwarz.Nach Vanbreuseghem werden keine Mikro-konidien, sondern nur sehr typische, mehr-fach septierte, glattwandige Makrokonidiengebildet.Das perfekte Stadium wird - wie bei Tricho-phyton - in die Gattung Arthroderma in dieFamilie Gymnoascaceae eingeordnet. Diesgilt als Argument, die Gattung Keratinomy-ces mit der Imperfektengattung Trichophy-ton zu vereinigen. Sollte bestätigt werden,daß bei Keratinomyces - im Gegensatz zurAuffassung von Vanbreuseghem - tatsäch-lich nicht nur Makrokonidien vorkommen,sondern auch Mikrokonidien, dann wäredies eine weitere Stütze für die Zusammen-legung.
Arten
1. Keratinomyces ajelloi(A. uncinatum)
2. Keratinomyces longifusus
37
Hefen
Hefen sind Pilze, Eumycota, die einerseitsdie Fähigkeit haben, sich durch Sprossungoder Teilung zu vermehren, andererseitsaber zum Teil imstande sind, nicht nur Pseu-domyzel, sondern auch echte, septierte, ve-getative Fäden zu bilden.Hefen sind hyaline Organismen oder solchemit rotem, orangefarbenem oder gelbemPigment.Nicht zu den Hefen zählen Pilze, die Sproß-zellen mit dunklem Pigment bilden, z.B. Au-reobasidium pullulans, auch nicht Pilze, dieals dimorph (oder biphasisch) bekannt sind,weil sie unter bestimmten Bedingungen he-feartig wachsen und Sproßzellen bilden,unter anderen Bedingungen aber als Schim-mel mit fruktifizierendem Luftmyzel, z.B.Ajellomyces (Blastomyces) dermatitidis oderHistoplasma capsulatum.
Ausdrücke wie „Hefen und Pilze", „Hefenoder Pilze", „Hefen und/oder Pilze" sind un-logisch, weil Hefen ja Pilze sind.
Einteilung der Hefen
Man unterscheidet perfekte und im perfekteHefen. Im perfekten Stadium werden Sexual-sporen gebildet (oft neben asexuellen Spo-ren), im imperfekten Stadium erfolgt die Ver-mehrung nur durch asexuelle Sporen.Sexualsporen sind entweder Askosporen,dann erfolgt die Einordnung bei den Asco-mycotina, oder es handelt sich um Basidio-sporen, dann stellt man diese Hefen zu denBasidiomycotina.Die imperfekten Hefen werden zu den Deu-teromycotina gestellt; sie können verwandt-schaftliche Beziehungen zu den perfektenHefen haben.
Klassifizierungssystem(nach N.J.W. Kreger-van Rij, 1984)
AscomycotinaHemiascomycetes
Endomycetales
BasidiomycotinaUstilaginales
Tremellales
DeuteromycotinaBlastomycetes
SpermophthoraceaeSaccharomycetaceae
FilobasidiaceaeTeliosporen bildende HefenSirobasidiaceaeTremellaceae
CryptococcaceaeSporobolomycetaceae
Basidiosporenbzw. Teliosporenbildende Hefen
Familie Gattung
Filobasidiaceae ChionosphaeraFilobasidiellaFilobasidium
Teliosporen bildende Hefen LeucosporidiumRhodosporidiumSporidiobolus
Sirobasidiaceae FibulobasidiumSirobasidium
Tremellaceae HoltermanniaTremella
38
Askosporenbildende Hefen
Familie/Unterfamilie Gattung
Spermophthoraceae
SaccharomycetaceaeSchizosaccharomycetoideae
Nadsonioideae
Lipomycetoideae
Saccharomycetoideae
CoccidiascusMetschnikowiaNematospora
Schizosaccharomyces
HanseniasporaNadsoniaSaccharomycodesWickerhamia
Lipomyces
AmbrosiozymaArthroascusCiteromycesClavisporaCyniclomycesDebaryomycesDekkeraGuilliermondellaHansenulaIssatchenkiaKluyveromycesLodderomycesPachysolenPachytichosporaPichiaSaccharomycesSaccharomycopsisSchwanniomycesSporopachydermiaStephanoascusTorulasporaWickerhamiellaWingeaZygosaccha romyces
Imperfekte Hefen Familie
Cryptococcaceae
Sporobolomycetaceae
Gattung
AciculoconidiumBrettanomycesCandidaCryptococcusKloeckeraMalasseziaOosporidiumPhaffiaRhodotorulaSarcinosporonSchizoblastosporionSterigmatomycesSympodiomycesTrichosporonTrigonopsis
BulleraSporobolomyces
39
HefedifferenzierungDie Bestimmung der Hefen nach Gattungund Art erfolgt aufgrund ihrer morphologi-schen und physiologischen Eigenschaften.
Makromorphologische Merkmale
Nur selten sind die Hefekolonien so charak-teristisch, daß Gattung und Art sofort er-kannt werden können.
Mikromorphologische Merkmale
Am besten werden diese Merkmale auf Reis-extrakt-Agar studiert. Alle Hefen müssen im-stande sein, auf zuckerhaltigen Nährme-dien Sproßzellen zu bilden (Abb. 44).Einige Hefen bilden auch Pseudomyzel(Abb. 45), das aus Sproßzellen besteht, dieaneinander hängen bleiben.
Die Reisagar-Platte
Ein Reisextrakt-Nährboden wird mit wenigHefematerial beimpft. Mehrere Deckgläserwerden aufgelegt, durch die nach etwa 24Stunden das Wachstum mikroskopisch be-urteilt wird. Wichtig ist, daß die Bebrütungder Reisagar-Platte (Abb. 46) nicht im Brut-schrank bei 37°C, sondern nur bei Zimmer-temperatur von etwa 20-25°C erfolgt.
Septiertes und unseptiertes Myzel
Im Gegensatz zum Pseudomyzel hat dasechte Myzel deutlich erkennbare, meistsenkrecht zur Fadenwand stehende Quer-wände (Abb. 47). Unseptiertes Myzel (Abb.48) hat keine solchen Querwände.
Askosporen
Perfekte Hefen weisen Sexualsporen auf,z.B. Askosporen (Abb. 49).
Assimilation
Geprüft wird die Assimilation von Stickstoff-verbindungen (Abb. 50) und Kohlenstoffver-bindungen (Abb. 51).
Fermentation
Das Gärungsvermögen der Hefen wird auf-grund der Vergärung verschiedener Zuckerbewertet (Abb. 52). Einzelheiten sind in derSpezialliteratur ausführlich beschrieben.
Abb. 44: Sproßzellen
Abb. 45: Pseudomyzel
Abb. 46: Beimpfte Reisagar-Platte
40
Abb. 47: Septiertes Myzel
Abb. 48: Unseptiertes Myzel
Abb. 50: Assimilation von Stickstoff. 1 = Pepton,2 = Kaliumnitrat
Abb. 51: Zuckerassimilation. 1 = Glukose, 2 = Ga-laktose, 3 = Saccharose, 4 = Maltose, 5 = Laktose
Abb. 49: Askosporen der BierhefeAbb. 52: Zuckervergärung. Von links: Glukose, Ga-laktose, Saccharose, Maltose, Laktose
41
Schimmelpilze
Unter Schimmelpilzen versteht man einegroße Anzahl von Pilzen, die imstande sind,unter geeigneten Bedingungen, mitunterquasi über Nacht, einen schimmeligen Über-zug auf einem Substrat zu bilden, in dem sichin großen Mengen meist asexuelle, bei eini-gen Arten aber auch sexuelle Fruchtformenentwickeln.Die Oberflächen der Kulturen sind samtig,flaumig, watteartig, wollig oder fädig. Esentstehen am Luftmyzel die unterschiedlich-sten Strukturen, an denen Gattung und Arterkennbar sind. Einige Arten bilden Mikro-und Makrokonidien, andere nur eine Sortevon Konidien, teils direkt an den Hyphen,teils an speziellen Fruchtständern.Eingeordnet in diese Gruppe sind auch dieErreger der Systemmykosen, die als bipha-sisch (oder dimorph) bekannt sind. In eini-gen Fällen sind die perfekten Stadien be-kannt, z.B. Ajellomyces dermatitidis — Bla-stomyces dermatitidis, Byssochlamys fulva— Paecilomyces varioti, Monosporium apio-spermum — Petriellidium boydii.
Schimmelbakterien
Nichtzu den Schimmelpilzen gehören schim-melig wachsende Bakterien, die wie PilzeLuftmyzel mit Konidien und zum Teil Sporan-gien bilden. Es sind vorwiegend Vertreterder Aktinomyzetengattung Streptomyces,die außerordentlich leicht mit Schimmel-pilzen verwechselt werden. Man müßtelogischerweise von „Schimmelbakterien"sprechen.Auch die Erreger der Aktinomykose und No-cardiose gehören — wie alle Strahlenpilze —zu den Bakterien.
Pilzallergie
Zahlreiche Schimmelpilze haben in der Hu-manmedizin Bedeutung als Erreger von al-lergischen Erscheinungen. Diese betreffenmeist die Haut und die Atmungsorgane. Ek-zem, Asthma und allergische Rhinitis könnenvon Pilzsporen in ähnlicher Weise ausgelöst
werden, wie dies von Gräser- und Getreide-pollen und Hausstaubmilben bekannt ist.
Die Isolierung und Identifizierung von Schim-melpilzen gewinnt auch aus diesem Grundezunehmend an Bedeutung.
Mykotoxine
Bis heute sind mehr als 100 verschiedeneSchimmelpilzgifte bekannt, die insgesamtals Mykotoxine bezeichnet werden. Beson-ders giftig ist Aflatoxin Bi aus Aspergillusflavus. Ein Teil der Mykotoxine wirkt in sub-toxischen Dosen krebserzeugend.Die Mykotoxine werden im allgemeinen andas Substrat abgegeben, in dem der Schim-melpilz wächst, z.B. in Erdnüssen. Die mei-sten Mykotoxine werden beim Kochen nichtzerstört, sondern erst ab 160°C.Schimmelpilze, die Speisepilze sind, z.B.Penicillium camemberti, werden staatlicher-seits auf Unschädlichkeit überprüft.
Im Untersuchungsmaterial kommen häufigSchimmelpilze vor, die zufällig auf Krank-heitserscheinungen gelangt sind. Dies be-rechtigt jedoch nicht zu der Auffassung,Schimmelpilze generell als harmlose Sapro-phyten einzustufen.
Von den folgenden Gattungen sind Arten mithumanpathogenen Fähigkeiten bekannt:
1. Absidia2. Anixiopsis3. Aspergillus4. Basidiobolus5. Blastomyces6. Cephalosporium7. Chrysosporium8. Cladosporium9. Coccidioides
10. Cunninghamella11. Curvularia12. Emmonsia13. Entomophthora14. Exophiala15. Fonsecaea16. Fusarium17. Geotrichum18. Hendersonula
19. Histoplasma20. Leptosphaeria21. Monosporium22. Mucor23. Mycocentrospora24. Paecilomyces25. Paracoccidioides26. Penicillium27. Peyronellaea28. Phialophora29. Piedraia30. Pyrenochaeta31. Rhinosporidium32. Rhizopus33. Scopulariopsis34. Sporothrix35. Verticillium
42
Trichophyton rubrumIn vielen Ländern der häufigste Dermatophyt, vor allem interdigital und in Nägeln.Die Kulturen wachsen zunächst reinweiß wie Watte und sind von seidigem Glanz. Manchmalerst nach Wochen wird das rötliche Pigment gebildet, auf der Rückseite der Kulturen be-ginnend und nur, wenn Zucker im Nährboden ist, nicht auf dem zuckerfreien Pepton-Agar,z.B. auf Sabouraud-3%-Pepton-Agar.
Abb. 53: Drei flaumige Kolonien mit nur schwach röt-lichem Rand auf Kimmig-Agar
Abb. 54: Typische Mikrokonidien, entlang den Hy-phen gewachsen, auch bei anderen Trichophyton-arten vorkommend
Abb. 55: Ringförmig dunkelrot pigmentierte Kolo-nien auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar
45
Abb. 56: Nicht pigmentierte Kolonien auf Sabou-raud-3%-Pepton-Agar
Trichophyton mentagrophytes
In zwei Varianten auftretender Dermatophyt: gipsig und flaumig, auch im Erdboden vorkom-mend, sowohl im asexuellen als auch im sexuellen Stadium. Bei Mensch und Tier weitver-breitet.
Abb: 57: Drei gipsige, d.h. üppig mit Konidien be-setzte Kolonien mit Anastomosen zwischen den Ko-lonien
Abb. 58: Zahlreiche typische, in Büscheln stehende,glattwandige Makrokonidien und dicke Haufen vonMikrokonidien
Abb. 59: Weißflaumige, aus einem Interdigitalraumisolierte Riesenkolonie
Abb. 60: Aus einer Erdprobe entstandene Koloniendes imperfekten (asexuellen) Stadiums und an einerStelle kugelige Cleistothecien des (perfekten) Sexual-stadiums (Arthroderma benhamiae)
46
Trichophyton tonsuransDieser klassische Dermatophyt war früher einer der Haupterreger der Kopftrichophytie. Dieursprünglich vier Arten (mit zahlreichen Synonymen) waren T.crateriforme, T. Sabouraudii,T.epilans und T.sulfureum. Heute werden sie nur noch als Variationen aufgefaßt. Bemerkens-wert ist, daß die Kulturen nicht pleomorph werden.
Abb. 61: Drei Crateriforme-Kulturen, die sich gegen-seitig im Wachstum hemmen, auf Kimmig-Agar
Abb. 62: Drei Sabouraudii-Kulturen, früher auch we-gen der zentralen Erhebungen „Acuminatum" ge-nannt, auf erdhaltigem Nährboden
Abb. 63: Epilans-Kultur, auch als „Cerebriforme" be-zeichnet, auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar
Abb. 64: Sulfureum-Kultur, auffällig durch die schwe-felgelbe Pigmentbildung, auf Sabouraud-2%-Glu-cose-Agar
47
Trichophyton schoenleinii
Erreger des Menschenfavus, in Nahost und Afrika noch weitverbreitet, wird in Europa wiedereingeschleppt.
Abb. 65: Sechs typische, cerebriforme Kolonien, ausKopfhaar isoliert
Abb. 66: oben: Mikroskopisches Bild eines Favus-Kronleuchters mit zwei Kugeln (Chlamydosporen)unten: Typische Hirschgeweihformen des Favusmy-zels im Scutulum
Trichophyton verrucosum
Erreger der „Rinderflechte", häufig aufMenschen übertragen.
Trichophyton concentricum
Erreger der Tinea imbricata, vorwiegend inOstasien beheimatet.
Abb. 67: Stark gewulstete, radiär gefurchte Reinkulturauf Kimmig-Agar
Abb. 68: Bernsteinfarbene, stark gefaltete Riesen-kolonie auf Kimmig-Agar, 60 Tage alt
48
Trichophyton violaceumEin sehr variabler Dermatophyt, im Mittelmeerraum und in Afrika sehr häufig, in Mitteleuropaseltener geworden.Subkulturen werden meist rasch pleomorph, d.h. es wird nur noch weißflaumiges Luftmyzelgebildet, so daß die Abgrenzung von anderen Dermatophyten oder sogar von weißflaumigenSchimmelpilzen sehr schwierig sein kann. Beim Anlegen von Subkulturen ist deshalb sehrdarauf zu achten, daß nur von violetten Stellen abgeimpft wird, und zwar vegetatives Myzelaus dem Agar, kein Luftmyzel.
Abb. 69: Sehr typische, violette Drillingskultur, Abb. 70: Stark kontrastierende Varianten: kompakt-6 Wochen alt, auf Pepton-Ägar violett und flaumig-weiß
Abb. 71: Rotviolette Reinkulturen, vom Kopf einesyemenitischen Kindes isoliert
49
Abb. 72: Mehrere Varianten von weiß bis violett inderselben Kultur auf Kimmig-Agar
Trichophyton soudanense
Zuerst in Zentralafrika entdeckter Dermato-phyt, aber auch in anderen Erdteilen vor-kommend, befällt Haut, Haare und Nägel.
Abb. 73: Besonders attraktive goldgelbe Kultur
Abb. 74: Mikroskopisches Bild einer Kultur auf Kim-mig-Agar. Typisch sind die gegenläufigen Hyphen,die besonders am Rand der Kolonien sehr ausge-prägt sind
Abb. 75: Mehrere Kolonien mit feinen, spitzen Rand-ausläufern. Die Variantenbildung beginnt. Mituntersind Varianten nur schwer von Trichophyton tonsu-rans zu unterscheiden
50
Trichophyton gallinae
Erreger des „Hühnerfavus", wird gelegentlich auf den Menschen übertragen
Abb. 76: Drillingskultur auf Kimmig-Agar. Das röt- Abb. 77: Glattwandige, mehrfach septierte Makro-liche Pigment diffundiert in den Agar konidien von Trichophyton gallinae
Trichophyton megninii
Ehemals Trichophyton rosaceum genannt,häufig in Barbierstuben übertragen
Trichophyton equinum
Erreger der „Scherflechte" bei Pferden, aufden Menschen übertragbar
Abb. 78: Rosa Kolonien, deren Pigment nicht in denAgar diffundiert
Abb. 79: Reinkultur auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar mit Entstehung einer dunkel pigmentierten Va-riante
51
Trichophyton terrestre
Im Erdboden weltweit verbreitet, von sehr geringer oder fehlender Pathogenität; kann zufälligmit Staub oder Erde auf die Haut gelangen.Beim Nachweis dieses Pilzes ist größte Zurückhaltung zu empfehlen bei Prüfung der Frage,ob es sich wirklich um den Erreger der Krankheitserscheinungen handelt, von denen der Pilzisoliert wurde. Es kann sich nämlich um eine ganz banale Verunreinigung mit erdehaltigemStaub handeln.
Abb. 80: Typische, anfangs flaumige, später infolgeüppiger Konidienbildung gipsige Kultur von sehr Abb. 81: Glattwandige, septierte Makrokonidien,charakteristischem würzigen Geruch 1- und 2 zellige Mikrokonidien und Zwischenformen
Abb. 82: Sexueller Fruchtkörper (Cleistothecium),mit gemshornförmigen Hyphen rundum, von Arthro-derma quadrifidum, einer der drei perfekten Formenvon Trichophyton terreste
Abb. 83: Aus einem Cleistothecium gewonnene Asko-sporen. Je 8 befinden sich in einem Askus, dessenWand durchsichtig ist
52
Keratinomyces (Trichophyton) ajelloi
Im Erdboden weltweit verbreitet. Äußerst variabler Dermatophyt von nur geringer Pathoge-nität bei Mensch und Tier.Diesen Pilz sollte man in jeder Pilzsammlung haben und ihn hinsichtlich seiner spontanenVariationen auf verschiedenen Nährböden oder sogar auf ein und demselben beobachten.Man bekommt dann ein gutes Gespür für die Schwierigkeiten, die richtige Pilzdiagnose zustellen, und die Notwendigkeit, Mykologie zu erlernen.
Abb. 84: Zartflaumige, im Zentrum pulvrig-sandigeKultur mit durchscheinendem rotvioletten Pigmentauf Sabouraud-2%-Glucose-Agar
Abb. 85: oben: Typische glattwandige, querseptierteMakrokonidienunten: Eine auskeimende Makrokonidie; die Hyphensind bereits septiert
Abb. 86: Sandige Kolonie mit Variantenbildung inzwei Sektoren der Peripherie
Abb. 87: Weißflaumige, sogenannte „pleomorphe"Variante ohne Konidienbildung
53
Mikrosporum audouiniiAnthropophiler Dermatophyt, früher gefürchteter Erreger der „Mikrosporie der Kinderköpfe",
heute in Europa selten geworden; in Afrika dagegen noch häufig.
Abb. 88: Primärkultur aus zwei Haarstümpfen einesSchulkindes mit Mikrosporie des behaarten Kopfes
Abb. 90: Sehr regelmäßig gewachsene, hellbräun-liche Reinkultur mit radiär gefurchtem Zentrum. Hell-bräunliche, manchmal auch mehr gelbliche Kulturenvon Mikrosporum canis sicher abzugrenzen, kann imEinzelfall sehr schwierig sein. Es wird sogar diskutiert,ob das früher so häufige Vorkommen von Mikro-sporum audouinii als Erreger der Mikrosporie derKinderköpfe die Wirklichkeit richtig widergespiegelthat. Die Diagnose wurde nämlich meistens aus denKrankheitserscheinungen abgeleitet, ohne daß Pilz-kulturen angelegt wurden
Abb. 89: oben: Typische langgestreckte, rauhwan-dige, septierte Makrokonidieunten: Etwas versteckt im Hyphengeflecht liegenderauhwandige Makrokonidie
Mikrosporum rivalieriIn Zentralafrika entdeckter anthropophiler
Erreger typischer Mikrosporie des behaar-
ten Kopfes; wird von einigen Autoren als
Variation von Mikrosporum audouinii auf-
gefaßt.
Abb. 91: Die abgebildete weißliche, radiär gefurchteReinkultur auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar ist 19Tage alt
54
Mikrosporum canis
In Europa heutzutage der häufigste Erreger von Mikrosporie des behaarten Kopfes und wei-terer Hautareale; oft von Tieren übertragen, besonders von Katzen, aber auch von Pferden,Löwen und Tigern.
Abb. 92: Typisches Mikrosporiehaar mit einer „Man-schette" aus unzähligen sehr kleinen Sporen in der„parasitären Phase" des Pilzes
Abb. 93: Zwei rauhwandige, spindelförmige, etwasbauchige, septierte Makrokonidien in der „sapro-phytären Phase" auf Nährboden
Abb. 94: Primärkultur aus pilzbefallenen Hautschup-pen und Haaren mit mehreren flaumigen, am Randegelb durchscheinenden Kolonien auf Kimmig-Agar
Abb. 95: Sandfarbene, fein granulierte Reinkultur,typisch für sehr üppige Makrokonidienbildung
55
Mikrosporum gypseum
Sehr rasch wachsender geophiler Dermatophyt mit üppiger Konidienbildung, deshalb fürwissenschaftliche Untersuchungen bevorzugt verwendet. Im Erdboden nesterweise weltweitverbreitet. Befällt, wenn auch relativ selten, Haut, Haare und Nägel.
Abb. 96: Von Mikrosporum gypseum befallenes Haar,bei dem die von Pilzfäden durchsetzte äußere Partiedes Haarschaftes mikromanipulatorisch freipräpa-riert wurde
Abb. 97: Spindelförmige Makrokonidien, meist sechs-kammrig, und einzellige Mikrokonidien aus einerKultur auf Kimmig-Agar
Abb. 98: Aus Pferdehaar isolierte, ockerfarbene, sehrsandige Reinkultur auf Kimmig-Agar
Abb. 99: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmeeiner typischen Makrokonidie mit Protuberanzen ander Zellwand
56
Mikrosporum fulvum
Ein geophiler Dermatophyt, der mit Mikro-sporum gypseum eng verwandt ist und voneinigen Autoren nicht davon abgegrenztwird, obwohl sich die perfekten Formendeutlich unterscheiden.
Abb. 100: Die Kultur auf Kimmig-Agar zeigt 10 Kolo-nien, die mit Haarködern aus Erdboden isoliertwurden
Mikrosporum cookei
Dieser geophile Dermatophyt wurde früherals „rote Variante" von Mikrosporum gyp-seum angesehen, die Makrokonidien undbesonders die perfekte Form unterscheidensich aber deutlich.
Abb. 101: Die Kultur auf Sabouraud-2%-Glucose-Agar zeigt ein ringförmig gebildetes rotes Pigment
Mikrosporum ferrugineum
Ein Mikrosporie-Erreger, der zeitweise alsTrichophyton ferrugineum bezeichnet wor-den war, bis erneut bewiesen wurde, daßrauhwandige Makrokonidien gebildet wer-den.
Abb. 102: Die Kolonien sind meist rostfarben (ferrugo= Rost), manchmal aber mehr gelblich oder auchgrünlich, die Oberfläche ist entweder gummiartigund glatt oder von weißem Flaum überzogen
57
Mikrosporum nanumEin im Erdboden vorkommender Dermatophyt, der ursprünglich als Zwergform von Mikro-sporum gypseum betrachtet wurde. Kommt als Erreger von Dermatomykosen bei Schweinenvor und wird gelegentlich auf den Menschen übertragen.
Abb. 103: Auf Kimmig-Agar ist die Kultur meist weiß-flaumig; wenn zahlreiche relativ kleine Makrokoni-dien gebildet werden, wird die Oberfläche hell sand-farben
Abb. 104: Auf Sabouraud-3%-Pepton-Agar sind dieKolonien radiär gefurcht, gelblich-grün mit weiß-flaumigem Zentrum
Mikrosporum distortumEin seltener Dermatophyt, der dadurch auffällt, daß die Makrokonidien mißgestaltet sind; sieweisen Verkrümmungen und Auswüchse auf.
Abb. 105: Die Kultur auf Kimmig-Agar ist unauffälligweißflaumig und kann mit anderen Arten verwechseltwerden
Abb. 106: Die mikroskopische Aufnahme vom Randeeiner Kolonie zeigt absonderliche bizarre Makroko-nidien
58
Epidermophyton floccosum
Einzige Art der Gattung Epidermophyton, häufiger Erreger von Inguinalmykosen, auch infeuchter Wäsche überlebend; bildet in der Kultur glattwandige keulenförmige Makrokonidien,aber niemals Mikrokonidien.
Abb. 107: Drei zartflaumige, grünliche Kolonien mitbeginnender Flöckchenbildung
Abb. 108: Ein Büschel glattwandiger, keulenförmigerMakrokonidien aus einer Mikrokultur
Abb. 109: Radiär gefurchte, im Zentrum cerebriformeReinkulturen ohne die sonst typische Flöckchenbil-dung
Abb. 110: Riesenkolonie, fast zur Hälfte weißflau-mig; rotes Pigment diffundiert in den Agar
59
Candida albicansDie beim Menschen am häufigsten angesiedelte imperfekte Hefe mit pathogenen Fähigkeiten,die unter bestimmten Bedingungen Krankheiten auslöst, die tödlichen Verlauf nehmen können.Auch bei einer ganzen Anzahl von Tieren vorkommend.
Abb. 111: Ausstrichkultur in einer Petrischale aufKimmig-Agar. {Glatte, cremige Kolonien ohne Aus-läufer
Abb. 112: Stuhlausstrich auf Kimmig-Agar mit großenKolonien von Candida albicans und kleinen vonEscherichia coli
Abb. 113: Pseudomyzel von Candida albicans inUrinsediment
Abb. 114: Mehrere Wochen alte Kultur, zum Teil mitausgeprägten Ausläufern aus Pseudomyzel undechtem Myzel rund um einzelne Kolonien
60
Candida albicanS (Fortsetzung)
Auf Spezialnährböden bildet Candida albicans charakteristische Strukturen, insbesondereMantelsporen (Chlamydosporen) mit doppelt konturierter Membran, sehr ähnlich denen vonCandida stellatoidea.
Abb. 116: Reisagarkultur mit typischen Chlamydo-Abb. 115: Riesenkultur mit üppiger Entwicklung von sporen am Pseudomyzel und zwischen den runden bisrandständigem Pseudomyzel und echtem Myzel kurzovalen Blastosporen
Candida stellatoideaSehr nahe Verwandte von Candida albicans, wird auch als Variante angesehen; bildet eben-falls Chlamydosporen, assimiliert aber — im Gegensatz zu Candida albicans — keine Sac-charose.
Abb. 117: Reinkultur auf Kimmig-Agar. Sehr feines Abb. 118: Reisagarkultur mit Blastosporen, Pseudo-Pseudomyzel ist deutlich erkennbar myzel und Chlamydosporen
61
Ccmdida tropicalis
Zweithäufigste Candidaart beim Menschen, bildet oft üppiges Pseudomyzel, aber keine Chla-mydosporen
Abb. 119: Ausstrichkultur mit feinen Fransen auf Kim- Abb. 120: Mikrokultur auf Reisagar zeigt Blastospo-mig-Agar ren und Pseudomyzel
Candida parapsilosis
Weitverbreitete Candidaart, kann Mykosen in der Haut, der Nagelplatte und auch Organmy-kosen verursachen
Abb. 121: Primärkulturen auf Schrägagar in Röhr-chen. Am Rande der Kolonien ist ein sehr feiner Fran- Abb. 122: Pseudomyzel mit Blastosporen auf Reis-sensaum erkennbar agar
62
Cryptococcus neoformans
Erreger der Cryptococcose, früher als „Eu-ropäische Blastomykose" bezeichnet, je-doch weltweit vorkommend; befällt vor al-lem das Zentralnervensystem.
Abb. 123: Braune Reinkultur auf Kimmig-Agar,schmierig glatt und glänzend
Abb. 124: Hellfeldpräparat der Sproßzellen (Blasto-sporen), aus Liquor cerebrospinalis isoliert
Abb. 125: Tuschepräparat mit Darstellung der Poly-saccharidkapseln um die Sproßzellen herum
63
Torulopsis glabrata(Candida glabrata)
Im Vaginalsekret und auch in der Mund-höhle vorkommende imperfekte Hefe, diekein Pseudomyzel bildet; kann unter be-stimmten Bedingungen Krankheitserschei-nungen auslösen.
Abb. 126: Dreierkultur, weißlich, glatt, cremeartig,aus Vaginalsekret isoliert, auf Kimmig-Agar
Abb. 127: Ausstrich auf Reisagar mit rundlichen biskurzovalen Sproßzellen (Blastosporen)
Torulopsis candida(Candida famata)
Eine in der Umgebung des Menschen häufigvorkommende imperfekte Hefe, die in derSystematik immer wieder anderswo einge-ordnet wird.
Abb. 128: Primärkulturen, aus einem Zwischenzehen-raum isoliert, auf Kimmig-Agar mit Zusatz von Peni-cillin und Streptomycinsulfat
64
Trichosporon cutaneum
Eine fadenbildende imperfekte Hefe, diegelegentlich Haut, Haar und Nägel befälltund auch in den Atemwegen vorkommenkann. Typisch ist die Bildung von Blasto-sporen und echtem Myzel, das in Arthro-sporen zerfällt.
Abb. 129: Haar mit Piedra-alba-Knötchen
Abb. 130: Reinkulturen auf Kimmig-Agar
Abb. 131: Mikrokultur auf Reisagar mit Blastosporenund Arthrosporen
65
Geotrichum candidum
Der häufigste, aus der Nahrung stammende, beim Menschen vorkommende Schimmelpilz, dersogenannte „Milchschimmel", in Sauermilch, Quark, Harzer Käse, Camembert-Käse usw. alsSäure- und Aromabildner wirksam. Sehr häufig im Stuhl, in der Mundhöhle, bei „Verschlucken"auch in den Atemwegen.
Abb. 132: Reinkultur mit feinem weißen Luftmyzelauf Kimmig-Agar, bei Temperatur von 20-25 C ge- Abb. 133: Typische in Gliederstücke (Arthrosporen)wachsen zerfallene Fäden (keine Sproßzellen!)
Penicillium camemberti
Der Schimmelpilz vom Camembert-Käseund ähnlichen Produkten, dient der Reifungund Aromabildung. Bei zu wenig oder feh-lender Magensäure bei Käseessern häufigim Stuhl nachzuweisen.
Penicillium roqueforti
Der Schimmelpilz vom Roquefort-Käse, vonGorgonzola, Danish Blue usw., sehr gewür-zig schmeckend.
Abb. 134: Weißflaumige, radiär gefurchte Reinkul-tur auf Kimmig-Agar
Abb. 135: Blaugrüne Reinkultur, von Blauschimmel-käse stammend, aus Stuhl isoliert
66
Penicillium expansum
Dieser weltweit verbreitete Pinselschimmel erzeugt einen Giftstoff, ein Mykotoxin,das Früchte,z.B. Zitronen, ungenießbar macht.
Abb. 136: Die Kultur auf Kimmig-Agar ist blaugrünund infolge üppiger Konidienbildung feingranuliert
Abb. 137: Ein für, Penicillium typischer „Pinsel" mitmehreren Konidienketten
Penicillium notatum
Ein grüner Schimmelpilz, der als erster Peni-cillinproduzent entdeckt wurde.
Penicillium griseofulvum
Diese Art erzeugt — außer einigen anderenArten — das antimyzetische AntibiotikumGriseofulvin.
Abb. 138: Sehr regelmäßig gewachsene Drillingskul-tur auf Kimmig-Agar
Abb. 139: Mehrere kompakte Kolonien auf Kimmig-Agar
67
Scopulariopsis brevicaulis
Erreger der Scopulariopsidose, vor allem der Fußnägel, die sich dadurch braun verfärben.Auch schon aus Leberabszessen isoliert. In der Natur weit verbreitet.
Abb. 140: Fein gezackte braune Kultur auf Sabou-raud-3%-Pepton-Agar
Abb. 141: Drei kurze Ketten mit rauhwandigen Ko-nidien am Luftmyzel einer Mikrokultur
Verticillium cinnabarinum
Bräunlicher Schimmelpilz, in der Natur vorwiegend an Pflanzen als Erreger von Welkekrank-heit vorkommend, gelangt mit dem Staub oder als Luftkeim auf Krankheitserscheinungen oderauf gesunde Haut, sehr selten humanpathogen.
Abb. 142: Typische, radiär gefurchte Reinkultur auf Abb. 143: Fruchtstand mit wirtelständigen Konidien-Kimmig-Agar trägem, daran rundliche Konidien
68
Cephalosporium acremonium
Erreger der Cephalosporiose der Haut und besonders der Nägel, auch bei Tieren vorkom-mend. Verwechselungsmöglichkeit mit Dermatophyten.
Abb. 144: Die Kultur auf Kimmig-Agar ist weißflau-mig, ähnlich den flaumigen Trichophyton-Kulturen
Abb. 145: Sehr typisch sind in der Mikrokultur die amEnde der Konidienträger stehenden Konidienköpf-chen
Chrysosporium pannorum
Gelegentlich als Erreger von oberflächlichen Dermatomykosen vorkommender Schimmelpilz,meist jedoch nur aus der Umgebung stammender Anflugkeim, wird sehr leicht mit Dermato-phyten verwechselt.
Abb. 146: Fünf weißflaumige Kolonien, die später,wenn die Konidien reif sind, eine gipsig aussehendeOberfläche aufweisen wie Trichophyton mentagro-phytes
Abb. 147: Mikrokonidien in Haufen, sehr leicht mitdenen von Trichophyton mentagrophytes zu ver-wechseln
69
Aspergillus fumigatus
Häufigster Erreger von Mykosen der Lunge, des Gehirns und weiterer Organe. In der Naturweitverbreitet, auch in Blumentopferde. . •
Abb. 148: Die Kultur auf Kimmig-Agar zeigt die typi-sche graugrüne Pigmentierung der Oberfläche. DiePeripherie ist noch weiß, da dort noch keine reifenKonidien gebildet sind
Abb. 149: Konidienköpfchen in einer Mikrokultur.Dicht aneinander liegende Konidienketten bedingensäulenförmige Strukturen
Aspergillus niger
Am häufigsten bei mykotisch infiziertem Gehörgangsekzem anzutreffen. Aber auch in derLunge, in Nägeln und bei Abwehrschwäche in verschiedenen Organen als Opportunist krank-heitserregend.
Abb. 150: Auf Kimmig-Agar sieht die Kultur sehr cha-rakteristisch aus. Das Myzel kann gelblich oder weißsein, die reifen Konidienköpfchen sind braunschwarz
Abb. 151: Aspergillus-niger-Köpfchen sehen aus wieStaubwedel. Die Konidienketten sind rundum ange-ordnet
70
Sporothrix schenckii
Erreger der Sporotrichose, wird von Pflanzen oder Holz auf den Menschen übertragen, befälltvorwiegend das Lymphsystem.
Abb. 152: Hellgraue, im Zentrum dunkler pigmen-tierte Reinkultur auf Kimmig-Agar bei Zimmertempe- Abb. 153: Mikrokultur mit ovalen bis zigarrenförmi-ratur von 20-25 C gewachsen gen Konidien am Luftmyzel
Fonsecaea pedrosoi
Auch als Phialophora pedrosoi bezeichnet. Erreger von Chromomykose, nicht nur in denTropen und Subtropen vorkommend; von Pflanzen auf den Menschen übertragen; z.B. durchDornen oder Holzsplitter.
Abb. 154: Aus Hautläsionen am Unterschenkel iso-lierte graue, flaumige Kolonien auf Kimmig-Agar
Abb. 155: Mikrokultur mit Büscheln von Konidien anKonidienträgern
71
Altemaria alternataSogenannter „Schwärzepilz", auf Pflanzen als Krankheitserreger weitverbreitet, ruft beimMenschen allergische Reaktionen hervor, z.B. allergische Rhinitis oder Asthma, in seltenenFällen auch Nagelmykose.
Abb. 156: Grauschwarze Kultur auf Kimmig-Agar
Abb. 157: Schematische Darstellung der mauerför-mig septierten, aneinanderhängenden Makrokoni-dien am Luftmyzel einer Mikrokultur
Cladosporium herbarumBesonders im Sommer weitverbreiteter Luftkeim, verursacht Schwarzfleckenkrankheit aufBohnen, Erbsen, Gurken und anderen Pflanzen, gelangt leicht als Anflugkeim in Untersu-chungsmaterial und erschwert die Auswertung.
Abb. 159: Schemazeichnung der sproßzellartigenAbb. 158: Grünschwarze Reinkultur auf Kimmig-Agar Konidienbildung am Luftmyzel
72
Mucor species
Mucorarten sind in der Natur überall zu finden, wo organische Substanz verrottet. Bei Immun-schwäche oder Stoffwechsel leiden, z.B. Diabetes mellitus, kann es zu lebensbedrohendenMykosen des Menschen kommen.
Abb. 160: Braunschwarze Kultur einer nicht näher be-stimmten Mucorart auf Kimmig-Agar
Abb. 161: Mikroskopische Aufnahme vom Randeeiner Mucorkultur mit geschlossenen runden Sporan-gien an Sporangiophoren
Abb. 162: Schematische Darstellung des nicht sep-tierten Luftmyzels mit Sporangien (Sporenbehälternbei Mucor species); zwei sind geplatzt und entleerenungeschlechtliche Sporangiosporen
Rhizopus nigricans
Naher Verwandter von Mucor, erkennbaran den wurzelartigen Rhizoiden.
Abb. 163: Schemazeichnung von Sporangien, Rhi-zoiden und Stolonen (Verbindungshyphen zwischenden Sporangien bildenden Strukturen) bei Rhizopusnigricans
73
Piedraia hortaeErreger der Piedra nigra. Am Haarschaft entstehen steinharte schwarze Knötchen, die der„Schwärzepilz" aus der Hornsubstanz des Haares bildet. Vorwiegend in feuchtheißen Ge-bieten anzutreffen. Bei Totalbefall des Haares wird Greisenhaar wieder schwarz.
Abb. 164: Typisches, schon etwasälteres schwarzes Piedra-Knöt-chen am Schaft eines Kopfhaares
Abb. 165: Noch verhältnismäßigjunges Knötchen am Haarschaft
Abb. 166: Geschwänzte Asko-sporen von Piedraia hortae ver-lassen gerade — nach Platzendes Askus — den Haarschaft
Abb. 167: Typische Kultur von Piedraia hortae aufKimmig-Agar
Abb. 168: Fußballähnlicher Sporenbehälter (Askus)mit 8 bananenförmigen Askosporen von Piedraiahortae
74
Trockennährböden
Art. Nr.
10456
10896
5414
10912
7315
8339
5438
5467
Produkt
Candida-Elektivagar nach NICKERSON
Dermatophyten-Selektivagar (DTM) nach TAPLIN
Pilzagar nach KIMMIG (Basis)
Reisextrakt-Agar
SABOURAUD-2% Glucose-Agar
SABOURAUD-2% Glucose-Bouillon
SABOURAUD-4% Glucose-Agar
Selektivagar für pathogene Pilze
Packungsgröße
100 g; 500 g
100 g; 500 g
100 g; 500 g
100 g; 500 g
100 g; 500 g; 5 kg
100 g; 500 g; 5 kg
100 g; 500 g; 5 kg
100 g; 500 g
Fertignährböden
Art. Nr.
10412
10422
10421
10424
10413
10415
Produkt
Merckoplate® Candida-Elektivagar nach NICKERSON
Merckoplate® Dermatophyten-Selektivagar (DTM) nach TAPLIN
Merckoplate® Pilzagar nach KIMMIG
Merckoplate® Reisextrakt-Agar
Merckoplate® SABOURAUD-2 % Glucose-Agar
Merckoplate® Selektivagar für pathogene Pilze
Packungsgröße
20 Petrischalen
20 Petrischalen
20 Petrischalen
20 Petrischalen
20 Petrischalen
20 Petrischalen
Reagenzien
Art. Nr.
3999
4001
15577
5033
366
6408
15525
995
8123
MERCK-Schuchardt822149
Produkt
Formaldehydlösung min. 37 % säurefrei
Formaldehydlösung min. 35 % reinst DAB 8
Immersionsöl nach DIN 58884
Kaliumhydroxid Plätzchen z.A.
Milchsäure etwa 90% reinst
Natriumchlorid Tabletten
RINGER-Tabletten
2-Propanol reinst, USP
Tetramethylammoniumhydroxid (10%ige Lösung)
Tetraethylammoniumhydroxid (20%ige Lösung in Wasser)
Packungsgröße
1L; 2,5 L; 32 kg
1L; 2,5 L; 32 kg
50 ml; 100 ml
500 g; l k g ; 5 kg
500 ml; 1 L
lOOTabletten; lOOOTabletten
100 Tabletten
1L; 2,5 L; 20 kg
50 ml; 250 ml
250 ml; 1 L
Färbereagenzien
Art. Nr.
11885
9216
13741
1287
15924
524
9033
15929
Produkt
Gram-color Färbetest
Grams Karbolgentianaviolettlösung
Lactophenolblaulösung
LÖFFLERs Methylenblaulösung
Nigrosin (wasserlöslich) Certistain®
Perjodsäure z.A.
Schiffs Reagenz
Thionin (Acetat) Certistain®
Packungsgröße
1 Pack
100 ml; 500 ml
100 ml
100 ml; 500 ml; 2,5 L
25 g
25 g; 100 g
500 ml
5 g ; 25g
* Vertrieb nur in der BR Deutschland
Für Auskünfte in der Bundesrepublik Deutschland: Tel. 06151 /722448
Diese Broschüre vermittelt einen Einstieg in die medizinische Mykologie. In einem allgemeinenTeil wird u. a. die Materialgewinnung, die Beobachtung, Beurteilung und mikroskopischeUntersuchung des Nativpräparates und der Kultur beschrieben. Die Systematik der Dermato-phyten, Hefen und Schimmelpilze (DHS) ist im speziellen Teil abgehandelt. Zum Schluß werdenin über 100, meist farbigen, Abbildungen die Kulturen und mikroskopischen Aufnahmen derwichtigsten Vertreter von Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilzen vorgestellt. Eine Abrundungerfährt die Broschüre durch ein umfassendes Glossarium.
E. Merck • Frankfurter Straße 250 • D-6100 Darmstadt 1 • Ttelefon (0 6151) 72 36 36
03-121005