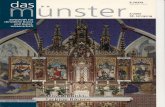Derks, T., 2014: Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern und verwandten ländlichen...
Transcript of Derks, T., 2014: Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern und verwandten ländlichen...
Römische Weihealtäre im Kontext
LIKIAS
veranstaltet durchdas Römisch-Germanische Museum der Stadt Kölnund die Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts
Internationale Tagung in Köln vom 3. bis zum 5. Dezember 2009„Weihealtäre in Tempeln und Heiligtümern“
herausgegeben von Alexandra W. Busch und Alfred Schäfer
Umschlag: Bildfeld eines Weihealtars oder einer Statuenbasis mit Opferszene; RGM Köln Inv. 670; Foto RBA Köln.
Bibliografi sche Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http: //dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-9817006-2-6
© 2014 Likias Verlag86316 Friedbergwww.likias.de
Redaktion: Alexandra W. Busch, Alfred SchäferSatz und Layout: Volker Babucke, Ursula Ibler
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten (Allgäu)
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Gedruckt mit Unterstützung
des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und der Archäologischen Gesellschaft Köln
Grußwort von Marcus Trier 9
Vorwort von Thomas Otten 10
Einführung von Alexandra W. Busch und Alfred Schäfer 13
Jörg Rüpke 19Rituelle Uniformität und individuelle Distinktion: Eine ritualtheoretische Perspektive auf Altarweihungen
John Scheid 27Opferaltar und Weihaltar in Rom und in Italien
Ulrike Egelhaaf-Gaiser 37Dicam Pistoris quid velit ara Iovis (Ov. fast. 6, 350): Historische und poetische Weihealtäre in Ovids Kalendergedicht
Günther Schörner 55Votivaltäre in Epidauros – ein antikes Zeichensystem zur Kategorisierung von Kultmonumenten
Christof Berns 67Weihealtäre aus dem Conventus Tarraconensis und die Kontexte ihrer Verwendung
Markus Scholz 79Grabaltäre in den nördlichen Grenzprovinzen des Imperium Romanum
William Van Andringa 107Espaces du sacrifi ce dans les lieux de culte publics de Pompéi
Gabrielle Kremer 121Silvanus und die Quadriviae in der Zivilstadt Carnuntum – ein Heiligtum und seine Weihedenkmäler
Friederike Naumann-Steckner 137Weihealtäre im römischen Köln
Gerhard Bauchhenß 155Die Weihaltäre aus Bonn
Inhalt
Thierry Luginbühl 179Autels, sacella et aires d’offrande dans la Civitas Helvetiorum Essai de sériation, comparaisons intra- et transculturelles
Ton Derks 199Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern und verwandte ländliche Tempelbezirke in Niedergermanien
Barbara Stark 221Das Heiligtum auf dem Yalak Başı in LykienBeobachtungen zum Phänomen der Massierung von Votivaltären in ländlichen Heiligtümern Kleinasiens
Thomas G. Schattner – José Suárez Otero – Michael Koch 249Weihaltäre im Heiligtum des deus lar Berobreus auf dem Monte do Facho (O Hío, Galicien)
Carmen Ciongradi 269Alburnus Maior und die Weihealtäre
Dirk Schmitz 281Weihebezirke an Wegekreuzungen? Inschriften zu den Wegegöttinnen und archäologischer Befund: das Fallbeispiel Nieder- und Obergermanien
Richard Neudecker 303Kult, Geld und Votive bei den Augustalen
Alexandra W. Busch 317Religiöse Orte und Weihungen des stadtrömischen Militärs
Oliver Stoll 335Genius, Minerva und Fortuna im Kontext. Gruppenbezogene Weihepraxis von Armeeangehörigen am Obergermanisch-Rätischen Limes
Rudolf Haensch 369Altäre von Armeeangehörigen aus Kleinasien
Jonathan C. N. Coulston 381The Maryport Roman altars revisited
Inhalt
Alfred Schäfer 397Weihealtäre in Statthaltersitzen und Benefi ziarierheiligtümern
Bernd Steidl 413Der Weihebezirk der Benefi ziarierstation von Obernburg am Main
Ute Verstegen 433Weihedenkmäler aus St. Gereon zu Köln – Spätantike Baustoffwiederverwertung als Ressourceneffi zienz oder symbolischer Traditionsbruch?
199
Einleitung
Ende des Jahres 1646 tobte ein wüster Sturm an der Küste Seelands, dessen zu großen Höhen auf-getriebenen Meereswellen einen Teil der Dünen von Domburg fortspülten. Kurz danach, am 5. Januar 1647, legte ein weiterer Sturm „die Fun-damente eines kleinen Häuschens“ sowie „einige große weiße Quadersteine“ frei, worauf „mit gro-ßen römischen Buchstaben“ Inschriften gemei-ßelt waren. Sie zeugen von dem römischen Gott Neptun und einer bis dahin unbekannten Göttin namens Nehalennia. Knapp eine Woche später wurde der sensationelle Fund in einem in Ams-terdam gedruckten Brief unter dem Titel Ausseror-dentliche antike Entdeckungen gefunden am Meeres-strand von Domburg bekanntgemacht1.
Mehr als 300 Jahre später, am 14. April 1970, holte die Besatzung der Tholen 6 einen Aufsehen erregenden Fang aus dem Meer. Verstrickt in den Netzen des Fischkutters wurden von einem Sand-riff in der Oosterschelde Teile von zwei Altären eines weiteren Nehalennia-Heiligtums geborgen2. In den nächsten Jahren sollten mit in der Archäo-logie ganz unkonventionellen Methoden einige Hundert Steinmonumente, mehr oder weniger komplett, aufgefi scht werden. Ein Sturm und der zufällige Fang eines Fischkutters setzten so-mit Seeland, das bislang nicht mit einem reichen römischen Erbe gesegnet war, endgültig auf die archäologische Karte der Niederlande. Domburg und Colijnsplaat erlangten in archäologischen und althistorischen Kreisen internationalen Ruf.
Fragen zur Überlieferungssituation
Für die Provinz Niedergermanien bieten die bei-den Nehalennia-Heiligtümer, und insbesondere dasjenige von Colijnsplaat, mit einer großen Zahl für dieselbe Göttin gesetzter Steinvotive, ausge-zeichnete Fallbeispiele für die Fragestellung des Kolloquiums, die auf eine Erschließung der Hand-lungsmuster im Kontext einer massierten Aufstel-lung von Weihealtären zielt. Zum einen verfügen wir seit einigen Jahren zu beiden Heiligtümern über grundlegende Materialvorlagen, auf die wir
zurückgreifen können3. Zum anderen können nur wenige Weihebezirke auf dem Territorium der niedergermanischen Provinz zahlenmäßig mit den Denkmälern aus den Nehalennia-Heilig-tümern konkurrieren. Für die Provinzhauptstadt Köln sind zwar viele Weihealtäre dokumentiert, aber vergleichbare große Gruppen einer einzel-nen Gottheit geweihter Votivsteine fehlen4. Das beste Vergleichsmaterial bieten die Matronenhei-ligtümer von Pesch, Bonn und Morken-Harff5. Methodisch wichtig ist die Feststellung, dass die hohe Zahl der aus diesen Heiligtümern geborge-nen Weihesteine kein direktes Indiz für die Be-liebtheit der hier verehrten Gottheiten sein kann, sondern vielmehr den an Ort und Stelle vorgefun-denen besonderen Fundkontexten zuzuschreiben ist. Wo immer ein umfassendes Fundensemble von Weihealtären gleichzeitig in einem Sekundär-kontext verschwand, ob dies nun geschah durch anthropogene Faktoren wie Spolienverwendung in Fundamenten und Mauerwerk spätantiker oder mittelalterlicher Steinbauten (so Pesch bzw. Bonn), oder durch natürliche Faktoren wie Über-schwemmung (Morken-Harff), Erosion (Colijns-plaat) oder Überdeckung durch Flugsand oder Dünen (Domburg), da gibt es auch die Chance ei-ner Wiederentdeckung desselben umfangreichen Ensembles. Für die archäologische Auswertung ergibt sich jeweils eine neue Fundstelle auf der
1 In diesem Aufsatz werden folgende Abkürzungen verwen-det: H mit Folgenummer verweist auf den Katalog in Hon-
dius-Crone 1955; A, B, C, D mit Folgenummern verweist auf die Katalog-Einträge in Stuart/Bogaers 2001; IKÖLN2
auf Galsterer/Galsterer 2010. Die Zitate gehen auf mei-ne Übersetzungen zurück. Zum niederländischen Origi-naltext des Briefes: Hondius-Crone 1955, 6. Auch in den Jahren nach 1647 kamen vereinzelt noch Votive zum Vor-schein. So wurden die beiden Victoriastatuen (H28, H29) erst 1711 (dazu Stuart 1973, 377, Anm. 6) und 1718 auf dem Strand gefunden. 1870 kam ein Altar (H26) in den Dünen von Domburg zum Vorschein. Der jüngste Fund aus Dom-burg (H11) stammt aus dem Jahr 1935 und wurde von einem Domburger Fischer aus dem Meer geborgen.
2 Die ersten zwei Zufallsfunde waren Bruchstücke der Altäre, die wir heute als A1 und A14 kennen.
3 Hondius-Crone 1955; Stuart/Bogaers 2001; dazu Raep-
saet-Charlier 2003. 4 Vgl. jetzt IKÖLN². 5 Lehner 1919; Lehner 1930; Kolbe 1960.
Ton Derks
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern und verwandten ländlichen Tempelbezirken in Niedergermanien
200
Ton Derks
Verbreitungskarte der Weihemonumente (Abb. 1). Die Eintragungen in der Verbreitungskarte der Votivdenkmäler werden wesentlich vom nach-römischen Schicksal der Heiligtümer bestimmt.
Wie vollständig ein Fundensemble überliefert ist, hängt u. a. davon ab, wie lange die Denkmä-ler, nachdem sie durch das Ende der römischen Weihepraxis ihre religiöse Bedeutung verloren hatten, noch in situ standen. Denn je länger Be-standteile des einstigen Ensembles an Ort und Stelle verfügbar waren, umso wahrscheinlicher waren Vorgänge der Verstreuung, Fragmentie-rung und Verwitterung. Im Falle des Nehalennia-Heiligtums bei Colijnsplaat wurden Tempel und Weihebezirk schon am Ende des dritten oder im vierten Jahrhundert von den Wellen der Ooster-schelde verschlungen und die Weihedenkmäler damit vor Verstreuung und Vernichtung ge-schützt. Das Heiligtum von Domburg hingegen verschwand erst im elften Jahrhundert unter den sich langsam landeinwärts zurückziehenden Dü-nen6. Damit waren die Domburger Weihemo-numente nicht nur erheblich längere Zeit der
Verwitterung ausgesetzt, eine beträchtliche Zahl muss in der Zwischenzeit auch aus der einstigen Kultstätte verschleppt worden sein. Letzteres lässt sich überzeugend an der ganz unterschiedlichen Verteilung der Denkmalformen der aus den bei-den Heiligtümern überlieferten Weihegeschenke feststellen: Altäre vom Grundtypus wurden auf-grund ihrer schlichten Form bevorzugt als Spo-lien verwendet und sind deshalb im Domburger Material signifi kant unterrepräsentiert (vgl. unten mit Abb. 11).
Für die Steindenkmäler des Domburger Hei-ligtums nahm die allmähliche Aufl ösung des Bestandes auch nach der Bergung am Strand im Jahre 1647 noch kein Ende. Denn die örtliche Kir-che, in der die Funde seit ihrer Wiederentdeckung aufbewahrt wurden, wurde 1848 von einem Blitz-schlag getroffen und brannte ab. Mit Ausnahme von vier Altären, die damals ausgelagert waren und somit verschont blieben, wurden die restli-chen Denkmäler weitestgehend zerstört. Heute sind wir daher auf vor dem Brand angefertigte Sti-che und Zeichnungen der Monumente angewie-
1 Verbreitungskarte der Weihaltäre im niederlän-dischen Teil der Germania inferior.
1 Valkenburg; 2 Room-burg; 3 Alphen a/d Rijn; 4 Woerden; 5 Vechten; 6 Herwen; 7 Nijmegen-castra (einschließlich der Altäre aus Holdeurn); 8 Voorburg-Forum Hadria-ni; 9 Den Haag-Uithofs-laan; 10 Houten; 11 Buren; 12 Kapel-Avezaath; 13 Tiel-Passewaaij; 14 Tiel-Zenne-wijnen; 15 Betuwe (genaue Fundstelle unbekannt); 16 Elst; 17 Nijmegen-Ulpia Noviomagus; 18 Westka-pelle; 19 Domburg; 20 Colijnsplaat; 21 Zun-dert; 22 Sint-Michielsges-tel-Ruimel; 23 Empel, 24 Alem; 25 Lith; 26 Wijchen-Tienakker; 27 Lommersum; 28 Roer-mond; 29 Sint-Odiliën-berg; 30 Maastricht.
201
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
sen7. Aufgrund dieser Überlieferungslage werde ich mich vor allem mit den Funden aus Colijns-plaat befassen und die Domburger Altäre nur dort heranziehen, wo sie uns erlauben, das gewonnene Bild zu ergänzen oder zu korrigieren.
Falls die Zahl der überlieferten Altäre des Hei-ligtums von Colijnsplaat einigermaßen die an-tiken Verhältnisse widerspiegeln sollte, so stellt sich die Frage, wie die zahlenmäßig geringere Überlieferung von Weihealtären in anderen Sa-kralbezirken Niedergermaniens zu bewerten ist. Ist anzunehmen, dass sich die Weihealtäre einst auch dort in großer Anzahl massenhaft aneinan-der reihten? Oder ist vielmehr davon auszugehen, dass die antike Votivpraxis in diesen Heiligtümern weniger ausgeprägt war? Wichtig ist die Feststel-lung, dass es im westlichen Niedergermanien keine natürlichen Steinvorkommen gibt. Daher musste der Werkstein für jeden Altar aus weit ent-fernten Steinbrüchen herantransportiert werden8. Der damit verbundene größere Aufwand wird si-cher zur Folge gehabt haben, dass im Vergleich zu dem „steinreichen“, südöstlichen Teil der Pro-vinz in dem „steinarmen“, westlichen Teil sich im Durchschnitt weniger Dedikanten die dort relativ teureren Steinvotive leisten konnten, so dass hier generell von einer geringeren Funddichte auszu-gehen ist9. Die Nehalennia-Heiligtümer, die beide an einem Wasserweg angebunden waren, dürften in diesem Teil der Provinz eine positive Ausnah-me gewesen sein. Letzteres lässt sich methodisch am besten anhand des Anteils der militärischen Weihungen darlegen.
Da die römische Weihepraxis, Altäre zu stiften, besonders in Kreisen des Militärs stark verbreitet war, würde man in einer Grenzprovinz wie Nie-dergermanien im unmittelbaren Umfeld der Mili-tärlager eine Fundkonzentration von Altarsteinen erwarten, vor allem von offi ziellen, von Komman-deuren oder Offi zieren im Namen der Einheit oder Abteilung gesetzten Kollektivweihungen10. Aber aus dem Gebiet westlich von Nimwegen gibt es aus den Garnisonsorten, Vechten ausge-nommen, zumeist nur Einzelfunde (so Woerden, Alphen a/d Rijn, Roomburg und Valkenburg). Obwohl gerade wegen des Fehlens natürlicher
Steinvorkommen die nachantike Ausbeutung hier tiefgreifender und systematischer gewesen sein könnte als in steinreicheren Grenzzonen, lässt sich die geringere Überlieferung im Kontext der niedergermanischen Kastelle trotz der hohen Grabungsintensität schwerlich ganz dem nachan-tiken Steinraub zuschreiben. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass hier nie dieselbe Dichte von Wei-hedenkmälern vorlag, wie sie z. B. für Britannien oder Obergermanien charakteristisch ist11.
Bestätigt wird diese Vermutung durch die Tat-sache, dass selbst auf dem Lande kaum von akti-ven Soldaten oder Veteranen gesetzte Altarsteine bezeugt sind. Exemplarisch für diese Fundsitua-tion könnte das Herkules-Heiligtum von Empel sein, wo zwar zahlreiche Funde von militärischen Ausrüstungsgegenständen und Pferdegeschirr die rege Opfertätigkeit von Veteranen der römi-schen Armee belegen12, aber nur ein Fragment eines Altarsteins gefunden wurde, wenn das win-
6 Für Colijnsplaat, Louwe Kooijmans 1971, bes. 19–21; für Domburg, Stuart/Bogaers 2001, 43 f.
7 Die auf den Umschlägen der beiden Kernpublikationen zu den Nehalennia-Heiligtümern (Hondius-Crone 1955; Stuart/Bogaers 2001) reproduzierten Weihesteine illust-rieren treffl ich die unterschiedliche konservatorische Lage der beiden Denkmalgruppen. Zur Museumsfunktion der Domburger Kirche: Stuart 1973.
8 Für die Steinaltäre von Colijnsplaat wurde überwiegend (etwa 82%) weißer Kalkstein aus Lothringen, daneben grauer Sandstein aus Nievelstein, schwarzer Kohlenkalk aus dem Mittelmaasgebiet sowie vereinzelt auch Basalt und Tuffstein aus dem Rheinland verwendet. Stuart/Bogaers 2001, 17–18.
9 Neben dem hier kartierten niederländischen Teil der Pro-vinz Niedergermanien gilt diese geringere Funddichte sicher auch für den benachbarten Xantener Raum. Vgl. Schalles 2006, 85; Bridger 2006, 140.
10 Vgl. z. B. die Verbreitung von Weihealtären mit Inschrift in Britannia bei Biró 1975, Karten 2 und 10; Millett 1995, Abb. 2. Die zahlreichen, mehrheitlich von Offi zieren gesetz-ten Altäre, die im Umfeld der Kastelle an der hadrianischen Mauer zutage kamen, sind nach Coulston 1988, xvii fast ausnahmslos aus lokalem Steinmaterial angefertigt. Auch das Steinmaterial der Monumente am Obergermanisch-Rätischen Limes kam zumeist aus nahegelegenen Brüchen; dazu zuletzt Noelke 2006, 104.
11 Wenn hier mit Stuck überzogene, hölzerne Altäre als Ersatz für steinerne Votive gedient haben dürften (so Eck 1998, 205–207) wird man m. E. damit die zahlenmäßige Lücke nicht schließen können.
12 Roymans/Derks 1990; Roymans/Derks 1993.
202
Ton Derks
zige Stück überhaupt richtig zugeordnet ist (Abb. 2)13. Mehr oder weniger dieselbe Aussage ist für das große Heiligtum von Elst zu treffen. Während der Ausgrabungen in der kriegszerstörten Kirche ist nur ein einzelnes Inschriftenfragment mit zwei Buchstaben geborgen worden, das wohl einem Al-tarstein zugeschrieben werden kann14. Unter den Spolien aus einer benachbarten einheimischen Siedlung fi ndet sich, neben einem wohl von dem Tempel stammenden Architravblock, ein weiteres Altarfragment, das im Hinblick auf seine Größe (mehr als 1 m hoch) und Fundstelle (nur etwa 600 m vom Heiligtum entfernt) am ehesten aus dem Heiligtum unter der Kirche stammt. Nach den beiden Anfangsbuchstaben war es wohl dem Herkules gewidmet (Abb. 3)15. Bezeichnend dürfte auch sein, dass für die Fundamente der ältesten, aus dem achten Jahrhundert datierenden, christli-chen Kirche, die aus Spolien des römischen Tem-pels errichtet wurden, soweit erkennbar, nicht der für Altäre übliche Kalkstein, sondern ausschließ-lich Grauwacke verwendet wurde.
Festzuhalten ist, dass die weitaus größte Men-ge der auf niederländischem Boden gefundenen Altarsteine Nehalennia geweiht waren. Daneben liegen für eine Reihe anderer Gottheiten meist nur Einzelexemplare vor, wobei, mit der Ausnah-me von Vechten, auffallend wenige Altarsteine aus den Militärstationen stammen.
Formen der Votivmonumente: die Weihealtäre
Wie andernorts ist auch in Domburg und Colijns-plaat der Altar die bevorzugte Form des Weihe-denkmals. Bezug nehmend auf den Opferaltar, an dem der Dedikant der Gottheit seine geschuldete Opfergaben darbrachte, wurde die Ara in der rö-mischen Votivpraxis generell zur privilegierten Denkmalform, mit der die Erfüllung eines Gelüb-des der Gottheit gegenüber dauerhaft festgehal-ten und die Weihegabe für immer mit der Person des Opfernden identifi ziert werden konnte16. Der Weihealtar, der vereinzelt in der Inschrift auch tatsächlich als ara bezeichnet wird17 – eine Explizi-tierung, die aus Platzgründen gewöhnlich unter-
lassen wurde –, wurde zum normativen Medium, mit dem man die Wirkungsmacht der Gottheit und die Pfl ichterfüllung des Stiftenden zu vermit-teln suchte.
Neben der Grundform des Altars sind für die Provinzen des Römischen Reiches regionale Ne-benformen charakteristisch, für welche eine all-mählich reichere Ausgestaltung der Form und Dekoration überliefert sind. Diese neuen Denk-malformen änderten nichts an der funktionalen Bedeutung des Steinvotivs als dauerhaftes Kom-munikationsmedium der Erfüllung einer religi-ösen Pfl icht. Die neuen Denkmalformen eröff-neten den Stiftern jedoch die Möglichkeit, den Weihestein auch als Mittel der sozialen Selbst-darstellung einzusetzen. In der differenzierten Gestaltung, Wahl des Gesteinsmaterials, Deko-ration, Größe, usw. werden also keine religiösen Unterschiede widergespiegelt, sondern es kommt darin vor allem ein außerrituelles, kompetitives Verhalten der Stifter zum Ausdruck18. Um diesen sozialen Sachverhalt im Rahmen der Nehalennia-Heiligtümer zu verstehen, werde ich zunächst die Formenvielfalt der in diesen Heiligtümern gestif-teten Weihedenkmäler beschreiben. Darauf sol-len die Beweggründe der Aufstellung untersucht und schließlich die den Dedikanten zur Verfü-gung stehenden Handlungsalternativen erörtert werden.
2 Empel, Herkulesheilig-tum. Rechte obere Ecke eines bei den Ausgra-bungen 1989–1991 geborgenen Altarsteines aus weißem Kalkstein (Fundnr. V 784).
203
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
Nach der Formgestaltung kann man das Corpus der für Nehalennia errichteten Weihealtäre in drei Hauptgruppen untergliedern. Die erste Gruppe umfasst die Denkmäler, die die Grundform des Altars beibehalten haben. Gekennzeichnet wird ihr Aufbau durch eine Basis, einen Schaft, ein Ge-sims mit fl acher Abstellfl äche (mensa) oder durch zwei seitliche Pulvini, zwischen denen sich eine Opferschale oder ein Focus befi ndet, so dass der betreffende Altar völlig funktionsfähig ist. Die-se Altäre werden sowohl als Kulteinrichtung, als auch als Denkmal gedient haben.
Während die Grundform des Altars in einigen niedergermanischen Heiligtümern (wie z. B. die beiden Matronenheiligtümer von Morken-Harff) die Norm gewesen sein dürfte (vgl. Abb. 11)19, so überwiegen in den beiden Nehalennia-Heiligtü-mern doch eher die üppigeren Formen20. In Co-lijnsplaat ist der schlichte Weihealtar vor allem be-legt in einer Gruppe von weitestgehend uniform gestalteten Altären aus Kohlenkalk (Abb. 4)21. Die Nebenseiten dieser Altäre sind unverziert, der Schaft ist schmal und die Oberseite zeigt entweder eine Opferschale oder eine fl ache Abstellfl äche. Für alle anderen in den Nehalennia-Heiligtümern vertretenen Altartypen gilt, dass sie nicht länger das „infrastrukturnahe“ Objekt des funktionalen Altares duplizieren, sondern abgeänderte Formen
des Grundtypus darstellen, die den Denkmalcha-rakter des Weihealtars in den Vordergrund rü-cken und letztendlich die praktische Verwendung als „echten“ Altar ausschließen. Nach formalen
13 Da während der Flurbereinigung in den frühen fünfziger Jahren des 20. Jhs. etwa 2 m des natürlichen Oberbodens abgetragen worden sind, ist in diesem Fall nicht ganz aus-zuschließen, dass Altäre undokumentiert verloren gegan-gen sind. Bei der archäologischen Begleitung von Baumaß-nahmen an der Autobahn A2 wurde ein Fragment einer Bronzeinschrift gefunden: Van Renswoude 2010, 22–23, Abb. 8. 4 (Inv. Nr. V3.77).
14 Bogaers 1955, Taf. 41 Abb. 43. 15 Die seit der Veröffentlichung der Ausgrabungsergebnisse
geäußerte Vermutung, dass auch das Elster Heiligtum dem Herkules geweiht war (Bogaers 1955, 173), wird durch die-se Deutung und aufgrund des Neufunds einer bronzenen Herkuleskeule endgültig bestätigt; Derks 2008, 138 f. mit Taf. 5G.
16 s. Derks 1998, 231; Busch/Schäfer in der Einleitung zu diesem Band.
17 B 37, B 47, B 48; vgl auch Abb. 5. 18 s. Derks 1998, 231–234; Busch/Schäfer in der Einleitung
zu diesem Band.19 Kolbe 1960. 20 Vgl. für Domburg die oben aufgeführten methodischen Be-
merkungen. 21 B47, B48, B50, B51 und die Fragmente B79–84 sowie
B106–111. Zu dieser Gruppe, Stuart/Bogaers 2001, 47. Während mit einer Ausnahme (D4) alle Steindenkmäler aus Kohlenkalk diesem Typus angehören, fi nden sich nur wenige Beispiele aus anderem Gesteinsmaterial: drei aus Kalkstein (B38, B44 und B45), eins aus Sandstein (B40) und eins aus Basalt (B49).
3 Elst-Brienenshof. Rekonstruktionszeich-nung eines Weihaltares mit der erhaltenen linken oberen Ecke mit den Anfangsbuchstaben einer Votivinschrift (links) und Foto des erhaltenen Fragmentes (rechts). Gefunden in sekundärem Kontext in der ländlichen Siedlung am Brienenshof weniger als 600 m vom Heiligtum unter der Kirche entfernt.
204
Ton Derks
4 Colijnsplaat, Nehalenniaheiligtum. Vorder- und Oberseite eines Altares der Grundform (B48).
Gesichtspunkten sind diese entwickelten Formen des Weihealtars in zwei Gruppen zu unterteilen, welche unsere zweite und dritte Hauptgruppe bil-den.
Die zweite Hauptgruppe umfasst all diejenigen Denkmäler, die in gewissem Maße die Grund-form des Weihealtars beibehalten, aber auf dem Schaft Dekorierungen aufweisen, die nichts mehr mit der Funktion des Altars zu tun haben. Sie stellen somit eine erste Stufe in der Entwicklung des funktionalen Weihaltars zum symbolischen Weihedenkmal dar. Außerhalb Niedergermani-ens begegnet man auf Vorder- oder Nebenseite der Altäre oft Darstellungen von Opfergerät wie
Omphalosschale, Kanne und Griffschale, so-wie Messer, die auf das Weinopfer, die dem Akt des Opferns vorangehenden rituellen Handwa-schungen und das Blutopfer verweisen22. Solche direkten Verweise auf eine Opfertätigkeit fehlen auf den Nehalennia-Votiven gänzlich23. Auf den Nebenseiten begegnen wir hier vor allem Füllhör-nern und Bäumen, wobei letztere nach ihren oft noch erkennbaren kugelförmigen Beeren wohl als Lorbeerbäume anzusprechen sind. Diese in der römischen Ikonografi e geläufi gen Sinnbilder des augusteischen Sieges sind vor allem als Metapher des daraus resultierenden Wohlstandes aufzufas-sen, den der Stifter, nach dem räumlichen Kontext des Aufstellungsortes zu urteilen, wenigstens teil-weise der göttlichen Hilfe zu verdanken wusste24.
Zu der zweiten Hauptgruppe rechnen wir fer-ner die Aedikula-Altäre, die nach der von Peter Noelke in seiner für die germanischen Provinzen erarbeiteten Typologie dem Typ D angehören25. Kennzeichnend für diesen Typ ist, dass die für die Gattung namengebende architektonische Rah-mung die gesamte Höhe und Breite des Altarkör-pers umfasst, der Schaft aber sonst intakt gelassen wurde. Bei Aedikula-Altären vom Typ D fungier-te die Aedikula vor allem als dekorative Umrah-mung des Inschriftfeldes. Wir kennen die Form nur zweimal aus Colijnsplaat26, hingegen nicht aus Domburg27.
Die dritte Hauptgruppe wird durch eine we-sentlichere Abänderung des Grundtypus gekenn-zeichnet. Sie umfasst die Altäre mit eingetiefter, oben von einer Konche abgeschlossen en Nische, die, umrahmt von einer Aedikula mit geöffne-tem Giebel und Gebälk, somit das Gehäuse für ein Götterbild bildete. Solche Aedikula-Altäre mit Bildnische – ich fasse hier die von Noelke un-terschiedenen Typen A, B und C zusammen28 – waren in Niedergermanien im allgemeinen und in den Nehalennia-Heiligtümern insbesondere äußerst beliebt. Dass auch diese von dem ur-sprünglichen funktionsfähigen Altar schon weit entfernte Denkmalform immerhin noch als Ara angesehen wurde, beweisen zwei Votivinschriften aus Colijnsplaat (Abb. 5)29.
Erwähnenswert ist schließlich eine besondere Variante dieses Aedikula-Altares, die neben der
205
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
Denkmalform der Ara und der in einer Bildni-sche dargestellten Gottheit, einmalig auch das dritte Wesenselement des römischen Opferritus – das Opfer selbst –, in einem Monument vereint. Ist im oberen Register die Nehalennia, hier in Anlehnung an die Matronen in ungewöhnlicher Dreigestalt dargestellt30, so erfassen wir in einem zusätzlichen Relief im unteren Register die Dar-bringung des Voropfers, der Spende von Wein und Weihrauch. Vergleichsbeispiele gibt es aus Niedergermanien ein Dutzend, unter denen der Weihaltar des Kölner decurio Candidinius Verus wohl das bekannteste ist31.
22 Nuber 1972. 23 Zum blutigen Opfer könnten vielleicht H6 und H21 heran-
gezogen werden. Auf der rechten Nebenseite des Denkmals B8 zeigt sich weiter ein mit einer Girlande geschmückter Sockel oder Altar, auf dem ein Kelch mit Opfergaben steht und auf den Nebenseiten des Denkmals B5 fi nden wir zwei tunicati, die sich mit Girlanden umtun. Darstellungen eines reich gedeckten, dreibeinigen Tisches sind bislang nur für Aedikula-Altäre belegt: A23, A44, H6.
24 Andere, auf den Nebenseiten repräsentierte Themen – z. B. Darstellungen eines mit Blättern gefüllten Kantharos oder
5 Colijnsplaat, Nehalenniaheiligtum. Vorder-, Neben-, und Oberseite eines Weih-altares mit Bildnische der Göttin (A43). In der Inschrift unter der Bild-nische wird das Denkmal am Anfang der zweiten Zeile als Ara angespro-chen.
Bilder von Göttern wie Herkules oder Neptun – bleiben hier unbesprochen.
25 Noelke 1990. 26 B1 und B2. 27 Eine Variante besteht darin, dass das Inschriftfeld von ei-
ner aus mehreren Rillen zusammengestellten rechteckigen Umrahmung eingefasst wurde. Die Form ist nur einmal in Colijnsplaat belegt (B3). Nicht länger funktionsfähig sind die Altäre, die oben auf der Bekrönung in Stein verewigte Opfergaben, meist Äpfel oder Birnen, aufweisen, sonst aber noch ganz der Grundform folgen. So B37, B60, B66 aus Kalkstein; B39 und möglich B68 aus Sandstein; B41 aus Tuffstein.
28 Es sei hier festgestellt, dass bei der Fülle des neuen Materi-als jetzt vereinzelt auch Formen belegt sind, die sich nicht in die Noelkesche Typologie einordnen lassen. So haben z. B. die Altäre A17, A29, A42 und A46 zwar eine Nische, aber diese ist nicht in einer architektonischen Rahmung gefasst, und mit Ausnahme von A17 fehlt in diesen Fällen auch die Konche; bei A25 und A27 sind zwar Kapitelle oder Giebel angedeutet, aber es fehlen die seitlichen Pilaster. Die Uniformität der Denkmalgruppe ist weniger ausgeprägt als bislang klar war.
29 A 43, A 46. 30 Hatte der Dedikant sich zufriedengestellt mit einem für den
Matronenkult gedachten, schon fertigen Werkstattprodukt, dem nur noch die Inschrift fehlte? Vgl. zu dieser Frage auch Altar A71, der ebenfalls die drei Matronen zeigt, laut Inschrift aber der Nehalennia geweiht war.
31 Liste bei Derks 1998, 224, Tabelle. 5.1; zu ergänzen ist die-se jetzt mit IKÖLN² 104.
206
Ton Derks
Obwohl die Altäre unserer zweiten und dritten Hauptgruppe typologisch jünger als der klassi-sche Weihealtar sein müssen, so ist selbstver-ständlich doch nicht von einer uni-linearen Ent-wicklung auszugehen, bei der die beschriebenen Hauptgruppen einander zeitlich genau ablösten. Auch wenn wir bei den größtenteils undatierten Denkmälern nicht in der Lage sind, die zeitliche Abfolge der Aufstellung zu rekonstruieren32, so lassen fünf konsuldatierte Altäre tatsächlich auf ein Nebeneinander der Hauptformen schließen, denn gerade der jüngste dieser Altäre gehört als einziger nicht dem Aedikula-Typ an33.
Formen der Votivmonumente: die Statuen und Statuetten
Die beschriebenen Altartypen repräsentieren die bei weitem am häufi gsten belegte Denkmal-form der für Nehalennia geweihten Votive. Ver-einzelt sind auch noch einige andere Denkmal-typen vertreten, worunter hier zuerst Steinvotive in der Form einer Sitzstatue der Nehalennia zu
nennen sind (Abb. 6). Wie die Weihaltäre sind diese Statuen oder Statuetten als Duplizierungen der Kulteinrichtung des Heiligtums zu betrach-ten: sie dienten gleichzeitig als Weihedenkmal und privates Kultbild, das gegebenenfalls Objekt der Verehrung werden konnte. Bei vier Statuet-ten, bei denen die Höhe noch ermittelt werden kann, liegt diese zwischen 24 und 85 cm. Der göttlichen Überlegenheit dem Menschen gegen-über entsprechend standen vermutlich alle Statu-etten ursprünglich auf einem Sockel34; da Sockel und Statuette in der Regel gesondert angefertigt wurden, ist der Zusammenhang heute aber meist verloren35. Die Sockel erscheinen heute anepigra-phisch; ob sie einst eine gepinselte Inschrift tru-gen (so die Bearbeiter) oder anonyme Stiftungen waren, muss offen bleiben. Ein letztes interessan-tes Detail: Sitzstatuen der Nehalennia kennen wir nur aus Colijnsplaat, nicht aus Domburg. Ob die-ser Befund nun auch die Realität widerspiegelt, wage ich zu bezweifeln. Aber augenfällig ist, dass uns umgekehrt nur aus Domburg eine Statue überliefert ist, die Nehalennia in stehender Posi-tion, und zwar mit einem Fuß auf dem Vorder-
6 Colijnsplaat, Nehalenniaheiligtum. Vorder- und Nebenseiten einer Sitzstatue der Göttin (D11).
207
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
steven eines Schiffes zeigt (Abb. 7). Der Bildtypus war aber in Colijnsplaat gut bekannt, wie Darstel-lungen in den Aedikula-Nischen und auch an den Nebenseiten belegen. Schließlich stellen wir fest, das andere Denkmaltypen, wie Porträts und Statu-en von „Pilgern“ oder anatomische Weihereliefs, in beiden Heiligtümern gänzlich fehlen.
Dedikantenkreise
Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen kön-nen, welche soziale Bedeutung der Stiftung eines Weihealtars beizumessen ist, müssen wir uns erst noch über den Dedikantenkreis Klarheit ver-schaffen. Eine erste Beobachtung ist, dass weder in Domburg noch in Colijnsplaat Frauen als De-dikanten bezeugt sind. Soweit erkennbar, wurden alle Denkmäler von Männern gestiftet, die meis-ten von individuellen Dedikanten, eine kleine Zahl aber auch von Männerpaaren. Im letzten Fall handelt es sich um Brüder, die im selben Beruf tätig waren36 oder, wo die Stifter unterschiedliche Gentilicia tragen, wohl um „Business Partner“
32 Da die Blütezeit der Weihepraxis in Niedergermanien gene-rell in die Zeit zwischen etwa 150 und 230 n. Chr. zu setzen ist, ist zu erwarten, dass auch die Nehalennia-Denkmäler überwiegend in diesen Zeithorizont datieren. Vgl. dazu Derks 1998, 81–91 mit einer Liste der vor 150 n. Chr. zu datierenden niedergermanischen Votivinschriften.
33 Die fünf datierten Altäre stammen aus den Jahren 188, 193, 223, 227 (und 222?); Stuart/Bogaers 2001, 40 f.
34 Vielleicht lässt sich so auch der kleine Sockel (?) AA1, der auf der Vorderseite einen opfernden (?) Dedikanten zeigt, erklären. Die Form dieses Denkmals ist, so weit ich weiß, sonst nicht in Niedergermanien bekannt. Zur vertikalen Hierarchie, vgl. auch die Vorschriften Vitruvs (IV, 9, 1) und Derks 1998, 200-213.
35 Erhalten ist er bei den kleinen Denkmälern D10 und D11, wo Statuette und gesondert angefertigter Sockel nachher mit Hilfe von Bitumen befestigt worden sind. Auf Grund übereinstimmender Maße konnte sonst noch die Zusam-mengehörigkeit einer größeren Statue (D3) und einer iso-lierten Basis (B46) wahrscheinlich gemacht werden.
36 A27, B45. 37 A35, A39, B8, B15. Der Umstand, dass die beiden Dedikan-
ten des Domburger Altares H4 unterschiedliche Gentilicia tragen, sich jedoch trotzdem als fratres bekannt gaben, dürf-te damit zu erklären sein, dass sie Berufsbrüder, d. h. Kol-legen, waren. Dagegen spricht, dass diese metaphorische Bedeutung eher Umgangssprache war und deshalb weniger in einer monumentalen Inschrift zu erwarten sein dürfte.
38 S. oben Anm. 32. 39 B10 und H25. Da viele Inschriften weder eine Filiation noch
den freigelassen Status des Dedikanten explizit erwähnen, sind diese methodisch zu den incerti zu rechnen. Ich gehe aber davon aus, dass es hier mehrheitlich um Freigeborene geht.
40 A43 und B51; dazu Raepsaet-Charlier 2003, 298.
ohne jegliche Blutsverwandtschaft37. Die große Mehrheit der Dedikanten aus Colijnsplaat besa-ßen das römische Bürgerrecht (81 Namen), etwa ein Fünftel waren Peregrine (18 Namen). Vor dem Hintergrund, dass die meisten Inschriften nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts anzusetzen sind38, braucht die Dominanz der Bürger nicht zu verwundern. Es zeugt von der fortgeschrittenen Einbürgerung der einheimischen Bevölkerung im zweiten und dritten Jahrhundert. Obwohl immer wieder behauptet wird, dass Händler oft Freige-lassene waren, gibt sich in den Votivinschriften aus den beiden Heiligtümern nur je eine Person als libertus zu erkennen39. Zwei Personen könnten Sklaven gewesen sein40.
Zu den biographischen Hintergründen der De-dikanten teilen uns die Inschriften nur etwas über die berufl iche Tätigkeit und/oder den Heimatort
7 Domburg, Nehalenniaheiligtum. Kupferstich einer Statue der Nehalennia (H1), die mit ihrem linken Fuß auf dem Vordersteven eines Schiffes ruht.
208
Ton Derks
Dedikant Beruf / Amt Zusätzliche Informationen Altar
1 [Se]tius Mi[---] negotiator A 53
2 Septim[ian?]us Casal[…] (fi lius) negotiator B 14
3 Placidus Viduci f. negotiator Britannicianus A 6
4 C. Aurelius Verus negotiator Britannicianus A 11
5 [. ] Val(erius) Mar[---] negotiator Cantianus [et?] Geserecanus ob merces bene conservatas A 9
6 [neg(otiator)] Gallicanus B 34
7 M. Exgingius Agricola negotiator salarius A 1
8 C. Iulius Florentinus negotiator salarius A 26
9 C. Iulius Ianuarius negotiator salarius A 49
10 Q. Cornelius Superstis negotiator salarius B 1
11 [. ] A[. . ]ius G[r]atus negotiator allecarius A 34
12 C. Catulinius Secco negotiator allecarius B 44
13 L. Secundius Similisnegotiatores allecarii A 39
14 T. Carinius Gratus
15 M. Secund(inius) Silvanus negotiator cretarius Britannicianus ob merces bene conservatas A 3
16 Q. Phoebius Hilarus decurio ob merces bene conservatasB 37B 63
17 [ob merc]es r[e]c[te] cons[ervatas] A 42
18 pro mercibus bene cons(ervatis) A 62
19 C. Crescentius Florus pro mercibus conservandisB 3B 56
20 I… Marcellus sevir Augustalis? Schiff mit Weinfässer A 41
21 Ottinius Frequens sevir AugustalisNehalennia mit Fuß auf Vordersteven; auf Nebenseiten Neptun u. Herkules
A 54
22 Vegisonius Martinus nauta A 57
23 Merca[tori]us Amabilis pro navibus B 2
24P. Arisenius Marius libertus P. Ariseni V[…]hi
libertus negotiatoris ob merces bene conservatas B 10
25 Bosiconius Quartus actor navis B 38
26 M. Cupitius Victor agens rem adiutor A 29
8 Weihinschriften aus Colijnsplaat mit Berufs-angaben der Dedikanten.
mit. Gelegentlich bieten ikonografi sche Details der Denkmäler zusätzliche Aufschlüsse. Die weit-aus größte Gruppe der Stifter war im Handel und Wassertransport tätig. Für Colijnsplaat lassen
sich 26 Dedikanten identifi zieren, die in diesem Sektor der Gesellschaft eine Tätigkeit ausübten – als freie Unternehmer oder manchmal auch als Hilfspersonal (Abb. 8 = Tabelle). Zwei Dedikan-
209
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
ten gaben sich als negotiatores zu erkennen, vier Kollegen benannten zusätzlich ihr geografi sches Tätigkeitsfeld (Britannien, Kanalküste und Galli-en), während neun negotiatores die Handelsware, auf die sie spezialisiert waren, erwähnten, mit den negotiatores salarii und allecarii gleichrangig an erster Stelle. Die nächsten sechs Eintragun-gen unserer Tabelle (Nr. 16–21) beziehen sich auf Handels- und Kaufsleute (negotiatores), für die wir nur indirekte Hinweise haben, z. B. weil ihr Denkmal mit einem Relief eines mit Fässern beladenen Schiffes geschmückt war oder weil sie in der Inschrift der Göttin für den Schutz ihrer Ware dankten. Zwei Dedikanten können als Ree-der (nautae) identifi ziert werden, entweder weil der Dedikant sich selbst so benennt oder weil er der Göttin für den Schutz seiner Schiffe dankte. Die letzten drei Personen waren Geschäftsfüh-rer oder sonstiges Hilfspersonal eines Händlers oder Reeders41. Eine solch starke Präsenz eines bestimmten, eng defi nierten Berufsmilieus lässt vermuten, dass hier auch ein oder mehrere Kolle-gien von nautae und negotiatores ihren Sitz hatten, aber dafür fehlt bislang jeder sichere Hinweis42.
Wenn wir die Herkunft der Dedikanten unter-suchen (Abb. 9), dann wird deutlich, dass sie aus
den antiken Gemeinden der Agrippinenser, Tre-verer, Rauraci, Sequani und Veliocasses stammen. Es handelt sich um einen weitgezogenen Kreis, den man als den gallisch-germanischen Raum, oder im Sinne der „Mental maps“ vielleicht besser als das Rhein-, Mosel-, Schelde- und Seinegebiet bezeichnen könnte. Das Namenmaterial der De-dikanten, das eine weniger spezifi sche Quelle für die Herkunftsfrage darstellt, deutet generell auf denselben Raum hin. Während bei den Bürgern die meisten Gentilicia und Cognomina (mehr als 80%) als lateinisch zu bezeichnen sind, gibt es auch keltische, germanische oder nicht näher zu bestimmende einheimische Namensteile. Da es aber nur wenige Nomenklaturen gibt, in denen
41 Unter den Dedikanten der Altäre aus Domburg lässt sich auf der Basis des erwähnten Beweggrundes der Weihung, ob meliores actus, noch ein weiterer Händler identifi zieren: H9, jetzt in Brüssel. Der in H23 erwähnte negotiator creta-rius Britannicianus ist vermutlich identisch mit dem Stifter des Altares A3. Vgl. u. Anm. 63
42 Es fehlt nicht nur eine Erwähnung eines corpus oder collegi-um, sondern auch jeder Hinweis auf das Verwaltungsperso-nal eines solchen.
43 Raepsaet-Charlier 2003, 300. Bei Peregrinen mit einfa-chem Namen gibt es generell, und so auch hier, einen grö-ßeren Prozentsatz nicht-lateinischen Namengutes.
9 Weihinschriften aus Colijnsplaat mit Herkunftsangaben der Dedikanten.
Dedikant Herkunft Beruf/Amt Altar
1 C. Iulius Florentinus CCAA negotiator salarius A 26
2 C. Iul(ius) Ianuarius CCAA negotiator salarius A 49
3 C. Aurelius Verus CCAA negotiator A 11
4 Ottinius Frequens CCAA sevir Augustalis A 54
5 M. Secund(inius) Silvanus CCAA ? negotiator cretarius A 3
6 M. Exgingius Agricola cives Trever negotiator salarius A 1
7 C. Catulinius Secco civis Trever negotiator allecarius B 44
8 Immunius Primus civis Trever – B 45
9 Immunius Ibliomarus civis Trever – B 45
10 Q. Phoebius Hilarus M Bat (negotiator) / decurio B 37
Q. Phoebius Hilarus M Bat (negotiator) / decurio B 63
11 Placidus Viduci f. civis Veliocassis (Rouen) negotiator A 6
12 Vegisonius Martinus cives Secuanus (Besancon) nauta A 57
13 I… Marcellus civis Rauracus (Augst) (negotiator) / sevir Augustalis? A 41
210
Ton Derks
beide Namensteile lateinisch sind, viele hingegen eine gemischte Zusammenstellung zeigen, ist kaum mit Zuwanderern aus Italien oder sonsti-gen über den gallisch-germanischen Raum hin-aus reichenden Reichsteilen zu rechnen43. Weil es überhaupt nicht gebräuchlich war, in einer Wei-heinschrift auf seine Herkunft zu verweisen44, stellt sich die Frage, ob alle Denkmäler, die keine Herkunftsangabe enthalten, von lokalen Stiftern gesetzt wurden, oder ob diese auch von orts-fremden Händlern geweiht sein könnten. Eine Antwort ist schwierig45, aber persönlich deute ich das fast völlige Fehlen von Grab- und Weihe-denkmälern im unmittelbaren Umfeld der beiden Nehalennia-Heiligtümer als ein Indiz, dass die Mehrheit der Nehalennia-Dedikanten Ortsfremde waren, die bestenfalls wegen ihres Geschäftes in der Umgebung des Heiligtums ansässig waren46. Die Weihung von steinernen Denkmälern in den Nehalennia-Heiligtümern muss ein vor allem von einer externen Gruppe getragenes Phänomen ge-wesen sein, das durch die besondere Wirkungs-kraft der Göttin als Schützerin der Schiffe und ihrer Ladung und Besatzung erklärt wird.
Neben den Händlern, Reedern und ihrem Per-sonal gibt es nur noch eine andere Gruppe, die in den Inschriften vertreten ist: das Militär. Es sind allerdings nur drei Weihungen von Angehörigen des Militärs bekannt, gesetzt von zwei benefi ciarii consulares – von denen einer entlassen war – und einem sesquiplicarius, der in der bei Dormagen gelagerten Ala Noricorum diente47. Stärker als bei den Kauf- und Geschäftsleuten darf man anneh-men, dass Angehörige des römischen Heeres ihren militärischen Hintergrund für gewöhn-lich in der Inschrift zum Ausdruck bringen. Das würde heißen, dass sich hinter den Dedikanten, die nichts von ihren Hintergründen preisgeben, kaum Soldaten verbergen dürften. Die Beteili-gung römischer Heeresangehöriger am Kultge-schehen in Colijnsplaat muss somit bescheiden gewesen sein.
So weit das Heer Interesse für den Nehalennia-Kult zeigte, galt jenes vielleicht dem Wirkungs-kreis der Göttin als Beschützerin der Seeleute und damit auch der Truppenversorgung des nie-dergermanischen Heeres. Deutlicher als in Co-
lijnsplaat wird dies in Domburg, zwar nicht aus den für Nehalennia selbst gesetzten Weihestei-nen, sondern aus Stiftungen, die in dem dortigen Heiligtum anderen Gottheiten gewidmet wurden. Unter den Funden am Domburger Strand befan-den sich namentlich neben den üblichen Neha-lennia-Votiven, auch ein Altärchen für eine weiter unbekannte Göttin namens Burorina48, drei oder vier Steinvotive für Neptun49, zwei Victoriastatu-en50, zwei Altäre für Jupiter51 und eine Bronzesta-tuette eines Genius52. Die Inschriften sind verlo-ren oder waren schon im achtzehnten Jahrhun-dert so weit verwittert, das sie schon damals unle-serlich waren, so dass wir über die Hintergründe der Dedikanten heute nichts Sicheres mehr sagen können, aber die gemeinsame Aufstellung von Votiven für Victoria, Jupiter, Neptun und einen Genius, lassen Militärkreise als Stifter vermuten. Diese Annahme wird noch verstärkt durch einen letzten, noch unerwähnt gebliebenen Altar, der den Dii deaeque praesides provinciarum, der Concor-dia und der [Fortuna] consilior[um] gesetzt wurde (Abb. 10). Auch hier ist keine Spur von dem Dedi-kantennamen erhalten, aber es wäre doch zuerst an einen Legionslegaten oder vielleicht sogar den
10 Domburg, Nehalenniaheiligtum. Zeichnung eines schlichten Weihaltares für die Schirmgötter der Provinzen und Concordia, vermutlich gesetzt von dem Statthalter oder einem Legionslegaten.
211
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
Statthalter zu denken53. Die Inschrift scheint fer-ner zu belegen, dass das Heiligtum von Domburg an der Grenze der Provinz Niedergermanien lag, die in dieser Gegend sehr wohl von der Schelde gebildet sein könnte. Es könnte bedeuten, dass sich auch das Nehalennia-Heiligtum bei Colijns-plaat in einer Grenzlage befand. Anders gesagt, aus der Perspektive des römischen Heeres liefen die Schiffe mit ihren wenigstens teilweise für das Militär bestimmten Waren, nicht einfach irgend-einen Hafen, sondern das Bezirksgebiet des nie-dergermanischen Heeres an und sicherten damit die Versorgung der Truppen.
Weihepraxis und religiöse Beweggründe zur Aufstellung eines Altares
Im Rahmen des Themas dieses Kolloquiums soll nach den Handlungsmustern gefragt werden, die mit der Aufstellung der Votive zu verbinden sind. Ein guter Einstieg bietet hier das Inschriftfor-mular. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Dedikantengruppe vor allem aus Händlern und Reedern zusammengesetzt war, kann es nicht verwundern, dass wir unter den explizit erwähn-ten Beweggründen, die Anlass zur Aufstellung eines Denkmals waren, vor allem auf kaufmän-nische Sprache stoßen: „wegen des Schutzes der Handelsware“ (ob merces (bene / recte) conservatas), „für die Erhaltung der Schiffe“ (pro navibus), „für bessere Geschäfte“ (ob meliores actus). Die beiden benefi ciarii consulares stifteten ihre Denkmäler, wie oft bei Angehörigen dieses Dienstgrades, „für sich selbst und die Seinen“ (pro se et suis). Obwohl viele Benefi ziarier mit diesem Beweggrund die Errichtung eines Altares bei der Vollendung der Dienstperiode an einer benachbarten Benefi zia-rier-Station – also expleta statione54 – motivierten, scheint es wenig wahrscheinlich, dass dies auch hier der Fall war: die Mehrheit dieser Denkmäler wurde für Jupiter Optimus Maximus gesetzt und wohl eher in einem zu der Statio gehörenden, gesondertenWeihebezirk als in einem Heiligtum der Gegend.
Wurden die Altäre aus unterschiedlichen Gründen geweiht, der rituelle Rahmen in dem
die Errichtung stattfand, war, soweit erkennbar, fast immer der gleiche: die Einlösung eines Ge-lübdes. Darauf verweisen neben der üblichen Ab-schlussformel vslm55, und der einmalig belegten Variante vsllm56, die Verkürzungen vs, lm, l, und die weiteren Varianten v(otum) l(ibens) p(osuit) und p(osuit) l(ibens) l(aetus) m(er ito)57. Fünfmal ist zudem die Formel ex voto belegt, einmal ex voto su(s)cepto, beide immer gefolgt von lm oder ähnli-
44 Verboven 2007, 302: “The decision to mention these [i. e. professional activities] must be seen as a conscious deviati-on from normality” und als eine Weise “to display economic independence and wealth and to claim social respectability in the absence of family descent” (ebd. 303). Zur relativen Seltenheit mit der in Votivinschriften auf Herkunft verwie-sen wurde, s. Derks 2009, 254.
45 Vgl. für einige Ansätze, unten, Anm. 56 und 57 . 46 Anders Raepsaet-Charlier 2003, 300, Anm. 104. 47 A5, A7, B30. 48 H38. 49 H33, H34, H35, H36; letztere zwei könnten zusammenge-
hören. 50 H28, H29. 51 H30, H32. 52 H39. 53 Vgl. z. B. einen vom Legionslegaten der 30. Legion in Vech-
ten errichteten Altar, der dem Jupiter Optimus Maximus, den Dii patrii, den Praesides huius loci Oceanique und dem Rhein geweiht wurde (CIL XIII 8810) .
54 Lieb 1967. 55 Bei dem Fragment B86 lesen die Herausgeber am Schluss
der Inschrift zweimal vslm: da der zweite Beleg aber viel un-tiefer ausgemeißelt ist und zwischen der ersten und zwei-ten erhaltenen Zeile weitere Spuren von untiefen Buchsta-ben zu lesen sind, handelt es sich hier wahrscheinlich um eine Nachbesserung, die auf eine bessere Verteilung des Textes über dem Schriftfeld zielte.
56 B85. Auch in Domburg gibt es einmal vsllm (H10). Die Formel vsllm ist nirgends im Reich so zahlreich belegt wie in Germania Superior (vgl. Alföldy 2005). Der Name des Dedikanten aus Colijnsplaat, Andanhianiu(s) Severus, ist ein Hapax, zeigt aber Verwandtschaft mit dem Namen An-dangus aus einer Mainzer Inschrift (CIL XIII 7086). Mög-licherweise stammte der Dedikant des Altares B85 aus dem Mittelrheingebiet.
57 Die Formel pllm, belegt in B4, soll als eine Variante von vsllm verstanden werden und könnte wiederum auf eine Herkunft des Dedikanten aus Obergermanien hinweisen. Sein Gentiliz, Mercatorius, ist selten: es ist zweimal belegt in Germania Superior (CIL XIII 11884, Mainz und CIL XIII 6567, Osterburken) und dreimal in Belgica (CIL XIII 11313 und AE 1989, 549, beide Trier; AE 1990, 726, Mamer), da-neben auch je einmal in Noricum, Pannonia Superior und Gallia Narbonensis.
212
Ton Derks
chem. Sc hließlich fi ndet sich noch einmal ex iussu und viermal ex imperio. Dass auch in diesen Fällen der Altar durchaus im Rahmen eines Gelübdes gesetzt sein dürfte, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Formel ex imperio in wenigstens zwei Beispielen lm hinzugefügt wurde. Der zwingende Charakter dieser Weihungen wird aus der Erfül-lung der Gebete seitens der Gottheit gefolgt sein. Diese für das römische Votum charakteristische Vorgehensweise wird schließlich auch klar aus der Weihung eines Ratsherrn der Bataver. Die In-schrift besagt, dass er wegen des Schutzes seiner Ware den Altar gestiftet hat, den er zuvor verspro-chen hatte (aram quam voverat)58. Die Votivpraxis unterstellt, dass der Dedikant erst gehalten war, eine Opfergabe zu bringen, nachdem die Gottheit ihrerseits ihren Beitrag geleistet hatte59.
Vor diesem Hintergrund stellt der Altar B3 aus Colijnsplaat einen besonderen, aber zugleich in-struktiven Fall dar. Das Denkmal trägt die einzi-ge60 mir bekannte Votivinschrift, die explizit be-sagt, dass der Gottheit kein Geschenk gegeben wurde für eine in der Vergangenheit schon emp-fundene Hilfe, sondern für eine erst in der Zu-kunft noch beizusteuernde Leistung: der Grund der Weihung wird hier umschrieben als pro mer-cibus conservandis statt dem geläufi geren pro mer-cibus conservatis. Zum besseren Verständnis der sprachlichen Abweichung eignet sich ein Ver-gleich mit den öffentlichen regulären Vota. Denn genau wie Amtsträger und Priesterkollegien am 1. bzw. 3. Januar überall im Reich ihre Vota für das Wohlergehen des amtierenden Kaisers einlösten, und gleichzeitig neue Gelübde eingingen61, so müssen auch in diesem Fall die Einlösung alter Gelübde mit der Versprechung neuer einher ge-gangen sein. Wie der Kaiser auf diese Weise unter permanentem Schutz der Götter stand, so stand die Handelsware dieses Kaufmannes unter der ununterbrochenen Schirmherrschaft der Neha-lennia. Während die eine Seefahrt gerade erfolg-reich vollendet war, stand die nächste, für die der Unternehmer erneut eine Versicherung suchte, kurz bevor. Die Verknüpfung der Einlösung des alten Gelübdes mit dem Versprechen eines neu-en für die nächste Fahrt leitete zu dieser einma-ligen, verständlichen, aber nicht ganz korrekten
Formulierung62. Dieses Vorgehen einer ständigen Erneuerung der Gelübde kann m. E. auch den bislang als rätselhaft empfundenen Umstand er-klären, warum wir für einige Dedikanten (darun-ter C. Crescentius Florus), eben zwei Stiftungen aus dem Heiligtum bei Colijnsplaat kennen oder je eine in den beiden Nehalennia-Heiligtümern63.
Zum Schluss dieses Abschnittes möchte ich noch auf ein Denkmal aus Domburg aufmerksam ma-chen, das mit seinem Formular pro salute fi li sui ganz aus dem Rahmen zu fallen scheint64. Seit meinen Forschungen zu den Weihegeschenken aus dem Lenus-Marsheiligtum von Trier, bei de-nen ich versucht habe, die von Vätern oder Eltern-paaren für das Wohlergehen eines Sohnes (pro sa-lute fi li) gesetzten Denkmäler in Verbindung mit einem Übergangsritual zu sehen, das zum Ziel hatte, junge Knaben in die Welt der Erwachsenen einzuführen65, neige ich dazu, für Inschriften mit einem vergleichbaren Formular eine ähnliche Deutung zu vermuten. In Domburg fehlen aber andere, vergleichbare Weihungen, die man bei einem von vielen Personen praktizierten Ritual erwarten würde. Das Fehlen vergleichbarer Votive kann deshalb nur bedeuten, dass – falls wir es hier tatsächlich mit dem Ausdruck eines vergleichba-ren Übergangsrituals zu tun haben – Vater und Sohn dafür ausnahmsweise das Nehalennia-Heiligtum ausgesucht hätten. Die meisten ihrer sozial gleichberechtigten oder nahestehenden Personen (Peers) hätten das Ritual aber andern-orts, in einem Heiligtum eines anderen Gottes, begangen. Wollen wir jedoch eine Überinterpre-tation unserer Quellen vermeiden, ist es besser, sich hier nicht festzulegen und als eine weitere Möglichkeit offen zu lassen, dass sich der Vater (vielleicht stellvertretend für den Sohn?) bei der Gottheit für die sichere Rückkehr seines Kindes von einer Seefahrt bedanken wollte.
Weihedenkmäler und kompetitives Verhalten
Wir haben in den vorangegangen Abschnitten versucht, ein Bild der Formenvielfalt der Weihe-
213
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
denkmäler, der Hintergründe der Stifter sowie der Beweggründe, die Anlass zur Aufstellung eines Denkmals gaben, zu skizzieren. Kehren wir jetzt zurück zu unserer eingangs aufgewor-fenen Fragestellung. Welche Handlungsmuster könnten die Masse und Variationsbreite dieser Weihemonumente erklären? Wie fanden die un-terschiedlichen Formen des Weihealtars Eingang und wodurch wurden diese weiter verbreitet? Für eine Beantwortung dieser Fragen müsste man in der Lage sein, die ältesten Beispiele jeder Denk-malform zu identifi zieren, was angesichts der Befundsituation eine unmögliche Aufgabe ist. Als Denkansatz möchte ich jedoch folgende Überle-gungen vorlegen.
Anders als die militärischen Weihungen, die oft von Präfekten oder Offi zieren im Namen der von ihnen geführten Einheit oder Abteilung aus-geführt wurden und in dem Sinne wohl als öffent-liche Weihungen zu betrachten sind, sind die in den Nehalennia-Heiligtümern gestifteten Altäre fast ausschließlich von privaten Auftraggebern gesetzt worden. Die Errichtung erfolgte, soweit kenntlich, immer aus privaten Gründen. Es las-sen sich keine beispielhaften Vorbilder ausma-chen, die die Norm für spätere Weihungen hät-ten setzen können. Wenn es solche Beispiele mit Vorbildcharakter gegeben hat, so sind diese eher außerhalb unserer Heiligtümer zu suchen.
Die meisten Dedikanten werden die Heiligtü-mer der Nehalennia während ihrer Handelsreisen besucht haben. Wie aus den inschriftlich doku-mentierten Berufsspezialisierungen hervorgeht, waren viele Reeder und Händler auf mehr oder weniger festen Transportrouten tätig oder hatten sich spezialisiert in der Verhandlung bestimmter Waren, deren Absatzmärkte wiederum bestimm-te Transportwege erforderten. Die hohe Zahl der in den Nehalennia-Heiligtümern gestifteten Wei-
58 B37. 59 Vgl. hierzu ausführlicher Derks 1998, 215–239. 60 Contra Stuart und Bogaers bin ich der Meinung, dass wir
in A62 und B63, wo der Text nur bruchstückhaft überliefert ist, nicht conservandis, sondern conservatis lesen sollen.
61 Dazu grundlegend Scheid 1990, 298 ff., bes. 307–309. 62 Entgegen dem Kommentar der Herausgeber wird dieser Al-
tar nicht vor der Fahrt gestiftet worden sein. Darauf weisst auch die Schlussformel l(ibens) m(erito), denn die Weihung konnte nur ‚verdient‘ gesetzt werden, nachdem der Schutz der Gottheit sich als wirksam erwiesen hatte.
63 Aus Colijnsplaat kennen wir jeweils zwei Weihungen von den nachfolgenden Dedikanten: Mercatorius Amabilis (B2 und B4), C. Crescentius Florus (B3 und B56), T. Tertinius Virilis (B11 und B15), Q. Phoebius Hilarus (B37 und B63) und möglich auch M. (?) Iustinius Albus (B54 und A71). M. Secund(inius) Silvanus stiftete in jedem der beiden Neha-lennia-Heiligtümer eine sehr ähnliche Ara (A3 und H23).
64 H26. 65 Derks 2006. 66 Vgl. A3 mit H23.
11 Vergleich der Weihdenkmäler aus Colijnsplaat, Domburg und Morken-Harff nach Gattungstypen. Auffallend sind der starke Prozentteil der Altäre mit Nische in Domburg und die geringe Vergegen-wärtigung dieses Typs in Morken-Harff.
215
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
hedenkmäler dürfte hauptsächlich mit diesen sich immer wiederholenden Fahrbewegungen zu erklären sein. Der Kreis der Kollegen, mit dem ein Dedikant in ständiger Konkurrenz stand, wird sich in erster Linie wohl nicht über alle Besucher ausgestreckt, aber auf die Kollegen zugespitzt ha-ben, die sich für dasselbe Absatzgebiet oder die-selbe Ware interessierten. Ein solcher Kreis lässt sich einigermaßen identifi zieren.
Die meisten Altäre der Grundform sind aus Kohlenkalk gearbeitet. Da diese Gesteinsart vor allem an der mittleren Maas gewonnen wurde, ist anzunehmen, dass wir es bei diesen Altären wohl mit tungrischen Dedikanten zu tun haben. Soweit nachweisbar, wurden all diese Altäre von Weihen-den ohne Bürgerrecht gesetzt: einmal von einem Sklaven (B51), der zweifellos als Stellvertreter sei-nes Patrons gehandelt haben wird, und viermal von einem Peregrinen. Diese Besonderheit wird wohl nicht regional, sondern vielmehr chronolo-gisch begründet sein. Die einfachsten Weihealtä-re wurden vermutlich in einer Zeit gesetzt, als die Einbürgerung der Tungrer noch nicht weit fortge-schritten war. Denkmalform und Status der De-dikanten dürften darauf deuten, dass sie zu den ältesten Weihungen für Nehalennia gehören. Ob Tungrer auch Altäre aus Kalkstein oder Sandstein setzten, lässt sich nicht mehr feststellen, ist aber auch nicht sicher auszuschließen. Die Vorausset-zung dafür wäre gewesen, dass entweder direkt bei den Nehalennia-Heiligtümern mehrere spe-zialisierte Bildhauerwerkstätten hätten bestanden haben müssen oder eine Werkstatt, die Produkte in unterschiedlichem Material hätte liefern kön-nen. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass die betreffenden Tungrer selbst von anders-wo einen fertigen Stein aus solchem Material mit-brachten.
Untersuchen wir nun die Aedikula-Altäre mit Bildnische, so ist augenfällig, dass es in Domburg mehr als zweimal soviel Belege gibt als in Colijns-plaat (vgl. Abb. 11). Dies kann kein Zufall sein. Da die Göttin dieselbe war und die gesellschaftliche Schicht, aus der die meisten Dedikanten stamm-ten, ebenfalls keine Unterschiede zeigt – wie wir gesehen haben, gibt es sogar einen Dedikant, der in beiden Heiligtümern einen Stein setzte66 –,
kann es auch nicht an dem Kreis der Verehrer liegen. Wie schon geäußert, ist das Verhältnis in Domburg durch die lange Verfügbarkeit der Steindenkmäler in nachrömischer Zeit höchst-wahrscheinlich verzerrt: die Altäre vom Grund-typus wurden bevorzugt als Spolien ausgesucht und verschleppt und sind deshalb signifi kant unterrepräsentiert. Andererseits verdeutlicht die Gegenüberstellung mit einem der beiden Heilig-tümer von Morken-Harff (Abb. 11), dass der Anteil von Aedikula-Altären in den Nehalennia-Heiligtü-mern vermutlich überdurchschnittlich hoch war. Dies könnte mit der besonderen Finanzkraft der Dedikanten zu tun haben sowie der guten Was-serverbindungen zu Orten wie Köln und Bonn, wo sich vermutlich die Werkstätten befanden, in denen der Aedikula-Typus entwickelt wurde67.
Ausschlaggebend für die Popularität des Aedi-kula-Typus in den Nehalennia-Heiligtümern dürf-te das Vorbild einiger von Magistraten der Colonia Claudia Ara Agrippinensium gestifteten Altäre ge-wesen sein, wobei den für die Aufanischen Ma-tronen geweihten Votiven eine besondere Rolle zukommen dürfte. Denn der bekannte, von dem Quaestor der Kolonie, Q. Vettius Severus, dieser Matronengruppe geweihte Altar, gilt bislang als das früheste datierte Beispiel eines niedergerma-nischen Aedikula-Altares68. Da die Nehalennia-Denkmäler auf vielfältige Verbindungen mit der Provinzhauptstadt schließen lassen69, wäre es durchaus denkbar, dass das von den Kölner Au-toritäten gesetzte Vorbild bei den Dedikanten der Heiligtümer an der westlichen Grenze der Pro-vinz seine Nachahmung fand.
67 Zu Bildhauerwerkstätten Noelke 2006.
68 Nesselhauf 1937, Nr. 165, konsuldatiert in das Jahr 164. 69 Zu denken ist an Personalverbindungen (also an in Köln
ansässige Stifter), Handelsverbindungen (Negotiatores, die Handel trieben mit Köln, aber nicht unbedingt aus Köln stammten; vgl. A1), Kultverbindungen (es gibt aus Köln drei der Nehalennia geweihte Denkmäler: CIL XIII 8498 = IKÖLN2 181; CIL XIII 8499 = IKÖLN2 182; Fremersdorf 1963, 65, Taf. 130) und Werkstattverbindungen (vgl. dazu o. Anm. 30).
70 Selbstverständlich wurden hier nur die vollständig erhalte-nen Altäre und die, wofür die vollständige Höhe rekonstru-ierbar war, aufgenommen.
12 Miniaturamphoren vom Typ Dressel 20 aus Bergen op Zoom-Thaliaplein. Nach fabric lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: weich gebrannte Amphoren mit hohen Konzentrationen von Mica (Nr. 1–11) und hart gebrannte Amphoren ohne Mica (Nr. 12–19). Die Formen der zweiten Gruppe sind etwas höher als die der ersten.
216
Ton Derks
Neben der Form des Denkmals dürfte auch sei-ne Größe eine Rolle beim sozialen Wettbewerb in-nerhalb eines bestimmten Dedikantenkreises ge-spielt haben. Wenn wir diesen Faktor in den Ana-lysen der aus Colijnsplaat bekannten Altäre mit einbeziehen70, dann zeigt sich eine umfangrei-che Mittelgruppe mit einer Höhe zwischen etwa 60 und 90 cm, eine kleine Gruppe von Altären, zumeist solche ohne Bildnische, die kleiner als 60 cm sind, und sehr wenige Stücke mit Höhen über 90 cm bzw. 1,20 m, die, nicht unerwartet, vor allem Altäre mit Nische darstellen. Aus diesen Ergebnissen lassen sich zwei Folgerungen ziehen: erstens, ob der zu stiftende Altar eine Nische ha-ben sollte oder nicht, für beide Formen war die Variationsbreite ungefähr gleich groß. Zweitens, wenn es um die Größe des Denkmals ging, lag in Colijnsplaat die Norm zwischen etwa 60–90 cm. Wer sich einen Altar in dieser Größe nicht leis-ten konnte oder wollte, stiftete ein schlichtes Ex-emplar. Die Stifter aber, die ihren Altar auch in einem sozialen Wettbewerb einsetzen mochten, mussten, um sich von der breiten Mittelschicht abheben zu können, entweder in einen Altar mit Aedikula investieren, oder sich einen außeror-dentlich großen Altar besorgen lassen. Wie das in concreto funktionierte, möchte ich gerne an dem Beispiel des oben erwähnten Denkmales für die praesides provinciarum zeigen (Abb. 10). Mit einer Höhe von 1,37 m ist es unter den Domburger Voti-ven das zweitgrößte Monument. Auch im Bestand von Colijnsplaat stünde es der Größe nach an zweiter Stelle71. Auch wenn der Altar keine Nische trägt, entspricht der Umfang des Denkmals der schon vermuteten hohen Stellung des Dedikan-ten. Vermutlich wollte der Auftraggeber als einer der einfl ussreichsten Stifter gesehen werden und versuchte, sein Ziel mit einem auffallend großen Denkmal zu verwirklichen.
Abschließend sei hier noch erwähnt, dass die Denkmäler nicht nur durch Form und Größe, aber auch durch Bemalung, von der an einigen Altären Spuren erhalten sind, eine auf Details in-dividualisierte Gestaltung bekamen, die es ermög-lichte, die persönliche Gabe im bunten Nebenein-ander der weitgehend gleichförmigen Monumen-te wiederzufi nden72.
Nicht-monumentale Weihegeschenke
Die Art und Weise, in der die Denkmäler der Nehalennia-Heiligtümer zu uns gekommen sind, lässt es nicht zu, ein genaues Bild von dem räum-lichen Kontext dieser Bezirke zu entwerfen. Auch haben wir kaum eine Vorstellung, was für andere, neben der Errichtung von Weihedenkmälern be-stehenden Opferpraktiken dort vollzogen wurden: denn Kleinfunde wurden, einmal abgesehen von den Münzen auf dem Domburger Strand, nicht aufgesammelt oder fi elen durch die Maschen der Netze. Eine jüngste Entdeckung bei Bergen op Zoom kann verdeutlichen, was wir vermissen.
Bei Grabungen (2002–2007) hinter der gro-ßen Kirche im Zentrum dieser ebenfalls am Schelde-Ufer gelegenen Stadt73 entdeckte man unter spätmittelalterlichen Bebauungsschichten einen völlig oxidierten, noch 35 cm mächtigen Rest einer Moormulde, die im Laufe der Zeit mit einer Sandschicht durchmischt wurde. In der ca. 20 bis 50 m breiten Senke fand man neben einer Streuung von insgesamt 84 römischen Münzen74 Ziegelmaterial und römische Keramik. Letztere bestand fast ausschließlich (97 %) aus Scherben von wenigstens 500 Miniaturgefäßen, hauptsäch-lich in Form von Ölamphoren des Typs Dressel 20 und eines zweihenkeligen Kruges (Abb. 12). Mineralogische Studien haben ergeben, dass sich nach der Beschaffenheit des Scherbens der Mini-aturgefäße zwei Gruppen unterscheiden lassen: so wurde für Miniaturamphoren mit einer Größe zwischen 11–15 cm (Abb. 12, Nr. 1–11) ein ande-rer Ton verwendet, als für größere Formen von 16–20 cm (Abb. 12, 12–18) und für kleine Krüge (Abb. 12, Nr. 19). Überraschenderweise stimmt die Beschaffenheit des Scherbens der ersten Gruppe haargenau mit der von einigen, im drei-zehnten und vierzehnten Jahrhundert vor Ort pro-duzierten Fehlbränden überein. Der Ton, der da-für verwendet wurde, stammt aus der Formation von Tegelen, die in der Gegend direkt um Bergen op Zoom zu Tage tritt. Diese Miniaturgefäße vom Typ Dressel 20 wurden also nicht aus der Baetica importiert, sondern lokal produziert. Die Ausgrä-ber vermuten in der Streuung der Miniaturgefäße eine Deponierungspraxis fassen zu können, die
217
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
71 Das höchste Monument in Colijnsplaat maß 1,43 m und be-traf ebenfalls einen Altar ohne Nische (B44); in Domburg war das höchste Denkmal, nicht verwunderlich, ein Altar mit Nische mit einer Gesamthöhe von 1,42 m (H4).
72 Die Wand der Nische A48 war hellblau bemalt, die Muschel und Kapitelle von H5 dunkelrot. Bogaers/Stuart 2001, 19.
73 Zur Paläogeographie, siehe Vermunt/De Clercq/Degryse 2009, Abb. 10, sowie Vos/Bazelmans et al. 2011, 62 f.
74 Sie können in die Zeit von Nero bis Gordian III datiert wer-den und haben einen Schwerpunkt in der Mitte des 2. Jhs.
75 Vermunt/De Clercq/Degryse 2009.76 Es gibt zwar drei republikanische Denare, aber aus der
ganzen julisch-claudischen Zeit ist keine einzige Münze bekannt.
77 Vgl. hierzu für die ältere Ansicht Deae Nehalenniae, S. 14, Abb. 1 mit der Karte bei Vos/Bazelmans 2011, 64)
78 Siehe dazu jetzt auch G. Raepsaet/M.-Th. Raepsaet-Char-lier, Revue du Nord 95, 209–242, die die Schelde als Gren-ze zwischen den Civitates der Frisiavonen und der Men-apier und somit zwischen den Provinzen Germania inferior und Gallia Belgica betrachten.
hier von Öl- und Weinhändlern ausgeübt wurde. Auf ihre Präsenz vor Ort würden die restlichen 3% der Keramik schließen lassen, die aus Scher-benmaterial der „normalen“ iberischen und galli-schen Öl- und Weinamphoren bestand75.
Ob wir die vorgeschlagene Deutung bis in alle Details akzeptieren müssen, sei dahingestellt; wichtig scheint mir, dass sie uns auf mögliche Alternativen aufmerksam macht, die wir in Dom-burg und Colijnsplaat durch die Bedingungen der Fundumstände nicht fassen können. Die Praxis, Weihemonumente zu stiften, war sicher auch in den Nehalennia-Heiligtümern im späten zweiten und frühen dritten Jahrhundert wichtig, wenn nicht dominant. Das schließt nicht aus, dass gleichzeitig auch eine andere Ritualsprache mit der Göttin geredet wurde, die uns völlig entgeht. Auch die Frage, was sich an diesen Orten vor dem massiven Einsetzen der Weihealtäre, also vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts vollzog, können wir kaum beantworten. Soviel lässt sich noch sa-gen, dass die Münzserie der am Strand von Dom-burg aufgesammelten Stücke mit den Flaviern beginnt76. Die Geschichte dieses Heiligtums wird bereits einen Anfang genommen haben, noch bevor der Altar zum normativen Weihegeschenk wurde. Das Quellenmaterial mit der wir diese frü-here Geschichte schreiben könnten, scheint aber für immer von den Meereswellen verschlungen zu sein.
Postscriptum
Im Haupttext dieses Beitrages sind die Fundorte der Weihaltäre von Domburg und Colijnsplaat, in Übereinstimmung mit der Einteilung des CIL und der Année Épigraphique, noch zur Germa-nia inferior gerechnet worden. Gleichzeitig wur-de davon ausgegangen (S. 209), dass die Schelde die Grenze zwischen Niedergermanien und der Gallia Belgica bildete. Nach den jüngsten geo-logischen Einsichten verlief dieser Fluss in der Umgebung des Heiligtums von Colijnsplaat aber nicht, wie bis vor kurzem allgemein angenom-men, südlich der in der heutigen Oosterschelde gelegenen Sandbank namens Vuilbaard, auf des-
sen Südfl anke die Weihaltäre aus dem Heiligtum gefunden wurden, sondern nördlich davon77. Die Nehalennia-Heiligtümer müssen somit beide auf dem Südufer der Schelde gelegen haben. Wenn die Hypothese über den Verlauf der Provinzgren-ze richtig ist, dann sind die beiden Nehalennia-Heiligtümer nicht länger der Provinz Niederger-manien, sondern der Gallia Belgica zuzuweisen78. Die neuen geologischen Einsichten wurden mir kurz vor der letzten Korrektur des Textes im April 2012 bekannt und fanden in der eingefügten Anm. 73 Berücksichtigung. Deren vollen Konse-quenzen für diesen Beitrag wurden mir erst da-nach klar und konnten nicht mehr berücksichtigt werden.
Seit dem Abschluss des Manuskriptes erschien P. Stuart, Nehalennia van Domburg. Geschiede-nis van de stenen monumenten (Utrecht 2013), in dessen Studie alle noch vorhandenen Denkmäler aus Domburg neu photographisch aufgenommen worden sind, während die verlorenen Monumen-te mittels teilweise bislang unveröffentlichten Aufnahmen von Stichen und Zeichnungen do-kumentiert sind. Gegenüber der älteren Arbeit von Hondius-Crone, die Ausgangspunkt meiner Überlegungen war, ist die Zahl der Domburger Weihealtäre jetzt mit zwei anzusetzen: es handelt sich um einen Altar des Grundtypus (Stuart 2013, Nr. 42) bzw. einen Altar mit Bildnische (Stuart
218
Ton Derks
2013, Nr. 22). Schliesslich sei hier erwähnt, dass die in der Anm. 31 genannte Liste der Altäre mit Opferszene jetzt mit einem Matronenstein aus Mechernich weiter ergänzt werden kann; siehe dazu Derks 2013.
Literatur
Alföldy 2005
G. Alföldy, Die Inschriftenkultur. Lesen und Schrei-ben in der Provinz. In: S. Schmidt/M. Kempa/A. Wais (Hrsg.), Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau (Stuttgart 2005) 110–116.
Biró 1975
M. Biró, The inscriptions of Roman Britain, Acta Arch. Acad. Scien. Hungar 27, 1975, 13–58.
Bogaers 1955
J. E. A. Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe. Nederlandse oudheden 1 (‘s-Gravenhage 1955).
Bridger 2006
C. Bridger, Veteran settlement in the Lower Rhine-land. The evidence from the civitas Traianensis, Journal Roman Arch. 19, 137–149.
Coulston 1988
J. C. Coulston, Hadrian’s Wall west of the river North Tyne. CSIR Great Britain I 6 (Oxford 1988).
Deae Nehalenniae 1971
Deae Nehalenniae. Gids bij de tentoonstelling Neha-lennia de Zeeuwse godin. Zeeland in de Romeinse tijd. Romeinse monumenten uit de Oosterschelde, Middelburg/Leiden (RMO) 1971.
Derks 1998
T. Derks, Gods, temples and ritual practices. The transformation of religious ideas and values in Ro-man Gaul. Amsterdam archaeological studies 2 (Amsterdam 1998).
Derks 2006
T. Derks, Le grand sanctuaire de Lenus Mars à Trè-ves et ses dédicaces privées: une réinterprétation. In: M. Dondin-Payre/M.-Th. Raepsaet-Charlier (Hrsg.), Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires ci-viques dans l’Occident romain (Bruxelles 2006) 239–270.
Derks 2008
Samenvatting en conclusies. In: T. Derks/P. G. Hoff/J. Van Kerckhove, Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002–2003). Zuidnederlandse archeologische rap-porten 31 (Amsterdam 2008) 135–148.
Derks 2009
T. Derks, Ethnic identity in the Roman frontier. The epigraphy of Batavi and other Lower Rhine tribes. In: T. Derks/N. Roymans (Hrsg.), Ethnic constructs in antiquity. The role of power and tradition. Amster-dam archaeological studies 13 (Amsterdam 2009) 239–282.
Derks 2013
T. Derks, Ein neuer Matronenaltar mit Opferszene aus Mechernich (Kr. Euskirchen), Arch. Korrbl. 43, 237–245.
Eck 1998
W. Eck, Inschriften auf Holz. Ein unterschätztes Phänomen der epigraphischen Kultur Roms. In: P. Kneißl/V. Losemann (Hrsg.), Imperium Roma-num. Studien zu Geschichte und Rezeption. Fest-schrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag (Stuttgart 1998) 203–217.
Fremersdorf 1963
F. Fremersdorf, Urkunden zur Kölner Stadtge-schichte aus römischer Zeit (Köln 1963) = Die Denk-mäler des römischen Köln 2.
Hondius-Crone 1955
A. Hondius-Crone, The temple of Nehalennia at Domburg (Amsterdam 1955).
IKÖLN²B. Galsterer/H. Galsterer, Die römischen Steinin-schriften aus Köln. Kölner Forschungen 10 (Mainz 2010).
Kolbe 1960
H.-G. Kolbe, Die neuen Matronen-Steine von Mor-ken-Harff, Kreis Bergheim. Bonner Jahrb. 160, 50–124.
Lehner 1919
H. Lehner, Der Tempelbezirk der Matronae Vacalli-nehae bei Pesch. Bonner Jahrb. 125, 74–162.
Lehner 1930
H. Lehner, Römische Steindenkmäler von der Bon-ner Münsterkirche. Bonner Jahrb. 135, 1–48.
Lieb 1967
H. Lieb, Expleta statione. In: M. G. Jarrett/B. Dob-son (Hrsg.), Britain and Rome. Essays presented to Eric Birley on his sixtieth birthday (Kendal 1967) 139–144.
Louwe Kooijmans 1971
L. P. Louwe Kooijmans, De Nehalennia-tempel te Colijnsplaat. Onderzoeksmethoden en vondstom-standigheden. In: Deae Nehalenniae. Gids bij de ten-toonstelling, Stadhuis Middelburg 17/6-29/8/1971 (Middelburg/Leiden 1971) 11–21.
Millett 1995
M. Millett, Re-thinking religion in romanization. In: J. Metzler et al. (Hrsg.), Integration in the Early Ro-man West. The role of culture and ideology. Dossiers
219
Die Weihealtäre aus den Nehalennia-Heiligtümern
d’archéo logie du Musée National d’Histoire et d’Art 4 (Luxemburg 1995) 93–100.
Nesselhauf 1937
H. Nesselhauf, Neue Inschriften aus dem römischen Germanien und den angrenzenden Gebieten. Ber. RGK 27, 1937, 51–134.
Noelke 1990
P. Noelke, Ara et aedicula. Zwei Gattungen von Votivdenkmälern in den germanischen Provinzen. Bonner Jahrb. 190, 1990, 79–124.
Noelke 2006
P. Noelke, Bildhauerwerkstätten im römischen Ger-manien. Bonner Jahrb. 206, 2006, 87–144.
Nuber 1972
H. U. Nuber, Kanne und Griffschale. Ihr Gebrauch im täglichen Leben und die Beigabe in Gräbern der römischen Kaiserzeit. Ber. RGK 53, 1972, 1–232.
Raepsaet-Charlier 2003
M.-Th. Raepsaet-Charlier, Nouveaux cultores de Ne-halennia. Ant. Class. 72, 291–302.
van Renswoude 2010
J. van Renswoude, Archeologisch onderzoek bij de Romeinse cultusplaats Empel-De Werf. Proefsleuve-nonderzoek en begeleiding in het kader van de ver-breding van de rijksweg A2, gemeente ’s-Hertogen-bosch. Zuidnederlandse archeologische rapporten 38 (Amsterdam 2010).
Roymans/Derks 1990
N. Roymans/T. Derks, Ein keltisch-römischer Kult-bezirk bei Empel (Niederlande). Arch. Korrbl. 20, 1990, 443–451.
Roymans/Derks 1993
N. Roymans/T. Derks, Der Tempel von Empel. Ein Hercules-Heiligtum im Batavergebiet. Arch. Korrbl. 23, 1993, 479–492.
Schalles 2006
H.-J. Schalles, Epigraphisches vom Niederrhein. Xantener Ber. 14 (Bonn 2006) 85–129.
Scheid 1990
J. Scheid, Romulus et ses frères. Le collège des frères Arvales, modèle du culte public dans la Rome des Empéreurs. Bibl. des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 275 (Rom 1990).
Stuart 1973
P. Stuart, De kerk van Domburg als Nehalenniamu-seum 1647–1866. In: W. A. van Es et al. (Hrsg.), Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brun-sting bij zijn zeventigste verjaardag (Bussum 1973) 367–378.
Stuart 2003
P. Stuart, Nehalennia. Documenten in steen (Goes 2003).
Stuart 2013
P. Stuart, Nehalennia van Domburg. Geschiedenis van de stenen monumenten (Utrecht 2013).
Stuart/Bogaers 2001
P. Stuart/J. E. Bogaers, Nehalennia. Römische Stein-denkmäler aus der Oosterschelde bei Colijnsplaat. Collections of the National Museum of Antiquities 11 = CSIR Nederland 2 (Leiden 2001).
Verboven 2007
K. Verboven, Good for business. The Roman army and the emergence of a ‘business class’ in the north-western provinces of the Roman empire (1st century BCE – 3rd century CE). In: L. De Blois/E. Lo Cascio (Hrsg.), The impact of the Roman army (200 BC – AD 476). Economic, social, political religious and cultural aspects (Leiden/Boston 2007) 295–314.
Vermunt/De Clercq/Degryse 2009
M. Vermunt/W. De Clercq/P. Degryse, An extraor-dinary deposit. A Roman place of offering with mi-niature amphorae in Bergen op Zoom. In: H. van Enckevort (Hrsg.), Roman material culture. Studies in honour of Jan Thijssen (Zwolle 2009) 201–211.
Vos/Bazelmans et al. 2011P. Vos/J. Bazelmans/H. Weerts/M. van der Meulen, Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste IJstijd tot nu (Amsterdam 2011).
Abbildungsnachweis1 B. Brouwenstijn (VU University Amsterdam) nach
Vorlage des Verfassers.2 unpubliziert; Foto M. Ydo. 3 nach Derks 2008, Abb. 5.1 und 5.2. 4 Fotos Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. 5 Foto Vorderseite T. Derks; übrige Photos Rijks-
museum van Oudheden, Leiden.6 Fotos Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.7 nach Stuart 2003, 21, Abb. 14.8–11 Verf.12 nach Vermunt/De Clercq/Degryse 2009, 204,
Abb. 4.
Dr. Ton DerksResearch Institute CLUEFaculty of HumanitiesVU University AmsterdamDe Boelelaan 11051081 HV AmsterdamNiederlande