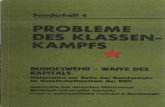Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.
Transcript of Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.
1
Christian Erk
Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion
Inhaltsübersicht
I. Corporate Responsibility oder die Frage nach der Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen
II. Das Konzept «Verantwortung» und seine Facetten
III. Können Unternehmen Verantwortung tragen?
IV. Unternehmensstrafrecht ohne Unternehmensverantwortung?
I. Corporate Responsibility oder die Frage nach der Verantwortungsfä-
higkeit von Unternehmen
Steuervermeidung, Lohndumping, Arbeitsplatzverlagerung bzw. Outsourcing in Billiglohnlän-
der, Massenentlassungen oder Werksschliessungen trotz Profitabilität, überbordende Mana-
gerlöhne, Ressourcenverschwendung, Korruption, Umweltverschmutzung, fragwürdige Wer-
bepraktiken, Bestechung, Kinderarbeit, Ausbeutung in Sweatshops, Unterlaufen von Sozial-
standards… Sobald ein Unternehmen öffentlich einer dieser Praktiken überführt oder auch
nur bezichtigt wird, dauert es nicht lange, bis mit fast schon reflexartiger Routine der Ruf
nach einer Stärkung der «Unternehmensverantwortung (UV)» bzw. der «Corporate Respon-
sibility (CR)»1 laut wird.
Was ist es aber genau, das da gestärkt werden soll? Den meisten von uns dürfte bei dieser
Frage ähnlich wie dem hl. Augustinus von Hippo gehen, der auf die Frage, was Zeit sei, ant-
wortete, dass er es wisse, wenn niemand ihn danach fragt, er es aber nicht wisse, wenn er
es jemandem, der ihn fragt, erklären wollte.2 Auch uns dürfte im Prinzip klar sein, was «Cor-
porate Responsibility» ist und worin sie besteht; aber wenn wir gebeten werden, diesen Be-
griff zu konkretisieren, dann dürfte es bei vielen von uns mit der Klarheit vorbei sein.
A) Corporate Responsibility: Ein Begriff mit vielen Definitionen
In einer solchen Situation ist es nicht selten hilfreich, sich einen Überblick darüber zu ver-
schaffen, wie andere den Begriff «Unternehmensverantwortung» bzw. «Corporate Respon-
sibility» definiert haben. Und Definitionsangebote gibt es genug: Über den Begriff der Unter-
nehmensverantwortung und seinen Gehalt wird nämlich nicht nur in akademischen Kreisen
Prof. Dr. phil. Christian Erk ist Assistenzprofessor für Management und Ethik an der Universität St. Gallen. Er vertritt im vorliegenden Aufsatz seinen persönlichen Standpunkt.
1 In der Literatur sind statt des Ausdrucks «Corporate Responsibility» auch die Ausdrücke «Corporate Social Responsibility (CSR)» und «Reponsible Business Conduct» («verantwortliche Unternehmensführung») gebräuchlich und werden syno-nym verwendet.
2 Diese Aussage findet sich in Buch XI, Kapitel 14 der «Confessiones (Bekenntnisse)» des hl. Augustinus und liest sich im Original wie folgt: «Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.» (AURELIUS
AUGUSTINUS. Confessionum Libri XIII. Hrsg. von Martin Skutella. Nachdruck der 2. Auflage von 1981. Berlin: Walter de Gruyter, 2012. S. 275.)
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
2
leidenschaftlich diskutiert und umfangreich publiziert; der Begriff ist darüber hinaus auch Ge-
genstand – auch durch Lobbying beeinflusster – politischer Aushandlungsprozesse und Be-
tätigungsfeld einer Vielzahl von zwischenstaatlichen/ internationalen Organisationen, Ver-
bänden, NGOs und Stiftungen3; und auch die betroffenen Entitäten selbst, die Unternehmen,
versuchen sich an seiner Interpretation und prägen ihn nicht zuletzt auch durch ihr Verhalten.
Analysiert man die vorfindbaren Definitionen, so lässt sich feststellen, dass sich praktisch
jede Definition des Begriffs «Corporate Responsibility» einer von zwei Kategorien zuordnen
lässt. Auf der einen Seite stehen Definitionen, nach denen Corporate Responsibility darin
besteht, dass Unternehmen – innerhalb des Rahmens des ihnen jeweils gesetzlich erlaubten
Verhaltens – Gewinne erwirtschaften und in die Bedingungen ihres zukünftigen Erfolgs rein-
vestieren: «There is one and only one social responsibility of business – to use its resources
and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of
the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or
fraud»4.
Dieser Sichtweise steht ein Verständnis von Corporate Responsibility gegenüber, nach dem
die Verantwortung von Unternehmen in mehr als nur der Erzielung von Gewinnen und der
Einhaltung von Gesetzen besteht. So verstehen – um nur ein paar Beispiele zu nennen –
manche unter Corporate Responsibility «policies and activities that go beyond mandatory
obligations such as economic responsibility (being profitable) and legal responsibility
(obeying the legislation and adhering to regulation)»5, andere beschreiben sie als «the efforts
corporations make above and beyond regulation to balance the needs of stakeholders with
the need to make a profit»6, dritte definieren sie als «the obligation to work for social better-
ment»7, wiederum andere umschreiben sie als «die Verantwortung von Unternehmen für ihre
Auswirkungen auf die Gesellschaft»8 und nochmals andere sehen sie als «den fakultativen
Beitrag der Privatwirtschaft an eine nachhaltige Entwicklung»9, bei dem «nicht die Einhaltung
3 Die Tätigkeit dieser Organisationen, Verbände, NGOs und Stiftungen schlägt sich nicht zuletzt in diversen (sich inhaltlich überschneidenden) Leitfäden und Standards nieder, die die aus ihrer Sicht jeweils wesentlichen Aspekte der Unterneh-mensverantwortung zu umreissen versuchen. Zu den wichtigsten Referenzstandards gehören sicherlich die «ISO 26000» der «International Organization for Standardization (ISO)», die «G4 Reporting Principles and Standard Disclosures» der «Global Reporting Initiative (GRI)», der «United Nations Global Compact», die «OECD-Leitsätze für multinationale Unter-nehmen», das «International <IR> Framework» des «International Integrated Reporting Council (IIRC)», die «Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy» der «International Labour Organization (I-PO)» und die «United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights».
4 MILTON FRIEDMAN. Capitalism and Freedom. Fortieth Anniversary Edition. Chicago: University of Chicago Press, 2008. S. 133. siehe hierzu auch: MILTON FRIEDMAN. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. 33 (13.09.1970): 122–126.
5 MINNA HALME & JUHA LAURILA. Philanthropy, Integration or Innovation? Exploring the Financial and Societal Outcomes of Different Types of Corporate Responsibility. Journal of Business Ethics 84.3 (2009): 325–339. S. 327.
6 DEBORAH DOANE. The Myth of CSR. Stanford Social Innovation Review 3.3 (2005): 22–29. S. 23. 7 WILLIAM C. FREDERICK. From CSR1 to CSR2. The Maturing of Business-and-Society Thought. Business and Society 33.2
(1994): 150–66. 8 EUROPÄISCHE KOMMISSION. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine neue EU-Strategie (2011–14) für die soziale Ver-antwortung der Unternehmen (CSR) (KOM 2011 (681) endgültig). Brüssel: 25.10.2011. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1427818686997&uri=CELEX:52011DC0681 S. 7.
9 STAATSSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT (SECO). CSR-Konzept des SECO. 11.12.2009. http://www.seco.admin.ch/themen/00645/04008/index.html?lang=de S. 2.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
3
der Gesetze, sondern darüber hinaus die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen im
Vordergrund»10 steht.
Besieht man sich die zur zweiten Kategorie gehörigen Definitionen genauer, so fällt auf, dass
sie keineswegs einen monolithisch-einheitlichen Block darstellen. Auch wenn zwischen allen
Definitionen dieser Kategorie Einigkeit herrscht, dass Corporate Responsibility mehr ist als
nur gesetzeskonforme Gewinnerzielung, so verlaufen innerhalb dieser Kategorie durchaus
auch Trennlinien. Zwischen den Definitionen der zweiten Kategorie herrscht nämlich Unei-
nigkeit, (a) worin genau dieses Mehr besteht, (b) ob sich dieses Mehr auf die Bedingungen
der Gewinnerzielung (z.B. Art der Produkte, Herstellungsbedingungen) und/ oder auch auf
die Verwendung des erzielten Gewinns (z.B. Spenden, Sponsoring) bezieht und (c) ob die-
ses Mehr freiwillig/ fakultativ oder obligatorisch ist, d.h. ob es den Unternehmen freigestellt
ist, dieses über die Einhaltung der Gesetze und der Erzielung von Gewinn hinausgehende
Verhalten an den Tag zu legen oder nicht.11
Wenn wir die Erkenntnisse, die sich aus ihrer Analyse gewonnen haben, zusammentragen,
so können wir festhalten, dass die verschiedenen Definitionen des Begriffs «Unternehmens-
verantwortung» bzw. «Corporate Responsibility» sich anhand der folgenden drei Fragen ka-
tegorisieren lassen:
Sind Unternehmen für mehr verantwortlich als die Erzielung von Gewinnen und die Einhal-
tung der jeweils für sie geltenden Gesetze?
Wenn ja:
o Worin genau besteht dieses über die gesetzeskonforme Gewinnerzielung hinausgehen-
de Verhalten?
o Bezieht sich dieses über die gesetzeskonforme Gewinnerzielung hinausgehende Verhal-
ten nur auf die Verwendung des erzielten Gewinns oder auch auf die Art und Weise der
Gewinnerzielung?
o Ist dieses über die gesetzeskonforme Gewinnerzielung hinausgehende Verhalten fakul-
tativ oder obligatorisch?
B) Die Frage nach der Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen
So weit, so gut. Man könnte sich nun an die Beantwortung dieser vier Fragen machen, um
so zu einer möglichst tragfähigen Vorstellung dessen zu gelangen, worin die Verantwortung
von Unternehmen besteht. Um hierbei jedoch Schnellschüsse zu vermeiden und zu halbga-
ren Lösungen zu kommen, lohnt es sich, an dieser Stelle kurz innezuhalten.
Denn eine wichtige Gemeinsamkeit aller Definitionen des Begriffs «Corporate Responsibili-
ty» geht aus obiger Analyse nicht hervor. Indem sie spezifizieren, wofür Unternehmen ver-
antwortlich sind, beruhen alle Definitionen von Corporate Responsibility logisch zwingend auf
einer gemeinsam geteilten Prämisse: Für alle muss implizit unumstritten sein, dass Unter-
10 SECO (Anm. 9), S. 2. 11 Für eine Diskussion der sich aus der Annahme der Freiwilligkeit von CR-Aktivitäten ergebenden juristischen Fragen (v.a.
in Bezug auf Art. 717 und Art. 718a OR) siehe: ROLF WATTER & TILL SPILLMANN. Corporate Social Responsibility – Leit-planken für den Verwaltungsrat Schweizerischer Aktiengesellschaften. Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (GesKR) 2–3 (2006): 94–116.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
4
nehmen Verantwortung tragen können. Doch, wie uns schon Georg Christoph Lichtenberg
warnt, ist mit solch impliziten Annahmen vorsichtig umzugehen: «Die gemeinsten Meinungen
und was jedermann für ausgemacht hält, verdient oft am meisten untersucht zu werden.»12
Und auch die Annahme, dass Unternehmen Verantwortung tragen können verdient eine sol-
che Untersuchung. Denn es sind – wie im Verlauf dieses Artikels gezeigt wird – durchaus
Zweifel angebracht, ob diese Prämisse aufrechterhalten werden kann. Wenn sich aber her-
ausstellt, dass Unternehmen nicht verantwortungsfähig sind, wäre es sinnlos, weiter in der
Form wie bisher darüber zu diskutieren, worin die Verantwortung von Unternehmen besteht.
Bevor also eine wie auch immer geartete inhaltliche Aussage über das Thema «Unterneh-
mensverantwortung» gemacht werden kann, ist es also nicht nur sinnvoll, sondern auch not-
wendig, gilt es die Frage zu beantworten, ob Unternehmen überhaupt Verantwortung tragen
können. Um dies tun zu können, müssen wir jedoch zuerst wissen, was es überhaupt bedeu-
tet, wenn wir sagen, dass jemand für etwas verantwortlich ist:
«If people are going to adopt the terminology of <responsibility> […] to suggest new, impro-ved ways of dealing with corporations, then they ought to go back and examine in detail what <being responsible> entails in the ordinary case of the responsible human being. Only after we have considered what being responsible calls for in general does it make sense to deve-lop the notion of a corporation being responsible.»13
Zu Beginn der Beschäftigung mit dem Thema «Corporate Responsibility» muss also die
grundlegende und damit philosophische Auseinandersetzung mit dem Konzept «Verantwor-
tung» stehen. Besteht über dieses einmal Klarheit, kann es in einem zweiten Schritt auf Un-
ternehmen übertragen und nach der Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen gefragt wer-
den. Und erst nachdem letztere bejaht worden ist, macht es Sinn, sich Gedanken darüber zu
machen, worin genau die Verantwortung von Unternehmen besteht.
Aufgrund ihrer grundlegenden Bedeutung auch für die Rechtswissenschaft (vgl.
Art. 102 StGB) widmet sich dieser Artikel in seinem weiteren Verlauf der Beantwortung den
folgenden beiden Fragen:
1. Was bedeutet die Aussage «A trägt Verantwortung für X»?
2. Können Unternehmen Träger von Verantwortung sein?
Die nachfolgenden Kapitel arbeiten diese beiden Fragen der Reihe nach ab: Kapitel II wid-
met sich der ersten und Kapitel III der zweiten Frage, bevor in einem letzten Kapitel vor dem
Hintergrund der in diesen beiden Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse über die Sinnhaftigkeit
von Art. 102 StGB nachgedacht wird.
12 GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG. Georg Christoph Lichtenberg’s Vermischte Schriften. Neue vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe. Mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht des Geburtshauses des Verfassers. Erster Band. Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1853. S. 98.
13 CHRISTOPHER D. STONE. Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Behavior. New York: Harper & Row, 1975. S. 111.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
5
II. Das Konzept «Verantwortung» und seine Facetten14
Die Aussage «A ist verantwortlich für X» bzw. «A trägt Verantwortung für X» kann auf ver-
schiedene Arten verstanden werden. Um herauszuarbeiten, wie viele Facetten der Begriff
der Verantwortung hat, ist es hilfreich, sich das anzuschauen, wofür A verantwortlich ist,
nämlich X. Was hier vor allem in den Blick zu nehmen ist, ist zum einen die Frage, was ge-
nau X ist, um zum anderen, ob X in der Vergangenheit oder der Zukunft liegt.
Grundsätzlich kann X in einem bestimmten Verhalten (VT/U)15 oder einer Konsequenz eines
Verhaltens VT/U (KV)16 bestehen. Je nachdem, ob es sich bei X um ein bereits an den Tag
gelegtes Verhalten VT/U von A bzw. um eine bereits eingetretene Konsequenz KV eines ver-
gangenen Verhaltens VT/U von A oder um ein in der Zukunft liegendes Verhalten VT/U von A
bzw. eine noch nicht eingetretene Konsequenz KV eines vergangenen oder zukünftigen Ver-
haltens VT/U von A handelt, hat die Aussage «A ist verantwortlich für X» jedoch einen grund-
legend unterschiedlichen Gehalt. Die beiden sich aus der Beantwortung der Frage nach der
zeitlichen Relation von X zur jeweiligen Gegenwart ergebenden Bedeutungsdimensionen
des Verantwortungsbegriffs werden üblicherweise als «prospektive Verantwortung» und «ret-
rospektive Verantwortung» bezeichnet:
Prospektive Verantwortung: Trägt A Verantwortung für X und steht X für ein in der
Zukunft liegendes Verhalten VT/U von A bzw. eine noch nicht eingetretene Konsequenz
KV eines (vergangenen oder zukünftigen) Verhaltens VT/U von A, dann ist A prospektiv
verantwortlich für X.
Retrospektive Verantwortung: Trägt A Verantwortung für X und steht X für ein ver-
gangenes Verhalten VT/U von A bzw. eine bereits eingetretene Konsequenz KV eines
vergangenen Verhaltens VT/U von A, dann ist A retrospektiv verantwortlich für X.
Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass es sich bei der Verantwortung um einen mehr-
stelliges Konzept handelt: Um sinnvoll über Verantwortung reden zu können, bedarf es we-
nigstens der Angabe eines Verantwortungsträgers (Verantwortungssubjekt), eines Verant-
wortungsobjekts bzw. -gegenstands und auch der spezifischen in Frage stehenden Form der
Verantwortung (Verantwortungsart). Doch damit nicht genug: Denn damit die Zuschreibung
einer bestimmten Verantwortungsart nicht willkürlich geschieht, muss begründet werden
können, weswegen ein Verantwortungssubjekt auf genau diese und keine andere Art ver-
antwortlich ist. Diese Begründung erfolgt unter Bezug auf den Verantwortungsstandard bzw.
-grund, der spezifiziert, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit einem Verantwor-
tungssubjekt eine bestimmte Verantwortungsart zugeschrieben werden kann. Um sinnvoll
über Verantwortung reden zu können, bedarf es – mit anderen Worten – wenigstens der Be-
antwortung der Frage, wer (Verantwortungssubjekt) wofür (Verantwortungsobjekt) wie (Ver-
antwortungsart) weswegen (Verantwortungsgrund) verantwortlich ist.
14 Der Inhalt dieses Kapitels basiert auf in folgendem Werk publiziertem Material: CHRISTIAN ERK. Rationierung im Gesund-heitswesen. Eine wirtschafts- und sozialethische Analyse der Rationierung nach Selbstverschulden. Berlin: de Gruyter, 2015. Kapitel III.1–4.
15 Mit der Abkürzung VT/U soll angedeutet werden, dass das Verhalten sowohl ein Tun (positives aktives Verhalten) als auch ein Unterlassen (negatives aktives Verhalten) beinhalten kann.
16 Zu KV, d.h. den Konsequenzen von VT/U, gehören alle aus VT/U resultierenden Sachverhalte, Zustände, Ergebnisse, Ereig-nisse und/ oder Folgen.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
6
Auf den folgenden Seiten soll kurz auf die unterschiedlichen Verantwortungsarten und die
ihnen zugrundeliegenden Verantwortungsstandards eingegangen werden.
A) Prospektive Verantwortung
Wenn einem Verantwortungssubjekt A prospektive Verantwortung für X zugeschrieben wird,
so ist damit im Kern ausgesagt, dass A für die Realisierung von X bzw. dafür zu sorgen hat,
dass X in der Zukunft (der Fall ist). Unabhängig vom konkreten Inhalt der prospektiven Ver-
antwortung bedeutet dies, dass A in Bezug auf X nicht frei ist, sich so zu verhalten, wie er
möchte bzw. dass A’s Freiheit eingeschränkt ist. Und dies ist genau das Kennzeichen und
Wesen einer Pflicht.17 Prospektive Verantwortung zu tragen bedeutet somit nichts anderes,
als eine Pflicht zu besitzen. Mit anderen Worten: Die Aussage «A ist prospektiv verantwort-
lich für X» ist gleichbedeutend mit der Aussage «A besitzt eine Pflicht mit Inhalt X». Wir kön-
nen also im Sinne einer Definition festhalten:
Prospektive Verantwortung: A trägt prospektive Verantwortung für X, wenn und weil A
eine Pflicht mit Inhalt X besitzt.
Wie bereits erwähnt, ist es der prospektiven Verantwortung eigen, dass sie sich auf die Zu-
kunft bezieht: Ein prospektive Verantwortung tragendes Verantwortungssubjekt ist für die
Realisierung von etwas verantwortlich, das noch nicht realisiert ist. Entsprechend kann das
Verantwortungsobjekt (X) der prospektiven Verantwortung nur in der zukünftigen Realisie-
rung eines bestimmten Verhaltens VT/U oder der zukünftigen Realisierung eines bestimmten
Zustands oder Sachverhalts, der als Konsequenz KV eines nicht näher bestimmten Verhal-
tens VT/U auftritt, bestehen. In erstem Fall besitzt das Verantwortungssubjekt die Pflicht, ein
bestimmtes VT/U zu realisieren; in zweitem Fall besitzt das Verantwortungssubjekt die Pflicht,
die Realisierung einer bestimmten KV beförderndes Verhalten VT/U an den Tag zu legen und
die Realisierung einer bestimmten KV nicht beförderndes Verhalten VT/U zu unterlassen.
Wie in obiger Definition festgeschrieben, trägt ein Verantwortungssubjekt A prospektive Ver-
antwortung für ein Verantwortungsobjekt X, wenn und weil A eine Pflicht mit Inhalt X besitzt.
Die Existenz einer Pflicht ist jedoch nicht eine Sache der Beliebigkeit. Als Verhaltensein-
schränkungen bedürfen Pflichten zu ihrer Entstehung einer Begründung, sei diese nun posi-
tiver/ legaler, konventioneller oder moralischer Natur.18 Legale/ positive Pflichten verdanken
ihre Existenz der Legiferierung durch eine hierzu befugte Autorität; zu dieser Klasse an
Pflichten gehören alle in Form von Gesetzen kodifizierten Pflichten. Konventionelle Pflichten
sind Pflichten, die in sozialer Praxis (d.h. Sitte, Brauch und/ oder Gewohnheit) wurzeln; als
solche bestehen sie unabhängig von Legiferierungsprozessen. Die dritte Klasse an Pflichten,
17 Eine Pflicht kann in zwei unterschiedlichen Formen auftreten. Diese leiten sich aus der Unterscheidung ab, nach der ein Verhalten VT/U, zu dem wir verpflichtet sind, entweder geboten oder nicht geboten (freigestellt) und verboten oder nicht verboten (erlaubt) sein kann (siehe hierzu ERK (Anm. 14), Kapitel IV.1). Ein gebotenes und nicht verbotenes Verhalten VT/U ist ein Gebot (auch: Gebotspflicht). Ein Verhalten VT/U, das zwar nicht geboten, aber verboten ist, ist ein Verbot (auch: Verbotspflicht). Ein Verhalten VT/U, das weder verboten noch geboten ist, d.h. das erlaubt und freigestellt ist, stellt eine sog. Freiheit (auch: Freiheitsrecht) dar. Für einen umfassenden Überblick über das Konzept der Pflicht siehe ERK (Anm. 14), Kapitel IV.2–5.
18 Für einen Überblick über diese verschiedenen Arten der Begründung von Pflichten und die daraus entstehenden Pflichten (positive/ legale, konventionelle, moralische Pflichten) siehe auch ERK (Anm. 14), Kapitel IV.4.2.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
7
moralische Pflichten, sind durch Ableitung aus einer moralischen Theorie begründet. Solche
Pflichten sind ihrem Wesen nach prä- und überpositiv als auch prä- und überkonventionell;
sie existieren und gelten also, ohne dass sie in einem Gesetz stehen oder Teil einer sozialen
Praxis sind und auch dann, wenn sie legalen und/ oder konventionellen Pflichten widerspre-
chen19. Analog zu der Existenz positiver/ legaler, konventioneller und moralischer Pflichten
kann man also zwischen positiver/ legaler, konventioneller und moralischer prospektiver
Verantwortung unterscheiden.
B) Retrospektive Verantwortung
Mit der retrospektiven Verantwortung verhält es sich (leider) nicht ganz so einfach wie mit
der prospektiven Verantwortung. Wie oben erwähnt, besteht das Verantwortungsobjekt (X)
dieser Form der Verantwortung in einem vergangenen Verhalten VT/U bzw. in einer bereits
eingetretenen Konsequenz KV eines vergangenen Verhaltens VT/U. Je nachdem, ob man das
Zustandekommen von X oder die Reaktion auf das Zustandekommen von X in den Blick
nimmt, wird innerhalb der retrospektiven Verantwortung zwischen (retrospektiver) Kausal-
verantwortung und (retrospektiver) Rechtfertigungsverantwortung unterschieden.
1. (Retrospektive) Kausalverantwortung
Der (retrospektiven) Kausalverantwortung geht es um die Klärung der Frage, ob einem Ver-
antwortungssubjekt A eine kausale Rolle bei der Hervorbringung des Verantwortungsobjekts
zugeschrieben werden kann. A ist also kausalverantwortlich, wenn ihm Kausalität für das
Zustandekommen eines vergangenen Verhaltens VT/U bzw. einer bereits eingetretenen Kon-
sequenz KV eines vergangenen Verhaltens VT/U nachgewiesen werden kann. Wann ist dies
aber der Fall?
Allgemein gesprochen hat A X dann verursacht, wenn X in einem vergangenen Verhalten
VT/U von A besteht oder wenn ein vergangenes Verhalten VT/U von A dazu geführt hat, dass X
und nicht nicht-X der Fall ist, d.h. wenn X eine Konsequenz KV eines vergangenen Verhal-
tens VT/U von A ist. Damit jedoch nicht genug: Denn in beiden Fällen wird implizit vorausge-
setzt, dass A auch kausal für das Verhalten VT/U war. Dass dies jedoch nicht immer der Fall
ist, wird anhand des folgenden Beispiels deutlich: A kann B bewusst, also wissentlich und
willentlich, auf den Fuss getreten sein; A kann aber auch von C geschubst worden und B
somit aus Versehen auf den Fuss getreten sein. Während wir in beiden Fällen eine Kausal-
verantwortung von A für das Auf-den-Fuss-Treten in dem Sinn bejahen können, dass A und
sonst niemand B auf den Fuss getreten ist, so hat die Kausalverantwortung von A im zweiten
Fall doch eine andere Qualität. Denn im zweiten Fall war das Verhalten VT/U von A kein be-
19 In diesem Sinne ist die im Wesentlichen auf Thomas von Aquin zurückgehende, aber sich bereits schon bei Platon, Aristo-teles und Augustinus findende (vgl. hierzu NORMAN KRETZMANN. Lex Iniusta Non est Lex – Laws on Trial in Aquinas' Court of Conscience. American Journal of Jurisprudence 33.1 (1988): 99–122. S. 100f.) Maxime zu verstehen, nach der ein un-gerechtes, d.h. ein nicht mit dem moralischen Sittengesetz in Einklang stehendes (positives) Gesetz kein Gesetz ist («lex iniusta non est lex»).
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
8
wusstes Verhalten. Entsprechend kann zwischen zwei Formen der (retrospektiven) Kausal-
verantwortung unterschieden werden:
(Retrospektive) äussere Kausalverantwortung: A trägt (retrospektive) äussere Kausal-
verantwortung für X, wenn und weil es sich bei X um ein vergangenes Verhalten VT/U von A
handelt oder wenn X eine bereits eingetretene Konsequenz KV eines vergangenen Verhal-
tens VT/U von A ist.
(Retrospektive) innere Kausalverantwortung: A trägt (retrospektive) innere Kausalver-
antwortung für X, wenn und weil A äussere Kausalverantwortung für X trägt und wenn das
vergangene Verhalten VT/U von A ein bewusstes (d.h. wissentliches und willentliches) VT/U
von A war.
2. (Retrospektive) Rechtfertigungsverantwortung
Während die Zuschreibung prospektiver Verantwortung normativer und die retrospektiver
Kausalverantwortung deskriptiver Natur ist, stellt die Zuschreibung von (retrospektiver)
Rechtfertigungsverantwortung im Kern einen wertenden und evaluativen Vorgang dar. Die
Zuschreibung dieser Art von Verantwortung hat nämlich Konsequenzen: Wenn ein Verant-
wortungssubjekt A Rechtfertigungsverantwortung für ein Verantwortungsobjekt X trägt, dann
bedeutet dies, dass A für die Tatsache, dass X (der Fall ist), mit einer bestimmten Reaktion
bedacht worden ist. Im Zentrum der Rechtfertigungsverantwortung steht somit die Frage, ob
A für die Tatsache, dass ein bestimmtes Verhalten VT/U an den Tag gelegt oder aufgrund
eines bestimmten Verhaltens VT/U eine Konsequenz KV herbeigeführt worden ist, mit einer
bestimmten Reaktion bzw. Verantwortungskonsequenz bedacht werden kann.
Eine solche Reaktion kann hierbei entweder positiv, neutral oder negativ ausfallen: Eine ne-
gative Reaktion äussert sich gemeinhin in einer Bestrafung oder Tadel; eine positive Reakti-
on besteht üblicherweise in einer Belohnung oder Lob; eine neutrale Reaktion liegt dann vor,
wenn sowohl eine positive als auch eine negative Reaktion ausbleibt. Welche dieser drei
möglichen Reaktionen zum Tragen kommt, hängt davon ab, ob dem Verantwortungssubjekt
A, dem Rechtfertigungsverantwortung für die Tatsache, dass X (der Fall ist), zugeschrieben
werden soll, eine prospektive Verantwortung für X besessen hat oder nicht:
A hat eine Pflicht mit Inhalt X besessen, d.h. eine Pflicht dafür zu sorgen, dass X
(der Fall ist): A dafür zur Rechenschaftsverantwortung zu ziehen, dass X (der Fall ist),
würde bedeuten, A dafür zu belohnen oder zu bestrafen, dass A getan hat, was A zu
tun verpflichtet war. Diese Konstellation zeitigt sicher keine negative Reaktion, aber
normalerweise auch keine positive, sondern üblicherweise eine neutrale Reaktion.
A hat eine Pflicht mit Inhalt nicht-X besessen, d.h. eine Pflicht dafür zu sorgen,
dass nicht-X (der Fall ist): A dafür zur Rechenschaftsverantwortung zu ziehen, dass
X (der Fall ist), würde bedeuten, A dafür zu belohnen oder zu bestrafen, dass A gegen
seine Pflicht verstossen hat, dafür zu sorgen, dass nicht-X (der Fall ist). Diese Konstel-
lation zeitigt sicher keine positive und wohl auch keine neutrale, sondern üblicherweise
eine negative Reaktion, da durch die Verletzung einer Pflicht gegen die Gerechtigkeit
verstossen worden ist.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
9
A hat keine in Zusammenhang mit X stehende Pflicht besessen, d.h. weder eine
Pflicht mit Inhalt X noch eine Pflicht mit Inhalt nicht-X: A dafür zur Rechenschafts-
verantwortung zu ziehen, dass X (der Fall ist), würde bedeuten, A dafür zu belohnen
oder zu bestrafen, dass A ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das ihm freigestellt
war, d.h. das ihm weder geboten noch verboten war. Diese Konstellation zeitigt sicher
keine negative und normalerweise auch keine positive Reaktion; die Reaktion wird üb-
licherweise neutral ausfallen.
Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich wird, zeitigt nur die zweite dieser drei Konstellatio-
nen als Verstoss gegen die Gerechtigkeit eine nicht neutrale, nämlich eine negative Reakti-
on. Wenn wir einen genaueren Blick auf diese Konstellation werfen, so können wir hieraus
folgende notwendige Bedingung der Zuschreibung negativer, d.h. der mit einer negativen
Reaktion verbundenen Form der Rechtfertigungsverantwortung ableiten: A kann nur dann für
die Tatsache, dass X (der Fall ist), mit einer negativen Reaktion (Strafe, Tadel) bedacht wer-
den, wenn A eine (vollkommene) Pflicht mit Inhalt nicht-X besessen hat. Diese Bedingung ist
jedoch nicht die einzige notwendige Bedingung der Zuschreibung von Rechtfertigungsver-
antwortung: Damit A für die Tatsache, dass X (der Fall ist), mit einer negativen Reaktion
(Strafe, Tadel) bedacht werden, muss A zudem innere und äussere Kausalverantwortung für
X besitzen. Denn es wäre Willkür, jemandem für etwas zu bestrafen oder zu tadeln, an des-
sen Zustandekommen er in keiner Weise beteiligt war.20
Es bleibt nun noch ein letzter gedanklicher Schritt zu gehen. Denn ein Verantwortungssub-
jekt A trägt im Grunde nicht schon dadurch Rechtfertigungsverantwortung für X, dass die
beiden bisher herausgearbeiteten Bedingungen erfüllt sind, sondern erst dann, wenn A dar-
über hinaus von einer dazu befugten Verantwortungsinstanz mit einer entsprechenden Reak-
tion bedacht und so zur Verantwortung gezogen worden ist. Das Konzept der Rechtferti-
gungsverantwortung verlangt somit nach einer sog. Verantwortungsinstanz, vor der sich das
Verantwortungssubjekt zu verantworten hat und die die Art und das Ausmass der Reaktion
auf die Zuschreibung von Rechtfertigungsverantwortung festsetzt.
Das bisher Gesagte zusammenfassend kann die (retrospektive) negative Rechtfertigungs-
verantwortung – und analog dazu auch die (retrospektive) positive Rechtfertigungsverant-
wortung – wie folgt definiert werden:
(Retrospektive) negative Rechtfertigungsverantwortung: A trägt negative (retrospekti-
ve) Rechtfertigungsverantwortung für X, wenn und weil A prospektive Verantwortung für
nicht-X getragen hat, A für X innere Kausalverantwortung trägt, A für X äussere Kausalver-
antwortung trägt, keine Exkulpationsgründe vorliegen und A von einer dazu kompetenten
Instanz zum Ausgleich des durch die Tatsache, dass X (der Fall ist), verursachten Verstos-
20 Selbst wenn einer Person P sowohl innere als auch äussere Kausalverantwortung für ein Verantwortungsobjekt X zuge-schrieben werden kann und selbst wenn sie zusätzlich eine Pflicht mit Inhalt nicht-X hatte, dann ist damit nicht automa-tisch gesagt, dass P für X zur Rechenschaft gezogen und mit einer negativen Reaktion (Strafe, Tadel) bedacht werden kann. Es können nämlich Gründe vorliegen, die dies verhindern, indem sie P exkulpieren. Ein Beispiel für einen solchen Exkulpationsgrund ist die sog. „Doctrine of Double Effect (DDE)“.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
10
ses gegen die Gerechtigkeit mit einer negativen Reaktion (Strafe, Tadel) bedacht worden
ist.21
(Retrospektive) positive Rechtfertigungsverantwortung: A trägt positive (retrospektive)
Rechtfertigungsverantwortung für X, wenn und weil A keine prospektive Verantwortung für
X getragen hat, A für X innere Kausalverantwortung trägt, A für X äussere Kausalverant-
wortung trägt, keine Exkulpationsgründe vorliegen und A für die Tatsache, dass X (der Fall
ist), von einer dazu kompetenten Instanz mit einer positiven Reaktion (Belohnung, Lob) be-
dacht worden ist.
C) Die fünf Arten der Verantwortung im Überblick
Wenn wir die vorangegangenen Kapitel herausgearbeiteten Einsichten zusammenfassen, so
können wir sagen, dass von Verantwortung grundlegend in zweierlei Hinsicht gesprochen
werden kann, nämlich in prospektiver und retrospektiver Hinsicht. Während das Tragen
prospektiver Verantwortung gleichbedeutend mit dem Tragen einer Pflicht ist, kann die retro-
spektive Verantwortung in die beiden Teilaspekte Kausalverantwortung und Rechtfertigungs-
verantwortung untergliedert werden, wobei die Kausalverantwortung nochmals in innere und
äussere Kausalverantwortung unterschieden werden muss.
Die nachfolgende Tabelle enthält eine zusammenfassende Übersicht über und detaillierte
Definitionen der fünf in diesem Kapitel herausgearbeiteten Verantwortungsarten:
Die fünf Arten der Verantwortung im Überblick (Eigene Darstellung)
21 In Anlehnung an die juristische Terminologie könnte man auch sagen, dass es für die Zuschreibung retrospektiver Recht-fertigungsverantwortung u.a. des Vorliegens eines «actus reus» (Verletzung einer Pflicht; lat. culpa) und eines «mens rea» (innere (und damit auch äussere) Kausalverantwortung für die Pflichtverletzung) bedarf.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
11
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
12
III. Können Unternehmen Verantwortung tragen?
Was bedeuten diese Überlegungen zum Konzept der Verantwortung nun für das uns im
Rahmen dieses Artikels interessierende Thema der Corporate Responsibility? Zu Beginn
dieses Artikels wurde die im Zusammenhang mit der Unternehmensverantwortung notwen-
digerweise zu adressierende Frage aufgeworfen, welche Vorstellung von Verantwortung
hinter der Aussage steckt, dass Unternehmen für etwas (z.B. Gewinn, Umwelt, Gesellschaft,
Mitarbeiter, o.ä.) verantwortlich sind. Grundsätzlich kann diese Aussage mit jeder der fünf im
vorangegangenen Kapitel herausgearbeiteten Verantwortungsarten gefüllt werden: Man
kann sich ohne weiteres Gedanken darüber machen, ob Unternehmen für all die eben bei-
spielhaft aufgezählten Dinge im Sinne der prospektiven, der äusseren Kausal-, der inneren
Kausal-, der negativen Rechtfertigungs- oder der positiven Rechtfertigungsverantwortung
verantwortlich sind oder sein können.
Es reicht jedoch nicht aus, wenn wir als mit dem Thema Corporate Responsibility befasste
Autoren jeweils explizit darlegen, über welche der fünf möglichen Arten der Verantwortung
von Unternehmen wir jeweils sprechen. Denn streng genommen steht es uns nicht frei, ein-
fach eine beliebige der fünf Verantwortungsarten herauszugreifen und zu fragen, ob Unter-
nehmen diese spezifische Verantwortungsart tragen. Wir haben beim Nachdenken über das
Thema Unternehmensverantwortung nämlich zu berücksichtigen, dass zwischen der pros-
pektiven, der Kausal- und der Rechtfertigungsverantwortung ein logischer Zusammenhang
besteht.
A) Über welche Art der Verantwortung sollten wir reden?
Worin besteht der eben erwähnte Zusammenhang? Wie aus den Ausführungen des voran-
gegangenen Kapitels hervorgeht, setzt die negative Rechtfertigungsverantwortung sowohl
prospektive als auch Kausalverantwortung voraus. Genauer: A kann nur dann für die Tatsa-
che, dass X (der Fall ist), negative Rechtfertigungsverantwortung tragen, wenn A sowohl
prospektive Verantwortung für nicht-X als auch innere22 Kausalverantwortung für X trägt.
Oder auf das uns interessierende Thema der Unternehmensverantwortung gemünzt: Ein
Unternehmen U kann nur dann für die Tatsache, dass X (der Fall ist), mit einer negativen
Reaktion (Strafe, Tadel) bedacht werden, wenn U sowohl prospektive Verantwortung für
nicht-X als auch innere Kausalverantwortung für X trägt.
Man kann also nur dann sinnvoll über die Rechtfertigungsverantwortung von Unternehmen
sprechen, wenn man sich vorher mit der prospektiven und der inneren Kausalverantwortung
von Unternehmen befasst und nachgewiesen hat, dass Unternehmen diese beiden Verant-
wortungsarten besitzen.23 Um diesen Nachweis zu erbringen, sind konkret die folgenden drei
Fragen zu beantworten:
22 Es ist ausreichend, in diesem Zusammenhang nur von innerer Kausalverantwortung zu sprechen. Denn wie aus der For-mulierung dieser beiden Arten der Kausalverantwortung hervorgeht (vgl. Kapitel II.B.1), trägt A automatisch auch äussere Kausalverantwortung für X, wenn A innere Kausalverantwortung für X trägt.
23 Vor diesem Hintergrund sollte auch einsichtig, dass und wieso die in den in Kapitel I.A erwähnten Definitionen des Begriffs «corporate responsibility» teilweise enthaltene Vorstellung von Unternehmensverantwortung als etwas der Freiwilligkeit
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
13
(1) Können Unternehmen Pflichten (und damit prospektive Verantwortung) besitzen?
(2) Wenn ja, welche Pflichten besitzen Unternehmen?
(3) Können Unternehmen innere Kausalverantwortung tragen?
Das folgende Kapitel versucht, eine Antwort auf die erste Frage zu geben.
B) Bedingungen für die Möglichkeit des Besitzes prospektiver Verantwortung
Die Beantwortung der Frage, ob Unternehmen Pflichten (und damit prospektive Verantwor-
tung) besitzen können, verlangt von uns, zunächst einmal die generellen Bedingungen für
die Möglichkeit des Besitzes von Pflichten herauszuarbeiten. Wenn Unternehmen diese er-
füllen, dann können sie Pflichten (und damit prospektive Verantwortung) besitzen; wenn
nicht, dann nicht. Grundsätzlich ist hierbei zwischen zwei Klassen von Bedingungen zu un-
terscheiden: Die erste Klasse umfasst alle Bedingungen, die Unternehmen aus logischen
Gründen und unabhängig von der Art der Pflicht (positiv/ legal, konventionell, moralisch) er-
füllen müssen, damit sie überhaupt Pflichten besitzen können. Die zweite Klasse enthält die-
jenigen Bedingungen, die Unternehmen darüber hinaus erfüllen müssen, damit sie positive/
legale, konventionelle oder moralische Pflichten besitzen können.24 Der Zusammenhang
zwischen diesen beiden Klassen an Bedingungen ist dergestalt, dass sich für Unternehmen,
die eine in der ersten Klasse enthaltenen Bedingungen nicht erfüllen, eine Beschäftigung mit
den Bedingungen der zweiten Klasse erübrigt.
Wenden wir uns also der ersten Klasse an Bedingungen zu: Nach dem Grundsatz «ought
implies can» impliziert jedes Sollen, d.h. jede Pflicht, notwendigerweise auch ein Können.25
Dieser Grundsatz wird oft dahingehend interpretiert, dass etwas (X) nur dann eine Pflicht
sein kann, wenn es (unter normalen Umständen) nicht unmöglich ist, X zu erfüllen. Niemand
kann dazu verpflichtet sein, objektiv Unmögliches zu leisten, d.h. zu leisten, was niemand zu
leisten imstande ist. Da es unter normalen Umständen und objektiv unmöglich ist, z.B. den
atlantischen Ozean mit einem einzigen Schluck auszutrinken, kann niemand dazu verpflich-
tet sein, den atlantischen Ozean mit einem einzigen Schluck auszutrinken.
Der Grundsatz «ought implies can» impliziert darüber hinaus aber auch, dass der Inhaber
einer Pflicht, die zu erfüllen unter normalen Umständen grundsätzlich möglich ist, die zur
Erfüllung der Pflicht nötige(n) Fähigkeit(en) entweder bereits besitzt (aktueller Besitz) oder
zumindest in der Lage ist, sich diese anzueignen (potentieller Besitz). Niemand kann dazu
verpflichtet sein, etwas zwar objektiv Mögliches zu leisten, das zu leisten ihm jedoch subjek-
Anheimgestelltes letzten Endes eine «contradictio in adiecto», d.h. ein Widerspruch in sich selbst ist. Wenn es etwas Freiwilliges wäre, dürfte man – wenn man den Begriff «Verantwortung» in seinem umfassenden Sinn versteht – nicht von Unternehmensverantwortung sprechen.
24 In diesem Zusammenhang ist z.B. die Anforderung des Personseins zu nennen. So kann ein Seiendes nur dann morali-sche Rechte und Pflichten tragen, wenn es eine moralische Person ist (vgl. ERK (Anm.14), Kapitel IV.6). Ähnliches gilt auch im Rahmen des Schweizer Rechts, das Rechtssubjekte, d.h. eigenständige Träger eigener positiver Rechten und positiver Pflichten innerhalb der Rechtsgemeinschaft, als Personen bezeichnet: «Personen sind die Subjekte der (Privat-)Rechtsordnung.» (HEINZ HAUSHEER & REGINA E. AEBI-MÜLLER. Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbu-ches. 3. Auflage. Bern: Stämpfli, 2012. S. 1 (RZ 01.01); vgl. auch CHRISTIAN BRÜCKNER. Das Personenrecht des ZGB (oh-ne Beurkundung des Personenstandes). Zürich: Schulthess, 2000. S.5 (RZ 5–6)).
25 Andere Formulierungen dieses Grundsatzes lauten «ultra posse nemo obligatur», «impossibilium nulla obligatio est» oder «ad impossibilia nemo obligatur».
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
14
tiv unmöglich ist. Mit anderen Worten: Jemand, für den es ein Ding der Unmöglichkeit ist, die
zur Erfüllung einer Pflicht mit Inhalt X nötigen Fähigkeit(en) gegenwärtig (aktueller Besitz)
oder durch Aneignung26 zukünftig (potentieller Besitz) zu besitzen, kann nicht Träger der
Pflicht mit Inhalt X sein.
Hiermit ist jedoch zweierlei ausgesagt: Zum einen darf es dem Inhaber einer Pflicht nicht
generell unmöglich sein, diejenigen Fähigkeit(en) aktuell oder potentiell zu besitzen, die zur
Erfüllung einer bestimmten Pflicht mit Inhalt X nötig sind. Zum anderen darf es dem Inhaber
einer Pflicht darüber hinaus jedoch nicht grundsätzlich unmöglich sein, diejenige Fähigkeit
aktuell oder potentiell zu besitzen, deren Besitz – soz. als gemeinsamer Nenner jeglicher
Pflichterfüllung – nötig ist, um überhaupt Pflichten erfüllen zu können. Bei der hier angespro-
chenen Fähigkeit handelt es sich um die Fähigkeit, bewusst (voluntary) handeln bzw. be-
wusstes Verhalten bVT/U an den Tag legen zu können – und damit um die Fähigkeit, innere
Kausalverantwortung tragen zu können. Wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden ist und auch
nicht erworben werden kann, dann ist es unmöglich, eine Pflicht – egal welchen Inhalts – zu
besitzen.
Aus dem Grundsatz «ought implies can» ergeben sich somit die folgenden Bedingungen für
die Möglichkeit des Besitzes einer Pflicht und damit prospektiver Verantwortung:
A kann eine Pflicht mit Inhalt X nur dann besitzen, wenn
(a) die Erfüllung der Pflicht keine generelle Unmöglichkeit darstellt, d.h. wenn es unter nor-
malen Umständen und objektiv nicht unmöglich ist, X zu realisieren,
(b) A die Fähigkeit besitzt, bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag zu legen, oder es A zu-
mindest grundsätzlich nicht unmöglich ist, diese Fähigkeit zu besitzen,
(d.h. A die Fähigkeit besitzt, innere Kausalverantwortung tragen zu können) und
(c) A die Fähigkeit besitzt, das spezifische zur Realisierung von X nötige bewusste Verhal-
ten bVT/U an den Tag zu legen oder es A zumindest grundsätzlich nicht unmöglich ist, diese
Fähigkeit zu besitzen.
Nur wenn Unternehmen diese Bedingungen kumulativ erfüllen, können sie Träger einer be-
stimmten Pflicht mit Inhalt X sein. Da es uns momentan um die allgemeinen und damit vom
konkreten Pflichtinhalt unabhängigen Bedingungen der Möglichkeit des Besitzes von Pflich-
ten geht, reicht es aus, wenn wir uns auf Bedingung (b) konzentrieren. Denn einzig diese
Bedingung ist unabhängig vom konkreten Pflichtinhalt X.
Als nächstes gilt es also zu prüfen, ob Unternehmen Bedingung (b) erfüllen können oder
nicht. Können sie es, dann sind sie in der Lage, Pflichten zu besitzen, und es ist für jede
Pflicht mit Inhalt X jeweils separat zu prüfen, ob auch die Bedingungen (a) und (c) erfüllt
sind. Ist es ihnen unmöglich, Bedingung (b) zu erfüllen, dann können sie keine Pflichten be-
sitzen und können entsprechend auch nicht Träger prospektiver Verantwortung sein; sie
können dann aber auch keine innere Kausalverantwortung tragen, so dass die zu Beginn
26 In diesem Zusammenhang ist das Problem der Verhältnismässigkeit zu erwähnen, das darin besteht, eine Antwort auf die Frage zu geben, innerhalb welcher Frist die Aneignung der zur Pflichterfüllung nötigen Fähigkeit(en) zu geschehen hat und welcher Aufwand (ordentlicher vs. ausserordentlicher) bei der Aneignung zu betreiben ist. Diese Frage spielt für den Zweck dieses Artikels jedoch keine Rolle.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
15
dieses Kapitels formulierte Frage nach der Möglichkeit der Übernahme von innerer Kausal-
verantwortung gleich mitbeantwortet (Frage (3)) wäre.
C) Können Unternehmen bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag legen?
Die in der Überschrift gestellte Frage verlangt von uns eine Aussage darüber, ob Unterneh-
men als Unternehmen, d.h. unabhängig von den Menschen, die sie bilden27, aktuell oder
potentiell die Fähigkeit besitzen können, bewusstes Verhalten VT/U an den Tag zu legen. Ein
bewusst an den Tag gelegtes Verhalten bVT/U ist hierbei als Verhalten zu verstehen, das wis-
sentlich und willentlich an den Tag gelegt wird.28 Ein bewusstes Verhalten bVT/U besitzt somit
eine kognitiv-rationale und eine voluntativ-appetitive Komponente:
Die Komponente der Wissentlichkeit setzt Kenntnis/ Wissen des durch VT/U zu realisie-
renden Ziels (Verhaltensabsicht; finis operantis) sowie des Inhaltes (finis operis), der
Umstände und der Konsequenzen von VT/U voraus.
Die Komponente der Willentlichkeit verlangt, dass die Realisierung von VT/U als Mittel
zur Realisierung der Verhaltensabsicht aus eigenem, nicht von aussen kommendem
Antrieb erstrebt wird.
Bewusstes Verhalten bVT/U setzt somit das Vorhandensein und den Einsatz von Vernunft und
(freiem) Willen auf Seiten desjenigen voraus, der bVT/U an den Tag legt. Jedes bewusste
Verhalten bVT/U ist das Ergebnis des Zusammen- und Wechselspiels von Vernunft- und Wil-
lensakten. Bevor wir die Frage beantworten, ob Unternehmen bewusstes Verhalten bVT/U an
den Tag legen können, lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen,
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Entität genuine Vernunft- und Wil-
lensakte an den Tag legen kann. Die Bedingungen, die hierfür gegeben sein müssen, sind
die Existenz von Geist («mens») und Leben bzw. genauer gesagt: rationalem Leben. Nur
belebte geistbegabte Entitäten können genuine Vernunft- und Willensakte an den Tag legen.
Um die Frage zu beantworten, ob Unternehmen bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag le-
gen können, müssen wir also prüfen, ob Unternehmen als Unternehmen, d.h. unabhängig
von den sie konstituierenden Menschen, rationales Leben besitzen können. Die Antwort hie-
rauf sollte relativ offensichtlich sein: Da Unternehmen keine Lebewesen sind und nicht zu der
Klasse des Seienden gehört, das Leben besitzen kann, können sie unmöglich rationales
Leben besitzen. Da nur rationale Lebewesen zu diesen fähig sind, können Unternehmen
entsprechend auch keine genuinen Vernunft- und Willensakte und damit auch kein bewuss-
tes Verhalten bVT/U an den Tag legen. Die Frage, ob Unternehmen als Unternehmen be-
wusstes Verhalten bVT/U an den Tag legen können, kann also mit einem klaren «Nein» be-
antwortet werden.29
27 Unabhängig davon, was ein Unternehmen sonst noch alles ist und sein kann, ist jedes Unternehmen zunächst einmal eine Gemeinschaft von Menschen bzw. «an organized group of people who collectively carry on some range of business activi-ties and which we recognize as a single body distinct from its environment» (MANUEL G. VELASQUEZ. Debunking Corporate Moral Responsibility. Business Ethics Quarterly 13.4 (2003): 531–562. S. 533).
28 Im Recht wird anstelle des Ausdrucks «bewusst» üblicherweise der Ausdruck «vorsätzlich» verwendet (vgl. Art. 12 StGB). 29 Unternehmen sind jedoch nicht nur unfähig zu bewusstem Verhalten; sie sind darüber hinaus auch absolut verhaltensun-
fähig. Denn da jedes Verhalten das Vorhandensein von Leben voraussetzt und Unternehmen kein von den sie konstituie-
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
16
Diese Erkenntnis erlaubt es uns nun, die beiden wesentlichen der zu Beginn und im Verlauf
dieses Kapitels aufgeworfenen Fragen (Fragen (1) und (3)) zu beantworten:
ad (1) Unternehmen können keine Pflichten und damit auch keine prospektive Verantwor-
tung besitzen.
ad (3) Unternehmen können keine innere (und damit auch keine äussere) Kausalverant-
wortung tragen.
Da das Vorliegen dieser beiden Arten der Verantwortung eine notwendige Voraussetzung für
das Vorliegen von Rechtfertigungsverantwortung ist, können Unternehmen in Konsequenz
auch keine Rechtfertigungsverantwortung tragen.
Und diese Antworten versetzen uns nun in den Stand, eine klare Antwort auf die in der Über-
schrift dieses Kapitels gestellte Frage zu geben: Unternehmen können als Unternehmen und
unabhängig von den sie konstituierenden Menschen weder prospektive Verantwortung noch
Kausalverantwortung noch Rechtfertigungsverantwortung und damit keine der drei mögli-
chen Verantwortungsarten tragen. Oder mit anderen Worten: Unternehmen können keine
Verantwortung tragen; sie sind absolut verantwortungsunfähig.
D) Wer, wenn nicht das Unternehmen, trägt Verantwortung?
Aus dem vorangegangenen Kapitel haben wir gelernt, dass Unternehmen als verhaltensun-
fähige Entitäten keine Verantwortung tragen können. Diese Schlussfolgerung wirft jedoch
sofort die Frage auf, wer für ein bestimmtes X, für das wir gemeinhin ein bestimmtes Unter-
nehmen U als verantwortlich bezeichnen, tatsächlich verantwortlich ist, wenn es nicht U sein
kann.
Die Antwort auf diese Frage ist im Grunde relativ naheliegend: Da Unternehmen im Kern
einen zweckorientiert-organisierten Zusammenschluss von Menschen darstellen und da Un-
ternehmen unabhängig von den sie konstituierenden Menschen keine Verantwortung tragen
können, kann jegliche Verantwortung, welche wir gemeinhin Unternehmen zuschreiben, nur
von den die Unternehmen konstituierenden Menschen getragen werden. Denn nur diese
sind als lebendige rationale Wesen fähig, bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag zu legen:
«To speak of corporations being responsible is simply elliptical for speaking of certain indivi-
duals within the corporation being responsible.»30
renden Menschen unabhängiges Leben besitzen, können sie als Unternehmen weder irgendeine positive Handlung (Tun/ Tat) noch irgendeine negative Handlung (Unterlassen/ Unterlassung oder Dulden/ Duldung) an den Tag legen.
30 JOHN R. DANLEY. Corporate Moral Agency: The Case for Anthropological Bigotry. In: Hoffman, Michael W. & Robert E. Frederick. Business Ethics. Readings and Cases in Corporate Morality. Third Edition. New York et al.: McGraw-Hill, 1995. pp. 183–189. S. 184. Der Artikel wurde ursprünglich publiziert in: Action and Responsibility. Bowling Green Studies in Ap-plied Philosophy, Volume II. 1980. pp. 140–149.
Siehe hierzu auch VELASQUEZ: «It makes sense to say that a corporation is morally responsible for a wrongful act only as an elliptical (and somewhat dangerous) way of saying that certain human individuals are morally responsible for that act.» (MANUEL G. VELASQUEZ. Why Corporations Are Not Responsible for Anything That They Do. Business & Professional Eth-ics Journal 2.3 (1983): 1–18. S. 1.)
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
17
Zu sagen, dass ein Unternehmen U Verantwortung für X trägt, ist vor diesem Hintergrund nur
als vereinfachender Ausdruck31 für die Aussage zu verstehen, dass entweder alle oder be-
stimmte32 der U konstituierenden Menschen Verantwortung für X tragen. Nur alle oder be-
stimmte der ein Unternehmen konstituierenden Menschen können prospektive Verantwor-
tung, Kausalverantwortung und/ oder Rechtfertigungsverantwortung für X tragen.
Was es also zu stärken gilt, wenn der Ruf nach einer Stärkung von Unternehmensverantwor-
tung erschallt, ist somit nicht die Stärkung einer konzeptionell unmöglichen Verantwortung
von Unternehmen, sondern die Stärkung der Verantwortung der die Unternehmen konstituie-
renden Menschen.
IV. Unternehmensstrafrecht ohne Unternehmensverantwortung?
Wenn wir das Ergebnis der obigen Reflexionen ernst nehmen, dann bedeutet das, dass die
Sinnhaftigkeit des seit dem 01.10.2003 geltenden und die Verantwortlichkeit von Unterneh-
men regelnden Art. 102 StGB aus philosophischer Perspektive zumindest hinterfragt werden
muss. Denn ein Unternehmen mit einer Strafe zu belegen bedeutet nichts anderes als dieses
Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen bzw. diesem Rechtfertigungsverantwortung zu-
zuschreiben.
Werfen wir zunächst einen Blick auf den in Frage stehenden Artikel. Gemäss Art. 102 StGB
werden Unternehmen in zwei Fällen strafbar:33 (1) Ein Unternehmen wird zum einen strafbar,
wenn (a) in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des
Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird (Anlasstat) und (b)
diese Tat wegen mangelhafter Organisation34 des Unternehmens keiner bestimmten natürli-
chen Person zugerechnet werden kann (Art. 102 Abs. 1 StGB; subsidiäre Unternehmens-
strafbarkeit).35 (2) Ein Unternehmen wird zum anderen strafbar, wenn (a) in einem Unter-
nehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks eine
31 JOHN HASNAS spricht in diesem Zusammenhang von «linguistic placeholders to facilitate communication» (JOHN HASNAS. Where Is Felix Cohen When We Need Him?: Transcendental Nonsense and the Moral Responsibility of Corporations. Journal of Law & Policy 19.1 (2010): 55-82. S. 70.). Ähnlich sieht es auch VELASQUEZ (Anm. 30): «We are often forced to adopt this elliptical way of speaking because, as outsiders, we are usually ignorant of the inner workings of a corporation. Suspecting that some members of a corporation knew that an act they were intentionally carrying out (or helping to carry out, or failing to prevent) was wrong, but not knowing who those members were, we refer to them under the rubric of «the corporation» and say that the corporation is morally responsible for the act.» (S. 13.)
32 Grundsätzlich können aber nur diejenigen der ein Unternehmen konstituierenden Menschen prospektive Verantwortung für ein bestimmtes X tragen, deren Verhalten VT/U einen Einfluss auf die Realisierung von X hat (prospektive Verantwor-tung) bzw. gehabt hat (Kausal- und Rechtfertigungsverantwortung). Dies bedeutet, dass die oberen Hierarchieebenen üb-licherweise eher und mehr Verantwortung tragen als die unteren. Ob alle, und wenn nein, welche der ein Unternehmen konstituierenden Menschen für X Verantwortung tragen, hängt davon ab, worin X besteht.
33 Die Strafbarkeit des Unternehmens ist neben Art. 102 StGB (Strafbarkeit) zudem auch in Art. 36 Abs. 2 StPO, Art. 112 StPO, Art. 178 lit. g StPO und Art. 265 Abs. 2 lit. c StPO (Strafverfahren) geregelt. Als Unternehmen im Sinn von Art. 102 StGB gelten laut Art. 102 Abs. 4 StGB juristische Personen des Privatrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts (mit Ausnahme der Gebietskörperschaften), Gesellschaften und Einzelfirmen. Auch wenn sie hiervon nicht direkt erfasst zu sein scheinen, wendet ein Teil der Lehre diese Bestimmung auch auf Konzerne an (vgl. PETER V. KUNZ. Kon-zernhaftungen in der Schweiz. Der Gesellschafter 5 (2012): 282–293. S. 287.).
34 Als Organisationsmängel gelten z.B. mangelhafte Zuständigkeitsregelungen, mangelhafte Dokumentation oder mangel-hafte Protokollierung.
35 MARCEL ALEXANDER NIGGLI & DIEGO R. GFELLER. Siebenter Titel: Verantwortlichkeit des Unternehmens. Art. 102. In: Niggli, Marcel Alexander & Hans Wiprächtiger (Hrsg.). Basler Kommentar. Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz. 3. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013. S. 1949–2045. S. 1970ff (N. 52ff).
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
18
bestimmte in Art. 102 Abs. 2 StGB abschliessend aufgeführte Anlasstat36 begangen wird und
(b) das Unternehmen nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Massnah-
men/ Vorkehrungen getroffen hat, um die Anlasstat zu verhindern (Art. 102 Abs. 2 StGB;
originäre (auch: kumulative; konkurrierende; primäre) Unternehmensstrafbarkeit).37 Gemäss
Art. 102 StGB sind Unternehmen somit zwar nicht strafbar für die Anlasstat, jedoch für Orga-
nisationsmängel, sofern diese entweder die Ermittlung des für eine Anlasstat verantwortli-
chen Straftäters verunmöglichen (Art. 102 Abs. 1 StGB) oder eine bestimmte Anlasstat ur-
sächlich ermöglichen (Art. 102 Abs. 2 StGB).38
Wie ist Art. 102 StGB vor dem Hintergrund der Ausführungen der beiden vorangegangenen
Kapitel zu beurteilen? Unabhängig wie, wofür genau und unter welchen Umständen Unter-
nehmen strafbar sein sollen, setzt Art. 102 StGB zwingend voraus, dass man Unternehmen
bestrafen kann. Aus einer philosophischen Perspektive ist diese Annahme jedoch nicht halt-
bar: Unternehmen können nämlich – wie in Kapitel III gezeigt wurde – unabhängig von den
sie konstituierenden Menschen keine Verantwortung und somit auch keine Rechtfertigungs-
verantwortung tragen. Und da sie somit nicht zur Verantwortung gezogen werden können,
können Unternehmen – ganz im Sinne des Grundsatzes «societas delinquere non potest»39
– auch nicht bestraft werden – weder für Organisationsmängel oder für sonst etwas: «The
corporation cannot be kicked, whipped, imprisoned, or hanged by the neck until dead. Only
individuals of the corporation can be punished.»40 Insofern beinhaltet Art. 102 StGB eine im
Grunde widersinnige, da auf einer Unmöglichkeit beruhende Regelung.41
Die Schweizerische Legislative und Exekutive scheinen sich dieser Tatsache allerdings
durchaus bewusst zu sein. Denn wie der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu einer vom
Nationalrat letzten Endes abgelehnten Motion darlegt, bildet die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Unternehmen «jedoch nach wie vor eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich
nur natürliche Personen strafbar machen können»42. Warum also wurde mit Art. 102 StGB
ein Gesetz verabschiedet, das eine Ausnahme vom und damit gleichzeitig auch einen
Verstoss gegen den Grundsatz «societas delinquere non potest» darstellt?
36 Bei den von Art. 102 Abs. 2 StGB abschliessend erfassten Anlasstaten handelt es sich um folgende: Beteiligung an einer kriminellen Organisation; Finanzierung des Terrorismus; Geldwäscherei; Bestechung schweizerischer Amtsträger; Vor-teilsgewährung; Bestechung fremder Amtsträger; Privatbestechung.
37 vgl. NIGGLI & GFELLER (Anm. 35), S. 1993ff (N. 230ff). 38 Während ein Unternehmen gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB zusätzlich zu der natürlichen Person, die die Anlasstat began-
gen hat, strafbar werden kann, kann auf Basis von Art. 102 Abs. 1 StGB das Unternehmen nur dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich nicht ermitteln lässt, welche natürliche Person die Anlasstat begangen hat.
39 vgl. MATTHIAS FORSTER. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB. Bern: Stämpfli, 2006. S. 56.
40 DANLEY (Anm. 30), S. 187. 41 Die Existenz von Art. 102 StGB sollte nicht zuletzt auch deswegen erstaunen, da Unternehmen aufgrund ihrer Unfähigkeit
zu bewusstem Verhalten die in Art. 12 StGB festgeschriebenen Voraussetzungen der Strafbarkeit nicht erfüllen können. Art. 102 StGB stellt also etwas unter Strafe, das gemäss Art. 12 StGB gar nicht vom Strafgesetz erfasst ist.
42 NATIONALRAT. Geschäftsnummer 09.3365: Motion «Umsetzung der Strafbarkeit von Unternehmen». Eingereicht von Nati-onalrat Daniel Jositsch am 27. April 2009. Stellungnahme des Bundesrates vom 20. Mai 2009. Behandelt im Nationalrat am 03. Juni 2009. http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093365 bzw. http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4809/300565/d_n_4809_300565_300936.htm
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
19
A) Pragmatische Gründe für die Existenz von Art. 102 StGB
Der Bundesrat sieht die Zulässigkeit einer Ausnahme darin begründet, dass aus seiner Sicht
«letztlich nicht die Dogmatik, sondern der legislatorische Wille, eine als Problem erkannte
Situation sachgerecht zu regeln, darüber entscheidet, ob diese Regelung zulässig ist»43. Wo-
rin genau liegt aber dieses Problem, das für den Bundesrat die Einführung einer strafrechtli-
chen Unternehmenshaftung rechtfertigt? Wie der Bundesrat darlegt, besteht dieses Problem
in der in der Ermittlungspraxis manchmal auftretenden Unmöglichkeit oder Unverhältnismäs-
sigkeit, die für eine Straftat verantwortliche natürliche Person im Rahmen eines Unterneh-
mens zu eruieren.44
Auch wenn es hierfür eine Reihe von Gründen gibt (Ungenügen der Ermittler; besonderes
Geschick der Täter), so können nicht zuletzt auch organisatorische Gründe Ursache dieser
Unmöglichkeit oder Unverhältnismässigkeit sein. Zu diesen Gründen sind zum einen ver-
meidbare Organisationsdefizite zu zählen, aber auch die mit zunehmender Grösse und damit
organisatorischer Komplexität von Unternehmen natürlicherweise erschwerte Zurechenbar-
keit einer Straftat auf einen oder mehrere Urheber45. Und genau für solche Fälle der «organi-
sierten Unverantwortlichkeit»46, so der Bundesrat, «erweist es sich als ebenso nötig wie rich-
tig, das Unternehmen als solches strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, um eine stos-
sende Strafbarkeitslücke zu vermeiden»47.
Streng genommen ist die Schwierigkeit der Ermittlung der für ein Delikt verantwortlichen na-
türlichen Person(en) jedoch kein Argument für die Einführung eines Unternehmensstraf-
rechts. Die in der «Undurchsichtigkeit, die Unternehmensstrukturen für Aussenstehende
aufweisen», begründeten Schwierigkeiten der Ermittlung eines individualisierbaren Täters
sind «vielmehr ein Argument für eine bessere Ausstattung und Ausbildung der Ermittlungs-
beamten», zumal «gerade die Informations- und Kommunikationsstrukturen von Unterneh-
men zumindest theoretisch Aufklärungs- und Beweismöglichkeiten bieten, die so im Bereich
der klassischen Individualkriminalität nicht vorhanden sind».48 Und selbst wenn eine solche
Aufklärung einmal nicht möglich sein sollte, so haben «Rechtsprechung und Doktrin […] Zu-
43 SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT. Geschäftsnummer 98.038: Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbu-ches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998. BBl 1999 II 1979. http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/1999/index_11.html Siehe auch: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=19980038. S. 2142.
Für einen Überblick über die im Zusammenhang mit der Strafbarkeit von Unternehmen zu adressierenden dogmatischen Grundsatzfragen siehe FORSTER. (Anm. 39), S. 23ff; zu klären wären demnach insbesondere die strafrechtliche Hand-lungsfähigkeit, die Schuldfähigkeit («nulla poena sine culpa») und die Straffähigkeit von Unternehmen.
44 vgl. BUNDESRAT (Anm. 43), S. 2141. 45 In diesem Zusammenhang ist besonders auf die Problematik hinzuweisen, dass «Kompetenzaufteilung und die Delegation
von Entscheidungsbefugnissen […] ein Auseinanderfallen von Ausführungstätigkeit, Informationsbesitz und Entschei-dungsmacht zur Folge (haben).» (FORSTER (Anm. 39), S. 9; vgl. auch S. 5.) In der Folge kann die Situation auftreten, dass sich keine natürliche Person findet, die alle strafrechtlich geforderten objektiven und subjektiven Tätereigenschaften auf sich vereinigt.
46 vgl. BUNDESRAT (Anm. 43), S. 2141 (FN 398). 47 vgl. BUNDESRAT (Anm. 43), S. 2141. 48 WOLFGANG WOHLERS. Die Strafbarkeit der Unternehmens. SJZ 96.16/17 (2000): 381–390. S. 382. Siehe hierzu auch:
FORSTER (Anm. 39), S. 5f (v.a. auch FN 21).
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
20
rechnungsgrundsätze entwickelt, […] die […] zeigen, dass auch unter diesem Gesichtspunkt
Alternativen zur Einführung von Unternehmenssanktionen bestehen»49.
Organisationsmängel stellen somit zwar einen, aber nicht unbedingt einen sonderlich tragfä-
higen Grund zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts dar. Dies ist insofern nicht son-
derlich tragisch, als sich weitere Gründe finden lassen, Ausnahmen vom Grundsatz «socie-
tas delinquere non potest» zuzulassen. Diese Gründe werden deutlich, wenn wir uns den
wohl wesentlichen Auslöser der Debatte über die Unternehmensstrafbarkeit in der Schweiz
näher betrachten, nämlich die Brandkatastrophe bei der Firma Sandoz in Schweizerhalle bei
Basel am 1. November 1986.50
Bei diesem Brand gingen knapp 1‘250 Tonnen agrochemische Produkte sowie andere, teil-
weise giftige Chemikalien in Flammen auf. Das zur Eindämmung des Brandes verwendete
und dadurch belastete Löschwasser (schätzungsweise 10‘000 Kubikmeter) versickerte nicht
nur im Boden und führte so zu einer Boden- und Grundwasserverschmutzung, sondern floss
auch ungefiltert in den Rhein, versuchte diesen grossflächig und löste ein massives Fisch-
sterben aus. Die in der Folge eingeleitete Strafuntersuchung musste in den Hauptpunkten
eingestellt werden, da zum einen keine hinreichenden Beweise zur Brandursache feststellbar
und zum anderen kein strafrechtlich relevantes Individualverschulden nachweisbar waren.
Lediglich der Chef der Werksicherheit sowie der Einsatzleiter der Werkfeuerwehr wurden
schuldig gesprochen und verurteilt: Ersterer zu einer Busse von CHF 500 wegen des Befehls
zum Schwemmen des Areals; zweiterer zu einer Busse von CHF 200 wegen Befolgung die-
ses Befehls.51 Für nicht wenige besteht zwischen dem durch den Brand entstandenen Scha-
den und den beiden ausgesprochenen Strafen ein krasses Missverhältnis. Hinter diesem –
durchaus berechtigten – Gefühl der mangelnden Angemessenheit bzw. Unbilligkeit versteckt
sich nun ein zweifaches Argument für die Einführung eines Unternehmensstrafrechts.
Zum einen vermag, wie das Beispiel «Schweizerhalle» zeigt, «der Rückgriff auf die Bestra-
fung natürlicher Personen eine sachangemessene Sanktionierung nicht in jedem Fall zu ge-
währleisten»52. Denn die über eine natürliche Person verhängte Geldstrafe kann sich nicht
an den Vermögensverhältnissen des Unternehmens, für das diese Person arbeitet, sondern
nur an denen der natürlichen Person orientieren. Dies führt also, selbst wenn sich eine Straf-
tat einer oder mehreren natürlichen Personen zurechnen lässt und diese bestraft werden, zu
– in Relation zum Schaden – unangemessen tiefen (Geld-)Strafen. Möchte man eine
sachangemessene Bestrafung sicherstellen, ist – so das erste Argument – die Bestrafung
natürlicher Personen nicht in allen Fällen ausreichend, sondern bedarf der zusätzlichen Be-
strafung des betreffenden Unternehmens.
49 WOHLERS (Anm. 48), S. 383 (insb. FN 19). FORSTER (Anm. 39) teilt diese Ansicht grundsätzlich (vgl. S. 19), sieht aber trotzdem ein Bedürfnis nach Unternehmenssanktionen «in relativ speziellen Fallkonstellationen, nämlich bei aus grossen und funktionell-differenzierten Unternehmen heraus begangenen Straftaten» (S. 23).
50 vgl. NIGGLI & GFELLER (Anm. 35), S. 1960 (N. 13); BUNDESRAT (Anm. 43), S. 2137; 2140. 51 vgl. NIGGLI & GFELLER (Anm. 35), S. 1960 (N. 13); Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 14. Mai 1993. 52 WOHLERS (Anm. 48), S. 383.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
21
Zum anderen wird durch die Bestrafung einer oder mehrerer natürlicher Personen oftmals
nur ein Teil des fehlerhaften Verhaltens strafrechtlich sanktioniert.53 Durch die Sanktionie-
rung einzelner natürlicher Personen werden die restlichen ein Unternehmen bildenden natür-
lichen Personen nicht davon abgehalten, ihr Verhalten fortzusetzen. Wenn sich innerhalb
eines Unternehmens so etwas wie eine «kriminelle Verbandsattitüde»54 entwickelt hat, dann
setzt das Unternehmen sein Verhalten unter Umständen trotz der Verurteilung einzelner oder
mehrerer natürlicher Personen einfach weiter fort. Eine wirkliche Verhaltensbesserung und
Prävention von gleichem oder ähnlichem Verhalten durch das betreffende Unternehmen
lässt sich nur dann erreichen, wenn man nötigenfalls auch die Unternehmenspraxis in den
Fokus der Bestrafung nimmt. Und dies – so das zweite Argument – kann nur dann sicherge-
stellt werden, wenn man nicht nur einzelne oder auch mehrere natürliche Personen, sondern
auch Unternehmen bestrafen kann.
Alles in allem gibt es also zwei belastbare pragmatische Gründe, die ins Feld geführt wer-
den, um einen Verstoss gegen den Grundsatz «societas delinquere non potest» zu rechtfer-
tigen: Durch die Einführung der Unternehmensstrafbarkeit kann (a) sach-, d.h. dem Schaden
angemessene und (b) präventiv wirkende Bestrafung von in einem Unternehmen in Aus-
übung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks begangener Ver-
brechen oder Vergehen sichergestellt werden.55
B) Eine vielleicht heikle Überlegung zum Schluss: Wer A sagt, muss auch B
sagen
Damit ist jedoch noch nicht gesagt, wieso diese pragmatischen Gründe ein grösseres Ge-
wicht haben sollen als die philosophisch-theoretischen Überlegungen aus den Kapiteln II und
III. Wieso genau soll das Bestreben nach einer sachangemessenen und präventiv wirkenden
Bestrafung ausreichen, um den Grundsatz «societas delinquere non potest» aufzugeben?
Diejenigen, die sich von den eben dargelegten pragmatischen Argumenten nicht überzeugen
lassen, sondern auf dem Grundsatz «societas delinquere non potest» beharren, müssen sich
zunächst die folgende Frage gefallen lassen: Warum soll – zumindest im Rahmen des aktu-
ell geltenden Schweizer Rechts – überhaupt an der Unverbrüchlichkeit des Grundsatzes
«societas delinquere non potest» festgehalten werden? Diese Frage ist durchaus berechtigt:
Denn zum einen ist der Grundsatz seit längerem bereits durch das Nebenstrafrecht aufge-
53 vgl. BUNDESRAT (Anm. 43), S. 2137; WOHLERS (Anm. 48), S. 383. 54 WOHLERS (Anm. 48), S. 383. 55 Demgegenüber gibt es durchaus Stimmen, die die Gerechtigkeit der Bestrafung von Unternehmen anzweifeln, da die
(finanzielle) Bestrafung eines Unternehmens letzten Endes immer auch Unschuldige (mitbe-)trifft (Kunden (Preiserhöhun-gen), Mitarbeiter (Arbeitsplatzverlust), Anteilseigner (Verlust des eingesetzten Kapitals)) und so gegen den Grundsatz «nulla poena sine culpa» verstösst: «Corporate punishment necessarily falls indiscriminately on the innocent as well as or in place of the guilty. Corporate punishment is inherently vicarious collective punishment.» (JOHN HASNAS. Reflections on Corporate Moral Responsibility and the Problem Solving Technique of Alexander the Great. Journal of Business Ethics 107.2 (2012): 183–195. S. 191; 194.).
FORSTER (Anm. 39) erachtet diesen Vorwurf jedoch für nicht überzeugend: «Verbandssanktionen schmälern zwar unstrit-tig die Rendite und gefährden im Extremfall auch Arbeitsplätze. In dieser wirtschaftlichen Betroffenheit realisiert sich aber nur die allgemeine, mit der Mitgliedschaft im bzw. der Beteiligung am Unternehmen verbundene Betriebsgefahr. Die Mit-arbeiter und die Aktionäre werden durch die Unternehmensstrafe nicht stärker betroffen als durch ein verlustreiches Ge-schäft oder durch zivilrechtliche Schadenersatzansprüche. Wer dieses Risiko vollständig vermeiden will, darf sich nicht an Verbänden beteiligen.» (S. 39)
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
22
weicht56; und zum anderen ist er bereits durch die Existenz von Art. 52 und 53 ZGB verletzt
bzw. ausser Kraft gesetzt.
Inwieweit ist letzteres der Fall? Laut Art. 52 und 53 ZGB sind Unternehmen unabhängig von
den sie konstituierenden Menschen als juristische Personen Träger von Rechten und Pflich-
ten. Aus Kapitel III.B wissen wir aber nun, dass eine der Bedingungen, die erfüllt sein müs-
sen, damit eine Entität Pflichten tragen kann, darin besteht, dass es der Entität zumindest
grundsätzlich nicht unmöglich ist, bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag zu legen. Art. 52
und 53 ZGB müssen also notwendigerweise voraussetzen, dass Unternehmen bewusstes
Verhalten bVT/U an den Tag legen können; wenn sie dies nicht könnten, könnten sie auch
nicht Träger von Pflichten sein. Wie in Kapitel III.C dargelegt, ist es Unternehmen als Unter-
nehmen nun jedoch unmöglich, bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag zu legen. Obwohl sie
also aus philosophisch-theoretischer Sicht keine Pflichten tragen können, stipulieren Art. 52
und 53 ZGB nichtsdestotrotz, dass Unternehmen Träger von Pflichten sind.57 Art. 52 und 53
ZGB stipulieren somit implizit auch, dass Unternehmen bewusstes Verhalten bVT/U an den
Tag legen können. Da der Grundsatz «societas delinquere non potest» im Grunde nichts
anderes besagt, als dass Unternehmen kein bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag legen
können, sollte deutlich sein, wieso und dass Art. 52 und 53 ZGB eine Verletzung dieses
Grundsatzes darstellen.
Jemand, der in Art. 102 StGB einen Verstoss gegen den Grundsatz «societas delinquere
non potest» sieht und diesen Artikel aus dogmatischen Gründen ablehnt, müsste somit ei-
gentlich konsistenterweise auch die Vorstellung ablehnen, dass Unternehmen als (juristi-
sche) Personen sein können. Akzeptiert man das Personsein von Unternehmen als pragma-
tische Rechtsfiktion58, dann akzeptiert man, dass Unternehmen als eigenständige Rechts-
subjekte gelten, die Rechte und Pflichten tragen können. Wieso sollen aber Entitäten, denen
das Recht die Fähigkeit zuschreibt, Pflichten zu besitzen, diese Pflichten nicht brechen und
für den Bruch nicht bestraft werden können? Dies zu vertreten wäre widersprüchlich. Denn
sowohl der Besitz als auch das Verletzen sowie die Bestrafung einer Pflichtverletzung setzen
voraus, dass Unternehmen eine Fähigkeit besitzen, die sie nicht besitzen können, nämlich
die Fähigkeit, bewusstes Verhalten bVT/U an den Tag zu legen.
Bejaht man die Rechtsfähigkeit von Unternehmen und damit implizit auch, dass Unterneh-
men die Fähigkeit zu bewusstem Verhalten bVT/U besitzen, dann wäre es selbstwidersprüch-
lich, mit dem Argument, dass Unternehmen die Fähigkeit zu bewusstem Verhalten bVT/U
56 Neben der kernstrafrechtlichen Regelung in Art. 102 StGB sieht auch das Nebenstrafrecht in Art. 7 VStrR und Art. 181 DBG die Strafbarkeit von Unternehmen vor (vgl. FORSTER (Anm. 39), 57ff.).
57 Welche pragmatischen Argumente grundsätzlich hinter der Vorstellung stehen, Unternehmen als Personen als Träger von Rechten und Pflichten zu betrachten («corporate personhood»), kann der folgenden Aussage entnommen werden: «The notion that a collection of human, physical, and financial resources could be treated as a single entity with all of the legal characteristics – especially those concerning holding and disposing of property – of a natural person has proved to be one of the most potent concepts in history, for it has permitted the aggregation, under unified direction and management, of large quantities of productive resources on the scale necessary to the efficient provision of goods and services, many of which we would be without or for which we would pay more dearly were it not for the corporate vehicle.» (RUSSELL B. STE-
VENSON. Corporations and Social Responsibility: In Search of the Corporate Soul. George Washington Law Review 42.4 (1974): 709–736. S. 709.)
58 Mit dem Ausdruck «Fiktion» ist nicht gemeint, dass, auch wenn sie nicht unabhängig von den sie konstituierenden Men-schen existieren, Unternehmen als zweckorientiert-organisierte Zusammenschlüsse/ Gemeinschaften/ Gruppen von Men-schen keine realen Entitäten sind. Der Ausdruck soll nur sagen, dass die Idee von Unternehmen als eigenständige Träger von Rechten und Pflichten eine vom Recht geschaffene ist, die philosophisch nicht haltbar ist.
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.
23
nicht besitzen, die Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen bzw. die Unternehmensstraf-
barkeit zu negieren. Bejaht man die Rechtsfähigkeit von Unternehmen, dann hat man damit
– ob bewusst oder unbewusst – die Gültigkeit des Grundsatzes «societas delinquere non
potest» über Bord geworfen und kann nur ohne Rückgriff auf diesen Grundsatz gegen die
Verantwortungsfähigkeit von Unternehmen bzw. die Unternehmensstrafbarkeit argumentie-
ren.
Hat das Recht einmal die Rechtsfiktion in die Welt gesetzt, dass Unternehmen rechtsfähig
sind, dann muss es dieser mit fast schon logischer Notwendigkeit auch die Fiktion folgen
lassen, dass Unternehmen verantwortungsfähig bzw. strafbar sind. Wer A sagt, muss in die-
sem Fall also auch B sagen; und wer nicht B sagen will, darf nicht A sagen. Denn welchen
Sinn würde es machen, Unternehmen zu Trägern von Pflichten zu machen, wenn sie nicht
für die Verletzung ihrer Pflichten zur Verantwortung gezogen werden können?
This article has been published as: Erk, Christian. “Corporate Responsibility: Eine kritische Reflexion.”
REPRAX. Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis in Gesellschafts- und Handelsregisterrecht 2 (2015): 23-47.