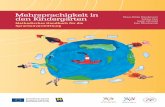Kultivierte Erholung versus Reflexion Lidija Ginzburgs um den Park von Peterhof kreisende Gedanken
Transcript of Kultivierte Erholung versus Reflexion Lidija Ginzburgs um den Park von Peterhof kreisende Gedanken
1
Stanislav Savickij
Kultivierte Erholung versus Reflexion
Lidija Ginzburgs um den Park von Peterhof kreisende Gedanken
ein „Wasserstadion“ für 5000 Zuschauer entstehen.4 Nicht alle diese Projekte wurden umgesetzt.
Zu einem wichtigen Ereignis in der Sowjetisierungsgeschichte Peterhofs wurde der Besuch Stalins im Juli 1933. Der Führer der kommunistischen Partei machte hier Station auf seiner Reise zum Weißmeer-Ostsee-Kanal (Belomorsko-Baltijskij Kanal), die er vom 18. bis 26. Juli 1933 in Begleitung von Vorošilov und Kirov vor der offiziellen Eröffnungen dieses grandiosen, von Häftlin-gen errichteten Bauwerks unternahm.5 Stalin äußerte sich wohl-wollend über die Erhaltung des historischen Teils der Anlagen in Peterhof,6 was auch der damalige Direktor des Museumskomple-xes Nikolaj Archipov (1887-1967) später berichtete:
„В 1933-м я сопровождал И.В.Сталина и задал вопрос: ‚Правильно ли было сохранить Петергоф и правильно ли делать это впредь?‛ На что получил лаконичный, совер-шенно точный ответ: ‚Правильно‛“.7
1933 begleitete ich I. V. Stalin und stellte ihm die Frage: „War es richtig Peterhof zu erhalten und wäre es richtig, dies weiter-hin zu tun?“ Darauf erhielt ich die lakonische, äußerst klare Antwort: „Richtig“.
In ihrem Bestreben, die Zerstörung des Ensembles zu verhindern, beriefen sich die Mitarbeiter des Museums in der Folge wiederholt auf die Meinung Stalins. Peterhof wurde vor allem dank der Bemü-hungen von Nikolaj Archipov erhalten, der seine Prinzipientreue mit fünf Jahren im Lager bezahlte. Seine Position in den Diskussio-nen um die sozialistische Rekonstruktion historischer Anlagen for-mulierte er folgendermaßen: „Ich war nicht für die Konservierung von Museen, aber ich war entschieden gegen die Verstümmelung des künstlerischen Charakters Peterhofs, der sich historisch heraus-gebildet hatte“.8 Sowjetische Neuerungen ergänzten das historische Ensemble des Parks, aber führten nicht zu seiner Zerstörung. Das widersprach den Forderungen der Verwaltung der Schlösser und Gärten des Leningrader Volksdeputiertenrats (Lensovet), die Anla-gen in einen, der in den 1920er und 1930er Jahren sehr populären Lunaparks umzugestalten.
In den 1930er Jahren verwandelte sich der Schlosspark von Peter-hof in einen sowjetischen Kultur- und Erholungspark (park kul’tury i otdycha, PKiO). Dies war das Schicksal der meisten öffentlichen Gärten und der Residenzen, die bis zur Revolution dem Adel gehör-ten. Mit der Umwandlung in Kultur- und Erholungsparks beka-men die Anlagen auch neue Namen. So wurden auch die frühe-ren kaiserlichen Residenzen umbenannt. Aus Zarskoje Selo wurde Detskoe Selo (Детское село) und später Puschkin, aus Pawlowsk wurde Sluck (Слуцк) und aus Gatschina Trock (Троцк) und spä-ter Krasnogvardejsk (Красногвардейск). Das sie besuchende neue Publikum hatte nur eine schwache Vorstellung von der früheren Garten- und Parkkultur, wenn es sie nicht gleich zum Überbleibsel der alten bürgerlichen Ordnung rechnete.
Die Parkanlage in Peterhof wurde neben dem Moskauer Gor’kij-Park (CPKiO imeni Maksima Gor’kogo) und dem Zen-tralen Park für Kultur und Erholung auf der Elagin-Insel in Lenin-grad (CPKiO imeni Sergeja Kirova) zu den wichtigsten sowjeti-schen Einrichtungen, die auf Initiative der Regierung Ende der 1920er – Anfang der 1930er Jahre im Bereich der Gartenkultur geschaffen wurden.1 Hier verbrachte man die Freizeit, erholte sich und durchlief zugleich ideologische Schulungen. Diejenigen, die kürzlich vom Land in die Stadt gezogen waren (und das waren nicht wenige) erwarben hier ihre ersten Kenntnisse des städti-schen Lebens. Einer der offiziellen Initiatoren und Propagan-disten des sowjetischen Garten- und Parkbaus Lazar’ Kaganovič erklärte: „Wir müssen es so machen, dass in diesen Parks diesel-ben Einrichtungen vorhanden sind, wie in europäischen Städten, mit dem ‚kleinen’ Unterschied, dass dort diese Einrichtungen von Kapitalisten genutzt werden und bei uns von Proletariern“.2
Bis Ende der 1920er Jahre entging Peterhof bedeutenden Ver-änderungen. Die „sozialistische Rekonstruktion“ des Parks begann erst mit der Direktive des Zentralkomitees (CK) und des Rats der Volkskommissare (SNK) vom 2. Dezember 1931 zu seiner Umwandlung in einen Kultur- und Erholungspark. Sie wurde in der Zeit der ‚Kulturrevolution’ durchgeführt. Die Entwicklung Peterhofs war Teil des Plans eines Neuen Leningrad, gemäß dem der Park ein neues „Kultur- und Aufklärungszentrum von landes-weiter Bedeutung“3 werden sollte. In diesem „grandiosen Kultur-kombinat“ sollten ein „Grünes Theater“ für 2500 Zuschauer und
2
* * *
Die Atmosphäre, die in Peterhof Mitte der 1930er Jahre herrschte, geben heute literarische Quellen, Reiseführer und Zeitungsberichte aus dieser Zeit wieder. In offiziellen Veröffentlichungen, ihren Tex-ten und Bildern, wurde der berühmte Park als Raum der Erho-lung dargestellt (Abb. 1). Ein Reiseführer für Peterhof bot 1935 solche Einrichtungen für aktive Freizeitgestaltung an wie „Schieß-buden“, „Volleyball- und Basketballfelder, Gymnastikanlagen, eine Sprunganlage, eine Sprintlaubahn auf 100 Metern“ und „Konzerte aus dem Radiostudio des Parks (Elektro-Radio-Grammophon)“9 (Abb. 2). Die Parkbesucher wurden eingeladen, an „Unterhaltun-gen, Massenspielen und Tänzen“10 teilzunehmen; zu ihrer Verfü-gung standen außerdem eine „Bühne für Amateur-Aufführungen“ und „eine Grünfläche zum Liegen“ bei der goldenen Kaskade.11 Auf dem „Sportfeld“ konnte man sich von dem diensthabenden Ins-truktor für ein Leistungsabzeichen nach den Normen von GTO (Gotov k trudu i oborone) und im Zielschießen (Vorošilovskij Stre-lok) prüfen lassen. Semen Geyčenko, der in diesen Jahren in Peter-hof arbeitete, schrieb in einer unveröffentlicht gebliebenen Bro-schüre unter dem Titel „Pavillon der Luftabwehr in Peterhof“ (Pavil’on PVO v Petergofe), dass man hier sogar von „Spezialis-ten des artilleriehistorischen Museums der Roten Armee“ in den
Luftabwehrkampf eingewiesen werden konnte.12 Parallel dazu wurden Exkursionen und Spiele mit historischer Thematik orga-nisiert.
Die zwanglose Fröhlichkeit, die gemäß dem Kanon des sow-jetischen Optimismus im Kultur- und Erholungspark als Grund-stimmung herrschen sollte, setzte 1935 der Musikfilm des ukrai-nischen Regisseurs Jakov Urinov „Der Intrigant, oder Der süßeste Flug“ (Intrigan, ili Sladčajšij polet) in Szene. Der Film erzählt die Geschichte eines „Flugschülers“ (učlet) Vasja Jaročkin, der an einer Sommerschule teilnimmt und sich einen Spaß daraus macht, während der Flugstunden die Pferdehorden der benach-barten Sowchose aufzuscheuchen. Dafür droht man ihm an, kein Abschlusszeugnis auszustellen. Der Konflikt löst sich auf, nach-dem es Jaročkin gelingt, einen entlaufenden Hengst namens Int-rigant wieder zu finden und in die Sowchose zurückzubringen. Auf die Suche nach dem Ausreißer begibt sich Jaročkin gemein-sam mit der befreundeten Flugschülerin Olja Gromova. Da die Flugschüler um die Schwäche Intrigants für Süßigkeiten wis-sen, locken sie ihn schließlich erfolgreich mit Zuckerstückchen zurück (Abb. 3).
Diese leicht absurde sowjetische Kino-Operette beinhaltet eine beeindruckende Episode mit dem Abschlussball der Sommerflug-schule. Während des Festes tanzen sich die Flugschüler durch den
1. Gruppe Junger Pioniere vor der Fontäne „Eva“ im Unteren Garten von Peterhof, Foto 1935.
3
Unteren Park von Peterhof, vorbei an seinen Fontänen.13 Dass der Abschlussball in den Alleen des Parks veranstaltet wird, ist eine Hommage an die Tradition der großen Feste in Peterhof, die auf die Ära Nikolaus I. zurückgeht. Seit Beginn des 19. Jahrhun-derts hatten jeweils im Sommer im Unteren Garten Massenfeste stattgefunden.14 In der sowjetischen Ära wurde diese Tradition bewahrt. Wie schon in der vorrevolutionären Zeit, nahmen in den 1930er Jahren an diesen Volksfesten in Peterhof mehrere zehntau-sende Menschen teil. Die „Rote Abendzeitung“ (Večernjaja kras-naja gazeta) veröffentlichte von Mai bis September regelmäßig auf ihrer letzten Seite die Ankündigungen von Veranstaltungen im Park von Peterhof. Ihr Reporter berichtete auch von dem groß-artigen Fest am 6. Juli 1935, das anlässlich des 12. Jahrestags der Verfassung der UdSSR in Peterhof stattfand. Laut verschiedenen Quellen nahmen daran zwischen 40.000 und 100.000 Besucher teil. Diese Zahlen scheinen nicht überzogen zu sein, wenn man die erwartete Besucherzahl berücksichtigt, die von der Verwaltung der Parkanlage beispielsweise zum Tag der sowjetischen Luftwaffe am 18. August 1936 veranschlagt wurde. In der „Notiz der Direktion des Peterhof-Museums an das Peterhof-Lebensmittelkombinat Nr. 2“ wird aus diesem Anlass Verpflegung für 75.000 Gäste veran-schlagt.15 An einzelnen Festtagen kamen bei weitem mehr Besu-cher in den Park, als es sogar zum Höhepunkt der Touristen-Saison der Fall war. Nach statistischen Angaben wurde im Juli 1935 mit 49.339 Personen die höchste monatliche Besucherzahl
Peterhof verzeichnet.16 Die höchste bis dahin erfasste Besucher-zahl pro Jahr lag bei fast 518.000, wobei die Zahl der Parkbesu-cher im Rahmen der Massenfeste eine Höhe von 800.000 Men-schen erreichte.17
Zum dem bereits erwähnten Fest am 6. Juli 1935 anlässlich des 12. Jahrestages der Verfassung der UdSSR wurde der Platz der Sowjets in Peterhof mit zwei großen Tafeln zum Thema „UdSSR – Brüderlichkeit der arbeitenden Völker“ (SSSR – bratstvo tru-dovych narodov) und „Das zaristische Russland – Gefängnis der Völker“ (Carskaja Rossija – tjur’ma narodov) ausgeschmückt. Auf der Hauptallee des Oberen Gartens wurden neuen große Portraits aufgestellt, die Lenin, Stalin und sieben Vorsitzende der Exeku-tivkommitees der Unionsrepubliken (Central’nyj ispolnite’nyj komitet sojuznych respublik) darstellten. Die Festankündigun-gen sprachen von Flugzeugen und Zeppelinen, die über den Park fliegen und Flugblätter abwerfen sollten.18 Die Zeitungen stell-ten den Besuchern des Festes außerdem „zwei Lastwagen mit Sandwiches, Piroggen und Süßigkeiten, 32 Essenstände, Eiswä-gen und individuelle Lunchpakete“19 in Aussicht. Ein an diesem Fest teilnehmender Journalist beschrieb die Feierlichkeiten auf folgende Weise:
„Веселые флажки, лозунги и пестрые ленты раскра-сили парк. Семь оркестров наполняли аллеи музыкой. Но главным аттракционом оставались, конечно, водо-
2. Plan von Peterhof, aus: Petergof i Oranienbaum. Spravočnik po dvortsam-muzejam parka. Leningrad 1935.
4
меты и фонтаны. […] По аллеям нижнего парка с музы-кой и пением прошел карнавал 600 детей, одетых в национальные костюмы. Правда, было странно видеть белобрысого ‚таджика’ в переливающемся всеми цве-тами радуги халате или черного, как смоль, и смуг-лого ‚карела’, но все же карнавал пользовался большим успехом. На море к концу гулянья появилось несколько яхт. К сожалению, из-за бурной погоды не удалось про-вести обещанного катанья посетителей. Вечером все 40000 человек, приехавшие вчера в Петергоф, были воз-награждены великолепным зрелищем водяных струй, освещенных цветными прожекторами. Весь ‚большой грот’ […] был освещен разноцветным сиянием. Затем у Большого дворца, в потоках бриллиантов дождя фейер-верка, возникли пылающие буквы: ‚Да здравствует две-надцать лет Конституции СССР!’ Этим закончилось гулянье“.20
Fröhliche Flaggen, Banner und bunte Bänder verschönerten den Park. Sieben Orchester erfüllten die Alleen mit Musik. Aber die Hauptattraktion blieben, natürlich, die Wasserspiele und Fontänen. [...] In den Alleen des Unteren Gartens fand mit Musik und Gesang ein Karnevalszug mit 600 in natio-nale Trachtenkostüme gekleideten Kindern statt. Sicher, es war etwas seltsam darunter einen blonden ‚Tadschiken’ in einer in allen Farben des Regenbogens schillernden Robe und einen schwarzhaarigen und dunkelhäutigen ‚Karelier’ zu beobach-ten, aber trotz allem wurde der Karneval ein großer Publi-kumserfolg. Gegen Ende des Festes erschienen auf dem Meer einige Yachten. Leider konnten wegen des stürmischen Wet-ters die angekündigten Besucherrundfahrten nicht durchge-führt werden. Am Abend wurden alle 40.000 Menschen, die gestern nach Peterhof gekommen waren, mit einem großarti-gen Schauspiel des mit farbigen Lichtern angestrahlten Was-sertheaters belohnt. Die ganze „Große Grotte“ [...] erstrahlte in farbenprächtigem Glanz. Schließlich erschienen beim Gro-ßen Palast im Strom des Brilliantenregens eines Feuerwerks die glühenden Lettern: „Hoch leben die zwölf Jahre der Ver-fassung der UdSSR!“ Damit endete das Fest.
Der Regisseur Jakov Urinov kannte die Peterhofer Feste nicht nur vom Hörensagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sogar am 6. Juli 1935 in Peterhof war, weil er bereits einen Monat davor zu den Dreharbeiten von „Intrigant“ nach Leningrad gekommen war, wor-über ebenfalls die oben zitierte „Rote Abendzeitung“ (Večernjaja krasnaja gazeta) am 9. Juni berichtet hatte.
Indessen, trotz der offensichtlichen Beliebtheit der regelmä-ßigen kulturellen Massenveranstaltungen, gefiel der sowjetische Peterhof bei weitem nicht allen Besuchern. Der Schriftsteller Alek-sej Panteleev, der ebenfalls um 1935 hier im Hotel „International“ in Sovetskaja 7 abstieg, berichtet nicht ohne Sarkasmus von den Volksfesten in der vormaligen kaiserlichen Residenz:
„Восемнадцатого мая в Петергофе традиционный праз-дник, открытие фонтанов. С утра за окном гвалт духо-вой музыки. Днем я работал, вышел в парк под вечер. Шумно, многолюдно, празднично, но – не весело. Много пьяных. И целые тучи продавцов „эскимо“. Много моря-ков, военных. Девочки в долгополых шелковых платьях. Самсон, раздирающий пасть cвейскому льву, только что вызолочен. Львиная пасть изрыгает водяной столб.Небо над заливом – старинное, акварельно-гравюрное. Дымит пароход, открывающий навигацию.В глубине парка повизгивает гармоника...Картинно красивый матрос в компании товарищей шагает с гармонью на ремне, наигрывает и поет:
Три-четыре взгляда – И будешь ты моя...
За ним идут рядами, как на демонстрации. Песня, даже такая, облагораживает толпу. Здесь меньше похабщины, ругани и просто – тише.“21
Am 18. Mai ist in Peterhof ein traditioneller Festtag, Eröffnung der Fontänen. Vom Morgen an ertönt aus dem Fenster Lärm der Blaskapelle. Tagsüber hatte ich gearbeitet, gegen Abend ging ich in den Park. Es war laut, überfüllt, feierlich, aber – nicht fröhlich. Viele Betrunkene. Und eine ganze Schar von Verkäufern von „Eskimo“-Eis. Viele Matrosen, Soldaten. Mäd-chen in langen Seidenkleidern. Samson, das Maul des schwe-dischen Löwen aufreißend, wurde gerade frisch vergoldet. Das Löwenmaul spie eine Wassersäule. Der Himmel über der Bucht wirkte altwürdig, aquarellig-kup-ferstichig. Ein Dampfschiff eröffnete die Saison, qualmte.In den Tiefen des Parks quäkte eine Ziehharmonika...Ein bildhübscher Matrose marschierte in Gesellschaft seiner Genossen mit einer Ziehharmonika am Schulterriemen, spielte und sang:
Drei, vier Blicke –und Du wirst die Meine...
Ihm folgten Menschenketten, wie auf einer Demonstration. Ein Lied, sogar ein solches, veredelt die Masse. Hier gab es weniger Obszönitäten, Flüche und es war einfach – ruhiger.
3. Standbild aus dem Film „Intrigant, oder der Süßeste Flug“ (Intrigan, ili Sladčajšij polet). Regisseur Jakov Urinov, 1935.
5
Man könnte diese kritische Skizze als Zeugnis einer negativen Einstellung der Intelligenzia gegenüber der Sowjetmacht auf-fassen. Jedoch erzählten unverdächtige sowjetische Bürger nicht weniger plastisch von den kritikwürdigen Umständen in Peter-hof auch in Hinblick auf eine mögliche Protesthaltung, wie bei-spielsweise die sogenannten Arbeiterkorrespondenten (rabkory), die ihren Urlaub in den lokalen Erholungsheimen verbrachten. In der Zeitung der Arbeiterkorrespondenten „Für neuen Alltag“ (Za novyj byt), die in Peterhof in den 1930er Jahren herausgege-ben wurde, erschien 1932 folgende Beschwerde:
„Как придешь обедать в столовую ДО 4-5 [дома отдыха], то там не хватает тарелок. Нас 14 человек, а тарелок – 3. И вот приходится стоять в очереди и ждать осво-бождающейся тарелки. Заведующий столовой тов. Уса-нов тарелок не дает и, кроме того, кричит на нас на чем свет стоит. За хлебом приходится идти в другую сто-ловую и, главное, каждой работнице отдельно вместо того, чтобы одной сходить и принести на всех хлеба. […] Имеет место и такой факт, когда тов. Усанов берет руками из общего протвеня (sic!) с плиты макароны и тут же их ест, а потом из этого же протвеня отпуска-ются макароны служащим, а руки Усанов моет, оче-видно, не каждый день, т.к. когда ни посмотришь, они у него всегда грязные“.22
Wenn Du in die Kantine der Erholungsheime Nr. 4-5 gehst, dann gibt es dort nie genügend Teller. Wir sind 14 Leute, und es gibt 3 Teller. Und also muss man sich in der Schlange anstellen und auf einen freien Teller warten. Der Kantinenlei-ter Genosse Usanov gibt keine Teller heraus, und außerdem schreit er uns an, wann immer er nur kann. Um Brot zu holen geht man in eine andere Kantine, und zwar jedes mal einzeln, anstatt dass eine Arbeiterin geschickt wird, um genügend Brot für alle gleich zu bringen. [...] Es ist auch vorgekommen, dass Genosse Usanov sich eine Handvoll Makkaroni vom gemein-samen Backblech nimmt und diese auf der Stelle isst, danach aber von eben diesem Blech die Makkaroni an die Kantinen-besucher ausgegeben werden; und seine Hände wäscht Usa-nov ganz offensichtlich nicht mal täglich, denn sobald man darauf schaut, sind sie immer dreckig.
Die neuen Kultur- und Erholungsparks unterschieden sich von der Gartenkultur der vorrevolutionären Zeit sowohl durch den neuen lumpenproletarischen Alltag als auch in Hinblick auf neue Formen der Freizeitgestaltung. Dieses bunte Leben der Gärten griffen bereitwillig Dichter und Schriftsteller in den 1920er und 1930er Jahren auf. Nikolaj Zabolotskij (1903-1958) beschrieb 1928 in dem Gedicht „Volkshaus“ (Narodnyj dom) die Vergnü-gungen und Rutschberge in dem Petersburger Alexander Park (Aleksandrovskij Park) am Kronwerk-Prospekt im Rücken der Peter-Paul-Festung:
„тут каждый мальчик забавлялся,кто дамочку кормил орехами,а кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты,над ними девочки – богини красоты – в повозки быстрые запрятались,повозки катятся вперед,красотки нежные расплакались,упав совсем на кавалеров.“23
Hier amüsierte sich jeder junge Mann,der eine verfütterte Nüsse an ein Fräulein,der andere schlummerte über dem Bier ein.Hier ragen „amerikanische Berge“ hervor,über ihnen thronen Mädchen – Göttinnen der Schönheit –,sie verschwinden in schnellen Wagen,die Wagen rollen vorwärts,die zarten Schönheiten heulten,auf ihre Kavaliere fallend.
In dem Roman „Bamboccianten“ (Bambočada24) von 1931 malte Konstantin Vaginov (1899-1934) in grotesker Manier aus, wie sich Bauern und Arbeiter die Gärten von Zarskoje Selo auf ihre spezifische Art aneigneten.25
Mit dem Aufkommen neuer Besuchertypen und Nutzungs-arten in den 1920er Jahren verlor der englische Landschaftspark die Verbindung mit der psychologisierenden Sprache, die seit dem späten 18. Jahrhunderts die Wahrnehmung der Gartenan-lagen prägte. Man konnte zwar zeitgenössische Gärten in einer melancholischen Stimmung abbilden, wie es beispielsweise in einem späten Gemälde von Apollinarij Vasnecov (1856-1933) unter dem Titel „Der Klang des alten Parks“ (Šum starogo parka) der Fall war (Abb. 4). Nichtsdestoweniger hätten in Anwesen-heit von Rotarmisten auf gemeinsamen Spaziergängen mit oder ohne junge Damen in den Alleen des Parks alle Texte der soge-nannten Dichtung von Zarskoje Selo (carskosel’skaja lirika), von Gavriil Deržavin und Alexander Puschkin bis Georgij Iva-nov und Anna Achmatova, völlig unangebracht geklungen.
4. Apollinarij Vasnecov, Der Klang des alten Parks (Šum starogo parka), 1926. Öl auf Leinwand, 106 x 176 cm. Memorial’nyj muzej-kvartira A.M. Vasnecova, Staat-liche Tret’jakov-Galerie, Moskau. (Aus: Bol’šaja illustrirovannaja ėncoklodedija živopisi. Moskva 2010, S. 97).
6
Um so überraschender wirkt der Essay „Der Gedanke, der einen Kreis umschrieb“ (Mysl’, opisavšaja krug) von Lidija Ginzburg (1902-1990),26 dessen Schlüsselpassage einen Spa-ziergang im Park von Peterhof darstellt. Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ginzburg begann 1936 die Arbeit an diesem Text, der psychologische Elemente des Landschaftsgar-tens aufnimmt und weiterführt, trotz ihrer Unbehaustheit in der Epoche des sozialistischen Aufbaus. Dies erscheint noch seltsa-mer, wenn man bedenkt, dass Peterhof in erster Linie für seine Gartenpartien im regelmäßigen Stil berühmt ist. Ein Blick in die intellektuelle Entstehungsgeschichte dieses Textes macht verständlich, wie diese Wahrnehmung Mitte der 1930er Jahre möglich wurde.
* * *
Lidija Ginzburg beschäftigte sich in dieser Zeit mit der Geschichte der russischen Spätromantik und verbrachte ihren Urlaub 1936 in einem der Hotels, die in der vormaligen kaiserlichen Residenz in Peterhof eröffnet worden waren. Wahrscheinlich wohnte sie im Hotel „International“, in dem die Gesellschaft zur Unterstützung der Schriftsteller – Litfond –ihren Mitgliedern einige Zimmer zur Verfügung stellte. Zu verschiedenen Zeiten stiegen dort die Schrift-steller Jurij German, der bereits erwähnte Aleksej Panteleev, Niko-laj Tichonov, Daniil Charms und auch die Regisseure Aleksandr Zarchi und Iosif Chejfic sowie der Kunstmaler Lev Kantorovič und viele andere ab. Der Schriftsteller Leonid Rachmanov (1908-1988) erinnerte sich:
„Домов творчества тогда еще не существовало, и, чтобы литератор мог пожить с месяц за городом и усиленно потрудиться в отрыве от семьи и многочисленных обще-ственных нагрузок, Литфонд зафрахтовал четыре или пять номеров в петергофской гостинице ‚Интернацио-нал’.27 […] Герман писал [здесь] ‚Лапшина’, Лев Канто-рович работал над иллюстрациями к ‚Нашим знакомым’, кинодраматурги М.Блейман и Э.Большинцов писали сценарий ‚Великого гражданина’. Житье было моло-дое, веселое, дружное; работали много, но находилось время и для бесед, и для шуток, и для лыжных прогу-лок […]“.28
Die Häuser der Kulturschaffenden existierten damals noch nicht, und damit ein Schriftsteller für einen Monat auf dem Land leben und losgelöst von der Familie und den zahlrei-chen gesellschaftlichen Verpflichtungen intensiv arbeiten konnte, mietete der Litfond vier oder fünf Zimmer im Peter-hofer Hotel „International“ an. [...] [Jurij] German schrieb [hier die Erzählung] „Lapschin“, Lev Kantorovič arbeitete an den Illustrationen zu „Unserem Bekannten“, die Kinodrama-turgen M. Blejman und Ė. Bol’šintsov schrieben das Dreh-buch [für den Film] der „Große Bürger“. Das Leben war hier jung, fröhlich, freundschaftlich; es wurde viel gearbeitet, aber es fand sich auch Zeit für Gespräche, für Scherze, für Skiaus-flüge [...].
Im Text Ginzburgs „Mysl’, opisavšaja krug“ wird das Leben des Kurbetriebs völlig ignoriert; Alltagsbeschreibungen interessier-ten sie an letzter Stelle. In Peterhof sah sie weder einen neuen sowjetischen Kurort noch die Ruinen des alten Russland, für das sie als eine Intellektuelle sozialistischer Prägung keine Sympa-thien hegte. Auch ihre jüdische Herkunft schloss die Möglich-keit aus, sich auf die Seite des antisemitischen „alten Regimes“ zu schlagen. In ihrer Erzählung beschrieb sie eine Suche nach basa-len Wertvorstellungen, die die Teilhabe am sowjetischen Leben begründen, und lotete poetische Grundsätze aus, die die sowjeti-sche Realität darzustellen ermöglichen.
Paradoxerweise stellten Mitte der 1930er Jahre die Gartenanla-gen von Peterhof für die Autorin einen Landschaftsraum für medi-tative Spaziergänge dar, ganz im Sinne der Reflexionslandschaften der Romantik des späten 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Sie beschreibt den Park in Peterhof als einen Ort, an dem es weder ein aktuelles politisches Leben, noch einen pittoresken Provinzall-tag gibt. Der deskriptive Teil des Essays ist im Winter und Frühling angesiedelt, zu einem Zeitpunkt also, da sogar die Gartenpartien im regelmäßigen Stil leicht als Landschaftsgarten im englischen Geschmack oder Waldpark wahrgenommen werden konnten. Das schien der ideale Ort zu sein, um aus dem gewohnten Gang der Dinge herauszutreten und zu versuchen, die Realität außerhalb der Logik des Alltäglichen - „entfremdet“ - zu betrachten; ein Grenz-raum zwischen gewöhnlicher Vorstellung und historischer Refle-xion. Der Grenzcharakter war in diesem Fall nicht nur eine Gar-tenmetapher. Peterhof war in jenen Jahren eine Grenzstadt. Wenn man den Beschluss „Über die Zutrittsordnung zu Grenzgebieten der UdSSR“ genau befolgte, so war die Stadt wohl der letzte Ort in westlicher Richtung von Leningrad, den man ohne schriftli-che Genehmigung des Innenministeriums (NKWD) besuchen konnte.29 Der Ort und die Gartenanlagen von Oranienbaum, die etwas näher an der Westgrenze lagen und außerdem eine Mari-nemilitärbasis in ihrer Nachbarschaft hatten, waren ohne Passier-schein nicht zugängig. Im Reiseführer über Peterhof und Orani-enbaum wurden Touristen daher gewarnt:
„Для проезда в Ораниенбаум необходим пропуск. Про-пуска выдаются в бюро пропусков НКВД (Ленинград). Учреждение или предприятие, организующие экскур-сию, представляют за три дня до экскурсии заявление с приложением списка участников (в трех экземпля-рах). Форма списка: порядковый номер, год рождения, партийность, социальное положение, место рождения, адрес. […] одиночный посетитель должен получить про-пуск в НКВД […], предварительно заполнив анкету и представив две фотографические карточки“.30
Für den Besuch von Oranienbaum ist ein Passierschein not-wendig. Passierscheine werden im Passierscheinbüro des NKWD (Leningrad) ausgestellt. Behörden oder Unterneh-men, die eine Exkursion organisieren, reichen drei Tage vor der Exkursion einen Antrag unter Beilage einer Teilnehmer-liste (in drei Exemplaren) ein. Format der Liste: Laufende Nummer, Geburtsdatum, Parteizugehörigkeit, gesellschaft-liche Stellung, Geburtsort, Adresse. [...] Ein Einzelbesucher
7
muss sich einen Passierschein beim NKWD ausstellen lassen [...], nach Ausfüllen eines Formulars und unter Vorlage von zwei Fotografien.
Der Park von Peterhof lag plötzlich in unmittelbarer Nähe zur Grenze, die den sowjetischen Staat von der westlichen Welt iso-lierte.
In dem Text Ginzburgs erscheint er als ein Raum außerhalb historischer Dimension, ein idealer Platz für Betrachtungen über die zeitgenössische sozialpsychologische Realität. Die poe-tischen Spaziergänge Ginzburgs könnte man durchaus mit den „Träumereien des einsamen Spaziergängers“ Jean-Jacques Rousse-aus vergleichen, der seinerzeit ein Refugium vor dem Leben der „großen Welt“ suchte und sich den Betrachtungen gesellschaft-licher Erfahrungen eines modernen Menschen an einem glei-chermaßen peripheren Ort hingab.31 Rousseau zählte zu ihren Lieblingsautoren. Sie war jedoch, um den Vergleich zu präzisie-ren, in dieser Zeit keine öffentliche Figur, anders als Rousseaus in den späten 1770er Jahren, obwohl sich beide zum Zeitpunkt der jeweiligen literarischen Reflexionen in marginaler Lage wie-der fanden.
Ginzburgs „Mysl’, opisavšaja krug“ stellt keine Reflexion aktueller Tagesthemen dar, es handelt sich bei diesem Text um Betrachtungen von Schlüsselfragen der Epoche. Der Essay wid-met sich der Suche nach neuen ethischen Werten und nach einer neuen literarischen Figur. Der Protagonist Ginzburgs ist ein Intellektueller, der hofft, volksnahe sozialistische Überzeu-gungen mit ästhetischen Ansichten in Übereinstimmung zu bringen, die unter dem Einfluss von Symbolismus und Futu-rismus entstanden. Ginzburgs Text zeigt, dass weder symboli-scher Mystizismus und avantgardistische Formensprache, noch christliche und kantianische Ethik in der Hochphase des sozia-listischen Aufbaus wirksam sein können. Als existentielle Posi-tionen und ethische Lehren verlieren sie angesichts sowjeti-scher Ideologie und des Atheismus jegliche Relevanz. Auf der Suche nach einem neuen Realismus, der den Anspruch erhebt, das Privatleben in kollektivistischer Gesellschaft beschreiben zu können, wendet sich die Autorin der Frage nach ethischen Werten zu. Dabei beschäftigt sie sich mit existentiellen mensch-lichen Grenzerfahrungen und insbesondere mit dem Verhält-nis zum Tod. In diesem Zusammenhang befragt sie Kollegen, Bekannte und auch weitere Personen aus den nichtintellektuel-len Schichten nach ihrer privaten Haltung zum Tod und stellt fest, dass viele ihrer Mitbürger ungern über ethische Grundsätze des Schicksals nachdenken. Im Gegensatz zu ihren Gesprächs-partnern erscheint Ginzburg übertrieben ernst in ihrem Bestre-ben, den Sinn des Todes für sowjetische Atheisten der 1930er Jahre mit ihren unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hin-tergründen und Bildungsgeschichten bestimmen zu wollen.
Diese sozialanthropologische Studie legt Ginzburg ihrer Erzählung zugrunde, die damit in die Textsorte der „wissen-schaftlichen“ Prosa fällt und sich als charakteristisch für die frühsowjetische Zeit erweist. In den 1920er und frühen 1930er Jahren interessieren sich viele Schriftsteller und Künstler für die Erkenntnisse der Wissenschaftler und geben sich oft Fan-tasien von unglaublichen wissenschaftlichen Utopien hin. So
kreisen auch Gespräche einfacher Menschen, die Ginzburg bei ihrer Studie beobachtet, unter anderem um die Zeitungsartikel über die Experimente des Professors Efim Semenovič London (1869-1939), der sich mit der Verdoppelung der durchschnitt-lichen menschlichen Lebensdauer beschäftigt. Die Analyse die-ser Gespräche geht ebenfalls in die Erzählung ein.32
In diesen Jahren arbeiten Wissenschaftler verstärkt an Mit-teln zur Stimulierung von Nerven- und Hirnaktivitäten. Im Zeitalter pausenloser Arbeitseinsätze (nepreryvki) und sozia-listischer Arbeitswettbewerbe in vorzeitiger Planerfüllung war die Erschöpfung eines der Haupthindernisse auf dem Weg zur leuchtenden Zukunft. Ein hormonelles Präparat legt bei-spielsweise Andrej Zamkov (1883-1942) vor. Er entwickelt auf Grundlage von Urin schwangerer Frauen ein Mittel zur Stei-gerung der Ausdauer namens „Gravidan“, das unter anderem seine Frau, die Bildhauerin Vera Muchina (1889-1953) nimmt, als sie an der Vollendung der monumentalen Skulptur „Arbeiter und Kolchosbäuerin“ arbeitet.33 Das Problem der Erschöpfung versucht man auch im Institut für Bluttransfusion zu lösen, an dessen Spitze damals mit Aleksander Bogdanov einer der ein-flussreichsten Ideologen des Frühbolschewismus steht, denn seit Mitte der 1920er Jahre erscheinen dort ständig Patienten, die über Erschöpfung klagen.34
Mit Müdigkeit und Methoden ihrer Überwindung beschäf-tigen sich im Zeitalter des ersten Fünfjahresplans nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Schriftsteller. Ginzburg kennt das Problem nicht nur vom Hörensagen, sie notiert in einem ihrer Arbeitshefte: „Es ist zu wenig, erschöpft zu sein, man muss sich übererschöpfen; es genügt nicht zu arbeiten, man muss sich überarbeiten [...]. Die Bedeutung der Arbeit hat sich aufs Äußerste ausgedehnt“.35 Wie man ein aktives Mitglied einer Gesellschaft bleiben kann, die einen radikalen Umbruch erlebt, und wie man die eigene „Jugendlichkeit bewahren“ kann, beschreibt Michail Zoščenko (1894-1958) in dem wissenschaft-lich-literarischen Prosastück „Die zurückgebrachte Jugendlich-keit“ (Vozvraščennaja junost’) von 1933. Dasselbe Problem spricht Jurij Oleša (1899-1960) in seiner Rede im Rahmen des Ersten gesamtsowjetischen Schriftstellertags im Jahr 1934 an.36 Der bereits erwähnte Konstantin Vaginov thematisiert 1933 in dem Roman „Garpagoniana“ das frühzeitige Altern der Intelli-genzia, die keinen Platz in der sowjetischen Gesellschaft gefun-den hat.37
Zusätzlich zur Unterstützung der Werktätigen in ihrer ins-pirierten und über die Kräfte gehenden Arbeit im Rahmen des ersten Fünfjahresplans begeisterte sich die Forschung der 1930er Jahre für das futurologische Projekt der Erschaffung eines neuen sowjetischen Menschen. Physiologen, Psychologen und Biologen wenden sich den Wegen zu, wie man in Hinblick auf den Traum des künftigen kollektiven Glücks menschliche Fähigkeiten verbessern kann.38 Diese unglaubliche anthropo-logische Utopie schließt sowohl die Entwicklung der Euge-nik,39 die Tätigkeiten des Instituts für Hirnforschung,40 als auch Experimente zur Verjüngung des Professors Volosatov ein, die der Schriftsteller Zoščenko in dem bereits erwähnten Roman „Zurückgebrachte Jugendlichkeit“ beschreibt. Noch Mitte der 1920er Jahre schreibt Michail Bulgakov (1891-1940) in seinen
8
Romanen „Hundeherz“ (Sobač’e serdce, 1925) und „Schick-salseier“ (Rokovye jajca, 1925) mit böser Bitterkeit in satiri-schen Zügen über die neue sowjetische Wissenschaft, die einen glücklichen Homunkulus züchtet. Zehn Jahre später nehmen diese Forschungsträume in den Fantasien der Künstler dage-gen monumentale Gestalt an: in der Verfilmung des Theater-stücks von Jurij Oleša unter dem Titel „Der strenge Jugend-liche“ (Strogij junoša, 1936) des Regisseurs Abram Room ist Professor Julian Stepanov nicht nur ein Chirurg erster Klasse, der die Mitglieder der Führung behandelt sondern er verleiht auch den Menschen Unsterblichkeit.41
Auch der Professor Efim Semenovič London, auf den Ginz-burg in ihrem Text eingeht, denkt über Möglichkeiten der Ver-jüngung und der Überwindung des Alters nach. Seine Überle-gungen stellt er in zwei Büchern unter den Titeln „Kampf für die Langlebigkeit“ (Bor’ba za dolgovečnost’, 1924) und „Leben und Tod“ (Žizn’ i smert’, 1926) dar, die er gemeinsam mit Ivan Kryžanovskij verfasst.42 Beide Forscher interessieren sich für eine der aussichtsreichsten Forschungsrichtungen der Eugenik in den 1920er Jahren für Experimente mit der Entfernung und Transplantation von Keimdrüsen (Gonaden), die die Chirurgen L. Štejnach und S. Voronov erfolgreich durchführten. Ginzburg setzt sich mit den Reaktionen ihrer Gesprächspartner auf den Zeitungsartikel über die Lebensverlängerung nach Efim Lon-don auseinander. Sie schließt damit ihre eigenen Gedanken über den Tod und die existentiellen Grundsätze, die es einem Athe-isten ermöglichen, die Angst vor der Endlichkeit des Lebens zu überwinden, in den schizoiden Kontext sowjetischer wissen-schaftlicher Experimente ein.
Noch wichtiger als die Frage nach utopischen Szenarien ver-längerten Lebens erscheint Ginzburg wie der Tod in der sowjeti-schen atheistischen Gesellschaft mythologisiert wird. So lässt sie beispielsweise den Protagonisten ihres Essays „Mysl’, opisavšaja krug“ die „musterhafte Park-Nekropole“43 in Leningrad besu-chen. Es handelt sich um den früheren Lazarevskij Friedhof des Alexander-Newskij-Klosters.44 Im Zuge der Umgestaltung zu die-ser neuen Park-Nekropole zerstörte man 1935-1937 alte Gräber und versetzte einige der erhaltenen Grabsteine an neue Orte. In die neue Nekropole wurden außerdem die Überreste von Revolu-tionären und Kulturschaffenden anderer Friedhöfen wie Volkovs-kij und Mitrofan’evskij umgebettet. Auf diese Weise entstand in Leningrad ein berühmter Memorialpark, das neue sowjetische Pantheon. Ginzburg beschreibt in ihrem Essay, wie der rituelle Raum der Nekropole gestaltet wird, jedoch gilt ihr Hauptinter-esse dem Verständnis des Todes als eines existentiellen Paradoxes. Der neue sowjetische Friedhof bei der Kathedrale, die sogenannte „kommunistische Plattform“ (kommunističeskaja ploščadka), frappiert sie durch die augenfällige Nähe des sowjetischen Athe-ismus zum traditionellen Aberglauben. Auf den Grabmälern der Atheisten, die am Aufbau der neuen Gesellschaft mitgearbeitet haben, entdeckt sie unangebrachte und absurd wirkende Ikonen sowie triviale Epitaphe. Dennoch erkennt die Autorin gerade auf dem Grabstein des Linguisten und Akademiemitglieds Nikolaj Marr (1865-1934) in unverhoffter Weise die ‚Formel’ zur Über-windung des Todes:
„На черном мраморе высечены слова: ‚Человек, умирая индивидуально, соматической смертью, не умирает обще-ственно. Переливаясь своим поведением, делами и твор-чеством в живое окружение общества, он продолжает жить в тех, кто остается в живых, если жил при жизни и не был мертв. И коллектив живой воскрешает мертвых’.“45
In schwarzen Marmor sind die Worte graviert: „Der Mensch, wenn er eines individuellen, somatischen Todes stirbt, stirbt nicht gesellschaftlich. Sein Verhalten, seine Taten und Werke fließen in das lebendige Umfeld der Gesellschaft ein, deswegen lebt er in denjenigen weiter, die am Leben bleiben, wenn er zu seinen Lebzeiten gelebt hat und nicht tot war. Und das Kollektiv der Lebenden erweckt die Toten zum Leben“.
Die gesellschaftliche Unsterblichkeit, die Erinnerung, die den Zeit-genossen und den folgenden Generationen übrig bleibt, erweisen sich als eine unerwartete Brechung der philosophischen Idee Niko-laj Fedorovs (1829-1903) zur Auferstehung der Toten im Pathos des neuen Gemeinschaftswerks, des Lebens und der Arbeit mit allen gemeinsam („truda so vsemi soobšča“),46 von denen zu Beginn der 1930er Jahre auch Boris Pasternak träumte. Die gesellschaftliche Unsterblichkeit nimmt die Furcht vor der Endlichkeit körperlicher Existenz.
Wie man die sowjetische Realität nun beobachten und reflektie-rend wahrnehmen kann, erschließt sich der Autorin des Essays wäh-rend eines Spaziergangs im Park von Peterhof. Die Landschaft der ehemaligen kaiserlichen Residenz ist leer und öde: Eine verschneite, leblose Natur, ein in ein Sanatorium umgewandelter Palast und Sol-daten, „die bereits gewarnt wurden“47 und daher bereit scheinen, jederzeit ihr Leben zu opfern.
„Снежный пейзаж не только освобождает мысль от вся-ческой суеты, – он освобождает ее от самого себя. Не пог-лощая и не задерживая мысль, он сквозь себя пропускает ее дальше.От высоко стоящего дворца открываются радиусами аллеи нижнего парка. Они двуцветны – белый тон снега и темный тон хвои и дерева. […] Удивительно просто мне предстают – высота, глубина, светотень, протяженность, движение“.48
Die Schneelandschaft befreit nicht nur den Gedanken von aller erdenklichen Hast, sondern sie befreit ihn auch von sich selbst. Weder vereinnahmt noch angehalten, treibt er durch die Land-schaft weiter fort.Von dem hoch oben stehenden Schloss öffnen sich radial die Alleen des unteren Parks. Sie sind zweifarbig – die weiße Tönung hat der Schnee und die dunkle Tönung haben die Nadeln und das Holz. [...] Erstaunlich einfach erscheint es mir jetzt – die Höhe, die Tiefe, das Helldunkel, die Ausdehnung, die Bewegung.
Durch diese ‚transparente’ Landschaft des Parks hindurch betrachtet Ginzburg die Realität des Begreifbaren und formuliert eine poetische Figur der Reflexion – eines Gedanken, der zu sich selbst zurückkehrt, oder, wie es im Titel des Essays heißt, der einen Kreis umschrieb.
9
Die Reflexion erscheint in diesem Essay als Mittel der Erörterung, als literarische Form und als ethischer Wert. So lautet die Alternative zum Symbolismus, Futurismus und zur marxistischen Soziologie zur Zeit des ersten Fünfjahresplans.
(Übersetzung aus dem Russischen von Florian Sander)
„Единство сознания – […] это связь материалов творчес-кой памяти в ее непрестанной борьбе со смертью […]“.49
Die Einheit des Bewusstseins – [...] das ist die Verbindung des Materials der kreativen Erinnerung in ihrem unaufhörlichen Kampf mit dem Tod [...].
Anmerkungen
1 Zur sowjetischen Gartenkultur der 1930er Jahre siehe den Beitrag von Katha-rina Kucher in diesem Heft der „Gartenkunst“.
2 Kommunal’noe chozjastvo 1 (1932), S. 30 „мы должны сделать так, чтобы дать в эти парки такие же удобства, какие даются в европейских городах, с той «маленькой» разницей, что там этими удобствами пользуются капиталисты, а у нас будут пользоваться пролетарии“. Hier und im Fol-genden, wenn nicht anders angegeben, stammen alle Übersetzungen ins Deut-sche von Florian Sander.
3 Planirovka Leningrada i značenie Petergofa v etoj planirovke (1935), in: Delo, skomponovannoe iz rossypi različnych del, 1930-1940, Band 2. Archiv des Staatlichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signa-tur D-777, l. 52: „культурно-просветительским центром всесоюзного значения“. - Der Verfasser dankt Julia Valentinovna Zelenjanskaja für ihre Hilfe bei der Arbeit mit den Beständen des Archivs des Staatlichen Muse-ums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg (Archiv Gosudarstvennogo Muzeja-Zapovednika „Petergof”).
4 „грандиозный культурный комбинат“, „Зеленый театр“, „Водный ста-дион“, siehe: Protokol vstreči naučnych rabotnikov Petergofskich muzeev so stachanovcami-transportnikami, otdychajuščimi v Petergofskom dome otdycha LOSPS (1935), in: Delo, skomponovannoe iz ros-sypi različnych del, 1930-1940, Band 1. Archiv des Staatlichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signatur D-776.
5 Siehe die Zeitungsnachrichten in Izvestija vom 26. Juli 1933 und Leningrads-kaja pravda vom 26. Juli 1933.
6 Dokladnaja zapiska o sostojanii Petergofa v 1936 g. in: Delo o sostojanii petergofskich parkov, 1936. Archiv des Staatlichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signatur D-369, l. 10.
7 Vypiski iz del archiva FSB i Gosudarstvennoj biblioteki Rossijskoj Federacii (byvšej imeni V. I. Lenina) o Archipove, in: Archiv des Staatli-chen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, fond 1, delo 17, l. 6.
8 Vypiski iz del archiva FSB i Gosudarstvennoj biblioteki Rossijs-koj Federacii, Archiv GMZ Peterhof, fond 1, delo 17, l. 16: „Я не был музейным консерватором, но я решительно возражал против искажения исторически сложившегося художественного облика Петергофа“.
9 „стрелковые тиры“, „площадки для волейбола и баскетбола, гимнас-тический городок, сектор прыжков, беговая дорожка на 100 метров“, „концерты из радиостудии парка (электро-радио-граммофон)“. Siehe die Erklärung zum Plan von Peterhof, in: Petergof i Oranienbaum. Spravočnik po dvortsam-muzejam parka. Leningrad 1935, o.S.
10 „затейничество, массовые игры и танцы“, Petergof i Oranienbaum, S. 44.11 „эстрада для самодеятельных выступлений“, „зеленая площадка для
лежания“, siehe Petergof i Oranienbaum, S. 44-45.12 Semen Gejčenko: Pavil’on PVO v Petergofe, 1933 (Typoskript). in:
Archiv des Staatlichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signa-tur R-284a: [пройти инструктаж по противовоздушной обороне у] „специалистов Артиллерийского исторического музея РККА“.
13 Siehe diese Episode (3:20 Min) aus „Intrigan, ili Sladčajšij polet“, Reg. Jakov Urinov (1935) unter: <http://rutube.ru/tracks/2061984.html>
14 Siehe dazu den Beitrag von Irina Paščinskaja in diesem Heft der „Garten-kunst“.
15 Zapiska ot direkcii Petergofskogo muzeja Petergofskomu piščekombinatu No. 2, in: Perepiska s Trestom restoranov, 1936. Archiv des Staatlichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signatur D-370, l. 12.
16 Ekskursionno-massovaja rabota v 1933-1936 godach. Archiv des Staat-lichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signatur D-2362, l. 9.
17 Statistika poseščaemosti petergofskich dvortsov-muzeev s 1918 po 1935 gg., in: Delo o sostojanii petergofskich parkov, 1936. Archiv des Staat-lichen Museums (GMZ) Peterhof, St. Petersburg, Signatur D-369, ll. 51, 53.
18 Vgl. Večernjaja krasnaja gazeta vom 4. Juli 1935.19 „две грузовые машины с бутербродами, пирожками и сладостями, 32
лотошницы, мороженое на тележках, индивидуальные пакеты с обе-дами“, Večernjaja krasnaja gazeta vom 4. Juli 1935.
20 Večernjaja krasnaja gazeta vom 7. Juli 1935.21 Aleksej Panteleev: Iz starych zapisnych knižek. 1924-1947, in: Ders., Sobra-
nie sočinenij. 4 Bände. Leningrad 1984, Band 4, S. 305f.22 Za novyj byt, 5 (1932). 23 Nikolaj Zabolockij, Sobranie sočinenij. 3 Bände. Moskau 1983. Band 1,
S. 370.24 In Anspielung auf „il Bamboccio“.25 Vgl. Konstantin Vaginov, Bambočada, in: Ders., Kozlinaja pesn’.
Romany. Moskau 1991, S. 352-364.26 Siehe zu Ginsburg zuletzt: Emily Van Buskirk, Andrei Zorin (Hg.), Lydia
Ginzburg‘s Alternative Literary Identities. A Collection of Articles and New Translations. (= Russian Transformations: Literature, Culture and Ideas; Band 3). Oxford, Frankfurt am Main 2012. Vgl. darin: Stanislav Savitsky, Reflection As An Ethical Value (Lydia Ginzburg’s „The Thought That Drew A Circle”), S. 263-282.
27 Leonid Rachmanov, Ljudi – narod interesnyj. Leningrad 1978, S. 362.28 Rachmanov, Ljudi – narod interesnyj, S. 429.29 О порядке въезда в пограничную полосу СССР, in: Bjulleten’, 1933,
Nachweis, S. 6-7. 30 Petergof i Oranienbaum. Spravočnik po dvorcam-muzejam parkam.
Leningrad 1937, S. 25-27.31 Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire. Lausanne 1782.32 Lidija Ginzburg, Mysl’, opisavšaja krug, in: Dies., Zapisnye knižki.
Povestvovanija. Ėsse. Sankt Petersburg 2002. S. 542-582, hier S. 547-549, S. 552.
33 Siehe dazu Ė. Najman: Diskurs, obraščennyj v plot’: A. Zamkov i voploščenie soveckoj sub’’ektivnosti, in: Chans Gjunter [Hans Gün-ther], Evgenij Dobrenko (Hg.), Socrealističeskij kanon. Sankt Peters-
10
burg 2000, S. 625-638.34 Vgl. Aleksandr Bogdanov, God raboty instituta perelivanija krovi. 1926-27.
Moskau 1927.35 „[…] утомляться мало – надо переутомляться; недостаточно рабо-
тать, надо перерабатываться […]. Значение работы расширилось до крайности“. Archiv Lidii Ja. Ginzburg, Rossijskaja nacional’naja bibliotheka (RNB), St. Petersburg, fond 1377, Tetrad’ V. 10.06.1929 –17.12.1930, S. 166a-166.
36 Jurij Oleša, Reč’ na Pervom Vsesojuznom s’’ezde soveckich pisatelej, in: Ders., Izbrannoe. Moskau 1935, S. 3-8.
37 Vgl. Konstantin Vaginov, Garpagoniana, in: Ders., Kozlinaja pesn’. Romany. Moskau 1991, S. 422, 450.
38 Vgl. Aron Zalkind, Psichologija čeloveka buduščego, in: Žizn’ i tech-nika buduščego (social’nye i naučno-techničeskie utopii). Moskau und Leningrad 1928, S. 432-503. - N. Š. Melik-Pašev: Čelovek buduščego, in: Žizn’ i technika buduščego (social’nye i naučno-techničeskie utopii). Moskau, Leningrad 1928, S. 337-431.
39 Siehe dazu Marija Malikova, NĖP kak opyt social’no-biologičeskoj gibri-dizacii, in: Otečestvennye zapiski 1 (2006), S. 175-192.
40 Monika Spivak, Posmertnaja diagnostika genial’nosti. Ėduard Bagrickij, Andrej
Belyj, Vladimir Majakovskij v kollekcii Instituta mozga. Moskau 2001.41 Siehe dazu Arkadij Bljumbaum: Oživajušaja statuja i voploščennaja
muzyka. Konteksty „Strogogo junoši“, in: Novoe literaturnoe obozre-nie 89 (2008), S. 138-189.
42 Efim London, Ivan Kryžanovskij, Bor’ba za dolgovečnost’. Petrograd 1924; Dies., Žizn’ i smert’. Leningrad 1926.
43 Zur zeitgenössischen Diskussion über Park-Friedhöfe vgl. stellvertretend den Zeitungsartikel: Parki-nekropoli, in: Večernjaja Krasnaja gazeta vom 14. Juni 1935.
44 Zur Umgestaltung des Friedhofs siehe Aleksandr B. Kobak, Jurij M. Pirjutko, Istoričeskie kladbišča Sankt-Peterburga. Moskau, Sankt Petersburg 2009, S. 228-234.
45 Ginzburg, Mysl’, opisavšaja krug, S. 560.46 Eine erste umfassende Werkausgabe des als Begründer des russischen Kosmis-
mus geltenden Philosophen wurde nach seinem Tod veröffentlicht: Nikolaj Fedorov, Filosofija obščego dela. Band 1. Vernyj 1906; Band 2. Moskau 1913.
47 „получившими предупреждение“. Ginzburg, Mysl’, opisavšaja krug, S. XXX.
48 Ginzburg, Mysl’, opisavšaja krug, S. 568.49 Ginzburg, Mysl’, opisavšaja krug, 581.