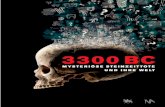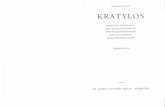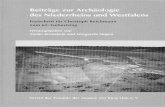Das Phänomen der großen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Zeitreise.
Expandierender Rückzug. Eine Rezension der ThLZ
Transcript of Expandierender Rückzug. Eine Rezension der ThLZ
1
EXPANDIERENDER RÜCKZUG
EINE REZENSION DER THEOLOGISCHEN LITERATURZEITUNG
Leipzig, Oktober 2013
Hartmut von Sass
Hinführung – oder: Sind wir auf einem Krisengipfel?
Um die Theologische Literaturzeitung steht es alles andere als gut. So schlimm, dass
man es offenkundig für nötig erachtet, den gesamten Herausgeberkreis nach Leipzig zu
rufen, um gemeinsam mit hoffnungsvoll jungen Fachvertretern die prekäre Lage einge-
hend zu sondieren. Eine Tagung als Krisengipfel oder gar als Gipfel der Krise – ? Das
jedenfalls war meine erste Reaktion, als ich die Einladung erhielt, hier „vorzusingen“.
Diese Vermutung geht sicher an der „eigentlichen Intention“ (so ja Bultmann
über den Mythos) dieser Zusammenkunft vorbei. Sich seiner selbst im Gespräch mit
anderen – oder mit dem Anderen seiner selbst – vergewissern zu wollen, sollte nicht
voreilig zu einer krisis stilisiert werden. Aber eine particula veri liegt dann doch in
meiner nicht ganz freundlichen Ausgangsbeobachtung; denn wenn alles zum Besten
stünde und sich keine Fragen mehr stellten, bräuchten wir hier gar nicht sitzen (oder
stehen). Wo sich hingegen Fragen auftun, ist etwas unselbstverständlich geworden.
Und, so heißt es dann entsprechend in der Einladung an die Referenten: „Ihre Antwor-
ten […] interessieren, damit wir das, was wir tun, künftig noch besser tun können.“
Auf welche Fragen sollen unsere Antworten antworten? Ich zitiere die Einla-
dung noch einmal; dort heißt es: „Welche Themen und Fragestellungen sollten aus ihrer
Sicht in einem Rezensionsorgan zu Ihrem Fachgebiet besonders beachtet werden? Was
würde Sie aus der Sicht Ihres Forschungs- und Arbeitsfelds besonders interessieren?
Wo sehen Sie Interessen, die über die Spezialfragen einer oft recht kleinen wissen-
schaftlichen Expertengruppe hinausgehen?“. Dies sind in der Tat zentrale Fragen, die
konkrete Probleme in unseren (Sub)Disziplinen betreffen, Fragen nach Präferenzen und
der damit unausweichlichen Selektion aus all den unabsehbaren Möglichkeiten und uns
überflutenden literarischen Angeboten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind.
2
Ich muss allerdings auch zugeben, dass es mir schwer fällt, auf die genannten
Fragen unmittelbar zu antworten; und zwar nicht, weil sich keine „Interessen“ und
„Spezialfragen“ benennen ließen – ganz im Gegenteil –, sondern weil jede sinnvolle
Antwort auf weit grundlegendere Schichten verweist, welche die gegenwärtige Ausrich-
tung und Ausgestaltung der ThLZ betreffen. Noch einmal: „Ihre Antworten […] inte-
ressieren, damit wir das, was wir tun, künftig noch besser tun können.“ Meine wohlwol-
lend-kritische These lautet etwas salopp: ‚Was Ihr tut, macht Ihr prima! Das Problem
liegt vielleicht eher in dem, was Ihr nicht tut.‘
Was ist damit gemeint? Einerseits, dass sich die drei Genres der ThLZ – Ein-
gangsaufsatz, Rezensionsteil und ggf. Literaturberichte – in ihrem Zusammenspiel be-
währt haben und nach wie vor dafür sorgen, dass die ThLZ eine Zeitschrift eigener Art
ist, also im besten Sinn ein eigenartiges Format bietet. Die starke Fokussierung auf das
rezensive Kerngeschäft ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Organs im Vergleich und
Kontrast zu anderen Zeitschriften und journals, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Das sollte unbedingt so bleiben. Andererseits stellen sich aus meiner Sicht Probleme –
oder: amerikanisch gewendet: ‚Herausforderungen‘ –, die weitreichend, aber behebbar
sind. Sie seien zunächst thetisch und nicht ohne gewisse Zuspitzungen genannt:
(1) Die ThLZ ist ein Publikationsorgan, das der ‚Theologen-Theologie‘ angehört
und einen „expandierenden Rückzug“ angetreten ist, d.h. der besagten Über-
flutung mit Neuerscheinungen wird akademisch-kühl, aber nicht medial-
einladend begegnet. Will die ThLZ ihren Auftrag auch über „kleine Exper-
tenkreise“ (so ja die Einladung) hinaus erfüllen, wird sie sich neuen Formen
der Besprechung der ihr anvertrauten Literatur weiter öffnen müssen. Dies
gilt auch und insbesondere für Themen der Systematischen Theologie.
(2) Kern der ThLZ ist die Rezension. Die expliziten oder nur lautlos vorausge-
setzten Parameter dafür, was eine ‚Rezension‘ sein könnte und welche For-
men sie annehmen dürfte, sind zu eng. Sie schließen partizipatorische und in-
teraktive Formen der Rezension genauso aus, wie Mehrfach- und Doppelre-
zensionen sowie Besprechungen anderer Genres (z.B.: Es werden nur Bücher
rezensiert – wieso nicht Aufsätze, die ebenso interessant und ergiebig sein
können? Oder: Es wird weitgehend Literatur gegenwärtiger Trends bespro-
chen, aber zu selten eben jene Trends der gegenwärtigen Literatur).
3
(3) Rezensionen (auch sondierende Literatur- bzw. summierende Überblicksar-
tikel) sagen, was der Fall ist. Ausblicke – der Blick also dafür, was nicht nur
der Fall ist, sondern zugleich dafür, was der Fall sein könnte – werden ge-
wagt, aber sind selten. Beides, die Spiegelung des status quo und der voraus-
schauende „Möglichkeitssinn“, verbleiben im Modus der Beschreibung. Das
ist verständlich, aber nicht selbstverständlich. Um der ThLZ eine noch inte-
ressantere und hörbarere Stimme zu verleihen, könnte ich mir vorstellen, den
Gestus des rein Deskriptiven durch den Mut zum Präskriptiven – nicht: zu
ersetzen, aber – zu ergänzen. Ein Organ der theologischen Selbstverständi-
gung – und dies mag eine prägnante ‚Definition‘ dessen sein, wofür die
ThLZ steht – wird Platz dafür haben, nicht nur mitzuteilen, was literarisch
los ist, sondern was theologisch das Los des Literarischen sein sollte.
Damit habe ich mein Pulver bereits verschossen. Was folgt, sind lediglich, aber immer-
hin systematisch-theologische Erläuterungen dieser zugegebenermaßen etwas pauscha-
len Vermutungen.
1. Ausgangslage: Adressaten – Trends
Von einer ‚Theologen-Theologie‘, an der auch die ThLZ partizipiere, war die Rede. Das
ist ausdrücklich nicht als Kritik gemeint – jedenfalls dann nicht, wenn ausschließlich
akademische Theologinnen und Theologen den Kreis der Adressaten ausmachen. Nun
heißt es im Gründungsaufruf von 1875:
„Die Theologische Literaturzeitung soll soviel als möglich allen Kreisen der pro-
testantischen Theologie Deutschlands dienen. Keine Richtung wird principiell
von der Mitarbeit ausgeschlossen sein. Die Beurtheilung der literarischen Er-
scheinungen soll möglichst sachlich sein, nur die wissenschaftliche Tüchtigkeit,
nicht den Parteistandpunkt in‘s Auge fassend. Indem aber so die Redaction sich
bestreben wird, Allen gerecht zu werden, hofft sie doch zugleich dem Blatte eine
einheitliche, charaktervolle Haltung wahren zu können. […]“
Zwei Punkte scheinen mir von besonderem Gewicht zu sein: dass zum einen „al-
le Kreise der protestantischen Theologie Deutschlands“ angesprochen werden und dass
4
zum anderen eine „einheitliche Haltung“ der Zeitschrift beabsichtigt ist. Bleiben wir
zunächst beim ersten Punkt. Ist die ‚akademische Theologie‘ synonym zur zitierten
Wendung, in der es um „alle Kreise der protestantischen Theologie“ geht? Wenn ja,
kann immer noch über die Ausgestaltung der ThLZ debattiert werden, aber jene Überle-
gungen reagieren auf eine komplexere Lage, wenn dies verneint wird. Mit der Erweite-
rung der Adressaten – Studenten, die Pfarrerschaft, die Kirche, andere Wissenschaften
oder gar Teile der intellektuell interessierten Gesellschaft – erschweren sich auch die
Rezeptionsbedingungen der ThLZ.
Dann nämlich stellen sich andere Erfordernisse: Bei steigender Heterogenität der
Leserschaft mag der Bedarf an einem orientierenden Zugriff auf die Literatur grösser
sein, ein Zugriff, der sich zu einem gewissen Teil die vergleichsweise kleinmaschigen
Einzelrezension entzieht. Die strukturelle Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Welche
Formen der Rezension sollen künftig angeboten werdeb? Und daran schließt sich eine
weitere, mediale Frage an, die schlicht lautet: Soll eine Zeitschrift wie die ThLZ ihre
Leser auch unterhalten, soll sie so gestaltet sein, dass sie – mit Kant – nicht nur ‚aus
Pflicht‘, sondern ‚aus Neigung‘ gelesen wird? Darauf wird zurückzukommen sein.
Neben der Frage nach den potenziellen Rezipienten stellt sich jene andere Fra-
gen nach den Entwicklungen des Faches, die man ‚rezensiv‘ einfangen möchte. Welche
wären dies mit Blick auf die Systematische Theologie? Einige zentralen Punkte seien
stichwortartig genannt:
1_ der drohende Bedeutungsverlust des (gedruckten) Buches; entweder könnte
dies in online-Publikationen (academia.edu) eingehen oder der (peerly reviewed)
Aufsatz wird weiter an Relevanz gewinnen;
2_ die Vielzahl von Lehrbüchern (mittlerweile zu fast allen dogmatischen Lehr-
stücken – bald: ‚Christologie für Gestresste‘); dies ist einerseits der Tribut an die
Durchschulung unseres Faches, aber zugleich auch ein Symptom dafür, dass der
status quo eher verwaltet, als kreativ revidiert wird;
3_ die Krise der Materialdogmatik – obgleich es hier zunehmend Gegentenden-
zen gibt; verwiesen sei exemplarisch auf zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet der
5
Ekklesiologie – obgleich damit über den (zuvor teilweise biographisch beding-
ten) Bezug der Autorinnen und Autoren zur Kirche noch nichts gesagt ist;
4_ methodische Fragen der systematisch-theologischen Ausrichtung; die betrifft
Teilfragen bezüglich der Beziehung von Theologie und Religionsphilosophie,
von theologischer Tradition und metaphysischem Denken und der Frage, wie die
Dogmatik aufgebaut oder strukturiert sei muss (trinitarisch, subjektivitätstheore-
tisch, hermeneutisch etc.);
5_ damit zusammenhängend: Ist die Theologie eine (einheitliche, enzyklopä-
disch strukturierbare) Wissenschaft? Konkreter: Bleibt die Theologie ‚wissen-
schaftlich‘, wenn sie sich als die traditionsgebundene kreative Auslegung des
christlichen Ethos versteht?
6_ (Selbst)Provinzialität der deutschsprachigen Systematischen Theologie, die
sich schwer tut, nach außen zu wirken, aber auch Impulse aus anderen Ländern
immer noch eher zaghaft aufnimmt;
7_ zur dezimierten Wirkung einer gesellschaftlich engagierten Theologie: Neu-
auflagen der politischen Theologie: Hat die Theologie als Disziplin das Potenzi-
al, sich Gehör zu schaffen? Die personalisierte Variante lautet: Welcher der ge-
genwärtigen Kollegen nimmt tatsächlich am gesellschaftlichen Diskurs teil und
wird als ernstzunehmende Stimme wahrgenommen?
Diese Aufzählung ist selektiv, benennt aber, hoffe ich, (die) zentrale(n) Probleme. Und
nun fragt sich, ob und wenn ja inwiefern die ThLZ ihren Beitrag leisten kann, um auf
jene Problemanzeigen konstruktiv zu reagieren.
2. Zum gegenwärtigen Format
Die genannten Fragen sind offensichtlich ganz unterschiedlichen Zuschnitts. Es geht um
formale Probleme (1: Zukunft des Buchformats), um inhaltliche Ausrichtungen (2:
Lehrbücher und 3: Materialdogmatik), um methodische Herausforderungen (4: ein
‚Prinzip‘ des Theologisierens und 5: der Wissenschaftscharakter der Theologie) und
6
schließlich um Probleme der Rezeption (6: innertheologisch im [inter]nationalen Kon-
text und 7: extern als Stimme im „Diskurs der Moderne“). Es wäre nicht sachgemäß zu
erwarten, die ThLZ könnte auf diese ziemlich divergenten Aufgaben gleichermaßen
antworten oder diese Probleme im Alleingang lösen. Bevor jedoch bei aller Vorsicht
benannt werden kann, was dann doch getan werden könnte, ist der Zuschnitt der ThLZ
genauer zu betrachten.
Damit komme ich auf die obige Behauptung zurück, dass die ThLZ als Rezensi-
onszeitschrift einen Begriff von Rezension hat, der selbst einer kritischen Rezension –
oder Revision – bedarf. Was sind also die expliziten oder lautlos mitlaufenden Prämis-
sen zu dem, was eine Rezension zu einer Rezension macht? Wenn man einige Verkür-
zungen in Kauf nimmt, lassen sich folgende Voraussetzungen freilegen:
(0) Jemand rezensiert etwas – das ist nur scheinbar trivial; denn:
(i) diese(r) jemand ist (zumeist) eine Einzelperson, die dem Thema mit Interesse
und / oder als Experte nahesteht und das Werk – entweder auf Anfrage oder von
sich – aus der entsprechenden Fachdisziplin heraus bespricht;
(ii) was heißt rezensieren? Noch einmal der ‚Gründungsaufruf‘: „Keine Rich-
tung wird principiell von der Mitarbeit ausgeschlossen sein. Die Beurtheilung
der literarischen Erscheinungen soll möglichst sachlich sein, nur die wissen-
schaftliche Tüchtigkeit, nicht den Parteistandpunkt in‘s Auge fassend.“; nicht
auf die theologische Schwerpunktsetzung (Thema, ‚Schule‘, Genre) kommt es
an, sondern auf einen sachlich-distanzierten, mithin deskriptiv-kritischen Zu-
gang, der „Allen gerecht zu werden“ versucht, auf den aber nicht seinerseits
noch einmal reagiert werden könnte.
(iii) Womit dabei deskriptiv-kritisch umgegangen wird, sind ausschließlich Bü-
cher (Monographie, Sammelbände, Lexika, Textsammlungen, mehrbändige
Werke). Es handelt sich folglich stets um etwas Literarisches, das wiederum mit
nur einer Gattung – dem Buch – identifiziert wird.
(iv) Und: In der ThLZ wird (i) bis (iii) gemacht – nichts anderes.
7
Es wurde schon betont: All diese Voraussetzungen mögen verständlich erscheinen und
sie haben ohne Zweifel ihre guten Gründe und willkommenen Wirkungen. Aber ver-
ständlich zu sein, ist noch keine Selbstverständlichkeit, sodass einmal probeweise zu
kontemplieren wäre, was passierte, wenn man zum einen die genannten Prämissen auf-
geben oder erweitern würde und zum anderen der klassischen Rezension weitere, auch
offenere Formen der (theologischen) Selbstverständigung an die Seite gestellt würden,
die dialogische und interaktive Zugänge einbringen. Gerade die sich darin abzeichnende
Polyphonie mag die im Gründungstext erwähnte Absicht einer „einheitliche[n] Hal-
tung“ womöglich treffender erfüllen.
3. Vorschläge
Nun einige Vorschläge zu unterbreiten, ist nicht ganz ungefährlich. Geht nicht! Alles
schon gehört! Zu idealistisch! Man kann nicht alles über den Haufen werfen! hört man
recht schnell, vielleicht ja mit guten Gründen. Aber ich zähle auf Ihr Wohlwollen –
schon deshalb, weil sich in den letzten Jahren in der ThLZ einige Dinge gewandelt ha-
ben, deren Ausgangspunkt genau dort liegen mag, wo auch die folgenden Erwägungen
ihren Ausgang nehmen. Ich denke dabei an die online-Version der ThLZ, die ganz neue
Möglichkeiten der Besprechung und insbesondere der Reaktionen darauf bietet, aber
auch an die Kür des „Buchs des Monats“, das – untypisch für die ThLZ – ein wertendes,
fast werbendes Statement darstellt. Ich freue mich darüber – daran wird man anschlie-
ßen können, auch wenn man sich umschaut, was nicht-theologische Rezensionsorgane
(etwa Theater der Zeit) bzw. Schwesterunternehmen in anderen Ländern betreiben (z.B.
Religious Studies Review).
Gehen wir also alle vier Prämissen – jemand (i) rezensiert (ii) etwas (iii) stets in
einer klassischen Rezension (iv) – einmal kritisch durch mit der Frage: Wie könnte es
anders sein?
Zu (i): die/der Rezensent/in: Eine der Voraussetzungen des Rezensierens liegt
für die ThLZ darin, dass ein Buch von einer ausgewiesenen Person besprochen wird.
Dabei wird es sicher mit guten Gründen bleiben, was nicht davon abhalten muss, in be-
stimmten Fällen von dieser Politik abzuweichen. Vorstellbar wäre, dass herausragende
8
Veröffentlichungen – ‚herausragend‘ durch den Autor, das Thema, die These – von
mehreren Leuten möglichst kontrovers besprochen werden. Nehmen wir ein ganz fri-
sches Beispiel: Im Septemberheft ist George Hunsingers How to read Barth von Chris-
tine Janowski rezensiert worden, und zwar aus Anlass der Übersetzung dieses bereits
1991 veröffentlichten Buches. Dieses darf als eine der wichtigsten englischsprachigen
Monographien zu Barth gelten, und die Rezensentin würdigt das Buch somit kritisch
aus zeitlichem und geographischem Abstand aus der barthianischen insider-Sicht. Wie
wäre es, wenn man den Präsidenten der Schleiermachergesellschaft dazu gewinnen
würde, seine Sicht der Dinge darzulegen? Jörg Dierken würde bestimmt zu anderen
Folgerungen und Wertungen kommen.
In eine ähnliche, aber doch davon verschiedene Richtung geht die folgende
Überlegung: Nehmen wir dazu wiederum ein Beispiel aus demselben Heft. Friedrich
Wilhelm Horn hat Ekkehard Stegemanns Aufsatzband zur den Brennpunkten der Rezep-
tion des Römerbriefs aus der Sicht der neutestamentlichen Wissenschaften rezensiert,
indem er es inhaltlich zusammengefasst hat. Nun ist das Thema offensichtlich auch aus
systematisch-theologischer Sicht interessant. Eine entsprechende Rezension würde an-
dere Schwerpunkte setzen (oder sich gar nur auf diese ganz selektiv fokussieren), aber
auch womöglich dazu beitragen, dass das angesprochene und seit Langem beklagte
Problem der Gesprächslosigkeit der theologischen Fächer untereinander von der ThLZ
konstruktiv verarbeitet würde. Analoges gilt für die akademischen Generationen, sodass
es gerade spannend sein könnte, wenn Rezensent und Rezensierter nicht einer Alters-
gruppe angehören – das vermeintlich Ungestüme der Jugend und die manchmal drohen-
de Eitelkeit der Etablierten kann man in Kauf nehmen.
Zu (ii): das Sprachspiel des Rezensierens: Es wurde mehrfach die deskriptiv-
kritische Ausrichtung der Rezension betont: Sie greift nicht ein, fordert nichts und stellt
auch keine eigenen Thesen auf, sondern sie informiert, ordnet, gibt einen Einblick in
eine Veröffentlichung jenseits von Werbung oder Warnung (von Ausnahmen abgese-
hen). Kurz: ‚Sie lässt alles, wie es ist‘ (Wittgenstein!), zumal sie eine Dienstleistung für
potenzielle (Nicht)Leser darstellt. Aus dessen Perspektive also ist sie zu schreiben. Nur,
was will der Leser? Zunächst einmal Information, aber gepaart mit Orientierung. Nur
jenem ersten Element kommt der rein beschreibende Charakter zu, während Orientie-
rungen von Unterscheidungen, Präferenzen und einem – dazu gegenläufigen – Vernach-
9
lässigen leben. Beim bloß Beschreibenden kann es folglich nicht bleiben, was sich auf
zwei Ebenen zeigt: Zum einen verdankt sich das, was überhaupt rezensiert wird, einen
unumgänglichen Selektionsprozess. De facto ist, soweit ich es überblicken kann, die
Auswahl sehr gelungen! Dennoch wird man über die dabei wirksamen Kriterien spre-
chen können. Auch hier ein Beispiel, das nun auf eine der obigen Trends zurückgreift:
Eine der prominenten Entwicklungen innerhalb der neueren Systematischen Theologie
liegt darin, dass es eine Reserve gegenüber materialdogmatischen Themen zu geben
scheint. Versteht sich die ThLZ nun so, dass sie es als ihre Aufgabe ansieht, hier gegen-
zusteuern? Dies hätte quasi (wissenschafts)politische Implikate: Ein Diskurs würde
nicht mehr nur rezensiv eingefangen, sondern partiell gesteuert werden.
Die zweite Ebene liegt nicht im Diskurs, sondern auf dem einzelnen Buch, das
zu einem Diskurs gehört. Momentan werden alle Bücher gleichbehandelt. Sie bekom-
men die Aufmerksamkeit von etwa zwei Spalten. Die neue Rubrik „Buch des Monats“
geht in eine andere Richtung und setzt so ein wertendes Zeichen. Dies ist eine weitrei-
chende Entscheidung gewesen, die ich begrüße und in deren Sinne man sich weitere
Aktionen wird vorstellen können. Dann aber bricht man mit jener Prämisse, „Allen ge-
recht zu werden“, da nun „starke Wertungen“ vorgenommen werden.
Zu (iii): die ‚gebuchte‘ Rezension: In diesem Punkt werden die meisten, oft nur
impliziten Voraussetzungen sichtbar, die zu diskutieren sind. Es wird zumeist ein aktu-
elles Buch besprochen. Warum eines? Warum nur ein Buch? Warum immer aktuell?
Zur ersten Frage: Häufig kann es hilfreich sein, eine Rezension komparativ zu
gestalten, ähnlich ausgerichtete Bücher also nicht separat, sondern kollektiv zu bespre-
chen, um Stärken und Schwächen ‚vergleichsweise‘ zu eruieren. Ich denke dabei an die
erwähnte Welle von Lehrbüchern und Einführungsliteratur. Gegenüber der Einzelrezen-
sion könnte dann der Überblicksartikel bzw. Literaturbericht gestärkt werden (wobei es
zu Überschneidungen käme mit dem, was in der Theologischen Rundschau passiert).
Zur zweiten Frage – nur Bücher? Der Fokus könnte auch weiter bzw. enger ge-
fasst werden. Zum Beispiel könnte man theologische Trends (wie oben) nachzuzeichnen
versuchen und ihrerseits ‚rezensieren‘. Ein weitgehend deskriptiver Gestus wiche dann
einem programmatischem Anliegen. Oder: Man könnte wichtige Aufsätze besprechen,
um das Privileg der Monographie etc. einmal zu brechen. Es setzt voraus, dass dort die
10
theologische Musik spielt. Das ist meist nicht so, leider. Darauf müsste man sich ein-
stellen und gleichzeitig in Kauf nehmen, das Problem der Selektion zu verschärfen.
Zur dritten Frage: nur aktuelle Bücher? Dazu nur eine weitere Frage als Vor-
schlag: Warum nicht „Buch des Monats“ – allerdings des Oktobers 1913?
Zu (iv): jenseits der Rezension?: Neben dem zentralen Rezensionsteil bietet die
ThLZ einen Eingangsartikel und Literaturberichte. Einige der vorangehenden Überle-
gungen gehen in die Richtung, diese Formate zu stärken. Über weitere, auch offenere
Gefäße wäre nachzudenken, die die ThLZ zugänglicher gestalten würden. Mit der onli-
ne-Version der ThLZ ergeben sich Möglichkeiten des Rezensierens und der entspre-
chenden Reaktionen darauf, die längst nicht ausgeschöpft sind und – bei allen Gefahren
– der print-Version derart überlegen sind, dass bald gefragt werden wird, warum es die-
se überhaupt noch geben muss. Davon unabhängig bleibt die Frage, welche Formen und
Weisen, eine theologische Selbstverständigung jenseits der Rezension gestalten zu kön-
nen, sich anbieten. Dabei denke ich vor allem an zwei Möglichkeiten: In eher essayisti-
scher, auch streitlustiger Form könnte auf gegenwärtige Trends, Herausforderungen und
Probleme reagiert werden, und zwar weniger deskriptiv-nachzeichnend, sondern durch-
aus im Modus der Forderung und Mahnung. In einem Interviewteil könnten im Modus
des Gesprächs mit ein oder zwei Fachvertretern aktuelle Publikationen, deren Kontext
und Bezug zu gegenwärtigen Konstellationen thematisiert werden.
Gegen Ende – die ThLZ als Organ der theologischen Selbstverständigung
Alle diese Erwägungen können nur im Kontext der umfassenderen Debatte abgewogen
werden, wie sich die ThLZ selbst künftig verstehen will: ausschließlich als Antwort auf
die Frage ‚Was ist in der Branche los‘? Konsistent durchhalten, lässt sich dies, wie ge-
zeigt, nicht. Antwortet aber die ThLZ über „die Spezialfragen einer oft recht kleinen
wissenschaftlichen Expertengruppe“ hinausgehend auch auf die Frage ‚Wie sollte unser
Geschäft aussehen?‘, sieht die Art theologischer Selbstverständigung nach innen und
außen anders aus. Ich wünsche mir von „allen Kreisen der protestantischen Theologie“
akademische Meinungsfreudigkeit und die (Ver)Suche, sich gesellschaftlich endlich
wieder einzubringen. Zu diesen Kreisen gehört – glücklicherweise – auch die ThLZ.