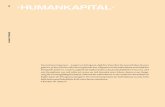Autorschaft im 21. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Positionsbestimmung (mit Matthias Schaffrick)....
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Autorschaft im 21. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Positionsbestimmung (mit Matthias Schaffrick)....
Komparatistische Studien / Comparative Studies
Hrsg. v. Baßler, Moritz / Frick, Werner / Schmitz-Emans, Monika
47
spectrum literaturwissenschaft
Matthias Schaffrick /Marcus Willand (Hrsg.)
Theorien undPraktiken derAutorschaft
DE GRUYTER CoopPartner
Inhalt
Teil I: Forschungsüberblick
Matthias Schaffrick / Marcus Willand Autorschaft im 21. Jahrhundert Bestandsaufnahme und Positionsbestimmung 3
I Ausgangslage 31 Prolog 32 Kurze Theoriegeschichte der Autorschaft: 1950–2000 9
II Systematische Rekonstruktion der Forschung 191 Hermeneutische Autorschaftstheorien 191.1 Hermeneutik und hermeneutischer Intentionalismus 191.2 Poetik, Rhetorik, Generik und Stilometrie 261.3 Funktionen und Argumente 301.3.1 Autorfunktionen 301.3.2 Argumente für einen Autorbezug 37
2 Poststrukturalistische Autorschaftstheorien 412.1 Subjektivierungen (Giorgio Agamben) 422.2 Auktorialität 502.3 Autofiktion 542.4 Gender 59
3 Autorschaft in Fiktionstheorie und Narratologie 613.1 Theorien 623.1.1 Fiktionstheorie 623.1.2 Narratologie 683.2 Exemplarische Studien 703.2.1 Herausgeberfiktion 703.2.2 Impliziter Autor 76
4 Theorien der Inszenierung von Autorschaft 834.1 Gegenbegriff ›Authentizität‹ 864.2 Texte und Medien 884.2.1 Paratexte 89
VI Inhalt
4.2.2 Internet 944.2.3 Stimme 964.3 Mediengesellschaft und literarisches Feld 984.4 Sozialhistorische Kontexte 1054.5 Soziale Systeme – Interdisziplinäre Erweiterungen 1114.5.1 Kunst 1114.5.2 Wissenschaft 1134.5.3 Politik 118
III Zur Konzeption des Bandes 120 Bibliographie 122
Teil II: Theorien literarischer Autorschaft
Moritz Baßler Mythos Intention Zur Naturalisierung von Textbefunden 151
Fotis Jannidis Der Autor ganz nah Autorstil in Stilistik und Stilometrie 169
Ralf Klausnitzer Autorschaft und Gattungswissen Wie literarisch-soziale Regelkreise funktionieren 197
Karin Peters Bataille und der gespenstische Souverän Der »Tod des Autors« revisited 235
Maik Neumann Der Autor als Schreibender Roland Barthes’ Konzept einer ›freundschaftlichen Wiederkehr des Autors‹ 263
Evelyn Dueck Diener zweier Herren Der Übersetzer zwischen Fergendienst und Autorschaft 287
Inhalt VII
Mirjam Horn »Breeding monsters out of its own flesh« Der multiple Autor in postmoderner Plagiatsliteratur 307
Teil III: Praktiken literarischer Autorschaft
Seán M. Williams C.F. Gellert als Vorredner des Genies Autorschaft um 1750 333
Uwe Wirth Autorschaft als Selbstherausgeberschaft E.T.A. Hoffmanns Kater Murr 363
Gero Guttzeit Writing Backwards? Autorpoetik bei Poe und Godwin 379
Marcel Schmid Auto(r)referentialität am Beispiel einer Collage von Kurt Schwitters 405
Clemens Götze »Ein Autor ist etwas ganz und gar erbärmliches und lächerliches« Autorschaft als Inszenierung bei Thomas Bernhard 419
Nina Maria Glauser Bewegtes Sprachleben Zum poetologischen Stellenwert des Autofiktionskonzepts im Werk Paul Nizons 439
Gerrit Lembke Vielstimmiges Schweigen Auktoriale Inszenierung bei Walter Moers 461
Innokentij Kreknin Der beobachtbare Beobachter Visuelle Inszenierung von Autorschaft am Beispiel von Rainald Goetz 485
VIII Inhalt
Eva-Maria Bertschy Der Autor ist anwesend! Zur poetologischen Bedeutung des leiblichen Autors bei den Auftritten der Autorengruppe Bern ist überall 519
Birgitta Krumrey Autorschaft in der fiktionalen Autobiographie der Gegenwart:Ein Spiel mit der Leserschaft Charlotte Roches Feuchtgebiete und Klaus Modicks Bestseller 541
Teil IV: Praktiken wissenschaftlicher Autorschaft
Felix Steiner Wissenschaftliche Autorschaft zwischen Zeitschrift und Handbuch Überlegungen zu einer am Autorbegriff orientierten Poetologie wissenschaftlicher Texte 567
Christina Riesenweber Reputation, Wahrheit und Blind Peer Review Eine systemtheoretische Perspektive auf anonymisierte Autorschaft als Qualitätssicherungsstandard der Wissenschaften 595
Teil V: Auswahlbibliographie
Matthias Schaffrick / Marcus Willand Autorschaftsforschung zwischen 2000 und 2014 615
Matthias Schaffrick / Marcus WillandAutorschaft im 21. JahrhundertBestandsaufnahme und Positionsbestimmung
I Ausgangslage
1 Prolog
Es gibt viele Argumente wissenschaftlicher und soziokultureller Provenienz, diedafür sprechen, dass Autorinnen und Autoren relevante und unverzichtbareFunktionen im Umgang mit Texten – keinesfalls bloß literarischen Texten –übernehmen. Diese Argumente können sich nicht nur auf wissenschaftsimma-nente Quellen berufen, sondern ergeben sich ebenso aus alltäglich beobachtba-ren Phänomenen der Autorschaft. Ob Skandale im Literaturbetrieb oder dieAuthentizität von Autorinnen und Autoren zur Diskussion stehen, ob die Wer-tigkeit anonymer politischer Meinungsäußerungen im Internet debattiert wirdoder es um die Zurechnung von wissenschaftlicher Reputation geht, ob literari-sche oder wissenschaftliche Plagiate oder die Verletzung von Persönlichkeits-rechten feuilletonistisch und juristisch zu verhandeln sind, ob ein Maßstab fürFaktualität und Fiktionalität oder auch Autorität gesucht wird, all diesen hete-rogenen und aktuellen Fragen liegt immer der gemeinsame Problembereichzugrunde, wer denn der Autor von ›etwas‹ ist und die Verantwortung für Ergeb-nisse und Folgen seines Kommunizierens, Schreibens oder Handelns zu über-nehmen hat – oder auch nicht! Auf diesem sehr weiten Feld haben sich in denletzten zehn Jahren nicht nur unzählig viele neue literaturtheoretische Proble-me und Fragestellungen entwickelt, die genannten Aspekte werden auch per-manent in der Medienkulturgesellschaft problematisiert und diskutiert und sindlängst selbst Gegenstand der literatur- und literaturbetriebsinternen Auseinan-dersetzung mit der Beziehung von Autor und Text geworden. 1
1 In der folgenden Einleitung versuchen wir die im letzten Jahrzehnt von der deutschen Lite-raturwissenschaft und insbesondere der Literaturtheorie meistdiskutierten Aspekte von Autor-schaft zu systematisieren, müssen aber gleichzeitig konzedieren, dass wir nicht jedes Phäno-men benennen oder bis ins letzte Detail diskutieren können.
4 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
Wenn ein Autor wie Peter Kurzeck es unternimmt, sein ganzes Leben so-wohl als Hörbuch als auch in Form von Romanen zu archivieren, wird dabeinicht nur die althergebrachte Unterscheidung von Autor und Erzähler prekär, 2
sondern auch die von Leben und Werk, ganz abgesehen von der Frage, wer alldas lesen oder sich anhören soll. Unter dem Titel Stuhl, Tisch, Lampe, gemeintsind damit die definierenden Requisiten einer Autoren-Lesung, berichtetKurzeck in einem Hörbuch von einer seiner Lesungen. Diese verdoppelte Autor-schaftsszene mit dem erzählenden Ich des Hörbuchs und dem erzählten Ich derLesung exemplifiziert auf vielfach verspiegelte Weise wie sich das Autor-Lebenund die damit gegebene Autorschaft in den medial-performativen Akten desSprechens, Lesens und Schreibens konstituiert. Im Hörbuch berichtet Kurzeckvon einer Lesung, bei der er einen Text liest, der in der Struktur einer mise enabyme in das Hörbuch eingegangen ist. Die Szene der Lesung wiederholt sichim Sprechen des Hörbuchs, das sich durch seine mediale Qualität jedoch mar-kant von der berichteten Lesung unterscheidet. Die erzählte, einmalige undnicht-wiederholbare Lesung, bei der der Autor anwesend sein musste, wirddurch das im Medium des Hörbuchs gespeicherte und das immer wieder hörba-re Erzählen vom Körper des Autors gelöst, während seine Stimme präsentbleibt. Während für die Lesung die Requisiten »Stuhl, Tisch, Lampe« als konsti-tutive Merkmale genannt werden, gibt der Paratext der Hörbuchhülle die fürKurzecks Autorschaft essentiellen Angaben in schriftlicher Form an – undstreicht das unwichtige aus. 3
2 Vgl. zuletzt Kablitz: Literatur, Fiktion und Erzählung; Köppe / Stühring: Against Pan-Narra-tor Theories. Zuvor Kania: Ubiquity; Alward: Ubiquity; Kania: Reply to Alward.3 Kurzeck: Stuhl, Tisch, Lampe.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 5
Jahreszahlen und Orte bzw. Regionen sind die für Kurzecks Autorschaft unver-zichtbaren Angaben. Historische Begebenheiten und Berufe werden getilgt. Erstdas doppelt unterstrichene »Schriftsteller« ist für die Autorschaft essentiell.Aber noch entscheidender, hervorgehoben durch mehrfache Unterstreichungund ein Ausrufezeichen, zudem noch einmal handschriftlich wiederholt, ist dasVerb »lebt«. Der Autor lebt und diese von ihm unterstrichene und handschrift-lich beglaubigte Vitalität lässt sich auch als Behauptung seiner ungebrochenenAktualität und Relevanz in Literatur, Kultur und deren Theoretisierung begrei-fen.4
Kurzeck ist nur ein Beispiel dafür, dass jeder Autor, jede Form der Autor-schaft, aber auch jedes Modell, jedes Konzept und natürlich jede Theorie vonAutorschaft einen durch bestimmte Vorannahmen geprägten Umgang mit Spra-che, Literatur und Gesellschaft impliziert. In diesen Wirkungszusammenhängenkann Autorschaft ganz verschiedene Funktionen erfüllen, je aus welcher Per-
4 Peter Kurzeck ist während der abschließenden Arbeiten an diesem Band, als dieser Teil derEinleitung längst geschrieben war, am 25. November 2013 verstorben. Der Band möge von derlebensüberdauerenden Lebendigkeit der Literatur und ihrer Autorinnen und Autoren zeugen.
Abb. 1: Peter Kurzeck lebt!
6 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
spektive man die Phänomene in den Blick nimmt und durch welche Medien undInstitutionen hindurch Autorschaft dargestellt wird.
Auch aufgrund dieser Vielfalt von in Texten, Paratexten und Medien auf-findbaren Autorschaftsphänomenen und deren Herausforderung für die wis-senschaftliche Analyse floriert die Forschung zum Thema Autorschaft und brei-tet sich über die Literaturwissenschaft hinaus aus. Dennoch vernachlässigt dieLiteraturwissenschaft bislang zentrale Bereiche der theoretischen Selbstver-ständigung und der zu beobachtenden Phänomene. Diese Bereiche zu erschlie-ßen und zu diskutieren, ist die Aufgabe des vorliegenden Bandes. Daher ist erauf Fragen ausgerichtet, die sich aus neuen Phänomenen, neu entstandenenForschungslücken und neuen Perspektiven auf die vergangenen Beiträge zurAutorschaftsdebatte um die 2000er Jahre ergeben. Dergestalt wird dieses Vor-haben – um mit dem Reihentitel zu sprechen – für das ganze spectrum Literatur-wissenschaft geöffnet.
Der Band setzt sich damit kein geringeres Ziel, als an die um die Jahrtau-sendwende erschienenen, wegweisenden und programmatischen Sammelbän-de anzuschließen, die heute zum literaturwissenschaftlichen Grundlagenwissenzählen und neue Forschungsfelder sowohl erschlossen als auch eröffnet haben. 5
So lässt der Blick auf die in der folgenden Einleitung systematisch rekonstruier-te literaturwissenschaftliche Theoriebildung der letzten zwölf bis vierzehn Jahreeine intensive Reflexion und Funktionalisierung des Autors und seiner gesell-schaftlichen Ausprägungen erkennen, die im Vergleich mit den stark durch diepoststrukturalistische Kritik beeinflussten 1980er und 1990er Jahren noch in-tensiviert wurden. Der vorliegende Band setzt eben diese Situation um das Jahr2000 als den Initiationspunkt seiner Betrachtungen an und will die seitdemfortgeführten und ausdifferenzierten Debatten und Positionen, aber auch die indiesem Zeitraum neu entstandenen Forschungsfragen inventarisieren, proble-matisieren und konturieren.6 – Althergebrachte, tief in die hermeneutische Tra-
5 Jannidis / Lauer u. a. (Hrsg.): Rückkehr des Autors; sowie Detering (Hrsg.): Autorschaft.6 Vgl. hierzu eine Auswahl der jüngsten Tagungen und Workshops zur Autorschaft als theo-retisches Phänomen: Anonymität & Autorschaft, Weimar (23.04.2009–25.04.2009); Kontrover-sen – Bündnisse – Imitationen: Geschichte und Typologie schriftstellerischer Inszenierungs-praktiken, Göttingen (25.06.2009–27.06.2009); Il traduttore come autore – The translator asauthor, Siena (28.05.2009–29.05.2009); Picture YourSelf. Authorship and Media in Contempo-rary German Literature, Coventry (08.05.2010–08.05.2010); Text, Erzählen, Subjekt. NeuePerspektiven auf Text- und Erzähltheorie, Berlin (05.03.2011–06.03.2011); Adel und Autor-schaft, Berlin (18.05.2011–19.05.2011); Autorschaft und Prophetie, Münster (27.05.2011–29.05.2011); »Aufgeschirrt für diese Welt«. Inszenierungen von Autorschaft in der Literatur derZwischenkriegszeit, Salzburg (12.01.2012–14.01.2012); Zwischen autobiografischem Stil und
Autorschaft im 21. Jahrhundert 7
dition eingebundene Problemstellungen bilden etwa Fragen nach der Rolle vonIntentionen, die durch ihre theoretische Reflexion im Kontext des hypotheti-schen Intentionalismus jüngst an Aktualität und Akzeptanz gewonnen haben,während es gegenläufige texttheoretische Bewegungen gibt, die Intentionenzum ›Mythos‹ erklären.7 Völlig neue Arbeitsgebiete haben sich für die Autor-schaftsforschung etwa im Bereich der neuen Medien eröffnet: Hier lassen sichFormen kollektiver Autorschaft, Inszenierungsstrategien und Imagebildungenbeobachten, die bis vor zehn bis fünfzehn Jahren noch undenkbar waren. Diessind jedoch nur einige Aspekte des hier vorgelegten Bandes. Darüber hinausfragt er nach den Auswirkungen der bisweilen stark normativ nuancierten Be-schreibung (oder war es doch die Forderung?) einer ›Rückkehr des Autors‹ umdas Jahr 2000 herum. Er fragt nach neuen Bedingungen für Autorschaft in derGesellschaft, bedingt durch veränderte Umgangsweisen mit literarischen Textendurch mediale, gesellschaftliche und institutionelle Einflüsse; er fragt darüberhinaus, wie sich die Literaturwissenschaft ihrer eigenen Praktiken im Umgangmit dem Phänomen Autorschaft bewusster werden kann, etwa indem auchFormen wissenschaftlicher Autorschaft wissenschaftstheoretisch problemati-siert werden. Und nicht zuletzt fragt er so nach den Möglichkeiten einer sinnvol-len Systematisierung der Hauptströmungen aktueller Autorschaftstheorien,autorschaftsbasierter Analyse- und Interpretationspraktiken und der Untersu-chung von Autorinszenierungen. Durch diese Fokussierungen grenzt sich der
Autofiktion. Narrative Funktionen und Identitätskonstruktionen der Figur des Ich-Erzählers inder Gegenwartsliteratur, Halle/Saale (31.01.2012–01.02.2012); Dichter und Lenker. Die Literaturder Staatsmänner, Päpste und Despoten vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Augsburg(09.02.2012–11.02.2012); Autorität und Autorschaft zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit,Bielefeld (16.02.2012 –17.02.2012); Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier. Poetolo-gien des deutschsprachigen Gegenwartsromans, Leipzig (13.03.–15.03. 2012); Der Autor istanwesend! Ou comment se mettre en scène avec son texte, Bern (13.04.2012); Weibliche Autor-schaft in der Mystik. Erzählstrategien und Ich-Inszenierungen, Tübingen (23.05.2012–24.05.2012); Fiktionen und Realitäten. Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Literaturbetrieb,Bremen (11.07.2012–13.07.2012); Subjektform Autor – Inszenierungen von Autorinnen und Au-toren als Praktiken der Subjektivierung, Oldenburg (20.09.2012–22.09.2012); Erzählung undGeltung. Wissenschaft zwischen Autorschaft und Autorität, Berlin (15.11.2012–15.11.2012);Schriftsteller und Diktaturen, Tartu (04.12.2012–04.12.2012); Dichterdarsteller – Selbstporträtsdes Autors als Autor, Zürich (27.06.2013–28.06.2013); Von sich selbst erzählen: HistorischeDimensionen des Ich-Erzählens, Irsee (30.09.201302.10.2013); Das Plagiat. Ein multidisziplinä-res Forum (Internationale Buchwissenschaftliche Gesellschaft, Jahrestagung 2013), St. Gallen(07.11.2013–08.11.2013) etc.7 Vgl. den Beitrag von Baßler: Mythos Intention (in diesem Band).
8 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
Band von anderen jüngst erschienenen Aufsatzbänden zum Thema Autorschaftab.8
Für die vorgenommene Bestandsaufnahme haben wir den folgenden Abrissin vier Abschnitte unterteilt, die auf den Sektionen einer 2011 von uns an derHumboldt Universität zu Berlin veranstalteten Tagung beruhen. 9 Der ursprüng-liche Titel »Autorschaft zwischen Intention, Inszenierung und Gesellschaft.Positionsbestimmungen nach der ›Rückkehr des Autors‹« hat sich jedoch, wieauch die Sektionstitel, als zu eng für die inhaltliche Reichweite der Beiträgeerwiesen. Aus diesem Grund haben wir die Tagungssektionen in die vier fol-genden Kategorien überführt, die für die Systematik der Einleitung und der amEnde des Bandes platzierten Auswahlbibliographie grundlegend sind:
1) Hermeneutische Autorschaftstheorien2) Poststrukturalistische Autorschaftstheorien3) Autorschaft in Fiktionstheorie und Narratologie4) Theorien der Inszenierung von Autorschaft
Da sich jede dieser Großkategorien aus eigenen Begründungszusammenhängenergibt, wird ihre Relevanz für eine literaturwissenschaftliche Revision autor-schaftsbezogener theoretischer Reflexion, Analysen und Lektüren durch dieausführliche Darstellung des jeweiligen Themenfeldes selbst zu plausibilisierenversucht. Dies folgt der Annahme, dass im Kontext aktueller literaturwissen-schaftlicher Forschung die Frage, ob der Autor auf irgendeine Weise relevantist, nicht mehr beantwortet werden muss bzw. durch ein bestimmtes Argumentbeantwortet werden kann. Eine systematische Rekonstruktion der zeitgenössi-schen Literaturwissenschaft muss auch in Autorfragen vielmehr die jeweiligenBegründungszusammenhänge einer Argumentation in Abhängigkeit von der
8 Insbesondere sind dies die Bände: Bannert / Klecker (Hrsg.): Autorschaft; Donovan / Fjel-lestad / Lundén (Hrsg.): Authority Matters; Dorleijn / Grüttemeier u. a. (Hrsg.): Authorship Re-visited; Hadjiafxendi / Mackay (Hrsg.): Authorship in Context; Künzel / Schönert (Hrsg.): Au-torinszenierungen; Kyora (Hrsg.): Subjektform Autor; Meier / Wagner-Egelhaaf (Hrsg.): Autor-schaft; Meier / Wagner-Egelhaaf (Hrsg.): Prophetie und Autorschaft; Pabst (Hrsg): Anonymitätund Autorschaft; Sieg / Wagner-Egelhaaf (Hrsg.): Autorschaften; Wagner-Egelhaaf (Hrsg.):Auto(r)fiktion.9 Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den zahlreichen Besucherinnen undBesuchern der Tagung, unseren freiwilligen und unfreiwilligen Helferinnen und Helfern sowieden uns finanziell und materiell unterstützenden Institutionen: Der Studienstiftung des Deut-schen Volkes, dem PhD-Net: »Das Wissen der Literatur«, der HU-Berlin, dem Exzellenzcluster»Religion und Politik« (WWU Münster) und der Graduate School »Practices of Literature«.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 9
literaturtheoretischen Provenienz des Argumentierenden beurteilen. Demge-genüber sind Aussagen wie »The author clearly is back on the agenda of literarystudies«10 ebenso unzulässig verallgemeinernd wie das vielbejubelte und späterebenso vielgescholtene Postulat eines vermeintlichen Tod des Autors. UnserVorschlag einer Systematisierung von autorbezogenen Forschungsbeiträgenaus der letzten Dekade muss demnach als Versuch einer vielschichtigen inhalt-lichen Kategorisierung verstanden werden, der den jeweils unterschiedlichenMotivationen und Umsetzungen, den Modi und normativen Gehalten des Be-zugs auf den Autor gerecht werden möchte.
Da sich die Beiträge zu diesem Band – auch durch die Fragestellung desCall for Papers für die genannte Tagung motiviert – nicht ausschließlich mittheoretischen Fragen beschäftigen, haben wir für den Band selbst – im Ver-gleich zu der Einleitung – eine offenere Struktur gewählt. Sie versucht nicht,einem für Tagungsbände kaum zu veranschlagenden Vollständigkeitsanspruchgerecht zu werden, sondern orientiert sich lediglich an der Unterscheidung vonTheorien und Praktiken der Autorschaft, wobei wir im letzten Fall zwischenPraktiken literarischer und Praktiken wissenschaftlicher Autorschaft differenzie-ren. Der Band schließt mit einer Auswahlbibliographie von gut 600 Titeln, diesich dezidiert mit autor(schafts)bezogenen Fragestellungen auseinandersetzen.Ihre Struktur orientiert sich an der Systematik der Einleitung.
2 Kurze Theoriegeschichte der Autorschaft: 1950–2000
Spätestens seit den 1980er Jahren und der Einführung des Begriffs »Anti-Hermeneutik« lässt sich eine stark irritierende Verwendung des Hermeneutik-Begriffs beobachten, der wir an dieser Stelle entgegentreten wollen. 11 So wird»Hermeneutik« von uns ausschließlich verwendet um eine bestimmte, auchrezent vertretene Theorietradition zu beschreiben. Diese zeichnet sich dadurch
10 Dorleijn / Grüttemeier: Aspects of Authorship.11 Besonders hervorheben möchten wir die Publikation Rusterholz: Hermeneutik, da hier(unseres Wissens) in der ersten bis zur achten Auflage nur von »Hermeneutik« die Rede ist.Dieser Artikel – aus den auch in der akademischen Lehre gängigen »Grundzügen der Literatur-wissenschaft« – wird dann Mitte der 1980er Jahre schon im Titel durch »neuere[ ] antiherme-neutische[ ] Strömungen« erweitert und markiert so deutlich, dass sich der Begriff ›Antiherme-neutik‹ zuvor im literaturwissenschaftlichen Kontext eingebürgert hatte. Vgl. ebenfalls »Anti-Hermeneutik« oder »Antihermeneutik« bei: Bergfleth: Antihermeneutik; Konersmann: Anti-Antihermeneutik; Laplanche: Psychoanalyse als Anti-Hermeneutik; Tepe: Kognitive Her-meneutik; Kreft: Theorie und Praxis.
10 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
aus, dass sie – und das ist ein für diesen Band durchaus hervorzuhebendesBestimmungskriterium – seit ihren Anfängen die Beschäftigung mit dem Autoreines Textes zu ihrem Gegenstandsbereich zählt und ihn auf bestimmte Weisenfunktionalisiert. Wenngleich diese Funktionen je nach hermeneutischem An-satz (teilweise stark) differieren, so werden sie in der Regel stets als konstitutivfür das Verstehen des literarischen Textes betrachtet. Legt der vermeintlicheGegenbegriff ›Anti-Hermeneutik‹ zwar einerseits nahe, dass sich die von ihmumschriebenen Positionen gegen jegliche Art autoraffiner Bedeutungskonzepti-onen aussprechen, impliziert er andererseits nicht weniger, dass diese Positio-nen dennoch auf irgendeine näher zu bestimmende Weise ebenfalls in der Tra-dition der Hermeneutik zu verorten sind oder sich zumindest aus ihr tradierthaben. Tatsächlich gehen sie aber nicht aus genuin hermeneutischen, sondernvielmehr aus verschärften formalistischen bzw. strukturalistischen und somitauf den ersten Blick kaum als »autoraffin« zu bezeichnenden Ansätzen hervor.
Doch sind auch unter diesen Positionen die wenigsten bereit gewesen, denhermeneutischen Autorbezug vollständig abzulehnen. Jan Mukařovský etwadenkt Mitte der 1940er Jahre den Autor als Schnittpunkt von äußeren Einflüs-sen, denen dieser aber nicht wehrlos ausgeliefert ist:
[W]enn wir behaupten, daß der Weg von der Künstlerpersönlichkeit zum Werk nicht di-rekt und unmittelbar ist, vor allem nicht spontan, so sind wir weit entfernt davon, dieKünstlerpersönlichkeit zu bestreiten. Vielmehr würden wir sie betonen wollen. Gesell-schaftliche, allgemein kulturelle und künstlerische Einflüsse ergreifen die Persönlichkeitnur insoweit und in der Weise, als sie es (bewußt oder unbewußt) zulässt. 12
Die später gerade in Frankreich prominent betriebene sprachphilosophische Ra-dikalisierung dieser strukturalistischen Ansätze redet dann aber dezidiert derNegierung einer Relevanz des Autors für Bedeutungszuschreibungen an literari-sche Texte das Wort. Dabei gehen deren Vertreter weder in ihrer Kritik noch inihrer Rhetorik wesentlich über die bereits 1928 von Roman Jakobson und JurijTynjanov beanstandete ›formalistische Kritik‹ am Autor hinaus. Diese hatten inihrem Manifest »Probleme der Literatur- und Sprachforschung« – das als zent-raler Text des Übergangs vom Russischen Formalismus in den Prager Struktura-lismus zu gelten hat – bereits »eine entschiedene Distanzierung [gefordert,] vonimmer häufiger auftretenden mechanischen Vermengungen neuer Methodolo-gie mit alten Methoden, von naivem Psychologismus und sonstigem metho-
12 Mukařovský [Vortrag/Erstdr. (tschech.) 1944/1966; dt. 1974]: Persönlichkeit, S. 79. Er be-handelt die Persönlichkeit des Künstlers auch unter dem Begriff ›Individualität‹ inMukařovský: Strukturalismus.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 11
dologischem Kram«.13 Es ist sicherlich kein Zufall, dass dieser frühe autorkriti-sche Aufsatz ›erst‹ und ›schon‹ knapp 40 Jahre später, 1966, in deutscherErstübersetzung im durchaus bekannten »Kursbuch« erscheint und so Agentzweier Bewegungen des internationalen Wissenstransfers wird: 14 Der nur lang-samen und späten deutschen Aneignung der Ansätze des frühen RussischenFormalismus – daher das ›erst‹ – wie aber auch der schnellen und frühen – da-her das ›schon‹ – Übernahme der nach 1945 formulierten autorkritischen Positi-onen (was wiederum einen Zeitraum betrifft, in dem der Prager Strukturalismus– wie Mukařovský oben – als Derivat des Russischen Formalismus eigentlichkeine eigene Kritik am Autor mehr formuliert).
Angesichts einer dergestalt skizzierten theoriegeschichtlichen Großwetter-lage Ende der 1960er Jahre bleibt nun aber weiterhin die zum Jahrtausendwech-sel von den Verfechtern der »Rückkehr des Autors« gestellte Frage offen, »wa-rum die poststrukturalistische Kritik den Autor als Interpretationskategorie sonachhaltig desavouieren konnte«.15 Vielleicht findet sich eine Antwort, verfolgtman die Ausgangssituation dieser Kritik im bereits eingeschlagenen Weg vonRussland und Tschechien aus weiter; genauer gesagt nicht nur chronologischweiter, sondern – geographisch betrachtet – auch über Deutschland hinausweiter Richtung Westen: Die Schriften Barthes’, Foucaults und Derridas richtensich insbesondere gegen eine positivistische Literaturgeschichtsschreibung undLiteraturwissenschaft à la Lanson und Picard,16 die zwar in Frankreich bis in die1960er tonangebend betrieben wurde, 17 in dieser Form im zeitgenössischenDeutschland jedoch gar nicht (mehr) existent war. Denn gegenüber der franzö-sischen muss die institutionalisierte deutsche Literaturwissenschaft der 1960erJahre als einflussfreudiger betrachtet werden. Die Gründe hierfür sind zahlreich
13 Jakobson / Tynjanov: Literatur- und Sprachforschung [1995], S. 63.14 Vgl. Jakobson / Tynjanov: Literatur- und Sprachforschung [1966], jedoch in einer wenigerbrauchbaren Übersetzung als in der in Anmerkung 13 genannten Poetik-Ausgabe Jakobsons.Weitere den Strukturalismus behandelnde und in diesem Heft abgedruckte Beiträge sind vonA. Bryan, F. de Saussure, R. Carnap, M. Bierwisch, Fodor und Katz, C. Lévi-Stauss undR. Barthes.15 Jannidis / Lauer u. a.: Rede über den Autor, S. 15.16 Vgl. bes. Lanson: Histoire und Picard: Nouvelle Critique.17 Vgl. zu dieser Kritik u. a. Barthes: Literatur oder Geschichte, bes. S. 67. Dort kritisiert er denanalogischen Determinismus des französischen Positivismus, »dem zufolge die Einzelheiteneines Werkes denen eines Lebens ›ähnlich‹ sein müssen, die Seele einer erfundenen Person derSeele des Autors, usw.« Die einschlägige Kontroverse zwischen Barthes und Picard, dessenBeitrag in der vorherigen Fußnote aufgeführt ist, rekonstruiert Helmut Scheffel in seinem Vor-wort zu dem von ihm übersetzen Pamphlet von Barthes: Kritik und Wahrheit.
12 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
und können anhand der wohl meistverbreiteten Interpretationsverfahren beiderLänder aufgezeigt werden. So hatte die deutsche Werkimmanenz 18 weder dieVerbreitung noch die Rigidität der französischen explication de texte mit der ihreigenen strengen Abfolge von introduction, développement und conclusion er-langt. Gerade hinsichtlich der Implementierung textexterner Wissensbestände– zu denen freilich autorbezogene Argumente zählen – kann das deutsche Pen-dant eine stärkere Diffusionsaffinität aufweisen. Wolfgang Kayser, einer derzentralen Vertreter der Werkimmanenz, schreibt 1948 in seiner für die Nach-kriegsgermanistik einflussreichen Monographie »Das sprachliche Kunstwerk«,dass die »rechte Erfassung eines Werkes sehr oft von der Kenntnis seines Ver-fassers abhängt«.19 Emil Staiger bekennt sich ebenfalls nicht nur emphatisch,sondern auch interpretationspraktisch zum Autorbezug. In »Die Kunst der In-terpretation« von 1951 vertritt er
die Ansicht, dass es ein barer Hochmut sei, sich beim Erklären von Sprachkunstwerkenauf den Text beschränken zu wollen. Wenden wir uns zu unserm Gedicht! Wir kennen denDichter: Mörike! Aber nur schon den Namen des Dichters zu wissen, ist wichtig und keinegeringe Erleichterung unseres Unternehmens. Wir wissen, wann dieser Dichter gelebt hat,und wissen Bescheid über seine Entwicklung. So werden wir auch erfahren wollen, auswelcher Zeit, womöglich aus welchem Jahr ›Auf eine Lampe‹ stammt. 20
In Frankreich ist die Situation eine andere. Die explication de texte als das nochimmer gängige Prüfungsverfahren zur Erlangung des Abiturs ( Baccalauréats),der Aufnahme an einer grande école (Concours) und in das höhere Lehreramt in
18 Als Vertreter gelten u. a. Kayser: Das sprachliche Kunstwerk; Staiger: Die Kunst der Inter-pretation; Trunz: Über das Interpretieren (bereits 1942 für eine Tagung geschrieben, aber we-gen des Krieges nicht in vor 1952 in gesprochener oder geschriebener Fassung veröffentlicht);Hamburger: Die Logik der Dichtung; Kindermann: Theatergeschichte Europas; Klotz: Form imDrama und Stanzel: Formen des Romans, aber auch »Germanisten wie Kurt May, Heinz-OttoBürger, Oskar Seidlin, Paul Stöcklein, […], August Closs und Heinrich Henel […]« können hiergenannt werden (Hermand: Neuere Entwicklung, S. 567). Eine Überblicksdarstellung findetsich in Danneberg: Theorie der werkimmanenten Interpretation.19 Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, S. 36. Er richtet sich gegen eine offensichtlich zuvornoch stärker auf Immanenz ausgerichtete Germanistik, die dem ›in neuester Zeit‹ aufgestellten›Grundsatz‹ folgt, »jedes Kunstwerk [sei] ein in sich geschlossenes Ganzes und [könne] nur aussich selbst heraus verstanden werden. Die Kenntnis eines Autors [könne] einer adäquatenAufnahme keine Hilfe bieten« (S. 35).20 Staiger: Die Kunst der Interpretation, S. 17 (der Monographie; dieser erste Teil wurde imgleichen Jahr in Neophilologus 35, S. 1–15 abgedruckt). Vgl. zur werkimmanenten Interpreta-tionskonzeption und ihres Zugriffs auf historische Kontexte auch Danneberg: Theorie derwerkimmanenten Interpretation.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 13
Sekundarstufen (Agrégation)21 präsumiert allein schon durch den situativenModus, in einer Prüfung angewandt zu werden – und eben daher auch immerfür diese Anwendung in einer Prüfung erlernt worden zu sein – die Verstehbar-keit des Textes aus ›sich selbst heraus‹: Der Prüfling und Anwender der explica-tion de texte erhält dabei weder Informationen über den Autor noch den Titeldes zu bearbeitenden Textes oder der Textstelle, soll aber nach der formalenAnalyse in der Lage sein, Rückschlüsse auf die Position der Textstelle im Ge-samttext, auf den Autor und auf den historischen Kontext zu ziehen. 22 DerGrundsatz des Verfahrens ist jedoch, dass das »sprachliche Kunstwerk […] vonsich aus und durch sich selbst erklärt« wird,23 was lediglich als Beleg der »im-mer schon vorausgesetzten Qualität einzelner Texte« verstanden wird und da-mit Ko-text, Autor und andere Kontexte als epistemologisch zweitrangig ausge-zeichnet werden.24 Diese Auffassung textimmanenter Analysen konfligiert miteiner bezüglich der Funktionalisierung von Kontextdaten freizügiger eingestell-ten deutschen Textimmanenz. 25 Doch wie lässt sich die Landesspezifik der lite-raturwissenschaftlichen Ausprägung beider als textimmanent zu bezeichnen-den Ansätze erklären?
Eine mögliche Antwort ist die asymmetrische Offenheit der nationalen Wis-senschaftssysteme gegenüber internationalen Theoriebewegungen. Die Thesewäre hier, dass man sich in Deutschland durchaus über die Landesgrenzenhinweg orientiert, während man in Frankreich größtenteils autonom bleibt undweiterhin den Ansatz Lansons verfolgte. 26 Plausibilisiert werden kann diesdurch eine Erweiterung des Sichtfeldes hinsichtlich der Frage, in welchem Ma-ße ein einigermaßen unabhängiges Drittes – etwa die anglophone Kritik autor-
21 Thiekötter: Explication de Texte, S. 371 schreibt, dass das Verfahren die »offizielle und fürSchule und Universität verbindliche Methode der Betrachtung und Analyse von literarischenTexten« sei. Interessanterweise wurde Thiekötters Aufsatz in spätere Ausgaben der »Grund-züge der Literaturwissenschaft« (hrsg. v. Arnold / Detering) nicht mehr aufgenommen.22 Vgl. Thiekötter: Explication de Texte, S. 371.23 Ebd., S. 372.24 Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (4. Aufl.): Explication deTexte, S. 186.25 Vgl. ebd.26 Dass Thiekötter: Explication de Texte, S. 374f. bei seiner Beschreibung der historischenEntwicklung der Methode ausschließlich französische Einflüsse nennt, kann als Argument fürdie oben formulierte These verstanden werden. Für die Schule der Annales gilt dies nebenbeierwähnt nicht, da durch sie die »Lücken sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Forschung inFrankreich […] in vieler Hinsicht wettgemacht [wurden]«, eben »durch den Import ausländi-scher Forschungsergebnisse und Forschungskonzepte« (Raphael: Erben von Bloch und Febvre,S. 102).
14 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
bezogener Theoriebildung aus den 1940er Jahren – von der deutschen und fran-zösischen Literaturwissenschaft jeweils rezipiert wurde. Als Exempel für solchein Vorgehen soll der bekannte Aufsatz (bzw. das bekannte Schlagwort) vonWimsatt und Beardsley zur Kritik intentionsbezogener Argumentation ins Feldgeführt werden.27 Wie die Statistiken von google Ngram-Viewer zeigen28 – vgl.die beiden Abbildungen auf der nächsten Seite 29 –, wurde der intentionale Fehl-schluss (intentional fallacy) in Deutschland nicht nur über zehn Jahre früher alsin Frankreich thematisiert (1), ab den frühen 1950er Jahren, sondern er erlangtein Deutschland bereits um 1960 ein (quantitatives) Niveau (N 2), das er in Frank-reich erst 1972/73 erreichen sollte (2). Zu diesem Zeitpunkt aber hatte die deut-sche Diskussion um das autorkritische Schlagwort bereits ein Ausmaß ange-nommen, das von der französischen Literaturwissenschaft nicht einmal mehrannähernd erreicht werden sollte (3).
27 Wimsatt / Beardsley: Der intentionale Fehlschluss; vgl. hierzu Köppe: Hirsch versus Be-ardsley und Wimsatt.28 Das Analyse-tool Ngram-Viewer (http://books.google.com/ngrams) kann Häufigkeits-statistiken über das Vorkommen von Wörtern aus 5,2 Mio. der von Google-Books gescanntenBücher erstellen. Die Wissenschaftsfähigkeit dieser Analysemethode und ihre Funktionen fürdie unterschiedlichsten Forschungsbereiche beschreiben Michel / Shen / Aiden / u. a.: Quanti-tative Analysis. Für eine ausgesprochen vorsichtige Verwendung im literaturwissenschaftlich-en Kontext argumentiert Matthew Jockers (http://www.matthewjockers.net/2010/12/22/unigra-ms-and-bigrams-and-trigrams-oh-my/).29 Für Deutschland siehe: http://books.google.com/ngrams/graph?content=intentional+fallacy&year_start=1940&year_end=2010&corpus=8&smoothing=3. Für Frankreich siehe: http://b-ooks.google.com/ngrams/graph?content=intentional+fallacy&year_start=1940&year_end=201-0&corpus=7&smoothing=3.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 15
Abb. 2: Google Ngram-Viewer: »intentional fallacy« in Deutschland (1950 -2000)
Abb. 3: Google Ngram-Viewer: »intentional fallacy« in Frankreich (1950 -2000)
16 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
Ein wissenschaftshistorischer Erklärungsversuch dieser Daten 30 könnte mit derThese argumentieren, dass in Deutschland auch für die ›werkimmanente Phase‹ein permanenter Autorbezug beobachtbar ist. Durch den zu diesem Zeitpunktvorhandenen Blick über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg fanden neueAusformulierungen der (eventuell seit der nationalsozialistischen Überhöhungdes Autors bereits bekannten) Probleme dieses Autorbezugs offene Ohren. InFrankreich hingegen war der Autor seit dem späten 19. Jahrhundert und derEinführung der explication de texte keine derart prominente Kategorie der Inter-pretation, sondern wurde höchstens als historisches Datum einer positivisti-schen Literaturgeschichtsschreibung verstanden. 31 Seine theoretische Proble-matisierung im Ausland musste hier als unangemessen erscheinen.
Die Ende der 1960er durch Barthes (1967/68) und Foucault (1969) formulier-te Autorkritik richtete sich nun gegen genau diesen naiv-positivistischen Autor-bezug, wovon vor allem die Argumentation von Roland Barthes zeugt. 32 InDeutschland hingegen betrieb man in diesem Zeitraum bereits eine literaturwis-senschaftliche Theoriebildung, die sich von der französischen Autorkritik hin-sichtlich der Theoretisierung des Autors als Kategorie literaturwissenschaftli-cher Interpretation deutlich unterschied. Zu diesen Unterschieden zählt unteranderem die deutlich frühere und stärkere Rezeption englischsprachiger Theo-rieimporte, für die es auch jenseits quantitativer Analysen Hinweise gibt. Strel-ka etwa spricht in der Einleitung zu einer literaturwissenschaftlichen Methodo-logie im Jahr 1970 von den beiden bereits zu diesem Zeitpunkt »bekannten undlängst altehrwürdig gewordenen ›fallacies‹ des ›New Criticism‹, der ›intentionalfallacy‹ und der ›affective fallacy‹«.33 Man hielt sich Ende der 1960er Jahre also– wenn überhaupt – an eine im Wesentlichen gemäßigte werkimmanente Inter-
30 Man muss bei der Interpretation der Grafiken sicherlich berücksichtigen, dass es erhebli-che (wissenschafts-)kulturelle Unterschiede in Deutschland und Frankreich bei der Übernah-me fremdsprachlicher Begriffe gibt. Da der Aufsatz »The Intentional Fallacy« erst im Jahr 2000ins Deutsche und u. W. bis heute nicht ins Französische übersetzt wurde, ist davon auszuge-hen, dass immer, wenn das von Wimsatt und Beardsley beschriebene Phänomen mit explizi-tem Verweis auf die beiden Theoretiker angesprochen wurde, auch die Formel » intentionalfallacy« genannt und somit für die oben durchgeführte Suche greifbar wurde. Nicht nur, weilPhänomen und Aufsatz den gleichen Namen haben, sondern auch, weil aufgrund der nichtvorhandenen Übersetzungen der Quellennachweis nur über den Aufsatztitel möglich war.31 Vgl. Anm. 16.32 Vgl. Barthes: Der Tod des Autors (die schwer greifbare Druckfassung der engl. Erstpublika-tion ist inzwischen online verfügbar: http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#barthes (21.03.2012); Foucault: Was ist ein Autor?33 Strelka: Essays zur Methodologie, S. 14.
Autorschaft im 21. Jahrhundert 17
pretationspraxis, war sich dank Kayser bereits seit den späten 1940ern – alsoseit 20 Jahren – der interpretationsrelevanten Unterscheidung von Autor undErzähler bewusst und kannte seit Mitte der 1960er Jahre zumindest ansatzwei-se34 die von Booth in »The Rhetoric of Fiction« (1961) ›zwischen‹ Autor und Er-zähler verortete Instanz des impliziten Autors.35 Versteht man dieses Konstruktmit Kindt/Müller als Ergebnis einer besonderen theoriegeschichtlichen Konstel-lation, in der Booth als Vertreter seiner Generation »einerseits vom ›intentiona-len Fehlschluß‹ überzeugt« war, andererseits »an der Idee fest[hielt], daß litera-rische Werke intentional strukturierte normative Welten darstellten, die einerethischen Kritik zugänglich seien«, 36 so muss die Übernahme des implizitenAutors in die deutsche Literaturtheorie ebenso als Abkehr von naiven autorbe-zogenen, etwa biographistischen Argumentationen wie auch als eindeutigesZeichen des Bedürfnisses nach einer theoretisch differenzierten Reflexion au-torbezogenen Interpretierens verstanden werden.
Gerade angesichts dieser Ausführungen aber bleibt ein bereits angespro-chenes Problem bestehen: Betrachtet man die rekonstruierten Faktoren der inDeutschland bereits einigermaßen etablierten und differenzierten Kritiken ander Konfundierung von Erzähler, implizitem und realem Autor, aber auch vonAutorintention und Textbedeutung, bleibt die Durchschlagskraft der ›französi-schen‹ Autorkritik in ihrem gut drei Jahrzehnte überdauernden, die heutigeTheorielandschaft noch immer mitbestimmenden Einfluss weiterhin nurschlecht zu plausibilisieren, will man sich nicht allein auf das Argument ihrerrhetorischen Schärfe stützen. Dass sie von nachhaltigem Einfluss war, ist je-doch unbestreitbar: Seit 1998 ist »Tod des Autors« ein literaturlexikalischesLemma.37
34 Siehe auch hierzu den Google-N-Gram-Viewer: http://books.google.com/ngrams/grap-h?cotent=implied+author%2CRhetoric+of+Fiction%2Cimplizite+Autor&year_start=1940&year_end=2008&corpus=8&smoothing=3. Unter der hier verlinkten Grafik finden sich den einzelnenBegriffen zugeordnete Zeitabschnitte, die wiederum zu den Einzeltexten führen, die etwa»impliziter Autor« im gewählten Zeitraum explizit nennen. Dort lassen sich (auf der linkenSeite) ganz spezifische Zeiträume – etwa 1960 bis 1974 – auswählen.35 Booth: Rhetoric of Fiction. Der hier stark gemachte implied author wird bereits vor der erst1974 erscheinenden Übersetzung ins Deutsche (Booth: Rhetorik der Erzählkunst) als »implizi-ter Autor« in vielen deutschsprachigen interpretativen und theoretischen Texten verhandelt.36 Kindt / Müller: Explikation und Verwendung, S. 279f. Alternative Erklärungsansätze fin-den sich (ideologiebezogen) bei Genette: Die Erzählung, S. 286 und (kohärenzbezogen) beiAbbott: Reading intended Meaning, S. 468.37 Vgl. Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (1. Aufl.), S. 534f.
18 Matthias Schaffrick / Marcus Willand
Kehrt man zurück zu der eingangs angesprochenen Kritik am Begriff ›Anti-Hermeneutik‹, wird deutlich, dass im Folgenden zweierlei gezeigt werden muss:Erstens, dass es ebenso zu einfach ist, von »poststrukturalistischen Ansätzen«zu sprechen, wenn man autorkritische Ansätze meint und zweitens, dass »Her-meneutik« eben nur einen Teil, aber bei weitem nicht alle autoraffinen Ansätzebeschreibt. Dies zeigt ein zentraler (und zumindest für das hermeneutischeLager wohl überraschender) Befund unserer Tagung: Entgegen der bis in die2000er Jahre hinein monierten Situation, dass zumindest ein Teil poststruktura-listischer Theoriebildung den Autor theoretisch ablehne, interpretationsprak-tisch aber stark funktionalisiere,38 zeigt sich nun, dass sich die literaturtheoreti-schen Verhältnisse in den letzten zehn Jahren offensichtlich verändert haben.Poststrukturalistische Positionen reduzieren sich nicht mehr (oder werden nichtmehr reduziert) auf die Kritik autorbezogener Ansätze, sondern bemühen sichum eine hochdifferenzierte und -reflektierte Einbindung autorschaftlicher Phä-nomene in ihren Theoriebau. Doch dazu erst im übernächsten Kapitel.
Vorerst sollen im Anschluss an diesen allgemeinen Überblick konkrete Va-rianten hermeneutischer Konzeptionen in den Fokus gerückt werden, die wirgrob in (1.1) genuin hermeneutische bzw. intentionalistische und (1.2) poeti-sche, rhetorische, generische und stilometrische Theoriezusammenhänge un-terteilen.
38 Winko: Autor-Funktionen; Jannidis: Der nützliche Autor; zuletzt Willand: Autorfunktionenin Theorie und Praxis.