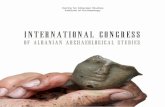Alttestamentliche Aspekte in der Diskussion um das "pro multis"
Transcript of Alttestamentliche Aspekte in der Diskussion um das "pro multis"
he chrift ausge?;eD(~n von
Dr. Gregor Professorin der alttestamentlichen Professor der neutestamentlichen
an der Universität an der Fakultät
2013 57 - Heft 2 ---- -----------------------------
des 1. Petrusbriefes ...................................................... . 161
184
216
244
in der 1Jl~;kussl(m um das pro multis 272
UMSCHAU UND KRlTIK
Neutestamentliche Rezensionen ......................................... 293
IJttestament:l1C]1e Rezensionen .......................................... 312
UND MITTEILUNG
AKN 2013 in
Dissertationen und
314
316
FER I AND SCHÖNINGH PADERBORN
ISSN 0006-2014
Alttestamentliche Aspekte in der Diskussion um das pro multis'i-
Von Stephan Lauber, Freiburg i.Ue.
1. Anlass der Fragestellung und Tendenzen der Diskussion
In einem Brief an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz hat Papst Benedikt XVI. im April 2012 die Neuübersetzung des Kflchwortes in der deutschen Fassung der eucharistischen Hochgebete verlangt.l Er wiederholt damit eine Anweisung, die schon in einem Schreiben des damaligen Präfekten der Gottesdienstkongregation Kardinal Francis Arinze aus dem Jahr 2006 formuliert, 2 aber bisher nicht umgesetzt worden war.
Danach soll es in der geplanten Neuausgabe des Messbuchs nicht mehr wie bisher heißen: "mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird", sondern "das für viele vergossen wird".
Diese Wiedergabe, die dem traditionellen lateinischen pro multis der römischen Liturgie entspreche, sei die allein angemessene wörtliche Übersetzung der Formulierungen in Mt 26,28; Mk 14,24, die der liturgische Text zitiert: Beide Stellen lassen Jesus davon sprechen, dass der Wein vergossen wird (EX)(Uwop..evov) als sein Blut, das den "Bund" bezeichnet (tO exlp..6. p..ou tii~ o~ex.ef)X'Yl~), und zwar 1tept 1tOAAWV (Mt 26,28) bzw. U1tSP 1tOAAWV (Mk 14,24) - und das heißt in wörtlicher Übersetzung eben "für viele". Die leicht variierenden Evangelienworte greifen zwei alttestamentliche Vorgaben auf:
Das Blut der Opfertiere besiegelt nach Ex 24,8 als Bundeszeichen (vgl. toex.tp..ex. 'tii~ Otex.ef)X'Yl~) den Bundesschluss am Sinai. Durch die Aufnahme Weses Motivs interpretieren die Evangelienberichte den Tod Jesu als neuen
* Der Beitrag geht zurück auf meinen am 5. Dezember 2012 vor der Theologischen Fakultät ~er Universität Freiburg i.Ue. gehaltenen Habilitationsvortrag. Der Vortragsstil ist weitgehend ~eibeha1ten.
1 In verschiedenen Sprachen veröffentlicht lla: Notitiae 49 (2012) 65-109, deutsche Fassung
In verschiedenen Sprachen veröffentlichtin: Notitiae 42 (2006) 441-458, deutsche Fassung
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 273
Bundesschluss, dessen Bundeszeichen sein eigenes, am Kreuz vergossenes Blut ist.
Die Angabe, wem dieser neue Bundesschluss gilt, geht dagegen auf das vierte Gottesknechtslied in Jes 52,13-53,12 zurück: 3 Nach 53,11-12 trug der Gottesknechtdie Sünden "vieler" (53,12) und macht so "die vielen" gerecht (53,11). Wie der Papstbrief selbst erläutert, gab es lange Zeit einen exegetis.chen Konsens, dass das Wort rabbim "viele" in Jes 53,11-12 "eine hebräische Ausdrucksform sei, um die Gesamtheit ,alle' zu benennen." 4 Das griechische 1tOAAOt, mit dem in der LXX rabbim wiedergegeben wird und auf das die Evangeliumsstellen anspielen, sei dementsprechend als Semitismus verstanden worden, dem wie in der Jesaja-Stelle die Bedeutung "für alle" beigelegt wurde.
Dieser in den 60-er Jahren, als die liturgischen Bücher in die Landessprachen übersetzt wurden, breite exegetische Konsens ist nach dem Urteil des Briefs inzwischen "zerbröckelt": "Die Wiedergabe von ,pro multis' mit ,für alle' war keine reine Übersetzung, sondern eine Interpretation, die sehr wohl begründet war und bleibt, aber doch schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist." 5 Stattdessen für eine korrekte Übersetzung in den liturgischen Büchern zu sorgen, das verlangt für ihn der "Respekt vor dem Wort Jesu, um ihm auch bis ins Wort hinein treu zu bleiben." 6
Mit dieser erneuten Anordnung, die Wandlungsworte "wörtlich" zu übersetzen, bekommt die Diskussion eine neue Aktualität, die schon 2006 das Schreiben der Gottesdienstkongregation ausgelöst hatte. Dort wurde die -jetzt wiederholte - Forderung einer wörtlichen Übertragung des neutestamentlichen Wortlauts vor allem durch den Hinweis auf den damit übereinstimmenden Überlieferungskonsens der westlichen ebenso wie der orientalischen liturgischen Tradition begründet. Außerdem, heißt es in dem Schreiben, vermeidet die Wendung "für viele" das theologische Missverständnis eines Heilsautomatismus : Es wird "so deutlicher die Tatsache zum Ausdruck [gebracht], dass das Heil nicht automatisch geschenkt wird, quasi ohne Einbezug des eigenen Willens oder Anteilnahme am Heil." 7
3 V gl. zur Frage dieser Intertextualität nur etwa die forschungsgeschichtlichen Angaben bei J Frey, Probleme der Deutung des Todes Jesu in der neutestamentlichen WISsenschaft. Streiflichter der exegetischen Diskussion, in: Ders.lJ. Schröter (Hrsg.), Deutung des Todes Jesu im Neuen 'Thstament (WUNT 1/181), Tübingen 2005, 3-50, 33-36 (mit weiteren Literaturangaben); außerdem etwa 0. Betz, Jesus und Jesaja 53, in: Geschichte - Tradition - Reflexion. Bd. ill: Frühes Christentum (FS M. Hengel), Tübingen 1996.3-19, 18f.
4 Notitiae 49 (2012) 65. 5 Notitiae 49 (2012) 66. 6 Notitiae 49 (2012) 69. 7 Notitiae 42 (2006) 455.
274 Diskussion um das ,Pro multis'
Darauf haben sich seinerzeit vor allem Neutestamentler, Systematiker und Liturgiewissenschaftler zu Wort gemeldet. 8 In vielen dieser Stellungnahmen wird die römische Entscheidung kritisiert, vOl;' allem weil man damit die Tendenz verbunden sieht, missverständlich die universale Reichweite der Lebenshingabe Jesu einzuschränken, wenn man statt von "allen" nur von "vielen" spricht, die in der Eucharistiefeier gemeint sind. Diese Ein-schränkung wird unterschiedlichen Argumenten zurückgewiesen.
Eines dieser Argumente ist Hinweis auf andere neutestamentliche Stellen, die klar von der Lebenshingabe Jesu zum Heil aller Menschen sprechen. Diese Stellen werden als hermeneutischer Schlüssel für die Bedeutung auch der Angaben rcept bzw. urc~p rcOAAW\I herangezogen und sollen deren Bedeutung im Sinn von alle" vereindeutigen. 9
Ein anderes Argument betont die Notwendigkeit, die genaue Bedeutung einzelner neutestamentlicher formulierungen im Horizont einer grundsätzlichen theologischen Reflexion über die Bedeutung des Todes Jesu zu klären.
Beiträge von Liturgiewissenschaftlern 10 erkennen die Tatsache an, dass die Wiedergabe mit pro multis bzw. einer landessprachlichen Entsprechung im Sinne von "für viele" sich auf einen breiten Überlieferungskonsens der Ostund Westkirche, vereinzelt auch der reformierten 11 Tradition stützen kann. Es wird aber auch daran erinnert, dass keines der eucharistischen Hochgebete eine biblische Vorlage wörtlich zitiert,12 sondern in den unterschiedlichen Liturgien verschiedene dieser Vorlagen auf verschiedene Weisen
8 V gl. nur etwa die repräsentative Auswahl von Stellungnahmen im Sammelband M. Striet (Hrsg.), Gestorben für wen? Zur Diskussion um das pro multis, Freiburg i.Br. 2007.
9 V gl. etwa T. Söding, Für euch..;. für viele - für alle. Für wen feiert die Kirche Eucharistie? , in: M. Striet (Hrsg.), Gestorben für wen? (s. Anm. 8) 17-27,22-27; außerdem etwa schon M. ZeIWick, "." pro vobis et pro multis effundetur ". ", in: Nocitiae 50 (1970) 138-140, 139.
JO Vgl. A. Gerhards, Pro multis - für alle oder für viele?, in: M. Striet (Hrsg.), Gestorben ftirwen? (s, Anm. 8) 55-64, 61-63; H Hoping, "Für die vielen". Der Sinn des Kelchwortes der römischen Messe, in: M. Striet (Hrsg.), Gestorben für wen? (5. Anm. 8) 65-·79, 73f.
11 H. Hoping, "Für die vielen" (5. Anm.l0) 74, nennt das anglikanische "Book of Common Prayer", das Messbuch der amerikanischen Methodisten und das Evangelische Gesangbuch für die Landeskirche in Württemherg. Er weist zugleich auf die an der deutschen Messe Luthers von 1526 orientierte Auslassung einer Entsprechung von pro multis in den meisten Gottesdienstordnungen der evangelischen Landeskirchen in Deutschland hin, was ihn aber nicht daran hindert, "ökumenische Grunde" für die Übersetzungsänderung geltend zu machen mit dem Argument: "Keine evangelische Kirche hat meines Wissens ,für alle"'.
12 Bei der Formulienmg der lateinischen Liturgie handelt es sich um ein Mischzitat, das die aus der paulinischen Tradition stammende Angabe U1tEp u[Lwv (Lk 22,20, vgl. 1 Kor 11,24) mit der Angabe 1tEpl1COnWV (Mt 26,28) bzw. u1CEp rcoAAW\! (Mk14,24) kombiniert (vgl. im Papstbrief die diesbezüglichen Ausführungen in: Notitiae 49 [2012J 68~69) und zudem die aus 1 Kor 11,25; Lk 22,20 aufgegriffene und syntaktisch abgewandelte Wendung 1) x<xwl) O\<x01jX'l1 durch die (unbiblische) attributive Bestimmung et aeterni ergänzt (vgl. dazu etwa A. Vanhoye, La traducci6n del "pro multis", in: phase 51 [2011J 311-317,315).
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 275
miteinander verbunden wurden, es also nicht vorrangig um eine möglichst getreue Wiederholung von für authentisch gehaltenen Worten Jesu geht, sondern um die aus unterschiedlichen Quellen gespeiste Deutung des gottesdienstlichen Geschehens. l } C Giraudo etwa weist außerdem darauf hin, dass sich in einigen syrischen und äthiopischen Anaphoren als Varianten des Elements pro multis an johanneische Wendungen angelehnte Totalitätsaussagen fmden wie "für das bzw. die Erlösung der ganzen Welt" (vgL Joh 6,52; 1 Joh 2,2) oder "für alle, die an mich glauben" (vgl. Joh 17,21).14 Damit ist auch eine liturgische Interpretation der Reichweite von pro· multis gegeben.
Neben solchen Argumenten gegen eine Neuühersetzung finden . sich selbstverständlich auch Stimmen, die sie verteidigen. Das wesentliche - auch in den beiden römischen Schreiben genannte - Anliegen der Befürworter der Neuübersetzung ist, dass die Bedeutung der persönlichen Glaubensentscheidung passender zum Ausdruck gebracht wird, wenn man nur von "vielen" spricht, nämlich von denen, die auf die Einladung Jesu positiv antworten. 15
Überblickt man die Diskussion, lässt sich der Eindru.ck kaum vermeiden, dass bei der Option für eine der beiden Übersetzungsvarianten weniger philologische als vielmehr entgegengesetzte theologische Schwerpunktsetzurtgen ausschlaggebend sind: Eine einladend-universale Interpretation steht im Widerstreit mit einer paränetisch-einschränkenden Haltung. Unschwer sind
Hintergrund auch konkurrierende ekklesiologische Konzepte auszumachen. 16
betonen beide Seiten, sich der notwendigen Ergänzung der eige·nen Schwerpunktsetzung durch den jeweils unterbetonten Aspekt bewusst zu sein. Dennoch ist in der Diskussion die Entscheidung für eine der beiden Übersetzungsvarianten quasi zum Bekenntnis für die mit der jeweiligen Option verbundene theologische Positionierung geworden.
13 Vgl. etwa A. Gerhards, Pro multis (5. Anm. 10) 61-63. 14 Vgl. die Übersicht bei C. Giraudo, La formula "pro vobis et pro multis" dei racconto
istituzionale. La recezione liturgica di un dato scritturistico alla luce delle anafore d' oriente e d'occidente, in: RivLi 94 (2007) 257-284,275-279.
15 V gl. etwa M Hauke, "Für viele vergossen". Studien zur sinngetreuen Wiedergabe des pro multis in den Wandlungsworten (Augsburg 22012) 89: "Um zu denen zu gehören, die Christus erwählt hat, braucht es die tätige Sorge um das persönliche Heil. In einer Zeit, da der biblische Begriff der Auserwählung in einen Limbus des Vergessens geworfen wurde, ist ein· solcher Weckruf überaus angemessen. "
16 Vgl. dazu etwa A. Stock, Für wieviele? Der Papst und das neue Meßbuch, in: StZ 238 (2012) 807-815.
276 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
2. Der philologische Befund: Überprüfungen und Klärungen
2.1 Zur Forschungsgeschichte
Die philologische Frage ist in der Auseinandersetzung allerdings eher wenig beachtet geblieben, obwohl es im Kern des Problems um diese philologische Klärung geht - als Voraussetzung für die angemessene und sinngemäße Deutung der Wendung in Mt 26,28; Mk 14,24 vor dem Hintergrund ihrer alttestamentlichen Herkunft. Inwiefern ist der exegetische Konsens, der vor 40 Jahren für die Übersetzung "für alle" ausschlaggebend war, nicht mehr tragfähig?
Diesen Konsens herbeigeführt - das ist in den Beiträgen zur Diskussion des Themas immer wieder angeführt - hatte j. Jeremias durch seine Studie Die AbendmahlsworteJesu e 1935; 41967), vor allem aber durch den Artikel zum Lexem lCOAAOL im 1959 erschienenen 6. Band des Theologischen Wörterbuchs zum Neuen Testament. In diesem Artikel geht es j. Jeremias ausdrücklich darum, Material bereitzustellen, das die Antwort auf die Frage vorbereitet, welchen Sinn die neutestamentlichen Stellen haben, "die den PlurallCoAAol verwenden, um den Kreis derer zu umschreiben, denen das Heilswerk Jesu gilt." 17
Diese Antwort ist vorgegeben mit der definitionsartigen These, die j. Jeremias an den Anfang seiner Ausführungen stellt und die seine nachfolgende Analyse des Wortgebrauchs zusammenfasst:
"Während im Griechischen 1I:OnOt sich von 1I:6\v'te,~ (OAOt) dadurch unterscheidet, daß es im Gegensatz zu einer Minderheit steht, also ausschließenden Sinn hat (viele, aber nicht alle), kann hebräisch 0":::1 i (il) / aramäisch PI;' 10 einschießenden Sinn haben: die nicht zu zählenden Vielen, die große Schar, alle. Das Gleiche gilt für (01) 1toAAot in judengriechischen Schriften." 18
Diese von anderen bereits zuvor vertretene,19 von j. Jeremias aber untermauerte und durch seine Untersuchungen in gewisser Weise zum Forschungsstandard gewordene Interpretation des von ihm als "inkludierend" bezeichneten Gebrauchs von rabbim wird bis in neueste Veröffentlichungen
17 J Jeremias, Art. 1COAAO[, in: Th WNT 6 (1959) 536-545, 536. 18 JJeremias, 1COAAOl (s. Anm.17) 536. 19 Vgl. etwa den Hinweis bei C. Marucci, Per molti 0 per tutti? Sul significato delle parole
1tEpl / lmep rcOAAWV nei sinottici, in: RivLi 94 (2007) 286-300, 290.293f., auf F. Zorell, Novi Testamenti Lexicon Graecum (CS S 7), Paris 1911, und J Knabenbauer, Evangelium secundum S. Marcum (CSS NT I/2), Paris 1907. J Jeremias, 1COAAOl (s. Anm.17) 536 Anm.l, nennt
neben eigenen Vorarbeiten P. Joüon, I:Evangile de Notre-Seigneur Jesus-Christ (Verbum salutis V), Paris 1930, 125; O. Cullmann, Neutestamentliche Wortforschung. 'YllEP CANTI) rrOAAnN, in: 'ThZ 4 (1948) 471-473. Außerdem verweist er auf die von ihm selbst betreute rezeptions geschichtliche Dissertation von H Hegermann, Jesaja 53 in Hexapla, Targum und Pescrutta (BFTI-I n 56), Gütersloh 1954, 68-69.91-93.96f.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
vorausgesetzt und wiederholt. 20 Allerdings gibt es in der Referenzwerke,die dieses Verständnis nicht teilen. 21
2.2 Überprüfung zentraler Argumente und alttestamentlicher Belegstellen
277
auch wichtige
Im Blick auf die wesentlichen Argumente, die Jeremias für die inkludierende Verwendung des hebräischen rabbim im AT anführt, erheben sich Bedenken, wenn er als grundsätzliche Ursache für die semantische Bestimmung des Adjektivs feststellt:
,,[Der] inkludierende Sprachgebrauch ist eine Folge davon, daß das Hebräische und Aramäische kein Wort für ,alle' besitzen." 22
Ein solches Wort gibt es aber durchaus: Das gemeinsemitische Nomen das "Ganze"/die "Gesamtheit"23 kann mit dem enklitischen Personalpronomen verbunden und dann in derselben Funktion wie ein Adjektiv mit
20 V gl. etwa H Ringgren, Art. :::n rak. 5. rabbfm in inldudierender Bedeutung, in: Th WAT VII (1993) 315, oder den überblick bei C. Marucci, Per molti 0 per tutti? (s. Anm.19) 293-297, und sein Fazit: "Riassumendo, la letteratura esegetica del XX secolo e praticamente univoca nell'intendere le frasi [ ... ] in senso indusivo."
21 T Hartmann, Art. ::::li rab in: TI-IAT II (1976), 715-726, etwa übergeht den Beitrag von Jeremias praktisch und führt ihn nur als bibliographische Angabe im Blick auf das NT an. G. Nebe, Art.1I:oM~, in: EWNT III CZ1992) 313-319, 316f., lehnt die übersetzung mit "alle" als Verbindung eines philologischen und eines theologischen Problems ab und rät generell zur Wiedergabe mit "viele".
Hier ist auch einzugehen auf die Anfang der 1990-er Jahre als Lizentiatsarbeit am Päpstlichen Bibelinstitut entstandene und 2007 in erweiterter Form veröffentlichte Studie: F. Prosinger, Das Blut des Bundes - vergossen für viele? Zur Übersetzilllg und Interpretation des hyper pollön in Mk 14,24 (Quaestiones non disputatae), Siegburg 2007. Der Verfasser hat es sich explizit zur Aufgabe gemacht, das Verständnis der Bedeutung von rabbim im einschließenden Sin.l1 von "alle" zu entkräften. Zwar verwendet die Arbeit exegetische Methoden und der Verfasser betont das exegetische Interesse (vgl. ebd., 35f.) der Studie. Offensichtlich ist er aber von einem dogmatischen Anliegen geleitet (vgl. nur die autobiographische Bemerkung ebd., 33): Er will den von ihm erhobenen biblischen Befund gegen einen falschen Heilsoptimismus verteidigen. (Noch deutlicher tritt dieses Anliegen hervor in den Beiträgen: F. Pmsinger, Zum aktuellen Stand der Diskussion "für viele/für alle", in: Theologisches 37 [2007] 123-130; Ders., überlegungen zu dem Buch "Gestorben für wen? Zur Diskussion um das ,pro multis"', hrsg. von M. Striet, in: Theologisches 37 [2007] 287-294). Relevanz erhält die Studie durch die im Vorwort der Druckausgabe mitgeteilte Kenntnisnahme durch den damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Kardinal Ratzinger, der sich demnach in einem Brief zustimmend auf sie bezieht (ebd., 7). Man wird also annehmen müssen, dass diese Studie. die Entscheidung zur Neuübersetzung des Kelchwortes zumindest mitbeeinflusst hat. Auf ihre Argumentation soll deshalb wenigstens beispielhaft eingegangen werden (s. Anm.26; 37; 51).
22 J Jeremias, rcoAAol (s. Anm. 17) 536. 23 Vgl. H Ringgren, Art. '::l kol, in: ThWAT N (1984) 145-153; HAWAT e81987-2010)
543-545.
278 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
Bedeutung"alle" gebraucht werden. Es ist daher sicher nicht der Mangel an anderweitigen Ausdrucksmäglichkeiten, der dazu zwingen würde, behelfsmäßig "viele" zu sagen, wenn man "alle" meint.
Das macht eine erste, grundsätzliche Klärung notwendig, die die These von J Jeremias etwas anders fasst: Wenn rabbim im inkludierenden Sinn verwendet wird, dam1 ist das keine Bedeutung, die sich unmittelbar aus der Semantik des Wortes ergeben würde, das in der Grundbedeutung "zahlreich", "viel" oder (als Aramaismus) auch "groß" 24 bedeutct. Es handelt sich vielmehr um einen idiomatischen Gebrauch: 25 Den "alle" nimmt rabbim nur irl bestimmten Verwendungszusammenhängen und mit bestimmten konnotativen Assoziationen an, diesen Verwendungszusammenhängen aber regelmäßig. 26
24 VgL HAWAT (18 1987-2010) 1210f.; HALAT el967-31996) 1092-1094; Fabry, Art.:::Ii rak. LI. und Belege, in: ThWATVlI (1993) 294-297; T Hartmann,::n rab viel (s. Anm. 715-726.
25 Als "idiomatische, u. a. wird eine in der Regel mehr-lexikalische Einheit bezeichnet, "deren in wenigstens einer Lesart
.""ro,·h",rl,·,.. Summe der Bedeutungen ihrer Elemente." (B. Schaeder, Art. Phraseolo-in: Metzler Lexikon [1993J 530; vgl. außerdem etwa T Lewandowski, Linguis
Wörterbuch [UTB 1518], Heidelberg 51990, 420-422). Häufig ist diese idiomatische Bedeutung an einen bestimmten Verwendungszusammenhang gebunden: So bedeutet "best man" nur im Kontext der Rede von Hochzeit und Heiraten "Trauzeuge", franz. "sagefemme" nur in Zusammenhang . Ebenso nimmt hebr. rabbim in bestimmten Verwendungszusammenhängen den von der lexematischen Grundbedeutung
verschiedenen Sinn"aIle" ~n. In diesem Sinn kaml von einem (in seiner Eigenart durch den Kontext der Belegstellen näher zu bestimmenden) "idiomatischen Gebrauch" gesprochen
auch wenn das Merkmal. der Mehrgliedrigkeit fehlt, was freilich die eindeutige Erkennbarkeit erschwert. Kennzeichnend für idiomatische WendImgen ist die Bewahrung der mit den verwendeten Lexemen üblicherweise verbundenen Konnotationen und Assoziationen, im Fall der idiomatischen Verwendung von rabbim etwa die Vorstellung der (sich aus der Summe vieler Einzelner ergebenden) (in diesem Sinn ist die semantische Bestimmung Jeremias, ?tonol [5. Anm. 536 Anm. 4, zutreffend).
26 Das setzt faktisch auch J Jeremias, 1tOAAOl (s. Amn. 17) 536, voraus, wenn er schreibt, dass das hebräische und aramäische Lexem für einschießenden Sinn haben kann, also keineswegs in jedem Fall tatsächlich hat. Mit dieser Bestimmung als idiomatische Wendung ist eine unsachgemäße Zuspitzung der Frage in der Studie von F. Prosinger, Das Blut des Bundes (5. Anm.21) 38-39, unterlaufen. In einer etwas umständlichen Erörterung mit erkem1tn1Stheoretischen Anleihen wird Jeremias dort unterstellt, er wolle die Bedeutung von rabbim auf "alle" beschränken und damit dem Hebräischen und Aramäischen grundsätzlich die Fähigkeit absprechen, die Vorstellungskategorie der"Vielheit" -auszudrücken. Dann wäre die Richtig·· keit der These mit jedem Beleg, der eine Verwendung von rabbfm in der Bedeutung "viele", nicht "alle" erkennen lässt, erschüttert. Um eine solche ausschließliche Bedeutung geht es aber nicht: Es geht um die Verwendungszusammenhänge des idiomatischen Gebrauchs und die Stichhaltigkeit der Grunde, die in diesen Fällen für die Bedeutung "alle" sprechen.
Lauber, Diskussion um das multis' 279
a) Der substantivische Gebrauch
Einen solchen Verwendungszusammenhang erkennt Jeremias zuallererst in den Belegen, in denen rabbim substantiviert und durch den Artikel determiniert gebraucht ist, also in der Wendung: "die Vielen". hält Jeremias den inkludierenden Sinn für "völlig eindeutig". 27 Bei näherem Hinsehen erscheint es aber zumindest nicht zwingend, die entsprechenden Stellen so zu verstehen:
1 Kön 18,25 Nun sagte Elija zu den Propheten des Wählt ihr zuerst den einen Stier aus, und bereitet zu; ihr seid die rabbim. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer!
Jeremias selbst übersetzt: ,,[I]hr seid die große Schar (d. ihr der Majorität)". 28 Das Adjektiv scheint also auch nach seiner Auffassung durch-· aus in der Grundbedeutung, "die Vielen", "die Zahlreichen", verwendet zu sein, und zwar determiniert durch den Artikel zum Ausdruck des Superlativs oder Elativs. 29 Elija spricht von der erdrückenden der Baalspro-pheten, nicht von ihrer Vollzähligkeit. Ähnliches trifft auf Beleg Est 4,3 zu:
Est 4,3 In einer jeden Provinz, WOhirl immer der königliche und sein Gesetz kamen, herrschte bei den Juden große mit Fasten, Weinen und Klagen. Sack und Asche wurden als Lager ausgebreitet für die rabbim (0":1").
Hier steht "die Vielen" in Parallele zu "die Juden", was der darauf dass eine Identität angedeutet sein soll. Trotzdem ist nicht eindeutig
zu erkennen, ob diese Identität in der numerischen Vollständigkeit oder der eindrücklichen der Betroffenen besteht. Gerade Hinblick auf Opposition viele vs. bleibt die Aussage uneindeutig.
Dasselbe gilt Verwendungs beispiele mit undeterminiertem rabbfm, etwa:
Ex 23,2 Sei nicht bei rabbim, wenn sie Unrecht tun, und sage in einem Rechtsverfahren nicht so aus, dass du dich rabbim fügst und das Recht beugst.
27 J Jeremias, 1tonol (s. Anm. 17) 536. 28 J Jeremias, 'ITonol (s. Anm. 17) 536f. 29 V gL P. ]oüon/T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27), Rom
22006, § 141j (mit Erwähnung der Stelle).
280 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
Jeremias übersetzt: "Du sollst nicht dem großen Haufen folgen", 30 und das lässt einfach an die "Mehrheit" denken, deren Urteil prozessentscheidend ist, aber eben irrig sein und daher Rechtsbeugung bedeuten kann.
b) In Universalitäts- und Totalitätsaussagen
So umfassend, wie Jeremias angibt, ist die inkludierende Verwendung von rabbim also offensichtlich nicht. Um Klarheit über den idiomatischen Gebrauch zu erhalten, sind deshalb solche Belege heranzuziehen, die einen Anhalt im Kontext bieten, der die intendierte Bedeutung erkennen lässt. Als solche kontextuelle Vereindeutigungen kommen zwei Fälle in Betracht:
- parallel oder synonym gebrauchte Wendungen und Begriffe - kontextuelle sachlich-inhaltliche Gründe, die das Bedeutungsspektrurn
einengen und auf eine konkrete Semantik festlegen.
Das deutlichste Beispiel für die Vereindeutigung durch die Verwendung in einern Parallelismus findet sich in Jes 2,2-4 (die Parallelüberlieferung in Mi 4,1-3 weicht im hier interessierenden Punkt ab):
2a Am Ende der Tage wird es geschehen: b Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der
Berge; c er überragt alle Hügel. d Zu ihm strömen alle Völker (0'1liT-';:'). 3a Viele Nationen (O':J., O'1.)Y) machen sich auf den Weg. b Sie sagen: c Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn d und zum Haus des Gottes Jakobs. e Er zeige uns seine Wege, f auf seinen pfaden wollen wir gehen. g Denn von Zion kommt die Weisung (iT.,1n) des Herrn, haus Jerusalern sein Wort. 4a Er spricht Recht im Streit der Völker (0'1liT), b er weist viele Nationen (O':J., O'1.)Y') zurecht. c Dann schmieden sie pflugscharen aus ihren Schwertern d und Winzermesser aus ihren Lanzen. e Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, f und übt nicht mehr für den Krieg.
Diese nachexilische Heilsverheißung mit der Rede vorn Herbeiströmen der Völker greift ein traditionelles Motiv der altorientalischen Tempeltheologie
30 ]. Jeremias, 1tOAAOt (s. Anm.17) 537.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 281
auf und überträgt es auf den Zion. Die. Erhöhllng des Tempelbergs durch Gott bewirkt, dass er· zum . Wallfahrtsziel· der Völker wird, die sich dort vorn Gott Jakobs Unterweisung erhoffen, damit sie auf seinen pfaden gehen können. Genauso geht vorn Zion auch eine Bewegung aus, deren Inhalt Gottes "Weisung" und sein Wort ist. Der Inhalt dieses Wortes wird nicht mitgeteilt, wohl aber sein Zweck: Gott spricht dadurch Recht zwischen den Völkern, sorgt für die friedliche Entscheidung in ihren Konflikten und schafft dadurch Frieden zwischen ihnen. 31
Diese Heilsverheißung ist umfassend und ohne Einschränkung, entsprechend ist in V. 2d von 0'1liT-';:' ,,allen Völkern" die Rede, denen sie gilt. 32 Die CsV 0'1liT-';:' "alle Völker" wird im synonymen Parallelismus V. 3a durch die Fügung O':J., O'1.)Y "viele Nationen" variiert, das ganz offensichtlich dieselbe Bedeutung hat und sich ebenfalls auf die Gesamtheit der Völker bezieht. Die Formulierung "viele Nationen" konnotiert dabei sicher auch deren große, unüberschaubare Zahl: Dass beide Assoziationen zusammengehören, lässt etwa die Kombination beider Mengenangaben in der Wendung "all die vielen Völker" (Ps 89,51; Ez 31,6) erkennen. Sachlich ist aber durch den Parallelismus der Sinn "alle" sichergestellt.
Dasselbe gilt für den synonymen Parallelismus in V. 4a-b: Das uneingeschänkte .!:J'1liT "die Völker" in V. 4a.ist synonym verwendet mit O'1.)Y O':J., "viele Völker" in V. 4b, was sich im Zusammenhang genauso einschränkungslos auf die Gesamtheit der Völker bezieht.
Hier ist tatsächlich ein inkludierender Gebrauch von rabbim zu erkennen: "Vtele" meint in solchen Univ.ersalitätsaussagen die große Zahl "aller" Völker. Ähnlich wird auch in Ez 27,33; Mi 5,7 durch ein paralleles Element die Rede von "vielen Völkern" sachlich auf "alle Völker" bezogen.
Dasselbe Verständnis legt sich aber auch in anderen universalen Heilsverheißungen nahe, die zwar nicht in einern vereindeutigenden Parallelismus stehen, aber ein Handeln Gottes an der ganzen Welt erwarten und dabei eben auch die ganze Völkerwelt im Blick haben, wenn sie von "vielen Völkern" sprechen. Von den Belegen, die]. Jeremias nennt,33 gehören dazu sicher die Stellen Ez 38,23; 39,27; Mi 4,11.13; Sach 8,22; Ps 97,1.
Nicht durch ein paralleles Element im unmittelbaren Kontext, aber durch austauschbare Formulierungen im selben Verwendungszusammenhang wird erkennbar, dass auch die Redeweise vorn Lob Gottes inmitten von "vielen"
31 V g1. etwa R. Kessler, Micha (HThKA1), Freiburg i.Sr. 1999, 184f. 32 Anders verhält es sich im parallelen Vers Mi 4,1, wo nur von" Völkern" gesprochen
wird. H Wildber:ger, Jesaja. I. Teilband. Jesaja 1-12 (SKAT XII), Neukirchen-Vlyun 1972, 83, sieht die Micha-Fassung als ursprünglich an und die Rede von »allen Völkern" als späteres, »theologisch bedingtes Ausziehen der Linie, auf der Jesaja steht."
33 V g1.]. Jeremias, 1tOAAOi. (s. Anm. 17) 537. Für die ebenfalls für die Idiomatik beanspruchte Stelle Ez 3,6-7 ist das weniger deutlich.
282 Lauher, DiSkussion um das,Promultis'
in Ps 109 "bO <funktionsäquivalent mit der zur· Gebetssprache gehörenden geprägten Wendung vom Gotteslobin der "ganzen Gemeinde" istunddarnit eine inldudierende Bedeuwnghat: 34
Ps 109, 30 Ich will JHWH sehr preisen mit meinem Mund, und inmitten (11M::I) von rabMm will ich ihn rühmen
Psalm 109 .orientiert sich am Gattungsformular der Klagepsalmen: 35 Er setzt in V. 1-5 ein mit der Anrufung Gottes und der Schilderung der Not des Beters, die in der Verfluchung durch seine Feinde besteht. Der Irilialt dieser Verfluchungen wird in V. 6-19 breit zitiert, V. 20 schließt diese Zitatreme ab. In V. 21-29 folgt die Bitte an Gott um Rettung und die Bestrafung der Feinde. Gattungsgemäß endet der Psalm in V. 30-31 mit der Andeutung eines Stimmungsumschwungs, in dem der Beter· seine Rettungsgewissheit andeutet und JHWH für diese Rettung dankt. Und dieser Dank vollzieht sich nach v. 30 inmitten von rabMm.
In anderen, an denselben Aufbauplan angelehnten Psalmen geschieht dieser durch die neugewonnene Rettungsgewissheit motivierte Dank inmitten der ~i1i' "Gemeinde" (vgl. Ps 22,23) oder der::l' ~i1i' "großen Gemeinde" (vgl. Ps 22,26; 35,18; 40,10), als deren restituiertes Glied der Beter sich erfährt. 36 Die Not von Anfechtung, Anfeindung und Vereinzelung ist überwunden, der Bezug zur Gemeinschaft ist geheilt. Damit das Motiv in dieser Weise als Heilsbild wirken kann, muss dabei auch an einen Heilszustand der Gemeinde gedacht sein - was unter anderem ihre Einmütigkeit und Vollständigkeit als Gemeinde "aller" ,die sich zu JHWH bekennen, impliziert. An solche Totalität denkt die Ankündigung in Ps 109,30, Gott inmitten von rabMm zu rühmen. 37
34 VrJ.JJeremias, 1tOAAot (5. Annl.17) 537. 35 V rJ. etwa E. Zenger/F. -L. Hossfeld,Das Buch der Psalmen, in: C. Frevel (Hrsg.), Einleitung
in das Alte Testament (Kohlhammer Studienbü4her Theologie 1,1), Stuttgart 82012, 428-452, 442.
36 VrJ.JJeremias, 1tOAAOt (s.Anm.17) 537. 37 E Prosinger verkennt diesen Heilscharakter der Gemeinde, in der der Psalmenbeter sich
ip seiner Rettungsgewissheit einbirgt, weil .. er das zugrtmdeliegende Gattungsfonnular völlig Ignoriert! Die Ausgangskonstellation mit der dichotomischen Gegenüberstellung des Beters \'Uld seiner.Feinde bleibt nach seinem Verständnis bis zum Ende der Psalmen bes~ehen, folvJich kann der Beter sich dort nur der Gemeinschaft weniger, unvermittelt auftauchender Getreuer erfreuen. Allenfalls ist für E Prosinger, Das Blut des Bundes (s. Anm. 21) 43, an einen "eschatologischen Ausblick in eine vollständige Neuordnung (nach ergangenem Gericht!)" zu denken. An derartigen Überlegungen sind 100 Jahre Gattungskritik spurlos vorübergegangen.
Lauher, Diskussion umdas,Pro multis' 283
c)Die Konstenation "einer" VB. "rabbim"
Ein wichtiger Verwendungszusammenhang, indem rabMm zur idiomatischen Bedeutung "alle" tendiert, sind Klagelieder, in denen sich "ein Einzelner" und rabbim feindlich gegenüberstehen. 38 In seiner subjektiven Wahrnehmung empfindet der Beter einen völligen Gegensatz zwischen sich und der ganzen als ablehnend-feindlich empfundenen Welt um sich herum, konkretisiert in der realsymbolischen Bedrängnis durch die mit rabbim bezeichneten Widersacher.
Zwei Beispiele verdeutlichen das:
Ps 3,2-3
2a JHWH, wie zahlreich ('::I,-m~) sind meine Gegner! b rabMm erheben sich gegen mich! 3a rabbim sind es, die von mir sagen: b "Für den gibt es keine Hilfe bei Gott!"
Die beklagte Feindschaft der Gegner ist umso umfassender, als sie nach dem Zitat V. 3b auch Gott selbst für sich in Anspruch nehmen und in ihren Anfeindungen den Bedrängten von Gott zu isolieren versuchen.
Ps 31,12-14
12a Vor all meinen Feinden bin ich zur Schmach geworden, b und meinen Nachbarn zum Hader, c ein Schrecken für meine Bekannten, d die mich sehen auf der Straße, fliehen vor mir. 13a Vergessen bin ich wie ein Toter aus dem Sinn, b ich bin wie ein zerschlagenes Gefäß. 14a Denn ich höre das Flüstern von rabbim -b Grauen ringsum, c wie sie sich miteinander beraten gegen mich, d darauf sinnen, mir das Leben zu nehmen.
Die Ablehnung durch die Gemeinschaft ist vollkommen: Der Beter vergleicht sich sogar mit einem Toten, der jeden Kontakt zum Leben und den Lebenden
38 VrJ. etwa B. Janowski, Er trug unsere Sünden. Jes 53 und die Dramatik der Stellvertretung, in: Ders./P. Stuhlmacher (Hrsg.),; Der leidende Gotteslmecht. Jesaja 53 und seine WIrkungsgeschichte (FAT 14), Tübingen 1996 27-48, 36-38 =i (mit einigen. Abweichungen) Ders., Stellvertretung. Alttestamentliche Studien zu einem theologischen Begriff (SBS 165), Stuttgart 1997, 67-96, 80f. Zur Rezeption im neutestamentlichen Sprachgebrauch vrJ. etwa M. Theobald, pro multis - Ist Jesus nicht "für alle" gestorben? Anmerkungen zu einem römischen Entscheid, in: M. Striet (Hrsg.), Gestorben für wen? (5. Anm.8) 29-54, 38: ",Viele' steht in den neutestamentlichen Belegen in Opposition nicht zu ,allen', sondern zu ,dem Einen"'.
284 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
verloren hat, Der Gegensatz zwischen ihm und der Welt um ihn herum ist umfassend, er steht als Einzelner in völliger Isolierung allen anderen gegenüber, und diese umfassende Opposition ist in V. 14a als Opposition zu rabbfm beschrieben.
Beide Beispiele lassen gut die Eigenart der inkludierenden Idiomatik von rabbim erkennen:
Die Belege gehören der poetischen Sprache an - es sind keine Definitionen, keine exakten statistischen Zahlenangaben, und es sind auch keine juristischen Aufnahmen von Tatbeständen. Die Unterscheidung zwischen dem "Einzelnen" und den "Vielen", der großen Zahl derer, die nicht dieser Einzelne sind, also allen anderen, ist eine poetische Wahrheit, keine numerische. Gegner und Bedränger sind für den Bedrängten ausnahmslos alle, die sich in seinem Blickfeld befinden und für ihn deshalb im Augenblick mit der erfahrbaren Menschheit zusammenfallen - dass diese erfahrbare Menschheit nicht mit tatsächlich existierenden zusammenfällt, spielt dabei keine Rolle. Im Übrigen würde auch dann, wenn statt von "vielen" lexematisch eindeutig von "allen" die Rede wäre, den Formulierungen dieselbe Uneindeutigkeit anhaften: Gerade in poetischen Texten hängt die Entscheidung, wer mit "allen" gemeint ist, genauso vom Kontext ab und ist genauso auslegungsbedürftig, solange nicht weitere Angaben den Bezugsrahmen eindeutig abstecken.
Mit diesen Bemerkungen soll eine kurze Analyse des vierten Gottesknechtsliedes vorbereitet sein, also des Textes, auf den der Überblick über wichtige alttestamentliche Verwendungszusammenhänge zulaufen muss, weil er Spendertext für das Kelchwort ist.
d) "Die Vielen" im 4. Gottesknechtslied Jes 52,13-53,12
Die Deutung des Nebeneinanders individueller und kollektiver Züge bei der Darstellung des Knechtes in den Gottesknechtsliedern Jes 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12 stellt eine bleibende Herausforderung der alttestamentlichen Exegese dar. 39 Wahrscheinlich thematisiert die Grundfassung der Lieder das biographische Schicksal eines anonymen prophetischen Knechtes, der
39 Vgl. H-j. Hermisson, Das vierte Gottesknechtslied im deuterojesajanischen Kontext, in: B. JanowskilP. Stuhhnacher (Hrsg.), Der leidende Gottesknecht (s. Anm. 38) 1-25, 1: ,,[D}as historische wie das theologische Verständnis des großen Textes [wird] bis zum Jüngsten Tag umstritten bleiben." Zu den Forschungspositionen vgl. H. Haag, Der Gottesknecht bei Deuterojesaja (EdF 233), Darmstadt 21993; W. Dietrich, Art. Gottesknecht, in: NBL 1(1991) 932-938; H-W.jüngling, Das Buch Jesaja, in: E.Zenger u. a. (c. Frevel [Hrsg.]), Einleitung in das Alte Testament (KStTh 1,1), Stuttgan 82012,521-547, 531f.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 285
als ideales Gegenbild und Vorbild des Gottesknechtes Israel (vgl. Jes 41,8-9; 44,1-2.21; 45,4; 48,20) gezeichnet wird. Auf der Endtextebene interpretieren redaktionelle Eingriffe und Fortschreibungen diese Gestalt kollektiv als Personifikation Israels. 4o Dabei blickt das vierte Gottesknechtslied in eigentümlicher Weise auf den Tod des Knechtes zurück und erwartet seine Erhöhung. Die mehrfach konzentrisch angelegte Textstruktur lässt sich folgendermaßen darstellen: 41
A 52,13-15 - Eröffnender Rahmen:JHWH-Rede
a b
V. 13 V. 14
Gegenwart: Erfolg und Erhöhung des Knechtes Rückblick: Entsetzen von rabbim über die Entstellung des Knechtes
a' V.15 Gegenwart: Erstaunen vieler (rabbim) Völker und Verstummen von Königen angesichts der unerwarteten Kunde über den Knecht
B 53,1-11b - Corpus: Rede der Wir-Gruppe
a V. 1 unglaubliche Kunde von JHWHs Wirken am Knecht
a'
b V.2-3 frühere Sicht: Verachtung und Abwendung der Wir-Gruppe vom unansehnlichen und
b'
c V.4-6 leidenden Knecht jetzige Sicht: Leiden und Tod des Knechtes für die Wir-Gruppe, deren Schuld er auf sich nimmt
V. 7-1 Oe Rückblick: Todesleiden vom Knecht ohne Widerstand erduldet, Lebenseinsatz als Sühnopfer
V. 1 Od-l1 b Zukunft des Ebed: Rettung des Knechtes durch Nachkommenschaft und langes Leben als Gelingen des JHWH-Plans, Knecht erblickt Licht und sättigt sich an Gotteserkenntnis
40 Vgl. etwa U. Berges, Das Buch Jesaja.Kompositioh und Endgestalt (HBS 16), Freiburg i.Br. 1998, 405f., zu den diese Interpretation implizierenden literarischen Kontextverbindungen vonJes 52,13-53,12.
41 Vgl. etwa die Strukturanalysen bei L. Ruppen, "Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht, und ihre Verschuldungen - er trägt sie" Oes 53,11). Universales Heil durch das stellvertretende Strafleiden des Gottesknechtes?, in: BZ NF 40 (1996) 5-17, 3f.; B. janowski, Er trug unsere Sünden (5. Anm. 38) 36-44; Ders., Stellvertretung (s. Anm.38) 80; U. Berges, Das Buch Jesaja (5. Anm. 40) 404.
286 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
A' 53,l1c-12 -Abschließender Rahmen:]HWH-Rede
a V. llc-d Wirkungfür die rabbim: Gerechttnachung durch Schuldtragen des Knechtes
b V. 12a-d Lohn des Knechtes: Anteil unter den rabbim wegen seiner Lebenshingabe
a' V. 12e-f Wirkungfiirdie rabbim: Schuldtragen des Knechtes als sein Eintreten für sie
Das eröffnende Gotteswort spricht in V. 13 zunächst vom Erfolg des Knechtes und kündigt seine Größe und Erhöhung an. Damit kontrastiert ein anschließender Rückblick: "Viele haben sich über ihn entsetzt" (V. 14a), und zwar wegen seiner Entstellung und Entmenschlichung, die in der Vergangenheit ausschlaggebend für die Wahrnehmung des Knechtes waren. Jetzt aber, fährt V. 15 fort, setzt er "viele Völker in Staunen und Könige müssen vor ihm verstummen" wegen eines bisher für undenkbar gehaltenen, jetzt aber realisierten und mitgeteilten Geschehens, das aber hier noch nicht benannt wird. 42
Im Mittelteil53,1-11 b tritt eine Wir-Gruppe als Sprecher auf. Diese Sprechergruppe bekundet in V. 1 in rhetorischer Frage im Anschluss an V. 52,15, wie unerhört und schwer zu glauben die Kunde ist, die sie mitzuteilen hat, und wie überraschend das Offenbarwerden des Machterweises JHWHs. Der Inhalt dieser Kunde,wird im Folgenden'berichtet:
Der unansehnliche und leidende, mit Krankheit und Schmerz belastete Knecht war von der WIr-Gruppe in der Vergangenheit verachtet und gemieden (V. 2-3). Diese frühere Sicht ist jetzt - davon sprechen V. 4-6 - abgelöst durch eine grundstürzend neue Erkenntnis: Krankheit und Leid des Knechtes waren nicht etwa Folge seiner eigenen Verfehlungen, die ihn nach den Gesetzmäßigkeiten des Tun-Ergehen-Zusammenhangs als Konsequenzen seiner Sünde getroffen hätten, sondern sie waren Folge der Verfehlungen und Schuld gerade der Wir-Gruppe: Der unschuldige Knecht hat sich treffen lassen von der eigentlich den Schuldigen zustehenden Strafe, die JHWH auf den Knecht geladen hat - zum Heil der Schuldigen: 43 "Durch seine Wunden sind wir geheilt!" (V. 5d)
Der Abschnitt V. 7-10c kommt auf das Leiden des Knechtes zurück, das jetzt als stellvertretendes Leiden zugunsten der Sprecher erkannt ist: Seine Misshandlung hat er stumm und ohne Widerstand ertragen, er wurde mitleidslos durch Haft und Gericht dahingerafft, zu Tode gebracht wegen der Verbrechen "seines Volkes" (V. 8d) und trotz seiner Unschuld bei Ver-
42 Zur Funktion des Gottesknechtes an den Völkern vgl. etwa H -J Hermisson, Das vierte Gottesknechtslied (s. Anm. 39) 3f.
43 V gl. L. Ruppert, Mein Knecht (5. Anm. 41) 4.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 287
brechemibegrahen(Y. 9). JHWH aber ha~Gefallengefundenanseinem Knecht, den er dem Leid unterworfen hat~ Er erkennt' seine Hingabe als ctt'~ "Sühnopfer~44 an.CV: lOc).
Von den zukünftigen Konsequenzen dieser .Lebenshingabe des Knechtes für ihn selbst handelt der Abschnitt V. 10d;...11 b: Sie bestehen in einem erneuerten Leben für den Knecht mit Nachkommenschaft und langer Lebensdauer, er wird das Licht erblicken und sich sättigen an Erkenntnis. So kommt der Plan Gottes mit ihm zum Durchbruch.
Die Verse 53,11c-12 bilden einen abschließenden Rahmen, indem wie im Eröffnungsabschnitt erneut JHWH das Wort ergreift. Hier ist die entscheidende Rede von den" Vielen" entllalten, auf die das eucharistische Kelchwort anspielt:
l1c Mein Knecht, der Gerechte, macht die rabbim gerecht, cl und ihre Verschuldungen - er wird sie tragen. 12a Deshalb gebe ich ihm Anteil bei den rabbim, b und mit den Mächtigen teilt er die Beute. c Darum dass er sein Leben ausschüttete in den Tod d und sich unter die Frevler rechnen ließ, e wobei er die Sünde von rabbim trug f und für die Frevler eintrat.
Die redaktionelle Endfassung des Liedes steht in einem Kontext; der von Zion spricht - und zwar in den unmittelbar vor- und nachstehenden Einheiten 52,1-12 und 54,1-17 von der Erniedrigung und Erhöhung Zions. Durch diese Einbindung muss das Geschick des Knechtes auf diesen Analogiefall hin transparent verstanden werden. Nach U. Berges etwa ist der leidende und erniedrigte Gottesknecht Zion, dem mit der WIr-Gruppe Juden aus der Diaspora gegenüberstehen, die erkennen, dass nicht die Mutterstadt schuldig und von JHWH gestraft worden ist, sondern sie ganz im Gegenteil wegen der Sünden derjenigen leidet, die ins Exil vertrieben wurden und jetzt verächtlich auf Jerusalem schauen. 45 L. Ruppert dagegen sieht im Knecht des redaktionellen Endtextes den zurückgekehrten Teil der Gola, der in der neu erstandenen Zion-Gemeinde erhöht wird,46 B. Janowski unbestimmter und offener die Gestalt des idealen Israel, das dem empirischen gegenübersteht. 47
44 Vgl. zur Eigenart des "Sühnopfers" etwa A. Schenker, Die Anlässe zmn Schuldopfer Ascharn, in: Ders. (Hrsg.), Studien zu Opfer und Kult im Alten restament (FAT 3), Tübingen 1992, 45-66.
45 V gl. U. Berges, Das BuchJesaja (5. Anm.40) 407. 46 Vgl. etwa L. Ruppert, Mein Knecht (s. Anm. 41) 12-14.
288 Lauber, Diskussion tun das ,Pro multis'
Für das philologische Anliegen sind diese Identifizierungen aber nicht entscheidend, sondern es kommt auf die Identität derrabblm in 53,11c-12 im Textverlauf an. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Bezug in V. 12a und demjenigen in V. llc.12e:
Die Rede von den" Vielen"· in V. 12a, bei denen der Knecht einen Anteil erhalten wird und die in Parallele zu den Mächtigen in V. 12b stehen, greift im Kontext den Parallelismus "viele Völker" und "Könige" in 52,15 auf: Der Knecht wird ein Gleichberechtigter unter den Fremdvölkern sein, seinen Anteil bei ihnen haben.
Die rabbfm in V. llc.12e sind dagegen diejenigen, die durch das Leid und die Lebenshingabe des Knechtes gerechtfertigt wurden, deren Sünde er getragen hat. Sie sind also identisch mit der Wir-Gruppe, den Sprechern im Mittelteil, die diesen Dienst des Knechtes an ihrer Schuld und sich selbst als Schuldige erkannt haben. 48 Diese Wir-Gruppe wird in 53,8d explizit als das Volk bezeichnet, dem der Knecht angehört, also als Israel identifiziert. Auch die rabbfm in 52,14a, die sich vor der Erkenntnis der Funktion des Knechtes über ihn entsetzt hatten, sind mit den Sprechern des Mittelteils gleichzusetzen.
Diese Opposition zwischen dem Knecht und Israel als all denen, die er gelitten hat, wird wie in den Klageliedern als Opposition zwischen dem Einzelnen und den rabbfm, der unüberschaubaren Menge aller anderen bezeichnet. 49 In dieser Konstellation ergibt sich für rabbfm die idiomatische Bedeutung "alle": Die dem Knecht gegenüberstehende Menge fällt sachlich mit der Gesamtheit des Volkes zusammen, das durch das Leid des Knechtes gerettet ist, also mit "allen", die zu Israel gehören.
47 Vgl. B. Janowski, Er trug unsere Sünden (s. Anm. 38) 35-36 = Dm., Stellvertretung (s. Anm. 38) 75-78.
48 Vgl. etwa Geweils mit weiteren Literaturangaben) E. Kutsch, Sein Leiden und Tod -unser Heil. Eine Auslegung von Jesaja 52,13-53,12, in: Dm. (L. Schmidt/K. Eberlein [Hrsg.]), Kleine Schriften (BZAW 168), Berlin- New York 1986, 169~196, 176.192f.; G.R Steck, Gottesknecht und Zion. Gesaffi).TIelte Aufsätze zu Deuterojesaja (FAT 4), Tübingen 1992, 2M.; L. Ruppert, Mein Knecht (5. Anm.41) 12-·14; R-j. Hermisson, Das vierte Gottesknechtslied (s. Anm.39) 12f. (der allerdings in der Wir-Gruppe nur eine "begrenztere Sprechergruppe [ ... ], die im Namen des Volkes, stellvertretend für Israel spricht", sieht.); M. Hengel, Zur Wirkungsgeschichte von Jes. 53 in vorchristlicher Zeit, in: B. JanowskilP. Stuhlmacher (Hrsg.), Der leidende Gottesimecht (s. Anm. 38) 49-91, 81 = Ders., Judaica, Hellerustica et Christiana.
Kleine Schriften TI (WUNT 1/109) Tübingen 22002,72-114, 104; B. Janowski, Er trug unsere Sünden (5. Anm. 38) 35-44 = Ders., Stellvertretung (s. Anm. 38) 77.81-92; U. Berges, Das Buch
Jesaja (5. Anm. 40) 410f.; A. Schenker, Knecht und Laffi).TI Gottes Gesaja 53). Übernahme von Schuld im Horizont der Gottesknechtslieder (SBS 190), Stuttgart 2001,70-73.
49 V gl. etwa R -j. Hermisson, Der Lohn des Knechts, in: Die Botschaft und die Boten (FS H. W. Wolff), Neukirchen-Vluyn 1981, 269-287, 28M.; vgl. B. Janowski, Er trug unsere Sünden (5. Anm. 38) 36-38 = Ders., Stellvertretung (5. Anm. 38) 80f.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 289
Diese Idiomatik ist an den Verwendungszusammenhang gebunden: In der ältesten Rezeption50 vonJes 53,11-12 in Dan 11,33; 12,3 ist dieKonstellation "Einzelner" vs. "viele" nicht aufgegriffen. Die Funktion des Knechtes wird dort auf die Mä..nner übertragen (vgl. ':J'iv-H 53,13a 11 Dan 11,33a; 12,3a), die während der Verfolgung durch Antiochus Iv. Epiphanes (175-164 v. ehr.) "viele" zur Bundestreue anhalten und nach Läuterung und Prüfung erhöht werden und aufstrahlen wie die Sterne. "Viele" sind dann aber nicht mehr die Gesamtheit Israels, sondern das endzeitliche Israel, die große, aber beschränkte Zahl derer, die die Belehrung annehmen.
e) Die Idiomatik im neutestamentlichen Sprachgebrauch
J Jeremias verfolgt die Idiomatik über die alttestamentlichen Belege hinaus vor allem in der deuterokanonischen und rabbinischen Literatur sowie in den Qumran-Schriften. Für die alttestamentliche Nachgeschichte des idiomatischen Gebrauchs von rabbfm soll hier nur auf Röm 5,18-19 verweisen werden (ein weiteres deutliches Beispiel ist 1 Kor 10,17). Die Stelle ist ein kaum zu widerlegender Beweis für die Kenntnis und weiterbestehende Gebräuchlichkeit der Idiomatik und ihres Verwendungszusammenhangs:
18 Wie es also durch die Übertretung eines einzigen (Ot' E.\lOc;) für alle Menschen (etc; 1tOtV'COU;; &vSPW1tOUC;)
zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat
eines einzigen (Ot' EVOC;) für alle Menschen (etc; 1tOt\!'ta<; &\)6pW1touc;) zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt.
19 Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen (tOU !voC; &v0pw1tou) die vielen (Ol 1tOAAOt)
zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam
des einen ('tou EVo<;) die vielen (Ol 1tOAAOt) zu Gerechten gemacht werden.
Die beiden Aussagen in V. 18 und V. 19 sind hinsichtlich aller Einzelelemente vollkommen parallel aufgebaut, die Wendungen "alle Menschen" in V. 18 und OL 1tOAAOl "die Vielen" in V. 19, die jeweils in Opposition zu "ein einziger" bzw. "einem Menschen" stehen, sind synonym gebraucht und
50 Vgl. L. Ruppert, Mein Knecht (5. Anm.41) 14-16; M. Hengel, ZurWrrkungsgeschichte von Jes. 53 (s. Anm .. 48) 60-64 = Dm., Judaica, Hellerustica et Christiana (s. Anm. 48) 83-87.
290 Lauber, Diskussion um das ,Pro multis'
austauschbar. 51 Die Anspielung von V. 19 auf das vierte Gottesknechtslied ist mit Händen zu greifen. Insofern ist dieser synonyme Parallelismus auch eine universalistische Auslegung von Jes 53,11-12.
3. Schlussfolgerungen
Alttestamentlich kann rabbim eine Gesamtheit unter dem Blickwinkel überwältigenden Vielzahl in den Blick nehmen und dann die Bedeutung "alle" annehmen. Dieser hier als "idiomatisch" bezeichnete Gebrauch ergibt sich aus der Interpretation der Verwendungszusammenhänge, in denen eine solche Bedeutung erkennbar wird. Insofern ist dem Papstbrief uneingeschränkt rechtzugeben: Die Übersetzung mit "alle" ist jeweils eine Frage
Interpretation 52 - ohne angemessenes Textverständnis freilich nie möglich ist.
Die idiomatische Redeweise gehört, wie die angeführten Belege deutlich machen, der poetischen Sprache an: Sie konstatiert nicht definitorisch eine exakte Mengen- und Verhältnisbestiromung, sondern will die Assoziation wachrufen: Alle - das ist eine unüberschaubare Menge von Einzelnen.
Diese Idiomatik 'wurde schon sehr früh verkannt: Bereits in Patristik beginnt die Spekulation darüber, warum in Röm 5,19 und im Kelchwort bei Mt und Mk von noAAOt und von 1t&V'tE~ gesprochen wird, und es ~.,,",..rlf·n Gründe gesucht für die Einschränkung, die man nOAAot selbstverständlich verbunden 53 Grund wurde meist in der Absicht zur Unterscheidung zwischen allen, denen das Heilswerk Christi gilt, und der eingeschränkten derer, die es sich durch Mittun aneignen, gesehen.
51 F. Prosinger, Das Blut des Bundes Anm.21) 104-107, bestreitet den offensichtlichen Befund und weist v. a. auf V. 17 der Rettung vom Empfang der Gnade abhängig sieht, was als Einschränkung interpretiert wird. Außerdem wird allgemein auf das Corpus Paulinum und dessen Gnmdüberzeugung durch den Gehorsam Christi nicht alle Menschen ebenso zu Gerechten werden wie durch den Ungehorsam Adams alle zu ungerechten." Solche grundsätzlichen können freilich die synonyme Verwendung von ltOAAOl und 1C<iV'tE~ in Röm 5,18-19 nicht Die Prägnanz der typologischen Formulierung, die Nebengedanken und jede anderswo begegnende Problematisierung ausblendet, lässt den idiomatischen Sprachgebrauch in aller Deutlichkeit hervortreten.
52 VgLAnm.5. 53 Vgl. M. Theobald, pro multis (s. Anm. 44-48, C Giraudo, La formula (s. Anm. 14)
280f., die auf Johannes Chrysostomos (gest. 407), Cyprian von Karthago (gest. 258), Hieronymus (gest. 420), Ambrosius von Mailand (gest. 397), Remigius von Lyon (gest. 875) hinweisen. Andere patristische Interpretationen scheinen dagegen ?tonal einen inklusiven Sinn beizulegen, vgL C. Marucci, Per molti 0 per tutti? (s. Anm.19) 297-300, der u.a. Origenes (gest. 253/254), Hilanus von Potiers (gest. 367), Apollinaris von Laodicea (gest. ca. 390), Johannes Chrysostomos (gest. 407) anführt.
Lauber, Diskussion um das ,Pro multis' 291
Diese Interpretation ist aufgegriffen in der scholastischen Distinktion "sufjicienterpro omnibus" - "efjicaciterpro multis": "hinreichend - "wirksam nur für viele". 54 Im Römischen Katechismus wurde diese Unterscheidung zur kirchenamtlichen Lehre. 55 Der Katechismus von 1992 etwa 1tOAAOl im Kelchwort dagegen ausdrücklich inklusiv im Sinn von "alle" erklärt (Nr. 605). Durch die jetzt beschlossene Neuübersetzung dafür gegebenen Erläuterungen wird die traditionelle Interpretation restituiert.
Ob die neutestamentlichen Formulierungen des Kelchwortes sich genommen überhaupt zu einer Interpretation in dogmatischen Kategorien taugen, ist fraglich:
Einerseits steht in der alttestamentlichen Idiomatik das lexematische Wort "viele" nicht wie in unserem Sprachgebrauch einschränkend im Gegen
satz zu "allen", sondern nimmt in bestimmten Verwendungszusammenhängen eine Gruppe eben als "alle" in den Blick. 56 die jetzt beschlossene wörtliche Wiedergabe mit "viele" Bereich eines solchen Verwendungszusammenhangs sicher nicht den Sinn.57
Andererseits entspricht wegen des poetisch assoziativen Charakters der Wendung aber auch eine Wiedergabe mit "alle" nicht der Idiomatik, wenn dabei sofort definitionsartig an einen soteriologischen Bezug "gesamte Menschheit" gedacht ist - dafür ist die in der wachgerufene Ganzheitsvorstellung zu uneindeutig kontextgebunden.
Insofern ist M Striet Recht zu geben: "Biblische Philologie reicht [ ... ] . aus, um das Bedeutungsspektrum des ,pro multis' entscheiden zu können. Sie reicht zumindest dann nicht aus, wenn sich' in ein theologisches Gesamtverständnis dessen einbindet, was den Glauben seinem Wesen ausmacht. "59
54 ehVa Thornas von Aquin, S. Th. m q. 78, a. 3, 8: Passio Christi [ ... ) ad sufficientiam profuit omnibus; quantum vero ad efficientiam profuit multis.
55 Cat. Rom.lI, 4,24: [ ... ] Pertinent autem ad passionis fructum atque utilitatem declarandam. Nam si eius virtutem inspiciamus, pro omnium salute sanguinem a Salvatore effusum esse fatendum erit; si vero fructum quem ex eo homines perceperint, cogitemus, non ad omnes sed ad multos tantum eam utilitatem pervenisse facile intelligemus,
56 Vgl. A. Vanhoye, La traducci6n (s. Anm. 12) 311-317. 57 Vgl. M. Zerwick,,, ... pro vobis et pro multis effundetur ... " (s. Anm. 9) 140. 58 Dasselbe gilt freilich auch bei der Verwendung eines Wortes mit der lexematisch ein
deutigen Bedeutung "alle", der sich auch erst im Konte1.1: konkretisiert. In diesem Sinn ist die Feststellung von M Theobald, pro multis (s. Anm.38) 40, zu ergänzen, der eine Kontextabhängigkeit nur für die Wendung "die Vielen" annimmt: "Der universale Aspekt ist also für den Ausdruck ,die Vielen' nicht konstitutiv, viehnehr haben wir einen Ganzheits-lerminus vor uns, der unterschiedliche Füllungen der Ganzheit erlaubt."
59 M Striet, Nur für viele oder doch für alle? Das Problem der Allerlösung und die Hoffnung der betenden Kirche, in: Ders. (Hrsg.), Gestorben für wen? (s. Anm. 8) 81-92, 83.
292 Diskussion um das ,Pro multis'
Am angemessensten wäre eine Wiedergabe, die eine Gesamtheit ausdruckt, ohne dabei definitorisch zu klingen und die Formulierung mit theologischen Konsequenzen zu belasten, die sie nicht beabsichtigt. Eine idiomatische deutsche Entsprechung wäre es etwa, "für die ganzen Menschen" zu übersetzen - eine Ganzheitsaussage ohne Definitionscharakter, die freilich nicht einem liturgisch angemessenen Sprachniveau angehört.
Ganz nahe am biblischen Sprachgebrauch, wenn auch im Deutschen ungebräuchlich und deshalb erklärungs bedürftig, wäre eine Wiedergabe von Teerl bzw. uTeep TeOAAW\I in der determinierten Form "für die Vielen" gewesen. 60 Die Syntax des neutestamentlichen Griechisch steht dieser Übersetzung nicht entgegen, weil dort semitisierend der Artikel nach Präpositionen ausfallen, aber mitgemeint sein kann. 61
Die Wiedergabe mit "die Vielen" hätte nicht nur den Vorteil gehabt, den Bezug des Kelchwortes zum vierten Gottesknechtslied klarer offenzulegen. Weil diese Formulierung den Charakter eines bibeltheologischen Terminus technicus hat, wäre sie auch schwerer mit dogmatischen Implikationen zu verbinden gewesen, die der biblische Text nicht intendiert.
Nachdem die Entscheidung nunmehr aber für die Wiedergabe "viele" gefallen ist, wird die vom Papst gewünschte Katechese, die die Neuübersetzung erklären soll, in Übereinstimmung mit den von ihm selbst gegebenen Hinweisen zu betonen haben: 62 ,,viele", das ist die große, unüberschaubare Menge derjenigen, denen Jesus als ihr Erlöser gegenübersteht und die er bei seiner Lebenshingabe als Gottesknecht im Blick hat. Und wir dürfen hoffen, dass dieser Blick allen Menschen gilt.
60 H Hoping, "Für die vielen" (s. Anm.10) 76. VgL auch C. Giraudo, La formula (s.
Anm. 14) 283, der für die italienische Übersetzung die Wendung "per la moltitudine" bzw. "per le moltitudini" vorschlägt, und A. Vanhoye, La traducei6n (s. Anm.12) 314, der franz. "pour la mulcitude", span. "por la multitud" als angemessene Wiedergabe betrachtet: "Me pareee una eleeci6n a tener en cuenta, porque respeta el original de la versi6n latina y al mismo tiempo evita eaer en contraposici6n entre ,muchos' y ,todos', manteniendo el sentido de la apertura
universal de la propuesta de Jesus del cäliz." 61 Vgl. M. Zerwick a. Smith [Hrsg.]), Biblieal Greek, Rom 92011, 58f. Nr.182.
62 Vgl. Notitiae 49 (2012) 68-70.