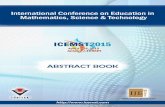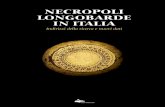A. Pedrotti, "BevÖlkerungs-und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol" in...
Transcript of A. Pedrotti, "BevÖlkerungs-und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol" in...
Mensch und Umwelt während des Neolithikumsund der Frühbronzezeit in Mitteleuropa
Ergebnisse interdisziplinärer Zusammenarbeitzwischen Archäologie, Klimatologie, Biologie und Medizin
Internationaler Workshop vom 9.-12. November 1995Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien
People and their Environment during the Neolithicand Early Bronze Age in Central Europe
Results of interdisciplinary coorperationbetween archaeology, clitnatology, biology and medicine
International workshop November 9-12,1995Institute for Pre- and Protohistory - University ofVienna
herausgegeben von
Andreas Lippert, Michael Schultz,Stephen Shennan und Maria Teschler-Nicola
Verlag Marie LeidorfGmbH · RahdenlWestf.2001
IV, 328 Seiten mit 210 Abbildungen und 5 Tabellen
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung durchAmt der Niederösterreichischen Landesregierung - Abteilung Kultur und Wissenschaft
Gesellschaft der Freunde des Naturhistorischen Museums WienNaturhistorisches Museum Wien - Anthropologische Abteilung
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit
in Mitteleuropa. Ergebnisse interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen
Archäologie, Klimatologie, Biologie und Medizin 1hrsg. von Andreas Lippert ...
Rahden/Westf.: Leidorf, 2001
(Internationale Archäologie: Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung,
Kongress; Bd. 2)
ISBN 3-89646-432-9
Alle Rechte vorbehalten©2001
lIVIlDDVerlag Marie LeidorfGmbH
Geschäftsführer: Dr. Bert WiegelStellerloh 65 . D-32369 RahdenlWestf
Tel: +49/(0)5771/9510-74Fax: +49/(0)5771/9510-75
E-Mail: vml-verlaMi-online.deInternet: http://www.leidorjdeInternet: http://www.vml.de
ISBN 3-89646-432-9ISSN 1434-6427
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, Internet oder einem anderen Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie LeidorfGmbH reproduziert werden
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
.. Umschlagentwurf: Dirk Bevermann und Bert Wiegel, Georgsmarienhütte und RahdenlWestf.Englische Ubersetzung: Stephen Shennan, Institute ofArchaeology - University College London und Ernest Jilg, IUF Wien
Scans: Peter Mrazek, Karina Grömer, Wolfgang Reichmann, Alexandra Krenn-Leeb und Martin Krenn(IUF Wien, NHM Wien, Verein ASINOE Krems)
Satz, Layout und Redaktion: Alexandra Krenn-Leeb, Institut für Ur- und Frühgeschichte,Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien;
E-mail: [email protected]:WWl1J.univie.ac.at/urgeschichte
Druck und Produktion: DSC-Heinz J. Bevermann KG, Raiffeisenstraße 20, D-49124 Georgsmarienhütte
Bevölkemngs- und Besiedlungsbild
des Spätneolitbikums im Trenüno/Südürol
Population and settlement situation0/ the Late N eolithic period in TrentinolSouth Tyrol
Annaluisa Pedrotti
StichworteBesiedlungsstruktur, Spätneolithikum, Trentino/Südtirol, Vasi a bocca quadrata-Kultur,alpine Nord-Süd-Beziehungen, Tamins-Kultur, Eismann
KeywordsSettlement structure, Late Neolithic period, TrentinolSouth Tyrol, Vasi a bocca quadrata culture,alpine north-south interrelations, Tamins culture, ice man
Das Trentino, südlich der Alpen gelegen, gilt mitSüdtirol - dank der Eisack-Etsch-Verbindung - alsBrückenregion zwischen dem mediterranen und nordalpinen Raum. Diese beiden Regionen sowie das gesamteGebiet der Dolomiten werden seit Jahren intensiv erforscht. Dadurch werden immer wieder neue Erkenntnisse bezüglich der frühesten Besiedlung dieses Gebietes gewonnen1.
Die Besiedlung des Trentino/Südtirol- außer einigen seltenen mittelpaläolithischen Spuren - beginnt imSpätpaläolithikum (Spätglazial) und betrifft, wie im gesamten Mesolithikum (Präboreal- Boreal), zwei unterschiedliche Höhenzonen, eine im Tal und eine im Gebirge. Von den über 200 Fundstellen, die zu diesen zeitlichen Abschnitten gehören, liegen lediglich zehn imTa12
• Dieser Unterschied in der Besiedlungsdichte läßtsich wohl folgendermaßen erklären: Am Talboden sinddie Fundstellen von meterhohen Ablagerungen bedeckt, während sie im Gebirge meistens an der Oberfläche liegen und somit durch Begehungen relativ leicht zufinden sind. Die hohe Dichte der Fundstellen im Gebirge ist wohl aufdie unstete, äußerst mobile Lebensweiseder damaligen Bevölkerung zurückzuführen.
Die derzeit bekannten Fundstellen im Talbereichliegen meistens im Etschtal rund um Trento und Rovereto. Dieses Gebiet wies immer eine intensive Bautätigkeit auf, wobei die Schuttkegel abgetragen und so dieFundstellen freigelegt wurden. Es handelt sich dabei um23 Felsdächer, die oft eine dichte Schichtenabfolge zeigen. Sie beweisen, daß die Besiedlung des Etschtalesauf das Altmesolithikum zurückgeht, und daß sie imSpätmesolithikum zunimmt (Abb. 1).
Dieses Faktum, zusammen mit der Tatsache, daßdie Anzahl an Fundstellen im Gebirge an der Wende des
Boreals zum Atlantikum geringer wird, könnte als Beweis dafUr dienen, daß die Bereitschaft zur Seßhaftwerdung zunahm und der Neolithisierungsprozeß griff.
Während dieses Prozesses wurden die Felsdächernach und nach aufgelassen. Es kam wahrscheinlich zurFavorisierung der Freilandstationen, um leichter Akkerbau und Viehzucht betreiben zu können. Mitte des 5.Jahrtausends kann man annehmen, daß die Felsdächernicht mehr aufgesucht wurden.
Diese Zeit beherrscht die Vasi a bocca quadrataKultur (mit Spiral-Mäandern verziert - VBQ 2) und erste Spuren der Ritz- und Stichverzierungen treten auf(VBQ 3), die zum ersten Mal in der Höhensiedlung vonIsera la Torretta gefunden wurden. Diese Fundstelleliegt bei Rovereto am rechten Etschufer und ist bereitsaus der Literatur bekannt (BARFIELD 1970). Sie wurde Anfang der neunziger Jahre vom Denkmalamt Trienterneut erforscht (PEDROTTI 1996; DE MARINIS undPEDROTTI1997).
Denn im Zuge der Aktivierung der Basaltgrubewurde eine mächtige Schichtenabfolge freigelegt. Eineerste Auswertung der Grabungsdaten ergab, daß dieseSiedlung fünf Begehungshorizonte aufweist (Abb. 4)und zwar: VBQ 3 mit Ritz- und Stichverzierungen (Isera 1), VBQ 3 mit Ritz- und Stichverzierungen mit Chassey-Einflüssen (Isera 2), Fiave 1-Castelaz di Cagno(Isera 3, Isera 4), Keramik mit glatten Leisten, TypusTamins-Carasso (Isera 5).
Isera 1
Die erste Besiedlungsphase ist durch drei Hüttendokumentiert. Die am besten erhaltene Hütte (Hütte 2,US 76) besitzt einen rechteckigen Grundriß und ist
106
Fundsteilen AN MNl MN2 JNl
Acquaviva 240
Paludei di Volano 180
Madonna Bianca 232
Borgo Nuovo 240MezzocoronaMezzocorona Doss de la 241ForcaDoss Trento 308
Riparo Gaban 270
Nogarole 1-3 300
Moletta Patone 95
Romagnano 190LochSolteri 220FelsdachOmo2 220FelsdachMonte Baone 270
Bersaglio di Mori 265
La Rupe di 218MezzolombardoLa Cosina di Stravino 600
Riparo deI Santuario- 500LasinoColombo di Mon 250
La Vela Valbusa 200
A bb. 1: Chronologische und kulturelle Entwicklung der Felsdächer im Trentinovom A ltmesolithikum bis zur Bronzezeit.
Annaluisa Pedrotti
AM: A ltmesolithikum, Sauveterrien. JM: Jungmesolithikum, Castelnovien. AN: A ltneolithikum, Gaban-Gruppe.MN1: Mittelneolithikum, VBQ-Kultur 1. Stil (linear-geometrisch). MN2: Mittelneolithikum, VBQ-Kultur 11. Stil
(meandro spiralico). JN1: Jungneolithikum, VBQ-Kultur III Stil mit Ritz- und Stichverzierung (Isera 1-2).JN2: Jungneolithikum, Fiave 1-Cagno Facies (Isera 3-4). Ä·neol: Ä·neolithikum (White Ware, Tamins/Isera 5,
Metopenverzierung, Glockenbecher-Begleitkeramik). FBZ: Frühbronzezeit, Polada-Kultur.* Grab/Gräber. • Spuren metallurgischer Tätigkeit. Heller Raster: unsichere Datierung.
NW-SO orientiert. Entlang der Längsachse wurden dreiFeuerstellen gefunden, mit je 1 m Durchmesser. In derHütte fand man Spuren von Holzkohle und gebranntemHüttenlehm, zum Teil verziert, sowie mehreren komplett rekonstruierbaren Gefäßen, welche annehmen lassen, daß die Hütte abgebrannt war. Das Keramikmaterial zeigt Gefäße mit flachem Boden. Einige davon wei-
sen ovale Profile, Griffe und Fingertupfen am Gefäßrand auf. Gefunden wurden auch Gefäße mit viereckigem Mundsaum (Abb. 2), meistens im Zick-Zack-Muster verziert, und Schalen ebenfalls mit viereckigemMundsaum, jedoch mit eingeritzten Dreiecken versehen. Alle Verzierungsmuster sind mit Stich- und Ritztechnik erzeugt worden und meistens weiß inkrustiert.
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 107
A bb. 2: Isera la Torretta: Gefäße der VBQ-Kultur aus Hütte 2, US 76.Horizont [sera 1 - 4500-4300 BC (photo: P. Chiste).
Diese Elemente sind typisch für die VBQ-Kultur 3 undentsprechen zum Beispiel denen von Rivoli Rocca, LeBasse di Valcalaona, Motton d'Asigliano e Belforte diGazzuolo (BAGOLINI 1984).
Die verzierten Schalen beweisen Kontakte mit derIsolino-Fazies der VBQ-Kultur. Entsprechungen findetman beispielsweise in Castelgrande (DONATI und CARAZZETTI 1986, Abb. 4). Alle diese Funde gehörenzum ältesten Abschnitt der VBQ-Kultur 3, der nochnicht mit der Chassey-Lagozza-Kultur in Verbindungwar. Diese wurde zum ersten Mal von BAGOLINI,BARBACOVI und BIAGI (1979) beschrieben und später als "Berico Euganeo" benannt (BAGOLINl 1984,402). Einige 14C-Daten von Knochen, die im Innerender drei Hütten gefunden wurden, datieren die erste Besiedlung dieser Fundstelle zwischen 4500-4300 v. Chr.(cal.; siehe Abb. 12) (NIKLAUS et al. im Druck) undbeweisen mit ihrem hohen Alter die Aussagen von BAGOLINI (1984, 403), daß dieser Horizont bereits zu einer Zeit auftrat, als noch der zweite Stil der VBQ-Kultur verbreitet war3
•
Isera 2
Die Formen und Verzierungen sind praktisch identisch mit Isera 1. Zahlreich vorhanden sind Fingertupfenleisten. Auch Pintadera (Tonstempel) sind anzutreffen4. Durchbohrte Grifllappen und Webgewichte, dieauf eine westliche Herkunft hinweisen, treten auf. Siefinden beispielsweise in den Schichten 100-120 vonIsolino di Varese ihre Entsprechung, die von Guerreschider Chassey-Proto-Lagozza-Phase zugeschrieben wer-
den. Es ist wahrscheinlich, daß die Ausbreitung solcherElemente nach Osten ab dieser Zeit von der Verbreitungeiner neuen Technologie abhängt, die vielleicht neueLösungen in der Weberei aufzeigte.
Tatsächlich weisen meistens die Webgewichte undSpinnwirtel auf Kontakte zwischen der VBQ 3 und derChassey-Lagozza-Kultur hin. Nordalpinen Einfluß zeigen einige Keramikfragmente, die mit Feinfurchenstichtechnik verziert sind (Abb. 3), wie sie z. B. in derSpätmünchshöfener Kultur verbreitet ist. Gute Parallelen fmdet man zum Beispiel in der "Räuberhöhle-Wettenburger" (NADLER und ZEEB et al. 1994)5.
Die Kontakte zwischen den nördlich und südlichder Alpen gelegenen Gruppen sind sicher greifbar in einer Zeit, in der in diesen Regionen erste Kupferobjekteverbreitet sind6 und könnten vielleicht durch den Fundeines Fragmentes eines Kupferbleches in Isera 2 bestätigt werden7
• Den Fundkomplex von Isera 2 kann mitdem Proto-Lagozza-Horizont parallelisiert (GUERRESCHI 1976-77, 489) und dadurch der VBQ-Plastik, die
A bb. 3: Isera la Torretta: Furchenstichkeramikaus Isera 2 (photo: E. Munerati}.
108 Annaluisa Pedrotti
5 cm 10o cm 3~
o cm 3--===--
~--
f\lo cm
0'P::l
~
~.Q ~
z i0<U....~
Nj~~ uU
\Xl
~ 8~
\Q("f)
8~ 00
n("t')
~~
~I
I-~"~
o cm 5.... ....
~-.
o cm 3~
~t--+-----------------------------------------t~Zo.....rau~ ~
~ g~
~ I
~ ~Cf.) ~
S ~
o m~ ~
o 5 cm 10::::J
A bb. 4: Chronotypologische Entwicklung au/grund der Stratigraphieder Höhensiedlung Isera la Torretta (I'N) (Zeichnungen: Monica TaU).
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 109
in Piemont von VENTURINO GAMBARI (1987;1995, 18-20) gefunden wurde, gleichgesetzt werden.Eine Korrelation besteht auch mit der Schicht 3 vomBorseht und Schicht 6 vom Lutzengütle (PRIMAS1982, 572 f.)8.
Für diesen Horizont stehen leider keine 14C-Datenzur Verfügung. Anhand der Stratigraphie kann beurteiltwerden, daß sich diese Stufe in einer Zeit nach Isera 1und vor Isera 3 bewegt.
Isera 3
Diese Stufe ist am häufigsten durch Grobkeramikgekennzeichnet. Es handelt sich dabei meist um großeGefäße mit Arkaden- und verdicktem Rand, die auchBeziehungen zu den nordalpinen Kulturen Altheim undPfyn aufweisen (PERINI 1995; BAGOLINI 1984).
Es gibt aber auch Verzierungsmuster, die keineVerbindungen nach Norden besitzen, wie zum BeispielVorratsgefäße mit häufig aufder Oberfläche parallel angeordneten horizontalen Fingertupfenleisten (Abb. 5).Auch Elemente aus dem Westen sind vorhanden, wiefeingemagerte Schalen mit durchlochten Griffen sowieGefäße mit Noppen, die in der Mitte vertieft sind. Diesefinden beispielsweise Entsprechungen in den Schichten100-080 von Isolino di Varese, die von Guerreschi derLagozza-Kultur (GUERRESCHI 1976-77, Taf. XXIX/1809, Taf. XXV/4502) zugeschrieben werden, sowie inden jungneolithischen Schichten von Castelgrande(CARAZZETTI und DONATI 1990, Abb. 10).
In Isera selbst sind Noppen mit Eintiefungen oftmit Fingertupfenleisten kombiniert. Diese Verzierungist am häufigsten in Fiave 1 vorhanden (PERINI 1994,45, Taf. 2/c20). Es ist auch ein Kupferahlenfragment gefunden worden, welches wahrscheinlich auch auf Verbindungen mit den Altheim- und Pfyn-Kulturen weisenkönnte9
• Da es in Norditalien momentan noch keineHinweise aufMetallproduktion gibt, sind diese Kupferobjekte als Importstücke zu verstehen. Im Keramikkomplex von Isera 3 findet man auch Gefäße mit viereckigem Mundsaum. Da in Fiave 1 überhaupt keine solchen Fragmente beobachtet wurden, könnten jene ausIsera als aus einer Sekundärlagerung stammend erklärtwerden, oder aber eine Gleichzeitigkeit von Fiave 1unddem Ende der VBQ-Kultur bedeuten1o.
Nach dem heutigen Stand besteht der Isera 3Komplex gleichzeitig zur Lagozza-Kultur (Schichten100-080 Isolino) und ist mit der Schicht 5b vom Lutzengütle (Liechtenstein) parallelisierbar (PRIMAS 1982,574). Der Horizont Isera 3 ist nur durch ein einziges14C-Datum von einem Knochenfragment aus Fiave 1mit einer Zeitspanne zwischen 3800-3600 v. Chr. datiert(NIKLAUS et al. in Druck).
Isera 4
Dieser Horizont ist durch das Verschwinden derElemente aus dem Westen charakterisierbar. Es treteneinige Formen mit ausladendem Rand auf Die Formenmit verdicktem Rand, vergleichbar mit dem nordalpi-
A bb. 5 (links): Isera la Torretta: Gefäß mitFingertupfenleisten aus dem Horizont Isera 3
(Photo: E. Munerati).
nen Raum, gehen weiter. Die Anwesenheit eines Silexdolchfragmentes mit zugespitzter Basis, das im Trentino im Depot des Doss Pipel vorhanden ist (MOTTES1996), zeigt, daß die Herstellung solcher Objekte vordem Gräberfeld von Remedello anzusiedeln ist11 .
Die Publikation von TILLMANN (1993, 453), inder einige Silexdolche als Importstücke aus Lessini dargestellt werden, die in Ergolding/Fischergasse (37003400 v. Chr.) und Pestenacker in Siedlungen der Altheimer Kultur gefunden worden sind, zeigt, daß diese Vergesellschaftung von Isera 3 korrekt ist12. Der Fundbestand von Isera 4 findet in Castellaz di Cagno (PERINI1973, Abb. 2) und in Romagnano Schicht R (PERINI1971, Abb. 52) eine Entsprechung. In beiden Siedlungen sind die Gefäße mit viereckigem Mundsaum sowiedie Elemente aus dem Westen (Lagozza) nicht mehr anzutreffen. Auch dieser Horizont ist durch ein einziges14C-Datum aus Romagnano R zwischen 3700-3380 v.Chr. datiert (FORNWAGNER und NIKLAUS 1995,83).
Isera 5
Die Keramik ist durch ungegliederte, annäherndzylindrische Töpfe charakterisiert, die ziemlich grobgemagert und oft mit horizontalen Leisten verziert sind.Die häufigsten Entsprechungen sind in Graubünden beider Fundstelle Tamins-"Crestis" (PRIMAS 1977 und1982, Abb. 2-3) und Cazis-Petrushügel (PRIMAS1985) sowie im Fürstentum Liechtenstein in der Schicht2 vom Borseht und in Schicht 4 vom Lutzengütle zu finden (PRIMAS 1982, 574 f.). Im Tessin und in Norditalien sind ähnliche Formen aus kupferzeitlichen Niveaus, nach dem heutigen Forschungsstand aufden Höhensiedlungen von Castel Grande13 und von Breno inValcamonica (FEDELE 1988, 120) zu erkennen.
110 Annaluisa Pedrotti
A bb. 6: Verbreitungskwte der gesichert nachweisbaren Fundsteilenim Trentino/Südtirol von 4300 bis 3800 v. ehr. • Höhensiedlung.
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 111
A bb. 7: Verbreitungskarte der gesichert nachweisbaren Fundstellen im Trentino/Südtirol von 3800 bis 3300 v. ehr.• Felsdach. • Höhensiedlung. • Feuchtbodensiedlung. 0 Freilandstation.
112
A bb. 8 (links): Isera la Torretta: Keramik mitglatten Leisten aus Isera 5.
Abb. 9 (rechts): Romagnano (TN): Gefäß vom TypusWhite Ware aus der Schicht Q (Photos: E. Munerati).
Dieser Keramiktypus, der von Primas als TaminsCarasso-Horizont postuliert wurde (PRIMAS 1977,28), ist teilweise mit der Horgener Kultur gleichzeitig.In Schicht 3 von Feldmeilen kommt ein einziges Gefäßmit parallelen Horizontalleisten wie in Tamins vor (WINIGER 1981, Taf. 94/4). Eine solche Gleichzeitigkeitwird auch von einer 14C-Datenserie aus Tamins bestätigt, die sich zwischen 3310-3036 und 3304-2915 v.Chr. bewegt, während die 14C-Daten von Cazis-Petrushügel ein Andauern dieses Horizontes bis mindestens2882-2614 v. Chr. zeigen (STÖCKLI, NIFFELER undGROSS- KLEE 1995, 306).
Die Gleichzeitigkeit zwischen Horgener Kulturund Tamins-Crestis-Horizont in Feldmeilen erlaubt eine Korrelierung zwischen Isera 5 und den Schichten Qvon Romagnano (Abb. 9). Hier tauchen einige zylindrische, schwach konvexe Gefäße auf, die unter dem Randeine horizontale Reihe von Buckeln haben, die von innen nach außen herausgearbeitet sind (PERINI 1971, 95f.) 14. Dieses Verzierungsmotiv wird von Barfield aufdieHorgener Kultur zurückgefiihrt (BARFIELD, BIAGIund BORELLO 1975-76, 98-100), welches er auch typisch für die von ihm definierte White Ware Facies hält.
Die White Ware Facies kommt in der Schichtenabfolge von Monte Covolo vor der Glockenbecherschichtvor (BARFIELD, BIAGI und BORELLO 1975-76, 98100). Eine weitere Bestätigung der Kontaktkontinuitätzwischen Norden und Süden stellen Silexdolche dar,die wahrscheinlich aus Lessini kommen und in Siedlungen der Chamer Kultur gefunden wurdenl5
, die aufgrund der 14C-Daten zeitgleich mit der Horgener Kulturist (MATUSCHIK. 1992, 201). Das Vorhandensein eines Gußlöffels in den Q-Schichten von Romagnano(PERINI 1980, 15) bestätigt, daß die Verbreitung dermetallurgischen Kenntnisse gleichzeitig mit der Verbreitung der Keramik vom Typus Tamins und Horgen in
Annaluisa Pedrotti
dieser Region einherging. Diesem Horizont kann manauch anband der 14C-Datierung (NIKLAUS et al. imDruck) die Körperbestattung einer erwachsenen Frau(CORRAIN 1982), die unter dem Felsdach von Acquaviva di Besenello Ende der siebziger Jahre gefundenworden ist (ANGELINI, BAGOLINI und PASQUALl1980), zuordnenl6
• Sie weist als Beigabe einen Silexdolchtyp mit gerundeter Basis und eine Stielpfeilspitzeauf, die mit dem Material aus dem Gräberfeld von Remedello vergleichbar sind, das De Marinis der Phase 1zuordnet. Dies führt zum Schluß, daß der Isera 5-Horizont und die Remedello-Kultur Phase 1 sowohl aufgrund typologischer Aspekte als auch der nun vorhandenen 14C-Datierungen als zeitgleich angesehen werdenkönnen. Da in dieser Bestattung der Schädel fehlt unddie Langknochen kaum vorhanden sind, kann man vermuten, daß sich eine Art des Ahnenkultes - wie vielleicht der "Schädelkult" - ab dieser Zeit im Trentino zuverbreiten beginntl7
• Die chronologische Abfolge inIsera wird teilweise die Lücke schließen, die M. PRIMAS (1982, 571 f.) anband der Schichtenabfolge vomLutzengütle und vom Borscht zwischen VBQ- und Glockenbecherkultur erkannte.
Diese Zuordnung wird durch eine Analyse der Besiedlungsspuren im Trentiner Raum bestätigt (Abb. 1).In den Horizonten von Isera 1 und 2, die einen neuenStil in der Keramik zeigen, fällt auf, daß die Felsdächerüberhaupt nicht benutzt wurden. Und gleichzeitig werden zum ersten Mal Höhensiedlungen in strategischgünstiger Lage besiedelt (Abb. 6). Isera 3 und 4, diedurch eine Abnahme der VBQ-Gefäße charakterisiertsind und eine Zunahme von Einflüssen aus dem Nordenund Westen aufweisen, zeigen auch eine kontinuierliche Besiedlung der Höhensiedlungen. Eine neue Besiedlungsart - die Feuchtbodensiedlung - tritt ebenfalls
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 113
A bb. 10: Verbreitungskarte der gesichert nachweisbaren FundsteIlen im Trentino/Südtirol von 3300 bis 2900 v. ehr.• Felsdach. • Höhensiedlung. <> Höhen/und.
114 Annaluisa Pedrotti
A bb. 11: Verbreitungskarte der FundsteIlen im Trentino/Südtirol von 3800 bis 2200 v. ehr.• Felsdach. Höhensiedlung. Feuchtbodensiedlung. 0 Freilandstation. <Q> Höhen/und, Steufund, Figurenmenhir.
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 115
Siedlungen Befunde Labomr.uneal.
Enur eal. Be 20' % Ö 13 Material KulturltorizontBP
4445 4424 1.6
4391 4388 0.2Isera la TOJTetta
US 61 ETH-12494 5440 55 4367 4218 86.7 -19 TierlmochenVBQ3/
(TN) Isera 14199 4143 9.6
4116 4091 1.9
Isera la TOJretta 4544 4324 98.8 VBQ3/US 75 ETH-12495 5580 65 -20.5 Tierlmochen(TN) 4279 4264 1.2 Isera 1
Isera la TOJTettaUS 76 ETH-12496 5570 55 4514 4332 100.0 -19.4 Tierlmochen
VBQ3/
(TN) Isera 1
Fiave 1 sett. IX 3932 3873 9.4 Fiave l-Cagno /str.F ETH-12498 4950 55 -19.7 Tierknochen
(TN) Q.Olf 3810 3640 90.6 Isera 3
Romagnano 3698 3504 94.02 Fiave l-Cagno /Liv.R R-775 4810 50 -25.2 Holzkohle
Loe. 3416 3383 5.98 Isera 4
3332 3213 20.1 Kupferzeit 1 /Aequaviva Homo-tba.l ETH-12497 4410 70 3203 3154 6.3 -22.2 Bestattungs-
di BeseneUo Knochen höhle / Isera 53140 2897 73.6
Riparo Gaban C5 Bln-1776 3985 50 2613 2333 100.0 Holzkohle Kupferzeit 2
A bb. 12: 14C-Daten der spätneolithischen und kupJerzeitlichen Siedlungen im Trentino.
auf. Ab dieser Zeit werden die Felsdächer wieder genutzt (Abb. 7).
Auch in der darauffolgenden Zeit (Isera 5), diedurch eine Verannung an Keramik und an Verzierungselementen sowie durch die Verbreitung der metallurgischen Techniken charakterisiert ist, werden die meistenFelsdächer wieder genutzt. Dieser Zeit scheinen aucheinige Oberflächenfunde, die in höheren Lagen gefunden wurden, zuzuordnen sein (Abb. 10)18.
Wie die obige Darstellung zeigt, lassen sich zwischen Norden und Süden während des 4. Jahrtausendsenge Verbindungen nachweisen. Betrachtet man dieEntwicklung der Keramik von Isera, kann man sagen,daß die alpinen Gruppen mit großer Wahrscheinlichkeitden gleichen kulturellen Prozeß durchliefen, auch wennsie verschiedenen Kulturerscheinungen angehörten. Sieweisen alle im Verlauf dieser Zeit eine Vergröberungder Keramik und eine Verarmung an Formen auf9
•
In der Tamins-Carasso-Gruppe scheint zum Beispiel nur eine Gefäßform, nämlich die zylindrische, inVerwendung gestanden zu haben (PRIMAS 1985, 107).Das gleiche kann man auch für Isera sagen (Abb. 1).Diese Erscheinung könnte nach Primas eine Konsequenz der klimatischen Veränderungen an der Wendevom Atlantikum zum Subboreal darstellen (PRIMAS1985, 101)20. Es ist sehr wahrscheinlich, daß in dieserZeit in den alpinen Gebieten die Almwirtschaft (Transhumanz) ihren Anfang findet. Dies scheinen auch dieFunde aus dem Trentino zu bestätigen. Ab dieser Zeit
wurden die Gebirge wieder begangen und die Siedlungen und Felsdächer benützt, welche für die mobile Gesellschaft des Mesolithikums typisch waren (Abb. 1).Jedoch ist - im Vergleich zum Mesolithikum - die Motivation eine andere.
So wurden diese Felsdächer zum Beispiel für Kupferverarbeitung und Begräbnisse genutzt, wahrscheinlich auch als Unterkünfte für Schafe und Ziegen während der Transhumanz. Dieses Phänomen reicht bisweit in die frühe Bronzezeit hinein21 . Es kann sein, daßin dieser mobilen Zeit Holzgefäße bzw. GefaBe aus organischen Materialien eher Verwendung fanden als diejenigen aus Keramik, und es dadurch zur Verarmung ankeramischen Formen kam.
Aufgrund der einfachen Keramikformen läßt dermomentane Forschungsstand bezüglich der Besiedlungsdichte noch keine genauen Schlüsse zu. Die Verbreitungskarte vom Ende des 4. Jahrtausends (Abb. 10)zeigt z. B. nur jene Fundstellen, deren chronologischeZuordnung durch stratigraphische Angaben oder 14C_Daten gesichert ist. Es kann sein, daß der Anfang vonvielen frühbronzezeitlichen Siedlungen, die nur durchOberflächenfunde repräsentiert sind, tatsächlich früheranzusetzen isr2. Detaillierte Aussagen können erst getroffen werden, wenn die vollständige Auswertung solcher Fundkomplexe und derjenigen, die momentan generell der "Kupferzeit" bzw. dem "Äneolithikum" zugeordnet werden (siehe Abb. 1 und 11)23, einschließlichder naturwissenschaftlichen Befunde (14C-Daten, pa-
116
läobotanische, archäozoologische und anthropologische Analysen) vorliegt.
Dies würde hoffentlich ein klareres Bild von derLebensweise jener Populationen aus der Zeit des "Eismannes" ergeben. Dieser scheint eben mit seinen beidenHolzgefäßen, dem Silexdolch und dem Kupferbeil diewichtigsten Neuerungen dieser Epoche darzustellen.Wahrscheinlich gehörte er einer Gesellschaft an, dieKeramik vom Typus Tamins und Isera 5 gebraucht hat.
Zusammenfassung
Das Trentino repräsentiert gemeinsam mit Südtiroldie verbindende Region zwischen dem mediterranenund dem nordalpinen Raum. Jahrelange Forschungenzeigen, daß die Besiedlung des Trentino/Südtirol - außer einigen seltenen mittelpaläolithischen Spuren - imSpätpaläolithikwn beginnt. Es können zwei SiedlungsHöhenzonen - eine im Gebirge und eine im Tal- unterschieden werden, wobei von über 200 Fundstellen lediglich zehn im Tal situiert sind. Dies wird durch diemassiven Ablagerungen im Talbereich erklärt.
Bei der Talbesiedlung handelt es sich im Etschtalum 23 Felsdächer mit umfassender Stratigraphie, dieauf das Altmesolithikum zurückgeht und im Spätmesolithikum zunimmt (Bereitschaft zur Seßhaftwerdung).Während des Neolithisierungsprozesses wurden dieFreilandstationen mehr und mehr bevorzugt und dieFelsdächer aufgelassen.
Die Vasi a bocca quadrata-Kultur (Phase VBQ 2)konnte für diesen Zeithorizont erstmals in Isera la Torretta nächst Rovereto nachgewiesen werden. Die Fundstelle mußte in den neunziger Jahren vom DenkmalamtTrento neuerlich ergraben werden. Eine mächtigeSchichtenabfolge mit fünf Besiedlungshorizontenkonnte dokumentiert werden (Abb. 1): VBQ 3 mit Ritzund Stichverzierungen (Isera 1), VBQ 3 mit Ritz- undStichverzierungen mit Chassey-Einflüssen (Isera 2),Fiave-Castelaz di Cagno (Isera 3 und 4) sowie Keramikmit glatten Leisten vom Typus Tamins-Carasso (Isera5). In Isera 1 und 2 wurden keine Felsdächer benütztund zum ersten Mal Höhensiedlungen in strategischgünstiger Lage besiedelt. In Isera 3 und 4 wurden nebenden kontinuierlich besiedelten Höhensiedlungen auchdie Felsdächer wieder genutzt. Die Feuchtbodensiedlung trat als Besiedlungsart neu auf. Isera 5 brachte eineVerarmung an Keramik und an Verzierungselementen.Charakteristisch wurde die Verbreitung der metallurgischen Tätigkeit. Die meisten Felsdächer wurden nunwieder genutzt, allerdings in Zusammenhang mit derTranshumanz, der Kupferverarbeitung sowie für Grabanlagen. Die Verarmung der keramischen Formenwurde - als eine Möglichkeit - mit der nun notwendigen Mobilität erklärt.
Abstract
The TrentinolSouth Tyrol region represents theconnection between the Mediterranean and the Northem Alpine area. Research spanning many years
Annaluisa Pedrotti
shows that settlement in TrentinolSouth Tyrol, apartfrom some rare Middle Palaeolithic traces, commencesin the Late Palaeolithic. Settlements were established in/wo zones: in the mountains and on the valley floors. Ofabout 200 settlements that have been located, only ten
have been found in valleys. This can be explained bythe massive soil depositions that have collected withinthese valleys.
Initial settlement in the Etsch valley consists of23rock shelters complete with extensive stratigraphy thatdates usage back as far as the early Mesolithic period,then increasing usage during the Late Mesolithic (preparingforpermanent settlement). During the transitionto the N eolithic period, the inhabitants began to preferliving in the open, eventually giving up the rock sheltersaltogether. Thefirst proofthat the Vasi a bocca quadrataeulture (Phase VBQ 2) stemsfrom this horizon in timewasfound in Isera la Torretta next to Rovereto. This sitehad to be newly excavated in the 1990s by archaeologists from the Federal Preservation Office in Trento.
A massive stratigraphie sequence featuring fivesettlement horizons was documented (fig. 1): VBQ 3with incised and indented decorations (Isera 1), VBQ 3with incised and indented decorations with Chassey in-fluences (Isera 2), Fiave-Castelaz di Cagno (Isera 3and 4) as weIl as ceramic with smooth mouldings oftype Tamins-Carasso (Isera 5).
No rock shelters were used in Isera 1 and 2 since,for the first time, hilI settlements in strategicallyfavourable positions were established. In Isera 3 and 4, therock shelters next to the continuously inhabitedhilI settlements were used once again. The lake-dwelling appeared as a new settlement type.
Isera 5 produced an impoverishment of the ceramics as weil as in their decorative elements. Characteristic became the dissemination ofmetallurgical knowhow. Most rock shelters came into use once more; a direct result in the increase oftranshumance, the workingofcopper as weIl as the use ofrock shelters as burialchambers. A possible explanation for the impoverishment ofthese ceramicforms was the necessity ofmobility.
Anmerkungen
1 Zusammenfassende Arbeiten zu diesem Thema: BAGOLINIund BROGLIO 1985; BROGLIO und LANZINGER 1990; BAGOLINI und PEDROTTI 1992.
2 Verzeichnis und Verbreitungskarten siehe DALMERI und PEDROTTI 1992.
3 In diesem Sinne könnte auch ein Fragment eines im dritten Stilverzierten VBQ-GefaBes von der FundsteIle La Vela interpretiert werden, von der sonst nur Verzierungen des ersten und zweiten Stiles bekannt sind (pEDROTTI 1990, Abb. 5/9).
4 Diese Objekte sind am häufigsten am Balkan verbreitet(MAKKAY 1984). In Norditalien sind sie typisch für die VBQ-Kultur. Für eine Verbreitung im alpinen Bereich siehe PEDROTTI 1990,Abb. 4; Neuer Stand bei RUTTKAY 1993/94. Weiters hinzuzufiigenist der neue Pintatera von Aulendorf-Steegerseeder aus der Pfyn/Altheimer Kulturschicht, siehe KÖNINGER und SCHLICHTERLE1993; KÖNINGER 1995, Abb. 1.
5 Für die Anwesenheit der Furchenstichtechnik in Italien siehe:PEDROTTI 1990,218.
Bevölkerungs- und Besiedlungsbild des Spätneolithikums im Trentino/Südtirol 117
6In Straubing wurde z. B. in einem Doppelgrab der Münchshöfener Gruppe ein Kupferohrring gefunden (BÖHM und PIELMEIER1993). Eine zusammenfassende Arbeit über die Anfange der Metallurgie nördlich der Alpen siehe: STRAHM: 1994 und die dort angegebene weiterführende Literatur).
7 Es handelt sich um den ältesten Kupferfund aus einem geschlossenen Fundkontext im Trentino. Kupferobjekte aus sicherenBefunden der VBQ-Kultur stammen in Norditalien aus Alba, ScuolaG. Rodani Palestra (VENTURINO GAMBARI 1995, 134, Abb. 110)und aus Rivoli Rocca (BARFIELD und BAGOLINI 1975-76, Abb.126, MI).
8 In dieser Schicht erkannte PRIMAS (1982) einen Verzierungsstil ähnlich dem der VBQ-Kultur 3 und in Rivoli Rocca einenBecher vom Typ Borscht.
9Eine Kupferahle wurde zum Beispiel in Straßkirchen in Bayern in einer Altheim-Kulturschicht zusammen mit einem Gefaß derBernburger Kultur mit durchlochtem Griff - ähnlich jenem der Lagozza-Kultur - gefunden (ENGELHARDT 1993 mit einem Verzeichnis der Kupferobjekte der Altheimer Kultur).
10 Eher ist wohl aufgrund der Fundkomplexe von Storo (DALMERII982), Völser Aicha (BAGOLINI und BIAGI 1986,387) undMosio (SIMONE 1980, 139 f.) die zweite These anzunehmen.
11 Anband der 14C-Daten wurde das Gräberfeld von Remedelloerst ab 3300 v. Chr. angelegt. Siehe DE MARINIS und PEDROTTI1997.
12 Diese Silexdolche sind schon in Fiave 1 vorhanden und dieProduktionswurzeln gehen wahrscheinlich auf die dritte Phase derVBQ-Kultur zurück (DE MARINIS und PEDROTTI 1997). In diesem Horizont war, wie der Fundkomplex Kanzianiberg beweist (PEDROTTI 1990), der Tausch von Feuerstein südlicher Herkunft nachNorden bereits begonnen.
13 Freundliche Mitteilung von Riccardo Carazzetti.14 Im Trentino fmdet man weitere solche Elemente in Riparo
Gaban, Bersglio di Mori und Madonna Bianca (pEDROTTI, in Vorbereitung).
15 Für das Verzeichnis solcher Silexdolche siehe TILLMANN1993,453.
16 Die 14C-Datierung dieser Bestattung liegt zwischen 33002800 v. Chr.
17 Diese Kultart ist vor allem in der frühen Bronzezeit im Trentino verbreitet. Ein Kommentar und ein Fundstellenverzeichnis befinden sich bei BAGOLINI, CARLI, FERRARI, MESSORI, PASQUALl und PESSINA 1989, 150 f.; dazu NICOLIS 1996.
18 Für die Verbreitung dieser Oberflächenfunde siehe BAGOLINI und PEDROTTI 1992, Abb. 2.
19 Siehe dazu PRIMAS 1985, 112, Tab. 12.20 Für eine detailliertere Beschreibung dieses Prozesses siehe
PRIMAS 1985, 109 f. mit weiterführender Literatur.21 Eine genaue Beschreibung der Bronzezeit-Besiedlung fmdet
sich in MARZATICO 1990, Abb. 2.22 Ein Verzeichnis solcher frühbronzezeitlicher Siedlungen im
Vinschgau befmdet sich in DAL RI und TECCHIATI 1995, Abb. 5;ein Verzeichnis der Höhensiedlungen der Frühbronzezeit im Trentino/Südtirol in DI GENNARO und TECCHIATI 1996, 231 f.
23 Eine Verbreitungskarte der spätneolithischen und äneolithischen FundsteIlen im Trentino befmdet sich bei DE MARINIS undPEDROTTI1997.
Literaturverzeichnis
ANGELINI, B., BAGOLINI, B. und PASQUALl, T. (1980): Acquaviva di Besenello. Preistoria Alpina 16, Trento, 67-69.
BAGOLINI, B. (1984): Neolitico. In Aspes, A. (Hrsg.): Il Venetonell'antichita. Preistoria e Protostoria I. Banca Popolare di Verona, Verona, ed. Grafiche Fiorini, 382-389.
BAGOLINI, B., BARBACOVI, F. und BlAGI, P. (1979): Le Ba.sse diValcalaona (colli Euganei). Alcune considerazioni su una facies abocca quadrata e sulla collocazione cronologica culturale. Monografie di Natura Bresciana 3, 3-72.
BAGOLINI, B., BlAGI, P. und NISBET, R. (1982): Ricerche negli insediamenti di Fingerhof presso Aica di Fie (Völseraicha - BZ).Rapporto preliminare sugli scavi 1980-1981. Rivista di Archeologia VI, Roma, 11-22.
BAGOLINI, B. und BROGLIO, A. (1985): Il ruolo delle Alpi neitempi preistorici (dal Paleolitico al Calcolitico). In: Studi di Paletnologis in onore di Salvatore M-Puglisi. Universita di Roma"La Sapienza", 663-705.
BAGOLINI, B., CARLI, R., FERRARI, A., MESSORI, A., PASQUALl, T. und PESSINA, A. (1989): Il sepolcreto eneolitico deIDos de la Forca (Mezzocorona - Trento). Preistoria Alpina 25,Trento, 121-164.
BAGOLINI, B. und PEDROTTI, A. (1992): Vorgeschichtliche Höhenfunde im Trentino-Südtirol und im Dolomitenraum vomSpätpaläolithikum bis zu den Anfangen der Metallurgie. In: Höpfel, F., Platzer, W. und Spindler, K. (Hrsg.): Der Mann im Eis.Band 1. Bericht über das Internationale Symposium 1992 in Innsbruck, 359-377.
BARFIELD, L. H. (1970): L'insediamento neolitico ai Corsi pressoIsera (Trento). Studi Trentini di Scienze Naturali, Sez. B., XLVIIIn. 1, Trento, 56-77.
BARFIELD, L. H. und BAGOLINI, B. (1976): The Excavation on theRocca di Rivoli (1963-68). Memorie deI Museo Civico di Storianaturale di Verona, Sezione Scienze dell'Uomo I, Verona, 1-173.
BARFIELD, L. H., BlAGI, P. und BORELLO, M. A. (1975-76): Scavi nella stazione di Monte Covolo (1972-73). Annali deI Museodi Gavardo XII, Gavardo, 5-160.
BARFIELD, L. H., BUTEUX, S. und BOCCHIO, G. (1995): MonteCovolo: una montagna e il suo passato. Birmingham UniversityField Archaeology Unit.
BÖRM, K. und PIELMEIER, R. (1993): Der älteste Metallfund Altbayerns in einem Doppelgrab der Münchshöfener Gruppe ausStraubing. Das Archäologische Jahr in Bayern 1993, BayerischesLandesamt für Denkmalpflege und Gesellschaft für Archäologiein Bayern (Hrsg.), Konrad Theiss Verlag, 40-42.
BROGLIO, A. und LANZINGER, M. (1990): Considerazioni sulladistribuzione dei siti tra la fme dei Paleolitico superiore e l'iniziodeI Neolitico nell'Italia settentrionale. In: Biagi, P. (Hrsg.): TheNeolithisation ofthe alpine region. Monografie di Natura Bresciana 13, 53-69.
CARAZZETTI, R. (1986): La ceramica neolitica di Bellinzona, Castel Grande. Prime osservazioni. Archäologie der Schweiz 003,110-115.
CARAZZETTI, R. und DONATI, P. A. (1990): La stazione neoliticadi Castel Grande. In: Die Ersten Bauern, 1. Bd., SchweizerischesLandesmuseum Zürich, 361-368.
CORRAIN, C. (1982): Osteometria di resti di uno scheletro rinvenutoad Acquaviva di Besenello (Trento). Preistoria Alpina 18, Trento,191-196.
CORNAGGlA CASTIGLIONI, O. und CALEGARI, G. (1978): Corpus delle pintadere preistoriche italiane. Problematica, Schede,Iconografia. Memorie della Societa italiana di Scienze NaturaliXXIVI, 7-30.
DALMERI, G. (1982): Rinvenimento di alcune stazioni preistorichenella zona di Storo (Val Giudicarie inferiore), Trento. PreistoriaAlpina 18, Trento, 163-174.
DAL RI, L. und TECCHIATI, U. (1995): Zur Vor- und Frühgeschichte des mittleren und unteren Vinschgaues. In: RaiffeisenkasseTschars (Hrsg.): Archäologie und Kunstgeschichte in Kastelbell-Tschars und Umgebung. Artigianelli, Trento.
DE MARINIS, R. C. und PEDROTTI, A. (1997): L'eta deI Rame nelversante italiano delle Alpi centro-occidentali. Atti della XXXIRiunione Scientifica dell'I.I.P.P., "La valle d'Aosta nel quadrodella Presitoria e Protostoria dell'arco alpono centro-occidentale"Courmayeur, 2-5 giugno 1994.
DI GENNARO, F. und TECCHIATI, U. (1996): Insediamenti su rilievi. In: Cocchi Genik, D. (Hrsg.): L'Antica eta deI Bronzo in Italia.Octavio, 229-245.
DONATI, P. (1986): Bellinzona a Castel Grande - 6000 anni di storia.Archäologie der Schweiz IX/3, 94-109.
DRIEHAUS, J. (1960): Die Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mitteleuropa. Römisch-German. Zentralmuseum inMainz, Verlag R. Habelt, Mainz.
ENGELHARDT, B. (1993): Ein Altheimer Erdwerk in Straßkirchen.Das Archäologische Jahr in Bayern 1993. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege und Gesellschaft für Archäologie in Bayern (Hrsg.), Konrad Theiss Verlag, 44-46.
FEDELE, F. (1988): L'uomo, le Alpi, la Valcamonica. 20.000 anni alCastello di Breno. Boario Terme (La Cittadina).
118
GUERRESCHI, G. (1976-77): La stratigrafia dell'Isolino di Varesededota dalla ceramica (scavi Bertone 1955-1959). Sibrium XIll,29-528.
KÖNINGER, J. und SCIll.JCHTHERLE, H. (1993): Zum Stand dertaucharchäologischen Untersuchungen im Steeger See bei Aulendorf, Kreis Ravensburg. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg, Konrad Theiss Verlag, 61-66.
LENNEIS, E., NEUGEBAUER-MARESCH, Chr. und RUTTKA~E. (1995): Jungsteinzeit im Osten Österreichs. WissenschaftlicheSchriftenreihe Niederösterreich 102-105.
LICHARDUS, J. (1991): Die Kupferzeit als historische Epoche.Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6-13/11/1988, Teil1-2, Saarbrücken Beiträge zur Altertumskunde LV, Verlag R. Habelt, Bonn.
LUNZ, R. (1986): Vor- und Frühgeschichte Südtirols. Band 1 Steinzeit, Manfrini, Calliano.
MAKKA~ J. (1984): Early stamps seals in South-east Europe, Akademie Kiad6, Budapest.
MARZATICO, F. (1990): Modeles d'habitats de l'äge du Bronze dansle Trentin. Colloque international de Lons-Ie-Saunier, 427-433.
MATUSCHIK, I. (1992): Die Chamer Kultur Bayerns und ihre Synchronisation mit den östlich und südöstlich benachbarten Kulturen. Studia Praehist. 11-12, Sofia, 200-220.
MOTTES, E. (1996): Lame di pugnale in selce dal Trentino meridionale conservate presso il Museo Civico di Rovereto. In: Tecchiati, U. (Hrsg.) (1996): Archeologia deI Comun Comunale Lagarino. Storia e forme d'insediamento dalla preistoria al Medio Evo.Rovereto, 97-105.
MOTTES, E. (1996): L'insediamento e la necropoli dell'antica etä. deIBronzo dei Solteri di Trento. In: Cocchi Genik, D. (Hrsg.): L'Antica eta deI Bronzo in Italia. Octavio, 542-543.
NADLER, M. und ZEEB, A. et al. (1994): Südbayern zwischen Linearbandkeramik und Altheim: ein neuer Gliederungsvorschlag. In:Beier, H. J. (Hrsg.): Der Rössener Horizont in Mitteleuropa.Beitr. Ur- und Frühgesch. Mitteleuropas 6, 127-189.
NIKLAUS, TH. R., BONANI, G., DE MARINIS, R., PEDROTTI,A., PRINOTH-FORNWAGNER, R. und DAL RI, L. (im Druck):New Radiocarbon Dates to Acces the Cultural and ChronogicalCharacterisation ofthe Man in the lee.
NIKLAUS, TH., BIANCHIN CITTON, E., BONANI, G., DAL RI,L., DE MARINIS, R., HAJDAS, 1., IVY, S., PEDROTTI, A. undPRINOTH-FORNWAGNER, R. (im Druck): Radiocarbon dating of various sites in the Italian Alps. Radiocarbon, be publishede
PEDROTTI, A. (1990): L'insediamento di Kanzianiberg: rapporticulturali fra Carinzia ed Italia settentrionale durante il Neolitico.In: BIAGI, P. (Hrsg.): The Neolithisations ofthe Alpine region.Monografie di Natura bresciana XIII, Brescia, 213-226.
PEDROTTI, A. (1990a): L'abitato neolitico de "La Vela" di Trento.In: Die ersten Bauern, 2. Bd., Schweizerisches LandesmuseumZürich, 219-224.
PEDROTTI, A. (1996): Un insediamento d'altura alla Torretta di Isera(lN). In: Tecchiati, U. (Hrsg.) (1996): Archeologia deI ComunComunale Lagarino. Storia e forme d'insediamento dalla preistoria al Medio Evo. Rovereto, 71-86.
PERINI, R. (1971): I depositi preistorici di Romagnano-Loc. Preistoria Alpina 7, Trento, 7-106.
PERINI, R. (1973): Un deposito tardo neolitico al Castelaz di Cagno(Valle di Non), Preistoria Alpina 9, Trento, 45-52.
PERINI, R. (1980): Preistoria trentina. Annotazioni. Provo Autonomadi Trento - Assessorato alle attivitä. culturali.
PERINI, R. (1984): Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiave-earera. Parte I campagne 1969-1976. Situazione dei depositie dei resti strutturali. Patrimonio Storico Artistico Trentino VIII,Provincia Autonoma di Trento.
PERINI, R. (1987): Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiave-earera. Parte II campagne 1969-1976. Resti della culturamateriale metallo - osso -litica - legno. Patrimonio Storico Artistico Trentino IX, Provincia Autonoma di Trento.
PERINI, R. (1994): Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiave-earera. Parte m campagne 1969-1976. Resti della culturamateriale ceramica - vol. 1/2. Patrimonio Storico Artistico Trentino X, Provincia Autonoma di Trento.
PRIMAS, M. (1977): Die Sondierung von Tamins "Cresti", Graubünden. Neue Aspekte des Alpinen Spätneolithikums. Arch. Korrbl.VII, 23-29.
PRIMAS, M. (1982): Lago di Garda-Lago di Costanza. rapporti interregionali di eta neolitica superiore ed eneolitica. In: Studi inonore di Ferrante Rittatore Vonwiller, vol. TI, Como, 572-583.
PRIMAS, M. (1985): Cazis-Petrushügel in Graubünden: Neolithikum, Bronzezeit, Spätmittelalter. Zürcher Studien zur Archäologie, Juris, Zurigo.
PRINOTH-FORNWAGNER, R. und NIKLAUS, TH. R. (1995): DerMann im Eis. Resultate der Radiocarbon-Datierung. In: Spindler,K., Rastbichler-Zissernig, E., Wilfing, H., Zur Nedden, D. undNothdurfter, H. (Hrsg): Der Mann im Eis. Neue Funde und Ergebnisse. Springer Verlag Wien-New York, 78-89.
RUTTKA~ E. (1993-94): Neue Tonstempel der Kanzianiberg-Lasinja-Gruppe. Mitt. Anthrop. Ges. Wien CXXITI-CXXIV, 221-238.
SALZANI, L. (1985): Rassegna dei ritrovamenti preistorici nella Valdadige veronese. Atti deI primo Convegno archeologico sullaValdadige meridionale, Pro Loco di Volarne - comune di Dolca,55-78.
STÖCKLI, E., NIFFELER, U. und GROSS-KLEE, E. (Hrsg.)(1995): Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum Mittelalter.SPM II Neolithikum. Schweizerische Gesellschaft fiir Ur- undFrühgeschichte, Basel.
SIMONE, L. (1980): Mosio (Aquanegra sul Chiese - Mantova).PreistoriaAlpina 16, Trento, 139-140.
STRAHM, CH. (1994): Die Anfänge der Metallurgie in Mitteleuropa.Helvetia Archaeologica 97/25, 2-39.
TILLMANN, A. (1993): Gastgeschenke aus dem Süden? Zur Frageeiner Süd-Nord-Verbindung zwischen Südbayern und Oberitalien im späten Jungneolithikum. Arch. Korrbl. XXIII, 453-460.
TECCHIATI, U. (1996): Il riparo deI santuario (Lasino, Trento) nelquadro dell'antica eta deI Bronzo dell'area medio-alpina atesina.In: Cocchi Genik, D. (Hrsg.): L'Antica eta deI Bronzo in Italia.Octavio, 534-535.
VENTURINO GAMBARI, M. (1987): Il Neolitico di Ghemme (Novara). Rapporti tra Lombardia e Piemonte nella cultura dei Vasi aBocca Quadrata, Atti della XXVI Riunione Scientifica dell'IIPPFirenze, 479-494.
VENTURINO GAMBARI, M. (Hrsg.) (1995): Navigatori e contadinie Alba e la valle deI Tanaro nella preistoria. Quaderni della Soprintendenza Archeologica deI Piemonte Monografie~ FamijaAlbesa.
VORUZ, J. L. (1991): Le neolithique suisse. Bilan documentaire. Documents du Departement d'anthropologie et d'ecologie de l'universite de Geneve XVI.
VORUZ, J. L. (Hrsg.) (1995): Chronologies Neolithiques. De 6000 a2000 avant notre ere dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloqued'Amberieu en Bugey, 19 et 20 septembre 1992. Documents duDepartement d'antropologie et d'ecologie dell'universite de GeneveXX.
WININGER, J. (1981): Feldmeilen-Vorderfeld. Der Übergang vonder Pfyner zur Horgener Kultur. Antiqua VIII, Verlag Schweizerische Gesellschaft fiir Ur- und Frühgeschichte, Basel.