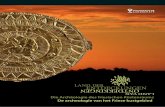Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Transcript of Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Akten des 14. Österreichischen Archäologentagesam Institut für Archäologie der Universität Graz
vom 19. bis 21. April 2012
Herausgegeben von
Elisabeth Trinkl
Sonderdruck
Wien 2014
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafelnund Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit*
Jörg Weilhartner
Die Logogramme der Linear B-Schrift bilden in den von lexikalischen Einträgen dominierten Tex-ten eine deutliche Orientierungshilfe, die nicht nur die inhaltliche Einordnung des jeweiligenTextes erleichtert, sondern auch die registrierende Funktion der Tafeln unterstreicht. In diesennur aus wenigen Strichen bestehenden symbolhaften Zeichen ist eine Fokussierung auf besonderscharakteristische Elemente des zu Erfassenden unabdingbar. Vergleichbar mit einem Comiczeich-ner legt der mykenische Schreiber das Hauptaugenmerk auf leicht und eindeutig erkennbare We-senszüge, während er weniger wichtige Attribute einfach weglässt. Demnach stellen sowohl diestandardisierte Normalform der einzelnen Logogramme als auch ihre jeweiligen graphischenVarianten eine wertvolle Informationsquelle für die als besonders spezifisch angesehenen Charak-teristika einzelner Lebewesen, Pflanzen, Nahrungsmittel, Rohstoffe, Erzeugnisse und Gebrauchs-gegenstände dar1.
Auf einem beträchtlichen Teil der Linear B-Tafeln finden sich logographische Zeichen fürPersonen und Tiere, da die Dokumentation des palatialen Personal- und Viehbestandes zu denzentralen Aufgaben der Verwaltungsbeamten in den spätbronzezeitlichen Palaststaaten der InselKreta und des griechischen Festlandes zählte. Mit diesen Zeichen konnten die mykenischenSchreiber die Registratur der betreffenden Personen oder Tiere unmissverständlich bewerkstelli-gen. Wie eine Gegenüberstellung dieser Logogramme auf der einen und entsprechender Darstel-lungen der ägäischen Bildkunst auf der anderen Seite zeigt, bildete die Ikonographie einewesentliche Inspirationsquelle für die Gestaltung dieser Zeichen2.
Ein eindeutiges Zeugnis dieser unmittelbar vergleichbaren Gestaltungskonventionen legenLogogramme und Darstellungen der Frau bzw. des Mannes ab3. Bei den Linear B-Logogrammenmanifestiert sich die unterschiedlich akzentuierte, symbolhafte Wiedergabe einer weiblichen bzw.einer männlichen Person hauptsächlich in der vorhandenen bzw. unterlassenen Angabe von Klei-dung (Abb. 1–2) und nicht in physiologischen Geschlechtsmerkmalen, wie dies bei Logogram-men anderer Schriftsysteme zu beobachten ist. In Bezug auf ein der Gestaltungsweise dieserLinear B-Logogramme diametral entgegengesetztes Beispiel sei auf frühe Belege der entsprechen-den Bildzeichen in der sumerischen Keilschrift verwiesen, die sich als Abbildungen der primärenGeschlechtsteile zu erkennen geben4. Die fehlende Angabe primärer Geschlechtsmerkmale beiden Logogrammen der Linear B-Schrift findet ihr Pendant bei der generellen Zurückhaltung ih-rer Darstellung in den Bildzeugnissen der mittleren und späten Bronzezeit5. Dies lässt daraufschließen, dass der Genitalbereich als Zeichen des Geschlechtergegensatzes keine wesentliche Rol-le spielte.
* Für die Durchsicht des Manuskripts sowie formaleund inhaltliche Verbesserungsvorschläge seien AngelikaBaier und Fritz Blakolmer herzlich gedankt. Ersterer ge-bührt darüber hinaus mein tief empfundener Dank fürihre stete Bereitschaft, mir in Hinblick auf Fragen ausdem Bereich der Gender Studies hilfreich zur Seite zu ste-hen, letzterem danke ich für die gewinnbringenden An-stöße bei den zahlreichen zu diesem Thema geführtenDiskussionen.
1 Einen Einblick in die Verwendung, Klassifizierungund graphische Gestaltung der mykenischen Logogramme
bietet Palaima 2005.2 Eine ausführlich dokumentierte Gegenüberstellung
von Logogrammen für Frau/Mann bzw. für Haustiere mitBelegen der Bildkunst findet sich bei Weilhartner 2012aund Weilhartner 2012b. Darüber hinaus waren auch paläo-graphische Traditionen wirksam, während das reale Vor-bild nur in sehr eingeschränktem Ausmaß als Vorlagediente.
3 Ausführlich dazu Weilhartner 2012b.4 Asher-Greve 1998, 10 f.5 Rehak 1998, 192 f.
445
Das Logogramm für Mann (Abb. 1), das im wesentlichen aus einem X mit einem horizonta-len Strich an der Oberseite und einem Halbkreis darüber besteht, bildet offensichtlich eine ver-kürzte, symbolhafte Wiedergabe des auf physischer Kraft basierenden männlichen Idealsbildlicher Darstellungen, indem es den Kopf in Profilansicht, die breite Schulterpartie und dieDreiecksform des Oberkörpers in Frontalansicht sowie die Schrittstellung der Beine wiederum inProfilansicht mit wenigen Strichen anschaulich abbildet6. Insbesondere der Wechsel zwischenProfil- und Frontalansicht greift hierbei auf eine Konvention zurück, die in der ägäischen Glyptikseit den frühesten Menschendarstellungen zu beobachten ist7. Entsprechend der zentralen Rolledes Krieges in der mykenischen Palastkultur, die im archäologischen Befund und in der Ikonogra-phie, aber auch in der mykenischen Namensgebung klar dokumentiert ist8, könnte das Logo-gramm für Mann symbolhaft einen schreitenden ‚Krieger‘ wiedergeben, der als Metapher fürMännlichkeit besonders geeignet erscheint (Abb. 3)9.
Bei dem Logogramm für Frau (Abb. 2) findet sich analog zu dem männlichen Pendant einenur sehr schematische Gestaltung des Kopfes. Zwei diagonal verlaufende Striche unterhalb desKopfes stellen die Arme dar. Der untere Teil des Logogramms besteht aus zwei längeren Strichen,die manchmal fast parallel, zumeist aber schräg nach unten verlaufen, und einer abschließendenhorizontalen Linie. Diese charakteristische dreieckige Form ist ohne Zweifel als Angabe eines lan-gen Gewandes zu verstehen, das sich demnach als das essentielle Charakteristikum dieses Logo-gramms erweist10.
Diese beiden Logogramme für Frau und Mann kommunizieren die unterschiedliche Kon-zeption von Weiblichkeit und Männlichkeit in mykenischer Zeit in einer mit der Ikonographievergleichbaren, wenn auch stark abgekürzten Form. Sie basiert auf einer traditionellen Bipolarisie-rung von passiver, bekleideter Frau (Abb. 4) und aktivem, nur spärlich bekleideten Mann (Abb.3), eine Konvention, die der ägäischen Bilderwelt entnommen ist und deren Gültigkeit bis weitin die historische Zeit reicht11.
Auch bei der Gestaltung der Logogramme für behörnte Haustiere hat man auf die Bildspra-che der Spätbronzezeit zurückgegriffen. Zwar weisen die Logogramme für Schaf (ovis: Abb. 5),Ziege (cap: Abb. 6) und Rind (bos: Abb. 7), die sich aus einem vertikalen Strich und einem un-terschiedlich gestalteten, oberen Teil zusammensetzen, auf den ersten Blick wenig bildhafte Ele-mente auf, doch legt ein Vergleich mit Darstellungen in Siegel- und Vasenbildern nahe, dassdieser obere Teil die jeweils charakteristische Form des Hornes mit einschließt12. Für die Gestal-tung eines Logogramms, das – wie eingangs erwähnt – auf die Fokussierung charakteristischer
6 Eine graphische Variante dieses Logogramms weisteine besonders kräftige Formung der Oberschenkel auf, s.Weilhartner 2012b, 290–292. Dieser ausdrückliche Hin-weis auf männliche Kraft scheint sich von der überpropor-tionalen Betonung männlicher Oberschenkel in der ägäi-schen Ikonographie herzuleiten. Ein Wiederhall dieserKonvention findet sich in den homerischen Epen: Zahl-reiche schmückende Beiwörter beschreiben die Oberschen-kel männlicher Krieger als besonders stattlich, s. Laser1983, 15.
7 Tamvaki 1989, 259. Dass das Linear B-Logogrammtatsächlich eine Schrittstellung der Beine in Profilansichtwiedergibt, wird durch die explizite Angabe der Füße beidem entsprechenden Linear A-Logogramm A 100/102 na-hegelegt, s. unten Abb. 18.
8 Zur immanenten und allgegenwärtigen Rolle desKrieges im mykenischen Griechenland s. z. B. Deger-Jal-kotzy 1999. Dass sich die Wert- und Wunschvorstellun-gen der kriegerischen Elite auch in der Namensgebungmanifestiert haben, ist von Neumann 1995 ausführlich
dargelegt worden.9 Da bei diesem Zeichen keinerlei Angabe einer
Waffe auszumachen ist, kann eine derartige Deutung nureine Vermutung bleiben. Immerhin findet sich eine demLinear B-Logogramm formal entsprechende Darstellungeines Mannes – mit einem Speer in der Hand – bereitsauf frühen Siegeldarstellungen, s. z. B. CMS II 2 Nr.104; VI, 1 Nr. 68; XII Nr. 68.
10 Mitunter haben die Schreiber die Angabe der ab-schließenden horizontalen Linie unterlassen. Dies lässtsich m. E. durch die vorgegebene Linierung der Texte er-klären, da dieses Phänomen des Weglassens der abschließ-enden horizontalen Linie bei einer ganzen Reihe von Logo-grammen (wie auch Syllabogrammen) zu beobachten ist, s.Weilhartner 2012b, 292 mit Anm. 36 und 37.
1 1 Langdon 1999, 26; Lee 2000, 111–123.12 Zur Wiedergabe der unterschiedlichen Hornform
bei Schaf, Ziege und Rind s. Weilhartner 2012a, 65–67 mit Abb. 6–11b.
446
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Elemente abzielt, scheint das Horn als einfach wiederzugebendes Unterscheidungsmerkmal beson-ders geeignet, da bei Horn tragenden Tieren das Schädelbild entscheidend von dem Gehörn ge-prägt ist.
Ein besonders eindrückliches Beispiel dieser unterschiedlichen Gestaltungsweise bietet derMiniaturfries der Nordwand von Raum 5 des Westhauses in Akrotiri auf Thera, der in einer in-nerhalb der ägäischen Kunst einzigartigen Zusammenstellung Schaf-, Ziegen- und Rinderherdenin einem Bild vereint13. Auch bei den phantastischen Mischwesen einer zusammengehörigenGruppe von Siegelabdrücken aus Kato Zakros findet sich diese Gestaltung der Hörner, die eineeindeutige Unterscheidung von Schaf- (Abb. 8), Ziegen- (Abb. 9) und Rinderkopf (Abb. 10) er-möglicht14. Demnach existierte in der ägäischen Ikonographie eine Konvention für die Gestal-tung der Tierhörner, auf die zur eindeutigen Differenzierung zurückgegriffen werden konnte undvon der auch bei der Gestaltung der entsprechenden Linear B-Logogramme Gebrauch gemachtwurde15.
Im Gegensatz zu der stets eindeutigen Gestaltungsweise der Logogramme weisen die Horn-form wie auch das Gesamterscheinungsbild der Tiere in den Bildzeugnissen jedoch eine erstaun-liche Variationsbreite auf, wodurch sich die exakte Zuordnung eines dargestellten Tieres zu einerbestimmten Gattung häufig nicht vornehmen lässt. Unter der Voraussetzung, dass die Schwierig-keiten einer exakten Bestimmung bereits für den bronzezeitlichen Betrachter bestanden haben,könnte diese Unschärfe in der Darstellung als ein bewusst gesetzter Akt eines mitunter fehlendenkonkreten Gestaltungswillens verstanden werden.
Zur Illustrierung dieses Gedankenganges sei exemplarisch auf ein Bildthema verwiesen, dashäufig als ‚Priesterin (bisweilen auch Göttin) mit Ziege (oder Widder)‘ bezeichnet wird16. DiesesDarstellungsmotiv zeigt eine weibliche, mit langem, verziertem Rock bekleidete Gestalt, die eingehörntes Tier auf ihrer Schulter oder vor ihrem Körper trägt. Im Allgemeinen wird dieses Sujetals szenischer Ausschnitt einer Opferhandlung gedeutet, wobei man in den leblos oder zumindestbetäubt erscheinenden Tieren Opfertiere vermutet, die entweder zur rituellen Schlachtung oderzur Zerlegung (nach bereits erfolgter Tötung) getragen werden17. Während mitunter eine eindeu-tige Klassifizierung des getragenen Tieres vorgenommen werden kann – so ist die Darstellung ei-nes Ziegenbocks auf dem Siegelabdruck CMS II 7 Nr. 23 (Abb. 11) ebenso unmissverständlich
13 Morgan 1988, 56–60; Televantou 1990, 315–319 mit Abb. 9–10.
14 CMS II 7 Nr. 144: Kopf und Hals eines Schafes imrechten Profil ; CMS II 7 Nr. 141: Kopf einer Ziege imrechten Profil ; CMS II 7 Nr. 145: Kopf und Hals einesRindes im rechten Profil. Vgl. Weingarten 1983, 62–64(Nr. 35, 37 und 43). Bei Weingarten 1983, 63 (Nr. 37)wird das auf CMS II 7 Nr. 144 dargestellte Mischwesenfälschlich als „squatting winged goat“ bezeichnet. An derIdentifizierung des Kopfes als Kopf eines Widders kannjedoch kaum ein Zweifel bestehen. Vgl. Hogarth 1902,81 (Nr. 37): „The head seems to be that of a ram withcurling horns, and ears well marked“. Diese charakteristi-sche Gestaltung des Widdergehörns findet sich auch aufanderen Siegeldarstellungen, s. z. B. CMS II 7 Nr. 55;VI, 1 Nr. 177; VI, 2 Nr. 330; XII Nr. 136.
1 5 Auf die unterschiedlich gestaltete Formung der Hör-ner als entscheidendes Kriterium bei der Identifizierunggehörnter Vierfüßler beruft sich auch I. Pini. Seine aus-schließlich auf Darstellungen in Siegelbildern beruhendeKlassifizierung stimmt mit der hier getroffenen Unterschei-dung unmittelbar überein, s. Pini 1984, S. XXXVII–XXXVIII.
16 Eine ausführliche Behandlung dieses Bildthemas
bietet Sakellarakis 1972 mit Taf. 94–95. Eine erweiterteZusammenstellung der Belege findet sich bei Pini 2010,335 f. mit Abb. 11–12, die folgende Siegelbilder enthält:CMS I Nr. 220–222; II 3 Nr. 86. 117. 287; II 4 Nr. 35.111. 204; II 7 Nr. 23; III, 2 Nr. 359. 511; IV Nr. 307; VSuppl. 1A, Nr. 369; V Suppl. 3, 1 Nr. 38; VI, 2 Nr. 322–323; VIII Nr. 144; XII Nr. 239. 276a; XIII Nr. 5D. InEinzelfällen (so z. B. bei CMS IV Nr. 307) muss die Zuge-hörigkeit zu dieser Gruppe jedoch mit einem Fragezeichenversehen werden. Vgl. Krzyszkowska 2012, 743 mit Anm.30. 32. 34. Demgegenüber können der Liste von Pini auchnoch CMS II 3 Nr. 213 (s. Sakellarakis 1972, Taf. 94 ζ),CMS V Suppl. 1A, Nr. 130 (s. Jung 1997, 173 Anm. 263),CMS XI Nr. 119 (Wingerath 1995, 218 Anm. 385) undvermutlich CMS XIII Nr. 135 (Wingerath 1995, 218 Anm.385) hinzugefügt werden. Auf einen weiteren Beleg (Sakel-larakis – Sapouna-Sakellaraki 1997, 696 Abb. 797) hatmich F. Blakolmer dankeswerterweise hingewiesen. Einemit diesem Motiv unmittelbar vergleichbare Darstellunggeben CMS I Suppl. Nr. 180, XI Nr. 27 und Nr. 335wieder.
17 Sakellarakis 1972, 254–257; Jung 1997, 172–176 mit Anm. 263; Pini 2010, 335.
447
Jörg Weilhartner
wie die Darstellung eines Widders auf dem Siegelstein CMS I Nr. 221 (Abb. 12) – , ist bei einerReihe von Beispielen, die dasselbe Motiv aufweisen, eine sichere Entscheidung, welches Tier ge-tragen wird, nicht möglich18. Dementsprechend findet sich bei den betreffenden Bildbeschrei-bungen in den jeweiligen CMS-Bänden in diesen Fällen auch die summarische Angabe„Vierfüßler“ oder „Tier“19. Offensichtlich sollte bei diesen Siegelbildern primär die Anwesenheiteines Tieres im Rahmen einer rituellen Handlung zum Ausdruck gebracht werden, eine eindeuti-ge Zuweisung zu einer bestimmten Tiergattung ist hierbei vom Künstler – meines Erachtens be-wusst20 – nicht vorgenommen worden (Abb. 13). Um diesen Sachverhalt in die griechischeSprache zu übertragen: Bisweilen kam es dem Gemmenschneider darauf an, einen τράγος (Zie-genbock) oder einen κριός (Widder) unverkennbar darzustellen, in anderen Fällen beließ er esbei der Abbildung eines πρόβατον, eines nicht näher spezifizierten Kleinviehs.
Ein vergleichbares Phänomen einer nicht sicher vorzunehmenden Zuordenbarkeit zu einerbestimmten ‚Spezies‘ lässt sich mitunter auch bei der Darstellung von Personen beobachten.Zwar wird – wie eingangs ausgeführt – sowohl bei den Logogrammen der Linear B-Schrift alsauch bei zahlreichen Darstellungen durch die Angabe einer bestimmten Gewandtracht, physio-gnomischer Merkmale oder auch mittels der konventionellen Farbe des Inkarnats21 eine eindeuti-ge Geschlechtercharakterisierung gegeben, doch findet sich demgegenüber auch eine Reihe vonBildzeugnissen, bei der die Identifikation der betreffenden Person als Frau oder Mann beträchtli-che Schwierigkeiten bereitet. In der älteren Forschungsliteratur hat dieses Ausbleiben einer ein-deutigen Darstellungsweise häufig zu einer unkommentierten unterschiedlichen Beschreibung einund derselben Figur als Frau oder als Mann geführt22.
Um wiederum ein Beispiel aus der Glyptik herauszugreifen, sei auf einen Bildtypus verwie-sen, der eine Figur in knöchellangem, mit diagonal verlaufenden Borten verziertem Gewand zeigt(Abb. 14–15)23. Diese Figuren wurden von A. Evans sowohl als „long-robed priestly personage“als auch als „priest-kings and princes“ bezeichnet, in jedem Fall aber als „high Minoan dignitariesof the male sex“ gedeutet24. In weiterer Folge ist die Interpretation dieser Figuren als hohe Wür-denträger weiter tradiert worden, wobei lediglich darüber Uneinigkeit besteht, ob sie eher demkultischen oder eher dem weltlichen Bereich zuzuordnen sind25. Eine Identifizierung dieser Figu-ren als Männer wird in Evans’scher Tradition zumeist als sicher vorausgesetzt26.
Ausschlaggebend für diese Einschätzung scheinen die getragenen Gegenstände zu sein. Un-ter diesen befinden sich die ‚Syrische Axt‘ sowie ein hammerähnliches Objekt, die beide von
18 s. z. B. CMS II 3 Nr. 86; II 4 Nr. 111.19 Im Gegensatz zu der vorsichtig formulierten An-
gabe „Vierfüßler“ sind im Laufe der Forschungsgeschichtezum Teil auch recht abenteuerliche Identifizierungsvor-schläge wie „Kalb“ oder „Pferd“ für die Tiere dieses Bild-motivs gemacht worden, s. Sakellarakis 1972, 247 f.
20 Für gewöhnlich geht man jedoch davon aus, dassauch in jenen Fällen vom Siegelschneider ein bestimmtesTier dargestellt worden ist, in denen sich die exakte Be-stimmung dem heutigen Betrachter entzieht, s. z. B. Mül-ler 1995, 151 f. Zu dieser Problematik s. Morgan 1989,145 f.
2 1 Zur Inkarnatsfarbe als weitgehend zuverlässigem ge-schlechtsspezifischem Kriterium s. Blakolmer 1993.
22 Exemplarisch sei auf einen Siegelabdruck aus KatoZakros verwiesen (CMS II 7 Nr. 7). In den beiden Figuren,die lange über den Rücken fallendes Haar tragen und mitGürteln und kurzen ›Fellröcken‹ bekleidet sind, hat mansowohl Männer (z. B. Evans 1921, 434 f. mit Abb. 312b;CMS II 7, S. 11) als auch Frauen (z. B. Long 1974, 37;Otto 1987, 17 mit Abb. 11) erkannt. Nur selten wurde aufbeide Möglichkeiten der Geschlechterzuordnung verwie-
sen, s. z. B. Nilsson 1950, 157 mit Abb. 64; Niemeier1986, 78 f. Grundsätzlich ist anzumerken, dass lange Haar-tracht (wie auch das Tragen von Schmuck und langen Ge-wändern) kein geschlechtsspezifisches Merkmal darstellt.
23 CMS I Nr. 225; II 3 Nr. 147. 198; II 8, 1 Nr. 258;V Suppl. 1A, Nr. 345; VI, 2 Nr. 318–319. Die überwie-gende Anzahl dieser Darstellungen findet sich auf kreti-schen Siegelbildern, zwei Belege wurden in Tholosgräberndes Festlandes gefunden (Vapheio, Routsi). Eine Zusam-menstellung sämtlicher Belege gibt Younger 1995, 162–165 mit Taf. 54. Vgl. Younger 1989, Taf. 12, 62–66.Auf CMS I Nr. 223 ist eine unmittelbar vergleichbareFigur abgebildet, die einen Greifen an der Leine führt.Vgl. Rehak 1994.
24 Evans 1935, 397–414, bes. 404 und 412 f.25 Marinatos 1993, 127–133 mit Abb. 88 (priests);
Rehak 1994, 83 (top administrators); Rehak 1995, 110 f.(middle administrators); Davis 1995, 15–17 mit Taf. 6 b–h(priests ?); Koehl 1995, 29–31 (priests).
26 So in sämtlichen in Anm. 25 genannten Aufsätzen.Vgl. außerdem Rehak 2000, 44: „[…], apparently all male,[…]“.
448
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Evans dem männlich-militärischen Bereich zugewiesen wurden27. Eine geschlechtsspezifische Zu-ordnung dieser nicht so sehr als Kriegswerkzeuge als vielmehr als Statussymbole zu verstehendenGeräte28 scheint aber nicht gerechtfertigt. Die Doppelaxt, die in der Ikonographie als zentrales re-ligiöses Symbol in Erscheinung tritt, wird jedenfalls von Männern und Frauen getragen29. Darü-ber hinaus sind in der ägäischen Glyptik auch Darstellungen von schwerttragenden30 undbogenschießenden31 Frauen belegt. Demnach wird man das Tragen von Hammer und Axt nichtzwangsläufig als ausschließlich dem männlichen Bereich zugehörig ansehen dürfen. Ein weiteresArgument gegen die Annahme, die ‚Syrische Axt‘ als exklusives Symbol männlicher Priester zudeuten, ist in der Darstellung einer entsprechenden Klingenform als Anhänger in blauer Farbe ei-nes Armbandes einer möglicherweise göttlichen, in jedem Fall aber weiblichen Figur auf einemFresko aus dem Gebäudekomplex Xeste 3 in Akrotiri, Thera, zu sehen32.
Mitunter hat man bei zwei Belegen dieses Bildtypus die Darstellung eines Bartes erkennenwollen33, was sich jedoch bei genauerer Betrachtung nicht verifizieren lässt und für die Darstel-lung auf dem Siegelstein CMS I Nr. 225 bereits von Evans als unwahrscheinlich erachtet wordenist34. Diese Einschätzung teilt auch I. Pini, dessen Auf listung der vergleichsweise seltenen Dar-stellungen bärtiger Männer in ägäischen Bildwerken keine der betreffenden Personen enthält35.
Hartnäckig hält sich auch die Auffassung, dass das um den Körper und eine Schulter drap-ierte Kleidungsstück ausschließlich von Männern getragen werde36. Diese vermutlich aus dem sy-rischen Raum37 stammenden ‚Wickelkleider‘ sind jedoch auch als eine von Frauen getrageneTracht belegt, wie am deutlichsten die Darstellung eines ein Räuchergefäß tragenden Mädchensauf einem Fresko aus Thera und das nur fragmentarisch erhaltene Bild einer Frau in freier Naturauf einem Fresko aus Hagia Triada bezeugen38.
Für zumindest eine dieser Figuren (Abb. 16) hat J. Younger vorsichtig eine Deutung alsFrau in Erwägung gezogen, da sich seiner Meinung nach sowohl die Angabe eines unter dem lan-gen Gewand getragenen Leibchens als auch das figurbetonte Tragen des Gewandes bei Darstellun-gen wiederfinden, die eindeutig Frauen wiedergeben39. Diese Auffassung teilt auch N. Platon,der in dieser Figur „die Darstellung einer weiblichen Gestalt, vielleicht einer Priesterin“ er-kennt40. Wenn diese Einschätzung zutrifft, dann wäre der bislang als sicher vorausgesetzten Iden-tifizierung der Figuren dieses Bildtypus als Männer die Grundlage entzogen und das Geschlechtbei jeder einzelnen dieser Darstellungen neu zu beurteilen. Dies muss insbesondere für jeneFigur gelten, die einen Vogel in Händen hält (Abb. 17), da Vögel vor allem in Verbindung mit
27 Evans 1935, 413 f. Vgl. Marinatos 1993, 130.28 Rehak 1994, 80.29 s. z. B. CMS II 3 Nr. 8; II 6 Nr. 10; V Suppl. 3 Nr.
394.30 s. z. B. CMS II 3 Nr. 16. Zur möglichen Darstel-
lung von schwerttragenden Frauen in der mykenischenVasenmalerei s. Brecoulaki u. a. 2008, 378 mit Anm. 46.
3 1 s. z. B. CMS XI Nr. 26. 29. Eine Bogenschützin istwahrscheinlich auch auf zwei zusammenhängenden Fres-kofragmenten aus Pylos zu erkennen, s. Brecoulaki u. a.2008, bes. 376–378. Als Beispiel für einen männlichenBogenschützen sei exemplarisch auf den SiegelabdruckCMS II 6 Nr. 21 verwiesen.
32 Doumas 1992, 162 Abb. 125.33 Für CMS II 3 Nr. 147 s. z. B. Demargne 1946, 149;
Koehl 1995, 29 mit Taf. 12g; Wingerath 1995, 67. FürCMS I Nr. 225 s. z. B. Demargne 1946, 149 (hommebarbu [?]); Koehl 1995, 29 mit Taf. 12 f; Marinatos 1993,128 mit Abb. 88 c.
34 Evans 1935, 414.35 Pini 1999, 664 f. Vgl. Jung 1997, 161 Anm. 175.36 Schachermeyr 1964, 165: „Sicher kultischen Cha-
rakter hat eine fremdartige, lange Robe ohne Taille, dieausnahmslos von männlichen Gestalten getragen wird“.Vgl. Schachermeyr a. O. 166 Abb. 92. Ebenso Davis1995, 15: „But no such spirally-wound cloth is ever wornby a woman“.
37 Marinatos 1993, 127–130; Koehl 1995, 29–31.38 Fresko aus Thera: Doumas 1992, 56 f. Abb. 24–25.
Fresko aus Hagia Triada: Militello 1998, Taf. L. Ausführ-lich zu dieser Gewandtracht haben sich Long 1974, 61 f.und bes. Trnka 2000, 43–47 geäußert.
39 Younger 1995, 164 f. (Nr. 54) mit Anm. 14. Auchfür die im Relief relativ stark hervortretende Jochbein-Kie-fer-Partie lassen sich Vergleichsbeispiele eindeutig weibli-cher Figuren anführen, s. z. B. CMS I Nr. 279; XI Nr.27. Vgl. Pini 1999, 666 mit Taf. CXLII, g–i, der sich imHinblick auf das Geschlecht dieser Personen jedoch be-deckt hält.
40 CMS II 3, S. 232 (Nr. 198). I. Pini hat sich imselben Band auf S. LVIII gegen diese Interpretation ausge-sprochen, eine Auffassung, der sich Krzyszkowska 2005,138 f. mit Anm. 62 angeschlossen hat.
449
Jörg Weilhartner
weiblichen Figuren dargestellt werden41. In jedem Fall scheint einer Benennung dieses Bildthe-mas als „robed priests and priestesses group“ gegenüber der konventionellen Bezeichnung „robedpriests group“42 der Vorzug zu geben zu sein.
Die Frage, welches Geschlecht die Figuren dieses Bildtypus aufweisen, ist aber möglicher-weise eine, die sich dem Gemmenschneider so gar nicht gestellt hat. Wie F. Blakolmer jüngst ineinem Beitrag über Ethnizität und Identität in der minoisch-mykenischen Ikonographie hervorge-hoben hat, zeugen die im Allgemeinen beliebig ausgeführten Gesichtsdarstellungen „von einer ge-wissen Gleichgültigkeit der Bildkunst gegenüber dem konkreten Individuum“43. Entsprechendeiner wenig ausgeprägten Darstellung individueller Identitätsmerkmale lässt sich in der ägäischenBildsprache auch die Kenntlichmachung von Fremden nur in Ausnahmefällen feststellen44. Mög-licherweise hat sich diese generalisierende Art der Darstellung mitunter auch in einer fehlenden,weil im betreffenden Zusammenhang nicht relevanten, geschlechtlichen Differenzierung niederge-schlagen. Im Falle unseres Bildmotivs würde dies bedeuten, dass bei den betreffenden Figurennicht die Darstellung eines einzelnen männlichen oder weiblichen Individuums im Vordergrundsteht, sondern die Ausübung einer bestimmten (priesterlichen?) Funktion45. Die geschlechtsspezi-fische Klassifikation bliebe in diesem Zusammenhang ohne Belang.
Ein vergleichbarer Sachverhalt ist möglicherweise auch bei den logographischen Zeichender Linear A-Schrift zu beobachten. Denn während bei den Linear B-Logogrammen für Frauund Mann eine graphisch klar ersichtliche Unterscheidung auszumachen ist, lässt sich das entspre-chende Zeichen der Vorgängerschrift nicht in eine weibliche und eine männliche Variante unter-teilen, da es Charakteristika von beiden in sich trägt (Abb. 18): Die Angabe des Gewandes desLinear B-Logogramms für Frau und die typische Gestaltung der Beinstellung des Linear B-Logo-gramms für Mann finden sich mitunter in einem Linear A-Logogramm vereint46. Demzufolgehat sich J.-P. Olivier überzeugend dafür ausgesprochen, in diesem Zeichen das generelle Logo-gramm für Mensch zu erkennen47. Falls es im Rahmen der Linear A-Schrift tatsächlich nicht in-tendiert war, graphisch mittels eines Logogramms zwischen Frau und Mann zu unterscheiden,dann könnte auch dies auf eine im minoischen Kreta bestehende, allgemeinere Konzeption desmenschlichen Körpers hinweisen, bei der das Geschlecht keine vorrangige Rolle spielte.
Dem in zwei gegensätzlichen Geschlechtskategorien denkenden ‚modernen Menschen‘ be-reitet eine derartige Konzeption auf den ersten Blick einiges Kopfzerbrechen. Allerdings gilt eszu bedenken, dass dem seit der Aufklärung bis in die jüngste Vergangenheit vorherrschenden Mo-dell des radikalen Geschlechterdimorphismus eine Jahrtausende währende Auffassung vorausging,die in den männlichen und weiblichen Genitalien mehr oder weniger vollkommene Abstufungen
4 1 Younger 1998, 59 mit Anm. 189. Als Belege für dasMotiv ‚Mann mit Vogel‘ verweist Younger neben dembesagten Siegelstein lediglich auf einen Goldanhänger(aus dem sogenannten Ägina-Schatz), dessen Gesamter-scheinungsbild aber nicht ägäisch anmutet. Für das Motiv‚Frau mit Vogel‘ werden hingegen eine ganze Reihe vonBeispielen angeführt, so z. B. CMS I Nr. 233 und VII Nr.134. Vgl. auch Marinatos 1993, 155 f. Younger 1988, 153führt unter der Rubrik ‚Man & Birds‘ drei Belege an. IhreAussagekraft ist jedoch von nur eingeschränktem Wert:Das Geschlecht der menschlichen Gestalt auf dem Siegelab-druck aus Knossos (CMS II 8, 1 Nr. 257) lässt sich nichtmit Sicherheit bestimmen, auf dem Siegelabdruck aus Ha-gia Triada (CMS II 6 Nr. 122) findet sich entgegen derAngabe Youngers gar keine menschliche Figur. Bliebe alseinziger Beleg wiederum nur der besagte Siegelstein CMSVI, 2 Nr. 318. Unter diesen Voraussetzungen muss esüberraschen, dass die Identifizierung dieser Figur alsMann bislang noch nie hinterfragt worden ist. In diesem
Zusammenhang sei auf die bereits genannte weiblicheFigur auf einem Fresko aus Akrotiri, Thera, verwiesen, dieeine Halskette mit Anhängern in Form eines Vogels trägt, s.Doumas 1992, 163 Abb. 126. Ein mit der Darstellung aufCMS VI, 2 Nr. 318 vergleichbares Motiv könnte auf CMSII 3 Nr. 170 abgebildet sein, doch muss die Identifikationdes von einer eindeutig weiblichen Gestalt getragenen Ob-jekts als Vogel unsicher bleiben, s. CMS II 3, S. LVII. 205.Younger 1998, 10 Anm. 13 nimmt eine Identifizierung alsVogel als gesichert an.
42 Betts 1981, 5 mit Anm. 22; Younger 1995, 162 f.43 Blakolmer 2010, 37. Zur verallgemeinernden Wie-
dergabe menschlicher Köpfe auf ägäischen Siegelbildern s.auch Pini 1999.
44 Blakolmer – Weilhartner in Druck.45 Vgl. Wingerath 1995, 159.46 GORILA V, S. XLII–XLIII (A 100/102).47 Olivier 1983, 82 f. Vgl. Palaima 1988, 325.
450
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
ein und derselben Fortpflanzungsorgane gesehen hat und dementsprechend als ‚Ein-Geschlecht-Modell‘ bezeichnet worden ist48. In einer Vorstellungswelt, in der zwischen dem Weiblichen unddem Männlichen keine scharfe Trennlinie gelegt wurde und das körperliche Geschlecht keineKonstante, sondern eine Variable bildete49, könnte die fehlende eindeutige Angabe von Ge-schlechtsmerkmalen auch auf eine flexible Geschlechterzuordnung hinweisen50. In diesem Fallläge die Ursache für die Unsicherheit bei der Zuweisung einer Reihe von figuralen Darstellungenzu einem bestimmten Geschlecht nicht in einem mangelnden ikonographischen Verständnis desmodernen Betrachters, sondern in einem bewussten Verzicht des bronzezeitlichen Künstlers aufeine eindeutige geschlechtsspezifische Charakterisierung 51, bei der nicht nur die Grenzen deskörperlichen Geschlechts, sondern auch die des sozialen Geschlechts verschwimmen.
AbbildungsnachweisAbb. 1: Ausschnitt aus Tafel KN As(2) 1516.3 nach COMIK II, 148Abb. 2: Ausschnitt aus Tafel KN Ak(3) 783.1 nach COMIK I, 298Abb. 3: nach CMS II 8, 1 Nr. 236Abb. 4: nach CMS III 2 Nr. 351Abb. 5: Ausschnitt aus Tafel KN Dl(1) 463.A nach COMIK I, 167Abb. 6: Ausschnitt aus Tafel KN Ce 152.4 nach COMIK I, 69Abb. 7: Ausschnitt aus Tafel KN Ce 144.1 nach COMIK I, 65Abb. 8: nach CMS II 7 Nr. 144Abb. 9: nach CMS II 7 Nr. 141Abb. 10: nach CMS II 7 Nr. 145AAbb. 11: nach CMS II 7 Nr. 23Abb. 12: nach CMS I Nr. 221Abb. 13: nach CMS II 4 Nr. 111Abb. 14: nach CMS I Nr. 225Abb. 15: nach CMS II 8, 1 Nr. 258Abb. 16: nach CMS II 3 Nr. 198Abb. 17: nach CMS VI 2 Nr. 318Abb. 18: Ausschnitt aus Roundel HT(?) Wc 3022 nach GORILA V, 14
BibliographieAlberti 2002 B. Alberti, Gender and the Figurative Art of Late Bronze Age Knossos, in:
Y. Hamilakis (Hrsg.), Labyrinth Revisited. Rethinking ›Minoan‹ Archaeology(Oxford 2002) 98–117
Alexandri 2009 A. Alexandri, Envisioning Gender in Aegean Prehistory, in: K. Kopaka (Hrsg.),FYLO. Engendering Prehistoric ›Stratigraphies‹ in the Aegean and the Mediterra-nean. Proceedings of an International Conference, University of Crete, Rethym-no 2–5 June 2005 (Liège 2009) 19–24
Asher-Greve 1998 J. M. Asher-Greve, The Essential Body: Mesopotamian Conceptions of the Gen-dered Body, in: M. Wyke (Hrsg.), Gender and the Body in the Ancient Mediter-ranean (Oxford 1998) 8–37
48 Laqueur 1992, bes. 13–133. Auf S. 17 führt La-queur ein eindrucksvolles sprachliches Zeugnis für diesesModell an, indem er darauf verweist, dass es in der gesam-ten Antike keinen eigenen Begriff für die Eierstöcke gab,sondern diese stets mit den Wörtern für Hoden (ὄρχεις,δίδυμοι) bezeichnet worden sind.
49 In diesem Zusammenhang sei an die mythologischeFigur Teiresias erinnert, der von einem Mann in eine Frauund später wieder in einen Mann verwandelt worden ist.Vgl. Ov. met. 3, 316–338. Weitere Belege für ‚Ge-schlechtswechsel‘ in der antiken Literatur finden sich beiTalalay – Cullen 2002, 187.
50 Eine vergleichbare Vermutung hat Talalay 2000,8 f., in Zusammenhang mit Figurinen des griechischenNeolithikums angestellt, die keine primären Geschlechts-merkmale aufweisen: „Were the sexless images viewed astruly ‚neuter‘, transcending sexual classification altogether ?Or, were they seen as somehow subsuming both male andfemale sexes ? In the latter case, the image would not havebeen seen as actually sexless but rather as capable of mo-ving in and out of various sexual categories (e.g. male,female or dual)“.
5 1 Vgl. auch Alberti 2002; Alexandri 2009, 22.
451
Jörg Weilhartner
Betts 1981 J. H. Betts, The Seal from Shaft Grave Gamma: A ›Mycenaean Chieftain‹?, Tem-ple University Aegean Symposium 6, 1981, 2–8
Blakolmer 1993 F. Blakolmer, Überlegungen zur Inkarnatsfarbe in der frühägäischen Malerei,ÖJh 62, 1993, 5–18
Blakolmer 2010 F. Blakolmer, Ethnizität und Identität in der minoisch-mykenischen Ikonogra-phie, in: Proceedings of the International Conference ›The Phenomena of Cultu-ral Borders and Border Cultures across the Passage of Time (From the BronzeAge to Late Antiquity)‹, Trnava, 22–24 October 2010 (Trnava 2010) 29–40
Blakolmer – Weilhartner in Druck F. Blakolmer – J. Weilhartner, Eberzahnhelmträger und ke-se-nu-wo.Die Aussage der Bildkunst und der Linear B-Texte zu Identität und Fremden-bild in der ägäischen Frühzeit, in: A. Pülz – E. Trinkl (Hrsg.), Das Eigene unddas Fremde. Tagung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,26.–27. März 2012, Origines 4 (in Druck)
Brecoulaki u. a. 2008 H. Brecoulaki – C. Zaitoun – S. R. Stocker – J. L. Davis – A. G. Karydas –M. P. Colombini – U. Bartolucci, An Archer from the Palace of Nestor. A NewWall-Painting Fragment in the Chora Museum, Hesperia 77, 2008, 363–397
COMIK J. Chadwick u. a., Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos I–IV (Cam-bridge 1986–1998)
Davis 1995 E. N. Davis, Art and Politics in the Aegean. The Missing Ruler, in: P. Rehak(Hrsg.), The Role of the Ruler in the Prehistoric Aegean. Proceedings of a PanelDiscussion Presented at the Annual Meeting of the Archaeological Institute ofAmerica, New Orleans, Louisiana, 28 December 1992 (Liège 1995) 11–20
Deger-Jalkotzy 1999 S. Deger-Jalkotzy, Military Prowess and Social Status in Mycenaean Greece, in:R. Laffineur (Hrsg.), POLEMOS. Le contexte guerrier en Égée à l’âge du Bron-ze. Actes de la 7 e Rencontre égéenne internationale, Université de Liège, 14–17avril 1998 (Liège 1999) 121–131
Demargne 1946 P. Demargne, Un prêtre oriental sur une gemme Crétoise du MR I, BCH 70,1946, 148–153
Doumas 1992 C. Doumas, The Wall-Paintings of Thera (Athen 1992)Evans 1921 A. Evans, The Palace of Minos at Knossos I (London 1921)Evans 1935 A. Evans, The Palace of Minos at Knossos IV (London 1935)GORILA L. Godart – J.-P. Olivier, Recueil des inscriptions en linéaire A I–V (Paris
1976–1985)Hogarth 1902 D. G. Hogarth, The Zakro Sealings, JHS 22, 1902, 76–93Jung 1997 R. Jung, Menschenopferdarstellungen? Zur Analyse minoischer und mykeni-
scher Siegelbilder, PZ 72, 1997, 133–194Koehl 1995 R. B. Koehl, The Nature of Minoan Kingship, in: P. Rehak (Hrsg.), The Role of
the Ruler in the Prehistoric Aegean. Proceedings of a Panel Discussion Presen-ted at the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, New Or-leans, Louisiana, 28 December 1992 (Liège 1995) 23–36
Krzyszkowska 2005 O. Krzyszkowska, Aegean Seals. An Introduction (London 2005)Krzyszkowska 2012 O. Krzyszkowska, Worn to Impress ? Symbol and Status in Aegean Glyptic, in:
M.-L. Nosch – R. Laffineur (Hrsg.), KOSMOS. Jewellery, Adornment and Tex-tiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International AegeanConference, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation’sCentre for Textile Research, 21–26 April 2010 (Liège 2012) 739–747
Langdon 1999 S. Langdon, Figurines and Social Change. Visualizing Gender in Dark AgeGreece, in: N. L. Wicker – B. Arnold (Hrsg.), From the Ground Up: BeyondGender Theory in Archaeology. Proceedings of the Fifth Gender and Archaeolo-gy Conference, University of Wisconsin-Milwaukee, October 1998 (Oxford1999) 23–29
Laqueur 1992 T. Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter vonder Antike bis Freud (Frankfurt 1992)
Laser 1983 S. Laser, Medizin und Körperpflege, ArchHom S (Göttingen 1983)Lee 2000 M. M. Lee, Deciphering Gender in Minoan Dress, in: A. E. Rautman (Hrsg.),
Reading the Body. Representations and Remains in the Archaeological Record(Philadelphia 2000) 111–123
452
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Long 1974 C. R. Long, The Ayia Triadha Sarcophagus. A Study of Late Minoan and Myce-naean Funerary Practices and Beliefs (Göteborg 1974)
Marinatos 1993 N. Marinatos, Minoan Religion. Ritual, Image, and Symbol (Columbia 1993)Militello 1998 P. Militello, Haghia Triada I. Gli Affreschi (Padua 1998)Morgan 1988 L. Morgan, The Miniature Wall Paintings of Thera. A Study in Aegean Culture
and Iconography (Cambridge 1988)Morgan 1989 L. Morgan, Ambiguity and Interpretation, in: CMS Beih. 3 (Berlin 1989) 145–
161Müller 1995 W. Müller, Bildthemen mit Rind und Ziege auf den Weichsteinsiegeln Kretas.
Überlegungen zur Chronologie der spätminoischen Glyptik, in: CMS Beih. 5(Berlin 1995) 151–167
Neumann 1995 G. Neumann, Wertvorstellungen und Ideologie in den Personennamen der my-kenischen Griechen, AnzWien 131, 1994, 127–166
Niemeier 1986 W.-D. Niemeier, Zur Deutung des Thronraumes im Palast von Knossos, AM101, 1986, 63–95
Nilsson 1950 M. P. Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Reli-gion ²(Lund 1950)
Olivier 1983 J.-P. Olivier, Une rondelle d’argile d’Haghia Triada (?) avec un signe en LinéaireA, BCH 107, 1983, 75–84
Otto 1987 B. Otto, Minoische Bildsymbole, in: W. Schiering (Hrsg.), Kolloquium zurÄgäischen Vorgeschichte, Mannheim, 20.–22. 2.1986 (Mannheim 1987) 9–27
Palaima 1988 T. G. Palaima, The Development of the Mycenaean Writing System, in: J.-P. Olivier – T. G. Palaima (Hrsg.), Texts, Tablets and Scribes: Studies in Myce-naean Epigraphy and Economy in Honor of Emmett L. Bennett, Jr. (Salamanca1988) 269–342
Palaima 2005 T. G. Palaima, Mycenaean Ideograms and How They Are Used, in: M. Perna(Hrsg.), Studi in onore di Enrica Fiandra. Contributi di archeologia egea e vicin-orientale (Neapel 2005) 267–283
Pini 1984 I. Pini, Erörterung einzelner Gesichtspunkte, in: CMS II 3 (Berlin 1984) XXI–XLVII
Pini 1999 I. Pini, Minoische ›Porträts‹?, in: Ph. P. Betancourt – V. Karageorghis –R. Laffineur – W.-D. Niemeier (Hrsg.), Meletemata. Studies in Aegean Archaeo-logy Presented to Malcolm H. Wiener III (Liège 1999) 661–670
Pini 2010 I. Pini, Soft Stone versus Hard Stone Seals in Aegean Glyptic: Some Observa-tions on Style and Iconography, in: CMS Beih. 8 (Mainz 2010) 325–339
Rehak 1994 P. Rehak, The Aegean ›Priest‹ on CMS I.223, Kadmos 33, 1994, 76–84Rehak 1995 P. Rehak, Enthroned Figures in Aegean Art and the Function of the Mycenaean
Megaron, in: P. Rehak (Hrsg.), The Role of the Ruler in the Prehistoric Aegean.Proceedings of a Panel Discussion Presented at the Annual Meeting of the Ar-chaeological Institute of America, New Orleans, Louisiana, 28 December 1992(Liège 1995) 95–118
Rehak 1998 P. Rehak, The Construction of Gender in the Late Bronze Age Aegean Art. AProlegomenon, in: M. Casey – D. Donlon – J. Hope – S. Wellfare (Hrsg.), Re-defining Archaeology: Feminist Perspectives (Canberra 1998) 191–198
Rehak 2000 P. Rehak, Aegean ‘Priests’, JPrehistRel 14, 2000, 44–45Sakellarakis 1972 I. A. Sakellarakis, Τὸ θέμα τῆς φερούσης ζῶον γυναικὸς εἰς τὴν Κρητομυκη-
ναϊκὴν σφραγιδογλυφίαν, AEphem 1972, 245–258Sakellarakis – Sapouna-Sakellaraki 1997 Y. Sakellarakis – E. Sapouna-Sakellaraki, Archanes. Minoan Crete
in a New Light I–II (Athen 1997)Schachermeyr 1964 F. Schachermeyr, Die minoische Kultur des alten Kreta (Stuttgart 1964)Tamvaki 1989 A. Tamvaki, The Human Figure in the Aegean Glyptic of the Late Bronze Age:
Some Remarks, in: CMS Beih. 3 (Berlin 1989) 259–273Talalay 2000 L. E. Talalay, Archaeological Ms.conceptions. Contemplating Gender and
Power in the Greek Neolithic, in: M. Donald – L. Hurcombe (Hrsg.), Represen-tations of Gender from Prehistory to the Present (London 2000) 3–16
453
Jörg Weilhartner
Talalay – Cullen 2002 L. E. Talalay – T. Cullen, Sexual Ambiguity in Plank Figures from Bronze AgeCyprus, in: D. Bolger – N. Serwint (Hrsg.), Engendering Aphrodite. Womenand Society in Ancient Cyprus (Boston 2002) 181–195
Televantou 1990 C. A. Televantou, New Light on the West House Wall-Paintings, in: D. A. Har-dy (Hrsg.), Thera and the Aegean World III.1. Proceedings of the Third Interna-tional Congress, Santorini, Greece, 3–9 September 1989 (London 1990) 309–326
Trnka 2000 E. Trnka, Überlegungen zur ›Reizwirkung‹ der altägäischen Frauen- und Män-nertracht, in: F. Blakolmer (Hrsg.), Österreichische Forschungen zur ÄgäischenBronzezeit 1998. Akten der Tagung am Institut für Klassische Archäologie derUniversität Wien, 2.–3. Mai 1998 (Wien 2000) 39–50
Weilhartner 2012a J. Weilhartner, Die graphische Gestaltung der Tierlogogramme auf den Linear B-Tafeln, in: C. Reinholdt – W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 13. Österreichi-schen Archäologentages, Klassische und Frühägäische Archäologie, Paris-Lodron-Universität Salzburg, vom 25. bis 27. Februar 2010 (Wien 2012) 63–73
Weilhartner 2012b J. Weilhartner, Gender Dimorphism in the Linear A and Linear B Tablets, in:M.-L. Nosch – R. Laffineur (Hrsg.), KOSMOS. Jewellery, Adornment and Tex-tiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International AegeanConference, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation’sCentre for Textile Research, 21–26 April 2010 (Liège 2012) 287–296
Weingarten 1983 J. Weingarten, The Zakro Master and His Place in Prehistory (Göteborg 1983)Wingerath 1995 H. Wingerath, Studien zur Darstellung des Menschen in der minoischen Kunst
der älteren und jüngeren Palastzeit (Marburg 1995)Younger 1988 J. G. Younger, The Iconography of Late Minoan and Mycenaean Sealstones and
Finger Rings (Bristol 1988)Younger 1989 J. G. Younger, Bronze Age Aegean Seals in Their Middle Period (ca. 1725–
1550 B.C.), in: R. Laffineur (Hrsg.), Transition. Le Monde égéen du Bronzemoyen au Bronze récent. Actes de la deuxième Rencontre égéenne internationalde l’Université de Liège, 18–20 avril 1988 (Liège 1989) 53–64
Younger 1995 J. G. Younger, The Iconography of Rulership. A Conspectus, in: P. Rehak(Hrsg.), The Role of the Ruler in the Prehistoric Aegean. Proceedings of a PanelDiscussion Presented at the Annual Meeting of the Archaeological Institute ofAmerica, New Orleans, Louisiana, 28 December 1992 (Liège 1995) 151–211
Younger 1998 J. G. Younger, Music in the Aegean Bronze Age (Jonsered 1998)
454
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
Abb. 1: Linear B-Logogramm vir
(Mann)Abb. 2: Linear B-Logogrammmul (Frau)
Abb. 3: Darstellung eines Mannesauf einem Siegelabdruck aus Knos-sos
Abb. 4: Darstellung einer Frauauf einem Siegelstein aus Knossos
Abb. 5: Linear B-Lo-gogramm ovis (Schaf )
Abb. 6: Linear B-Lo-gogramm cap (Ziege)
Abb. 7: Linear B-Lo-gogramm bos (Rind)
Abb. 8: Darstellung eines Misch-wesens auf einem Siegelabdruckaus Kato Zakros
Abb. 9: Darstellung eines Misch-wesens auf einem Siegelabdruckaus Kato Zakros
Abb. 10: Darstellung eines Misch-wesens auf einem Siegelabdruckaus Kato Zakros
455
Jörg Weilhartner
Abb. 11: Darstellung einer ‚Pries-terin mit Ziegenbock‘ auf einemSiegelabdruck aus Kato Zakros
Abb. 12: Darstellung einer ‚Pries-terin mit Widder‘ auf einem Sie-gelstein aus Vapheio
Abb. 13: Darstellung einer ‚Pries-terin mit Vierfüßler‘ auf einemSiegelstein aus Knossos
Abb. 14: Darstellung einer Personmit langem Gewand auf einemSiegelstein aus Vapheio
Abb. 15: Darstellung einer Personmit langem Gewand auf einemSiegelabdruck aus Knossos
Abb. 16: Darstellung einer Personmit langem Gewand auf einemSiegelstein aus Vatheia
Abb. 17: Darstellung einer Personmit langem Gewand auf einemSiegelstein aus Knossos
Abb. 18: Linear A-LogogrammA100/102 (Mensch ?)
456
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern der ägäischen Bronzezeit
VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS FÜR ARCHÄOLOGIEDER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
BAND 11
Phoibos Verlag,Wien 2014
Gedruckt mit Unterstützung durch:Land Steiermark. Abteilung Wissenschaft und Gesundheit
Bibliografische Information Der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Bibliographic information published by Die Deutsche BibliothekDie Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie;detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.
Einband: Gipsmuseum des Instituts für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz; © Institutfür Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz. Photo: J. KraschitzerRedaktion: Hanne Maier
Copyright # 2014, Phoibos Verlag,Wien. All rights reservedwww.phoibos.at; [email protected] in the EUISBN 978-3-85161-114- 4
Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cristina-Georgeta Alexandrescu – Gerald Grabherr – Christian Gugl –
Barbara KainrathVom mittelkaiserzeitlichen Legionslager zur byzantinischen Grenzfestung: Die rumänisch-österreichischen Forschungen 2011 in Troesmis (Dobrudscha, RO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TomÆš Aluš�k – Anežka B. SosnovÆMöglichkeiten einer 3D-Rekonstruktion der Architektur und der Fundorte imminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Martin AuerDas „Atriumhaus“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Maria Aurenhammer – Georg A. PlattnerDer Eroten-/Satyrfries vom Theater in Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Claudia-Maria BehlingDer sog. Rundmühle auf der Spur – Zug um Zug zur Neudeutung römischer Radmuster . . . . 63
Fritz BlakolmerDas orientalische Bildmotiv der Gottheit auf dem Tier in der Ikonographie desminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Andrea CsaplÆros – Tina Neuhauser – Ott� SosztaritsDie Rolle des Isis-Heiligtums in Savaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nina Dornig
Eine archäologische Landschaft zur Römerzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Josef EitlerEine weitere Kirche des 6. Jahrhunderts am Gipfel des Hemmabergs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Claudia Ertl – Daniel Modl
Die Habsburger zwischen Antikenschwärmerei und Archäologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Nicole Fuchshuber – Franz Humer – Andreas Konecny – Mikulaš FenikEin Nekropolenbefund an der südlichen Peripherie von Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Robert F�rhacker – Anne-Kathrin KlatzDie Anwendung moderner Methoden der Konservierung und Restaurierung am Beispielarchäologischer Funde aus dem Laßnitztal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Monika Hinterhçller-KleinPerspektivische Darstellungsmodi in der Landschaftsmalerei des Vierten Stils und dieRekonstruktion des Freskenprogramms im Isistempel von Pompeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Denise Katzj�gerSpätantikes Wohnen auf Elephantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Doris KnausederÜberlegungen zu den kräftig profilierten Fibeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Johanna KçckRömische Zwischengoldgläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Andreas KonecnyDie Wasserversorgung der Zivilstadt Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5
Julia KopfIm Westen viel Neues … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Gabrielle KremerZur Wiederverwendung von Steindenkmälern in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Susanne LammZwischenland – Zur Grenze zwischen Noricum und Pannonien abseits des Wienerwaldes . . . 209
Felix Lang – Raimund Kastler – Thomas Wilfing – Wolfgang Wohlmayr
Die römischen Ziegelbrennöfen von Neumarkt-Pfongau I, Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Claudia Lang-AuingerRömische Tempelanlagen in griechischen Städten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Hannes LeharDem Ignis Languidus auf der Spur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Johann LeidenfrostDas Holzfass vom Magdalensberg und seine Rekonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Stephan LeitnerDie Römer im Oberen Vinschgau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Patrick Marko
Κἀπὶ Κυρβάντεσι χορεύσατε. Ein soziologischer Versuch zu veränderten Bewusstseins-zuständen in der Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Daniel Modl
Zum Stand der Experimentellen Archäologie in der Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Tina Neuhauser – Marina UgakovićEpetion (Stobreč, HR) – City wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Karl Oberhofer – FØlix TeichnerIm Schatten der Colonia Emerita Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Toshihiro Osada
Ist der Parthenonfries sinnbildlicher Ausdruck des athenischen Imperialismus ? . . . . . . . . . . . . 307
Lisa PeloschekFunktionell oder rituell ? Technologische Charakterisierung spätklassisch-hellenistischerKeramik aus der Nekropole von Aphendrika (Zypern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
RenØ PloyerUntersuchungen zur Besiedlung des südlichen Hausruckviertels (Oberösterreich) währendder römischen Kaiserzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Sven SchipporeitTriumphal- und Siegesdenkmäler außerhalb von Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
G�nther SchçrnerHäuser und Hauskulte im römischen Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Yvonne SeidelEx oriente ? – Zur Entstehung und Entwicklung von Beleuchtungsgeräteständern . . . . . . . . . . 353
Stephanie SitzFirmalampen des EVCARPVS. Produktion und Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Eva Steigberger – Barbara ToberDie Fallstudie des Heiligtums des Iuppiter Heliopolitanus in Carnuntum . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Karl StrobelNoreia – Atlantis der Berge ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
6
Inhaltsverzeichnis
Magdalena St�tzDen Gürtel um die Hüfte geschlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Attila Botond SzilasiWohlsdorf: The Bronze Age Settlement and the Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Ingrid Tamerl„Baccus fecit“ – Überlegungen zum Fassbinderhandwerk in der römischen Antike . . . . . . . . . 413
Susanne TiefengraberSt. Jakob am Mitterberg – Romanische Kirchenruine und frühe mittelalterliche Burgstelle . . 423
Barbara ToberDie Wandmalereien von Immurium-Moosham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Jçrg Weilhartner
Zur Darstellung von Mensch und Tier auf Linear B-Tafeln und Siegelbildern derägäischen Bronzezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Gudrun Wlach
Arnold Schober – Leben und Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Programm des Archäologentages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
7
Inhaltsverzeichnis