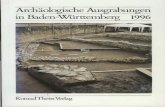Zum lettischen Ausdruckssystem
Transcript of Zum lettischen Ausdruckssystem
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM
Bohumil VYKYPĚL Universität Brno
RÉSUMÉ : Le présent article est une tentative de description du système d’expression de la langue lettone (sur un plan phonologique) selon les principes de la théorie glossématique. Sur cette base, des observations sont faites sur quelques aspects de cete théorie en général et sur sa relation à la phonologie. MOTS-CLÉS : Baltique ; Letton ; Linguistique ; Phonologie ; Glossématique.
ABSTRACT : In the present paper an attempt is made to describe the Latvian expression system (at phonological level) according to glossematic principles. On this basis a few observations are made concerning some aspects of the glossematic theory in general and its relationship to phonology. KEY WORDS : Baltic ; Latvian ; Linguistics ; Phonology ; Glossematics.
DIE BALTISCHEN Sprachen wurden immer überwiegend aus der historischen oder historisch-vergleichenden Sicht untersucht, und erst in der neuesten Zeit lässt sich ein deutlicher Zuwachs an Arbeiten beobachten, die sich mit dem Litauischen oder dem Lettischen (leider jedoch weniger mit dem Altpreußischen) vom synchronischen oder sprachtheoretischen Gesichtspunkt aus befassen (vgl. auch Heberlein 1998). Allerdings gab es auch früher Sprachwissenschaftler, die die baltischen Sprachen nicht als Objekt oder bloße Quelle verschiedentlicher indogermanistischer Rekonstruktionen betrachteten, sondern als Quelle von Beispielen für sprachtheoretische Ausführungen oder als Objekt synchronischer Beschreibungen. Einen wichtigen Platz in dieser « diskreten » Strömung in der Geschichte der Sprachwissenschaft nimmt der Begründer der glossematischen Sprachtheorie, Louis Hjelmslev ein. Das Interesse Hjelmslevs für die baltischen Sprachen und überhaupt für die baltischen Völker ist bekannt 1. Der längste Text, in dem Hjelmslev in der zweiten Hälfte der 30er Jahre seine Glossematik dem sprachwissenschaftlichen __________
1. Vgl. Hjelmslev (1922 ; 1930 ; 1932 ; 1946 ; 1956), Palionis (1978), Gregersen (1991, I, S. 174-177, 208-218), Rasmussen (1992, S. 3-4).
106 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
Publikum darzulegen versuchte, wurde eben einem baltistischen Problem gewidmet, und zwar der litauischen Prosodie (Hjelmslev 1936-1937). Das war damals der ganze Anfang in der Entwicklung von Hjelmslevs Sprachtheorie. Wir haben an einer anderen Stelle versucht, diese Theorie in ihrer endlichen (bekanntlich jedoch fragmentaren) Form auf die Beschreibung des litauischen Ausdruckssystems (oder — in der linguae communi der modernen Sprachwissenschaft — der Phonologie) anzuwenden (Vykypěl 2003a). Der Grund dafür war primär sozusagen intern sprachtheoretisch : Es war eine Reaktion auf eine grundlegende morphonologische Beschreibung des Litauischen (Hoskovec 2002), durch die sich eine gute Möglichkeit angeboten hatte, die Morphonologie und die glossematische Beschreibung des Ausdrucksplans zu vergleichen. Nun möchten wir zu unserer Beschreibung des litauischen Ausdruckssystems noch einen Abriss des lettischen Ausdruckssystems hinzufügen.
Zunächst sei allerdings an die bekannte Tatsache (wieder)erinnert, dass die glossematische Theorie ein Fragment darstellt und in ihren allen Aspekten nicht zu Ende geführt wurde. Damit hängt auch zusammen, dass es nur wenige und zudem nicht problemlose Beschreibungen einzelner Sprachen vom glossematischen Gesichtspunkt aus gibt. Trotzdem lässt sich vielleicht einiges sagen 2.
1. Zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Lettisch besteht keine Eins-zu-Eins-Beziehung, und sie müssen daher als zwei unterschiedliche Sprachen (Schemata) betrachtet werden. Im Folgenden wird das gesprochene Lettisch unter dem Lettischen verstanden.
1.1. Das Lettische hat sowohl analytische als auch synthetische Sätze (Lexeme und Nexus) und Satzgruppen (Lexien und Nexien) : Es hat teilbare Ausdruckseinheiten, die eine katalysierte Überkette (d.h. die in der Analyse unmittelbar vorangehende Einheit) alleine bilden können, und hat extense Ausdruckscharakteristiken (Modulation). Mit der Kategorie der extensen Ausdruckscharakteristiken werden wir uns hier nicht näher befassen : Die Beschreibung der lettischen Satzintonation in einer konsistenten und methodologisch bewussten Form ist noch zu erwarten.
__________
2. Wir werden die glossematischen Termini nicht definieren (ein « glossematisches Minimum » vorzutragen, wäre zwar vielleicht doch möglich, wenn auch schwierig, erscheint uns jedoch hier wenig sinnvoll) und verweisen in diesem Punkt auf die entsprechende Literatur (vgl. v.a. Hjelmslev 1973, S. 247-266 ; 1975). Das beste Buch über Hjelmslevs Sprachtheorie wurde von Michael Rasmussen (1992) geschrieben ; es hat leider einen für das allgemeinsprachwissenschaftliche Publikum wesentlichen Nachteil, und zwar, dass es auf dänisch verfasst worden ist…
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 107
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
Das Lettische hat auch analytische Silben (Syllabeme) und synthetische Silben : Es hat sowohl Einheiten, die in katalysierter Form alleine eine unkatalysierte Lexie im Ausdrucksplan bilden können, als auch intense Ausdruckscharakteristiken (Akzente).
Es bestehen zwei Möglichkeiten der Beschreibung der Kategorie der intensen Ausdruckscharakteristiken im Lettischen :
1° Die Kategorie wird in zwei Subkategorien geteilt : Die erste wird durch die sog. Akzente gebildet, die zweite durch die sog. Intonationen. Die erste Subkategorie wird von der zweiten selektiert (die zweite ist von der ersten syntagmatisch dependent). Die Subkategorie der « Akzente » hat zwei Glieder, die arbiträr « starker Akzent » (') und « schwacher Akzent » (°) genannt werden können 3 ; die Subkategorie der Intonationen hat drei Glieder, die arbiträr « gefallene Intonation » (`), « gedehnte Intonation » (~) und « gebrochene Intonation » (^) genannt werden können. Das System ist das folgende (auf der Dimension ‘steigend’ und negativ orientiert) :
α Α β Β γ
° ' ← ` ~ ^
Die sog. Intonationen selektieren die sog. Akzente, da die Akzente alleine
(d.h. ohne Intonation) stehen dürfen (und zwar der Akzent ' in den Silben mit einem sog. kurzen Vokal und ohne l, r, n, m), aber nicht umgekehrt. Der « schwacher Akzent » (°) ist intensiv, da in Verbindung mit ihm die Intonationen latent, d.h. synkretisiert und durch Null manifestiert werden. Das System der « Intonationen » ist nach der Substanz (nach der phonischen Manifestation) strukturiert, denn es bestehen hier keine Synkretismendominanzen.
2° Die zweite erwähnte Möglichkeit ist, die Kategorie nicht zu teilen und mit fünf Gliedern zu rechnen, die arbiträr als « starker Akzent » oder « Gravis » ('), « schwacher Akzent » (°), « gefallene Intonation » (`), « gedehnte Intonation » (~) und « gebrochene Intonation » (^) bezeichnet werden können. Das System ist das folgende (auf der Dimension « steigend » und negativ orientiert) :
__________
3. Dass der « Akzent » im Lettischen als Invariant registriert werden darf (trotz Hjelmslev, 1973, S. 189) oder « phonologisch distinktiv » ist, vgl. Sokols et al. (1959, S. 70), Mathiassen (1997, S. 36-37).
108 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
α Α β Β γ
° ' ` ~ ^
Der Grund gegen eine solche Verbindung der zwei Subkategorien, der im
Falle ihrer Entsprechungen im Litauischen angeführt werden kann, und zwar die Tatsache, dass derart die syntagmatische Beziehung zwischen ihnen nicht erfasst wird (vgl. Vykypěl 2003a, S. 162), gilt im Lettischen nicht unbedingt, denn man braucht hier die Koexistenz der « Akzente » und der « Intonationen » eigentlich gar nicht anzunehmen : Den Grund, weshalb diese Koexistenz im Litauischen vorauszusetzten ist, stellt die Tatsache dar, dass der Synkretismus der « Intonationen » in der Verbindung mit dem « schwachen Akzent » auflösbar ist (d.h. dass ein Element der Kategorie der « Intonationen » in die gegebene syntagmatische Beziehung eingeführt werden kann ; vgl. Hjelmslev 1973, S. 188, 204 ; Vykypěl 2003a, S. 161, 170). Im Lettischen ist dieser Synkretismus jedoch nicht auflösbar, und man braucht daher auch nicht, mit der Koexistenz der « Intonation » mit dem « schwachen Akzent » in einer Silbe rechnen.
Man kann allerdings folglich auch den « starken Akzent » oder « Gravis » streichen : Der « starke Akzent », der alleine steht (in den Silben mit einem sog. kurzen Vokal und ohne l, r, n, m), lässt sich als Varietät einer der « Intonationen » betrachten. Die Kategorie hätte somit nur vier Glieder (die « gefallene Intonation », die « gedehnte Intonation », die « gebrochene Intonation » und den « schwachen Akzent »), wobei der « starke Akzent » oder « Gravis » (arbiträr oder aufgrund seiner Manifestation) mit der « gedehnten Intonation » identifiziert oder genauer in ein einziges Element reduziert wird. Das System wäre das folgende (auf der Dimension « steigend » und negativ orientiert) :
β Β γ Γ
` ~ ^ °
Die phonologische Manifestation ist die folgende : die « gefallene
Intonation » (`) durch die Hervorhebung der ersten More ; die eine Varietät (positionelle Variante) der « gedehnten Intonation » (~) durch die Hervorhebung der zweiten More, die andere Varietät durch die Hervorhebung der einzigen More einer Einmoresilbe ; die Variationen (« freie Varianten »)
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 109
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
der « gebrochenen Intonation » (^) durch die Hervorhebung der beiden Moren oder der Grenze der Moren ; der « schwacher Akzent » (°) durch die Absenz der Hervorhebung (zur Beschreibung des lettischen Akzents und der Intonationen durch das gegenseitige Verhältnis der Moren vgl. Trubetzkoy 1939, S. 189, 215 ; Hoskovec 2002, S. 282).
1.1.1. Anders scheinen sich die Sachen im heutigen Standardlettisch zu verhalten. Hier gibt es zunächst nur zwei « Intonationen » (wie bekanntlich übrigens in den meisten lettischen Dialekten) : die « gedehnte » (~) und die « gefallene » (`) (vgl. Holst 2001, S. 59-61). Außerdem lässt sich hier ein Grund anführen, weshalb es mit zwei koexistierenden (in der syntagmatischen Beziehung zueinander stehenden) Subkategorien der intensen Ausdruckscharakteristiken zu rechnen ist : Die « gedehnte Intonation » (~) der « betonten » Silbe kann nicht in der Silbe stehen, nach der eine Silbe mit einem sog. langen Vokal oder mit einem Vokal und r, l, m, n folgt, und sie wird durch die « gefallene Intonation » ersetzt (vgl. Holst 2001, S. 72-73, 104). Dies kann in der Weise interpretiert werden, dass in der « folgenden » Silbe sich der « schwache Akzent » (º) und Synkretismus von ~ und ` befinden, wobei dieser Synkretismus den « Intonationswechsel » (~ ⇒ `) in der vorangehenden Silbe hervorruft ; mit anderen Worten kann ~ in der Verbindung mit dem « starken Akzent » (') nur auftreten, wenn in der folgenden Silbe º alleine steht. Folglich lässt sich ' nicht streichen, und das System sieht folgendermaßen aus (auf der Dimension « steigend » und positiv-negativ orientiert) :
α Α α Α
° ' ← ~ `
oder :
α Α
α ~ `
Α ° '
110 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
(horizontal « steigend » und positiv-negativ orientiert ; vertikal « punktuell » und negativ orientiert). (Das Element ~ ist deswegen intensiv, da es durch ` ersetzt werden kann.)
1.2. Die Ausdruckskonstituenten (-themative) bilden allgemein vier Kategorien : die selektierten (Vokale), die selektierenden (Konsonanten), diejenigen, die sowohl selektiert als auch selektierend sind (Sonanten), und diejenigen, die weder selektiert noch selektierend sind. In die vierte Kategorie gehören die Ausdruckselemente, die als Interjektionen dienen können, und man könnte hier vielleicht auch die Fremdelemente eingliedern, falls diese zum gegebenen Sprachbau gezählt werden dürfen (zum Letzten vgl. noch unten 1.2.3.).
1.2.1. Die Ausdruckskonstituenten, die sowohl selektiert als auch selektierend sind, sind im Lettischen zwei : i und u. Ihre vokalischen Varietäten werden durch die Phoneme / i / resp. / u / manifestiert, ihre konsonantischen Varietäten durch / j / und / v / (oder eher / w /). Bei der Registrierung werden die jeweiligen Varietäten in eine einzige Invariante im Lettischen sowohl aufgrund des Substanz- als auch aufgrund des Zeichenaspekts des Sprachgebrauchs reduziert (d.h. aufgrund ihrer phonologischen Nähe und aufgrund ihrer Positionen in Zeichen ; zur zweiten Reduktion vgl. kāvu « ich schlug » vs. kaut « schlagen », tevi « dich » vs. tev « dir », tvert « nehmen » vs. turēt « halten », klaja « offen (Gen. Sg. M.) » vs. klajš « offen (Nom. Sg. M.) », dzeja « Lyrik » vs. dzejnieks « Dichter » u.ä.).
Das System der Sonanten sieht somit folgend aus (auf der Dimension « vordere » und positiv orientiert) :
α Α
i u
Das Element i wäre deshalb intensiv, da vor ihm k und g variieren (vgl. unten 2.1.). (Vgl. noch unten 1.2.3.1.1.)
1.2.2. Die selektierten Ausdruckskontituenten sind drei : a, e, ®. Die übrigen Kandidaten auf Vokale lassen sich reduzieren. Die langen
Vokale können in Identitätsdiphtonge aufgelöst werden : ī ≡ ii, ū ≡ uu, ā ≡ aa, ē ≡ ee, | ≡ ®® (es besteht keine Kommutation zwischen den langen Vokalen und den entsprechenden Indentitätsdiphtongen ; dazu kommen auch morphonologische Gründe, vgl. Hjelmslev 1973, S. 198-200 ; Vykypěl 2003a,
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 111
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
S. 162-163, 167) 4. Die Größe ŏ kann als Signal für Fremdwörter und Variante von a betrachtet werden ; die Größe ō lässt sich dann zu ŏŏ reduzieren.
Auch ® ließe sich eventuell reduzieren, und zwar in ea. Dies würde jedoch die Komplikation in der Beschreibung sowohl des Zeichen- als auch des Substanzaspekts des Sprachgebrauchs mit sich bringen : Die Silbe mit | würde vier Vokale enthalten (eaea), und | würde vier Ausdruckselemente manifestieren, was beides sonst nicht vorkommt.
Die Vokale bilden folgendes System (auf der Dimension « offen » und positiv orientiert) :
β Β Γ
® e a
® ist intensiv, da es in manchen Fällen in e impliziert wird. Unter Einschluss von o sieht das System folgendermaßen aus (auf der Dimension « offen » und positiv orientiert) :
β Β γ Γ
® e o a
1.2.3. Auch die meisten Kanditaten auf Konsonanten lassen sich reduzieren. Die « palatalen » Konsonanten lassen sich in eine Verbindung eines
nichtpalatalen Konsonanten mit j auflösen : ņ ≡ nj, ļ ≡ lj, š ≡ sj, ž ≡ zj, ķ ≡ kj, g ≡ gj. Die sog. scharfen Affrikaten lassen sich in eine Verbindung von « Explosive » und « Sibilante » auflösen : c ≡ ts, 3 ≡ dz. Entsprechend lassen sich dann die sog. stumpfen Affrikaten auflösen : č ≡ tš ≡ tsj, 3Ù ≡ dž ≡ dzj. In eine Verbindung mit j können auch einige Konsonantengruppen aufgelöst
__________
4. Wenn die langen Vokale als Identitätsdiphtongen interpretiert werden, lassen sich weitere Zeichen anführen, aufgrund deren die Größen i und j sowie u und v in jeweils ein einziges Element reduziert werden können : vgl. līt ≡ liit ‘regnen’ vs. lija ≡ liia « es regnete », skūt ≡ skuut « ich rasiere » vs. skuvu ≡ skuuu « ich rasierte » u.ä. — Zu rein phonologischen Gründen für die Interpretation der langen Vokale als Identitätsdiphtonge vgl. Trubetzkoy (1939, S. 172).
112 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
werden : šņ ≡ snj, žņ ≡ znj, šļ ≡ slj, žļ ≡ zlj, ļņ ≡ lnj, ļķ ≡ lkj, ļg ≡ lgj, ņķ ≡ nkj, ņg ≡ ngj, šķ ≡ stj, zg ≡ zdj oder zgj.
Den Grund zu diesen Auflösungen stellt — ähnlich wie oben (1.2.2.) im Falle der langen Vokale — die Absenz der Kommutation dar zwischen den jeweiligen Größen und den Gruppen (komplexen Größen), in die diese aufgelöst werden (zu diesem Grundsatz vgl. Hjelmslev 1943, S. 62f. ; 1973, S. 217). Einen weiteren Grund kann die Vereinfachung der morphonologischen Alternationen darstellen, die allerdings nur teilweise ist (dazu vgl. unten 2.1.).
Die Größen f und x lassen sich als Signale für Fremdwörter und Varianten betrachten : f schließt Synkretismus mit p ein, x mit k oder mit Null 5. 1.2.3.1.1. Im Falle der Elemente m, n, r, l stellt sich die Frage, ob sie zu den Sonanten (1.2.1.) oder den Konsonanten einzugliedern sind, denn es wird manchmal mit ihren sog. silbischen Varianten gerechnet (vgl. iesms « Spieß », putns « Vogel », katrs « jeder », katls « Kessel »). Es gibt im Grunde drei Lösungen :
1º Die silbischen m, n, r, l werden als Manifestation der Verbindung von m, n, r, l mit einen Synkretismus aller Vokale interpretiert. Dagegen spricht jedoch, dass es nicht klar ist, unter welchen Bedingungen dieser Synkretismus eingeschlossen würde (es lassen sich dafür kaum rein im Ausdrucksplan wurzelnde Bedingungen finden).
2º Die silbischen m, n, r, l werden tatsächlich in die Kategorie der Sonanten eingegliedert, und zwar als Subkategorie, die sich von der Subkategorie von u und i dadurch unterscheidet, dass ihre Glieder sich ohne Vokal, u oder i nicht
__________
5. Es stellt sich natürlich eine allgemeine Frage, wie die sog. Fremdelemente zu bewerten sind. Im Allgemein ist ihr Status im Rahmen der Theorie Hjelmslevs nicht ganz klar, und zwar in zwei Hinsichten. Es ist nicht klar, wie sie festzustellen sind und ob sie zum gegebenen Sprachbau gehören oder nicht. Jens Holt (1964, S. 12-13 ; 1967, S. 63) spricht über einen Synkretismus zwischen Sprachen resp. ihren Teilen. Ein Synkretismus zwischen zwei Größen besteht, wenn die Kommutationsbeziehung zwischen diesen unter bestimmten Bedingungen suspendiert (aufgehoben) wird. Der Synkretismus, mit dem man im Falle der sog. Fremdelementen zu tun hat, besteht zwischen Elementen des einen Sprachbaus und Elementen des anderen Sprachbaus, und dieser Synkretismus wird durch die Beseitigung des Konnotatums « eine bestimmte Sprache » hervorgerufen. Im Falle der lettischen Konsonanten geht es um die Elemente f, x und h der anderen Sprachen und die Elemente p und k und die Null des lettischen Sprachbaus. Die Ergebnisse dieses Synkretismus sind als Varietäten (positionelle Varianten) der entsprechenden einheimischen Elemente in einer Verbindung mit dem Indikator der Fremdheit zu betrachten und werden durch die Phoneme / f / und / x / manifestiert. Wenn dieser Indikator beseitigt wird, wird der Synkretismus durch die entsprechenden einheimischen Elemente manifestiert — im Falle der lettischen Konsonanten durch / p /, / k / und die Null. Die Frage, die bleibt, ist diejenige, ob also die lettischen Größen f und x tatsächlich als Varianten zu interpretieren sind, d.h. immer in der Verbindung mit dem erwähnten Indikator stehen.
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 113
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
mit dem « starken Akzent » (') verbinden können, während dies bei der anderen Subkategorie der Sonanten möglich ist.
3º Die silbischen m, n, r, l werden gar nicht interpretiert als selektiert, d.h. als Kern eines Ausdrucksyntagmas, in dem eine intense Ausdruckscharakteristik enthalten ist ; d.h. m, n, r, l werden als Konsonanten aufgefasst. Es gibt nämlich eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass die Ausdrucksthemen wie ms oder sms in iesms den « schwachen Akzent » (º) enthalten. (Ähnlich Holst 2001, S. 48).
Die zweite Lösung ist vielleicht vom Gesichtspunkt der Beschreibung des Substanzaspekts des Sprachgebrauchs aus einfacher als die dritte : Wenn man m, n, r, l in die Kategorie der Sonanten eingliedert, wird die Beschreibung der Manifestation der « Intonationen » einfacher, denn es reicht zu kontatieren, dass die Intonationen sich an den Vokalen oder Sonanten manifestieren, während im Falle der Eingliederung von m, n, r, l in die Kategorie der Konsonanten sich die Intonationen an den Vokalen, Sonanten und einigen Konsonanten manifestiert hätten.
Vom operativen Gesichtspunkt aus kann die rhythmische Analyse über die Eingliederung von m, n, r, l entscheiden. Der Rhythmus (das Metrum) schreibt die Silben als Einheiten des Ausdrucksplans vor, und der Sprachgebrauch setzt in diese Einheiten diejenigen Elemente ein, die ihm der Sprachbau einzusetzen ermöglicht. Diese Elemente sind die intensen Ausdruckscharakteristiken und die Ausdruckskonstituenten. Unter diesen Konstituenten muss immer wenigstens ein Element aus der Kategorie der Vokale oder derjenigen der Sonanten sein. Man geht davon aus, dass die Anzahl der Silben im zu analysierenden Text (in der Kette) bekannt ist, und man muss darin auch die entsprechende Anzahl der Elemente wenigtens einer der beiden erwähnten Kategorien finden. In einigen Ketten stellt man fest, dass die Anzahl der Elemente, die die operative Definition des Vokals erfüllen, hinsichtlich der Anzahl der Silben ungenügend ist, aber zugleich die benötigte Anzahl durch die Elemente m, n, r oder l ergänzt werden kann. In anderen Ketten ist die Anzahl der Vokalen dagegen genügend, und zudem sind auch die Elemente m, n, r oder l darin enthalten. Wenn man beide Typen von Ketten findet, lässt sich sagen, dass m, n, r und l in die Kategorie der Sonanten gehören.
Die übrigen Elemente bilden das folgende System (horizontal « vordere » ; vertikal « stimmlos » ; beides positiv orientiert) :
114 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
β Β γ Γ
α p k t s
Α b g d z
Die Konsonanten t und d sind intensiv (auf der Dimension « vordere »), da sie im s vor t in der homosyllabischen Verbindung impliziert werden. Die Konsonaten s und z sind Γ, wodurch auch seine Manifestation durch frikative Phoneme erklärt werden kann, während die anderen Elemente dieser Kategorie durch Verschlussphoneme manifestiert werden.
Unter Einschluss von f und x würde das System folgendermaßen aussehen (auf denselben Dimensionen, wobei allerdings x nicht stimmhaft manifestiert wird und f nur potentiell Γ2 ist) :
β Β γ Γ Γ2
α p k t s f
Α b g d z x
Die stimmhaften Konsonanten ließen sich indessen in Verbindungen der
entsprechenden stimmlosen mit x auflösen und vor einem anderen stimmhaften als Varianten des entsprechenden stimmlosen Konsonanten betrachten. Die sog. Neutralisation der Stimmhaftigkeitskorrelation (vor einem stimmlosen Konsonanten) wäre als Manifestation der Latenz von x zu betrachten. Das System wäre dann das folgende (auf der Dimension « vordere » und positiv orientiert) :
β Β γ Γ Γ2
p k t s x
(Das Element x ist Γ2 wegen seiner vorderen und hinteren Varianten, d. h. x und ç.)
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 115
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
Gegen diese Reduktion kann allerdings derselbe Einwand erhoben werden wie gegen die Reduktion der litauischen ė und o in ee und ŏŏ (vgl. Vykypěl 2003a, S. 163) : Diese Reduktion würde eine Komplikation dahingehend mit sich bringen, das x alleine nur in Fremdwörtern enthalten ist, während es als Teil von Konsonantengruppen auch einheimische Zeichen bildet. Man müsste auch f in das System einschließen (horizontal « vordere » und positiv orientiert ; vertikal « Verschluss » und negativ orientiert) :
β Β γ
α f x s
Α p k t
2. Diesem Abriss des lettischen Ausdruckssystems fügen wir nun noch einige allgemeine Bemerkungen. 2.1. Eine der wichtigsten Eigenschaften der glossematischen Theorie stellt bekanntlich der Grundsatz dar, dass die Beschreibung sich nicht nach der Empirie im gewöhnlichen Sinne des Wortes richten soll, sondern nach dem Empirieprinzip, das lautet : Die Beschreibung soll widerspruchsfrei (konsistent), exhaustiv und möglichst einfach sein. Dies ist auch verständlich: Die glossematische Beschreibung will den Sprachbau (langue) erfassen, während die Empirie im gewöhlichen Sinne im Falle der Sprache dem Sprachgebrauch (parole) gleicht, der die Manifestation des Sprachbaus darstellt und den Sprachbau voraussetzt. Die Glossematik kann daher nicht auf dem Korrespondenzprinzip der Wahrheit (d.h. auf der Empirie im gewöhlichen Sinne) aufbauen, sondern sie muss den Kohärenzprinzip der Wahrheit (d.h. das Empirieprizip) befolgen. Nichtsdestoweniger muss der Sprachgebrauch auch im Rahmen der glossematischen Beschreibung einer einzelnen Sprache berücksichtigt werden. Diese Notwendigkeit der Berücksichtigung resultiert im Grunde aus zwei Tatsachen. Erstens kann man den Sprachbau nur durch den Sprachgebrauch erkennen, was einen außertheoretischen Grund darstellt. Zweitens muss die Beschreibung des Sprachbaus so gestaltet werden, dass der Übergang von dieser Beschreibung zu derjenigen des Sprachgebrauchs nicht kompliziert wird. Dies lässt sich als innertheoretischer Grund betrachten, denn die Einfachheit bildet einen Teil des Empirieprinzips. Hjelmslev hat die Einfachheit der Beschreibung vornehmlich als Einfachheit des resultierenden Elementeninventars aufgefasst, d.h. er wollte, dass die Anzahl der Elemente möglichst klein ist. Die Reduktion einer komplexen Größe in zwei bereits als Invarianten registrierten Größen kann jedoch eine Komplikation in
116 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
Kombinationsregeln der Elemente oder in ihren Manifestationsregeln mit sich bringen (wie wir es bereits oben § 1.2.2. gestreift haben) 6.
Instruktives Beispiel für die Komplikation in der Beschreibung des Zeichenaspekts des Sprachgebrauchs (d.h. in der Morphonologie oder der formalen Morphologie der Zeichen), die die zu große Reduktion der Anzahl von Elementen mit sich bringen kann, bietet eben das Lettische an. Oben (1.2.3.) haben wir einige konsonantische Größen in eine Verbindung anderer Größen mit j aufgelöst. Damit werden die morphonologischen Alternationen n ~ ņ ≡ nj, l ~ ļ ≡ lj, s ~ š ≡ sj, z ~ ž ≡ zj, c ≡ ts ~ č ≡ tsj, 3 ≡ dz ~ 3Ù ≡ dž ≡ dzj, st ~ sķ ≡ stj und die weiteren, die konsonantische Gruppen betreffen, mit den morphonologischen Alternationen p ~ pj, b ~ bj, m ~ mj, v ~ vj identifiziert : Beides lässt sich somit aus der Sicht der formalen Morphologie der Zeichen interpretieren als bloße Anfügung einer mit j beginnenden Endung (oder eines Suffixes) zum unveränderten Stamm. Es bleiben jedoch vier Alternationen, die in dieser Weise nicht identifiziert werden können : t ~ š ≡ sj, d ~ ž ≡ zj, k ~ c ≡ ts, g ~ 3 ≡ dz ; in diesem Falle muss mit einer Endung (oder einem Suffix) gerechnet werden, die eine Veränderung des Stamms hervoruft. Mit den oben vorausgesetzten Reduktionen der Anzahl von Konsonanten kommt man also zu einer Komplikation in der Beschreibung des Zeichenaspekts des Sprachgebrauchs : Die morphonologische, auf der Phonologie aufbauende Beschreibung konstatiert eine einzige Endung mit der Fähigkeit, den Stamm in einer bestimmten Weise zu verändern, während die glossematische Beschreibung mit drei Endungen rechnen muss — einer, die den Stamm verändert und mit j beginnt (t ~ š ≡ sj; d ~ ž ≡ zj), einer zweiten, die den Stamm verändert, aber nicht mit j beginnt (k ~ c ≡ ts, g ~ ≡ dz), und schließlich einer dritten, die den Stamm unverändert lässt und mit j beginnt (die übrigen Alternationen).
Unter Voraussetzung, dass ķ und g Varietäten von k und g vor i und e in einer homosyllabischen Verbindung darstellen 7 und vor a, u und i (bzw. ŏ) in eine Verbindung von k resp. g mit der vokalischen Variante von i aufgelöst werden, ließen sich diese Probleme teilweise mit einer alternativen Interpretation der betreffenden Größen lösen : Die Größen š, ž, c und 3 ließen sich in den einen Fällen in sj, zj, ts und dz auflösen, in den anderen dagegen in tj, dj, kj und gj (d.h. s ~ š ≡ sj vs. t ~ š ≡ tj; z ~ ž ≡ zj vs. d ~ ž ≡ dj ; c ≡ ts ~ č ≡ tš ≡ tsj vs. k ~ c ≡ kj ; 3 ≡ dz ~ 3Ù ≡ dž ≡ dzj vs. g ~ 3 ≡ gj). Man hätte hier somit mit einer Synonymie zwischen der Form und der Substanz im Ausdrucksplan zu tun, d.h. mit der Tatsache, dass eine und dieselbe Entität der
__________
6. Vgl. zum Gesagten Vykypěl (2003a, S. 172 ; 2003b, S. 79-81 ; 2004, § 2). 7. Vgl. zaķi ≡ za / ki « Hasen » vs. saki ≡ sak / i « du sagst ». Die Manifestation von k und g
in der homosyllabischen Verbindung mit i und e durch / k / resp, / g / stellt ein Signal für Fremdwörter dar (vgl. Sokols et al. 1959, S. 62).
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 117
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
Ausdruckssubstanz (hier die Phoneme / š /, / ž /, / c / und / 3 /) in verschiedenen syntagmatischen Beziehungen verschiedene Elemente der Ausdrucksform manifestiert 8. Offensichtlich würde jedoch diese alternative Lösung wiederum eine Komplikation in Manifestationsregeln mit sich bringen — eben dadurch, dass dieselben Elemente in verschiedenen Verbindungen verschieden manifestiert werden.
Was k und g angeht, so würde diese Lösung zudem auch eine weitere Komplikation in der Beschreibung der formalen Morphologie der Zeichen mit sich bringen : Bei den Verben, die in der 2. Person Singular Präsens die Nullendung resp. im Reflexiv -ies haben, die die Alternation von k und g hervorrufen, müsste man statt einer einzigen mit zwei Endungen rechnen, -ø und -j resp. im Reflexiv -ies und -jies (vgl. metu « ich werfe », met « du wirfst » vs. nāku ≡ naaku « ich komme », nāc ≡ naakj « du kommst »). Ebenso wären zwei Endungen statt einer bei den Wörtern wie zaķis und brālis vorauszusetzen : vgl. Nominativ Plural zaķi ≡ zakji « Hasen » vs. brāļi ≡ braalji « Brüder ».
2.2. Ein kurzer Schluss kann ähnlich wie früher sein (Vykypěl 2004, § 2). Für denjenigen, der sowohl mit der « subtantiellen » Phonologie als auch mit der streng glossematischen Beschreibung des Ausdrucksplans unzufrieden ist, bieten sich zwei Alternativen : Die eine besteht darin daß alle Aspekte der Einfachheit berücksichtigt werden 9, die andere in der syntagmatischen (morphonologischen) Klassifizierung des phonologischen Systems. Die zweite Alternative ist dabei noch umsomehr spannender, dass sie mit der Untersuchung der phonologischen Theorie von Vilém Mathesius verbunden werden kann, bekanntlich einer ungerecht fast vergessenen alternativen Richtung im Rahmen der klassischen Prager Phonologie.
reçu juin 2004 adresse de l’auteur :
Ústav pro jazyk český AV ČR etymologické oddělení Veverí 97 CZ-60200 Brno email : [email protected]
__________
8. Allgemein hierzu vgl. Hjelmslev (1959, S. 80 ; 1973, S. 198, 231). 9. Diesen Grundsatz findet man auch im phonologischen Meisterwerk von Josef Vachek
zum Tschechischen : Die möglichen Komplikationen der Elementenmanifestation und -kombination haben beispielsweise die Auflösung der langen Vokale in Identitätsdiphtonge bei gleichzeitiger Identifizierung von j und i verhindert, denn eine Ausdrucksform wie jí « er / sie / es isst » oder « ihr (Dativ) » würde zu / iii/ (vgl. Vachek, 1968, S. 44).
118 B. VYKYPĚL
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
LITERATURVERZEICHNIS
GREGERSEN, F. (1991). Sociolingvistikkens (u)mulighed. Videnskabshistoriske studier i Ferdinand de Saussures og Louis Hjelmslevs strukturalistiske sprogteorier, I-II. København, Tiderne Skifter.
HEBERLEIN, F. (1998). « Aufgaben einer synchronen komparativen Baltistik », Bammesberger, A. (Hrsg.), Baltistik : Aufgaben und Methoden, 331-344, Heidelberg,Winter.
HJELMSLEV, L. (1922). « Indtryk fra Litauen. I : Ydre linjer. II : Indre liv », Gads danske Magasin 16, 409-416 & 456-464.
HJELMSLEV, L. (1930). Det litauiske Folk og dets Sprog, København, Henrik Koppels Forlag.
HJELMSLEV, L. (1932). Études baltiques, Copenhague, Levin & Munksgaard. HJELMSLEV, L. (1936-1937). « Accent, intonation, quantité », Studi baltici 6, 1-57 [repr.
in Hjelmslev 1973, 181-222]. HJELMSLEV, L. (1943). Omkring sprogteoriens grundlæggelse, København,
Munksgaard. HJELMSLEV, L. (1946). « Estland, Letland og Litauen », Frit Danmark, 5, Nr. 19, 7 &
10-11. HJELMSLEV, L. (1956). « Études de phonétique dialectale dans le domaine letto-
lituanien », Scando-Slavica 2, 62-86. HJELMSLEV, L. (1959). Essais linguistiques, Copenhague, Travaux du Cercle
linguistique de Copenhague 12. HJELMSLEV, L. (1973). Essais linguistiques II, Copenhague, Travaux du Cercle
linguistique de Copenhague 14. HJELMSLEV, L. (1975). Résumé of a Theory of Language, Hrsg. von F. J. Whitfield,
Copenhague, Travaux du Cercle linguistique de Copenhague 16. HOLST, J. H. (2001). Lettische Grammatik, Hamburg, Buske. HOLT, J. (1964). Beiträge zur sprachlichen Inhaltsanalyse, Innsbruck, Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft. 21. HOLT, J. (1967). « Contribution à l’analyse fonctionelle du contenu linguistique »,
Togeby, K. (Hrsg.), La glossématique : L’héritage de Hjelmslev au Danemark, 59-69, Paris, Langages, 6, Juin 1967.
HOSKOVEC, T. (2002). « Fonologický inventár& a jeho morfonologické tr &ídění. Obecná metodologická rozvaha nad konkrétním materiálem jazyka litevského » [Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung. Eine allgemeine methodologische Überlegung anhand konkreten Materials aus dem Litauischen]. Slavia 71, 267-300.
MATHIASSEN, T. (1997). A Short Grammar of Latvian, Columbus, Slavica Publishers. PALIONIS, J. (1978). « L. Hjelmslevo lietuviški laiškai », Kalbotyra 29, 108-112. RASMUSSEN, M. (1992). Hjelmslevs sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk,
videnskabsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv, Odense, Odense Universitetsforlag [Studies in Scandinavian Languages and Literatures 25].
ZUM LETTISCHEN AUSDRUCKSSYSTEM 119
Histoire Épistémologie Langage 26/II (2004) : 105-119 © SHESL
SOKOLS, E. et al. (1959). Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika, I, Rīga, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība.
TRUBETZKOY, N. S. (1939). Grundzüge der Phonologie, Prague, Travaux du Cercle linguistique de Prague, 7.
VACHEK, J. (1968). Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny [Die Dynamik des phonologischen Systems des gegenwärtigen Schrifttschechisch], Praha, Academia [Studie a práce lingvistické 8].
VYKYPĚL, B. (2003a). « Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung (einige Bemerkungen) », Acta linguistica Lithuanica 48, 159-175.
VYKYPĚL, B. (2003b). « Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute (mit Beispielen aus dem Obersorbischen) », Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 51, 57-82.
VYKYPĚL, B. (2004). « Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems », Bayer, M. ; Betsch, M. ; Blaszczak, J. (Hrsg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7, München (im Druck), Otto Sagner.