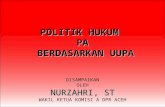Wirtschaft und Politik in der Schweiz
Transcript of Wirtschaft und Politik in der Schweiz
©(2005) Swiss Political Science Review 11(3): 141-203
Debatte: Wirtschaft und Politik in der Schweiz
Die schweizerische Wirtschafts- und Fiskalpolitik im internationalen Vergleich1
Klaus Armingeon, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern; E-Mail: [email protected]
Probleme
Die Schweiz hat ein eigentümliches wirtschaftliches Leistungsprofil. Im Ver-gleich mit anderen etablierten Demokratien der OECD-Ländergruppe weist sie seit mehr als einem Vierteljahrhundert ein rekordniedriges Wirtschaftswachs-tum auf. In der Folge rutschte sie von einer früheren Spitzenposition auf der Rangliste des Inlandsprodukts pro Kopf (in Kaufkraftparitäten) im Jahr 2003 auf den 5. Platz ab. Mit 32‘500 USD p.c. liegt sie hinter Irland, Norwegen, den Vereinigten Staaten und Luxemburg. Der Abstand zu den acht nachfolgenden Ländern ist gering. Belgien, Island, das Vereinigte Königreich, Australien, Nie-derlande, Kanada, Oesterreich und Dänemark haben ein kaufkraftbereinigtes Inlandsprodukt p.c. das mindestens 90% des schweizerischen Wertes beträgt. Häufig wird darauf hingewiesen, diese Zahlen zeichneten das Bild zu dunkel (siehe jüngst: Kohli 2005; Rich 2005). Zum einen würden die Verbesserungen der Handelsbedingungen (terms of trade) nicht sachlich richtig – als Vorteile tech-nologischen Fortschritts – statistisch bei der Berechnung der Wachstumsindices erfasst. Und viel besser sehe es ohnehin aus, wenn man sich nicht auf das Brut-toinlandsprodukt (also im Wesentlichen das im Land entstandene Einkommen) stütze, sondern auf das Bruttosozialprodukt (Bruttonationaleinkommen), also
1 Dieser Beitrag dient als Einleitung zu der nachstehend dokumentierten Debatte. Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen unterlag er aufgrund seines summarischen Charakters nicht dem Begutachtungsverfahren. Die verwendeten Daten zur ökonomischen Variablen stammen von der OECD (www.oecd.org). Als Herausgeber bin ich dem Gutachter dankbar, der mit einer Ausnahme alle der folgenden Analysen evaluiert hat und wichtige Anregungen zur Verbesserung gegeben hat.
142 DEBATTE
des von Inländern in der Schweiz und im Ausland erzielten Einkommens. Die Differenz kommt zustande, weil Inländer – vor allem durch ihre Vermögens- anlagen – im Ausland beträchtliches Einkommen erwirtschaften. Unter Ge-sichtspunkten des Erfolges nationaler Wirtschaftspolitik ist dies allerdings ein schwacher Trost. Für Schweizer sind offensichtlich die Bedingungen im Aus-land Einkommenssteigerungen zu erzielen, ceteris paribus besser als im Lande selbst. Und zur Beurteilung der Erfolge der nationalen Wirtschaftspolitik taugt das Inlandsprodukt besser als das Bruttosozialprodukt, das auch im schweizeri-schen Falle in starkem Masse Erfolge und Niederlagen der Wirtschaftspolitik des Auslandes widerspiegelt.
Eine häufige Fehlwahrnehmung in der öffentlichen Debatte bezieht sich auf die Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Unternehmen auf dem Welt-markt. Die Schweiz spielt keineswegs im internationalen Handel von Gütern und Dienstleistungen an vorderster Front mit. Andere kleine, weltmarktoffene Länder – wie Luxemburg, Irland, Niederlande, Belgien, Oesterreich – exportie-ren und importieren sehr viel mehr Güter und Dienstleistungen (gemessen in Einheiten des Sozialprodukts, 2000-2002) als dies die Schweiz tut. Es gibt zwar auch andere kleine Nationen, die einen ähnlich bescheidenen Aussenhandel wie die Schweiz haben. Dies gilt für Dänemark, Norwegen, Finnland, Island und Neuseeland. Aber das im Inland gerne kolportierte Bild der Eidgenossen, die auf ausländischen Güter- und Dienstleistungsmärkten nahezu unschlagbar sind, ist ein Wunschtraum. Damit einher geht eine starke Asymmetrie zur EU, dem wichtigsten Wirtschaftspartner. Im Jahr 2003 gingen 60% des schweizerischen Exports in die EU, während nur 7% des EU Exports in der Schweiz landete. Das Wohl und Wehe der schweizerischen Wirtschaft hängt im beträchtlichen Aus-mass von der EU-Oekonomie und deren wirtschaftspolitischen Akteuren ab, während die Bedeutung der Schweizer Wirtschaft für die EU sich einer quantité négligeable annähert.
Erfolge
Auf der Habenseite sind im internationalen Vergleich sicherlich der Arbeits-markt, das System der Arbeitsbeziehungen, das wohlfahrtsstaatliche System und seine Finanzierung sowie die erfolgreiche Geld- und Fiskalpolitik zu ver-buchen. Mit 4.5% war im Jahr 2004 die für den internationalen Vergleich stan-dardisierte Arbeitslosenquote niedrig. Aehnlich gute Werte wiesen acht OECD-Länder auf (Oesterreich, Irland, Japan, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und das Vereinigte Königreich). Nur Neuseeland und Korea hatten eine ger-ingere Arbeitslosigkeit. Mit ihrer Erwerbsquote ist die Schweiz zusammen mit Island im Jahr 2004 Klassenbester. Die Frauenerwerbsquote ist hoch und wird nur noch von jener in den nordeuropäischen Ländern übertroffen. Im Gegen-
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 143
satz zu Nordeuropa geht jedoch dieser hohe Frauenanteil sehr stark auf eine deutlich überdurchschnittliche Ausbreitung der Teilzeitarbeit zurück. Die Früh-verrentung mit ihren katastrophalen Folgen für das Sozialstaatsbudget ist viel schwächer ausgeprägt als in den Nachbarländern (Ebbinghaus 2000; Ebbing-haus 2001). Das System der Arbeitsbeziehungen ist durch ein vergleichsweise geringes Streikniveau und eine Dominanz sozialpartnerschaftlicher Orientie-rungen geprägt. Der Wohlfahrtsstaat ist im Moment noch finanzierbar und er richtet grosszügige Leistungen an seine Klienten aus. Entlastend ist in dieser Hinsicht, dass 20% der Bevölkerung und 25% der Erwerbstätigen Ausländer sind. Diese Bevölkerungsgruppe hat bezüglich der Beiträge und Leistungen des Wohlfahrtsstaates eine günstigere demographische Zusammensetzung. Dies ändert sich, wenn eine wachsende Zahl von Ausländern ihr ganzes Erwerbs-leben in der Schweiz verbringt und damit Ansprüche auf volle Altersrenten erwirbt. Ebenso problematisch könnte sich eine Angleichung der Ausländer-fertilität an jene der Schweizer Bevölkerung auswirken. Die Nationalbank hat wie in den vergangenen Jahrzehnten eine Geldpolitik betrieben, die sich kon-sequent und erfolgreich am Ziel der Preisstabilität orientiert. Ihr wurde zwar von Gewerkschaften und Sozialdemokratie vorgeworfen, die restriktive Politik der 1990er Jahre hätte den Aufschwung abgewürgt, bevor er überhaupt hätte beginnen können. Aber in ihrer preisstabilitätsorientierten Politik kann sich die SNB wahrscheinlich auf eine Mehrheit der Bevölkerung stützen, wie man dies anhand der einschlägigen Abstimmungsergebnisse erkennen kann. Die Steuer-belastung ist noch immer gering. Die OECD berichtet, Steuern und Abgaben im engeren Sinne (dazu zählen beispielsweise nicht die Beiträge zur Zweiten Säule) hätten in der Schweiz im Jahr 2005 35% des Inlandsprodukts betragen. Derart niedrige Werte konnten nur noch die USA, Korea, Japan und Irland aufweisen. Norwegen und Schweden haben hingegen eine Fiskalquote von ca. 60%. Die Defizite der öffentlichen Haushalte sind vergleichsweise gering. Sie betrugen im Durchschnitt der Jahre 1996-2005 gerade 0.5%. Der Schuldenstand wird seit 2002 auf einem Niveau von 55% konsolidiert. In ökonomischer Perspektive sind sowohl Defizit und insbesondere Schuldenstand weit von Idealwerten entfernt. Aber im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern sind diese schlechten Werte noch immer sehr gut.
Gefahren
Auf dieses positive Bild fallen allerdings einige Schatten: Die Arbeitslosigkeit ist anfangs der 1990er Jahre auf das heutige Niveau angestiegen und es gelang der Schweizer Arbeitsmarktpolitik nicht, die Arbeitslosenquote nachhaltig wieder nach unten zu drücken. Die Erwerbsquote der Männer zwischen 55 und 64 Jahren ist seit 1990 um 10 Prozentpunkte gefallen. Dies wirkte sich bei
144 DEBATTE
der Gesamterwerbsquote nicht aus, weil gleichzeitig die Erwerbsquote älterer Frauen im selben Masse gestiegen ist. Auch in der Schweiz zeigen sich somit Hinweise auf eine bedenkliche Lösung von Arbeitsmarktproblemen durch die zunehmende Frühverrentung von Männern (vgl. die Besprechung des Buches von David Dorn durch Bernhard Ebbinghaus in dieser Ausgabe). Der koope-rative Charakter der Arbeitsbeziehungen schwächte sich in den vergangenen fünf Jahren ab. Auf Seiten der Unternehmer wurde teilweise weniger Wert auf (kostspielige) Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gelegt (Mach 2004). Die grossen Gewerkschaften leiden unter Mitgliederschwund. Sie versuchen die finanziellen und politischen Folgen durch Organisationsreformen zu min- dern und führen zunehmend Arbeitskämpfe durch. Eine geringere Konzessions-bereitschaft der Unternehmer dürfte nur ein Grund für diesen Strategiewandel sein. Daneben sind vielleicht die Gewerkschaften zu Medieninszenierungen gezwungen, um ihre Nützlichkeit für Arbeitnehmer zu kommunizieren. Diese neuen Strategien sind umso wichtiger, je mehr die klassischen Arbeitnehmer-milieus mit ihren sozialisierenden Funktionen zerfallen. Und schliesslich wird der bisherige Korporatismus auch geschwächt, weil der Staat die Sozialpartner-verbände weniger als in der Vergangenheit in die Formulierung öffentlicher Politiken einbezieht (Sciarini, Nicolet et al. 2002; Häusermann, Mach et al. 2004). Dramatisch sind schliesslich die Veränderungen im Bereich des Wohlfahrts-staates. In der OECD-Welt ist die Schweiz Spitzenreiterin bei den Zuwächsen der Sozialausgaben (% BIP). Der Anteil der Sozialausgaben stieg von 14 (1980) auf 26% des Bruttoinlandsprodukt (2001). Daran sind Leistungsausdehnungen nur teilweise schuld. Das Wachstum des Quotienten von Sozialausgaben und Bruttoinlandsprodukt (BIP) geht auch auf den geringen Zuwachs des Nenners, also des BIP, zurück. Der Sozialausgabenanteil wäre fast um die Hälfte geringer ausgefallen, wenn nur das BIP in einem Ausmasse zugenommen hätte, wie das im OECD Durchschnitt in dieser Periode der Fall gewesen ist (Armingeon 2001). Auch dieser Befund deutet auf das fehlende Wirtschaftswachstum als zentrale Herausforderung der schweizerischen Wirtschaftspolitik hin. Wird sie nicht bewältigt, werden ceteris paribus die Erfolge im Bereich der Fiskal- und Sozialpolitik ebenso wenig zu halten sein wie ein überdurchschnittlicher Platz in der Rangreihe des wirtschaftlichen Reichtums.
Was kann Wirtschaftspolitik tun und erreichen?
Welche politischen Ursachen für solche wirtschaftlichen Probleme, Erfolge und Gefahren gibt es? Die vergleichende Politikwissenschaft hat hierzu in den vergangenen Jahren eine Reihe von Befunden zusammengetragen. Einige besonders interessante Ergebnisse können folgendermassen zusammengefasst werden:
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 145
(1) Die Steuerungschancen des politischen Systems gegenüber dem ökono-mischen System werden systematisch überschätzt, weil in der Regel die Politik nur inkrementale Veränderungen zuwege bringt und weil die politische Intervention in die Wirtschaft häufig aufgrund deren Eigenlogik scheitert. Unter Normalbedin-gungen eines stabilen politischen Systems können unterschiedliche Institutionen, Personen oder Parteien nur inkrementale Veränderungen bewirken (Pierson 1994; Rose und Davies 1994; Schmidt 2005). Langfristig wirken sich zwar Kurswechsel um nur zwei Grad substantiell aus – man erreicht von Europa kommend nicht Florida, sondern Kuba – aber kurzfristig sind zwischen zwei Wahlterminen grosse Verände-rungen aufgrund der Pfadabhängigkeit von staatlichen Politiken kaum realisierbar. Und selbst wenn der Politik ein grosser Wurf gelänge, bedeutet dies noch nicht, dass er auch die gewünschte Wirkung hat. So haben beispielsweise die britischen Unternehmer teilweise die Gewerkschaftsreformen von Frau Thatcher unterlaufen, weil diese etablierte betriebliche Arbeitsbeziehungen zerstörten (Marsh 1992).
(2) Eine wichtige Implikation dieses Befundes ist die Bedeutung früher Entschei-dungen. Hat man sich einmal – ohne grosse Chancen auf Antizipation der Folgen in ferner Zukunft – in einer Entscheidungsphase zugunsten eines sozialpolitischen Modells entschieden, kann man sich nicht umstandslos davon verabschieden (Pier-son 2000). Freilich können sich dramatische Dynamiken ergeben, wenn weitge-hend reformresistente Institutionen in der gewandelten Umwelt fortbestehen. Ein Beispiel ist die schweizerische AHV, die kaum ein Finanzierungsproblem kennen würde, wenn die Lebenserwartung und das wirtschaftliche Wachstum seit ihrer Einrichtung annähernd gleich geblieben wären.
(3) Diese Pfadabhängigkeit bedeutet für politische Parteien, dass sie viel weni-ger erreichen können, als sie im Parteienwettbewerb beanspruchen (Schmidt 2002). Weder haben sie die Option, einen umfangreichen Wohlfahrtsstaat weitgehend abzubauen (Kitschelt 2001; Obinger und Kittel 2004), noch können sie sich Hoff-nungen machen, kurzfristig Arbeitslosigkeit zu beseitigen (Armingeon 2003). Die Logik des Parteienwettbewerbs zwingt sie jedoch dauernd zu weitreichenden Ver-sprechungen, die sie nach dem Stand unseres Wissens kaum erfüllen können.
(4) Institutionen machen einen Unterschied für die Wirtschaftspolitik, jedoch erheblich differenzierter, als die Intuition nahe legt: So liefern eine Reihe von Ana- lysen Hinweise, dass Mehrheitsdemokratien nicht besser als Konkordanz- demokratien geeignet sind, wirtschaftspolitische Strukturreformen durchzufüh- ren. Ebenso liegen recht robuste Befunde vor, dass korporatistische oder konkor-danzdemokratische Länder kein geringeres Wirtschaftswachstum verzeichnen, als Wettbewerbsdemokratien und Nationen mit pluralistischen Staat-Verbände-Beziehungen (Lijphart 1999; Armingeon 2002). Vetopunkte wie starke Gliedsta-aten (Braun 2003; Cusack und Fuchs 2003), unabhängige Nationalbanken (und die direkte Demokratie) korrelieren häufig mit einem fiskalisch schlanken Zentral-staat.
146 DEBATTE
(5) Für das wirtschaftliche Wachstum ergibt sich der erstaunliche Befund, dass in der Regel Politik nicht wichtig ist. Der robusteste politisch-institutionelle Indikator ist die Garantie von Eigentumsrechten. Der robusteste ökonomische Indikator ist der wirtschaftliche Reichtum zu Beginn des Beobachtungszeitrau-mes. Je höher das Sozialprodukt zu Beginn einer Untersuchungsperiode ist, desto geringer sind seine nachfolgenden Wachstumsraten (Sala-i-Martin 2002; Obinger 2004).
(6) Die ökonomischen Wirkungen von Wirtschafts- und Sozialpolitiken sind hochgradig kontextabhängig (Hall und Soskice 2001). Ein umfangreicher Sozi-alstaat ist beispielsweise systematisch nicht wachstums- und beschäftigungs-feindlicher als ein schlanker Wohlfahrtsstaat. Grosszügige passive Arbeits-marktpolitiken haben nicht durchgängig die verhängnisvollen Beschäftigungs-wirkungen, die ein einfaches ökonomisches Modell unterstellt. Aktive Arbeits-marktpolitik erhöht nur unter bestimmten Bedingungen die Beschäftigung. So wurde kürzlich gezeigt, dass die kontinentaleuropäische Sozialpolitik mit ihrem Schwergewicht auf den beitragsfinanzierten Sozialwerken beschäftigungs-feindlich ist, weil sie die Schaffung von Arbeitsplätzen für schlecht Qualifizierte erschwert. Aber umgekehrt hat der umfangreiche nordeuropäische Sozialstaat nicht diese Effekte, weil er sich stärker über Steuern finanziert und Beschäfti-gung im öffentlichen Sektor schafft (Scharpf 2000). Wendet man diese Befunde auf die Schweiz an, so sind die in der Oeffentlich-keit häufig erhobenen Vorwürfe gegen Konkordanz, Korporatismus, direkte Demokratie und Föderalismus gegenstandslos. Ein beträchtlicher Teil des ge-ringen Wachstums wäre als Ausdruck eines kaum vermeidbaren Konvergenz-prozesses hin auf ein einheitliches Niveau wirtschaftlichen Reichtums zu ver-stehen. Dem schwach ausgebildeten Parteienwettbewerb wäre das Ausbleiben von Strukturreformen nicht anzulasten. Ein Hauptproblem der schweizerischen Wirtschaftspolitik bestünde nicht in der Variation einer einzelnen Politik oder eines Sets von Politiken, sondern vielmehr in einer effizienten Konzertierung von Institutionen und Politiken.
Die Beiträge zu der Debatte
Was im Allgemeinen für die OECD-Länder gilt, muss nicht notwendigerweise für die Schweiz gelten. Der prominente Basler Oekonom Silvio Borner und seine Mitarbeiter betrachten die Schweiz als System sui generis, das sich gegen einen Vergleich mit anderen etablierten Demokratien sperre. Sie vertreten zusammen mit anderen Wirtschaftswissenschaftlern, wie Walter Wittmann, seit längerer Zeit die These, die ökonomischen Probleme der Schweiz liessen sich auf die Wirkung von politischen Institutionen zurückführen. Dazu gehören die direkte Demokratie und die Konkordanz.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 147
Die in diesem Heft dokumentierte Debatte wurde durch einen Beitrag von Hans Peter Fagagnini ausgelöst, den er der Redaktion zum Abdruck anbot. Er argumentiert, die wirtschaftlichen Probleme der Schweiz seien zu einem beträchtlichen Teil durch institutionell abgestützte und verstärkte Fehlentschei-dungen der Wirtschaftseliten verursacht, die unter anderem die Politik für ihre kurzfristigen Interessen instrumentalisiert hätten. Fagagnini nimmt damit eine Gegenposition zur These von Borner und Mitarbeitern ein. Ich habe daraufhin eine Reihe von Politikwissenschaftler und Oekonomen gebeten, mit einer kurzen pointierten Stellungnahme auf der Basis der eigenen einschlägigen Forschung einen Beitrag beizusteuern. Als Fragestellung gab ich vor, ob und wie politische Institutionen oder politische Kräfteverhältnisse die wirtschaftlichen Problemen der Schweiz verursacht oder verstärkt haben. Damit sich die Beiträge aufein-ander beziehen können, bat ich eines der drei folgenden Probleme zu behan-deln: Das geringe Wirtschaftswachstum, die Hysteresis der Arbeitslosigkeit auf international niedrigem Niveau oder die Finanzierungsdefizite der Sozialwerke. Es wurde klargemacht, dass keine umfassenden und differenzierten Analysen erwartet werden. Vielmehr ging es um eine kurze pointierte Stellungnahme, in der ein zentraler Punkt deutlich zu machen sei.
Den Beginn der Auseinandersetzung markieren die konträren Beiträge von Bodmer/Borner und Fagagnini. Die Oekonomen Feld und Schaltegger weisen in ihrer Analyse auf die ökonomischen Vorteile von direkter Demokratie (Inno-vation, breite Legitimation staatlichen Handelns), Föderalismus (z.B. Kantone als Labors für innovative Lösungen) und Konkordanz hin (zuverlässige, nach-haltige und wenig durch Partikularinteressen geprägte Politik). Gebhard Kirch-gässner behandelt den Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschafts-wachstum. Er argumentiert, die beobachteten hohen kantonalen Staatsquoten seien nicht wachstumsfeindlich. Vielmehr könnten reiche Kantone mit hohem Wirtschaftswachstum ihren Bürgern mehr Leistungen bieten und hätten trotz-dem eine geringere Staatsquote als einkommensschwächere Kantone mit gerin-gem Wachstum. Zu einem gegensätzlichen Befund kommen Jan-Erik Lane und Dominic Rohner. Sie argumentieren, die wachsende Belastung der Bürger mit Steuern und Sozialabgaben seien die Ursachen des geringen wirtschaftlichen Wachstums. Den politischen Institutionen seien keine wachstumsfeindlichen Effekte anzulasten. In diesem Punkt treffen sie sich mit Georg Lutz und Thomas Votruba. Die Autoren untersuchen, ob der Vorwurf berechtigt ist, die direkte Demokratie wirke wirtschaftsfeindlich. Sie haben hierzu das Abstimmungsver-halten der Bürger untersucht und finden, die Bürger stimmten meist wirtschafts-freundlich ab. Rita Nikolai geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie man die positive Arbeitsmarktperformanz trotz geringem Wachstum erklären könne. Sie hebt drei Punkte hervor: Die hohe Flexibilität des Arbeitsmarktes, das beschäfti-gungsfreundliche sozial- und fiskalpolitische Klima und der Ausbau der aktiven
148 DEBATTE
Arbeitsmarktpolitik. Herbert Obinger weist in seiner Analyse darauf hin, dass die Wachstumsraten der Schweiz recht gut den Vorhersagen der neoklassischen Wachstumstheorie entsprechen. Institutionen wie direkte Demokratie, Födera-lismus oder Konkordanz wären nicht die Ursache der Wachstumsschwäche. Mehr spricht – ebenso wie bei Lane und Rohner – für politische Fehlentschei-dungen. Die Chance zur Korrektur solcher Fehlentscheidungen sei in der Schweiz besonders hoch, weil hier die institutionellen Voraussetzungen für einen verhandelten Wandel der Wirtschaftspolitik besonders gut seien.
An dieser Debatte sind mehrere Ergebnisse interessant. Unter anderem fällt auf, dass das Lager der Oekonomen in der Ursachenanalyse genauso wenig kohärent ist, wie jenes der Politikwissenschaftler. Und zum zweiten fällt die Konvergenz von methodischen Zugängen trotz beachtlicher methodischer Unterschiede auf. Die Vorgehensweisen der Oekonomen bei der Analyse des konkreten Falles der Schweiz unterscheiden sich kaum von jenen der Poli-tologen, obwohl die letzteren den Fokus auf politische Variablen legen und die Wirtschafswissenschaftler sich eher auf ökonomische Grössen konzentrie- ren. Diese internen Unterschiedlichkeiten der Argumente der Fachwissen-schaften und die methodischen Aehnlichkeiten zwischen den beiden beteiligten Disziplinen könnten selbstverständlich einen Selektionseffekt darstellen, weil sich nur jene an dieser Diskussion beteiligt haben dürften, die vermuten, dass sich beide mit wirtschaftspolitischen Problemen beschäftigten Disziplinen etwas zu sagen haben. Dass tatsächlich die wechselseitige Wahrnehmung von Argu-menten vorteilhaft ist, zeigt meines Erachtens auch diese Debatte. Vielleicht sind solche Konfrontationen von Befunden unterschiedlicher Disziplinen intellek-tuell ergiebiger, als dem immer wieder nachdrücklich vorgetragenen politischen Wunsch nach Interdisziplinarität nebst Synergieeffekten mit Lippenbekenntnis-sen nachzukommen. In der Praxis zeigt sich, dass diese Interdisziplinarität in den je unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Kreisen mit ihren spezifischen Erfolgs- und Reputationskriterien kaum zu verwirklichen ist. Viel mehr scheint es etwas zu bringen, wenn man mit Interesse, Lernbereitschaft und Skepsis Analysen aus den Nachbardisziplinen rezipiert. Dies gilt für die Politikwissen-schaft. Aber auch für die Oekonomie.
Bibliographie
Armingeon, Klaus (2001). ”Institutionalising the Swiss Welfare State”, in Jan-Erik Lane (Hrsg.). The Swiss Labyrinth. Institutions, Outcomes and Redesign. (Special Issue West European Politics, Vol. 24, April 2001). London: Frank Cass, pp. 145-168.
Armingeon, Klaus (2002). ”The Effects of Negotiation Democracy. A Comparative Analysis”, European Journal of Political Research 41(1): 81-105.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 149
Armingeon, Klaus (2003). ”Die Politische Oekonomie der Arbeitslosigkeit”, in Herbert Obinger, Uwe Wagschal und Bernhard Kittel (Hrsg.). Politische Oekonomie. Demokratie und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Opladen: Leske und Budrich, S. 151-174.
Braun, Dietmar (2003). Fiscal Policies in Federal States. Aldershot: Ashgate.
Cusack, Thomas R. und Susanne Fuchs (2003). ”Parteien, Institutionen und Staatsausgaben”, in Herbert Obinger, Uwe Wagschal und Bernhard Kittel (Hrsg.). Politische Oekonomie. Demokratie und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Opladen: Leske und Budrich, S. 321-354.
Ebbinghaus, Bernhard (2000). ”Any Way Out of 'Exit from Work'? Reversing the Entrenched Pathways of Early Retirement”, in Fritz W. Scharpf and Vivien A. Schmidt (eds.). Welfare and Work in the Open Economy. Volume II. Diverse Responses to Common Challenges. Oxford: Oxford University Press, pp. 511-553.
Ebbinghaus, Bernhard (2001). ”When labour and capital collude. The political economy of early retirement in Europe, Japan and the USA”, in Bernhard Ebbinghaus und Philip Manow (Hrsg.). Comparing Welfare Capitalism. London, New York: Routledge, pp. 76-101.
Häusermann, Silija, André Mach and Yannis Papadopoulos (2004). ”From Corporatism to Partisan Politics: Social Policy Making under Strain in Switzerland”, Swiss Political Science Review 10(2): pp. 33-59.
Kitschelt, Herbert (2001). ”Partisan Competition and Welfare State Retrenchment. When Do Politicians Choose Unpopular Policies?” in Paul Pierson (ed.). The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, pp. 265-302.
Lijphart, Arend (1999): Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.
Mach, André (2004). La Suisse entre internationalisation et changement politiques internes. La legislation sur les cartels et les relations industrielles dans les années 1990. Basel: Helbing und Lichtenhahn.
Marsh, David (1992). The New Politics of British Trade Unionism. Union Power and the Thatcher Legacy. Houndsmill, London: Macmillan.
Obinger, Herbert (2004). Politik und Wirtschaftswachstum. Ein internationaler Vergleich. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Obinger, Herbert und Bernhard Kittel (2004). ”Parteien, Institutionen und Wohlfahrtsstaat. Politisch-institutionelle Determinanten der Sozialpolitik in OECD-Ländern”, in Herbert Obinger, Uwe Wagschal und Bernhard Kittel (Hrsg.). Politische Oekonomie. Demokratie und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Opladen: Leske und Budrich, pp. 355-384.
Pierson, Paul (1994). Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press.
Pierson, Paul (2000). ”Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, American Political Science Review 94(2): 251-267.
Rich, Georg (2005). ”Die Schweizer Wirtschaft wächst schneller, als es scheint. ‘Zusatzverdienst‘ im Ausland und Reformdruck im Inland”, Neue Zürcher Zeitung 226(152): 31.
Rose, Richard and Phillip L. Davies (1994). Inheritance in Public Policy: Change without Choice in Britain. New Haven, London: Yale University Press.
Scharpf, Fritz W. (2000). ”Economic Changes, Vulnerabilities, and Institutional Capabilities”, in Fritz W. Scharpf and Vivien A. Schmidt (eds.). Welfare and Work in the Open Economy. Volume I. From Vulnerability to Competitiveness. Oxford: Oxford University Press, pp. 21-124.
150 DEBATTE
Schmidt, Manfred G. (2002). ”The Impact of Political Parties, Constitutional Structures and Veto Players on Public Policy”, in Hans Keman (ed.). Comparative Democratic Politics. A Guide to Contemporary Theory and Research. London: Sage, pp. 166-184.
Schmidt, Manfred G. (2005). ”Politische Reformen und Demokratie. Befunde der vergleichenden Demokratie- und Staatstätigskeitsforschung”, in Hans Vorländer (Hrsg.). Politische Reform in der Demokratie. Baden-Baden: Nomos, S. 45-62.
Sciarini, Pascal, Sarah Nicolet et Alex Fischer (2002). ”L‘impact de l‘internationalisation sur le processus du décision en Suisse”, Revue Suisse de Science Politique 8(3/4): 1-34.
Ist die direkte Demokratie mitschuldig an der wirtschaftlichen Stagna-tion der Schweiz?
Frank Bodmer, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel; E-Mail: [email protected] Silvio Borner, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel; E-Mail: [email protected]
1 Einleitung
Die Schweiz stagniert. Seit Beginn der 90er Jahre konnte praktisch kein Wachstum erzielt werden. Die Schweiz liegt damit im Vergleich zu den anderen OECD-Län-dern weit abgeschlagen auf dem letzten Platz, noch deutlich hinter Deutschland und Japan, über deren Krisen schon viel geschrieben wurde.1 Gleichzeitig stiegen die Staats- und die Fiskalquote markant an. Während für die 90er Jahre die Krise allgemein sicht- und spürbar ist, so liegen ihre Wurzeln bereits in der Phase nach der ersten Erdölkrise von 1974.
Worauf ist diese Wachstumsschwäche nun zurückzuführen? Grundsätzlich gibt es nur drei Erklärungsmöglichkeiten: erstens könnte es sich um Pech in Gestalt von exogenen Angebots- oder Nachfrageschocks gehandelt haben, zweitens um wachstumsfeindliche Verhaltensänderungen von Unternehmen und Arbeitnehm-ern oder schliesslich drittens um falsche Weichenstellungen in der Wirtschafts-politik. Die erste Möglichkeit können wir ausschliessen, scheint die Schweiz
1 Seit der kürzlichen Revision der Zahlen für das Bruttoinlandprodukt ist auch klar geworden, dass die Wachstumsschwäche nicht nur scheinbar ist und auf mögliche Daten-probleme zurückgeht. Für eine Übersicht zur Entwicklung der schweizerischen Volks-wirtschaft, siehe Borner und Bodmer (2004).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 151
über verbesserte Terms-of-Trade doch eher vom Globalisierungs-Glück profitiert zu haben. Die fehlende Dynamik als zweiter möglicher Grund kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Dem steht aber die eindrückliche Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Exportwirtschaft gegenüber, welche solche kulturellen Er-klärungsfaktoren allein als ungenügend erscheinen lässt. Es verbleibt damit die Wirtschaftspolitik als Hauptverdächtiger. Mit der Wirtschaftspolitik geraten auch direkte Demokratie und Volksentscheide in die Kritik, hat das Volk als Souverän doch praktisch immer das letzte Wort und ist damit (mit-)verantwortlich.In Bezug auf die Wirtschaftspolitik stehen wir eigentlich vor einem Rätsel. Die empirische Forschung hat nämlich in einer inzwischen sehr langen Reihe von Arbeiten gezeigt, dass die direkte Demokratie auf kantonalem Niveau zu mehr Wachstum, weniger Staatsausgaben, tieferen Steuern, weniger Verschuldung, besserer Steuermoral und ganz allgemein zu grösserem Glück führt.2 Diese Resultate und die Tatsache, dass die Schweiz auf nationalem Niveau über soviel direkte Demokratie verfügt wie kein anderes Land, passen natürlich schlecht zur wirtschaftlichen Stagnation und zur steigenden Steuer- und Abgabenlast. Erstens stellt sich deshalb die Frage, ob die Kantonsvergleiche überhaupt auf die natio-nale Politik und die nationalen Probleme übertragen werden können. Aus unserer Sicht gibt es viele und gute Gründe, weshalb dies nicht der Fall ist.3 Zweitens muss untersucht werden, ob und wie die direkte Demokratie auf nationalem Niveau einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik haben könnte.
Wir werden uns im folgenden auf grundsätzliche Überlegungen und nicht auf statistische Resultate stützen. Einerseits ist die Schweiz international ein Sonder-fall, womit internationale Vergleiche entfallen. Andere statistische Methoden, wie das Auszählen von Volksentscheiden, scheinen uns ebenfalls wenig geeignet, die Auswirkungen der direkten Demokratie auf die wirtschaftliche Entwicklung fest-zustellen.4 Dagegen gibt es Fallbeispiele, welche auf einen negativen Einfluss der direkten Demokratie hinweisen. Zu nennen sind vor allem die negativen Volks-
2 Diese Literatur arbeitet mit der interkantonalen oder intermunizipalen Variation an direkter Demokratie. Zu Einkommensniveau und Wachstum, siehe Feld und Savioz (1997) und Vatter und Freitag (2001). Zu öffentlichen Finanzen, siehe z.B. Feld und Kirchgässner (2001); zu Steuermoral, siehe z.B. Feld und Frey (2001); zu Glück, siehe z.B. und Stutzer und Frey (2000).
3 Dabei ist einerseits zu beachten, dass die Probleme auf nationalem Niveau anders sind als auf kantonalem Niveau. Andererseits ist es möglich, dass die Resultate bezüglich kantonaler Entwicklung nicht so robust sind, wie es den Anschein hat. Zu öffentlichen Finanzen, siehe Fischer (2004) und Bodmer (2004); zu Wachstum, siehe Bodmer (2005).
4 Lutz und Votruba (2005) haben kürzlich vorgeschlagen, die Anzahl der Überein-stimmungen zwischen Abstimmungsresultaten und FDP-Parolen als Indikator für die Wirt-schaftsverträglichkeit der direkten Demokratie zu verwenden. Grundproblem dieses Ansatzes ist das fehlende Gewicht, das einzelnen Abstimmungen beigemessen wird. Die Religionsartikel sind für das Wachstum ja nicht von derselben Bedeutung wie ein EWR-Beitritt oder die Liberalisierung des Strommarktes.
152 DEBATTE
entscheide zu EWR-Beitritt und zur Strommarktliberalisierung. Der Einfluss der direkten Demokratie beschränkt sich aber nicht auf einzelne Volksentscheide, sondern wirkt sich auch über die Ausbildung und Funktionsweise der übrigen politischen Institutionen (wie Parlament und Regierung) aus. Dazu kommen noch die Vorauswirkungen von potenziellen Referenden, welche den politischen Pro-zess wesentlich mitbestimmen.
2 Zur Qualität der Entscheidungen in der direkten Demokratie
Es wird oft davon ausgegangen, dass die direkte Demokratie zu Entscheidun-gen führt, die den Präferenzen der Wähler besser entsprechen als Entscheide von Parlamenten. Dies scheint auf der Hand zu liegen, haben die Stimmbürger dank ihrer Volksrechte doch mehr Einflussmöglichkeiten auf das Verhalten der gewählten Politiker. Formal lässt sich dies in einem Modell eines Politi- kers zeigen, der seine eigenen Interessen verfolgt, soweit dies seine Wiederwahl-chancen nicht zu sehr beeinträchtigt.5 Wahlen finden nur alle vier Jahre statt, und während dieser Zeit kann ein Politiker auch Ziele verfolgen, die nicht im eigent-lichen Interesse seiner Wähler liegen. Gründe dafür sind - abgesehen von einem kurzen Gedächtnis der Wähler - Schwierigkeiten, das Verhalten von Politikern genau zu verfolgen und die Auswirkungen des Verhaltens der Politiker richtig einzuschätzen.
Auch wenn dieses Principal-Agent-Argument akzeptiert wird, folgt daraus allerdings noch nicht, dass die Gesamtheit der Entscheidungen in der direkten Demokratie näher an den Präferenzen der Stimmbürger liegt.6 Was nämlich oft übersehen wird, ist die Unmöglichkeit, individuelle Präferenzen in fairer und konsistenter Weise zu sozialen Präferenzen zu aggregieren. Dieses Problem ist unter dem Namen Condorcet-Paradox bekannt und wurde von Arrow (1963) und einer Reihe von weiteren Ökonomen formal bewiesen. Die Konsequenzen dieser Unmöglichkeit sind tiefgreifend, können doch Volksentscheide nicht mehr ein-fach mit dem ”Volkswillen” gleichgesetzt werden.7 In der Praxis heisst dies unter anderem, dass die Reihenfolge von Abstimmungen oder andere taktische Anord-nungen einen Einfluss auf das Resultat haben können.
Ein weiteres Problem ist die Grundrichtung der Entscheide. Es wurde schon oft moniert, dass die Abstimmenden den Status-Quo befürworten.8 Es sei hier
5 Zu entsprechenden Modellen des Politikerverhaltens siehe Dixit (1996) oder Persson und Tabellini (2002). Ein Modell unter Einbezug der direkten Demokratie wird von Besley und Coate (2001) präsentiert.
6 So setzt das Principal-Agent-Argument z.B. informierte Wähler voraus.7 Riker (1982) hat als erster auf die Bedeutung dieses Resultates für die Einschätzung der
direkten Demokratie hingewiesen, siehe auch Haskell (2002).8 So z.B. Borner et al. (1990).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 153
an die vielen Anläufe zur Einführung des Frauenstimmrechts, der AHV oder der Sommerzeit erinnert. Es gibt eine grosse Anzahl von Gründen, warum der Status-Quo bevorzugt wird. Erstens sind im schweizerischen politischen System viele Sicherungen eingebaut.9 Dazu gehören doppeltes Mehr, Zwei-Kammersys-tem und die Volksrechte selber. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beschluss an einer dieser Hürden scheitert. Zweitens dürfte der Medianwähler in der Schweiz konservativ eingestellt sein, eine Tendenz, welche durch das stei-gende Durchschnittsalter noch verstärkt werden wird.
Das Festhalten am Bisherigen muss nicht automatisch negativ sein. Es dürfte beispielsweise für den langsamen Ausbau des Wohlfahrtsstaates und die lange Zeit tiefe schweizerische Staatsquote mitverantwortlich sein. Der Status-Quo-Bias hat aber dann negative Auswirkungen, wenn komplexe Probleme einer dringenden Lösung harren. In diesem Fall kann das Festhalten am Bisherigen fatale Auswirkungen haben. Wir sind der Meinung, dass sich die Schweiz im Moment in seiner solchen Situation befindet. Probleme bei der Überregulierung des internen Marktes, bei den Sozialversicherungen und im Gesundheitssystem harren einer Lösung. Solche tief greifende Reformen werden weiter durch die Unmöglichkeit erschwert, in der direkten Demokratie Reformpakete zusam-menzustellen. Da in der Regel über einzelne Gesetze und Verfassungsvorlagen getrennt abgestimmt wird, können solche Pakete nämlich im letzten Moment wieder aufgelöst werden.
3 Institutionen und Governance
Beurteilt man die Staatsformen nach den gegensätzlichen Kriterien ”Regier-barkeit” und ”Partizipation”, so weist das schweizerische System sehr viel Par-tizipation, aber eine begrenzte Regierbarkeit auf.10 Dies ist sicherlich gewollt und dürfte den Präferenzen einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entspre-chen. Die Konsequenz davon ist aber eine begrenzte Regierbarkeit. Es sollte dies eigentlich niemanden wundern, stellt es doch den Preis der hohen Partizipation dar. Drei Aspekte der tiefen Regierbarkeit, nämlich die Möglichkeit inkonsis-tenter Entscheide, den Status-Quo-Bias und die Schwierigkeit Reformpakete zusammenzustellen, haben wir bereits besprochen.
Es bestehen im schweizerischen politischen System aber noch andere Governance-Probleme. Zu nennen ist hier vor allem die sehr eigentümliche Organisation der Regierung. Der Bundesrat besteht ja bekanntlich aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern aus vier verschiedenen Parteien, welche sich
9 Siehe dazu Moser (1996).10 Zu diesem gegensätzlichen Paar, siehe z.B. Sartori (1987), March und Olson (1995)
oder Papadopoulos (1997). Für die Schweiz haben Neidhart (1970b), Germann (1994) und Wittmann (1979) früh auf die Mängel bei der Regierbarkeit hingewiesen.
154 DEBATTE
nie auf ein Regierungsprogramm einigen. Die Konkordanz garantiert zwar eine breite Partizipation der wichtigsten Parteien und verschiedener Bevöl- kerungsgruppen. Dies geht aber wieder auf Kosten der Kohärenz und der Regi-erbarkeit.11 Ähnliches ist zum Milizsystem des Parlamentes zu sagen. Dieses hat kaum eigene Ressourcen, und die Teilzeitpolitiker sind von Informationen aus der Verwaltung oder aus den Verbänden abhängig. Gleiches gilt im übrigen für die Parteien. Die schwache Stellung der Regierung und des Parlaments sind wiederum unmittelbare Konsequenzen der direkten Demokratie.12
Die Lücke, welche durch die schwache Stellung von Regierung und Parla-ment entsteht, wird durch die starke Stellung des Volkes nur teilweise gefüllt. Ein zentraler Gewinner ist die Verwaltung, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die auch gegenüber den eigenen Bundesräten eine sehr starke Stellung hat. Ein weiterer Gewinner sind die organisierten Interessen, welche über das Vernehm-lassungsverfahren einen institutionalisierten Einfluss auf die Entscheidfindung haben. Angesichts der komplizierten Entscheidungswege und eines insgesamt wenig transparenten Entscheidungssystems überrascht es deshalb trotz sehr viel direkter Demokratie nicht, wenn viele Bürgerinnen und Bürger der Ansicht sind, Entscheide würden in Berner Hinterzimmern ausgehandelt oder von der Verwaltung bestimmt.
4 Einige abschliessende Bemerkungen zu den nötigen politische Reformen
Angesichts der bereits sehr grossen Bedeutung des Kriteriums Partizipation überrascht es dann doch, wenn viele Reformvorschläge darauf hinauslaufen, einseitig nur die Partizipation weiter auszubauen.13 Aus unserer Sicht sollte es vielmehr darum gehen, die Regierbarkeit wieder zu verbessern.14 Angesichts des Misstrauens, welche die ”Classe Politique” beim Volk hervorruft, haben Refor-men, welche auf einen Abbau der direkten Demokratie zielen, aber wohl keine Chance. Eine reine Regierungsreform, wie die Einführung von Staatssekretären,
11 Es besteht zwar internationale Evidenz, dass konsensorientierte Systeme besser oder zumindest nicht schlechter als konkurrrenzorientierte Systeme abschneiden (z.B. Lijphart 1999). Da die Schweiz bei der Konsensorientierung wiederum einen Extremfall darstellt, halten wir diese Evidenz im konkreten Fall für nicht ausreichend. Es ist mit anderen Worten ohne weiteres möglich, dass die Schweiz weit jenseits des diesbezüglichen Optimums liegt.
12 Die klassische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Referendum und Konkordanz stammt von Neidhart (1970a), siehe auch Vatter (1997). Das Volk hat zudem wiederholt eine Reform des Milizsystems wie auch Regierungsreformen abgelehnt, welche die Arbeitslast der Bundesräte etwas mindern würden. Siehe dazu die Übersicht in Klöti (2004).
13 So der Vorschlag für eine Verfassungsreform von Müller und Kölz (1990).14 In diese Richtung gehen auch Neidhart (1970b) und Germann (1994).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 155
ist nicht nur unpopulär, sondern dürfte auch kaum ausreichend sein. Wir halten deshalb die Abkehr von der Konkordanz für die vielversprechendste Möglich-keit, wieder mehr Kohärenz ins schweizerische politische System zu bringen. Dies könnte über eine Abkehr der Parteien resp. des Parlamentes von der Kon-kordanz erfolgen.15 Oder es könnte die Volkswahl des Bundesrates eingeführt werden, allerdings über die Wahl eines Präsidenten und allenfalls Vizepräsi-denten oder über die Wahl einer Liste. Wahlen für einzelne Sitze, wie sie in den Kantonen üblich sind, würden das Problem der fehlenden Kohärenz und Regier- barkeit dagegen nicht lösen.
Bibliographie
Arrow, Kenneth (1963). Social Choice and Individual Values. 2nd edition. New York: Wiley.
Besley, Timothy and Stephen Coate (2001). ”Issue Unbundling via Citizen’s Initiatives”. CEPR Discussion Paper No. 2857. London: CEPR.
Bodmer, Frank (2005). Bestimmungsgründe des kantonalen Wirtschaftswachstums. Manuskript. Universität Basel.
Bodmer, Frank (2004). ”Warum die direkte Demokratie den Anstieg der Staatsquote in der Schweiz nicht verhindern konnte”, in Frank Bodmer und Silvio Borner (Hsg.). Wohlstand ohne Wachstum - Die Hintergrundberichte. WWZ Forschungsberichte 04/06. Universität Basel.
Borner, Silvio und Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Wachstum – Eine Schweizerische Illusion. Zürich: Orell Füssli.
Borner, Silvio, Aymo Brunetti und Thomas Straubhaar (1990). Schweiz AG: Vom Sonderfall zum Sanierungsfall? Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
Dixit, Avinash (1996). The Making of Economic Policy. CESifo Lecture Series. Cambridge Mass:MIT Press.
Feld, Lars P. and Bruno S. Frey (2001). ”Trust breeds Trust: How Taxpayers are Treated”, Economics of Governance 2: 87-99.
Feld, Lars P. and Gebhard Kirchgässner (2001). ”The political economy of direct legislation: direct democracy and local decision-making”, Economic Policy 16(33): 331-367.
Feld, Lars P. and Marcel R. Savioz (1997). ”Direct Democracy Matters for Economic Performance”, Kyklos 50(4): 507-538.
Fischer, Roland (2004). Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone. mimeo. Bern: Eidg. Finanzverwaltung.
15 Eine solche Änderung wird von Politologen nicht durchwegs negativ beurteilt, wie der kürzliche Beitrag von Sciarini (2004) zeigt. Damit ist natürlich nicht die gegenwärtige Infragestellung des Kollegialitätsprinzips durch die SVP und ihren Bundesrat Blocher gemeint, welche die Kohärenz der Regierung noch weiter reduziert.
156 DEBATTE
Freitag, Markus und Adrian Vatter (2000). ”Direkte Demokratie, Konkordanz und Wirtschaftsleistung. Ein empirischer Vergleich der Schweizer Kantone”, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 136(4): 578-605.
Germann, Raimund (1994). Staatsreform: Der Übergang zur Konkurrenzdemokratie. Bern: Verlag Paul Haupt.
Haskell, John (2002). Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the Populist Myth. Boulder: Westview Press.
Kirchgässner, Gebhard, Lars P. Feld und Marcel R. Savioz (1999). Die Direkte Demokratie. Modern, Erfolgreich, Entwicklungs- und Exportfähig. Basel: Helbing & Lichtenhahn.
Klöti, Ulrich (2004). ”The Government”, in Ulrich Klöti, Peter Knoepfel, Hanspeter Kriesi, Wolf Linder and Yannis Papadopoulos (eds.). Handbook of Swiss Politics. Zürich: NZZ Publishing.
Lijphart, Arend (1999). Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.
Lutz, Georg und Thomas Votruba (2005). ”Ist der Souverän wirtschaftsfeindlich? Direkte Demokratie taugt nicht als Sündenbock”, Neue Zürcher Zeitung 226 (2): 25.
March, James G. and Johan P. Olson (1995). Democratic Governance. New York: The Free Press.
Moser, Peter (1996). ”Why is Swiss Politics so Stable?”, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 132(1): 31-61.
Müller, Jörg Paul und Alfred Kölz (1990). Entwurf für eine neue Bundesverfassung vom 16.Mai 1984. Basel: Helbing und Lichtenhahn.
Neidhart, Leonhard (1970a). Plebiszit und Pluralitäre Demokratie. Eine Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums. Bern: Francke Verlag.
Neidhart, Leonhard (1970b). Die Reform des Bundesstaates. Bern: Francke Verlag.
Papadopoulos, Yannis (1998). Démocratie Directe. Paris: Economica.
Persson, Torsten and Guido Tabellini (2002). Political Economics. Explaining Economic Policy.Cambridge Mass: MIT Press.
Riker, William (1982). Liberalism against Populism. San Francisco: W.H. Freeman.
Sartori, Giovanni (1987). The Theory of Democracy Revisited. Chatham: Chatham House Publishers.
Sciarini, Pascal (2004). ”Für eine reduzierte Drei-Parteien-Konkordanz”, Neue Zürcher Zeitung (225)293.
Stutzer, Alois and Bruno S. Frey (2000). ”Stärkere Volksrechte - Zufriedenere Bürger: eine mikroökonometrische Untersuchung für die Schweiz”, Swiss Political Science Review 6(3): 1-30.
Vatter, Adrian (1997). Die Wechselbeziehungen zwischen Konkordanz- und Direktdemokratie, Politische Vierteljahresschrift 38(4): 743-770.
Wittmann, Walter (1979). Wohin treibt die Schweiz? Bern: Schwerz Verlag.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 157
Ist die Politik an allem schuld?
Hans Peter Fagagnini, Institut für Politikwissenschaft, Universität St. Gallen, Schweiz; E-Mail: [email protected]
Für Silvio Borner und Frank Bodmer (2004) ist die schweizerische Wachstums-schwäche systeminhärent, und zwar als Folge starken Ausgabenwachstums, grosszügiger Sozialleistungen, zuviel Regulierung und zu wenig Wettbewerb und Offenheit. Und dies, weil die politischen Strukturen Reformen und Anpas-sungen verhindern. Haben wir es darum hierzulande mit einer Wachstums-bremse, genannt politischer Overstretch zu tun?
Reduziert man die Befunde der beiden Autoren auf ihren Kern, so ergibt sich die Funktion: Wirtschaftliches Wachstum = f(Politik). Politik wäre damit für die Wachstumsschwäche alleine schuld. Wie viel an politischem Gestaltungsspiel-raum und Verantwortlichkeit ist aber tatsächlich auszumachen? Und könnten die Probleme nicht auch bei der Wirtschaft selber liegen? Dass die politischen Institutionen das Verhalten der Akteure formen, bedeutet nicht, dass sich die Wirtschaft nicht auch selber steuert. Sie folgt sowieso einer eigenen Logik und tut dies entlang vorhandener (Managament-)Fähigkeiten unterschiedlicher Qualität. Im Folgenden soll darum diesem Problem der Selbststeuerung nach-gegangen werden mit der Frage: politische Steuerung kontra Wirtschaftssteuer-ung?
Die Trends
Ausgangspunkt bildet eine Personal- und Ressourcenfluss-Rechnung. Tabelle 1 zeigt in 10-Jahres-Etappen die Bewegungen auf – gerechnet von 1970 zu 1980 zu 1990 zu 2000 und zu 2002 bzw. 2003.
Die Stellung der wirtschaftlichen Schweiz in der Welt ist an den Plätzen 24, 26, 27 und 29 festzumachen. Gemessen an der relativ kleinen Bevölkerung ist ihr Gewicht als erheblich und eigentlich die eigenen Grenzen sprengend einzustufen. Alois Riklin (1975) sprach seinerzeit vom Kleinstaat Schweiz als einer wirtschaftli-chen Mittelmacht.1 Dies gilt trotz abnehmendem Gewicht noch heute.
Die inländische Bevölkerung ”lebt” von der Zuwanderung und der Konjunk-tur. Die 1973er-Rezession führte zur raschen Abwanderung, während die guten 1980er Jahre die Zuwanderung begünstigten, was sich dann auch später wieder-holte. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm deutlich zu – in der Wirtschaft mehr als im öffentlichen Dienst, der in den 1990er Jahren abnahm. Die Erwerbsquote verbesserte sich lediglich in den 1980er Jahren.
1 Riklin setzte die Schweiz auf Platz 23. Seine Zahlen sind jedoch nicht vergleichbar mit den hier verwendeten.
158 DEBATTE
Tabelle 1: Personal- und Ressourcenbewegungen
70er Jahre 80er Jahre 90er Jahre Bis 2002/03
Position der Schweiz in der Staatenwelt nach Rangfolge
BIPBevölkerungTotal Länder
2458123
2667123
2773123
2988232
Prozentuale Veränderung der Wohnbevölkerung (WB)
1% 8% 6% 2003: 1%
Prozentuale Ver-änderung der ausländischen Be-völkerung (60er Jahre: +84.7%)
-12.5% 31.7%2 20.1%3 1%
Veränderung der Anzahl Er-werbstätigen
AbsolutIn Prozent
23’0000.1%
655’0004
20.7%268’000
7.0%88’0002.2%
Veränderung der Brutto-erwerbsquote
0% 8.6% -2.1% -0.1%
Veränderung der Anzahl Er-werbstätiger in den Sektoren
PrimärIndustrieServicedavon Staat
-18.9%1.8%22.3%26.8%
-25.7%1.8%39.5%27.0%
14.2%-15.5%17.5%-13.1%
-8.9%-5.6%16.3%
Veränderung der Steuern und Entgelte
134.2% 79% 58.1%
Veränderung der öffentlichen Ausgaben
134.3% 82.3% 42.7%
Veränderung der Staatsver-schuldung
124% 27.1% 103.9% 9.1%
Veränderung der Sozial-indikatoren
SozialausgabenAusbau BVGEinnahmen
196.3%163.8%174.5%
97.4%178.9%111.7%
78.5%32.2%56.7%
Veränderung des BIP p.c. 1.2% 1.5% 0.4%
Veränderung der Arbeits-produktivität per annum
2.1% 0.9% 0.5% 1.4%
Veränderung beim Aussen-handel
Exporte und Importe
121.% 54.5% 49.5% -0.7%
Exporte in Prozent der Importe
23.1% 10.4% 9.3% 7.6%
Bemerkungen: Position der Schweiz in der Staatenwelt nach Rangfolge: 70er/80er/90er Jahre: Maddison (2001) bei 123 erfassten Ländern; bis 2002/03: The World Factbook (2003) bei 232 erfassten Ländern. Prozentuale Veränderung der Wohnbevölkerung: BfS (2004a) Prozentuale Veränderung der ausländischen Bevölkerung: BfS (2004a) Veränderung der Anzahl Erwerbstätiger: BfS(2004b) Veränderung der Bruttoerwerbsquote: BfS (2004b)
1 Entspricht 4.8 von 8 Prozentpunkten der Wohnbevölkerungsentwicklung. 3 Entspricht 2.4 von 6 Prozentpunkten der Wohnbevölkerungsentwicklung. 4 Diese Zunahme setzt sich zusammen aus einem Minus von 56‘000 des primären
Sektors sowie einem Plus von 27‘000 des Industriesektors und einem grossen Plus des Dienstleistungssektors von 688‘000. Zehn Jahre später ergibt sich die Zunahme aus einem Plus des Primärsektors von 23‘000, einem Minus des Industriesektors von 178‘000 und wiederum einem Plus bei den Dienstleistungen von 425‘000. Die ersten Jahre im neuen Jahrhundert führen diese Veränderung weiter.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 159
Veränderung der Anzahl Erwerbstätiger in den Sektoren: Staat: Bis 1980 Germann (1998: 12) sowie BfS-Statistik, ab 1991 aufgrund von Betriebszählungen. Die 80er Jahre reichen von 1980 bis 1991 und die 90er Jahre von 1991 bis 2001. Bei Germann sind die parastaatlichen Organisationen nicht einbezogen. Veränderung der Steuern und Entgelte: Bericht des Bundesrats zur Entwicklung der Abga-ben und Steuerbelastung in der Schweiz (1970-2000). Bericht zur Erfüllung des Postulats (98.3576). Veränderung der öffentlichen Ausgaben: Economiesuisse (o. J.) Veränderung der Staatsverschuldung: BfS (2004c) Veränderung der Sozialindikatoren: Economiesuisse (o. J.) Veränderung des BIP p.c.: Borner und Bodmer (2004: 31) Veränderung der Arbeitsproduktivität pro Arbeitsstunde: (OECD 2005c) Veränderung beim Aussenhandel: Economiesuisse (o. J.)
Wie überall so haben wir es auch hierzulande mit der Deindustrialisierung zu tun. Für Torben Iversen und Thomas R. Cusack (2000: 313ff.) liefert diese den Grund für die Verstärkung des Sozialschutzes. Tatsächlich weist der Sozialbereich denn auch eine ganz gehörige Dynamik auf.
Aber die Pensionskassen zeigen, wie sehr neben sozialen ebenso starke wirtschaftliche Komponenten im Spiel sind. Die 2. Säule umfasst nämlich ein Ver-mögen von derzeit rund 500 Milliarden CHF, weshalb sie ein wichtiges Element der hoch profitablen Vermögensverwaltung bildet. Auch politisch ist die ”Vater-schaft” ausgewiesen: das 3-Säulenkonzept wurde seinerzeit von der Wirtschaft eingebracht und fand in der Volksabstimmung 1972 die politische Zustimmung. Auch andere Sozialbereiche enthalten wirtschaftliche und noch mehr beschäf-tigungsrelevante Komponenten. Vor allem aber generiert der ganze Bereich eine bedeutende Wertschöpfung. Gleiches gilt für die Bewilligungsverfahren, die für die Rechts- und Beratungsindustrie schon längst als (lukrative) Geschäftsfelder genutzt werden. Noch fehlen für die Schweiz Studien, die über den (bremsen-den?) Einfluss von Anwälten auf die Entwicklung des Landes Auskunft geben könnten.
Gehörige Steigerungen sind bei den Steuern und Entgelten festzustellen – im Einklang mit Verschuldungssprüngen. Die Aussagekraft der Schulden ist indessen solange begrenzt, als offen bleibt, wieweit damit Investitionen getätigt oder bloss Konsumausgaben finanziert wurden. Letzteres käme einem Overstretch gleich.
Eine Schweiz à deux vitesses?
Aus dem Bisherigen ergibt sich ein ansehnlicher Input an Personal, Ressourcen und Krediten in Wirtschaft und Gesellschaft. Und gleichwohl wuchs die Wirtschaft nur schwach und konnte die Arbeitsproduktivität nur geringfügig verbessert werden.5
5 Gemäss OECD (2005a) war die Arbeitsproduktivität im Businesssektor zwischen 2001 und 2003 gar durchwegs negativ – im Gegensatz zum Gesamtwert gemäss Tab. 1.
160 DEBATTE
Fiel die Dynamik der Sozialausgaben zu sehr ins Gewicht? Immerhin hat sich die Schweiz im internationalen Vergleich gegenläufig verhalten, haben doch viele Länder, so z. B. Schweden und die Niederlande, rückläufige Sozialanteile zu verzeichnen (Tabelle 3) und weisen dennoch höhere Wachstumsraten aus als die Schweiz. Die Schweiz gehört mit ihrer Sozialpolitik zu den ausgabenfreu- digen Ländern der OECD, was sich auch in den relativen Lohnkosten der Indust-rie äussert. Diesbezüglich liegt die Schweiz nämlich derzeit genau im Mittelfeld, dabei waren 1990 nur Japan und Deutschland besser (OECD 2005a). Deshalb kann der Sozialbereich trotz seiner erheblichen Wertschöpfungsrelevanz nicht einfach von der Wachstumsdiskussion ausgeklammert werden.
Warum aber erzielte die Wirtschaft selbst keine höhere Wertschöpfung? Ging man mit dem Zuzug billiger Arbeitskräfte den Weg des geringsten Wider-standes? Und/oder hat man zuwenig für künftige Erfolgspositionen gekämpft, im Unterschied z. B. zu Finnland nach dem Handelseinbruch mit der Sowjet-union? Wenn Letzteres empirisch ausgemacht werden könnte – einige Firmen-pleiten liefern Fingerzeige –, dann wäre es um die hiesigen wirtschaftlichen Führungsqualitäten nicht zum Besten bestellt. Zudem verweist die Ausländer-statistik auf den Weg des geringsten Widerstandes – die deutlich unterdurch-schnittliche Arbeitsproduktivität der Schweiz generell (Tabelle 3) und speziell in Branchen wie dem Detailhandel, Gastgewerbe, Verkehr, Gesundheit und Sozia-les, Landwirtschaft, Bau, Teile der Maschinenindustrie (BfS 2004: 241f.) legen solches nahe.
Anders präsentieren sich die Exporte und die international tätigen Unter-nehmen. Sie spielen in einer anderen Liga, da sie globalen Trends sowie der Kundschaft folgen müssen. Die schweizerische Dynamik findet damit offenbar mehr im Ausland als zuhause statt. Die Kapitalbewegungen dokumentieren denn auch eine Schweiz à deux vitesses (OECD 2005b).6
Wahltag ist Zahltag
Der Hang der Wirtschaft, Probleme per Ausländerpolitik zu lösen, provozierte immer wieder Wählerreaktionen. Bevölkerungsfragen und im Gefolge davon soziale und Umweltanliegen garantierten respektable oppositionelle Wahler-folge (Tabelle 2), bis schlussendlich die SVP wie ein Staubsauger das rechte Spekt- rum integrierte.
Insgesamt darf davon ausgegangen werden, dass Push- wie Pullbewegun-gen wirtschaftlich initiiert waren und sich die Politik jeweils lange zu permissiv verhielt, bis jeweils Reaktionen unausweichlich wurden.
6 So rangiert die Schweiz in der OECD auf Platz 10, was die FDI in andere Länder anbelangt (outflow), aber nur auf Platz 15 bezüglich der FDI in die Schweiz (inflow). Vgl. auch Tabelle 3 in OECD (2005a).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 161
Tabelle 2: Oppositionelles Flussdiagramm bei Nationalratswahlen
Nicht im Bundesrat vertreten / Veränderung der Wähleranteile 70er Jahre 80er Jahre 90er Jahre 2003
1971 41.3%
1975 -14.0%
1979 -28.1%
1983 26.4%
1987 41%
1991 9.2%
1995 -18.2%
1999 -38.8%
2003 0%
Bemerkungen: Quelle: BfS (2003). Nicht einbezogen sind LPS und EVP, da sich beide nicht als Oppositionsparteien betrachten. Auch die übrigen sind nicht eingerechnet.
Wer steuert wen?
Mit Blick auf die politische Steuerung setzen Borner und Bodmer (2004) rich-tigerweise bei den Wirtschaftsartikeln von 1947 an, die seit dem 2. Weltkrieg das Gerüst für Wettbewerb, mehr noch aber für staatliche Interventionen, Förderungsmassnahmen und eigener unternehmerischer Tätigkeit des Staa-tes abgeben (vgl. Schürmann 1983: 24ff.). Den Anlass zu staatlicher Aktivität liefern die einzelnen Branchen und nachgelagert auch die Regionen; beide haben sie nämlich den Nachweis zu erbringen, dass eine staatliche Tätigkeit im öffentlichen Interesse liegt. Die Wirtschaftsartikel bilden mit andern Worten eine Rahmenordnung, der sich Interessierte bedienen können. Direkt und indi-rekt konnte sich darin auch so etwas wie eine Kartellmentalität ausbilden.
Die Wirtschaftsartikel machen es einfach, die Schweiz als koordinierte Marktwirtschaft zu bezeichnen – im Gegensatz zu Marktwirtschaften liberaler Prägung (Hall and Soskice 2001: 21ff.). Darin ist ein Wohlfahrtsstaat (Estevez-Abe et al. 2001: 145ff.; Mares 2003: 229ff.) entstanden – gewissermassen als Folge und Ergänzung der vorherrschenden (industriellen) Produktionswelt. Die Erfahrung lehrt nämlich Folgendes: Produziert eine Volkswirtschaft z. B. vorwiegend hochwertige Güter, so erfordert dies entsprechend qualifizierte Mitarbeitende. Diese ihrerseits investieren jedoch in sich selber nur, wenn sie mit entsprechendem Einkommen und abgesicherten Arbeitsmarktrisiken rech-nen können. Da die Unternehmen diese ”Man Power” suchen, sind sie ebenfalls interessiert an adäquaten Absicherungen. Die Schweiz nimmt sich darin nicht aus; d.h. die Schweiz ist dieser Welt zuzuordnen.
162 DEBATTE
Umgekehrt sind in Volkswirtschaften, die schwergewichtig Massengüter herstellen, weniger anspruchsvolle Tätigkeiten gefordert, und die Unternehmen müssen sich nach dem jeweiligen Kostenführer im Markt ausrichten. Darum sind hohe Arbeits- und Sozialschutzstandards genierlich. Dafür ist Flexibilität gefragt.
Die Gegenüberstellung – hier hochwertige Güter, da Massengutproduktion – ist natürlich mehr als grobschlächtig. Sie macht aber die wirtschaftlichen Inter-essen transparent und erklärt, wann Reformen wirtschaftlich motiviert sind. Das ist mittlerweile bei vielen Produktionsverfahren der Fall; automatisierte Ferti-gungen werden mehr und mehr mit Massenguterzeugungen vergleichbar.
Ein erster Schub an Deregulierung und ein Rückzug des Staates aus der direkten unternehmerischen Verantwortung (Swisscom, Post, SBB, Swissair) waren die ersten Ergebnisse, er erfolgt im Vergleich leicht verspätet.
Im Übrigen hat sich im Alltag aber die korporatistische und auf Hei-matschutz gerichtete Verhaltensweise gehalten. Einmal gewährt die Verfassung den Wirtschaftsverbänden ein umfangreiches Anhörungsrecht, das sie zu ihren Vorteilen nutzen können. Zudem wirken sie beim Vollzug oft unmittelbar mit, sei es durch Übernahme von Verwaltungsaufgaben, durch Einsitz in Kommis-sionen mit Entscheidungsbefugnissen (Kartellkommission als ein Beispiel) oder sei es, dass sie den Vollzug begleiten. So kann sich wirtschaftlicher Einfluss unmittelbar durchsetzen. Interessant wäre es zu erforschen, welches der verblei-bende Part ist, welcher der Politik dabei noch verbleibt; ob er grösser ist als z. B. in den USA, wo er unter Einbezug sämtlicher Interessen noch bei 10-20% liegen soll (Zakaria 2003: 171). Darum spricht manches für Peter A. Hall und David Soskice. Danach bekunden koordinierte Marktwirtschaften mehr Mühe, mark-twirtschaftliche Konzepte umzusetzen als liberale, da sich die Wirtschaft und die Unternehmen weiterhin die vorhandenen institutionellen Vorteile zu nutze machen wollen – auch und vor allem in der globalisierten Welt (Hall and Soskice 2001: 48ff).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 163
Tabelle 3: Die Schweiz im internationalen Vergleich
Sozialausga-ben in % des
BIP, 2001
Soziale Entwicklung in den 90er
Jahren
Arbeits-produktivität
BIP/h US Dollar, 2003
Wachstum 1990-2002, per annum
BIP p.c. PPP US
Dollar,2002
Netto Foreign Direct Invest-
ment, Mia. US Dollar
Dänemark 27.2 -4.3 39.6 2.1 30’940 -9.7%
Finnland 24.8 -8.8 36.2 2.5 26’190 26.7%
Frankreich 28.5 1.0 47.2 1.6 26’920 301.0%
Niederlande 21.8 -21.1 44.0 2.2 29’100 96.3%
Norwegen 23.9 -10.5 55.0 3.0 36’600 2.2%
Österreich 26.0 6.6 39.9 1.9 29’220 -7.6%
Schweden 28.9 -7.7 38.1 2.0 26’050 -18.0%
Schweiz 26.4 31.6 35.6 0.4 30’010 108.5%
USA 14.8 -0.2 41.3 2.0 35’570 -18.7%
Bemerkungen: Quellen: OECD (2004), OECD (2005a), OECD (2005b) und United Nations Development Programme (2004).
Und jetzt?
Aus dem Bisherigen ergibt sich eine differenziertere Funktion als die bei Borner und Bodmer (2004) angelegte. Die Einflüsse können zwar nicht quantitativ aus-gewiesen werden. Sicher aber liegen Heil und Unheil nicht einfach bei der Politik. Im Gegenteil, es haben sich Praktiken in die Politik eingenistet, welche während Jahren die Durchsetzung der Wirtschaftsinteressen garantierten, welche sich aber jetzt offenbar als Wachstumsbremsen entpuppen. Das heisst, Institutionen konditionieren zwar das wirtschaftliche Verhalten. Zu fragen ist nur, wer die Schalthebel beeinflusst. In der Schweiz spricht manches dafür, dass sich die Wirtschaft ein schönes Stück selber steuerte und die Politik für ihre Zwecke instrumentalisierte. Zudem ist der Sozialbereich, der meist nur als Ausgabenlast empfunden wird, als wertschöpfungsrelevant zu betrachten. Aus diesem allem sind die Probleme rund um die einheimische Wachstumsschwäche auch und vor allem wirtschaftlich, sicher nicht nur politisch anzugehen.
Bibliographie
BfS (2003). Nationalratswahlen 2003. Der Wandel der Parteienlandschaft seit 1971. Neuenburg: Bundesamt für Statistik.
BfS (2004a). Struktur der Wohnbevölkerung 1900-2000. T 1.2.2.1. URL: http://www.statistik.admin.ch (26.4.2005).
164 DEBATTE
BfS (2004b). Erwerbstätige nach Sektoren, Heimat und Geschlecht. Jahresdurchschnittswerte 1960-2003. URL: http://www.statistik.admin.ch (26.4.2005)
BfS (2004c). Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Zürich: Neue Zürcher Zeitung.
Borner, Silvio und Frank Bodmer (Hrsg.) (2004). Wohlstand ohne Wachstum: Eine Schweizer Illusion. Zürich: Orell Füssli.
Central Intelligence Agency (2003). The World Factbook. URL: http://www.Bartleby.com (26.4.2005).
Economiesuisse (o. J.). Zahlenspiegel. URL: http://www.zahlenspiegel.ch (26.4.2005).
Estevez-Abe, Margarita, Torben Iversen and David Soskice (2001). ”Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State”, in Peter A. Hall and David Soskice (eds.). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, pp. 145-183.
Germann, Raimund E. (1998). Öffentliche Verwaltung in der Schweiz. Band 1: Der Staatsapparat und die Regierung. Bern: Haupt.
Hall, Peter A. and David Soskice (2001). ”An Introduction to Varieties of Capitalism”, in Peter A. Hall and David Soskice (eds.). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-68.
Iversen, Torben and Thomas R. Cusack (2000). ”The Causes of Welfare State Expansion. Deindustrialization or Globalization?”, World Politics 52(3): 313-349.
Maddison, Angus (2001). The World Economy. A millennial Perspective. Paris: OECD Publications.
Mares, Isabela (2003). ”The Source of Business Interest in Social Insurance. Sectoral versus National Differences”, World Politics 55(2): 229-258.
OECD (2004). Social Expenditure Database. Paris: OECD.
OECD (2005a). Factbook. Economic, Environmental and Social Statistics. Paris: OECD.
OECD (2005b). International Direct Investment Database. Paris: OECD.
OECD (2005c). International Comparison of Labour Productivity Levels – Estimates for 2003. Paris: OECD.
Riklin, Alois (1975). Grundlegung der schweizerischen Aussenpolitik. Bern, Stuttgart: Haupt.
Schürmann, Leo (1983). Wirtschaftsverwaltungsrecht. Bern: Stämpfli. 2. Auflage.
United Nations Development Programme (2004). Human Development Report. Cultural Liberty in Today’s Diverse World. New York: United Nations Development Programme.
Zakaria, Fared (2003). The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York, Ithaca: Norton.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 165
Die Wachstumsschwäche der Schweiz: verursacht durch die politischen Institutionen?
Lars P. Feld, Philipps-Universität Marburg, CESifo und CREMA; E-Mail: [email protected] Christoph A. Schaltegger, Eidgenössische Steuerverwaltung, Universität St. Gallen und CREMA; E-Mail: [email protected]
Diagnose der Schweizer Wachstumsschwäche
Die wirtschaftliche Performance der Schweiz weist seit einigen Jahren eine ge- ringe Dynamik auf. Wirtschaftspolitische Reformversuche scheitern jedoch zuwei-len an den direkten Volksrechten auf Bundesebene oder an der starken Stel-lung der Kantone. Dem Föderalismus wird angelastet, er hemme die Wirkung des Binnenmarktgesetzes und des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungs-wesen zur Dämpfung des hohen Preisniveaus in der Schweiz. Vermeintliche Schuld an der Reformträgheit haben somit die politischen Institutionen der Schweiz. Eliten warnen daher in regelmässigen Abständen, die direkten Volks-rechte, der föderale Staatsaufbau und die Konkordanz verunmöglichten die drin-gend notwendigen Reformen (Borner et al. 1990, 1994; Borner und Bodmer 2004; Rentsch et al. 2004). Sowohl die direkte Demokratie, als auch der Föderalismus neigten eher als andere politische Institutionen dazu, den Status Quo zu begünsti-gen. Die Konkordanz richte sich gleichsam im vorauseilenden Gehorsam mit ihren Gesetzesvorhaben an erzielbaren Mehrheiten aus, so dass der Bundesrat wagemu-tige Reformvorhaben unterliesse. Um die institutionelle Blockade zu überwinden, wird mehr politische Führung (‘Leadership’) gefordert. Ein Abbau direkter Volksre-chte und Einschränkungen des Föderalismus sollen den Handlungsspielraum der (Bundes-)Politiker für notwendige Reformen vergrössern (Rentsch et al. 2004).
Voreilige Therapieansätze
Zunächst scheint die Logik dieser Argumente bestechend: Wenn aus politisch-öko-nomischen Gründen Reformen unterbleiben, so können vornehmlich die Verände-rungen der politischen Spielregeln für neue reformfreundliche Anreize der Akteure in der Tagespolitik sorgen. Ein kursorischer Blick in andere OECD-Länder verdeut-licht, dass politische Führung vermeintlich ausschlaggebend für erfolgreiche Refor-men ist. Das Paradebeispiel ist die ehemalige britische Premierministerin Thatcher, die ihre liberale Wirtschaftspolitik gegen den massiven Widerstand der englischen Gewerkschaften in den 1980er Jahren durchsetzte. Zusammen mit dem im vergan-genen Jahr verstorbenen damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan leitete sie damit eine neue konservative Ära ein.
166 DEBATTE
Was ist von diesen Vorschlägen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu halten? Verfassungsänderungen sind nicht ohne Kosten zu haben. Verfassungen dienen dazu, den durch schlechte, missgünstige oder in-kompetente Regierungen potentiell verursachten Schaden für die Bürger gering zu halten. Checks and Balances sollen den politischen Wettbewerb zwischen einzelnen Machtzentren so stärken, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen an den Bedürfnissen der Bürger ausrichtet. Die Stärkung von Veto-Positionen ist geradezu gewollt, um Machtmissbrauch zu verhindern.
Direkte Volksrechte bereichern die Politik
Direkte Volksrechte in ihrer Gesamtheit für den fehlenden Reformeifer in der Schweiz verantwortlich zu machen ist überzogen. Von ihrer Konstruktion her sind (Gesetzes- oder Verfassungs-)Initiativen auf politische Innovation aus-gelegt. Sie sollen es den Bürgern ermöglichen, neue politische Vorhaben in die Diskussion einzubringen, die bislang von der politischen Klasse vernachlässigt wurden. Ein gutes Beispiel dafür ist die kalifornische Proposition 13 aus dem Jahr 1978, welche die Steuerzahlerrevolten in den USA einleitete und damit die politische Diskussion und wissenschaftliche Forschung zur adäquaten Ausge-staltung fiskalischer Budgetbeschränkungen anstiess (Matsusaka 2004).
Die Initiative lässt sich auch von der Exekutive als Drohung einsetzen, um Gesetzesvorhaben gegen den Widerstand des Parlamentes durchzusetzen. Auch hier ist ein (aktuelleres) kalifornisches Beispiel interessant. Gouverneur Schwarzenegger gelang es, eine Deregulierung der Kompensationsregelung bei Arbeitsunfällen von Arbeitnehmern gegen anfängliche Widerstände des Parlaments durchzusetzen. Die alte Regelung war durch höhere Kosten und geringere Auszahlungen an die Arbeitnehmer als bei vergleichbaren Systemen in anderen Bundesstaaten charakterisiert. Eine Reform wurde bislang vom Par-lament verhindert. Schwarzenegger drohte mit einer Gesetzesinitiative, die zu ungünstigeren Ergebnissen aus Sicht des Parlaments geführt hätte, so dass es schliesslich dem ursprünglichen Gesetzesentwurf zustimmte. Auch hier erleich-terte die direkte Demokratie es der Exekutive, politische Führung zu zeigen, und erhöhte damit die Reformfähigkeit.
Im schweizerischen Kontext wird eher dem (fakultativen) Referendum ange-lastet, dass es Reformen verhindere (Rentsch et al. 2004; Borner, Brunetti und Straubhaar 1990, 1994). Es biete den Interessengruppen ein zusätzliches Instru-ment, um ihre Einsprüche gegen Reformen geltend zu machen, und verlangsame somit den Reformprozess. In der Tat kann es dadurch zu einer Verlangsamung oder gar Verhinderung eines Reformprozesses kommen. Eine solche Reform ist dann jedoch durch eine Mehrheit der Stimmbürger und nicht einfach durch den Widerstand der betroffenen Interessengruppe zu Fall gebracht worden.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 167
Was aber sind Reformen wert, die keine Unterstützung durch die Bevölke- rung erhalten? Politische Führung genügt an dieser Stelle nicht. Grundlegende Reformen müssen breit abgestützt sein, damit sie nachhaltig wirken können und nicht bei der nächstbesten Gelegenheit wieder rückgängig gemacht werden. Selbst Margaret Thatcher wusste bei ihrer harten Haltung gegen die britischen Gewerkschaften die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Die Institution des Referendums hilft den politischen Entscheidungsträgern noch stärker, sich auf die Reformwünsche der Bürger einzustellen und Fehler zu vermeiden (Matsu-saka 2004).
Völlig abwegig ist es jedoch, wenn behauptet wird, die direkte Demokratie sei an der Wachstumsschwäche der Schweizer Wirtschaft schuld (Borner und Bodmer 2004). In einer ersten Analyse zum Einfluss der direkten Demokratie auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kantone stellen Feld und Savioz (1997) fest, dass die direkten Volksrechte im Unterschied zu den Behauptungen von Borner et al. (1990, 1994) sogar zu einem signifikant höheren BIP pro Kopf geführt haben. Dieses Ergebnis hielt einer Reihe von Robustheitstests stand. Ger-mann (1999) kritisierte etwa, dass direkte Demokratie falsch gemessen würde. Freitag und Vatter (2000) und Kirchgässner, Feld und Savioz (1999) konnten diese Ergebnisse jedoch mit alternativen Massen für die direkte Demokratie bestäti-gen. Zudem stärkt die Evidenz von Blomberg, Hess und Weerapana (2004) für die USA diesen Befund. Hinreichende Argumente, warum direkte Demokratie auf Bundesebene schädlich sein sollte, wenn sie sich auf der Kantonsebene als günstig herausgestellt hat, lassen sich bislang nicht finden (Feld 2004).
Vitaler Föderalismus als innovationsgenerierender Prozess
Der Föderalismus schweizerischer Prägung kennt durch die weitgehende Steuer- autonomie der Kantone und ihre starke Stellung bei der zentralstaatlichen Ent- scheidungsfindung tief verankerte vertikale Checks and Balances (Vatter und Wälti 2003; Wagschal 2002). Auch die institutionell abgesicherte vertikale Machtteilung im Bundesstaat schafft zusätzliche Vetomöglichkeiten im Reform-prozess. Bei dieser Kritik wird die Rolle des Föderalismus als wissens- und inno-vationsgenerierender Prozess vernachlässigt (Walker 1969; Feld und Schnellen-bach 2004). Politische Reformen sind nicht risikolos. Bei dezentraler Leistungs-erstellung und Finanzierung ist es möglich, mit neuen staatlichen Lösungen für wirtschaftliche Probleme dezentral zu experimentieren. Die Hemmschwelle zur Durchführung von Reformen wird dadurch herabgesetzt, weil das Scheitern von Politikexperimenten mit geringeren Kosten als bei zentralstaatlichen Refor-men verbunden ist. Ein Vergleichswettbewerb zwischen den Kantonen führt zur Verbreitung von Wissen in der Politik und somit in einer dynamischen Pers-pektive zu Effizienzsteigerungen (Besley und Case 1995; Kerber 1998). Je schlech-
168 DEBATTE
ter die eigene politische Performance einer Kantonsregierung im Vergleich zu den Nachbarregierungen und je näher die Wettbewerber, desto eher werden Reformen angeregt (Schaltegger 2004). Oates (1999) spricht in diesem Zusammenhang von ‘laboratory federalism’ und verweist darauf, dass die Reform der amerikanischen Sozialhilfe von 1996 aus diesem Grund eine Rückverlagerung von Kompetenzen von der Bundesebene auf die Ebene der Bundesstaaten vornahm.
Die Argumente für eine innovationsfördernde Wirkung des fiskalischen Wett- bewerbs sind jedoch umstritten. Da die Wirkung politischer Reformen mit Unsicher-heiten behaftet ist, haben risikoscheue politische Unternehmer Anreize, sich abwar-tend zu verhalten und die sich ex post als überlegen erweisenden Lösungen zu imi-tieren bzw. auf ihre Bedürfnisse zu adaptieren. Es entsteht ein Trittbrettfahrerprob-lem (Rose-Ackerman 1980). Zudem bieten Politikinnovationen im föderalen Staat eigennützigen Politikern die Möglichkeit, sich persönliche Vorteile zu verschaffen und als Resultat der Unsicherheit von Politikinnovationen herauszustellen (Kotso-giannis und Schwager 2001). Schliesslich sind die Anreize der Bürger, sich über Poli-tik zu informieren, gering, so dass eher Skepsis angebracht ist, ob sie die Politiker zu Reformen anhalten (Schnellenbach 2004). Die erfolgreiche Diffusion von Politikin-novationen setzt daher echten Wettbewerb um knappe Ressourcen voraus. Mobile Individuen haben im Föderalismus Anreize, sich Informationen über alternative Wohn- und Standorte zu beschaffen, und erhöhen so den Druck auf die Politik, sich aktiv den Herausforderungen zu stellen.
Auch für den Einfluss des Föderalismus auf politische Innovation lässt sich empirische Evidenz finden. Widmer und Rieder (2003) belegen die Diffusion kantonaler Verwaltungsreformen durch einen Vergleichswettbewerb zwischen den Schweizer Kantonen. Nach Ladner und Steiner (2003) führt dies auf der Schweizer lokalen Ebene lediglich zu einer mässigen Konvergenz der Lösungen. Es dominiert eine Vielfalt der Lösungsansätze über die Adaption der Gemeinden an ihre jeweiligen Verhältnisse und Präferenzen. In ihrem Vorwort weisen Vatter und Wälti (2003) darauf hin, dass der Schweizer Föderalismus unter dem Strich eher kein Hemmschuh für Reformen in der Schweiz darstellt.
In einer Untersuchung der Effekte einzelner Instrumente des Föderalismus auf die ökonomische Leistungsfähigkeit von Schweizer Kantonen zwischen 1980 und 1998 liefern Feld, Kirchgässner und Schaltegger (2004) zudem empirische Belege dafür, dass der schweizerische Föderalismus eher positiv für die wirtschaftliche Performanz ist. Weder Steuerwettbewerb noch die Fragmen- tierung eines Kantons in seine Gemeinden sind schädlich für die ökonomische Leis-tungsfähigkeit. Steuerwettbewerb erhöht das kantonale BIP pro Erwerbstätigen vielmehr dadurch, dass er die öffentliche Hand zu einem effizienten Einsatz ihrer Ressourcen zwingt, wohingegen die fehlende Ausschöpfung von Skalenerträgen bei dezentraler Leistungserstellung und -finanzierung, etwa bei starker Fragmen-tierung eines Kantons in Gemeinden, eher unbedeutend ist. Feld und Dede (2004)
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 169
legen schliesslich Evidenz für die OECD-Länder vor, dass Föderalismus sich positiv auf deren Wirtschaftswachstum auswirkt.
Konkordanz unterstützt in der Tendenz das Wirtschaftswachstum
Auch die Auswirkung der Konkordanz auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes ist umstritten. Einerseits vertreten breit gestützte Regierungskoali-tionen weniger gezielt Partikularinteressen als Einparteienregierungen. Konkor-danzregierungen sind daher gezwungen, eine breite Interessenvertretung wahr-zunehmen, die gesamtwirtschaftlichen Belangen eher als eine Einparteienregierung Rechnung trägt. Es ist folglich auch mit weniger Regierungswechseln zu rechnen, die die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Politik beeinträchtigen. Dies alles wirkt sich positiv auf das Vertrauen der wirtschaftspolitischen Akteure in die sta-atlichen Institutionen aus und begünstigt damit die wirtschaftliche Leistungsfähig-keit einer Volkswirtschaft (Lijphart und Crepaz 1991; Crepaz 1996).
Andererseits wird argumentiert, dass breite Koalitionsregierungen eine wenig kohärente und undisziplinierte Fiskalpolitik verfolgen. Die breite Zusammenset-zung der Exekutive kann nämlich auch dazu führen, dass die Regierung anfällig auf Transferbegehren diverser Interessengruppen wird (Roubini und Sachs 1989). Beim letzten Argument zeigen jüngste Forschungsergebnisse jedoch, dass es entschei-dend ist, die Grösse der Regierung von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung zu unterscheiden (Schaltegger und Feld 2004). Berücksichtigt man beide Einflussfak-toren simultan, zeigt sich, dass die undisziplinierte Fiskalpolitik weniger durch die Grösse der Koalition als vielmehr durch die Grösse des Kabinetts verursacht wird. Dies deshalb, weil die einzelnen Minister bei ihren Entscheidungen zwar die volle Verantwortung für die Ausgaben in ihrem Aufgabenbereich übernehmen, aber nur einen Teil der Verantwortung für die ausgelösten Kosten tragen, die durch die allge-meine Steuererhebung auch den anderen Fachbereichen in der Regierung zufallen.
Eine Reformagenda mit der Unterstützung des Volks
Kritiker der politischen Institutionen in der Schweiz argumentieren, eine stärkere Ausprägung des Wahlwettbewerbs anstatt der Sachabstimmungen garantiere, dass die kompetentesten Politiker mit der Durchführung der Reformen betraut werden. Damit die Reformen zügig an die Hand genommen werden können, bedürfe es daher zusätzlich einer Erweiterung der Machtbefugnisse der gewählten Politiker. Das heisst, ein grösserer diskretionärer Spielraum zur Politikgestaltung durch Abbau institutioneller Hemmnisse sei notwendig.
Vor dem Hintergrund der empirischen Erkenntnisse vermag diese Kritik nicht zu überzeugen. Die publikumswirksam vorgetragene anekdotische Evidenz, dass konkordante Regierungssysteme nur halbherzige Reformschritte zulassen, direkte
170 DEBATTE
Volksrechte die Ausbildung einer politischen Elite verhindern und der kleinräu-mige Föderalismus einzig für Protektion missbraucht wird, steht in Kontrast zu den Ergebnissen systematischer Untersuchungen über die Wirkung dieser politischen Institutionen. Nur im Nirvana ist bessere Politik durch möglichst uneingeschränkte politische Führung ohne Gewaltenteilung zu erreichen. In einer vergleichenden Per-spektive stellt sich für die Schweiz nicht die Frage nach dem Abbau von Checks and Balances, sondern vielmehr die nach der adäquaten Ausgestaltung wirtschaftspoli-tischer Reformen. Nur mit der Unterstützung durch die Stimmbürger und nicht gegen sie wird es gelingen, rationale und nachhaltig wirkende Reformen durch-zuführen.
Bibliographie
Besley, Tim und Anne C. Case (1995). ”Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition”, American Economic Review 85(1): 25 – 45.
Blomberg, S.Brock, Gregory D. Hess und Akila Weerapana (2004). ”The Impact of Voter Initiatives on Economic Activity, European Journal of Political Economy 20(1): 207 – 226.
Borner, Silvio und Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Wachstum – Eine Schweizer Illusion. Zürich: Orell Füssli.
Borner, Silvio, Aymo Brunetti und Thomas Straubhaar (1990). Schweiz AG: Vom Sonderfall zum Sanierungsfall? Zürich: NZZ.
Borner, Silvio, Aymo Brunetti und Thomas Straubhaar (1994). Die Schweiz im Alleingang. Zürich: NZZ.
Crepaz, Markus M.L. (1996). ”Consensus Versus Majoritarian Democracy: Political Institutions and Their Impact on Macroeconomic Performance and Industrial Disputes”, Comparative Political Studies 29(1): 4-26.
Feld, Lars P. (2004). Ein Finanzreferendum auf Bundesebene – Chancen, Risiken und Ausgestaltung. Gutachten zuhanden der Kommission für Konjunkturfragen (KfK) im Rahmen ihres Jahresberichts 2004.
Feld, Lars P. und Tarik Dede (2004). Fiscal Federalism and Economic Growth: Cross-Country Evidence for OECD Countries. Unveröffentlichtes Manuskript, Philipps-Universität Marburg.
Feld, Lars P. und Marcel R. Savioz (1997). ”Direct Democracy Matters for Economic Performance: An empirical Investigation”, Kyklos 50(4): 507-538.
Feld, Lars P. und Jan Schnellenbach (2004). ”Begünstigt fiskalischer Wettbewerb die Politikinnovation und -diffusion? Theoretische Anmerkungen und erste Befunde aus Fallstudien”, in Christoph A. Schaltegger und Stefan Schaltegger (Hrsg.). Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Zürich: vdf, S. 259-277.
Feld, Lars P., Gebhard Kirchgässner und Christoph A. Schaltegger (2005). ”Fiskalischer Föderalismus und wirtschaftliche Entwicklung: Evidenz für die Schweizer Kantone”, Jahrbuch für Regionalwissenschaft/Review of Regional Research 25 (1): 3-25.
Freitag, Markus und Adrian Vatter (2000). ”Direkte Demokratie, Konkordanz und Wirtschaftsleistung: Ein Vergleich der Schweizer Kantone”, Swiss Journal of Economics and Statistics 136(4): 579-606.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 171
Germann, Reimund E. und Fabrizio Gilardi (1999). Die Kantone: Gleichheit und Disparität”, in U. Klöti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder und Y. Papadopoulos (Hrsg.). Handbuch der Schweizer Politik/Manuel de la politique suisse, Zürich: NZZ Verlag, S. 387-420.
Kerber, Wolfgang (1998). ”Zum Problem einer Wettbewerbsordnung für den Systemwettbewerb”, Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie 17: 199 – 230.
Kirchgässner, Gebhard; Lars P. Feld und Marcel R. Savioz (1999). Die direkte Demokratie: Modern erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig. Basel, München: Helbing und Lichtenhahn.
Kotsogiannis, Costas und Robert Schwager (2001). Policy Uncertainty and Policy Innovation.mimeo. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).
Ladner, Andreas und Reto Steiner (2003). ”Die Schweizer Gemeinden im Wandel, Konvergenz oder Divergenz? Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 9(1): 233-259.
Lijphart, Arend und Markus M.l. Crepaz (1991). ”Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Conceptual and Empirical Linkages”, British Journal of Political Science 21(2): 235-246.
Matsusaka, John G. (2004). For the Many or the Few, The Initiative, Public Policy, and American Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
Oates, Wallace E. (1999). ”An Essay on Fiscal Federalism”, Journal of Economic Literature 37(3): 1120–1149.
Rentsch, Hans, Stefan Flückiger, Thomas Held, Yvonne Heiniger und Thomas Straubhaar (2004). Ökonomik der Reform: Wege zu mehr Wachstum in der Schweiz. Zürich: Orell Füssli.
Rose-Ackerman, Susanne (1980). ”Risk-Taking and Reelection: Does Federalism Promote Innovation?”, Journal of Legal Studies 9(2): 593–616.
Roubini, Nouriel und Jeffrey Sachs (1989). ”Government Spending and Budget Deficits in the Industrialized Countries”, Economic Policy 8(2): 99-132.
Schaltegger, Christoph A. (2004). ”Finanzpolitik als Nachahmungswettbewerb: Empirische Ergebnisse zu Budgetinterdependenzen unter den Schweizer Kantonen”, Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 10(2): 61–85.
Schaltegger, Christoph A. und Lars P. Feld (2004). ”Do Large Governments Favor Large Governments? Evidence from Swiss Sub-Federal Jurisdictions”. CESifo Working Paper No. 1294.
Schnellenbach, Jan (2004). Dezentrale Finanzpolitik und Modellunsicherheit: Eine theoretische Untersuchung zur Rolle des fiskalischen Wettbewerbs als Wissen generierender Prozess.Tübingen: Mohr Siebeck.
Vatter, Adrian und Sonja Wälti (Hrsg.) (2003). Schweizer Föderalismus in Vergleichender Perspektive: Sondernummer der Schweizerischen Zeitschrift für Politikwissenschaft 9(1). Chur, Zürich: Rüegger.
Wagschal, Uwe (2002). ”Der Preis des Föderalismus”, in Uwe Wagschal und Hans Rentsch (Hrsg.). Der Preis des Föderalismus. Zürich: Orell Füssli, S. 11-27.
Walker, Jack L. (1969). ”The Diffusion of Innovation Among the American States”, American Political Science Review 63(4): 880-899.
Widmer, Thomas und Stefan Rieder (2003). ”Schweizer Kantone im institutionellen Wandel. Ein Beitrag zur Beschreibung und Erklärung institutioneller Reformen”, Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 9(1): 201-231.
172 DEBATTE
Zum Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschaftswachstum1
Prof. Dr. Gebhard Kirchgässner, Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung, Universität St. Gallen, und CESifo und Leopoldina; E-Mail: [email protected]
Der Zusammenhang zwischen staatlicher Aktivität und wirtschaftlicher Entwick-lung ist ein wissenschaftlich interessantes Problem und gleichzeitig ein politisch heiss debattiertes Thema. Dies gilt besonders in einer Situation wie derjenigen der Schweiz, die seit den neunziger Jahren eine kaum bestrittene Wachstums-schwäche aufweist, welche mit einem Anstieg der Staatsquote einhergeht. Diejeni-gen, welche den Staat zurückbinden möchten, haben ein Interesse daran, dass ein negativer Zusammenhang aufgezeigt wird, während diejenigen, die dem Staat neue Aufgaben übertragen möchten, einen solchen Zusammenhang verleugnen.
In einer neueren Arbeit versucht Schaltegger (2004) zu zeigen, dass das Wachstum in in Kantonen mit geringer Staatsquote – ceteris paribus – höher ist als in Kantonen mit hoher Staatsquote.2 Mit den gleichen Daten lässt sich jedoch ‘beweisen‘, dass das Wirtschaftswachstum umso höher ist, je höher die Staatsaus-gaben pro Kopf sind. Beide Aussagen scheinen sich zu widersprechen. Tatsächlich liegt den Ergebnissen jedoch Umkehrkausalität zugrunde: Reiche Kantone mit hohem Wirtschaftswachstum können ihren Bürgerinnen und Bürgern mehr Leis-tungen bieten und haben dennoch eine geringere Staatsquote als arme Kantone mit geringem Wachstum. Die Schätzergebnisse von Schaltegger sind daher nicht geeignet, die politische Forderung nach einer Verringerung der Staatsquote im Interesse einer Belebung des Wachstums in der Schweiz zu stützen.
Im folgenden sollen zunächst Schätzungen für den Zusammenhang zwischen Staatsquote und Wirtschaftswachstum und anschliessend für den Zusammenhang zwischen Staatsausgaben pro Kopf und Wirtschaftswachstum vorgestellt werden. Danach wird anhand eines einfachen theoretischen Modells erläutert, wie diese scheinbar gegensätzlichen Ergebnisse zustande kommen können.
Staatsquote und Wirtschaftswachstum in den Kantonen
Mit Hilfe einer Panelanalyse über den Zeitraum von 1981 bis 2001 untersucht Schaltegger (2004), ob in den 26 Kantonen die Staatsquote, definiert als Ausga-ben der Kantone und Gemeinden als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, oder die
1 Ich möchte Christoph A. Schaltegger (Eidgenössische Steuerverwaltung und Universität St. Gallen) danken, dass er mir die von ihm aufbereiteten und verwendeten Daten zur Verfügung gestellt hat.
2 Zum Zusammenhang zwischen Staatsquote und wirtschaftlicher Entwicklung gibt es im Anschluss an Barro (1991) eine Reihe internationaler Arbeiten sowie auch einige Arbeiten über die Schweiz. Siehe hierzu die Übersicht in Kirchgässner (2004).
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 173
Steuerquote signifikante Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum hatten. Hierzu verwendet er folgende Schätzgleichung:3
(1) yi,t – yi,t-1 = ß0 + ß1 (gi,t – yi,t) + ß2 yi,t-1 + + δt + ωi + εi,t.
Dabei sind yi,t das logarithmierte reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Kanton i, i = 1, …, 26, im Jahr t, t = 1981, …, 2001, gi,t die logarithmierten Staats-ausgaben pro Kopf, weshalb (gi,t – yi,t) die logarithmierte Staatsquote darstellt, Xj,i,t, j = 1, …, k, eine Reihe weiterer erklärender Variablen, wie z.B. die Erwerbs- oder die Arbeitslosenquote, δt eine Hilfsvariable für das Jahr t, die für dieses Jahr den Wert Eins annimmt und sonst den Wert Null hat, ωi eine entsprechende Hilfsvariable für den Kanton, sowie εi,t ein stochastisches Restglied. Durch den Einbezug dieser Hilfsvariablen, d.h. ‘fester Effekte‘ sowohl für die Zeit als auch für die einzelnen Jahre, erfassen die Schätzungen ausschliesslich kurzfristige Abweichungen von den Durchschnittswerten der Kantone sowie von der allge-meinen Entwicklung.
Schaltegger kommt zu dem Ergebnis, dass die Staatsquote einen hoch signi-fikanten negativen Einfluss, die Steuerquote bestenfalls einen marginal signifi-kanten negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum der Schweiz hatte. Dies zeigen die in Tabelle 1 nachgeschätzten Ergebnisse seiner beiden wohl wichtigsten Gleichungen, wobei freilich jetzt die Steuervariable auch nicht mehr marginal signifikant ist; ihre Signifikanz ist von jedem konventionellen Signifikanzniveau weit entfernt.4
Die unterschiedlichen Ergebnisse für die Staats- und die Steuerquote deuten daraufhin, dass Umkehrkausalität vorliegt. Die Staatsausgaben werden jeweils im Vorjahr im Haushaltsplan in Abhängigkeit von der erwarteten Entwicklung festgelegt. Verläuft die Konjunktur besser als erwartet, sinkt die Staatsquote, während sie bei einer schlechteren Entwicklung steigt. Diese negative Korrela-tion schlägt sich in den Ergebnissen nieder und wird als negativer Einfluss der Staatsquote auf das Wirtschaftswachstum interpretiert. Bei den Steuereinnahmen ist die Situation komplizierter. Sie ergeben sich in Abhängigkeit von der tatsächli-chen Entwicklung, aber wegen der Vergangenheitsbesteuerung mit einer Ver-zögerung von ein bis zwei Jahren. Soweit die Entwicklung zyklisch verläuft, kann sich auch hier ein negativer Zusammenhang ergeben, aber er dürfte deut-lich weniger stark ausgeprägt sein als bei den Ausgaben. Insofern verwundert es nicht, dass hier keine Signifikanz mehr gegeben ist.
( )k
j 2 j,i,tj 1
X+=β∑
3 Siehe hierzu Schaltegger (2004: 4). 4 Der Grund für die hier gegenüber den Angaben bei Schaltegger deutlich niedrigeren
t-Statistiken liegt darin, dass wir die geschätzten Varianzen der Koeffizienten mit Hilfe des Newey-West-Verfahrens um die möglichen Auswirkungen von Autokorrelation und Heteroskedastie korrigiert haben.
174 DEBATTE
Tabelle 1: Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, 1980–2001, 546 Beobachtungen
Modell (1) (2) (3) (5)
Verzögertes BIP -0.142***(4.89)
-0.129***(5.08)
-0.137***(5.69)
-0.122***(4.97)
Staatsquote -0.064**(3.11)
Steuerquote -0.010(0.78)
Staatsausgaben pro Kopf 0.036(*)(1.95)
Steuereinnahmen pro Kopf
0.011(*)(1.86)
Private Investitionen 0.003(0.46)
-0.010(0.98)
-0.017*(2.02)
-0.010(1.57)
Erwerbsquote 0.046(1.59)
0.029(0.98)
0.014(0.50)
0.024(0.82)
Urbanisierung 0.012(0.76)
0.023(1.42)
0.027(*)(1.66)
0.023(1.42)
Bevölkerung -0.109**(2.70)
-0.109**(2.70)
-0.112**(2.71)
-0.118**(2.87)
Anteil der Bevölkerung unter 19 Jahren
0.102(1.43)
0.118(*)(1.71)
0.107(1.52)
0.093(1.33)
Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren
0.129(*)(1.93)
0.187*(2.46)
0.218**(2.97)
0.93**(2.72)
Hilfsvariable für den deutschen Sprachraum
-0.031(0.96)
-0.019(0.59)
-0.009(0.28)
-0.019(0.62)
Maturandenquote -0.021(0.83)
-0.021(0.83)
-0.032(1.22)
-0.027(1.03)
Arbeitslosenquote -0.002**(3.31)
-0.002**(3.25)
-0.002**(3.07)
-0.002**(3.04)
0.592 0.576 0.579 0.577
Standardfehler 0.007 0.007 0.007 0.007
Jarque-Bera Teststatistik 710.773*** 921.881*** 1052.154*** 1077.998***
Die Zahlen in Klammern sind die absoluten Werte der geschätzten t-Statistiken, wobei die Standardfehler nach Newey-West korrigiert wurden. ‘***’, ‘**’, ‘*’ bzw. ‘(*)’geben an, dass die entsprechende Nullhypothese auf dem 0.1, 1, 5, bzw. 10 Prozent Signifikanzniveau verwofen werden kann.
Staatsaugaben pro Kopf und Wirtschaftswachstum
Will man diesen Effekt, der sich dadurch ergibt, dass in der Staats- bzw. Steuer-quote das Sozialprodukt pro Kopf (und damit die abhängige Variable) im Nenner enthalten ist, ausschalten, kann man anstelle der Staatsquote die Staats-ausgaben (bzw. Steuern) pro Kopf als erklärende Variable verwenden. Dann ergeben sich sowohl für die Staatsausgaben als auch für die Steuern positive, auf dem 10 Prozent Niveau signifikante Effekte; eine Ausdehnung der Staats-
2R
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 175
tätigkeit scheint jetzt das Wirtschaftswachstum zu verstärken. Auch hier kann man jedoch argumentieren, dass Umkehrkausalität vorliegt: Kantone mit hoher Wirtschaftskraft haben nicht nur höhere Steuereinnahmen pro Kopf, sondern können sich auch leisten, den Bürgern mehr Leistungen zur Verfügung zu stel-len.
Die negativen bzw. positiven Vorzeichen der Staatsausgaben und Steuern in diesen Gleichungen dürften sich dadurch ergeben, dass die verwende-ten Schätzgleichungen tatsächlich zwar einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftskraft (Bruttoinlandprodukt pro Kopf) und Staatsquote (bzw. Steuer-quote), aber nicht zwischen Wirtschaftswachstum und Staatsquote impliziert. Eine einfache Umformulierung von (1) führt zu
(1‘) yi,t = ß0 + ß1 (gi,t – yi,t) + (1 + ß2) yi,t-1 + + δt + ωi + εi,t.
Eine konstante Staatsquote, wie hoch sie auch immer sei, hat bei gegebenem Wert der Vorperiode in diesem Modell keinerlei Einfluss auf das heutige Brutto-inlandprodukt pro Kopf und damit auch nicht auf dessen Wachstumsrate; sie ‘geht im konstanten Glied unter’: Nur Veränderungen der Staatsquote haben einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. Bei konstanter Staatsquote ist das Wirtschaftswachstum in diesem Modell – ceteris paribus – exogen und wird durch die zeitabhängige Hilfsvariable δt erzeugt.
Dies erklärt freilich nicht den Wechsel der Vorzeichen in den in Tabelle 1 wie-dergegebenen Gleichungen. Hierzu macht es Sinn, vom traditionellen Modell zur Erklärung der Staatsausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen auszuge-hen, d.h. von
(2) G = α + β Y,
wobei G die Staatsausgaben und Y das Volkseinkommen sind. Generell kann angenommen werden, dass zwischen Staatsausgaben und Volkseinkommen eine positive Beziehung besteht, d.h. dass
(3) = β > 0
gilt. Für das Verhältnis zwischen Staatsquote und Volkseinkommen gilt jedoch
(4) < 0 für α > 0,
d.h. wir finden eine negative Beziehung.
GY∂∂
2
GYY Y
∂ α= −∂
( )k
j 2 j,i,tj 1
X+=β∑
176 DEBATTE
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Staatsausgaben pro Kopf, Durchschnittswerte, 1981–2001
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Staatsquote, Durchschnitts-werte, 1981–2001
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
12 16 20 24 28 32
Wac
hstu
msr
ate
des
real
en B
IP p
ro K
opf
Ausgabenquote
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Staatsausgaben pro Kopf
Wac
hstu
msr
ate
des
real
en B
IP p
ro K
opf
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 177
Damit dies auch zu einem Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate der Wirtschaft auf der einen Seite und den Staatsausgaben und Steuereinnah-men pro Kopf auf der anderen Seite führt, müssen jene Kantone, die ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aufweisen, auch stärker wachsen. Tatsächlich beobachten wir, wie Abbildung 1 zeigt, für den Zeitraum von 1981 bis 2001 eine Korrelation von 0.306 zwischen der durchschnittlichen Wachstumsrate und den realen Staatsausgaben pro Kopf in den Kantonen. Abbildung 2 zeigt dagegen den Zusammenhang zwischen der Ausgabenquote und dem Wirtschaftswachstum; hier ist der Zusammenhang mit -0.266 wie erwartet negativ.
Abschliessende Bemerkungen
Somit dürfte sich die unterschiedlichen Schätzergebnisse aus der föderalen Struktur der Schweiz ergeben. Kantone mit hoher Wirtschaftskraft und hohem Wirtschaftswachstum können ihren Bürgen relativ viele Leistungen zukom-men lassen und haben dennoch vergleichsweise geringe Steuersätze. Damit die ärmeren Kantone für ihre Bürger auch nur annähernd die gleichen Leistungen erbringen können, müssen deren Steuersätze sehr viel höher sein, was eine höhere Staatsquote mit sich bringt. All dies sagt nichts darüber aus, wie sich eine bestimmte Höhe der Staatsquote auf die wirtschaftliche Entwicklung aus-wirkt. Dazu kommt, dass selbst dann, wenn ein solcher Zusammenhang auf der Ebene der Kantone zweifelsfrei nachgewiesen werden könnte, völlig offen ist, ob dies Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung in der Schweiz hatte oder nur Verschiebungen zwischen den Kantonen bewirkte. Sie rechtfertigen damit auch keine politischen Forderungen nach einer Senkung der Staatsquote.
Bibliographie
Barro, Robert J. (1991). ”Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics 106(2): 407–443.
Kirchgässner, Gebhard (2004). ”Zum Zusammenhang zwischen staatlicher Aktivität und wirtschaftlicher Entwicklung”, Diskussionspapier Nr. 2004-16, Volkswirtschaftliche Abtei-lung der Universität St. Gallen .
Schaltegger, Christoph A. (2004). Ist die Höhe der Staatsquote schuld an der Schweizer Wachstums-schwäche? Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Abteilung Steuerstatistik und Dokumentation, Bern. (http://www.estv.admin.ch/data/sd/d/pdf/wachstum.pdf (16/08/04)), gekürzt in Die Volkswirtschaft 78(1/2): 55–58.
178 DEBATTE
Economic growth in Switzerland: What can the government do?1
Jan-Erik Lane, Department of Political Science, University of Geneva; E-Mail: [email protected] Dominic Rohner, Faculty of Economics, University of Cambridge; E-Mail: [email protected]
The overall predicament of the Swiss economy today is well-known as to its basic macro features: low economic growth, stagnating employment, and growing fiscal deficits at the local and cantonal government levels (Borner and Bodmer 2004). These facts call for an explanation. And such a theory of Swiss dismal growth may be employed to state a growth promoting policy. Why, then, has Switzerland a growth problem today, when it used to have Asian miracle growth rates after World War II?
These irrefutable outcomes should first be related to the theory of leading Swiss economists and political scientists (e.g. Kirchgässner and Pommerehne 1996; Feld and Savioz 1997; Frey and Stutzer 2000; Freitag and Vatter 2000) pre-dicting that the political institutions of the country frame its economic results. The basic model of the Swiss public choice school links political institutions and economic outcomes in a positive probabilistic manner. Thus, Switzerland’s refe-rendum democracy and its strong, real dualistic federalism as well as its peculiar consociational government constitute a major explanation of the affluence of the country. Since the political institutions of the country remain the same as when this public choice theory of Swiss economic dynamism was first launched, we must ask the question what explains the weakened Swiss macroeconomic per-formance, given that the established theory is no longer in agreement with the irrefutable facts.
We suggest that the Swiss referendum, its grand coalition as well as Swiss federalism do not have an inherent tendency towards promoting affluence and economic growth, limiting rent-seeking and undoing the power of distributional coalitions. It seems that varying distributional coalitions score victory after vic-tory in referenda and elections wanting to increase public spending for various purposes. The Swiss institutional framework is in our view not the major explan-atory factor of the public sector expansion and the evolution of the tax state, as also preferences and socio-demographic factors (e.g. the percentage of elderly people etc.) decide, not only institutions. An explanation of the overall low growth rates in the Swiss economy since 1990 must focus in our view to a smaller extent on political institutions than on economic and social policy. In the present
1 We would like to thank Werner Seitz and Heiner Ritzmann from the Swiss Statistical Office and Elsbeth Etter from the Swiss Finance Department for providing data. As well helpful comments from Dalibor Eterovic and Peter Jensen are gratefully acknowledged.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 179
contribution we will focus on different social policies. Due to limited space we cannot treat other potential explanations of low growth in Switzerland: Military spending, agricultural subsidies, cartels etc.
Below, a set of regression models will be explored to the aim of estimating the influence of the size of the public sector and of several sorts of policies upon economic growth during the post-war period. The underlying framework is a simple Solow-style growth model, described in equation 1.
(1)
where Y=Gross domestic product, A=Total factor productivity, K=Capital, L=Labor, H=Human capital, , β=parameters between 0 and 1.
Growth in GDP per capita results from growth in total factor productivity or from an accumulation of physical or human capital. As levels of human capital are difficult to estimate, we will mainly refer to physical capital in the following analysis. Public spending for allocative or income maintenance purposes mat-ters positively for economic growth in various ways. Certain expenditures can affect the level of total factor productivity (e.g. rule of law, contract enforcement), the level of capital accumulation (e.g. public infrastructure, property rights pro-tection) and the level of human capital (e.g. education). However, public spen-ding has an opportunity cost, namely the crowding out of private spending due to less disposable income. As a result, public spending can reduce economic growth when a certain threshold has been broken and the size of allocative and redistributional expenditures escalate.
The relationship between public expenditures and economic growth is that of an inverted U-curve: at low levels of expenditure increases in public resource allocation or transfer payments lead to economic expansion among others because of the establishment of the rule of law and of political stability (Rohner 2005), but at high levels of expenditure more of public allocation or insurance reduces growth rates. To account for the hyperbolic nature of the impact of public expenditures upon growth we would have to go into micro foundations, especially the theory of incentives: crowding out capital, tax wedges, work-lei-sure trade-off, inefficiencies due to lack of productivity or rent-seeking, delocali-zations etc.
For the empirical analysis of the impact of the Swiss welfare state upon economic growth time series data for Switzerland from 1960 to 2002, provided mainly by the Swiss Statistical Office, are used. First, we can study the corre-lations between the variables displayed in Table 1. We can see that variables linked to public spending are negatively correlated and capital accumulation is positively correlated with economic growth.
��
LH
LK
LA
LY
180 DEBATTE
Table 1: Pearson correlations between the key variables
Note: See statistical annex for sources and abbreviations.
Now, public spending is not exogenous, but depends on the state of the econ-omy. Notably, in times of bad economic performance the government tends to re-launch the economy by increasing public spending. Similarly, a positive cor-relation between economic growth and capital accumulation could mean that either too low a level of investments lowers growth, or alternatively, that in times of economic recession company investments are insufficient. Thus, simple corre-lations cannot tell whether increased public spending is the main reason or rather a consequence of bad economic performance. Because of the endogeneity bias described above, we cannot use ordinary least squares (OLS) estimators, but we need to use the estimation method of two-stage least squares (2SLS).
For reasons of multicollinearity, we have not been able to include more than one of the key variables per different specifications. This certainly makes our analysis less interesting, but is the only valid statistical procedure to follow. In all specifications the dependent variable is the growth of GDP per capita, and the independent variables include capital accumulation, the size of the public sector, social insurance or transfer payments, education spending and health spending. The results of the regression analysis are summarized in Table 2.
The percentage of the population aged 65 years or more (AGE) and the fertil-ity rate (FERTIL) have been used as instrumental variables in all specifications. These two variables are exogenous for certain, are highly correlated with the explanatory variables and not significantly correlated with the error terms in all of the specifications. We have done several tests and adjustments. When multi-collinearity was a problem, it has been eliminated by changing the specification rather than by ”mechanical methods”. We have as well tested for stationarity, using the augmented Dickey-Fuller test (ADF). All variables in all specifications appear to be non-stationary at a 1% level. However, as they are co-integrated in all equations, this does not affect the validity of the results. Performing the White test, all equations have moreover been tested for heteroskedasticity. When heteroskedasticity has been found, it has been corrected using White heteroske-dasticity-consistent standard errors and covariance. Further, we have tested for autocorrelation, and where appropriated, corrected it by including AR(1) terms.
GDP_GROWTH CAP_ACCUM PUB_SEC EDUC HEALTH SOC_SPE RETIREM PENSION AGE FERTIL POPGDP_GROWTH 1.00CAP_ACCUM 0.59 1.00PUB_SEC -0.65 -0.90 1.00EDUC -0.62 -0.75 0.89 1.00HEALTH -0.63 -0.71 0.85 0.99 1.00SOC_SPE -0.62 -0.72 0.84 0.98 0.99 1.00RETIREM -0.64 -0.75 0.89 0.99 0.99 0.99 1.00PENSION -0.55 -0.64 0.75 0.94 0.96 0.98 0.94 1.00AGE -0.58 -0.75 0.92 0.95 0.93 0.90 0.96 0.82 1.00FERTIL 0.48 0.81 -0.90 -0.78 -0.72 -0.70 -0.78 -0.59 -0.90 1.00POP -0.55 -0.71 0.88 0.97 0.96 0.96 0.96 0.93 0.93 -0.78 1.00
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 181
Table 2: 2SLS-Regressions with growth in GDP per capita as explained variable
Note: See statistical annex for sources and abbreviations. The t-stats are in the brackets. *** = significant at a level of confidence of 1%, ** = significant at a level of confidence of 5%.
The results of Table 2 indicate that capital accumulation has a positive impact on economic growth and that different kinds of public spending lower growth. Or to put it differently, the Swiss growth malaise during the last years could be explained by increased public expenditures and by too low a level of physical capital accumulation. We can see that the variables of the size of the public sector, of education and of health spending are significant at a level of 5%, whereas the variable of social spending and social insurance is significant at a level of 1%.
At first sight it seems surprising that education appears to have a negative impact on growth, as flows of education spending can be seen as accumulation of human capital. One explanation is that even if education increases tax burden in the short run, it may have a positive impact in the very long-run. Due to the limited length of our time series, we could not perform a statistically significant test for this. Another explanation would be that Swiss education spending was not used in a productive way (Mangold and Hennessey 2003).
What to do? Economic policy can have real effects if the policy is a long-run one, according to the theory of commitment in policy-making. Thus, Switzer-land would need an economic growth policy that is backed up over a longer time period. It could only come from a consensus among the political elite to favor a package of policies that stimulate output, investments and labor market flexibility as well as productivity. If not, Switzerland runs a large risk of falling even more behind in affluence.
(1) (2) (3) (4) (5)
Constant -0.017 0.202*** 0.097*** 0.086*** 0.079***(-1.122) (3.490) (4.542) (3.809) (4.928)
CAP_ACCUM 0.639***(4.076)
PUB_SEC -0.006**(-2.680)
EDUC -0.028**(-2.670)
HEALTH -0.035**(-2.561)
SOC_SPE -0.005***(-3.034)
AR (1) 0.458*** 0.527*** 0.518*** 0.512***(3.033) (3.567) (3.641) (3.775)
R-square 0.387 0.543 0.541 0.545 0.570Adj. R-square 0.371 0.519 0.514 0.518 0.547
F-stat 19.685 21.810 19.740 19.742 24.133
182 DEBATTE
Economic growth results from increases in employment, capital (invest-ments) and productivity (technology). Since the Swiss public sector is already large any further expansion of the public sector should be outlawed. This must be true of allocation as well as of social security, which redistributes resources more than creates new ones. Thus, we have:
RULE 1: The tax ratio in Switzerland must be pushed back or at least be kept con-stant in the coming years.
Economic growth will have to come mainly from the private sector in the country. Improving infrastructure can only bring marginal contributions to the GDP in a country with excellent roads and tracks. As long as there is no system for measuring performance in government, productivity risks being relatively low in the public sector. The key player in the market sector is the entrepreneur. He/she will only invest and hire labor if the expected value of investments in Switzerland is higher than of corresponding investments out-side of Switzerland. Thus, for creating incentives for capital accumulation and investment we have:
RULE 2: The social charges on employment inside Switzerland must be reduced or at least be kept constant.
Implementing these two rules in a long-term commitment to economic expansion must entail a halt to public sector growth and a reversal of the trend of yearly increases that are larger than GDP growth. It also entails that salaries in government cannot be the norm for salaries in the market sector, creating an inexorable push towards too high wages everywhere in the economy. On the micro level both government and enterprises need to link salary with perfor-mance in a better way, underlining productivity.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 183
Statistical Annex
Table A1: Abbreviations
AGE Percentage of people of 65 years or more in the total population
CAP_ACCUM Capital accumulation (in % of GDP)
EDUC Education spending per capita
FERTIL Fertility rate (births per woman)
GDP_GROWTH Growth of GDP per capita
HEALTH Health spending per capita
PENSION Pension funds (BV/PP) per capita
POP Total population
PUB_SEC Size of the public sector (in % of GDP)
RETIREM Retirement insurance (AHV/AVS) per capita
SOC_SPE Social insurance and social spending per capita
Data provided by the Swiss Statistical Office, except for AGE and FERTIL (data from the World Bank, World Development Indicators) and for PUB_SEC (data from the Swiss Finance Department). All variables are time series between 1960 and 2002. All variables are expressed in Millions CHF, current prices if nothing else is stated. The variables CAP_ACCUM, PUB_SEC, AGE and FERTIL are ratios, POP is expressed in Thousands.
Bibliography
Borner, Silvio and Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Grenzen – Eine Schweizerische Illusion. Zürich: Orell Füssli for Avenir Suisse.
Feld, Lars and Marcel Savioz (1997). ”Direct Democracy Matters for Economic Performance: An Empirical Investigation”, Kyklos 50(4): 507-538.
Freitag, Markus and Adrian Vatter (2000). ”Direkte Demokratie, Konkordanz und Wirtschaftsleistung: Ein Vergleich der Schweizer Kantone”, Swiss Journal of Economics and Statistics 136(4): 579-606.
Frey, Bruno and Alois Stutzer (2000). ”Happiness, Economy and Institutions”, Economic Journal 110(466): 918-938.
Kirchgässner, Gebhard and Werner Pommerehne (1996). ”Tax Harmonization and Tax Competition in the European Union: Lessons from Switzerland”, Journal of Public Economics 60(3): 351-371.
Mangold, Roland and Richard Hennessey. (2003). ”PISA-Ergebnisse, Effizienz und Produktivität des Bildungssystems”, Wirtschaftspolitische Blätter 50(3): 437-445.
Rohner Dominic (2005). Inequality, Conflict and Welfare State. mimeo. Cambridge:University of Cambridge.
World Bank (2005). World Development Indicators. Washington: World Bank.
184 DEBATTE
Ist der Souverän wirtschaftsfeindlich?
Georg Lutz, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern; E-Mail: [email protected] Thomas Votruba, Student der Betriebswirtschaftlehre und Politikwissenschaft, Universität Bern; E-Mail: [email protected].
Einleitung
Die direkte Demokratie sei wesentlich für die Wachstumsschwäche und die wirtschaftlichen Problemen in diesem Land verantwortlich, behaupten ver-schiedene Ökonomen seit einigen Jahren (Borner und Rentsch 1997; Borner und Bodmer 2004; Rentsch et al. 2004; Wittmann 2001). Als Begründung wird angeführt, direkte Demokratie bringe inkonsistente und willkürliche Politik-ergebnisse, zudem würden die demokratischen Verantwortlichkeiten ver-wischt. Wegen der direkten Demokratie könne nicht schnell genug auf aktuel- le und neue Probleme reagiert werden, bewahrende Tendenzen hätten ein Übergewicht und insgesamt hätten Interessengruppen zu viel Einfluss in Ent-scheidungsprozessen (Borner und Bodmer 2004: 149ff.). Anhand verschiedener Einzelbeispiele, etwa der EWR-Abstimmung von 1992, dem abgelehnten Ener-giemarktgesetz 2002 oder dem abgelehnten Steuerpaket 2004 wird diese These untermauert. Mehr Demokratie wird auch mit mehr (wirtschaftsfeind-licher) Umverteilung gleichgesetzt. In jedem Staat gibt es eine schiefe Einkommensver-teilung, d.h. es gibt deutlich mehr Personen mit mittleren und kleinen Einkom-men, während in der Regel eine kleine Gruppe deutlich über dem Durchschnitt verdient. Das Durchschnittseinkommen liegt deshalb über dem Medianeink-ommen (Meltzer und Richard 1981). Deshalb wäre zu erwarten, dass in einer Demokratie, in der das Mehrheitsprinzip gilt, der Medianwähler, der über ein unterdurchschnittliches Einkommen verfügt, für mehr Umverteilung zwischen reich und arm votiert. Wenn zudem das Durchschnittsein-kommen sinkt, dann wäre zu erwarten, dass der Grad der Umverteilung steigt (Meltzer und Rich-ard 1981). Ein solcher Effekt wäre etwa zu beobachten, wenn in der Phase der Ausweitung des Stimmrechts das Medianeinkommen der Wähler sinkt, da das Stimmrecht vor allem auf Wähler unterer Einkommens-schichten ausgeweitet wurde oder wenn wie in jüngster Zeit die Zahl, der Sozialhilfe- und Arbeitslose-nentschädigung und damit die Einkommensungleichheit steigt. Demokratien sollten deshalb mehr umverteilen als Nicht-Demokratien (Tavares und Waciarg 2001: 1344) oder, abgeleitet daraus, mehr demokratische Volksrechte, etwa in Systemen mit direkt-demokratischen Möglichkeiten, sollte zu mehr Umver-teilung führen. Ein solcher Effekt findet etwa Matusaka (2000) für die erste
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 185
Hälfte des 19. Jahrhunderts in den US-Bundesstaaten. Unter der Annahme, dass mehr Umverteilung und expansive Staatstätigkeit auch zu ge-ringerem Wirtschaftswachstum führe, lässt sich deshalb argumentieren, dass direkte Demokratie einen negativen Effekt auf wirtschaftliche Indikatoren wie etwa dem Wirtschaftswachstum haben sollte.
Andere Autoren gelangen zu einer anderen Bewertung. Basierend auf Kan-tonsvergleiche oder Vergleiche zwischen grösseren Städten, kommen sie zum Schluss, direkte Demokratie wirke positiv, sowohl auf die Wirtschaftsleistung als auch auf das Wirtschaftswachstum, führe zu einer geringeren Arbeitslosen-quote, geringerer Steuerlast und Ausgabenquote des Staates pro Kopf und auch zu einer geringeren Verschuldung (Kirchgässner et. al. 1999; Freitag und Vatter 2004; Feld und Savioz 1997; Freitag et. al. 2003; Vatter 2002). Als theoretische Begründung wird angeführt, politische Eliten neigen eher dazu gesellschaft-liche Probleme mit zusätzlichen Ausgaben zu lösen, weil spezifische Kosten auf viele Steuer- und Beitragszahlende verteilt werden können. Demgegenüber muss in der direkten Demokratie jede Steuer- oder Abgabeerhöhung den Test der Volksabstimmung überstehen, sei es in Form eines fakultativen oder obliga-torischen Referendums. Gleichzeitig gebe es bei der Stimmbevölkerung eine grössere Skepsis gegenüber einer Defizitwirtschaft (vgl. dazu Wagschal und Obinger 2000). Ingesamt wirke die direkte Demokratie deshalb als Bremsklotz für eine Expansion der Staatstätigkeit, was wiederum ein wirtschaftsfreund-liches Umfeld schaffe. Zudem hätten die Stimmberechtigten ein Verständnis für die Bedeutung guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und unterliegen nicht fiskalischer Illusionen. Die Grösse des Staates und die Steuerbelastung blei- ben konstant, auch wenn eine Mehrheit der Wähler dies kritisiert (Meltzer und Richard 1981: 925).
Theoretisch gibt es keine abschliessende Bewertung, ob direkte Demokra-tie begünstigend auf die Wirtschaft wirke oder nicht. Die Frage muss deshalb empirisch untersucht werden. Hier deuten vergleichend-empirische Ergebnisse klar auf einen positiven Zusammenhang zwischen verschiedenen wirtschaft-lichen Indikatoren und direkter Demokratie hin. Diesen Studien, die schwer-punktmässig auf Kantons- und Gemeindevergleiche basieren, ist vorgeworfen worden, dass sie sich nicht einfach auf die nationale Ebene in der Schweiz tran-sponieren lassen. ”Auf nationaler Ebene dominieren dagegen die Ausgaben für Gesundheit und Soziales, die auch immer eine grosse Umverteilungskom-ponente beinhalten und damit vom Medianwähler durchaus positiv beurteilt werden können” (Borner und Bodmer 2004: 153). Auch seien die Entscheide auf nationaler Ebene komplexer und stärker von internationalen Bedingungen beein- flusst (Borner und Bodmer 2004; Wittmann 2001). Der St. Galler Studie von (Kirchgässner et. al. 1999) wird unterstellt, dass sie verborgene, interne Mecha-nismen der Schweizer Politik nicht berücksichtige und da die Autoren nicht zu
186 DEBATTE
den intimen Kennern des schweizerischen Systems gehören, sei es ihnen nicht gelungen auch nur eines der zentralen Forschungsergebnisse der ‘alten Schule’ zu wiederlegen” (Wittmann 2001: 45).
Methodisch gibt es in der Tat verschiedene Schwierigkeiten, die Auswirkun-gen direkter Demokratie auf nationaler Ebene in der Schweiz zu analysieren. Will man beurteilen, wie denn direkte Demokratie wirkt, bräuchte es eigentlich konkrete Bezugspunkte, d.h. es bräuchte einen Vergleich mit anderen poli-tischen Systemen. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich im Gebrauch der direkten Demokratie ein Sonderfall und dadurch lassen sich Effekte der direkten Demokratie auf verschiedene, z.B. ökonomische Variablen nur schwer isolieren. Methodische Schwierigkeiten haben jedoch auch Skeptiker der direk-ten Demokratie und es wurden bisher keine Ergebnisse vorgelegt, welchen einen umgekehrten Zusammenhang systematisch und empirisch schlüssig untermauern und die über Einzelbeispiele hinausgehen. Wenn man Trägheit des Systems behauptet oder den übergrossen Einfluss von Interessengrup-pen beklagt, dann müsste man eigentlich belegen können, dass in einem rein repräsentativen System Entscheide schneller gewesen wären oder der Ein-fluss von Interessengruppen geringer sei. Ein Blick in andere Länder lässt hin- gegen nicht den Eindruck aufkommen, die Schweiz tue sich im internationalen Vergleich besonders schwer mit Reformen oder grosse Interessengruppen und Lobbyisten hätten in rein repräsentativen Systemen einen kleineren Einfluss. Auch müsste man etwas systematischer aufzeigen können, das Themen und Abstimmungsverhalten auf nationaler Ebene substanziell von der kantonalen Ebene abweichen.
Analyse
Auch auf nationaler Ebene gibt es Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Aus-wirkungen direkter Demokratie empirisch näher zu untersuchen. Interessant wäre es etwa, einzelne Entscheidungsprozesse in der Schweiz daraufhin zu untersuchen, in welchem Ausmass Referendumsdrohungen von grossen Inter-essengruppen, die Partikulärinteressen vertreten, zu Anpassungen an Gesetzen geführt haben. Hier fehlen leider neuere Forschungen. Eine zweite Möglichkeit, die hier gewählt wurde, besteht darin, das effektive Abstimmungsverhalten auf Wirtschaftsfreundlichkeit zu untersuchen.
Eine erste Schwierigkeit ist die Definition was genau wirtschaftsfreundlich ist. Bei vielen Abstimmungen behaupten Befürworter und Gegner gleichzeitig, ein Ja bzw. Nein sei gut für die Wirtschaft oder schade zumindest der Wirtschaft nicht. Im Vorfeld der Abstimmung über den EWR-Beitritt etwa hatten sowohl Befürworter wie Gegner wirtschaftliche Untergangsszenarien im Falle einer Annahme oder Ablehnung entworfen. Wirtschaftliche Prognosen sind ein
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 187
schwieriges Unterfangen und auch nachträglich lassen sich Auswirkungen oft nur schwer abschätzen, denn wer kann schon genau sagen, was denn passiert wäre, wenn ein Abstimmungsergebnis anders ausgefallen wäre.
Wir haben einen pragmatischen Weg zur Bestimmung der wirtschaftspoli-tischen Dimension gewählt und halten uns an die Abstimmungsempfehlungen von Parteien und Interessenverbänden. Als wirtschaftsfreundlich bezeichnen wir die Position der beiden grossen Wirtschaftsverbände Arbeitgeberverband und economiesuisse (früher Vorort), und wenn keine Parolen der Wirtschafts-verbände vorliegen, an die Parole der FDP. Wer sollte besser definieren können, was den Interessen der Wirtschaft dient, als die grossen Wirtschaftsverbände, die per Definition die Interessen der Wirtschaft bzw. der Arbeitgeber vertre-ten. Parolen beider Verbände stimmen in allen Fällen untereinander überein, wenn Parolen beider Verbände vorliegen. Die Empfehlung der Wirtschaftsver-bände ist auch fast immer gleich mit der Position der FDP. Ingesamt wurden 302 Abstimmungen im Zeitraum 1970 bis Ende 2004 untersucht. In all diesen Unter-suchungen sind Parolen der FDP und der anderen Bundesratsparteien vorhan-den. Von der economiesuisse sind 211 Ja- oder Nein-Parolen erfasst, vom Arbeit-geberverband 201, von mindestens einem der beiden Verbänden liegen in 245 Fällen Parolen vor. Abweichungen zwischen Parolen der Wirtschaftsverbände und der FDP gab es nur in 10 dieser 245 Fälle,1 wobei in fünf Fällen die Position der FDP obsiegte, in fünf Fällen die Position der Wirtschaftsverbände.2
1 Gegenüber der Position der CVP gab es 27 Abweichungen von 243 Abstimmungen, gegenüber der SVP gab es 28 Abweichungen bei 244 Abstimmungen, bei denen gemeinsame Positionen vorliegen.
2 Wie erwähnt, wurde in diesem Fall die Position der Wirtschaftsverbände als Grad-messer für die Wirtschaftsfreundlichkeit gewertete. Ebenso bei einer weiteren Abstimmung, bei der die FDP Stimmfreigabe beschlossen hatte (1999 beim Bundesgesetz über die Inva-lidenversicherung).
188 DEBATTE
Tabelle 1: Wirtschaftsfreundlichkeit des Abstimmungsverhaltens, insgesamt, im Zeitverlauf, nach Abstimmungstyp
Wirtschaftsfreundlichkeit in % aller Abstimmungen N
Total 80 302
Nach Legislatur
1971-75 80 25
1975-79 79 47
1979-83 75 16
1983-87 77 35
1987-91 80 25
1991-95 71 52
1995-99 91 34
1999-03 98 47
2003- 46 13
Nach Art der Vorlage
Obligatorische Referenden 76 115
Fakultative Referenden 70 79
Initiativen 94 108
Quellen: Parolen und Abstimmungsergebnisse BFS, IPW. Eigene Berechnungen.
In 80%, d.h. 243 der untersuchten 302 Abstimmungen haben die Stimmbere-chtigten im Sinne der Anliegen von Wirtschaft und/oder FDP gestimmt nur in 59 Fällen dagegen. Vergleicht man über die Zeit hinweg, so sind durchaus Schwankungen festzustellen. So lag die Wirtschaftsfreundlichkeit in den 1970er und 80er Jahren bei oder knapp unter 80%. In den beiden Legislaturen zwischen 1995-2003 stieg die Wirtschaftsfreundlichkeit auf über 90% an.3 Der zeitliche Ver-lauf stützt die These der Wirtschaftsfreundlichkeit im Abstimmungsverhalten. So hätte man erwarten können, dass in Zeiten härter werdender Umverteilungs-kämpfe die Bevölkerung für die Erhaltung oder einen Ausbau des Sozialstaates
3 In einem bereits erschienen NZZ-Artikel vom 4.1.2005 ist für die Periode 1999-2003 ein etwas geringerer Wert ausgewiesen. Dies hat damit zu tun, dass die Abstimmung zum Gegenvorschlag der Goldinitiative 2002 als Stimmfreigabe der economiesuisse kodiert worden war, und damit die zustimmende Position der FDP Gradmesser war. Inzwischen wurden die Parolen nochmals validiert und laut Angaben der economiesuisse haben sie damals die Nein-Parole beschlossen, womit eine zusätzliche Abstimmung nach unserer Definition im Sinne der Wirtschaft entschieden worden ist.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 189
stimmt. Das Gegenteil ist der Fall: Seit Mitte der 90er Jahre ist eine besonders hohe Zustimmungsrate im Sinne der Anliegen der Wirtschaft zu beobachten. In der Legislatur 1999-2003 wurde gerade eine von 47 Abstimmungen nicht im Sinne der Wirtschaft entschieden (die Abstimmung über das Elektrizitäts-marktgesetz 2002). Ein etwas anderes Bild zeigt sich in der jüngsten Legislatur. Von den 13 Abstimmungen 2004 wurden sieben nicht im Sinne der Wirtschaft und/oder FDP entschieden. Im Februar wurde sowohl der Gegenvorschlag zur Avanti-Initiative und die Revision des Mietrechts abgelehnt als auch die Initia-tive zur Verwahrung nicht-therapierbarer Straftäter angenommen – wozu allerd-ings die Wirtschaftsverbände keine Parole herausgegeben hatten. Im April 2004 fanden die von der Linken bekämpfte 11. AHV-Revision als auch die Reform des Steuergesetzes, gegen die sich auch die Kantone stellten, keine Mehrheit. Und schliesslich wurden im September 2004 zwei Einbürgerungsvorlagen abgelehnt. Damit lässt sich jedoch kaum ein neuer Trend ableiten, dafür ist die Zahl der Abstimmungen zu klein und die Legislatur ist noch lange nicht zu Ende. Eher zu vermuten ist, dass verschiedene Vorlagen, die 2004 zur Abstimmung kamen, im Vorfeld der Wahlen, als sie noch vom alten Parlament ausgestaltet wurden, zu überladen und zu einseitig waren und deshalb an der Urne scheiterten. Initia-tiven werden fast immer wirtschaftsfreundlich entschieden, obligatorische und fakultative Referenden etwas unterdurchschnittlich.
Es handelt sich nicht bei allen Vorlagen eindeutig um wirtschaftspolitische Abstimmungen, bei denen es um einen klaren Links-Rechts Gegensatz geht. In einem Land, in dem linke Parteien seit mehr als 80 Jahren einen Wählerstim-menanteil von nur rund 30% haben, wäre auch rein theoretisch eine sehr hohe Zustimmungsrate im Sinne der wirtschaftlichen Anliegen zu erwarten, wenn die Wählerinnen und Wähler den Parolen ihren Parteien folgen. Um dies näher zu untersuchen, haben wir deshalb die Abstimmungen noch nach verschiedenen Konfliktmustern aufgeschlüsselt und analysiert, wie in Abhängigkeit dazu die Wirtschaftsfreundlichkeit ausfällt. Wir haben dabei zwei Konfliktstrukturen analysiert, eine nach parteipolitischer Konstellation der vier Bundesratsparteien und eine in Abhängigkeit davon, ob es einen Konflikt zwischen ”Kapital und Arbeit” gibt, wobei in analoger Weise wie mit den Wirtschaftsverbänden die Position der ”Arbeiter” über die Parolen des Schweizerischen Gewerkschafts-bundes operationalisiert wurde.4
Am häufigsten sind bei den untersuchten Abstimmungen alle Bundesrats-parteien einig, gefolgt vom Konflikttypus bei dem die SPS den anderen drei Bundesratsparteien gegenübersteht. An dritter Stelle ist jener Typus, bei dem
4 Pro ”Arbeit” wurde die Parole des SGB gewertet. Im Falle abweichender Parolen von SGB und SPS, was bei 6 Abstimmungen der 239 Abstimmungen der Fall war, zu denen eine Parole vorliegt, wurde die Parole des SGB als massgebend für die Position der ”Arbeit” definiert.
190 DEBATTE
die SVP gegen die drei anderen Bundesratsparteien antritt, wobei dieser Typus erst seit Anfang der 90er Jahre häufig ist. Wenn der Links-Rechts Gegensatz eine Rolle spielen sollte, so wäre zu erwarten, dass in jenen Fällen, in denen die Linke gegen die anderen Parteien antrittt, die Wirtschaftsfeindlichkeit im Abstimmungsverhalten grösser ist, als in jenen Fällen, in denen alle Parteien einig sind.
Tabelle 2: Wirtschaftsfreundlichkeit des Abstimmungsverhaltens nach Konflikttypen
Konstellation der Bundesratsparteien Wirtschaftsfreundlichkeit in % aller Abstimmungen N
Alle 4 Bundesratsparteien gleich 86 134
SPS gegen Bürgerliche 83 112
SVP gegen Mitte-Links 68 31
Andere Konfliktstruktur 56 25
”Kapital-Arbeit”
Kein Konflikt* 81 167
Konflikt 79 135
*Als kein Konflikt wurde ebenfalls gewertet, wenn SGB und SPS beide keine Ja/Nein-Parole gefasst haben oder Stimmfreigabe beschlossen haben, was in 13 Abstimmungen der Fall war.
Ingesamt gibt es zwischen allen Konflikttypen nur wenige Unterschiede in der Wirtschaftsfreundlichkeit. Ob alle vier Bundesratsparteien oder die drei Bürgerlichen gegen die SPS antreten, hat auf die Wirtschaftsfreundlichkeit keinen Einfluss. Auch keinen wesentlichen Unterschied gibt es in Abhängigkeit eines Konflikts ”Kapital-Arbeit”. Einzig wenn die SVP gegen die anderen Bundesrats-parteien antritt oder wenn zwischen den Bundesratsparteien Sonderkonstel-lationen auftreten, sinkt der Anteil wirtschaftsfreundlichen Verhaltens leicht. Diese Analysen lassen vermuten, dass Abstimmungen gegen die Interessen der Wirtschaft nur zum Teil ein Erfolg der Linken sind – dann hätte es in Abhängig-keit der Konfliktstruktur grössere Unterschiede geben sollen - sondern vielmehr unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Ein Blick auf die 59 Vorlagen, die gegen die Interessen der Wirtschaft oder der FDP entschieden wurden, bestätigt dies. In 31 von diesen Abstimmungen gab es eigentlich keinen Konflikt ”Kapi-tal-Arbeit”, d.h. die Position von Gewerkschaften/SPS und oder Wirtschaft/FDP waren identisch. Viele dieser Abstimmungen haben auch keine eindeutige wirtschaftspolitische Dimension. Es handelt sich um generell gesellschafts- oder aussenpolitische Vorlagen, die in der Mehrheit der Fälle von rechten Splitter-parteien bekämpft worden waren. In den 90er Jahren haben nur zwei Abstim- mungen eine klare wirtschaftspolitische Dimension: die EWR-Abstimmung
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 191
von 1992 sowie die Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung, die von SGB und den Wirtschaftsverbänden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, bekämpft worden war.
Es bleiben 28 Abstimmungen bei denen bei einem Konflikt zwischen Wirt-schaft/FDP und Gewerkschaften/SPS gegen die Wirtschaftsinteressen entschie-den wurde. Diese lassen sich in vier grössere thematische Gruppen unterteilen:
- Acht Abstimmungen hatten umweltpolitische Forderungen, denen die Stimmberechtigten gefolgt sind, viele aus den 70er und 80er Jahre. Darunter sind etwa die Einführung der Autobahnvignette, die Rothenthurm- und die Alpenschutzinitiative, oder der abgelehnte Gegenvorschlag zur Avanti-Initia-tive.
- Bei fünf sozial- und steuerpolitischen Vorlagen siegte die Linke, darunter fallen im Jahr 2004 das abgelehnte Steuerpaket und die abgelehnte 11. AHV-Revision als auch 1996 die abgelehnte Revision der Arbeitslosenversicherung und 1996 die Lockerung der Sonntagsarbeitsbestimmungen, die von CVP und SPS gemeinsam bekämpft worden waren.
- Bei vier Vorlagen ging es um Konsumentenschutz und Service public (Ener-giemarktliberalisierung 2002, die Revision des Mietrechtes 2004 sowie Anfang der 80er Jahre wurden die Konsumentenschutzinitiative und die Initiative zur Verhinderung missbräuchlicher Preise angenommen).
- Fünf Abstimmungen sind Landwirtschaftsvorlagen, in denen das Volk in den 90er Jahren der bundesrätlichen Landwirtschaftspolitik einen Scherben-haufen bereitete.
- Es bleibt eine Restkategorie mit sechs Abstimmungen, in denen es nicht hauptsächlich um wirtschaftliche Anliegen ging.5
Fazit
Ausgangspunkt dieses Beitrages war die Kritik an der direkten Demokratie, die laut einigen Ökonomen wesentlich für die Wachstumsschwäche in diesem Land verantwortlich sein soll. Die Interpretation der Ergebnisse im Abstimmungsver-halten in der Schweiz lässt wenig Spielraum: auf nationaler Ebene wird in der Schweiz sehr wirtschaftsfreundlich abgestimmt. Die direkte Demokratie kann deshalb nur schwerlich als Argument für die Wachstumsschwäche herangezo-gen werden. Ansonsten hätte man deutlich häufiger wirtschaftfeindliches Ver-halten beobachten müssen. Damit bleibt offen, welche anderen Faktoren, auch etwa politisch-institutionelle Faktoren, relevant sein könnten. Eine solche umfas-sende Untersuchung kann in diesem Rahmen allerdings nicht geleistet werden.
5 Aus Platzgründen ist es nicht möglich, alle Abstimmungen aufzulisten. Die Daten, die dieser Untersuchung zugrunde liegen, sind von den Autoren erhältlich.
192 DEBATTE
Drei mögliche methodisch bedingte Verzerrungen seien hier noch erwähnt:
- Die Gleichsetzung der Position von Wirtschaftsverbänden mit Wirtschafts-freundlichkeit ist diskutabel. So könnte es sein, dass die Wirtschaftsverbände bereit sind, einzelne Sonderinteressen ihrer Mitglieder zu schützen und diese dem volkswirtschaftlichen Gesamtwohl voranstellen.
- Direkte Demokratie wirkt nicht nur direkt über den effektiven Abstim-mungsentscheid, sondern eine Abstimmung hat möglicherweise bereits eine Vorwirkung auf den Entscheidungsprozess von Regierung und Parlament und somit auf die Ausgestaltung einer Vorlage.
- Es wurde in dieser Studie keine Gewichtung einzelner Abstimmungen vorgenommen. So wäre bei wirtschaftspolitisch eher unwichtigen Abstimmun-gen theoretisch eher wirtschaftsfreundliches, bei wichtigen Abstimmungen eher wirtschaftsfeindliches Abstimmungsverhalten möglich.
Bei der Deutlichkeit der Ergebnisse ist es hingegen unwahrscheinlich, dass das Gesamtbild der hier vorgelegten Untersuchung wesentlich anders ausfallen würde, wenn man diese methodischen Unschärfen einbeziehen würde. Weitere empirische Studien dazu wären sicherlich interessant, gefordert sind dabei vor allem die Kritiker der direkten Demokratie unter den Ökonomen.
Literatur
Borner, Silvio und Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Wachstum. Eine Schweizer Illusion. Zürich: Orell Füssli Verlag.
Borner, Silvio und Hans Rentsch (Hrsg.) (1997). Wieviel direkte Demokratie verträgt die Schweiz. Kritische Beiträge zur aktuellen Reformdebatte. Chur: Rüegger.
Feld, Lars P. und Marcel R. Savioz (1997). ”Direct Democracy Matters for Economic Performance. An Empirical Investigation”, Kyklos 50(4): 507-538.
Freitag, Markus und Adrian Vatter (2004). ”Political Institutions and the Wealth of Regions”, European Urban and Regional Studies 11(4): 291-301.
Freitag, Markus, Adrian Vatter und Christoph Müller (2003). ”Bremse oder Gaspedal? Eine empirische Untersuchung zur Wirkung direkter Demokratie auf den Steuerstaat”, Politische Vierteljahresschrift 44(3): 1-22.
Kirchgässner, Gebhard, Lars P. Feld und Marcel R. Savioz (1999). Die direkte Demokratie: Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig. Basel, Genf, München: Helbing & Lichtenhahn.
Matusaka John G. (2000). ”Fiscal Effects of the voter initiative in the first half of the twentieth century”, Journal of Law and Economics 43(2): 619-650.
Meltzer, Allen H.und Scott F. Richard (1981). ”A rational theory of the size of government”, The Journal of Political Economy 89(5): 914-927.
Rentsch, Hans et.al. (2004). Ökonomik der Reform: Wege zu mehr Wachstum in der Schweiz. Zürich: Orell Füssli Verlag.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 193
Tavares, José und Romain Wacziarg (2001). ”How democracy affects growth”, European Economic Review 45(8): 1341-1378.
Vatter, Adrian (2002). Kantonale Demokratien im Vergleich. Opladen: Leske + Budrich.
Wagschal, Uwe und Herbert Obinger (2000). ”Der Einfluss der Direktdemokratie auf die Sozialpolitik”, Politische Vierteljahresschrift 41(3): 466-497.
Wittmann, Walter (2001). Direkte Demokratie. Bremsklotz der Revitalisierung. Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber.
Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in der Schweiz - Die Schweiz als Erfolgsmodell?
Rita Nikolai, Institut für Politische Wissenschaft, Universität Heidelberg; E-Mail: [email protected]
1. Einleitung
Die Schweiz zeigt einen Befund der auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint: eine außerordentliche Performanz in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli-tik trifft auf eine anhaltende Wachstumsschwäche. Im OECD-Vergleich wies die Schweiz für das Jahr 2002 mit 3,0 Prozent die drittniedrigste Arbeitslosenquote, mit 81,3 Prozent die höchste Erwerbsquote und mit 24,7 Prozent die vierthöch-ste Teilzeitquote auf. In zwischenstaatlichen Vergleichen zur Arbeitsmarktpolitik wird die Schweiz oft außer Acht gelassen, da sie nicht Mitglied der Europäischen Union ist und zudem aufgrund ihres politischen Systems als Sonderfall gilt, deren Erfolge nicht auf andere Länder übertragbar seien. Trotzdem lohnt es sich zu fragen, worin die Ursachen für das ”swiss employment puzzle” liegen (Bonoli und Mach 2001: 81).
2. Analyse
Konnte die Schweiz ihre Arbeitsmarktprobleme in den 70er und 80er Jahren noch durch die Nichtverlängerung von Aufenthaltsbewilligungen lösen und nahezu Vollbeschäftigung erreichen, kann für die 90er Jahre nicht mehr von einem Export der Arbeitslosigkeit gesprochen werden (Schmidt 1995). Der Anteil der Nie-dergelassenen, die den Schweizer Erwerbstätigen auf dem Arbeitsmarkt gleich-gestellt sind, ist seit den 60er Jahren kontinuierlich angestiegen, so dass sie mitt-
194 DEBATTE
lerweile mit 56,5 Prozent die Mehrheit unter den ausländischen Erwerbstätigen bilden. Die Niedergelassenen besitzen einen gesicherten Aufenthaltsstatus, so dass sie auch bei Arbeitslosigkeit nicht gezwungen sind, die Schweiz zu verlassen. Auch die etappenweise Einführung des freien Personenverkehrs durch die EU-Verträge vom 1. Juni 2002 mit der Abschaffung des Saisonnierstatuts und Inlän-dervorrangs sowie der Liberalisierung des Grenzgängerstatus verknappte neben der veränderten Aufenthaltsstruktur der ausländischen Erwerbstätigen den Hand- lungsspielraum in der Ausländerpolitik. Ebenso können die beschäftigungspoli-tischen Erfolge nicht mehr wie in den 70er und 80er Jahren mit dem Rückzug der Frauen vom Arbeitsmarkt erklärt werden, da die Frauenerwerbsquote im OECD-Vergleich mit 72,5 Prozent 2002 überdurchschnittlich hoch ausfällt.
Da die Schweiz im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2002 mit 0,8 Prozent das Schlusslicht bei den Zuwachsraten im Wirtschaftswachstum bildete, kann auch das Wirtschaftswachstum keine Erklärung liefern. Anders als in den skandina-vischen Ländern hat weder eine Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Sektor noch eine Umverteilung der Arbeitszeit wie in den Niederlanden durch Teilzeitarbeit stattgefunden. Die Teilzeitquote war schon zu Beginn der 90er Jahre mit 22,9 Prozent (1991) überdurchschnittlich hoch und stieg bis 2002 nur geringfügig auf 24,7 Prozent an. Auch steigende Lohndisparitäten können nicht die Arbeitsmarktbilanz erklären wie in den angelsächsischen Ländern, da die Ein-kommensabstände zwischen den oberen und den unteren Einkommensbeziehern kaum zugenommen haben. Die niedrige Arbeitslosenquote und die hohen Be-schäftigungsquoten müssen daher auf andere Erklärungsfaktoren zurückzufüh-ren sein, die auf einem Mix von verschiedenen Systemelementen und Reformen in der Arbeitsmarktpolitik beruhen.
a) Die hohe Flexibilität des Schweizer Arbeitsmarktes
Der Schweizer Arbeitsmarkt reagiert auf Wachstum besonders stark. Kennzeichen für den Schweizer Arbeitsmarkt ist eine niedrige Beschäftigungsschwelle, da schon ein geringes Wirtschaftswachstum zu mehr Beschäftigung führt. Die hohe Flexibilität des Schweizer Arbeitsmarktes liegt vor allem in seinem flexiblen Lohn-bildungssystem und der geringen Regulierungsdichte begründet. Im internatio-nalen Vergleich zur Regulierungsdichte der Beschäftigungsschutzgebung wird die Schweiz an fünfter Stelle nach Australien, Kanada, Großbritannien und den USA verortet und verfügt somit über eine geringe Regulierungsdichte auf dem Arbeits- markt (OECD 1999). Die hohe Teilzeitbeschäftigung und die geringen Hürden für Wochenend- und Nachtarbeit sind Ausdruck dieser geringen Regulierungs-dichte. Bei einem Kündigungsschutz von einem bis drei Monaten je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit kann in der Schweiz zwar leichter entlassen werden, aber die Arbeitskräfte werden auch schneller wieder eingestellt.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 195
Je nach einzelbetrieblichen Voraussetzungen verhandeln die Unternehmen die Löhne mit der Belegschaft oder Gewerkschaften direkt auf Betriebsebene aus. Die dezentralen Lohnverhandlungen haben zur Folge, dass die Unternehmen über eine große Flexibilität und einen großen Handlungsspielraum in ihrer Lohngestaltung verfügen. Je nach Umsatz- oder Gewinnentwicklung können die Unternehmen ihre Personalkosten auch kurzfristig beeinflussen und auf Angebots- und Nach-frageentwicklungen flexibel reagieren. Studien von Traxler et al. zeigen jedoch, dass dezentralisierte Lohnverhandlungen nicht ausschließlich vorteilhafter sind (Traxler et al. 2001). Es ist nicht allein die dezentrale Lohnverhandlung, die es den Unternehmen ermöglicht, der ökonomische Situation angemessene Problem-lösungen zu finden, sondern auch die konsensorientierte Ausrichtung der Schwei- zer Sozialpartnerschaft spielt eine Rolle. So waren die Gewerkschaften in den 90er Jahren zu moderaten Lohnerhöhungen bereit, um weitere Entlassungen zu vermeiden. In der Tradition der Schweizer Sozialpartnerschaft bevorzugen die Sozialpartner Verhandlungslösungen auf der unterstmöglichen Ebene zwischen Belegschaft und Unternehmensführung. Gerade die institutionellen Verhand-lungsstrukturen konnten in den 90er Jahren als Stabilitätsfaktor dienen, so dass trotz der wirtschaftlichen Krise ein hoher Konsensgrad beibehalten werden konnte, der sich auch an der im internationalen Vergleich niedrigen Streikquote ablesen lässt. Die hohe Flexibilität kommt vor allem den Kleinen und Mittelstän-dischen Unternehmen (KMU) zugute, die sich in den 90er Jahren als die eigent-liche Stütze des Arbeitsmarktmarktes erwiesen haben. In der Rezession der 90er Jahre verloren die KMU weniger Mitarbeiter als es in den Großunternehmen der Fall war, so dass Ende der 90er Jahre rund drei Viertel der Beschäftigten in KMU arbeiteten.
b) Das beschäftigungsfreundliche Klima
Auch das System der sozialen Sicherung und die Steuerpolitik beeinflussen die Kostenstruktur der Unternehmen. Mit 35,7 Prozent lag die Fiskalquote 2000 noch unter dem OECD-Durchschnitt (38,9 Prozent) und dem europäischen Mittel (41,5 Prozent), jedoch hat sich in den 90er Jahren der Abstand deutlich verringert, da die schweizerische Fiskalquote in den 90er Jahren stärker angestiegen ist als in den übrigen OECD-Staaten. Die schweizerische Fiskalquote ist im internationalen Ver-gleich unterdurchschnittlich, doch innerhalb der Schweiz variiert die Steuerbela-stung aufgrund der weitgehenden Autonomie der Kantone beträchtlich. Auf einer Skala mit dem Durchschnitt von 100 Punkten schwanken die Steuerbelastungen zwischen 50,8 Punkten (Zug) und 145,2 Punkten (Obwalden). Im europäischen Vergleich verfügt die Schweiz insgesamt über eine milde Unternehmenssteuer-belastung, einige Kantone wie Graubünden oder Genf mit der höchsten Arbeits- losenquote der Schweiz (5,1 Prozent 2002) weisen aber Belastungen auf, die
196 DEBATTE
deutlich über dem internationalen Vergleich liegen. Würde man die Pensions-kassenbeiträge zu den Fiskalquoten hinzuzählen, die je nach Alter der Beschäf- tigten zwischen 7 und 18 Prozent liegen und die auch von den Arbeitgebern zu zahlen sind, so würde die Belastung höher ausfallen und die Fiskalquote wäre nur noch niedrig im europäischen Vergleich, jedoch nicht im OECD-Vergleich. Noch kommt der Schweiz aber zugute, dass durch Kurskorrekturen am Wohlfahrtsstaat in Richtung höherer Eigenbeteiligung, wie etwa in der Rentenpolitik, die Beiträge zu den Sozialversicherungen niedrig gehalten werden konnten (Obinger 1999). Aufgrund ihrer im europäischen Vergleich niedrigen Steuer- und Abgabenquote kann die Schweiz gerade bei der Gruppe der Geringqualifizierten, die als eine der Problemgruppen des Arbeitsmarktes gelten, eine niedrige Arbeitslosenquote und eine hohe Beschäftigungsquote aufweisen, wie sie ähnlich in den angelsäch-sischen Staaten anzutreffen ist. Seit den 90er Jahren lässt sich aber international ein Trend sinkender Steuersätze beobachten, dem die Schweiz Rechnung tragen wird müssen, will sie ihren Wettbewerbsvorteil nicht verlieren.
c) Aktivierungsprinzip in der Arbeitsmarktpolitik
Die Neuausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik Mitte der 90er Jahre durch ver-schärfte Sanktionsmaßnahmen, erschwerte Zugangsbedingungen, ein neues Beitrags- und Leistungsregime in der Arbeitslosenversicherung und eine Neuor-ganisation der Arbeitsverwaltung mit der Einführung regionaler Arbeitsvermitt-lungszentren führten in der Schweiz zu einem Paradigmenwechsel hin zur Forcie-rung der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Nach wie vor liegen aber die Ausgaben der Schweiz für aktive Arbeitsmarktpolitik mit 0,5 Prozent unterhalb des OECD- und EU-Durchschnitts (0,7 bzw. 0,9 Prozent). Besonders positiv bewerten Evaluations-studien das Instrument des Zwischenverdienstes, bei dem die Arbeitslosenver-sicherung 70 bzw. 80 Prozent der Differenz zwischen dem Verdienst der neuen und vorherigen Arbeitsstelle zahlt, wenn der Arbeitslose eine Stelle annimmt, dessen Verdienst unterhalb des Leistungssatzes der Arbeitslosenentschädigung liegt. Maßnahmen wie Umschulungen, Weiterbildungen und vorübergehende Beschäftigung haben jedoch kaum einen signifikanten Effekt auf die Wiederein-gliederungschancen der Arbeitslosen, sie wirken zum Teil sogar kontraproduktiv. Die höchsten Erwerbsquoten weisen Teilnehmer an Zwischenverdiensten auf, die niedrigsten verzeichnen dagegen die Teilnehmer an vorübergehender Beschäfti-gung und an Weiterbildungsprogrammen (Lechner und Gerfin 2000).
3. Fazit: Die Schweiz als Erfolgsmodell?
Die beeindruckende Arbeitsmarktbilanz ist nicht ohne Schatten, da die Schweiz nach wie vor trotz zurückgehender Zahlen Ende der 90er Jahre einen hohen Anteil
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 197
an Langzeitarbeitslosen verzeichnet (21,8 Prozent 2002). Auch die in jüngster Zeit wieder angestiegene Arbeitslosenquote weist daraufhin, dass der Arbeitsvermitt-lung sowie der Erhaltung und dem Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierungsmaßnahmen, wie etwa dem erfolgreichen Zwischenverdienst, nach wie vor eine große Bedeutung zukommt. Ebenso die niedrige Teilzeitbe-schäftigung der Männer (7,7 Prozent 2002) zeigt, dass in der männlichen Teil-zeitarbeit noch Reformpotentiale zum Ausbau der Beschäftigung liegen könnten. Trotz der anhaltenden Wachstumsschwäche kann die Schweiz zu den ”beschäf-tigungspolitisch erfolgreich” geltenden Länder gezählt. Das Wirtschaftswachs-tum erweist sich in der Schweiz als besonders beschäftigungsintensiv, das in der hohen Flexibilität des Arbeitsmarktes begründet liegt. Hierzu gehört vor allem das konsensorientierte und dezentrale Lohnfindungssystem, das den regionalen und betrieblichen Erfordernissen Rechnung trägt und die Entwicklung der Lohn-stückkosten bremsen kann, die geringe Regulierungsdichte und der hohe Anteil der Teilzeitbeschäftigung. Die Schweiz ist daher mit ihrer Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ein beschäftigungspolitisches Erfolgsmodell, das größere Beachtung verdient.
Bibliographie
Bonoli, Giuliano und André Mach (2001). ”The New Swiss Employment Puzzle”, Swiss Political Science Review 7(2): 81-94.
Lechner, Michael und Michael Gerfin (2000). ”Wirkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik der Schweiz auf die individuellen Beschäftigungschancen von Arbeitslosen”, MittAB 33(3): 396-404.
Nikolai, Rita (2004). Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in der Schweiz. Die Schweiz als Erfolgsmodell. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität Heidelberg.
Obinger, Herbert (2000). ”Der schweizerische Sozialstaat in den 90er Jahren”, Zeitschrift für Politikwissenschaft 10(1): 43-63.
OECD (1999). Employment Outlook. Paris: OECD.
Schmidt, Manfred G. (1995). ”Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Vom Sonderweg zum Normalfall”, Politische Vierteljahresschrift 36(2): 35-48.
Straubhaar, Thomas und Heinz Werner (2003). ”Arbeitsmarkt Schweiz – ein Erfolgsmodell?”, MittAB 36(1): 60-76.
Traxler, Franz, Sabine Blaschke und Bernhard Kittel (2001). National Labour Relations in Internationalized Markets. A Comparative Study of Institutions, Change and Performance.Oxford: Oxford University Press.
198 DEBATTE
Verirrt im Labyrinth? Die Wachstumsschwäche der Eidgenossenschaft am Ende des 20. Jahrhunderts
Herbert Obinger, Zentrum für Sozialpolitik, Abteilung ”Institutionen und Geschichte des Wohlfahrtstaates”, Universität Bremen; E-Mail: [email protected]
International vergleichbare Daten (Heston et al. 2002) zeigen, dass die Schweiz gemessen an der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des realen BIP pro Kopf im Zeitraum zwischen 1980 und 2000 innerhalb der entwickelten OECD-Demokratien den letzten Rang einnimmt. Insbesondere in den 1990er Jahren hat sich das schweizerische Wirtschaftswachstum vom internationalen Wachstumszug abgekoppelt (Wagschal et al. 2002: 11; EVD 2002: 3). Zwar gibt es Indizen, dass das reale schweizerische Wirtschaftswachstum unterschätzt wird, dennoch muss selbst bei Berücksichtigung dieses Umstandes davon aus-gegangen werden, dass die Volkswirtschaft der Eidgenossenschaft in diesem Zeitraum auf hohem Niveau stagnierte.
Unter den vielen Problemdiagnosen nimmt eine politikzentrierte Interpreta-tion eine prominente Stellung ein, die im politischen Institutionengefüge des Landes eine wichtige Quelle der ökonomischen Stagnation ortet (Borner und Bodmer 2004). Demnach sei der institutionell vermittelte politische Immobi-lismus und die damit einhergehende Unfähigkeit zur Implementierung von (wirtschafts-)politisch notwendigen Reformen der wesentliche Grund für die helvetische Malaise, da es eine hohe Vetospielerdichte im politischen System unmöglich mache, offenkundig ineffiziente Politikpfade zu verlassen. Diese Problemdiagnose und die verordnete Medizin sind grundsätzlich nicht neu. Schon vor einiger Zeit liess die Unzufriedenheit mit dem aus vielen institutionel-len Checks and Balances bestehenden ”schweizerischen Labyrinth” (Lane 2001) Rufe nach einem Systemwechsel in Richtung Mehrheitsdemokratie laut werden (Germann 1994).
Dieser Debattenbeitrag argumentiert, dass die Vorstellung einer durch poli-tische Institutionen induzierten Wachstumsschwäche theoretisch bezweifelt werden kann und aus vergleichend-empirischer Sicht wenig stichhaltig ist.
Bevor allerdings mögliche Einflüsse politisch-institutioneller Stellgrössen diskutiert werden sollen, ist es ratsam, einen Blick auf die ökonomische Wachs-tumstheorie zu werfen, da dadurch die schweizerische Wachstumskrise etwas relativiert und im richtigen Kontext verortet werden kann. Gerade für den wirtschaftlichen Performanzvergleich der fortgeschrittenen OECD-Demokra-tien hat sich die neoklassische Wachstumstheorie als ausgesprochen erklä-rungsmächtig erwiesen. Demnach besteht in der Übergangsphase zu einem langfristigen Wachstumsgleichgewicht zwischen dem ökonomischen Entwick-lungsniveau und dem Wirtschaftswachstum eine inverse Beziehung. Kapital-
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 199
schwache und damit in der Regel ärmere Länder weisen daher höhere Wachs-tumsraten auf als reiche Volkswirtschaften. Tatsächlich waren in der westlichen Welt die ersten Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen raschen wirtschaftlichen Aufholprozess der ärmeren Nationen geprägt. Wenngleich sich der Konvergenzprozess im Gefolge der beiden Ölpreisschocks deutlich abge-schwächt hat, ist diese negative Beziehung zwischen dem Wirtschaftswachstum und dem ökonomischen Ausgangsniveau1 weiterhin zu erkennen (Abbildung 1).
Abbildung 1: Durchschnittliches jährliches reales Wirtschaftswachstum in 22 OECD Ländern, 1980-2000
Quelle: Penn World Table Project Version 6.1. (Heston et al. 2002).
Der Rückgriff auf die neoklassische Wachstumstheorie relativiert die schwei-zerische Wachstumskrise in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird deutlich, dass in ökonomisch hoch entwickelten Ländern wie der Schweiz exorbitant hohe Wachstumsraten, wie sie in der jüngeren Vergangenheit etwa in den südosta-siatischen Tigerländern beobachtet werden konnten, unrealistisch sind. Zum anderen weist laut Schaubild 1 die Eidgenossenschaft absolut zwar das ger-ingste pro Kopf Wachstum auf, relativ zu ihrem ökonomischen Ausgangsniv-eau haben jedoch Neuseeland und Griechenland (beides übrigens Mehrheits- demokratien) ihr Catch-up-Potenzial geringer ausgeschöpft. Dies ist allerdings
10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0
6
5
4
3
2
1
0
USA S
P
NZ
N J I
IRL
GRE
D UK SF E
CH
CAN AUS
Wir
tsch
afts
wac
hstu
m (i
n Pr
ozen
t)
BIP pro Kopf 1980 (ln)
1 In Abbildung 1 erklärt das ökonomische Startniveau knapp ein Drittel der Varianz des Wirtschaftswachstums.
200 DEBATTE
weder ein Trost noch Grund zur Entwarnung, zumal auch unübersehbar ist, dass Länder mit vergleichbarem Entwicklungsniveau wie die Vereinigten Sta-aten (ein Land mit ebenso vielen Checks and Balances wie die Schweiz) in den letzten beiden Dekaden deutlich höhere Wachstumsraten als die Schweiz er-zielt haben. Kurz: Die nationalen Wachstumsprofile haben sich zuletzt wieder stärker auseinanderentwickelt, was einer politischen Ursachenforschung zwei- fellos stärkeren Aufwind verleiht. Im Zentrum der eingangs skizzierten Prob-lemdiagnose steht dabei die Staats- und Demokratiestruktur der Eidgenossen-schaft. Wie plausibel ist nun diese These?
Aus theoretischer Sicht gibt es zwei gewichtige Gegenthesen. Zum einen bildet ein hoher Grad an vertikaler Machtteilung eine institutionelle Vorausset-zung sicherer Märkte, da dadurch Eigentumsrechte besser geschützt und Un-sicherheit stärker reduziert wird als in politischen Gemeinwesen, wo eine Zentralregierung eine grosse Machtfülle besitzt und deshalb die wirtschaft-spolitischen Spielregeln unilateral verändern kann (Weingast 1993). Die Institu-tionen des Föderalismus sind dieser Gegenthese zufolge Teil einer institutionel-len ”commitment technology” im Sinne einer (Selbst-)bindung von Herrschaft, die in einer höheren Glaubwürdigkeit politischer Akteure ihren Niederschlag findet.
Horizontale und vertikale Machtteilung bedeutet zum anderen aber auch, dass politische Entscheidungen vielfach nur mit Supermehrheiten getroffen werden können. Nach Olson entsteht dadurch ein ”superencompassing inter-est” zugunsten einer stärker gemeinwohlorientierten Politik: ”If [...] a democ-racy such as the United States or Switzerland has checks and balances that imply more than a majority is normally required for major policy changes, then the ruling supermajority will redistribute even less income to itself and will provide an even larger supply of public goods than a majority representing a smaller fraction of the society’s income-earning capacity” (Olson 2000: 19). Freilich heisst dies nicht, dass es keine Verteilungskoalitionen gibt, die den Staat als Selbstbe-dienungsladen instrumentalisieren und dadurch mittelfristig die wirtschaftliche Dynamik lähmen. Da sich solche Verteilungskoalitionen gerade in alten und politisch stabilen Demokratien einnisten (Olson 1982), sollten sie in der Schweiz eine weite Verbreitung gefunden haben. Allerdings – und dies haben viele Arbei- ten schweizerischer Ökonomen gezeigt – stellen die auf allen Staatsebenen ver-breiteten Instrumente der Direktdemokratie scharfe Waffen zur Disziplinierung politischer Verteilungskartelle dar.
Man kann theoretisch also dem Föderalismus, dem Konkordanzsystem und der direkten Demokratie durchaus positive Effekte auf die wirtschaftliche Per-formanz unterstellen. Dies entkräftet allerdings noch nicht die These, wonach diese Institutionen aufgrund der zahlreichen Vetopunkte einen wachstums-politisch ineffizienten Politikzustand durch lock-in-Prozesse gewissermassen
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 201
einfrieren können. Ob eine hohe Vetospielerdichte einen wachstumspolitischen Fluch oder Segen darstellt, lässt sich theoretisch somit nicht entscheiden. Die Theorie der Vetospieler ”[...] does not make any predictions about a relation-ship between veto players and growth. [...]. It is not clear whether many veto players will lead to higher or lower growth, because they will ‘lock‘ a country to whatever policies they inherited, and it depends whether such policies induce or inhibit growth” (Tsebelis 2002: 204).
Es ist daher auch wenig überraschend, dass die Befunde des internationa-len Vergleichs auf einen Nulleffekt von institutionellen Vetospielern auf das Wirtschaftswachstum hindeuten. Eine systematische Auswertung des For-schungsstandes (vgl. Obinger 2004) zeigt, dass die empirischen Befunde im Hin-blick auf den Einfluss von Staats- und Demokratiestrukturen auf die nationalen Wachstumsprofile ausserordentlich inkonsistent sind. Wenn die Mehrheitsde-mokratie als Patentlösung gepriesen wird, so soll an dieser Stelle daran erin-nert werden, dass die klassischen Mehrheitsdemokratien Großbritannien und Neuseeland trotz ihrer unitarischen Staatsverfassung und hoher Regierbarkeit in den ersten vier Jahrzehnten nach 1945 den mit Abstand flachsten Wachstums-pfad aller demokratischen OECD-Staaten aufgewiesen haben.
Bleibt die Direktdemokratie als potenzielle Quelle des Übels. Da die Schweiz als einziges Land diese auf nationaler Ebene ausgiebig praktiziert, ist es verfüh-rerisch, sie als Ursache für die ökonomische Misere verantwortlich zu machen. Der innerschweizerische Vergleich lehrt jedoch, dass Kantone, die direktde-mokratische Instrumente häufiger und zudem auch im Finanzbereich einsetzen, keinesfalls den übrigen Kantonen wirtschaftlich hinterher hinken. Dies führt zum Schluss, dass die ökonomische Stagnation der Eidgenossenschaft in erster Linie als Ergebnis politischer Fehlentscheidungen gedeutet werden muss, die von Institutionen lediglich vorstrukturiert und eventuell verstärkt, nicht aber determiniert werden. Das Sägen an den politischen Fundamenten ist kein geeig- neter Ausweg aus der Krise. Schlechte Wirtschaftspolitik wird in Konkor-danz- und Mehrheitsdemokratien gemacht. Constitutional engineering bleibt überdies aufgrund der hohen Kontextgebundenheit von Institutionen in aller Regel erfolglos (vgl. Przeworski 2004) und kann in einer radikalen Variante sogar die Kohäsion des Landes gefährden – mit wirtschaftlich wohl ungleich fataleren Folgen. Der historische Rückblick zeigt, dass der Wohlstand immer wieder durch Krisen bedroht wird. Die Liste der zu Modellnationen hoch stili-sierten Länder ist ebenso lange wie die jener Staaten, denen eine langwierige Krankheit attestiert wurde. Und nicht wenige Nationen finden sich zu unter-schiedlichen Zeitpunkten auf beiden Listen. Zumeist ist es also gelungen, diese Krisen – wenngleich mit unterschiedlichen Mitteln – zu überwinden. Neusee-land hat den Kurswechsel ebenso eingeleitet wie es Großbritannien gelungen ist, die British Disease abzuschütteln. Kleine europäische Konkordanzdemokratien
202 DEBATTE
haben demgegenüber ihre hohen Lern- und Anpassungskapazitäten an verän-derte wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Katzenstein 1985) genutzt, um Kris-ensituationen mittels eines koordinierten Politikwandels zu meistern. Was in der Schweiz zu tun ist, ist weitgehend bekannt (vgl. EVD 2002). Krisen besitzen immerhin den Vorteil, dass sie den Elitenkonsens wahrscheinlicher machen, der nötig ist, um das Steuer herumzureissen. Die Herbeiführung dieses Konsenses kann gerade in Kleinstaaten aufgrund einer zahlenmäßig kleinen Elite vergleichs- weise leicht bewerkstelligt werden: If ”you give a party in the capital, you can easily invite all the important political players. This makes a difference to both politics and policy” (Katzenstein 2003: 11). Den Ausweg aus der Krise könnte ein zwischen den Bundesratsparteien und Verbänden akkordiertes wirtschafts-politisches Reformpaket darstellen, welches Kosten und Nutzen breit streut. Entscheidend ist dabei v.a. die symmetrische Verteilung von Verlusten über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Ein derart konzipierter und von allen relevanten kollektiven Akteuen mitgetragener nationaler Kraftakt sichert am ehesten eine breite Legitimationsbasis und erhöht dadurch die Chancen, die Referendums-hürde zu überstehen. Die institutionenzentrierte Krisendiagnose unterschätzt m.E. dieses Potenzial für einen ”negotiated change”. In der Konkordanz liegen also durchaus Chancen: Parties matter!
Bibliographie
Borner, Silvio und Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Wachstum – Eine Schweizer Illusion.Zürich: Orell Füssli Verlag.
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD) (2002). Der Wachstumsbericht. Determinanten des Schweizer Wirtschaftswachstums und Ansatzpunkte für eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik. Bern. URL: <http://www.seco-admin.ch/imperia/md/content/analysenundzahlen/ strukturanalyse-nundwirtschaftswachstum/rapport_croissance_d.pdf> (10.01.2005)
Germann, Raimund E. (1994). Staatsreform. Der Übergang zur Konkurrenzdemokratie. Bern: Haupt.
Heston, Alan, Robert Summers und Bettina Aten (2002). Penn World Table Version 6.1. Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania, October 2002.
Katzenstein, Peter J. (1985): Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca, London: Cornell University Press.
Katzenstein, Peter J. (2003). ”Small States and Small States Revisited”, New Political Economy 8(1): 9-30
Lane, Jan-Erik (ed.) (2001). The Swiss Labyrinth. London, New York: Frank Cass.
Obinger, Herbert (2004). Politik und Wirtschaftswachstum. Ein internationaler Vergleich.Wiesbaden.
WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 203
Olson, Mancur (1982). The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven, London: Yale University Press.
Olson, Mancur (2000). Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. New York: Basic Books.
Przeworski, Adam (2004). ”Institutions Matter?”, Government and Opposition 39(4): 527-540.
Tsebelis, George (2002). Veto Players. How Institutions Work. Princeton: Princeton. University Press.
Wagschal, Uwe, Daniele Ganser und Hans Rentsch (2002). Der Alleingang. Die Schweiz 10 Jahre nach dem EWR-Nein. Zürich: Orell Füssli Verlag.
Weingast, Barry R. (1993). ”Constitutions as Governance Structures: The Political Foundations of Secure Markets”, Journal of Institutional and Theoretical Economics 149(3): 286-311.








































































![Japan 2013: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft [Japan 2013: Politics, Economy and Society]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631587f95cba183dbf080807/japan-2013-politik-wirtschaft-und-gesellschaft-japan-2013-politics-economy.jpg)