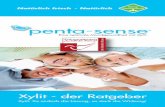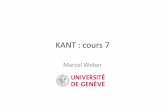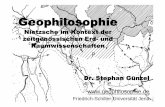Was ist für Kant der „gute“ Wille?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Was ist für Kant der „gute“ Wille?
Université du Luxembourg
Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
Was ist für Kant der „gute“ Wille und versteht man unterdem kategorischen Imperativ?
Vorgelegt von:
AGOVIC Dino
011122622c
Inhaltverzeichnis
A. Einleitung 2
Zur Person von Immanuel Kant 2
B. Hautptteil 3-
13
1.Der „gute“ Wille 3-
5
1.1.Das sittliche „gut“ 4
1.2.Der Wille 4-
5
1.3.Konsequentialismus 5
2.Der kategorische Imperativ und seine verschiedene Formulierungen
5-13
2.1.Der hypothetische Imperativ
5-8
2.2.Der kategorische Imperativ
8-9
2.3.Die Naturgesetzformel
9-10
2.4.Die Zweck-an-sich-Formel
10-11
2.5.Die Autonomieformel 12
2.6.Die Reich-der-Zwecke-Formel
3
13
C. Schlussfolgerung 14
D. Literaturverzeichnis 15
A. EinleitungDie folgende Hausarbeit wird sich wesentlich auf zwei Hauptziele
orientieren. Erstens soll sie die Frage beantworten, was Kant als
einen guten Willen meint, und zweitens was sein kategorischer
Imperativ überhaupt ist und welche Fassungen dieses Imperativs
finden wir in seinem Werk, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
Was verstehen wir unter einer Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten? „Also, eine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist der mit der Aufsuchung
und Festsetzung des obersten Prinzips der Moralität befaßte Teil einer Metaphysik der
Sitten. Eine Metaphysik der Sitten ist eine Reine Moralphilosophie.1“ Hier stellt sich
wiederum die Frage was eine reine Moralphilosophie eigentlich 1 BITTNER, Rüdiger : Das Unternehmen einer Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten. S. 16.4
bedeutet? Rein ist eine Moralphilosophie erst dann wenn diese
„lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt“2.
Am Anfang der Hausarbeit werde ich kurz auf die Person von Kant
eingehen um einen kurzen überblick zu liefern, wie die Person
gewesen war und in welcher Zeitspanne sie gelebt hat und ihre
Theorien entwickelt hat.
Zur Person von Immanuel Kant3
Immanuel Kant, geboren als Emanuel Kant, am 22. April 1724 in
Königsberg,( im alten Preußen, heute Russland), verstorben am 12.
Februar 1804, ist der bekannteste Vertreter der abendländischen
Philosophie. Er war das als vierte Kind einer Sattlerfamilie.
Sein Leben wird nicht spektakulär geschildert, er lehrte
Philosophie in Königsberg, jedoch bekam viele Angebote in anderen
Universitäten zu lehren, (Bsp. Jena) doch diese lehnte er ab.
Viele Autoren sagen uns, dass sie uns den Tagesplan von Kant
besser wissen als die ttsächlich Philosophie von ihm, damit soll
wiedergegeben werden, dass Kant einen relativ strikten Lebensplan
hatte und diesen Tagtäglich ausführte.
2 AAIV, 445.3 Vgl. : LUDWIG, Ralf : Kant für Anfänger, Die Kritik der reinen Vernunft,
S.20.ff.5
B. Hauptteil1. Der „gute“ WilleAm Anfang des ersten Abschnitts präsentiert Kant eine für seine
Ethik grundlegende Ansicht: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch
außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten
werden, als allein ein guter Wille“4
Hier findet man eine Definition des guten Willens, jedoch
erläutert Kant uns hier nicht was der gute Wille eigentlich ist,
sondern genau das Gegenteil, er sagt uns was er nicht ist. Hierbei
sprechen wir von einer metaethischen Definition oder grob
Metaethik. Was ist der Unterschied zwischen Ethik und Metaethik?
Die Ethik beschäftigt sich mit Fragen wie: Was soll ich tun?
Welche Handlungen sind gut? Die Metathik im Gegensatz versucht auf
Fragen zu antworten wie: Was ist das „Gute“ überhaupt? An dieser
Stelle kann man sich die Frage stellen was Kant überhaupt unter
gut versteht?
Wir können gut auf verschiedene Arten verstehen (wie oben
illustriert), jedoch wollen wir herausfinden was moralisch gut
ist. Beispiel: -das Messer ist gut. In diesem Fall ist das
Messer nicht moralisch, sondern hier schließt man aus dem Kontext,
dass das Messer nützlich oder scharf ist. Das Messer kann nicht
moralisch gut sein, weil es nicht nur für etwas Gutes verwendet
4 AA IV, 393.6
werden kann. (z.B.: schneiden oder Leute ermorden) Für Kant ist
das Gute ein uneingeschränktes gut. Der gute Wille bei Kant muss
nicht alle diese Kriterien beinhalten.
Als nächstes meint Kant dass die Eigenschaften wie Talente des
Geistes (Verstand, Witz und Urteilskraft) oder positive
Eigenschaften des Temperaments (Mut, Entschlossenheit und
Beharrlichkeit im Vorsatze) oder Glücksgaben (Macht, Reichtum,
Ehre und Gesundheit) positiv als auch negativ auswirken. Für ihn
entscheidet nur der Wille über eine positive oder negative Nutzung
dieser Eigenschaften. Beispiel einer positiven oder negativen
Nutzung einer Eigenschaft (z.B.: Mut):
Positive Nutzung => Ein Feuerwehrmann muss Mut besitzen um
Menschen in einem Brandfall zu retten.
Negative Nutzung =>Ein Räuber muss Mut aufbringen um jemanden
seine Brieftasche zu entwenden.
Die Werte der Alten (also die Tugenden der Philosophen in der
Antike wie Mut,…) sollen den Willen hochstufen, sie sollen den Mut
entwickeln einer verletzten Person auf der Straße zu helfen, aber
dies würde am Wert dieser Tatsache, ob ich es jetzt gut oder
schlecht finde dieser verletzten Person zu helfen überhaupt keinen
Einfluss darauf haben. Diese Werte würden nur die praktische
Umsetzungsbarkeit befördern. Kants Problem betrifft die Frage
woher wir diese Tugenden haben? Kants Meinung ist es, dass wir die
Tugenden extern aus der Natur und Gewohnheit lernen können. Das
moralische Handeln soll nach Kant von sich selbst (intern) kommen,
also kann für ihn eine Handlungsbegründung nicht aus der Erfahrung
entwickelt werden. Unsere moralischen Handlungen sollen sich
grundsätzlich rational, also Mittels Vernunft beruhen. Unser
Handeln sollte frei von jeglichen Motiven, Trieben oder Zwängen
7
sein, die z.B.: aus unseren Gefühlen oder Erfahrung hergeleitet
werden. So kann man schließen dass es nicht moralisch ist wenn man
seiner Großmutter auf der Straße helfen würde die einen
Herzinfarkt bekam, da wir gewisse Gefühle (Mitleid, Liebe…)
subjektiv zu ihr haben und vielleicht auch andere Triebe (wenn die
Großmutter stirbt bekomme ich kein Extra-Taschengeld mehr) als ihr
primär zu helfen. Würde man jedoch einer unbekannten Person auf
der Straße helfen und kein Motiv für sein Handeln haben, dann
würde ich laut Kant moralisch handeln. Die Vernunftgründe für
unser Handeln müssen für uns einsehbar und zwingend sein.
1.1.Das sittliche „gut“Was ist sittlich gut? Für Kant kommt nur der gute Wille in Frage,
da die konkreten Inhalte je nach spezifischen Situationen wechseln
und alle Eigenschaften (Tugenden) auch zum Negativen verwendet
werden können. Also ist der gute Wille allgemeingültig (allgemein-
zweckmäßig5) da er sich nicht auf subjektive Neigungen oder Triebe
einer Person richtet. Kant merkt an, dass der gute Wille allein
durch das Wollen gut ist. In späteren Seiten äußert sich Kant,
dass ein guter Wille erst gut ist wenn dieser nur durch die
Pflicht bestimmt wird.
1.2.Der WilleWas versteht Kant unter dem Begriff Wille? Der Wille ist bei Kant
ein motivationaler Grund, d.h. ein Grund, dass jemand zum Handeln
bewegt/erzwingt wird. Diesen Grund definiert Kant als
uneingeschränkt, der aus reinem gutem Willen heraus resultiert. An
anderer Stelle nennt Kant den Willen auch noch Vernunft im
5 AA IV, 393.8
praktischen Gebrauch. Wenn der Wille besteht, so Kant, müssen wir
alles Erdenkliche tun.
1.3.Konsequentialismus Der Konsequentialismus bewertet die Konsequenzen (Folgen) von
einer Handlung. Wir unterscheiden zwei Positionen des
Konsequentialismus, um diese zwei Positionen besser zu deuten
gehen wir immer von diesem Fallbeispiel aus: Wir finden eine
verletze Person auf der Straße die schnellstmöglich erste Hilfe
benötigt. In unserem Fall müssen wir die Mund-zu-Mund-Beatmung
durchführen.
a) Beabsichtigte Folgen, wir wollen dieser Person nicht die Rippen
brechen. (die Rippen sind trotzdem gebrochen, jedoch wollte ich
das nicht)
b) Tatsächliche Folgen, wir haben der Person zufällig die Rippen
gebrochen (egal ob ich es wollte oder nicht)
Was meint Kant zu diesen jeweiligen Positionen? Es ist nur der
gute Wille der zählt egal wie der Ausgang der Handlung ist. Wir
haben alles in unserer Möglichkeit stehende (unser Bestes) getan
um dieser Person zu helfen. „wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen“6 Wir
können laut Kant mit unserem Ergebnis zufrieden sein, da wir
mittels unserem guten Willen gehandelt haben und all unsere
Möglichkeiten getan haben um dieser Person zu helfen.
2. Der kategorische Imperativ und seine
verschiedene Formulierungen
6 AA IV, 394.9
2.1.Der hypothetische ImperativJedoch bevor wir zu Kants kategorischen Imperativ kommen erläutern
wir den hypothetischen Imperativ. In sprachlicher Art sind
Imperative => Soll-Sätze. Für Kant versteht den Imperativ nicht
als Befehl, er definiert sie als Gebote.
Was ist der spezifische Unterschied von Imperativ im Verständnis
von Befehl und Gebot? Imperative sind Gebote, Regeln die zu
befolgen sind aber nicht im Sinne, dass sie nur befehligt werden.
Das Missverständnis bei Befehle wäre, dass sie gewisser Maßen von
außen (extern) einem auferlegt werden.
Warum finden wir diese Imperative in der Ethik und wer macht
diese? Die Imperative kommen aus der Vernunft heraus, d.h. dieses
praktische Vernunftvermögen ist ein Vermögen um Imperative
aufzustellen. Zudem drückt die Vernunft dem Imperativ keine Regeln
von Außerhalb ein, sondern sie ist ein Vermögen, was in uns allen
drin ist (intern) und was uns ermöglicht Gesetzmäßigkeiten zu
erkennen. Diese Gesetzmäßigkeiten die die Vernunft erkennt sind im
praktischen Sinne für das Handeln in der Form der Imperative.
Diese Imperative können wir als Tatsachen definieren. Der
Imperativ unterscheidet sich von einer Regelform (Zum Beispiel:
Wünsche). Die Wünsche sind etwas, was wir als Regel definieren
können.
Beispiel: Ich wünsche mir Klavier spielen zu können.
=> Dies ist aber kein Imperativ, Wünsche drücken etwas anderes aus
wie z.B.: ich will Klavier spielen können, dies sind Tatsachen für
uns und nicht zu verstehen mit Regeln die die Außenwelt (Eltern,
Freunde…) uns aufdrücken.
Sondern: Wenn ich ein guter Klavierspieler werden möchte, dann
muss ich viel üben. Dass sind für uns Tatsachen, die gleichzeitig
10
in einer imperativen Form formuliert sind. Diese Tatsachen haben
eine besondere Eigenschaft: sie sind laut Kant, objektiv gültig,
d.h. wenn ich sehe, dass man viel üben muss um ein guter
Klavierspieler zu werden. Diese Tatsachen gelten für alle und
nicht nur subjektiv für eine gewisse Person. Die Tatsachen sind
allgemeingültig, jeder muss viel üben um ein guter Klavierspieler
zu werden. In diesem Kontext ist es zu verstehen dass Imperative
eine Art Nötigung ausdrücken.7
Warum spricht Kant hier von Nötigung? Die Vernunft stellt und eine
Form von Gesetzmäßigkeit dar, mit dieser können wir beurteilen, ob
gewisse Handlungen adäquat sind um einen gewissen Zweck zu
verfolgen oder nicht. Die Imperative geben uns einen Algorithmus,
mit diesem können wir feststellen ob es gut ist Fern zu schauen
dafür dass wir den Zweck verfolgen ein guter Klavierspieler zu
werden.
Warum brauchen wir (Menschen) Imperative? Kant unterscheidet von
zwei verschiedenen Wesen8:
Vollkommene (reine) Vernunftwesen: Heilige Wesen, die von
ganz alleine, das Richtige tun. Keine Neigungen (Triebfedern)
haben die sie beeinflussen könnten.
Unvollkommene Vernunftwesen: Kant meint hiermit die Menschen,
die Neigungen haben und mittels Imperative auf die richtige
bahn geleitet werden sollen.
Was haben vollkommene und unvollkommene Vernunftwesen gemeinsam?
Die vollkommenen (reine) Vernunftwesen haben die Einsicht (um ein
guter Klavierspieler zu werden, muss ich viel üben). Der Mensch
dagegen braucht eine Erkenntnis um dieses zu folgern. Die
vollkommenen Vernunftwesen erkennen den motivationalen Gehalt und7 Vgl.: AA IV, 413.8 Vgl.: Ebd., 414.
11
den Zusammenhang von üben und dem guten Klavier spielen. Sie
setzen dies sofort um. Die unvollkommenen Wesen erkennen die
Gesetzmäßigkeit da drin aber das führt bei ihnen noch nicht dazu
dass sie diese Handlung auch umsetzen. Für die vollkommenen
Vernunftwesen wären diese Gesetzmäßigkeiten keine Imperative, es
wären lediglich nur Gesetzmäßigkeiten und zwar ausgeführte. Die
Imperative entstehen erst im Adressaten, also ein Wesen was begabt
ist diese Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, auf der anderen Seite
darüber reflektieren zu können und sein Handeln dann danach
aufzurichten.
In Kants Ethik sind die Imperative eine praktische Sache. Es geht
nicht um die Imperative sondern um die Anwendung von
Vernunftgesetzen, die alle verstehen, und jedoch sie nicht direkt
umsetzen müssen. Aber dies bedeutet auch wenn es Vernunftgesetze
sind, die wir erkennen dann ist die Reichweite dieser
Vernunftgesetze nicht eingeschränkt, d.h. die Tatsache, dass sie
diesen Zusammenhang (zwischen dem guten Klavier spielen und dem
vielen Üben) ist etwas was Kant äußert als darin bestehe eine
allgemeine Notwendigkeit. Dies ist der Grund warum das vollkommene
Vernunftwesen es tut, jedoch für das unvollkommene Vernunftwesen
hat diese Notwendigkeit aber den Charakter, dass es nötigend
wirkt. Sie verstehen, dass es das Richtige ist viel zu üben. ,
deswegen zwingt es uns das auch zu tun, aber zwingt es uns nicht
direkt zur Ausübung, weil sie noch andere persönliche Triebe in
uns auffinden. Was sind hypothetische Imperative? Für Kant sie
immer Zweck-Mittel-Beziehungen. „Der hypothetische Imperativ sagt also nur,
daβ die Handlung zu irgend einer möglichen oder wirklichen Absicht gut sei.“9 Der
hypothetische Imperativ wird angewendet um einen bestimmten Zweck
9 AA IV, 41412
zu erreichen. Wenn ich ein guter Klavier spielen werden möchte, so
muss ich viel üben. Also ich muss etwas tun, um mein Ziel/Zweck zu
erreichen. Wenn wir einen hypothetischen Imperativ formulieren
wollen funktioniert er immer:
„Wenn man einen bestimmten Zweck will, soll man die dafür notwendigen Mittel
ergreifen.“ 10
Weshalb gilt der hypothetische Imperativ? Wir finden heraus warum
sie gelten, wenn wir sie selbst betrachten, da in ihnen selbst
steckt analytisch schon ihre Gültigkeit. Was versteht man unter
analytisch? Analytisch bedeutet dass in diesen Begriffen des
hypothetischen Imperativs schon enthalten ist warum dieser gilt.
Gegenfolie davon ist synthetisch, bei diesen bräuchten wir mehr
Wissen um etwas zu erklären, da alleine wir nicht auf eine
Gültigkeit kommen.
Beispiel eines analytischen Satzes: Alle Junggesellen sind
unverheiratet.
Beispiel eines synthetischen Satzes: Alle Schwäne sind weiß. =>
Durch den Begriff „Schwäne“ ist nicht ausgeschlossen, dass es auch
schwarze (oder andere) Schwäne gibt.
Wir müssen Zwecke setzen, wenn wir einen hypothetischen Imperativ
aufstellen. David Hume ist einer anderen Auffassung als Kant. Für
ihn gibt es nur Wünsche.
Wunsch 1 Ich will gut Klavier spielen können.
↓
Vernunft
↓
Wunsch 2 Ich will üben.
10 Ebd., 41513
Die Vernunft ist hier verantwortlich für eine Zweck-Mittel-
Verknüpfung, sie ist auch verantwortlich für den Wunsch 2: ich
will üben. Die Vernunft nimmt den Zusammenhang zwischen diesen
beiden. Hier kann man eine kausale Beziehung erkennen. Wenn ich X
als Resultat will, dann muss ich Y machen, wenn ich Y mache dann
folgt X daraus. Dass wir den Wunsch 2 haben, kommt aus der
Erfahrung (Bsp.: Tom, ist ein guter Klavierspieler und hat mir
gesagt dass man jeden Tag üben muss) So kommt man auf die
Erkenntnis, dass man viel üben muss um gut Klavier zu spielen.
Kant kritisiert Hume, er traut der Vernunft mehr zu. In der
Zwecksetzung dass wir gut Klavier spielen wollen, nicht nur drin
enthalten (dafür notwendig ist), dass wir üben wollen oder dass
das viel üben ein gutes Mittel (adäquates) ist. Die praktische
Vernunft bei Kant sieht bei dieser Zwecksetzung einen normativen
Gehalt, d.h. in dem Moment wo wir verstehen, dass das viele üben
ein Mittel dafür ist, gibt es dazu noch eine Form von Aufforderung
nämlich, dass wir das Mittel anstreben sollen. Man muss den Wunsch
nicht haben um Klavier spielen zu lernen, jedoch wenn man diesen
hat spürt man laut Kant eine Nötigung um viel zu üben. Wir werden
intern gezwungen um zu üben um unser Resultat zu verwirklichen.
Hypothetische Sollwert: Wenn man einen Zweck will, dann soll man
ihn erreichen. Hier sehen wir dass der Soll-Gehalt hier vertreten
ist. Diesen finden wir auch in Kants kategorischen Imperativ.
2.2.Der kategorische ImperativWas ist der kategorische Imperativ? Wie stellen wir den
hypothetischen Imperativ auf und wie den kategorischen?
Beim Hypothetischen erkennt die Vernunft die Mittel die
14
erforderlich sind um unseren Zweck gerecht zu werden, und beim
kategorischen beziehen Unsere Handlung sich nicht auf einen Zweck,
sondern sie gilt als Prinzip. Der kategorische Imperativ ist eine
praktische Notwendigkeit. Etwas was unbedingt sein muss, dass aber
völlig für sich selbst gilt und nicht nur unter der Bedingung dass
wir z.B.: Klavier spielen erlernen wollen.
Kants Beispiel: „ Es ist notwendig, nicht zu lügen“. Die Frage: „wozu ist
es notwendig, nicht zu lügen? Wird sich hier nicht gestellt. Denn
bei dem kategorischen Imperativ kommt es nicht auf individuellen
Zweck an, dem die Handlung als Mittel dienen soll, sondern eine
Handlung wird ohne einen Bezug auf einen individuellen Zweck als
notwendig zu formulieren.
Kants kategorischer Imperativ ist schwierig zu definieren. Dieses
Gesetz wird von Kant in 5 verschiedenen Fassungen dargestellt.
Kant gibt uns eine bestmögliche Definition, sie wird auch in
Fachkreisen, Universalisierungsformel oder auch Grundformel
genannt.
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein
allgemeines Gesetz ist.“11
Die Problematik an dieser Formel liegt darin, dass man nicht weiß
was ein allgemeines Gesetz ist. Kant umgeht dieses Problem, indem
er meint dass Menschen kausal determiniert sind. Man kann es
verstehen, dass es allgemeine Gesetze auf dieser Welt gibt, die
wir Menschen absolut nicht verstoßen können. (Bsp.: Wenn man (aus
dem Fenster) springt, dann fällt man.
2.3.Die Naturgesetzformel des kategorischen Imperativs
11 AA IV, 421.15
Eine andere Fassung des kategorischen Imperativs ist die
Naturgesetzformel:
„Handle so als ob die Maxime deiner Handlung zum allgemeinen Naturgesetz werden
sollte.12“ oder auch: „Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allgemeine
Naturgesetze zum Gegenstande haben können.“13
Kant meint, dass die Naturgesetzformel, die
Universalisierungsformel so ausformuliert, dass sie praktisch
Anwendbar ist. Sie gibt gewisser Massen einen Algorithmus vor. Die
Naturgesetze besitzen eine Notwendigkeit und sind allgemeingültig.
Es sind genau diese Eigenschaften, die laut Kant, auch moralische
Gesetze auszeichnen müssen. Die Naturgesetzformel wird von allen
Fassungen von Kant am ausführlichsten behandelt. In dieser Formel
spricht er von vier Fallbeispielen14:
-Selbstmordbeispiel -Verbrechensbeispiel
-Talentbeispiel -Hilfe-in-der-Not-Beispiel
Mittels dieser Beispiele formuliert Kant seine vier Grundtypen
moralischer Pflichten. „Nun wollen wir einige Pflichten herzählen nach der
gewöhnlichen Einteilung derselben im Pflichten gegen uns selbst und gegen andere
Menschen, in vollkommene und unvollkommene Pflichten.“15 Bei diesen Pflichten
handelt es sich zum einen um Pflichten gegen sich selbst (das
Selbstmord- und Talentbeispiel würde man in diese Gruppe
hineinbringen) und Pflichten gegen andere (in welche man die
restlichen zwei Beispiele unterbringen kann).Aber Kant
unterscheidet zudem zwischen vollkommene und unvollkommene
Pflichten.
Vollkommene Pflichten Unvollkommene
12 Ebd., 421.13 Ebd., 437.14 Vgl.: Ebd., 422-423.15 Ebd., 422.
16
Pflichten
Gegen sich selbst Selbstmordverbot Verbot der
Nichtentwicklung
eigener Fähigkeiten
Gegen andere Verbot des falschen
Versprechens
Verbot der
Gleichgültigkeit
gegen fremde in Not
Wie unterscheiden sich vollkommene und unvollkommene Pflichten
voneinander? Vollkommene Pflichten besitzen einen Widerspruch im
Denken. Hier passen das Beispiel und vom falschen Versprechen
hinein. Wir werden jetzt auf das Beispiel des falschen
Versprechens eingehen. Kant spricht im Beispiel von der Situation,
dass man kein Geld besitzt und von jemandem es ausleihen will,
jedoch mit dem Hintergedanken im Kopf hat ihm dieses nicht wieder
zugeben zu können. Die Voraussetzung eines Versprechens ist die
Wahrheit. Ob diese Person letztendlich dass gegebene Versprechen
einlösen kann oder nicht, spielt keine Rolle. Wir können nicht
unter der Annahme, dass wir immer das Versprechen brechen, kein
Versprechen eingehen. Dies wäre so als ob würden wir sagen, wir
lügen unter der Annahme, dass wir aber niemals die Wahrheit in
sich behalten können. Für Kant nennt dies einen begrifflichen
Widerspruch.
2.4.Die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs
(oder Menschheitszweckformel)Die dritte Variante des kategorischen Imperativs ist die Zweck-an-
17
sich-Formel; Kant definiert diese folgender Maßen: „Handle so, daß
du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“16 Auch diese Formel wird in
der GMS von Kant noch in einer anderen Art gedeutet: „Handle in
Beziehung auf ein jedes vernünftige Wesen (auf dich selbst und andere) so, daß es in
deiner Maxime zugleich als Zweck an sich selbst gelte“17
Diese Formulierung ist anthropozentrisch, da diese Weise des
kategorischen Imperativs den Menschen als Zentrum sieht. Zentral
soll hier gemeint sein, dass der Mensch nicht nur ein Mittel zum
Zweck ist, sondern auch gleichermaßen der Zweck ist. Hier gibt es
ein gutes Beispiel für Kants Denkweise: §14 Abs. 3: „unmittelbaren
Einwirkung mit Waffengewalt [...]wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass
das Flugzeug gegen Menschen eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur
Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist.“ Dieser Abschnitt des
Luftsicherheitsgesetzes galt 2004 als sehr umstritten. Das Gesetz
würde hiermit zustimmen, gegebenenfalls ein voll besetztes
Passagierflugzeug abzuschießen, wenn man befürchten würde, von ihm
könnte eine potenzielle Gefahr ausgehen, wie zum Beispiel die,
eines Terroranschlags wie der des 11. Septembers 2001. Es wurde
2006 abgelehnt mit der Argumentation, es würde gegen die
Menschenwürde verstoßen, dem Staat die Möglichkeit zu geben,
kurzfristig Todesurteile zu fällen, um eventuell andere
Menschenleben zu retten. Der Artikel sei absolut unvereinbar mit
dem Grundgesetz. In anderen Worten stößt die rechtliche
Beurteilung hier an ihre Grenzen. Doch wie steht es mit der
ethischen Rechtfertigung? Ist ein Verhalten ethisch vertretbar,
wenn die abgezielten Folgen moralisch sind? Laut Kant darf das
Flugzeug nicht zerstört werden. Wenn man das Flugzeug zerstören 16 AAIV, 429.17 Ebd., 437.
18
würde, dann wären die Passagiere (Menschen) ein Mittel zum Zweck.
Dies würde die Idee von Kant Sicherheit des Volkes widersprechen.
Der Mensch soll nicht als Gegenstand oder Sache behandelt werden.
Allen Menschen, also Vernunftwesen kommt die Würde als Zweck an
sich selbst zu. Der Mensch darf laut Kant als Mittel seines
eigenen Zweckes gebraucht werden, aber nur unter der Voraussetzung
dass seine Würde nicht behindert wird.
„Nun sage ich: der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existiert als Zweck an
sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauch für diesen oder jenen Willen,
sondern muß in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige
Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden.“18
2.5.Die Autonomieformel des kategorischen ImperativsHandle so: „daß der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein
gesetzgebend betrachten könne“19 oder , handle so, das der eigene Wille:
„[...]sich selbst gesetzgebend zum Gegenstande haben könne“20
Die Autonomieformel nimmt auf einer Weise einen Aspekt auf der
über die Grundformel und die Naturgesetzformel hinausgeht, aber18 AAIV,428.19 AAIV, 434.20 Ebd., 432.
19
auch fällt sie nicht hinter die Zweck-an-sich-Formel zurück,
sondern fügt eine inhaltliche Dimension der Pflicht mit ein.
Der Ausgangspunkt dieser Formulierung ist die Idee der Freiheit.
Kant will mit dieser Formulierung die Rechtfertigungsmöglichkeit
des moralischen Gesetzes analysieren. Des weiteren baut sich die
Gesetzgebung als allgemein verbindlich aber auch als aus
selbstbestimmter und autonomer Freiheit auf. So kann jeder Mensch
sein Handeln selbst lenken, sei es böse oder gute Handlungen.
Herbert Huber meint hierzu: „Freilich liegt die Würde des bösen Menschen nicht
in den Bösen selbst, das er tut, sondern auch bei ihm liegt sie in der Möglichkeit zum
Guten, die durch die Freiheit auch demjenigen Subjekt eröffnet ist, das sich zum Bösen
bestimmt.“21
Jedes Vernunftwesen möchte niemals nur als ein Mittel angesehen
werden, sondern immer auch als Zweck. Die Würde und die
menschliche Achtung wird indirekt so zum universellen Gesetz. Der
Mensch kann laut Kant, tun was er will (gut oder böse), der
subjektive Wille beeinflusst dem Menschen seine Handlung. Der
Wille ist für Kant nur frei, wenn dieser von nichts Externes
(Menschen, Autoritäten, Gesetzen usw.) beeinflusst wird.
„Dass Kant die Moral als autonomes Normensystem begreift und somit der eigene
gesetzgebende Wille den Ursprung von Moralität bildet, hängt mit Kants These zusammen,
dass die Normen der Moral unbedingten Status haben. Wenn moralische Gebote und
Verbote nicht relativ, sondern bedingungslos gelten, dann muss ihre Gültigkeit aus ihrer
Übereinstimmung mit dem moralischen Prinzip folgen, das sich ein freier und vernünftiger
Wille gibt.“22
Aus diesem Gedankengang der Autonomieformel schlussfolgert Kant
eine folgende Formulierung, die Reich-der-Zwecke-Formel.
21 HUBER, Herbert : Kant ; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S.12.22 PAUER-STAUDER, Herlinde : Einführung in die Ethik, S.16.
20
2.6.Die Reich-der-Zwecke-Formel des kategorischen
ImperativsDie letzte Formulierung des kategorischen Imperativs ist unter der
Reich-der-Zwecke-Formel bekannt. Kant definiert diese Formel so:
„Demnach muß ein jedes vernünftige Wesen so handeln, als ob es durch seine Maximen
jederzeit ein gesetzgebendes Glied in allgemeinen Reiche der Zwecke wäre“23, oder
auch wird diese Formel von Kant so erwähnt: „Das vernünftige Wesen muß
sich jederzeit als gesetzgebend in einem durch Freiheit des Willens möglichen Reiche der
Zwecke betrachten, es mag nun sein als Glied, oder als Oberhaupt“24
Für Kant sind alle vernunftbegabten Wesen im Reich der Zwecke
durch den kategorischen Imperativ verknüpft. Dieses Reich der
Zwecke ist ein Idealstand von einer Zusammensetzung aller
moralisch agierenden Vernunftwesen. Das einzelne Wesen in einer
solchen Gemeinschaft dazu verpflichtet sind, erstens immer seine
individuellen Handlungsabsichten zu prüfen und zweitens diese auch
auf alle anderen Vernunftwesen dieser Gemeinschaft einzugehen. In
anderen Worten kann man dieses Reich als eine systematische
Verknüpfung unterschiedlicher Vernunftwesen durch immanent
gemeinschaftlicher Gesetze ansehen, da jeder dieser Individuen
selbst widrig handeln kann. Diese Immanenz ist durch die Vernunft
und moralischen Gesetzen charakterisiert. Kant Entschluss ist der
folgende: „Hierdurch aber entspringt eine systematische Verbindung vernünftiger
Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze, d.I. Ein Reich, welches, weil diese
23 Ebd., 438.24 Ebd., 434.
21
Gesetze eben die Beziehung dieser Wesen aufeinander, als Zwecke und Mittel, zur Absicht
haben, ein Reich der Zwecke (freilich nur ein Ideal) heißen kann.“25 Ein Leben in
vollendeter moralischen Gemeinschaft ist laut Kant nur möglich
mittels eines vernunftbezogenes und pflichtgemäßes Befolgen der
Gesetze in der Sitte. Das Reich der Zwecke muss, nicht wie das
Naturreich, vom vernünftigen Wesen geschaffen werden und von
diesem auch wie eine Pflanze erhalten werden.26 Hier wird das
moralische Gelingen des einzelnen Vernunftwesen der Gesellschaft
ins Zentrum gesetzt. Die Vernunftfähigkeit des Wesens soll durch
die Trennung von der Sinnlichkeit eine Form der Gleichheit
realisieren, die allgemeingültig ist. Eine systematische
Verbindung ist nach Schönecker nur so möglich, er ergänzt: „als ein
geordnetes Zusammenleben von Wesen, die sich und ihre Zwecksetzungen harmonisch
ordnen und gegenseitig unterstützen“27.
C. Schlussfolgerung
Die Hausarbeit hat uns geholfen den kategorischen Imperativ von
Kant darzustellen. Wir haben heraus gefunden dass es Kant gelungen
ist ein zentrales Prinzip des moralischen Agieren zu finden und es
darzustellen. Mit Kants Werk der Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten wird die Frage eines guten und gelungenen Lebens
25 Ebd., 433.26 Vgl. KLOPFER, Max : Ethik- Klassiker von Platon bis John Stuart Mill, S.318.27 SCHÖNECKER Dieter\WOOD, Allen : Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
S.161.22
beantwortet. Die Hausarbeit zeigte uns auch die fünf verschiedenen
Formulierungen des kategorischen Imperativs. Wir schlussfolgern
dass der kategorische Imperativ ein Mittel der Vernunft ist, durch
welcher unser Wille gefordert wird, selbstständig zu sein. Dies
autonome Handeln ist nur möglich da unsere Vernunft ihn dazu
anstrebt. Die Gesetzgebung des Willens ist ein Phänomen das dem
Willen durch den kategorischen Imperativ von der praktischen
Vernunft erteilten Gesetzes. Eine Handlung ist nach Kant erst
„gut“, durch erstens ihre Vereinbarkeit mit dem KI und zweitens
wenn sie durch die Selbstständigkeit zu einem freien Handeln
führt.
Auch noch in unserer Zeit sind kategorische nicht weg zudenken;
diese werden noch heutzutage von verschiedenen Autoren
konstruiert, eines der berühmtesten Beispiele hierfür wäre Jonas
KI, der folgender wäre:
„Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz
echten menschlichen Lebens auf Erden‘; oder negativ ausgedrückt: ‚Handle so, daß die
Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen
Lebens‘; oder einfach: ‚Gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der
Menschheit auf Erden‘; oder wieder positiv gewendet: ‚Schließe in deine gegenwärtige
Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mit-Gegenstand deines Wollens ein.“28
28 JONAS, Hans : Das Prinzip der Verantwortung, S.36.23
D. Literaturverzeichnis
BITTNER, Rüdiger: Das Unternehmen einer Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten (Hrsg) Höffe Otfried, in: Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten, 3. Auflage, Frankfurt Am Main 2000
HUBER, Herbert: Kant; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
[http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?
id=77838887&url=af90973104141d7364294122de2e587e] Türkheim 2006
JONAS, Hans : Das Prinzip der Verantwortung, Versuch einer Ethik
für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main 1979
KANT, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Hrsg)
Kraft, Bernd & Schönecker Dieter, Felix Meiner Verlag, Hamburg
1999
KLOPFER, Max: Ethik-Klassiker von Platon bis John Stuart Mill, Ein
Lehr- und Studienbuch, Stuttgart 2008
LUDWIG, Ralf : Kant für Anfänger, Die Kritik der reinen Vernunft,
15. Auflage, München 2011
PAUER-STAUDER, Herlinde: Einführung in die Ethik, UTB, Wien 2003
24