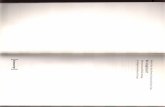Was ist eine geschichtliche Sequenz?
Transcript of Was ist eine geschichtliche Sequenz?
Christian Schmidt (Hg.)
Können wir der Geschichte entkommen?Geschichtsphilosophie am Beginn des 21. Jahrhunderts
Campus VerlagFrankfurt/New York
Gefördert mit freundlicher Unterstützung der VolkswagenStiftung.
Bibliogra�sche Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra�e. Detaillierte bibliogra�sche Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.ISBN 978-3-593-39972-0
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover�lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Copyright © 2013 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am MainUmschlaggestaltung: Campus Verlag GmbH, Frankfurt am MainDruck und Bindung: CPI buchbücher.de, BirkachGedruckt auf Papier aus zerti�zierten Rohsto�en (FSC/PEFC).Printed in Germany
Dieses Buch ist auch als E-Book erschienen.www.campus.de
Inhalt
Können wir der Geschichte entkommen? Ein einführender Überblick zur Fragestellung Christian Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Aufklärung – Befreiung
Kritik, Zeit, Geschichte Nikolas Kompridis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Notwendige Geschichte – Zur Debatte um »radikale Aufklärung« Martin Saar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hegels %eorie der Befreiung – Gesetz, Freiheit, Geschichte, Gesellschaft Christoph Menke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Negative Geschichtsphilosophie nach Adorno Peggy H. Breitenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kritik als Lebensform – Foucaults Studien zu Kant und revolutionärer Subjektivität Christian Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6
II. Sich lösen
Was ist als-ob? Die Rolle des Fiktiven in der Geschichte Beatrice Kobow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Die säkulare Fraglichkeit des Menschen
im globalen Hochkapitalismus –
Zur Philosophie der Geschichte in der
Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners
Hans-Peter Krüger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
III. Geschichtliche Aufgaben
Der Historismus und das Ereignis
Martin Jay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Was ist eine geschichtliche Sequenz?
Zur philosophischen Analyse von Prozessen der Veränderung
Frank Ruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Vom Herrenrecht, Geschichte zu geben –
Von Nietzsche zu Rancière
Tobias Nikolaus Klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Geschichten, Geschichtswissenschaft
und Selbstverständigungsprozesse
Robert Schnepf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
I
Was ist eine geschichtliche Sequenz?
Zur philosophischen Analyse von Prozessen der Veränderung
Frank Ruda
1. Lenins Tanz: Von der Geschichte zu Geschichten
Einer berühmten Anekdote zufolge tanzte Wladimir Illjitsch Uljanow,
der besser unter dem Namen Lenin bekannt ist, einmal im Schnee. Dies
soll genau zu dem Zeitpunkt geschehen sein, an dem die Ergreifung oder
genauer die Erhaltung der ergriffenen Macht in Russland durch die revolu-
tionäre-bolschewistische Partei unter der Führung Lenins einen Tag länger
währte als knapp fünfzig Jahre zuvor, im Jahr 1871, diejenige der Pariser
Kommune.1 Diese Anekdote lässt sich aber nicht nur als eine geschichtliche
Skurrilität oder als eine Anekdote über die Schrulligkeit oder, wahlweise,
den sympathisch-jovialen Charakter eines gewichtigen politischen Denkers und Akteurs des 20. Jahrhunderts verstehen. Sie führt aus etwas anderer
Perspektive auch ins Herz des $emas, der Frage und vor allem des Begriffs,
der mir für ein Denken der Veränderung zentral zu sein scheint: Sie führt
zur geschichtlichen Sequenz. Die leninsche Schneetanzanekdote lässt sich
auch, nimmt man den gerade erwähnten Kontext, das heißt ihr Verhältnis
zur Pariser Kommune, mit in den Blick, als eine Art eigentümliche Kom-
mentierung des berühmten Satzes von Karl Marx aus dessen Kritik der poli-tischen Ökonomie begreifen, nach dem sich »die Menschheit immer nur die
Aufgaben stellt, die sie lösen kann.«2 Der tanzende Lenin ist dann, wenn
1 Zur Geschichte der Pariser Kommune vgl. die brillanten Analysen von Lissagaray,
Prosper, Geschichte der Commune von 1871, Frankfurt a. M. 1971. Badiou, Alain, »Die
Pariser Kommune. Eine politische Deklaration über die Politik«, in: Ders., Die Kommu-nistische Hypothese, Berlin 2011, S. 108–143. Und natürlich: Marx, Karl, »Der Bürger-
krieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation«,
in: Ders./Engels, Friedrich, Werke, Bd. 17, Berlin 1964, S. 313–365. 2 Marx, Karl, »Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, 1859«, in: Marx/Engels,
Werke 13, Berlin 1961, S. 7–11, hier S. 9.
220
sich diese Pointierung aufrechterhalten lässt, als eine Art Emblem für die
Lösung einer solchen menschheitlichen Aufgabe und in diesem Sinne gar
als eine eigentümliche Variante eines kantischen Geschichtszeichen zu ver-stehen.3 Doch, so kann man an dieser Stelle sofort nachfragen, wenn sich diese Anekdote tatsächlich auf eine von der Menschheit selbst gestellte und
schließlich selbst gelöste Aufgabe beziehen soll, um welche Aufgabe und
welche Lösung handelt es sich. Kurz, was genau sollte das Problem sein, des-
sen Lösung von Lenin tanzend gefeiert wird? Eine erste Antwort zeichnet
sich ab, wenn man Folgendes festhält:
Der Anekdote nach tanzt Lenin genau dann, wenn etwas in Russland
1917 anders verläuft als 1871 in Paris. Das impliziert aber, sobald man
bestimmen kann, »was« später und in Russland »anders« und vermeintlich
(nach welchem noch zu bestimmenden Maß auch immer) »besser« verlaufen
ist, als früher in Paris, kann man notwendigerweise zugleich bestimmen, was
einerseits die (russische) Lösung und andererseits die (französische) Aufgabe
war, die sich die Menschheit zwischen 1871 und 1917 selbst gestellt hat.
Um also zu verstehen, um welche Problemlösung es bei der Anekdote
geht, hilft es, genauer zu bestimmen, wie sich 1917 zu 1871 verhält, oder
anders: was das Verhältnis von Pariser Kommune und Russischer Revolu-
tion ist. Mit dieser Frage des Verhältnisses beginnt man bereits inmitten
eines zeitlichen Intervalls. Man beginnt mit zwei Daten, zwei Eckpunkten
und mit dem noch unbestimmten Gedanken, dass sich zwischen beiden
etwas ändert. Bisher kann man sagen, dass 1871 etwas »realisiert« und 1917
es »anders realisiert«. Das legt ebenso eine weitere Sache nahe. Das, was sich
an diesen beiden Daten auf zwei verschiedene Weisen »realisiert« hat, ist in
gewisser Weise dasselbe, eben dieselbe Aufgabe, die verschiedene Lösungen
erfahren hat. Zu verstehen, was dieses »dasselbe« ist, hilft somit durch die
Erkenntnis der verschiedenen »Realisierungsweisen«, das Verständnis von
dem, was sich 1871, und dem, was sich 1917 zugetragen hat, genauer zu
fassen. Und, wie ich zeigen werde, der Begriff der geschichtlichen Sequenz
bestimmt gerade, was dabei »dasselbe« ist.
Sequenz ist ein Begriff »Desselben in Differenz«. Eine Sequenz bestimmt
sich deshalb immer nur aus der Differenz zu mindestens einer weiteren
3 Lenins Tanz wäre dann strukturell dem Enthusiasmus analog, den Kant in der Begeis-
terung seiner Zeitgenossen über die Französische Revolution ausmachte. Der tanzende
Lenin wäre dann ebenfalls ein »signum rememorativum, demonstrativum, prognosti-
con«, das einen – wie auch immer komplex gefassten – Begriff des Fortschritts impli-
zierte. Was hier Fortschritt heißen kann, wird sich im Folgenden noch deutlicher zeigen.
Vgl. Kant, Immanuel, Der Streit der Fakultäten, Hamburg 1959, S. 95.
F R
221
Sequenz. So ist bereits mit dem Verweis auf das Verhältnis von Pariser
Kommune und Oktoberrevolution ein Differenzkriterium zwischen zwei
verschiedenen Sequenzen in abstrakter Weise mit angegeben. Eine Sequenz
kann vorläufig und ex negativo wie folgt bestimmt werden:
Mit ihren eigenen Mitteln vermag sie manche der Aufgaben, die sie sich
selbst gestellt hat, nicht zu lösen. Eine solche Lösung erfährt die Aufgabe
erst in einer anderen, einer weiteren geschichtlichen Sequenz, die sich somit
einerseits von der ersten Sequenz unterscheidet und, so könnte man sagen,
die erste allererst zu einer Sequenz macht. Die Einheit einer Sequenz ergibt
sich demgemäß erst durch eine ihr nachfolgende, welche das, was die erste
transzendiert, zu ihrem eigentlichen Konstituens macht. So bleibt damit
aber die zweite Sequenz auf die erste bezogen, und zwar in der Weise einer
vorab unerfüllten Aufgabe, eines vormals ungelösten Problems. Die erste
Sequenz übermittelt der zweiten Sequenz eine Aufgabe, deren Bewältigung
die erste Sequenz allererst zur Sequenz macht. Das zeigt an, dass Sequenzen
und ihre Übergänge sowohl immanente als auch sich selbst transzendie-rende Gebilde sind. Sequenzen zeugen von Entwicklung, wenn nicht Fort-schritt4, denn zwischen zwei Sequenzen gibt es eine Art Übertragung, die ein Problem, eine Aufgabe von einer zur anderen weitergibt. Sequenzen sind geschichtliche Übertragungsgebilde.
Ich werde deswegen mit Bemerkungen zum Verhältnis von Pariser Kommune und Russischer Revolution beginnen. Diesen Bemerkungen, die sich im Feld der Politik bewegen – genauer: in dem, was man einst »revolu-tionäre« oder emanzipatorischen Politik genannt hat –, werden versuchen, die Anekdote über Lenin aufzuklären, und zwar als eine, die direkt mit der Sequenzialität von politischen Veränderungsprozessen zu tun hat. Aus dieser Bestimmung werde ich im Folgenden immer wieder auch das Kon-kret-Geschichtliche ein wenig verlassen, um aus dem Konkreten grundsätz-lichere Charakteristika des Sequenzbegriffes zu destillieren.
Ein sequenzieller Begriff von Veränderung, der weiterhin dialektisch
gefasst ist, soll so Teil eines Durcharbeitens dessen sein, was man vor einiger
Zeit einmal einen dialektischen Materialismus genannt hat und was man
4 Man kann bereits verraten, dass der Begriff »Fortschritt«, den ich hier in Anschlag
bringe, einer ist, der zugleich kein Ziel kennt. Es mag nicht überraschen, dass dies exakt
eine Definition dessen ist, was der frühe Marx »Kommunismus« nannte, der als sol-
cher nie das Ziel der menschlichen Entwicklung ist. Kommunismus ist geschichtlicher
Fortschritt ohne Ziel (als Beendigung, so könnte man pointieren, der Vor-Geschichte
der Menschheit, in der man noch an einem falschen Begriff des Fortschritts – mit Ziel
– festzuhalten versuchte).
W S
222
heute wohl eher eine materialistische Dialektik nennen sollte. Ich werde im
Folgenden, dies als letztes Wort der Einleitung, zeigen, dass ein sequen-
zielles Denken von Veränderung für seine Konsistenz eine notwendige
Bedingung hat. Es benötigt einen Geschichtsbegriff, der nicht länger auf
eine Geschichte, eine Geschichte mit extra-großem G, wenn man so will,
und ihre Gesetze führt, sondern unabdingbar und immanent eine Verviel-
fachung der Geschichten mit sich bringt. Der Slogan, den man dieser not-
wendigen Implikation des Sequenzbegriffs beigeben kann, lautet: »Von der
Geschichte zu Geschichten!«
Diese Implikation kann man noch in einer weiteren Version fassen.
Denn die schon leicht verstaubt anmutende und geschichtlich vielleicht
heute nicht mehr überzeugende Annahme des hegelianisierten Marxismus,
dass es ein Subjekt der Geschichte gäbe – das man Proletariat oder Arbei-
terklasse genannt hat –, aber ebenso jede Annahme, dass die Geschichte in
irgendeiner Weise von einem einheitlichen Subjekt – das man als Menschheit
oder wie auch immer adressieren könnte – gemacht würde, diese Annahme
muss in gewisser Weise ebenfalls aufgegeben werden. Oder genauer gesagt,
man muss eine solche Annahme vielmehr in folgender Weise reformulie-
ren: Es gibt kein Subjekt der Geschichte, aber der sequenzielle Begriff von
Geschichte impliziert, dass es sich in ihrer Subjektivität immer wieder auf-
einander beziehende Subjekte von Geschichten gibt. Letztlich meint dies,
dass Sequenzen Geschichte konstituieren und Geschichte sich sequenzi-
ell konstituiert, beide sind in Wechselbestimmung, wie man mit Hegels
berühmtem Wort sagen kann.
2. Always Periodize! Oder:
Wie man eine Seite der Weltgeschichte umblättert
Alain Badiou hat in seinem frühen Werk Die "eorie des Subjekts über Lenins
Schneetanzanekdote bemerkt, dass
»die bolschewistische Partei Lenins sicherlich der aktive Träger einer Bilanz der Misserfolge der Pariser Kommune [ist]. Das besiegelt Lenin, wenn er 1917 in Mos-kau im Schnee tanzt, als die Macht einen Tag länger als 1871 in Paris gehalten wurde. Es ist der Bruch des Oktober 1917, der die Pariser Kommune periodisiert, eine Seite der Weltgeschichte umblättert.«5
5 Badiou, Alain, Die "eorie des Subjekts, Zürich 2013. Die Übersetzung basiert auf: Badiou, Alain, "éorie du sujet, Paris 1982, S. 38.
F R
223
Die russische Oktoberrevolution von 1917 periodisiert also die Pariser Kom-
mune. Doch was meint hier Periodisierung? Um dies aufzuklären, ist es
hilfreich, eine Bestimmung dessen zu diskutieren, was Badiou die kommu-
nistische Hypothese6 nennt. Dieser ein wenig dunkel scheinende Ausdruck7
wird sich im Verlaufe meiner Ausführungen erhellen. Badiou hat in einer seiner neusten Veröffentlichung, in Le Reveil de L’Histoire – »Das (Wieder-)
Erwachen der Geschichte«8 –, davon gesprochen, dass die Idee emanzipato-
rischer Politik, einer Regierung von Gleichen, einer Herrschaft von Gleichen
über Gleiche, die man etwa unter dem Namen der Demokratie fassen kann,
die man aber auch immer wieder unter dem Namen des Kommunismus
adressierte, verschiedene geschichtliche Formulierungen gefunden hat. Im
18. Jahrhundert zunächst eine republikanische – man denke hier philoso-
phisch an Rousseau9 oder Kant10, praktisch politisch etwa an Robespierre11
oder St. Just12 –, im 19. Jahrhundert eine, die er »naiv kommunistisch«
nennt – man denke philosophisch an St. Simon13 oder politisch an die Pari-
ser Kommune14. Im 20. Jahrhundert schließlich hat diese Idee eine staat-
lich kommunistische Formulierung gefunden. Diese recht abstrakte und
schematische Einteilung offeriert bereits einen ersten möglichen Zugang zur
Frage der Periodisierung. Denn, beginnt man mit den ersten beiden Aus-
formulierungen der Idee einer emanzipatorischen Politik,15 kann man fol-
6 Vgl. Badiou, Alain, Die Kommunistische Hypothese, Berlin 2012.
7 Dass das Wort »Kommunismus« und auch der Ausdruck »kommunistische Hypo-
these« heute einen dunklen, eher obskuren Klang hat, ist selbst ein Effekt dessen, was
im 20. Jahrhundert unter diesen Ausdrücken an Erfahrungen gesammelt wurde. Diese
Erfahrungen waren ohne Zweifel mit viel Leid und Schrecken verbunden, aber die aus-
schließliche Insistenz auf Leid und Schrecken – die Zahl der Toten etwa – ist bereits ein
Effekt der Verdunklung, die in Bezug auf die genannten Ausdrücke statthat. Deswegen
hat heute der Ausdruck »kommunistische Hypothese« etwas Dunkles genau in dem
Sinne, den Georges Sorel dem Wort »Sozialismus« bescheinigt hat. (Vgl. Sorel, Georges,
Über die Gewalt, Frankfurt a. M. 1981, S. 145.) Das dies selbst ein Effekt des 20. Jahr-
hunderts ist, lässt sich nachvollziehen, wenn man Badious Rekonstruktion desselben
liest: Badiou, Alain, Das Jahrhundert, Zürich/Berlin 2006. 8 Vgl. Badiou, Alain, Le Réveil de L’Histoire. Circonstances, 6, Paris 2012. 9 Vgl. Rousseau, Jean-Jacques, Der Gesellschaftsvertrag, Leipzig 1978.10 Vgl. Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Stuttgart
2008.11 Vgl. Robespierre, Maximilien, Virtue and Terror, London/New York 2007.12 Vgl. Saint-Just, Oeuvres Complétes, Paris 2003.13 Vgl. Saint-Simon, Mémoires, Paris 1998.14 Vgl. dazu erneut Lissagaray, Geschichte der Commune.15 Welche Charakteristika diese Idee nahezu überzeitlich bestimmt haben, findet man
in: Badiou, Alain, Le courage du présent, in: npa2009.org, 19.02.2010, http://www.npa2009.org/content/le-courage-du-pr%C3%A9sent-par-alain-badiou.
W S
224
gende Charakteristika festhalten: Der geschichtliche Zeitabschnitt, in dem der Gedanke aufkommt, dass es ein soziales, politisches Ordnungsgefüge
geben kann, in dem es zu einer perpetuierten Organisation der Unmög-
lichkeit von Ungleichheit kommt, das heißt, in dem es zu dem Gedanken
kommt, dass es eine Ordnung geben kann, in der sich Gleiche als Gleiche
organisieren, und in dem zudem die Frage aufkommt, in welcher Form eine
solche Ordnung konkret umzusetzen sei, beginnt in gewisser Weise mit der
Französischen Revolution und dauert etwa achtzig Jahre, bis hin zu den 72
Tagen der Pariser Kommune.
Die erste Sequenz dieser radikal demokratischen oder, wie Badiou sie
nennt, kommunistischen16 Hypothese, lässt sich als eine Zeit fassen, die
dadurch ausgezeichnet ist, dass sie der Hypothese – eine gerechte Ord-
nung von Gleichen ohne Ausschluss etablieren zu können – eine erste
Artikulation(sform) zu geben sucht. Sie versucht, so könnte man sagen, die
Hypothese als Hypothese zu formulieren. Die erste Sequenz ist die Sequenz
einer Formierung und auch der Formalisierung der Hypothese als solcher.
Damit verhält es sich, wenn man den Ausdruck der Hypothese buch-
stäblich nimmt, ebenso wie mit einer Hypothese in der Wissenschaft. Ein
Beispiel dafür, das Badiou selbst anführt,17 wäre die Fermatschen Vermu-
tung18 in der Mathematik. Sie besagt, dass für die Formel xn + yn = zn für
n > 2 keine Lösung im Bereich der natürlichen Zahlen gefunden werden
kann. Fermat formuliert diese Vermutung im 17. Jahrhundert – genauer
gesagt, behauptet er bewiesen zu haben, dass die entsprechende Aussage
gilt, ohne dass der Beweis überliefert ist. Was aber zählt, ist, dass diese
16 Die Frage, ob man nun diese Fassung emanzipatorischer Politik demokratisch oder
kommunistisch nennt, ist keine bloße Frage von Präferenzen – so als wäre »Kommu-
nismus« der Name für Demokratie bei jenen, die sich gerne etwas radikaler gebärden.
Kommunismus als Bezeichnung gilt es, wie mir scheint, dann vorzuziehen, wenn man
die Nichtstaatlichkeit einer Organisationsform von Gleichen zu betonen sucht. Kontu-
riert man den Begriff der Demokratie in einer Weise, die diesen synonym mit dem der
Volksdiktatur gebraucht – ebenso ein ziemlich aus der Mode gekommener Begriff – und
wird diese gerade nicht so gefasst, dass sie in einer repräsentativen, parlamentarischen
Organisationsform aufgeht, gibt es, meines Erachtens, keinen Unterschied zwischen
Demokratie und Kommunismus (mit Ausnahme der Tatsache, dass die Demokratie zu
verteidigen heute nicht nur leichter fällt als den Kommunismus, sondern man sich im
Zuge einer solchen Verteidigung auch leicht auf ein und der gleichen Seite mit strikten
Gegner der Emanzipation wiederfinden kann).
17 Vgl. Badiou, Die kommunistische Hypothese, S. 12 f.
18 Hier ist die popularisierende Darstellung bei Simon Singh hilfreich: Singh, Simon Fer-mats letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels, München
2000.
F R
225
Hypothese bis zu ihrem endgültigen Beweis durch Wiles und Taylor 1995 zu vielen mathematischen "eoremen, Entdeckungen und Experimenten führte. Diese genuin mathematische Hypothese hatte also für etwa drei
Jahrhunderte gerade als Hypothese eine Validität.
Mit der ersten Sequenz der Hypothese emanzipatorischer Politik ver-
hält es sich in gewisser Weise ähnlich wie mit der Fermatschen Vermu-
tung. Die erste Sequenz formuliert die Hypothese als Hypothese. Und sie tut
dies, indem sie die eine sehr konkrete Form sozial-politischer Bewegung,
die Massenbewegung, die etwa in der Gestalt von Unruhen, Streiks oder
Demonstrationen geschichtlich in Erscheinung trat, mit einer politischen
Vorstellung verbindet, nämlich derjenigen, den Staat, so wie er ist, zu stür-
zen.19 Ihn, so die (konsequente) Folgerung dieser Zeit, überhaupt stürzen
zu können, ist nur dann möglich, wenn man sein »Zentrum« besetzt. Die
grundsätzliche Annahme, die die erste Sequenz als Sequenz auszeichnet, das
heißt, die sie trotz aller Unterschiede der mannigfaltigen Artikulation mit
einer internen Konsistenz versieht, war, dass der Staat durch nichts ande-
res definiert ist als durch eine fundamentale Restriktion der Möglichkeiten
– etwa der Möglichkeiten der Realisierung der eigenen Freiheit oder der
Möglichkeit, ein gerechtes Regime von Gleichen zu errichten, dessen mögli-
che Existenz gerade hypothetisch behauptet wird.20 Was sich notwendig aus
dieser Bestimmung des Staates ergibt, ist also, dass der Staat als Staat zer-
stört werden muss, um wirklich freies Handeln und wirklich freies Handeln
von Gleichen zu ermöglichen.21 Diese Aufgabe erfüllt der Akteur, der bereits
an unterschiedlichen Orten konkret in Aktion getreten war, nämlich die
Massenbewegung, genauer: ihre organisierteste Form, das heißt die Arbei-
terbewegung. Genau dies, die Aufhebung der Restriktionen hinsichtlich
der Möglichkeiten freier Handlungen von Gleichen durch eine Bewegung
von Massen von Arbeitern, war es, was man dementsprechend unter dem
19 Vgl. zu den folgenden Ausführungen ebenfalls: Ruda, Frank/Völker, Jan, »Was heißt es,
ein Marxist in der Philosophie zu sein?«, in: Badiou, Alain, Ist Politik denkbar?, Berlin
2010, S. 135–165.
20 Diese Bestimmung hat bis heute Nachwirkungen. Man denke auf der einen – eman-
zipatorischen – Seite an Lenin, Luxemburg, Mao – auf der anderen an eine Linie, die
vom Hegelinterpreten Rudolf Haym bis Guido Westerwelle reicht. Während die eine
Seite diese Möglichkeitsbegrenzungen immer wieder und in unterschiedlicher Art zu
sprengen sucht, um ein Regime der Gleichen zu etablieren, versucht die andere den
Einflussbereich des Staats zu reduzieren, um (meist marktorientierten) Realisierungen
individueller Freiheit den Vorrang zu geben.
21 Dies bestimmt die wesentlich anti-hegelsche Qualifizierung der ersten Sequenz. Hegel
hatte vor allem in seiner Rechtsphilosophie für das exakte Gegenteil optiert.
W S
226
Begriff der Revolution gedacht hat.22 Daher stammt der auch heute noch –
und vielleicht nicht zu Unrecht – verbreitete Gedanke, dass eine Revolution
alle Formen und Momente von Ungleichheit abschafft und so etwas ein-
richtet, was Jacques Rancière einmal in der Sprache der Arbeiterbewegung
des 19. Jahrhunderts eine »Gemeinschaft der Gleichen«23 genannt hat.
In dieser Zeit werden formale Operatoren, wie »Gleiche«, »Organisa-
tion« etc., bereitgestellt, die als abstrakte Ausdrücke eingesetzt werden und
dazu dienen, das zu artikulieren, was Louis Althusser in Anlehnung an
Lenin eine konkrete Analyse konkreter geschichtlicher Situationen, kon-
kreter geschichtlicher Wirklichkeit genannt hat.24 Gemeint ist damit eine
Analyse des Staates und seiner unterdrückenden Effekte, die mit der Mas-
senbewegung zugleich einen Agenten, ein Subjekt skizziert, das eben diese
Unterdrückung, die sich in dem so entworfenen Subjekt verdichtet, abzu-
schaffen fähig ist. Die Pariser Kommune, so kann man ausgehend von die-
ser ersten Bestimmung festhalten, bringt nun zwei Dinge hervor. Einerseits
führt sie erstmals die Elemente der so formulierten Hypothese zusammen.
Eine Massenbewegung, die in entscheidendem Maße Arbeiter einbezieht,
versucht den Staat, der als ein Restriktionsapparat der Möglichkeiten wahr-
genommen wird, abzuschaffen und ihm eine andere Form der Organisation
entgegenzusetzen. Andererseits zeigt sie auch, und ebenfalls in sehr kon-
kreter Gestalt, die Beschränktheiten dieser Annahme, die Begrenzungen dieser Konstruktion auf. Denn in den zwei Monaten ihres Bestehens, vom 18. März 1871 bis zum 28. Mai, erwies es sich für die Pariser Kommune nicht als möglich, die Hypothese eines neuen Organisationsformats – einer
anderen Organisation, die sie lokalerweise zu etablieren fähig war – über ihr bloß begrenztes und lokales Territorium hinaus zu bewahrheiten.25 Das Organisationsmodell der Kommune funktionierte begrenzt, weil es nur für die Kommune und nicht etwa auf nationaler Ebene angewandt werden konnte. Zugleich zeigte sich noch ein zweiter Mangel. Die Pariser Kom-mune war nicht in der Lage, sich gegen die Einwirkungen, Handlungen und Manöver ihr feindlich gesinnter Parteien, der so genannten konter-re-
volutionären Bewegung abzusichern.
22 Vgl. dazu u. a. Menke, Christoph/Raimondi, Francesca (Hg.), Die Revolution der Men-schenrechte. Grundlegende Texte zu einem neuen Begriff des Politischen, Berlin 2011.
23 Rancière, Jacques, Proletarian Nights. !e Workers’ Dream in Nineteenth-Century France, London/New York 2012.
24 Vgl. Althusser, Louis, Machiavelli and Us, London/New York 2011.
25 Zur Frage der Ausdehnung lokaler Organisationsformate, vgl. Badiou, Le Réveil de
L’Histoire, besonders S. 31–81.
F R
227
Die zweite Sequenz dessen, was Badiou die kommunistische Hypothese
nennt, beginnt nun mit der Russischen Revolution und dauert insgesamt
von 1917 bis in die siebziger Jahre des 20, Jahrhunderts. Sie ist für ihn letzt-
endlich mit dem Tod Maos 1976 beendet. Ihr Ende wird damit für Badiou
systematisch einerseits vom Ende der Kulturrevolution und andererseits
etwa fünfzig Jahre nach ihrem Beginn von den Aufständen des Mai 68
markiert. Die Frage, die in entscheidendem Maße die zweite geschichtliche
Sequenz, die sich ebenfalls unter das Label der Hypothese einer gerech-
ten Ordnung von Gleichen bringen lässt, auszeichnet, ist: Wie kann man
ausgehend von den und trotz der Erfahrungen, die mit und in der Pariser
Kommune gemacht wurden, siegreich sein? Und noch genauer: Wie kann
man siegreich bleiben?
Nun war bereits Lenin einer der Ersten, die eine wirkmächtige Antwort
auf diese Frage theoretisch wie praktisch gegeben haben. Lenin gab der
Hypothese so etwas wie einen symbolischen Körper, der beide Sequenzen
verbindet. Er entwarf einen symbolischen Körper, der dauerhaft und bestän-
dig zu sein vermochte und damit eine Expansion vom Lokalen – zumindest
aufs Nationale und prinzipiell auch aufs Internationale – zuließ und sich
zudem gegen konter-revolutionäre Tendenzen, die den Status quo erhalten
wollten, zur Wehr zu setzen fähig war: die Partei.26 Die zweite Sequenz
konstituiert sich somit zunächst durch den Rückbezug auf ein ungelöstes
Problem der ersten Sequenz. Das Problem, das sich in verdichteter Gestalt
in der Pariser Kommune zeigte, war:
Welche symbolische und materiale Form kann entwickelt werden, um
eine gerechte Gemeinschaft von Gleichen in einer Weise zu etablieren, die
beständig und dauerhaft aufrechtzuerhalten ist – auch gegen alle Geg-
ner und Anfeindungen? Wie kann, so könnte man auch fragen, ein neuer
Typus von Macht – eine Macht, die die Machtposition nur einnimmt, um
diese selbst abzuschaffen – so organisiert werden, dass sie nicht von ihren
Gegnern, bevor sie sich selbst als Macht – und damit Macht tout court –
abschafft, abgeschafft wird?
26 Vgl. dazu u. a. Lenin, Vladimir Iljitsch, »Parteiorganisation und Parteiliteratur« (1905),
in: Ders., Werke, Bd. 10, Berlin 1958, S. 29–34.
W S
228
3. Sequenz: normativ, konsequenziell, konkret-allgemein
Hier wird bereits deutlich:
1. Eine Sequenz impliziert immer eigene – im Falle der Politik, kollektive
– normative Selbstfestlegungen (an denen sie selbst in ihren Konsequen-
zen zu messen ist).27 Das kann etwa die Forderung sein, die Hypothese
der Möglichkeit eine gerechte Ordnung von Gleichen so zu organisie-
ren, dass in dieser das Auftreten von Ungleichheit, von Aussagen, die
Ungleichheit statuieren, unmöglich ist. Sequenzen lassen sich deswe-
gen als präskriptive Gebilde verstehen, weil sie durch eine Präskription,
eine normative Selbstfestlegung konstituiert werden, die in der Folge
die Handlungen der Akteure der Sequenz auf eine Weise instruiert,
dass alle Handlungen im Einklang mit dieser Präskription, mit einer
Hypothese zu stehen haben.28 Die Formulierung dieser Hypothese oder
Präskription ist immer historisch spezifisch und zugleich so unspezi-
fisch, dass sie sich in vielfältigen konkreten geschichtlichen Situationen
zur Anwendung bringen lässt – wie etwa die Formulierung: »Proletarier
27 Dies lässt sich auf zweifache Weise erläutern. Zum einen gibt es eine hegelianische
Erläuterung, bei der man die #ese so auslegt, dass die normativen Selbstfestlegungen
selbst den Standard für deren Evaluierung, d. h. ihre Einhaltung, setzen. Es handelt
sich also um eine implizite Normativität, die in der Folge expliziert wird und damit aber
auch rückwirkend das Implizite der so gefassten Selbstfestlegungen verändern kann.
(Die erste Hälfte dieser Auslegung ließe sich auch mit Robert Brandom formulieren, die
zweite aber nicht.) Zum anderen gibt es eine Erläuterung im Rahmen der badiou’schen
#eorie. Hier wird die #ese so ausgelegt, dass sie zudem ein Unterscheidungskriterium
zwischen wirklich ereignishafte Sequenzen und nicht-ereignishaften Handlungszu-
sammenhängen liefert, kurz: zwischen Ereignissen und dem, was Badiou, »das Simu-
lakrum eines Ereignisses« (Badiou, Alain, Ethik. Ein Versuch über das Bewusstsein des
Bösen, Berlin/Zürich, S. 55) nennt. Ereignishaft (zumindest in der Politik) sind nur die Sequenzen, die in ihren unmittelbaren normativen Selbstfestlegungen, d. h. in dem, was durch ein Ereignis ermöglicht wird, keiner Exklusivitätskriterium für die Partizi-
pation an ihnen implizieren. Simulakren von Ereignissen sind scheinbar fundamentale
Veränderungen, die bereits in ihren Anfängen die Teilnahme an der Entfaltung der
Konsequenzen dieser Veränderung beschränken. Ereignisse und deren Sequenzen ken-
nen universale Akteure, die prinzipiell niemand ausschließen. Nicht-Ereignisse haben in
ihren normativen Selbstfestlegungen einen normativ-begrenzten Begriff desjenigen, der
überhaupt als legitimier Akteur gelten kann. Vor diesem Hintergrund kann man etwa
zwischen Kommunismus und Faschismus unterscheiden.
28 Bei Hegel wiederum ist dies durch die Kategorie der »Angemessenheit« gefasst. Vgl.
dazu meinen Kommentar in: Ruda, Frank, Hegels Pöbel. Eine Untersuchung der »Grund-
linien der Philosophie des Rechts«, Konstanz 2011, S. 48 f.
F R
229
aller Länder vereinigt Euch!«, die sich als eine Präskription subjektiver
Handlungen deuten lässt, mit der dann die entscheidende Frage verbun-
den ist, wie ich handeln kann und sollte, damit in einer geschichtlich
spezifischen Situation meine Handlung im Einklang mit dieser Maxime
steht.29
2. Eine Sequenz steht immer vor konkreten Fragen der Realisierung und
Aufrechterhaltung ihrer präskriptiven, normativen Selbstfestlegungen.
Sequenzen sind daher geschichtliche Gebilde, deren Handlungsgeflecht
sich als Konsequenz aus der normativen Selbstfestlegung verstehen lässt.
Die Handlungen sind konkrete Entfaltungen von Implikationen der
Präskription innerhalb konkreter geschichtlicher Situationen. Sequen-
zen sind damit konsequenzielle Gebilde.
3. Es gilt, dass in den geschichtlich spezifischen Kontexten, in denen solche
Selbstfestlegungen situiert sind, immer infrage steht, welche Mittel, For-
men und Methoden zur Organisation der Entfaltung der Implikationen
der normativ-präskriptiven Selbstfestlegung hinsichtlich des eigenen
Handelns gegeben sind. Die Präskription ist eine formale, besser: allge-
meine Präskription, keine, die es ermöglicht, konkrete Handlungen aus
einer feststehenden Regel oder einem Gesetz abzuleiten, und die den-
noch nur in konkreten Handlungen und Situationen manifest werden
kann. Sequenzen sind damit konkret allgemeine Gebilde.
4. Neue, und ebenfalls sehr konkrete Fragen ergeben sich in Handlungen,
die zur Beantwortung der Frage, wie die normativen Selbstfestlegungen
in concreto zu realisieren sind, versucht werden. Denn die Entfaltung von
implizierten Konsequenzen der Präskription verändert die geschichtliche
Situation, in der sie statthaben, und generiert damit eine neue Situation.
So stellt sich konstitutiv immer die Frage, wie man mit der Entfaltung
der Konsequenzen mit den einem zur Verfügung stehenden Mitteln,
Formen und Methoden weitermachen kann. Anders gesagt, wenn es
29 Es sollte deutlich werden, dass es sich hier um die Historisierung einer Art kategorischen
Imperativs handelt. Die entscheidende Pointe dieser Historisierung ist dann aber auch,
dass es diesen Imperativ nicht einfach immer schon (transzendental) gibt, sondern er
vielmehr in geschichtlich spezifischen Situationen in ebenso geschichtlich spezifischer
Form in Erscheinung tritt und dennoch seine Funktionsweise, die eines kategorischen
Imperativs (in all seiner inhaltlichen Unbestimmtheit und formalen Rigidität) ist.
W S
230
gewisse Mittel ermöglichen, Handlungen in Einklang mit der Präskrip-
tion zu realisieren, dann verändert diese Realisierung die Situation und
somit (möglicherweise) auch die Adäquatheit der Mittel. Bezogen auf
das vorab erwähnte Beispiel kann etwa gefragt werden, ob man in der
nach einer kollektiven revolutionären Aktion (und das meint durch den
Einsatz gewisser Organisations- und Handlungsformen und -mittel)
entstandenen Situation die Macht übernommen hat, wie diese aufrecht-erhalten wird oder wie sie auszudehnen ist?
In dem hier angeführten Kontext bedeutet das für das Verhältnis von Pariser
Kommune zur Russischen Revolution zunächst, dass Lenin in der zweiten
Sequenz eine neue Lösung auf die Frage erfindet, die sich aus dem Scheitern
der Pariser Kommune – und man muss sagen, allein aus dem Scheitern und
nicht ohne dieses30 – ergibt. Seine Antwort lautet, dauerhaft und beständig
lässt sich ein neuer Typus von Machtausübung nur durch eine revolutionäre
Partei sichern. Es ist genau diese Konzeption der Partei, die von Lenin als
geschichtlich wirkmächtige Antwort auf das Problem der ersten Sequenz
angeführt wird. Anders gesagt, Lenin löst mit seiner Konzeption der revo-
lutionären Partei die Aufgabe, die dadurch gestellt wurde, dass die erste
Sequenz daran scheiterte, der eigenen Präskriptionen in dem Rahmen die
Treue zu halten, in dem sie sich bewegte. Aus genau diesem Grund spielt
das $ema des Sieges, die Obsession, siegreich zu sein, in der und für die
zweite Sequenz der emanzipatorischen Hypothese eine entscheidende Rolle
(eine Rolle, die dieses $ema nicht in der ersten Sequenz innehatte). Denn
die zweite Sequenz, oder genauer das, was in der Geschichte der Versuche
eine emanzipatorisch-kommunistische Politik praktisch umzusetzen nach
der Jahrhundertwende begann, wollte genau eines nicht noch mal, nämlich
an den eigenen Ansprüchen scheitern.
30 Ich stimme hier kein (liberales) Lob des Scheiterns an. Vielmehr zeigt im Kontext des
hier entwickelten Argumentes gerade das Scheitern, dass ein vorab adäquates Mittel
in der durch es veränderten Situation nicht länger adäquat ist, um der Veränderung
selbst treu zu bleiben, d. h. sie unter veränderten Koordinaten weiter voran zu treiben.
In einem anderen Kontext könnte man dies verdeutlichen, indem man darauf verweist,
dass sicherlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den Willen eines radikalen Umstur-zes (des Staates) die Gründung einer (revolutionären) Partei ein geeignetes Mittel war.
Heute jedoch, nach dem, was diese Revolutionen hervorgebracht haben, lässt sich
schwerlich noch behaupten, dass die Gründung einer neuen Partei Effekte haben wird,
die die Struktur des Staates, so wie sie gegenwärtig ist, transformieren können. Ein gutes
Beispiel dafür ist etwa die Gründung der deutschen Partei »Die Linke«, die einer solchen Sackgasse eine materielle Gestalt gibt.
F R
231
Die erste Sequenz formuliert die Hypothese und gibt ihr eine erste
Gestalt. Doch sie scheitert an den Ansprüchen, diese Hypothese aufrecht-
zuerhalten. Die zweite Sequenz versucht nun gerade, das Scheitern zu ver-
meiden, und sie versucht dies in sehr spezifischen Begriffen, in denen der
Niederlage, des Besiegtwerdens. So ergibt sich die Frage des Sieges und
damit verbunden die Frage nach dem, was untrüglich wirklich und real ist
(etwa indem man feststellen will, wer wirklich und zweifellos revolutionär
und wer konterrevolutionär ist). Denn nur durch den Bezug auf die Wirk-
lichkeit konkretisiert sich der Anspruch, nicht zu scheitern. Erst wenn man
weiß, wer auf der eigenen Seite steht, weiß man, wer den gleichen Anspruch
hat, wie man selbst. Es handelt sich darum, nicht nur das Scheitern an den
eigenen Ansprüchen zu verhindern, sondern ebenso das Scheitern durch die
Intervention von Gegnern (aus den eigenen Reihen oder von außen).
Die Fragen nach Sieg und Wirklichkeit ergeben sich als immanente
Konsequenzen aus der selbst gesetzten normativen Konfiguration und dem
Scheitern ihrer Erfüllung in der ersten Sequenz. Die Frage des Sieges ist
aber in der zweiten Sequenz über die Konzeption der Partei zudem direkt
mit Fragen der Organisation und (militärischen) Disziplin verbunden und
führt letztlich zu einer Konzeption, die auf die Einheit von $eorie und Pra-
xis zielt und diese in einer zentralisierten und homogenen oder zumindest
homogenisierten31 Klassenpartei umgesetzt sieht.
4. Die Partei hat immer recht
Die Kommunistische Partei nach Lenins Vorbild war eine Klassenpartei,
die in der Lage war, eine direkte Antwort darauf zu geben, wie und mit
welchen Mitteln nach der Revolution die neue Macht und letztlich der neue
Staat organisiert werden sollte. Um aber überhaupt zu siegen, musste man,
um Lenins Sprache zu übernehmen, gegen die Kräfte des Imperialismus
31 Das !ema der Homogenisierung der revolutionären Partei steht im Hintergrund all
der so genannten »Säuberungen«, die sowohl im post-revolutionären Russland unter
Stalin als auch im China der Kulturrevolution eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Vgl. dazu u. a. das aufschlussreiche Buch Getty, J. Arch, !e Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932-1939, New York 1999. Ebenso: Karl Schlö-
gel, Terror und Traum. Moskau 1937, München 2008. Inwiefern sich damit gewisse
Elemente wiederholen, die Hegel in seiner Kritik der Französischen Revolution bereits
antizipiert hatte, findet sich in dem hervorragenden Buch Comay, Rebecca, Mourning Sickness. Hegel and the French Revolution, Stanford 2011.
W S
232
auf dessen eigenem Terrain bestehen können, das heißt, man musste auf
dem Terrain des Staates demselben entgegen treten können. Zu siegen hieß
weiterhin, die staatliche Macht zu ergreifen, aber diese auch dauerhaft zu
halten. Diese Dauerhaftigkeit wurde gerade für die zweite Sequenz umso
mehr ein #ema, als sie die Zeit nach der Machtübernahme, das heißt die neue Form des Staates, betraf, der letztlich nur ein Übergangsstaat sein sollte, also ein Staat, der zur Abschaffung des Staates führt – was schon der
Ausdruck der »Diktatur des Proletariats«32 bei Marx meinte. Die Partei im
Sinne Lenins lieferte die Antwort auf diesen gesamten Fragenkomplex und
erscheint somit als spezifische Konstruktion der zweiten Sequenz, welche
– man kann in diesem Kontext nicht nur an Russland, sondern auch an
China, Vietnam33, Kambodscha34, Albanien35 oder Korea36 denken – eine Verbindung von Massendisziplin, lokalen Befreiungs- und Emanzipations-erfolgen und einer tendenziell militarisierten Organisation entwickelte, um diese Aufgabe zu lösen.37 In dieser Hinsicht – und so kann man zum lenin-schen Schneetanz zurückkehren – löste die zweite Sequenz Schwierigkeiten,
die sie von der ersten geerbt hat. Aber, und dies ist ebenso entscheidend, sie
war nicht in der Lage im Rahmen ihres Lösungsvorschlags, das heißt mit
ihren eigenen Mitteln, nun wiederum mit den Problemen umzugehen, die
sich als Konsequenz ihrer eigenen Konstruktion ergaben. Ihre Lösung schuf
wiederum Probleme, die keine Lösung fanden.
So erwies sich die kommunistische Partei durchaus als fähig, gegen
eine geschwächte Macht, wie den Zarismus in Russland, siegreich zu sein
und sogar eine Ausdehnung ihres Organisationmodells auf eine nationale
Ebene herzustellen und zudem noch für die Dauerhaftigkeit der Machtaus-
übung zu sorgen. Jedoch erwies sie sich im gleichen Atemzug als unfähig,
gerade die Idee eines neuen Staates, einer Ausübung der Macht, die auf
deren Abschaffung zielt – was ja die dialektische Formel für den Niedergang
des Staates ist – zu verwirklichen. Und diese Unfähigkeit ließ die tatsäch-
liche Machtausübung zunehmend paranoid werden. Durch die spezifische
32 Vgl. Lenin, Vladimir Iljitsch, »Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom
Staat und die Aufgabe des Proletariats in der Revolution«, in: Ders., Werke 25, Berlin
1972, S. 393–507.
33 Tréglodé, Benoît de, Heroes and Revolution in Vietnam. 1948-1964, Singapore 2012.
34 Chandler, David P., !e Tragedy of Cambodian History. Politics, War, and Revolution since 1945, Yale 1993.
35 Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens gegen den modernen Revisionismus. 1955-1966, Berlin 2005.
36 Kim, Se-Jin, !e Politics of Military Revolution in Korea, Charlotte 2009.37 Vgl. Badiou, Ist Politik denkbar?.
F R
233
Konstruktion der kommunistischen Partei wurde ein Staat errichtet, der
sowohl bürokratisch-autoritär als auch terroristisch war und sich in jeder Hinsicht weit von der Idee eines Niedergangs des Staates entfernte. Auf
diese Weise kann man auch Stalins Adaption der revolutionären Idee als
eine Art Abwehrreaktion38 gegen den prinzipiell universalistischen Kern der
leninschen Politik verstehen, die aber gerade deswegen an diesen andocken
konnte, weil die Konstruktion der zweiten Sequenz, die aus den Elementen
»Macht«, »Staat«, »Partei« bestand, dies ermöglichte.39
So erscheint in dieser geschichtlich spezifischen Errichtung einer neuen
und doch nicht gänzlich neuen, da weiterhin oder sogar in gesteigerter
Weise restriktiven Staatsform die immanente Begrenzung der zweiten
Sequenz, die schließlich auch zu ihrem inneren Ende – zu einem erneuten
Scheitern (am Nicht-Scheitern-Wollen) – führt. Noch die letzten Ereignisse
dieser Sequenz – man kann hier etwa an den Mai 68 denken, aber auch an bestimmte geschichtliche Abschnitte innerhalb der chinesischen Kulturre-volution – versuchen, diese interne Limitierung zu überwinden, die in den
autoritären Staatsterrorismus führt, ohne dies letztlich leisten zu können. So versucht etwa die 68er Bewegung, einen anderen Typus der Organisation zu erfinden, der weder gewerkschaftlich und auf politische Macht setzend noch unter dem Banner einer Partei formiert ist. Aber diese Bewegung scheitert an diesem Projekt, da sie nicht im Stande ist, die grundlegende Verkettung der Elemente von »Macht«, »Partei« und »Staat« zu durchbrechen. Ebenso versucht Mao in der Kulturrevolution, die kommunistische Partei gegen sich selbst und die ihr immanenten Bürokratisierungstendenzen auszurich-
ten und auf diese Weise eine erneute Beziehung zur Massenbewegung – der
Studenten und der (von Stalin so gehassten) Bauern – zu etablieren. Einige
Zeit lang probiert er so, gerade vom Partei-Staat-Modell ausgehend eine
Transformation des staatlichen Rahmens zu denken und die in ihm ange-
siedelten und verbundenen Elemente zu dissoziieren.40
Aber auch die Kulturrevolution wird in ihrer Entfaltung zeigen, wel-
che Begrenzungen dieser dialektische Versuch der immanenten Zerstörung
des fixierten staatlichen Rahmens (durch Einsatz unter anderem staatlicher
38 Grundlegende Überlegungen zur Funktionsweise von »Abwehrmechanismen« findet sich in Santner, Eric, Zur Psychotheologie des Alltagslebens, Zürich 2011.
39 Vgl. auch Badiou, Alain, Über Metapolitik, Berlin/Zürich 2003, S. 91 ff.
40 Es sollte deutlich sein, dass ich hier keineswegs Maos Politik verteidige, sondern viel-
mehr versuche, aufgrund der in der zweiten Sequenz explizit werdenden normativen
Selbstfestlegungen zu deuten, wie sich diese immanent und aus der konkreten Situation
heraus verstehen lassen.
W S
234
Mittel) haben wird. Der Versuch, aus dem Inneren des Partei-Staats eine
kollektive Organisation hervorzubringen, die diesen überschreitet, führt –
im Unterschied zum leninistischen Verständnis der Diktatur des Proletariats
und in noch deutlicherer Abgrenzung zu Stalins Verachtung der Bauern-
massen – zunächst dazu, nie zuvor gesehene Massen in die Frage einzu-
binden, wie sich eine neue antistaatliche und nicht-zentralisierte kollektive
Selbstorganisation denken lässt, sodass immense Massen von Menschen in
die Lösung der wesentlichen Aufgabe der zweiten Sequenz einbezogen wer-
den. Dies geht aber neben (bis heute) bedeutsamen Erfahrungen auch mit
schrecklichen Gräueltaten einher.41
Die genaue Analyse dieser Sequenz zeigt zudem, wie sich gerade aus die-
sem Experiment zwei notwendig widersprüchliche Bewegungen ergeben.
Die Formen kollektiver und massenhafter Selbstorganisation drohen perma-
nent, die Ordnung als solche aufzuheben. Sie führen zu Gewaltausbrüchen
der Jugend gegen die etablierten Kasten. Und letztlich droht der Bürger-
krieg. Dieser muss immer wieder durch gewaltsame staatlich-militärische
Interventionen auf unterschiedlichen Ebenen auf eine Weise verhindert
werden, die notwendig die staatliche Ordnung restauriert. Die Restauration
des Staates droht im Anschluss überdies immer wieder, in die Hände der reaktionären, bürokratisierenden, staatsterroristischen Tendenzen zu fallen, von denen der Staat, zumindest der maoschen Idee nach, eigentlich befreit
und gereinigt werden sollte.
5. Zum Schluss (der zweiten Sequenz)
Der Versuch der Großen Proletarischen Kulturrevolution, die kommunis-
tische Hypothese zu realisieren, führt einerseits zu einer unaufhebbaren
und widersprüchlichen Oszillation zwischen der immanenten Zerstörung
des Partei-Staats-Modells (das heißt zu einer rein zerstörerischen Negation),
der wiederum und immer wieder staatliche Grenzen gesetzt werden müs-
sen, und er führt andererseits zur Säuberung von reaktionären Tendenzen
innerhalb des Staats und der Partei (das heißt zu einer wiederum rein zer-
störerischen und negierenden Purifikation), die unauflösbar mit der ersten
41 Es sind gerade diese Gräuel, die manifestieren, dass das Problem der zweiten Sequenz
weiterhin ein nicht-gelöstes Problem bleiben wird.
F R
235
Seite verbunden ist und unaufhörlich in diese hinüberführt.42 Es entsteht so
ein unendliches Schwanken zwischen Zerstörung und Stärkung des Staats,
zwischen erneuter Einbeziehung der Massen und Dynamisierung des Par-
tei-Modells einerseits und Aufrechterhaltung der Ordnung und Fixierung
der bürokratischen Festigkeit der Partei andererseits.
Die beiden Versuche, sowohl die Kulturrevolution als auch der Mai 68, das Scheitern der zweiten Sequenz zu verhindern, misslingen so letztlich und führen zugleich beide zu einer umso stärkeren Restitution – und einer
weitgehenden Naturalisierung – des Staates in seiner bestehenden Form.
Ein weiteres deutliches Resultat dieses Scheiterns, erneut eines Scheiterns an
den eigenen, das heißt kollektiv gesetzten, normativen Präskriptionen wird
etwa durch die Krise oder noch deutlicher durch den Niedergang des Mar-
xismus – und all seiner geschichtlichen Referenten, seien diese nun nationale
Befreiungskämpfe, so genannte realsozialistische Staaten oder massenhafte
Arbeiterbewegungen, die alle zugleich verschwinden – augenscheinlich.
Nun ist zumindest eine Sache deutlich und vielleicht nicht sonderlich über-
raschend. Sequenzen konstituieren sich vor allem über ihr Ende und dieses Ende muss als ein immanentes Scheitern an den eigenen Ansprüchen verstanden werden, das heißt, als ein Scheitern, das in und an der Praxis statthat, in der die Konsequenzen aus den selbst gesetzten normativen Selbstfestlegungen entfal-tet werden. Zugleich gilt es bei dieser Diagnose zu beachten, dass
»das Ende oder der Abschluß einer politischen Sequenz nicht aufgrund von äuße-ren Kausalitäten oder Widersprüchen zwischen ihrem Wesen und ihren Mitteln ein[tritt], sondern durch den strikt immanenten Effekt einer Erschöpfung ihrer Kapazitäten. […] Die Kategorie des Scheiterns ist, anders gesagt, nicht relevant […]. Es gibt kein Scheitern, es gibt ein Aufhören«43.
Das Scheitern einer Sequenz ist kein Scheitern, das einer einfachen Nieder-
lage gleichkäme. Dies ist ein wichtiger Punkt für die Qualifizierung des
Begriffs der geschichtlichen Sequenz als philosophischen Begriff. Denn,
wie bereits meine bisherigen Bemerkungen auffällig werden ließen, geht
es aus einer Perspektive, die sich der Sequenzialität zuwendet, nicht um
ein Unternehmen, das zu objektiven Urteilen über die Geschichte kommt
– Urteile, die etwa die Form annehmen könnten: Der Kommunismus ist
oder war (schon immer) ein Übel. Sondern es geht in ihr um eine konkrete Analyse von konkreter, um im Beispiel zu bleiben, kollektiver normativer Selbstfestlegung und den konkreten Versuchen, aus dieser Selbstfestlegung
42 Zur komplexen Logik dialektischer Purifikation vgl. Badiou, !eorie des Subjekts.43 Badiou, Metapolitik, S. 138.
W S
236
Konsequenzen abzuleiten. Sequenzielle Betrachtung der Geschichte bedeutet, Geschichte von einem immanenten und das meint auch subjektiven Standpunkt aus zu bestimmen, zu beschreiben, vom Standpunkt der subjektiven Akteure
der Geschichte selbst.44
Um diesen methodischen Zug, den der Begriff der geschichtlichen Sequenz philosophisch erforderlich macht, genauer zu fassen, hilft ein Blick in das Buch über das 20. Jahrhundert, das Badiou 2005 veröffentlicht hat45
– und wichtig ist hier bereits, dass es Das Jahrhundert und nicht wie bei
Günter Grass Mein Jahrhundert heißt. Dort schreibt Badiou, nachdem er
unterschiedliche Möglichkeiten, über das Jahrhundert zu schreiben, ange-
führt hat – etwa die, sich von großen politischen, kulturellen Ereignissen
oder von grundsätzlichen Charakteristika oder von der Reihe schrecklicher
Vorkommnisse leiten zu lassen:
»Einen Typus objektiver oder geschichtlicher Einheit auszuwählen (seien es kom-munistische Heldentaten, das radikal Böse, die triumphierende liberale Demokra-tie, etc.) hilft uns nicht unmittelbar. Denn die Frage ist für uns Philosophen nicht die, was in einem Jahrhundert geschehen ist, sondern was dort gedacht wurde. Was wurde von den Menschen des Jahrhunderts gedacht, was nicht einfach die Fortführung eines vorherigen Denkens ist? Welches sind die noch nicht übertra-genen Gedanken? Was wurde vorab als undenkbar gedacht? Unsere Methode wird also sein: In die Rekonstruktion des Jahrhunderts manche Dokumente und Spu-ren einzubeziehen, die anzeigen, wie das Jahrhundert sich selbst gedacht hat. Und genauer noch: wie das Jahrhundert sein Denken gedacht hat, wie es die denkende Singularität seines Verhältnisses zu der Geschichtlichkeit seines Denkens identifi-ziert hat. […] Meine Idee ist, dass wir uns absolut nah an den Subjektivitäten des Jahrhunderts halten. Nicht an beliebige Subjektivitäten, sondern an genau diejeni-gen, die sich auf das Jahrhundert beziehen. Es geht nicht darum, das Jahrhundert als objektive Gegebenheit zu beurteilen, sondern darum, sich zu fragen, wie es sub-jektiviert wurde«46.
Diese Methode ist auch die Methode, die der Begriff der geschichtlichen
Sequenz erfordert. Man geht nicht von objektiven Gegebenheiten aus,
sondern von den Modi der Subjektivierung. Der Ausgangspunkt ist dann
beispielsweise, wie in unterschiedlicher Weise der Gedanke einer emanzi-
patorischen Hypothese (kollektiv) subjektiviert wurde (über die Frage nach
dem Machterhalt, des Sieges usw.). Ist für die Rekonstruktion eines Jahr-
44 Badiou hat dies einmal so gefasst, dass man die Französische Revolution nur dann ver-
steht, wenn man den Standpunkt St. Justs einnimmt und nicht denjenigen Kants. Vgl.
Badiou, Metapolitik, S. 38.
45 Badiou, Alain, Das Jahrhundert, Berlin/Zürich 2005.46 Ebd., S. 10.
F R
237
hunderts deswegen etwa die Frage, wie viele Jahre ein Jahrhundert angedau-
ert hat, eine wirkliche Frage, so gilt etwa für die Frage danach, was bisher
und wie bisher über die Hypothese der Emanzipation, die Hypothese einer
Gemeinschaft von Gleichen gedacht wurde, Ähnliches. Es gilt nachzuvoll-ziehen, es gilt zu denken, wie die Akteure bestimmter Sequenzen über diese
Hypothese gedacht haben, anhand welcher Operatoren, welcher Mittel,
unter welcher Fragestellung, über welche #emen. Das ist nicht schlicht
subjektivistisch, sondern besitzt vielmehr eine immanente Universalität, da
es in einer solchen Betrachtung darum geht, was eine Sequenz – trotz ihrer
internen Vielfältigkeit – immanent zu einem konsistenten Gebilde macht.
Zugleich ist damit gesagt, so gemeinsam ihnen allen die Orientierung an
der Hypothese der Emanzipation sein mag, so sehr unterscheiden sich
unterschiedliche Akteure unterschiedlicher Sequenzen doch darin, dass sie
jeweils ein anderes, spezifisches Undenkbares haben. Denn undenkbar ist etwa
für einen Kommunarden, dass die Organisationsform der revolutionären
Partei ein grundlegendes Problem der Kommune lösen wird. Undenkbar
wiederum ist es für Lenin oder Mao – und es bleibt auch heute in gewisser
Weise noch undenkbar oder scheint unmöglich, was das gleiche meint –,
wie eine Form von kollektiver Organisation zu denken ist, die von der
Form der Partei und von der Bezogenheit auf die Staatsmacht vollständig
abgezogen ist. Philosophie, bezieht sie sich auf Geschichte in der Form von
Sequenzen, ist daher Sequenzanalyse. Sequenzanalyse ist als Analyse von
spezifischer Undenkbarkeit Gegenwartsanalyse – ohne Genealogie zu sein.
So präsentiert aber philosophische Sequenzanalyse als Gegenwartsanalyse
auch immer eine immanente Analyse der un-dialektischen Einheit von
#eorie und Praxis, welche Badiou unter den Begriff des Denkens subsu-
miert. Sequenzanalyse ist immer auch Problemanalyse, doch Probleme sind
dann keine objektiven, abstrakt prinzipiellen Probleme, sondern welche, die
durch die Selbstfestlegungen, Präskriptionen und historischen Settings und Mittel emanzipatorischer Subjekte produziert wurden.
6. Sättigung
Jede Sequenz hat ein Ende. Das teilt sie mit jedem Jahrhundert. Doch ist das Ende nicht eines, das man – um eine Anleihe bei der Französischen
Revolution zu machen – aus thermidorianischer Perspektive einfach als ein
Scheitern an äußeren Umständen oder ein Scheitern an einem abstrakten
W S
238
Prinzip verstehen könnte. Sondern das Scheitern, das Aufhören, das Ende
einer Sequenz muss als eines verstanden werden, das sich nur aus immanen-
ten Präskriptionen und den Konsequenzen, die sie in konkreten geschicht-
lichen Situationen zeitigen, ergibt – eine Art historisierter kategorischer
Imperativ generiert konkrete Folgen, die dessen Befolgung, nicht ad hoc, aber nach und nach unmöglich werden lassen. Badiou hat dafür auch den Begriff der Sättigung (saturation) verwandt, der mir hier hilfreich zu sein scheint. Er übernimmt diesen von seinem Freund, dem politischen Den-ker Sylvain Lazarus, der ihn in seiner Anthropologie du Nom im Jahr 1996 entwickelt hatte.47 Dort definiert er ihn wie folgt: »Ich nenne Sättigungs-methode die Untersuchung, die von dem Inneren eines Werks oder eines Denkens ausgeht und sich dem Verfall einer seiner fundamentalen Katego-rien zuwendet.«48 Sättigung bezeichnet also eine Art und Weise, das Ende eines Werks oder Denkens aus einer immanenten Perspektive zu verstehen, und wird so zu einem entscheidenden Werkzeug für eine Philosophie als Sequenzanalyse.
Das Konzept der Sättigung erlaubt es, die Gründe der Beendigung einer Sequenz allein aus den Handlungen und Organisationsformen zu verstehen, welche in der Sequenz entscheidend sind. So ermöglicht es das Konzept, jede externe, und das heißt auch nur objektive, Evaluierung zu vermeiden, welche zumeist gerade das Scheitern nicht als Scheitern am eigenen Pro-jekt versteht, sondern anderweitige Gründe dafür sammelt. Ähnlich dem Geiste einer foucaultschen Gegengeschichte handelt es sich bei der Kategorie der Sättigung um eine Gegen-Kategorie, die sich politisch gegen reaktionäre, thermidorianische Deutungen des Scheiterns richtet.
Nun wird hier eine weitere Pointierung relevant. Badious philosophisches Projekt zielt auch darauf, erneut einen Begriff des Absoluten zu etablieren.49 Es zielt darauf, selbst Sequenzen als zumindest potenziell unendliche Proze-duren zu bestimmen. Wenn alle Prozesse, die in Sequenzen aktiv und wirk-lich sind, potenziell unendlich sind, wie lässt sich dann aber ein Ende dessen verstehen, was kein Ende kennen muss? Hier kann erneut ein Verweis auf Lazarus helfen. Dieser bestimmt das Ende eines Werks oder Denkens als Übergang eines Prozesses – den er »politischen Modus« nennt – von seiner Geschichtlichkeit (das heißt seiner geschichtlichen Wirklichkeit im Wort-sinn) zu seiner Denkbarkeit. Solange, so Lazarus’ hegelianische Pointe, wie
47 Lazarus, Sylvain, Anthropologie Du Nom, Paris 1998.
48 Ebd., S. 37 (eigene Übersetzung).49 Vgl. etwa: Badiou, Alain/Ruda, Frank/Völker, Jan, Towards a Contemporary Conception
of the Absolute, 04.06.2012, http://vimeo.com/28417395.
F R
239
ein politischer Modus aktiv ist, das heißt Geschichtlichkeit besitzt, kann er
nicht adäquat und konzeptuell gedacht werden. Die potenzielle Unendlich-
keit seiner Fortsetzung lässt keine Totalisierung zu. In dieser Hinsicht sind
aktive Prozesse, die für eine Sequenz konstituierend gewesen sein werden,
solange sie in actu sind, nicht-totalisierbar, da sie in historisch konkreten
Situationen nicht vorauszusehende Mittel und Wege, Formen und Aussa-
gen erfinden können.
Die in diesen Prozessen engagierten Subjekte – und ein Subjekt wäre
dann etwa im Sinne eines politischen Prozesses mal eine Massenbewegung
in der ersten Sequenz, mal eine Partei im Sinne der zweiten – sind so Agen-
ten, die diese potenzielle Unendlichkeit solange entfalten, bis sie an imma-
nente Hindernisse stoßen. Doch, und das ist entscheidend, diese ergeben
sich aus einer Verschaltung mehrerer Dimensionen von Kontingenz: der
Kontingenz der historischen Umstände, der Kontingenz der Mittel und
Formen, die entfaltet werden, um der eigenen Präskription die Treue zu hal-
ten, dem kontingenten Potenzial eben dieser Mittel und Formen. Kontin-
gent produzieren sie sich ändernde Koordinaten der Situation, und folglich
die Frage nach dem Potenzial dieser Mittel, der Präskription trotz der durch
sie selbst in Gang gesetzten Veränderung der Welt die Treue zu halten. Nur,
wenn diese Mittel sich nicht als fähig erweisen, weitere Konsequenzen aus
den Präskriptionen zu entfalten, gibt es einen Übergang von Geschichtlichkeit zu Denkbarkeit im lazarus’schen Sinne. Die Beendigung einer Sequenz ist
somit auch als eine Konsequenz aus den Handlungen denkender Subjekte
zu betrachten. Und diese kann als Konsequenz nur nach dem Ende einer
Sequenz verstanden werden.
Hier kann man zu Recht an Hegels Formulierung aus der Rechtsphiloso-phie denken, die auch das Konzept der Sättigung instruiert, nämlich, dass
die Eule der Minerva erst mit der Dämmerung ihren Flug beginnt. Die Sät-
tigung eines Prozesses muss stattgehabt haben, damit gedacht werden kann,
was gedacht und in dieser Hinsicht der nächsten, möglichen Sequenz ver-
erbt wurde. Lazarus meint dies, wenn er schreibt: »Die Sättigungsmethode
unterscheidet zwischen dem, was in einem Denken gedacht wurde, als es
stattgehabt hat, und dem, was gedacht wird, wenn der Modus geschlossen
ist.«50 Somit ist das Denken einer Sequenz des Denkens immer nach dem
Ende dieser Sequenz situiert. Der leninsche Schneetanz und die Konzeption
der Partei periodisieren in diesem Sinne die Pariser Kommune. Und die
zweite Sequenz lässt sich erst aus unserer Gegenwart denken, die von ihr
50 Lazarus, Anthropologie Du Nom, S. 41.
W S
240
geprägt ist. Sättigung, um es sehr kurz zu fassen, ist genau das, was aus einer
Sequenz eine Sequenz macht, denn jede Sequenz endet als gesättigte.
Was heißt all dies aber für einen philosophischen Begriff der Verände-
rung? Auch hier kann bei dem Begriff vermeintlichen Scheiterns begonnen
werden. Denn das Scheitern, das sich aus der Sequenzanalyse ergibt, ist
ein sehr spezifisches. Dieser Begriff des Scheiterns läuft darauf hinaus, dass
die Realisierungsversuche der emanzipatorischen Hypothese gescheitert
sind, wobei es aber nicht möglich ist, einfach bei der Behauptung stehen zu
bleiben, sie seien gescheitert. Sequenzanalyse als Analyse immanenter Sätti-
gung, die zu einem Scheitern an den eigenen normativen Selbstfestlegungen
führt, sucht eine neue Lesbarkeit eben dieses Scheiterns herzustellen, die
aufschlussreich für unsere Gegenwart sein kann. Wieso? Weil auch unsere
Gegenwart, so kann man Badiou pointieren, sich aus den vor ihr liegenden
Sequenzen, das heißt aus den Problemen und spezifischen Undenkbarkei-
ten, die sie uns vererbt haben, verstehen lässt. So generiert die Analyse von
Sequenzen nicht nur eine neue Lesbarkeit des Scheiterns, sondern auch eine
neue Lesbarkeit der Gegenwart – dessen, was in ihr für die Hypothese unge-
löste Probleme sind (vielleicht sogar Probleme, die von unserem historischen
Standpunkt als per se unlösbar erscheinen und die Hypothese als Hypothese
invalidiert haben könnten). Wenn die Hypothese als solche heute unmög-
lich scheint, dann muss und kann diese Unmöglichkeit – und damit unsere
Gegenwart – analysiert werden. Als Analyse solcher Unmöglichkeit – die
zudem der Hypothese die Treue hält – ist Sequenzanalyse ein Instrument
zum Verständnis der Gegenwart.
F R