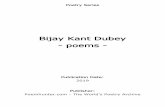Friede und Föderalismus bei Kant
Transcript of Friede und Föderalismus bei Kant
ZfP 53. Jg. 4/2006
4/200653. Jahrgang(Neue Folge)Seite 377–???Gegründet im Jahre 1907 durch Adolf Grabowsky und Richard Schmidt
ZfP Zeitschrift für PolitikO r g a n d e r H o c h s c h u l e f ü r Po l i t i k M ü n c h e n
Herausgeber: Prof. Dr. Dietmar Herz, Universität Erfurt; Prof. Dr. Franz Knöpfle, Universi-tät Augsburg; Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch, Universität München; Prof. Dr. ArminNassehi, Universität München; Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Oberreuter, Universität Passau;Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer, Technische Universität Dresden; Prof. Dr. Theo Stam-men, Universität Augsburg; Prof. Dr. Roland Sturm, Universität Erlangen-Nürnberg; Prof.Dr. Hans Wagner, Universität München; Prof. Dr. Wulfdiether Zippel, Technische UniversitätMünchen
Redaktion: Prof. Dr. Dr. Hans-Martin Schönherr-Mann, Universität München
Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Ulrich Beck; Prof. Dr. Alain Besançon; Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Karl Dietrich Bracher; Dr. Friedrich Karl Fromme; Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Gumpel;Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Häberle; Prof. Dr. Wilhelm Hennis; Prof. Dr. Peter Graf Kiel-mansegg; Prof. Dr. Dr. h.c. Gottfried-Karl Kindermann; Prof. Dr. Leszek Kolakowski; Prof.Dr. Dr. h.c. Hermann Lübbe; Prof. Dr. Harvey C. Mansfield; Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin;Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Oberndörfer; Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Jürgen Papier; Prof. Dr.Roberto Racinaro; Prof. Dr. Hans Heinrich Rupp; Prof. Dr. Charles Taylor
InhaltMassimo MoriFriede und Föderalismus bei Kant .................................................................. 379
Efe ÇamanTürkei quo vadis? Determinanten türkischer Außenpolitik in Europa und Asien ............................................................................................................ 393
Zum Thema: ItalienStefan KöpplItalien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? .............................. 420
Michaela Koller-SeizmairDie Interessen und Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit in Südtirol ... 436
Buchbesprechungen mit Verzeichnis ............................................................. 455
01_Inhalt Seite 1 Donnerstag, 9. November 2006 2:35 14
Zeitschriftfür PolitikZfP
Organ der Hochschule für Politik München
Redaktion: Prof. Dr. Dr. Hans-Martin Schönherr-Mann,Hochschule für Politik, Ludwigstraße 8, 80539 München.
Unaufgefordert eingereichte Manuskripte werden von min-destens zwei Experten anonym begutachtet. Die Manus-kripte sollen deshalb der ZfP-Redaktion nach Möglichkeitals Datei in einer anonymisierten Version eingereicht wer-den (vorzugsweise per E-Mail). Diese darf keinerlei Hin-weise auf die Autorenschaft enthalten; dies gilt auch fürVerweise im Manuskript auf andere Veröffentlichungen desVerfassers oder solche Hinweise, die es erlauben, auf dieIdentität des Autors schließen zu können.
Internet: www.politik-im-netz.com/zfp.htm Email: [email protected]
Verlag: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Postfach 100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 2104-0, Telefax 0 72 21 / 21 04-43.
Nachdruck und Vervielfältigung: Die Zeitschrift und allein ihr enthaltenen einzelnen Beiträge sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzendes Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verla-ges unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeiche-rung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bezugsbedingungen: Die Zeitschrift erscheint viermal imJahr. Jahrespreis 74,– €, für Studenten und Referendare(unter Einsendung eines Studiennachweises) jährlich 54,– €zuzüglich Versandkosten. Einzelheft 19,– € zuzüglich Ver-sandkosten. Kündigung nur vierteljährlich zum Jahresende.
Anzeigen: sales_friendly, Verlagsdienstleistungen, BettinaRoos, Maarweg 48, 53123 Bonn, Telefon 02 28 / 9 78 98-0,Telefax 02 28 / 9 78 98-20, E-Mail: [email protected].
Druckerei: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Postfach 100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 2104-24, Telefax 0 72 21 / 21 04-79
ISSN 0044-3360
Hinweise für Autoren zur Gestaltung derManuskripte
1. Manuskripte sollten der ZfP-Redaktionanonymisiert als Datei möglichst per E-Mail eingereicht werden.
2. Der Umfang eines Artikels sollte bei etwa25 Seiten DIN A4, 1 1/2-zeilig geschrieben,liegen. Schriftgröße: 12 pt, neue Recht-schreibung.
3. Am Ende des Manuskripts ist eine deutscheund eine englische Zusammenfassung zubringen, wobei die deutsche Fassung 10 Zei-len nicht überschreiten soll.
4. Es gibt kein Literaturverzeichnis am Endedes Manuskripts; vielmehr werden in derZfP Literaturverweise und zitierte Literaturausschließlich in den Fußnoten (FN) in nor-maler Groß- und Kleinschreibung genannt,Reihenfolge der Angaben, Hervorhebun-gen (Kursivschrift, Anführungszeichen) undInterpunktion entsprechend den folgendenBeispielen:
Bücher:Christine Landfried, Das politische Europa,Baden-Baden 2005, S. …
Artikel:Niklas Luhmann, »Das Gedächtnis der Politik«in: Zeitschrift für Politik, 2/1995, S. 109-121oder in: Buchzitation wie oben angegeben
Bei zwei oder mehr Autoren und zwei odermehr Erscheinungsorten wird der Schräg-strich/ verwendet; bei den Autoren mit jeweilseiner Leertaste vor und nach dem Schräg-strich, bei den Erscheinungsorten ohne Leer-stellen.
Verwendete Abkürzungen: ebd., S. … undaaO. (FN…), S. …
Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt einProspekt des Blätter Verlags und der NomosVerlagsgesellschaft bei. Wir bitten freundlichstum Beachtung.
Autoren dieses HeftesAssist. Prof. Dr. Efe Çaman, Fachbereich Internationale Beziehungen, Fak. f. Wirtschafts- u. Ver-waltungswiss., Univ. Kocaeli/TürkeiMichaela Koller-Seizmair, Dipl. sc. pol. Univ., Publizistin und Journalistin, MünchenStefan Köppl M.A., Akademie für Politische Bildung TutzingProf. Dr. Massimo Mori, Ordinarius für Geschichte der Philosophie an der Universität Turin/Ita-lien
01_Inhalt Seite 2 Donnerstag, 9. November 2006 2:35 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori
Friede und Föderalismus bei Kant1
1. »Westfälisches Modell« und domestic analogy
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg nahm der ehrgeizige Versuch Gestalt an,durch ein Bündnis der Völker, das Streitigkeiten mit Hilfe eines internationalenSchiedsspruchs schlichten sollte, den künftigen Frieden zu fördern. Dem Völker-bund, der aus diesem Projekt hervorging, war indes kein langes Leben beschiedenund vor allem erwies er sich als untaugliches Werkzeug für die Verwirklichung desgesetzten Ziels. Ein gelungenerer Versuch war die Gründung der Vereinten Natio-nen (UNO) nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach wie vor tätig ist, auch wenn vorallem in den letzten Jahren ihre institutionelle Schwäche und ihre geringe Durchset-zungskraft in Krisensituationen immer deutlicher zu Tage getreten sind. Es scheint,als habe sich Woodrow Wilson, der noch vor Kriegsende für die Gründung des Völ-kerbunds eintrat, an Kant inspiriert, obwohl er in seinen Schriften nur sehr seltenund in allgemeiner Form auf den großen Philosophen Bezug nimmt. Noch indirek-ter ist die kantische Urheberschaft der UNO, die aus einer umfänglichen diplomati-schen Aktion entstand, in der sich nur schwer philosophische Einflüsse ermittelnlassen. Auf konzeptioneller Ebene bildet Kants Projekt Zum ewigen Frieden aberunzweifelhaft das Vorbild für beide Institutionen, weil es mit ihnen die ebenso ehr-geizige wie schwer zu verwirklichende Idee teilt, dass ein institutionalisiertes, alsovon einem zentralen Organismus abhängiges Rechtsverhältnis zwischen allen Völ-kern der Erde herstellbar sei.
In Wirklichkeit war Kants Bezugsmodell ein Philosoph, dem nichts ferner stehenkonnte als der Gedanke eines ewigen Friedens unter den Völkern, nämlich ThomasHobbes. In zwei Punkten stimmen der Autor von De Cive und Leviathan und Kantüberein. Erstens konzipieren beide den Naturzustand als Kriegszustand, in dem esnicht zwangsläufig zu Konflikten und realen Zusammenstößen kommt, der Kriegaber potenziell immer möglich ist, weil es an einer unparteilichen Autorität fehlt,
1 Der vorliegende Text spiegelt einen Vortrag wieder, der bei der Siemens-Stiftung Mün-chen am 14. 06. 2006 gehalten wurde. Es geht um ein work in progress, der im Rahmeneines umfangreicheren, von der Alexander von Humboldt-Stiftung und der UniversitätTurin befördeten Forschungsprojekts über Kants internationales Denken steht. Für dieDiskussion der einschlägigen Sekundärliteratur wird auf die endgültige Fassung hinge-wiesen - Alle Kant-Zitate stammen aus der Akademie-Ausgabe: Kant‹s GesammelteSchriften, Berlin-Leipzig, 1910 ff. Im Text werden Band, Seite und Zeile im Klammernangegeben.
02_Mori Seite 379 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant380
die Streitigkeiten mit rechtlichen Mitteln schlichten würde 2. Die zweite Analogiebesteht in der gemeinsamen Überzeugung beider Autoren, dass man aus dem natür-lichen Kriegszustand herausfinden muss (exeundum e statu naturali), indem manvom Zustand der natürlichen Freiheit zu einem Zustand von gesetzlichem Zwangübergeht. Für Hobbes wie für Kant konnte dies einzig und allein durch die Schaf-fung der bürgerlichen Gesellschaft gelingen, auch wenn die Bedingungen des Ge-sellschaftsvertrags, auf dem sie basiert, und folglich die Natur des daraus entstehen-den Staates für beide völlig andere waren.
Damit sind die Analogien aber auch schon zu Ende und es tritt stattdessen einsehr erheblicher Unterschied hervor. Hobbes zieht die Ausweitung des Gesell-schaftsvertrags von einer einzelstaatlichen zur zwischenstaatlichen Ebene nicht inBetracht. Mit anderen Worten ist der Staat für Hobbes die höchste Form von politi-scher Institution, über die hinaus es keine andere Obrigkeit gibt. Der Souverän istmit jener schon von Jean Bodin theoretisierten potestas absoluta ausgestattet, die ihnallein Gott unterstellt. Das von Hobbes erarbeitete Denkmodell entspricht übrigensder internationalen Realität seiner Zeit. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648,mit dem de facto die übernationalen politischen Funktionen von Papsttum und Kai-serreich schwanden, bildete sich das jus publicum europaeum heraus, mit dem dieinternationale Ordnung nun auf ein System souveräner Staaten gegründet wurde,also auf das Gleichgewicht zwischen Nationen, die sich als gleichberechtigt betrach-teten und wechselseitig ihre Unabhängigkeit anerkannten.
Zwar waren die meisten Vertreter der Naturrechtsschule im Unterschied zuHobbes, mit dem sie doch die These vom vertraglichen Ursprung des Staates teilten,der Ansicht, dass es ein nicht nur die Individuen, sondern auch die Staaten betref-fendes Naturrecht gebe. Das internationale Naturrecht würde die Staaten an Ge-waltanwendung, also an Kriegen, hindern, es sei denn zur Selbstverteidigung oderZurückweisung eines Angriffs (vim per vim repellere licet, wie der alte Spruch vonUlpian lautet). Die Gewaltanwendung wäre nur insoweit gerechtfertigt als sie derWiederherstellung der verletzten Rechtsordnung dient. Auf diesem Gedanken be-ruht seit Thomas von Aquin die Lehre vom »gerechten Krieg«. Aber gerade weildas internationale Naturrecht den Naturrechtsphilosophen ganz und gar ausrei-chend erschien, um die zwischenstaatlichen Beziehungen zu regeln, hielten sie esmit dem Prinzip der absoluten Souveränität für durchaus vereinbar. Die souveränenStaaten selbst hatten es anzuwenden. Deshalb schlossen die Naturrechtsphiloso-phen – genau wie Hobbes – die Notwendigkeit einer Ausdehnung des Gesell-schaftsvertrags von der individuellen auf die staatliche Ebene kategorisch aus. Dieeinzige Ausnahme bildete Christian Wolff, der eine die besonderen civitates um-schließenden civitas maxima voraussetzte 3. Allerdings bestätigt die Ausnahme die
2 Vgl. Thomas Hobbes, De cive, I, 12; Leviathan, I, XIII; Immanuel Kant, Zum ewigenFrieden, VIII, 348, 4-5 / 349, 1-2.
3 Christian Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, Halle-Magdeburg, 1750, Prole-gomena, §§ 9-21. Die civitas maxima ist aber von Wolff als reine Fiktion der Vernunftverstanden.
02_Mori Seite 380 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 381
Regel: Sein Schüler Emer de Vattel, Verfasser eines viel gelesenen Droit de gens, dasals Handbuch in der europäischen Diplomatie weite Verbreitung fand, ging zu derLehre von der civitas maxima entschieden auf Abstand, obgleich er dem Lehrer inallen wichtigen Fragen bis ins Kleinste folgte. In seinen Augen war sie von Grundauf falsch, weil sie den Staaten ihre Unabhängigkeit nahm4. In der naturrechtsphilo-sophischen Perspektive, wie sie die politische Kultur des 17. und 18. Jahrhundertsallgemein beherrschte, war die Achtung des internationalen Rechts somit in das Er-messen der einzelnen souveränen Staaten gestellt, ohne Anrufungsmöglichkeit ir-gendeiner höheren Rechtsinstanz. Das vor Kant dominierende politische Modell,auf das die Politologen noch heute unter dem Begriff »Westfälisches Modell« Bezugnehmen, fußt demnach wesentlich auf dem Prinzip internationaler Anarchie.
Diesem Hobbes‹schen und allgemein naturrechtsphilosophischen Modell setzteKant die von den heutigen Politologen als domestic analogy bezeichnete Theorieentgegen. Dieser zufolge ist die Situation zwischen den Staaten im Naturzustand diegleiche wie zwischen den Individuen: Es handelt sich jeweils um einen Kriegszu-stand. Daher muss das Vertragsmodell von der individuellen auf die staatliche Ebeneausgedehnt werden.
»Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurtheilt werden, die sich inihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußern Gesetzen) schondurch ihr Nebeneinandersein lädiren, und deren jeder um seiner Sicherheit wil-len von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähn-liche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann« (VIII,354, 3-8).
Gehen wir also davon aus, dass die Staaten ebenso wie die Individuen in eine Artinternationale Gesellschaft treten müssen, um aus dem natürlichen Kriegszustandherauszufinden, so stellt sich folgende Frage: Beinhaltet die Ausweitung des Ver-tragsmodells von der zwischenmenschlichen zur zwischenstaatlichen Ebene einevollkommene oder eine unvollkommene Analogie zwischen beiden Ebenen? DieAlternative zieht höchst unterschiedliche Folgen nach sich. Ist die Analogie voll-kommen, so müssen die Staaten einer einzigen Zentralgewalt unterstehen, wie dieBürger sich einer einzigen Regierung unterwerfen. Mit Kant gesprochen wäre diedaraus hervorgehende Staatengesellschaft also ein »Völkerstaat«. Wenn die Analogiehingegen nur unvollkommen ist, wenn das auf die Individuen angewandte Vertrags-modell also nur bis zu einem gewissen Punkt auf die Staaten ausgedehnt werdenkann, dann gehen diese einfach in einem Organismus internationaler Koordinationzusammen, der über keinerlei Zwangsgewalt (also über keine Zentralregierung) ver-fügt, sondern die nationale Unabhängigkeit und Souveränität der einzelnen Mit-gliedsstaaten unangetastet lässt. In diesem Fall gelangt man nicht zu einem Völker-staat, sondern zu einem bloßen »Völkerbund«. Konzeptionell unterscheiden sichdie beiden Lösungen durch das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein einer
4 Emer de Vattel, Le droit des gens, London, 1758, Préface, I, pp. XVII-XVIII.
02_Mori Seite 381 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant382
Zentralregierung, doch können sie einander im Hinblick auf ihren Zwangscharakterdurchaus sehr annähern. Die Gewalten des Völkerstaats können sich in manchenFällen auf wenige für die Friedenssicherung notwendige außenpolitische Kompe-tenzen beschränken5, während die Befugnisse des Völkerbunds von der bloßen poli-tischen Empfehlung bis zu einem mit vereinten militärischen Kräften ausgeübtenZwang reichen können. Jedenfalls wird der internationale Friede besser durch denVölkerstaat garantiert, Freiheit und Unabhängigkeit der einzelnen Staaten durchden Völkerbund.
2. Zwischen Völkerbund und Völkerstaat
Kants Lösung des angesprochenen Problems durchläuft eine parabelartige Ent-wicklung. Obwohl er grundsätzlich stets dem Völkerbund den Vorzug gab, gewannbis Anfang der 1790er Jahre die These des Völkerstaates an Gewicht; danach spracher sich hingegen immer nachdrücklicher zugunsten des Völkerbunds aus.
In der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784)steht die genannte Alternative noch nicht zur Debatte. Die einzige vorgeschlageneLösung ist die des Völkerbunds. Zwar macht Kant hier keine konkreten Angabenzur institutionellen Struktur der Föderation, doch ist sie seinen Äußerungen zufol-ge ermächtigt, »nach Gesetzen des vereinigten Willens« zu beschließen und diesenWillen mit Hilfe der »vereinigten Macht« (V, 24, 26-27) durchzusetzen. Sein Hin-weis auf den foedus anphictyonum scheint auf den Bündnispakt der griechischen po-leis anzuspielen. Die Zwangsgewalt der Föderation ist mithin nicht durch ihre insti-tutionellen Organe gegeben, sondern durch die tatsächliche Fähigkeit zurUmsetzung gemeinsam getroffener Entscheidungen unter Vereinigung der einzel-nen Kräfte. Folglich denkt Kant lediglich an einen Völkerbund – auch in späterenWerken die einzige von ihm akzeptierte Lösung –, schreibt diesem Bund jedoch defacto weit reichende Zwangsgewalt zu, die ihm eine ähnliche Durchsetzungskraftwie einem Völkerstaat verleiht.
In der Schrift Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugtaber nicht für die Praxis (1793) unterscheidet Kant erstmals eindeutig – wenigstenswas die gedruckten Werke anbelangt – zwischen einer »weltbürgerlichen Verfas-sung« als »weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt«, das heißt ei-nem Völkerstaat, und »ein[em] rechtliche[n] Zustand der Föderation nach einemgemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht«, das heißt einem Völkerbund (VIII,311, 4-5). Die Entscheidung für eine der beiden Möglichkeiten ist durch den Konf-likt zwischen dem, was die »Theorie« vorschreibt und dem, was die »Praxis« nahe-legt, bedingt. Die auf das »Völkerrecht« bezogene Theorie ist unmissverständlich:Um den Kriegszustand zu überwinden, ist »kein anderes Mittel, als auf öffentliche
5 Vgl. Z. B. die heute von Otfried Höffe vorgeschlagene Teorie des »extrem minimalenWeltstaates« (Otfried Höffe, »Völkerbund oder Völkerrepublik« in: Immanuel Kant,Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, S. 109-32).
02_Mori Seite 382 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 383
mit Macht begleitete Gesetze, denen sich jeder Staat unterwerfen müßte, gegründe-tes Völkerrecht (nach der Analogie eines bürgerlichen oder Staatsrechts einzelnerMenschen) möglich« (VIII, 312, 25-29). Die Lösung wäre demnach der Völkerstaat.Aber in der »Praxis« wenden diejenigen, die sich gegen die Möglichkeit einer An-passung der Praxis an die Theorie wehren, ein, dass die Staaten sich niemals solchenZwangsgesetzen beugen werden; sie leugnen also die Möglichkeit eines Völker-staats. Dagegen spricht Kant sich gemäß der allgemeinen These der Schrift, wonachErwägungen praktischen Nutzens die Gültigkeit der theoretischen Sätze nicht be-einflussen dürfen, zugunsten des Völkerstaats aus:
»Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprin-zip ausgeht, wie das Verhältniß unter Menschen und Staaten sein soll, und dieden Erdengöttern die Maxime anpreiset, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zuverfahren, dass ein solcher allgemeiner Völkerstaat dadurch eingeleitet werde,und ihn also als möglich (in praxi), und daß er sein kann, anzunehmen« (VIII,313, 7-12).
Im Jahr 1795 verfasste Kant das Werk, das die eingehendste Auseinandersetzungmit dem Problem von Krieg und Frieden darstellt: Zum ewigen Frieden. Das Pro-blem wird darin ähnlich gestellt wie in der Schrift von 1793, aber Kants Position er-scheint genau umgekehrt. Nach wie vor steht der Völkerstaat auf der Seite der The-orie und der Völkerbund auf der Seite der Praxis, doch pflichtet Kant jetzt denErwägungen praktischen Nutzens bei, womit er klar hinter die These von 1793 zu-rückgeht. Er unterscheidet zwischen einer Position »in thesi«, also aufgrund desvon der Vernunft Gesetzten (titemi), und einer Position »in ypothesi«, die von nichtauf die Vernunft zurückführbaren empirischen Voraussetzungen ausgeht. »In thesi«kann an der vollkommenen Analogie zwischen Staaten und Individuen und somitan der Notwendigkeit eines »Völkerstaates« kein Zweifel bestehen:
»Für Staaten im Verhältnisse unter einander kann es nach der Vernunft keine an-dere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, heraus-zukommen, als daß sie eben so wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose)Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen(freilich immer wachsenden) ›Völkerstaa‹t (›Civitas gentium‹), der zuletzt alleVölker der Erde befassen würde, bilden« (VIII, 357, 5-11).
Was Kant aber »in thesi«, also vom theoretischen Standpunkt, weiterhin richtigerscheint, stellt sich ihm in der Praxis als nicht umsetzbar dar, weil die Staaten näm-lich von der »Ypothesis« ausgingen, nicht auf ihre Unabhängigkeit »nach ihrer Ideedes Völkerrechts« (meine Hervorhebung) verzichten zu müssen. Auch Kant akzep-tiert diese »Voraussetzung« und meint, man müsse sich – (»wenn nicht alles verlo-ren werden soll«) – »an d[er] Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik« mit dem»negative[n] Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich immerausbreitenden Bundes« (VIII, 357, 13-16) zufrieden geben, auch wenn die besagteIdee einer Weltrepublik in thesi rational richtig wäre. Schon der Überschrift nachsetzt sich der zweite Definitvartikel zum ewigen Frieden daher nur »einen Födera-
02_Mori Seite 383 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant384
lism freier Staaten« (meine Hervorhebung) zum Ziel. Das internationale Recht zielt»lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für sich selbst undzugleich anderer verbündeten Staaten, ohne daß diese doch sich deshalb (wie Men-schen im Naturzustande) öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselbenunterwerfen dürfen« (VIII, 356, 11-14).
Die größte Abneigung gegen den Völkerstaat samt der daraus folgenden instituti-onellen Schwächung des internationalen Organismus für die Erhaltung des Friedenszeigt Kant in der Metaphysik der Sitten von 1798 (Rechtslehre, § 61). Tatsächlichhält er auch in diesem Werk an dem Prinzip fest, wonach der Völkerstaat theore-tisch betrachtet die einzig wahre Lösung der Friedensfrage darstellen würde:
»Da der Naturzustand der Völker eben so wohl als einzelner Menschen ein Zu-stand ist, aus dem man herausgehen soll, um in einen gesetzlichen zu treten: so istvor diesem Ereignis alles Recht der Völker und alles durch den Krieg erwerblicheoder erhaltbare äussere Mein und Dein der Staaten bloß ›provisorisch‹ und kannnur in einem allgemeinen Staaten-Verein (analogisch mit dem, wodurch ein VolkStaat wird) ›peremptorisch‹ gelten und ein wahrer Friedenszustand werden« (VI,350, 6-12).
Doch trotz dieser klaren Konzession an die Theorie vertritt Kant die Ansicht,dass der internationale Organismus für die Erhaltung des Friedens »keine souveräneGewalt (wie in einer bürgerlichen Verfassung), sondern nur eine Genossenschaft(Föderalität) enthalten müsse« (VI, 344, 18-19). Der Verein, der keinerlei Einmi-schung in die Innenpolitik seiner Mitglieder zulassen darf, soll temporärer Art seinund muss folglich von Zeit zu Zeit erneuert werden. Kant so äußert über die inter-nationale Institution, die er mit der 1719 in Den Haag einberufenen Versammlungder Generalstaaten vergleicht: »Man kann einen solchen Verein einiger Staaten, umden Frieden zu erhalten, den permanenten Staatenkongreß nennen, zu welchem sichzu gesellen jedem benachbarten unbenommen bleibt« (VI, 350, 23-25). Um jegli-chen Zweifel auszuräumen, setzt er erläuternd hinzu, dass unter Kongress »nichteine solche Verbindung, welche (wie die der amerikanischen Staaten) auf einerStaatsverfassung gegründet und daher unauflöslich ist«, sondern einfach »eine will-kürliche, zu aller Zeit auflösliche Zusammentretung verschiedener Staaten« (VI,351, 1-4) zu verstehen sei.
3. Das »Postulat des öffentlichen Rechts«
Bevor wir untersuchen, aus welchen Gründen Kants Skepsis gegenüber dem Völ-kerstaat von 1793 an immer größer wurde, sollten wir uns fragen, ob diese Positionmit dem allgemeinen Rahmen der kritischen Philosophie und namentlich mit dertranszendentalen Rechtsauffassung vereinbar ist. Das Recht ist für Kant »der Inbe-griff der Bedingungen, unter denen die Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheitnach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann« (VI, 230, 24-26). Mitanderen Worten ist das Recht das von der reinen Vernunft (in ihrem praktisch-
02_Mori Seite 384 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 385
rechtlichen Gebrauch) festgesetzte allgemeine System der Freiheiten, aufgrund des-sen jedermanns äußere Freiheit mit der aller anderen vereinbar wird. Obwohl dasvon der reinen Vernunft bestimmte Rechtssystem absoluten normativen Wert hat,besitzt es indes keinerlei tatsächliche Macht, solange es nicht in ein positives Rechts-system übersetzt wird, also mit Zwangsgewalt ausgestattetes Gesetz wird: »Rechtund Befugnis zu zwingen bedeuten also einerlei« (VI, 232, 29). Mit Kant gesprochenhat das »Privatrecht« (natürliches Recht) nur »provisorischen« Wert; allein das »öf-fentliche Recht« (positives Recht) ist »peremptorisch«.
Deshalb beruht das »öffentliche Recht« nach Kant auf einem »Postulat«:
»Du sollst im Verhältnisse eines unvermeidlichen Nebeneinanderseins mit allenanderen aus jenem heraus in einen rechtlichen Zustand, d. i. den einer austhei-lenden Gerechtigkeit, übergehen« (VI, 307, 9-11).
Anders gesagt: Wenn die Menschen die Möglichkeit haben, in Wechselbeziehun-gen zu treten und sich folglich auch gegenseitig zu schaden, so müssen sie notwen-digerweise aus dem Naturzustand heraustreten, der ein Kriegszustand ist, um statt-dessen in einen rechtlichen Zustand zu treten, der ein Zustand des Friedens ist. Nunhaben die Menschen, so Kant, stets die Möglichkeit, miteinander in Beziehung zutreten, weil die Erde rund, ihre Oberfläche also nicht unendlich ist; außerdem kön-nen nunmehr auch große Distanzen leicht zurückgelegt werden – das 18. Jahrhun-dert ist ein Jahrhundert der großen Entdeckungsreisen –, es gibt also keine innerenSchranken mehr, die die Völker voneinander trennen. Daraus ergibt sich das im Na-turzustand allen kraft Vernunft verliehene Recht, die anderen zum Hinaustreten ausdiesem Zustand zu zwingen, um sich gemeinsam eine »rechtliche Verfassung« zugeben, in der das Recht nicht nur »provisorisch«, als im Naturrecht enthaltene Ver-nunftvorgabe, sondern »peremptorisch« durch den mit dem positiven Recht gesetz-ten Zwang gilt.
Das öffentliche Recht gliedert sich seinerseits in drei Ebenen. Es betrifft 1. die Be-ziehungen zwischen Individuen innerhalb eines Staates im Sinne der bürgerlichenVerfassung (Staatsrecht, ius civitatis); 2. die Beziehungen zwischen Staaten (Völker-recht, ius gentium); 3. die Beziehungen zwischen Staaten und Einzelmenschen(weltbürgerliches Recht, ius cosmopoliticum) (VIII, 349, 25-35). Folglich müsstedas »Postulat des öffentlichen Rechts« auf allen drei genannten Ebenen Gültigkeithaben, das heißt, zwischen den verschiedenen Ebenen müsste eine perfekte Analo-gie herrschen. Auch wenn die miteinander in Beziehung tretenden Subjekte von Fallzu Fall andere sind – Individuen mit Individuen, Staaten mit Staaten, Individuen mitStaaten – müsste stets die Regel gelten, derzufolge zwei Subjekte, die in Wechselbe-ziehungen kommen, aus dem Naturzustand herausfinden und in einen gesetzlichenZustand übergehen müssen. Aber genau in diesem Punkt gerät Kant gewisserweisein Widerspruch zu sich selbst, weil er die Befolgung des »Postulats« de facto nur fürdie erste Ebene fordert, auf der die einzelnen Bürger der Zwangsgewalt des Staatesunterstehen. Auf der zweiten Ebene, der der internationalen Beziehungen, würdedie genaue Anwendung des »Postulats« nämlich unweigerlich zur Befürwortungdes »Völkerstaats« führen, zu der Kant – wie wir gesehen haben – nicht bereit ist.
02_Mori Seite 385 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant386
Die dritte Ebene endlich, die des weltbürgerlichen Rechts, betrifft ausschließlich das»Besuchrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten«(VIII, 358, 8-9), also die Möglichkeit, andere Länder zu erkunden und mit anderenVölkern Handel zu treiben. Sie kann daher nur in der zweiten Ebene – dem interna-tionalen Recht – ihre Gewähr finden und geht ganz und gar in ihr auf.
4. Die Gründe für eine Ablehnung
Warum weigert sich Kant also, die domestic analogy zu besiegeln, das heißt, dasPostulat des öffentlichen Rechts, das er für die Einzelmenschen geltend macht, aufdie zwischenstaatlichen Beziehungen auszudehnen? Anders gefragt: Warum lehnt erden Völkerstaat in der Praxis ab, nachdem er in der Theorie seine Notwendigkeitanerkannt hat? Verstreut lassen sich in Kants Texten verschiedene Gründe dafür er-mitteln. Bei einigen handelt es sich um Überlegungen empirischer Art: 1) Die über-mäßige Ausdehnung eines Staates beeinträchtigt dessen Regierbarkeit (VI, 350, 12-15); 2) eine »Universalmonarchie« würde die bürgerliche und politische Freiheit zubeschränken drohen (dass große Ausdehnung des Staates und Despotismus inWechselbeziehung stünden, war eine gemeinsame Überzeugung der republikani-schen Tradition des 17. und 18. Jahrhunderts, die auch Montesquieu teilte); 3) da derhistorische Fortschritt schließlich durch den »Antagonismus« – die »ungeselligeGeselligkeit« – angetrieben werde, müsse der internationale Frieden durch eineweltbürgerliche Ordnung gesichert werden, die, wie der Völkerbund, »nicht ohnealle Gefahr sei, damit die Kräfte der Menschen nicht einschlafen« (VIII, 26, 10-12).Aber solcherlei praktisch-empirische Betrachtungen haben in einer transzendenta-len Rechtsauffassung, die das Rechtsgebäude ganz und gar a priori nach Maßgabeder allgemein gesetzgebenden reinen praktischen Vernunft errichtet, nicht den ge-ringsten Wert.
Triftiger erscheint aufgrund seiner formalen Natur der Einwand, wonach dieStaaten nicht gezwungen werden können, aus dem Naturzustand herauszufinden,in dem sie sich in ihren Wechselbeziehungen befinden, weil jeder von ihnen sich be-reits in seinem Inneren eine Rechtsverfassung gegeben, den Naturzustand also hin-ter sich gelassen hat (VIII, 355, 36-37 - 356, 1). Allerdings haben auf diese Weise nurdie Bürger ein und desselben Staates die Pflicht erfüllt, aus dem Naturzustand her-auszutreten, nicht aber alle Individuen, die als Angehörige verschiedener Staatenmiteinander in Kontakt kommen können und sich untereinander demnach weiter-hin im Naturzustand befinden. Dagegen setzt das Postulat des öffentlichen Rechts»ein Recht [fest], jedermann, mit dem wir irgend auf eine Art in Verkehr kommenkönnten, zu nöthigen, mit uns in eine Verfassung zusammen zu treten, worin jenes[ein äußeres Mein und Dein] gesichert werden kann« (VI, 256, 33-35). Im Übrigenwiderspricht Kant sich selbst, wenn er in der Metaphysik der Sitten erklärt:
»Nun spricht die moralisch-praktische Vernunft in uns ihr unwiderstehlichesVeto aus: Es soll kein Krieg sein, weder der, welcher zwischen Mir und Dir imNaturzustande, noch zwischen uns als Staaten, die, obzwar innerlich in gesetzli-
02_Mori Seite 386 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 387
chen, doch äußerlich (im Verhältniß gegen einander) im gesetzlosen Zustandesind« (VI, 354, 20—25).
Die bisher betrachteten Begründungen mögen zwar sicher ernste Bedenken vonKant zum Ausdruck bringen, sie berühren aber nicht den Kern des Problems. Derwahre Grund für seine Ablehnung des Völkerstaats-Gedankens erhellt dagegen auseiner wichtigen Seite des Ewigen Friedens:
»Darin [im Begriff eines Völkerstaats, M. M.] aber wäre ein Widerspruch: weilein jeder Staat das Verhältnis eines Oberen (Gesetzgebenden) zu einem Unteren(Gehorchenden, nämlich dem Volk) enthält, viele Völker aber in einem Staatenur ein Volk ausmachen würden, welches […] der Voraussetzung widerspricht«(VIII, 354, 8-15).
Kant führt das Argument so vor, als zeige es einen logischen Widerspruch auf,und zwar nach folgendem Gedankengang: Einerseits wohnt dem Begriff des inter-nationalen Rechts die Idee der Pluralität der Völker als unbestreitbare Vorausset-zung inne. Andererseits beinhaltet der universale Staat Einheit, Negation der Plura-lität, das heißt Negation der Voraussetzung. Ist die Voraussetzung nach Kant abernotwendigerweise wahr, dann ist das ihr Widersprechende inakzeptabel.
In Wahrheit beinhaltet ein Völkerstaat indes keineswegs die Negation der Plurali-tät. Es gilt ihn nämlich streng vom homogenen Weltstaat, also von der Universalmon-archie abzugrenzen (wie Kant sich ausdrückt, der beide Begriffe wohl bisweilenverwechselt). In letzterer lösen sich die Staaten in einem einzigen universalen politi-schen Organismus auf, während der Völkerstaat nicht bloß ein »Staat von Individu-en«, sondern von Völkern ist. Auch wenn folglich eine zentrale Bundesregierungexistiert, die in einigen Bereichen (Außen-, Steuer-, Finanzpolitik) über Zwangsgewaltverfügt, bewahren die einzelnen Staaten dennoch ihre staatliche Identität und teilwei-se auch ihre Autonomie und Souveränität. Dies lehrte das Beispiel der VereinigtenStaaten, die von einem Staatenbund ohne Bundesregierung (Kongress in Philadelphia,1774, der zu den 1777 verabschiedeten und 1781 in Kraft getretenen Articles of Fede-ration führte) zu einem Bundesstaat mit Zentralregierung übergegangen waren (Ver-fassungskonvent von Philadelphia, 1787). Nun war Kant mit dem amerikanischen Fallgut vertraut, führte ihn in der Metaphysik der Sitten sogar als Negativbeispiel an (undzeigte in diesem Fall, dass er den Völkerstaat klar von der Universalmonarchie unter-schied). Warum beharrt er also auf seiner Ablehnung des Völkerstaats und meint, erstehe im Widerspruch zur »Voraussetzung« der Staatenvielfalt? Tatsache ist, dass die»Voraussetzung«, von der Kant spricht, nicht theoretischer Natur ist, sondern aus ei-ner empirischen Betrachtung des Bestehenden entspringt. Sie deckt sich eher mit der»ypothesis«, von der – wie wir gesehen haben – die zeitgenössischen Staaten ausgehen,die nicht bloß ihre politisch-administrative Identität, sondern ihre Unabhängigkeitund absolute Souveränität bewahren wollen, im Gegensatz zur »thesis« der Vernunft,die für die Gründung eines Völkerstaats sprechen würde. Mit ihnen teilt Kant die»Voraussetzung«-»ypothesis«, dass die Souveränität absolut unteilbar sei: entwederman besitzt sie ganz oder es ist keine Souveränität.
02_Mori Seite 387 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant388
Dass Kant dieser naturrechtsphilosophischen Konzeption, die das Prinzip derabsoluten staatlichen Souveränität verteidigte, stark verhaftet blieb, obwohl er inanderer Hinsicht den Vertretern der Naturrechtsschule gegenüber kritisch einge-stellt war, beweist auch sein persönliches Exemplar des Jus naturae in usum audi-toru. Pars posterior von Gottfried Achenwall, der Text, den er als Handbuch für sei-ne Vorlesungen benutzte. In Buch IV lesen wir: »Quaelibet gens respectu alteriusgentis est persona moralis degens in statu naturali« (§ 210). Daraus folgt: »gentes om-nes sunt liberae et a se invicem indipendentes« (§ 214)6. Achenwall geht davon aus,dass die Völker, oder einige von ihnen, sich in einem dauerhaften internationalenBündnis (societas libera maior et aeterna, § 190) frei zusammenschließen, das entwe-der Zwangscharakter haben oder sich – was die eingehender analysierte Hypotheseist – auf eine Föderation (foederatarun rerum publicarum corpus, § 211) beschrän-ken kann7. Derlei Bündnisse fallen seiner Ansicht nach aber nicht unter das Natur-recht, das jeder Nation absolute Unabhängigkeit sowie das Recht verleiht, für ihreSelbsterhaltung zu sorgen, vorausgesetzt das Naturrecht wird dadurch nicht ver-letzt. Bedeutsamerweise hat Kant, der die von ihm verwendeten Texte gewöhnlichmit Randbemerkungen vollschrieb, wenn er nicht einverstanden war, an diesem Teilvon Achenwalls Handbuch nur wenige und eher unbedeutende Bemerkungen ange-bracht.
5. Ein Kompensationsversuch
Kant ist sich völlig darüber im Klaren, dass die Option für den Völkerbund undgegen den Völkerstaat eine Schwächung der Friedensgarantie bedeutet. Wahrschein-lich unternahm er deshalb seit 1793 einen Kompensationsversuch, indem er denMechanismus der Friedenssicherung weniger dem internationalen Organismus alsvielmehr der Umformung der inneren Verfassung der Einzelstaaten übertrug. Kantspolitisches Ideal war die republikanische Regierungsform, in der die Macht aus-schließlich nach dem Gesetz, und damit (wenigstens ideell) gemäß dem Volkswillenausgeübt werde. Gerade weil die republikanische Verfassung auf dem Volkswillenund nicht auf der Willkür des Despoten gründet, ist sie in seinen Augen tendenziellauf Frieden ausgerichtet.
»Wenn […] die Bestimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu be-schließen, ob Krieg sein sollte, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da siealle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten […], sie sich sehrbedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen« (VIII, 351, 4-11).
6 G. Achenwall, Juris naturalis pars posterior, complectens Ius familiae, Ius publicum etIus gentium in usum auditorum, in Kant‹s gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe),XIX, 419 e 421.
7 Vgl. Akademie-Ausgabe, XIX, 411 und 420.
02_Mori Seite 388 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 389
Die Friedenssicherung durch einen internationalen Organismus und das Eintre-ten für die republikanische Regierung sind zwei eng miteinander verknüpfte Polevon Kants rechtspolitischem Denken: Ohne republikanischen Geist (heute würdenwir sagen: ohne Demokratie) kann der Friede nicht gefördert werden, wie umge-kehrt der Republikanismus nicht ohne Frieden möglich ist. Nicht von ungefähr ver-kehrt sich jedoch das Ursache-Folge-Verhältnis zwischen beiden Faktoren im Ver-lauf der Kantischen Denkentwicklung. In der Idee von 1784, als er dem bindendenHandeln des internationalen Friedensbundes noch große Bedeutung beimaß – auchwenn er ihn nicht mit einer Zentralregierung gleichsetzte –, betrachtete Kant denVölkerbund als Voraussetzung für die Errichtung der republikanischen Verfassung:
»Das Problem der Errichtung einer vollkommnen bürgerlichen Verfassung istvon dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren ›Staatenverhältnisses‹ abhängigund kann ohne das letztere nicht ausgelöset werden« (VIII, 24, 2-5).
In der Schrift von 1795 kehrt Kant das Verhältnis dagegen um, nachdem er nun-mehr seine Kritik am Völkerstaat verschärft hat. Der erste Definitivartikel (undfolglich die erste Voraussetzung) für den ewigen Frieden lautet: »Die bürgerlicheVerfassung in jedem Staate muß republikanisch sein« (VIII, 349, 8). Erst der zweite,vom ersten abhängende Artikel fordert: »das Völkerrecht soll auf einen Föderalis-mus freier Staaten gegründet sein« (VIII, 354, 2).
Mit Sicherheit war diese gewandelte Orientierung durch den Gang der Französi-schen Revolution mitbeeinflusst worden, auf die Kant – als einer der wenigen Deut-schen seiner Zeit – auch nach Königsmord und Terror weiterhin seine Hoffnungensetzte.
»Die Ausführbarkeit (Objektive Realität) dieser Idee der Föderalität, die sichallmählig über allen Staaten erstrecken soll und zum ewigen Frieden hinführt,läßt sich darstellen. Denn wenn das Glück so fugt: daß ein mächtiges und aufge-klärtes Volk sich zu einer Republik (die ihrer Natur nach zum ewigen Friedengeneigt sein muß) bilden kann, so giebt diese einen Mittelpunkt der föderativenVereinigung für andere Staaten ab, um sich an sie anzuschließen und so den Frei-heitszustand der Staaten gemäß der Idee des Völkerrechts zu sichern und sichdurch mehrere Verbindungen dieser Art nach und nach immer weiter auszubrei-ten« (VIII, 356, 14-23).
Näher liegend ist aber, dass Kant die Gewähr für den Frieden, die er von einer aufder Voraussetzung der absoluten Souveränität der Staaten fußenden internationalenOrdnung nicht erwarten konnte, woanders – nämlich in der inneren Transformati-on der Staaten statt in ihrer äußeren Assoziation – zu suchen begann.
6. Realismus oder Utopie?
Kant ist ein revolutionärer Denker, was Erkenntnistheorie und Moral, was daspolitische Denken, aber auch was die Friedenslehre betrifft. Die Friedenspläne vor
02_Mori Seite 389 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant390
ihm machten gewöhnlich an den europäischen Grenzen Halt, waren in Wirklichkeitalso bloße Erweiterungen des Hobbes‹schen Modells, wobei man die pax civilis aufganz Europa ausdehnte und den Naturzustand außerhalb seiner Grenzen verwies.Mit Hilfe seiner universalistischen Vernunftauffassung gelingt es Kant dagegen, ei-nen die ganze Welt umschließenden Frieden zu denken. Was die Souveränitätsauf-fassung angeht, die er nicht anders als absolut und unteilbar zu denken vermag,bleibt er indes ein Kind seiner Zeit. Was den meisten heutzutage offensichtlich er-scheint, dass die Staaten sich nämlich einem Integrationsprozess, der unweigerlichdie fortschreitende Einbuße von »Stücken« von Autonomie und Souveränität mitsich bringt, nicht entziehen können, war für den »Naturrechtsphilosophen« Kantundenkbar – auch um den Preis, mit sich selbst, mit seiner Auffassung von Rechtund reiner praktischer Vernunft in Widerspruch zu geraten.
Es ist sicher nicht leicht, Lösungen für das Problem eines Weltföderalismus auf-zuzeigen, ohne in Utopie zu verfallen. Deshalb hat die Kritik sich häufig sehr nach-giebig gezeigt mit Kants Position, der gerade das Verdienst des Realismus zuerkanntwurde. Viele Interpreten betrachten Kants Option für den Völkerbund als eine Artvernunftbedingtes Sich-Abfinden mit einem leichter erreichbaren Ziel, während dieehrgeizigere Verwirklichung des Völkerstaats einer künftigen theoretischen Pers-pektive vorbehalten blieb. Diese Position birgt jedoch ein doppeltes Missverständ-nis. Erstens weil Kant an keiner Stelle schreibt, dass der Völkerbund vorerst die bes-sere Lösung sei. Im Gegenteil. Der Wortlaut der Texte zeigt unmissverständlich,dass er den Völkerbund (offenkundig im Sinn einer »Konföderation«) trotz der the-oretischen Überlegenheit des Völkerstaats für die endgültige Lösung hält, weil sieals einzige der »Voraussetzung« der Pluralität autonomer und unabhängiger Staatennicht widerspricht.
Aber es liegt ein zweites, noch weiter reichendes Missverständnis vor, das unmit-telbar Kants Realismus betrifft. Es stimmt ganz genau, dass Kant kein Utopist war,wenn wir Utopie in der – in Wahrheit ein wenig reduktiven – Bedeutung der Ver-wechslung von projekthafter Idealität und tatsächlicher Realisierbarkeit verstehen.In diesem Sinne war beispielsweise das Projet pour rendre la paix perpétuelle en Eu-rope (1713) des Abbé de Saint-Pierre utopisch, der glaubte, die Vernünftigkeit seinesProjekts sei eine sichere Gewähr für dessen Realisierung, es reiche also, an die Ver-nunft zu appellieren, damit ausgerechnet die absoluten, keiner Kontrolle unterwor-fenen Gewalthaber fürderhin zugunsten des normativen Prinzips auf Gewaltan-wendung verzichten würden. Kant war in diesem Sinne überhaupt kein Utopist,weil er den Abstand zwischen der faktischen Wirklichkeit und der Idealität seinesProjekts von Grund auf zu würdigen wusste. In der Metaphysik der Sitten erklärt erauf der selben Seite, wo er den Bund zur Erhaltung des Friedens auf einen perma-nenten Staatenkongress reduziert, unumwunden, dass der ewige Friede »freilicheine unausführbare Idee« (VI, 350, 17) sei. Doch das Bewusstsein vom Abstandzwischen Realität und Idealität, von der unüberbrückbaren Kluft zwischen Seinund Sein-Sollen, kann im transzendentalen System der Absolutheit der Norm kei-nen Abbruch tun, die allen praktisch-faktischen Erwägungen zum Trotz absolutbleibt.
02_Mori Seite 390 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant 391
»Also ist nicht mehr die Frage: ob der ewige Friede ein Ding oder Unding sei,und ob wir uns nicht in unserem theorethischen Urtheile betrügen, wenn wir daserstere annehmen, sondern wir müssen so handeln, als ob das Ding sei, was viel-leicht nicht ist…« (VI, 354, 25-29).
Kants »Realismus« besteht also nicht in der Akzeptanz von Kompromisslösun-gen, sondern in seiner Einsicht, dass die Absolutheit der Norm und ihre möglicheUnrealisierbarkeit (bzw. nur asymptotische Realisierbarkeit) durchaus vereinbarsind. Obwohl oder gerade weil das Imperativische der Norm von ihrer Realisierbar-keit unabhängig ist, kann es nämlich zum Leitkriterium für die Rationalisierung derWirklichkeit werden. Die Stärke von Kants rechtspolitischem Denken liegt im ab-soluten Wert des Normativen, das gerade dadurch konkret wirksam wird (also nichtutopisch ist), dass es die Kluft zwischen Realität und Idealität als unüberbrückbaranerkennt. Wie Kant selber uns gelehrt hat, brauchen wir für Überlegungen prag-matischer Art keine Philosophen, oder keine »moralischen Politiker«, welche diePolitik der Moral unterordnen, sondern es reichen die »politischen Moralisten«, diedie Theorie dem praktischen Nutzen anpassen.
Zusammenfassung
Kant dehnt das Vertragsmodell von der Ebene der Individuen auf die der Staatenaus. Nach der Meinung des Autors hätte Kant das Prinzip der heutzutage so ge-nannten domestic analogy aus systematischen Gründen rigoros anwenden sollen:Zur Analogie mit der bürgerlichen Gesellschaft sollte der internationale Friedensor-ganismus ein mit zentraler Regierung und zentraler Gewalt ausgestatteter »Völker-staat« sein. Aber Kant zieht ab 1795 immer entschiedener die Lösung des »Völker-bundes« vor, die die Autonomie und Unabhängigkeit der einzelnen Staatengarantiert. Die These des Aufsatzes ist folgende: Hinter dem von Kant festgestelltenlogischen Widerspruch zwischen dem Völkerstaat und dem Begriff des Völker-rechts steckt Kants Festhalten an der naturrechtlichen Tradition und am zeitgenos-sischen dogmatischen Prinzip der absoluten Staatssouveränität. Ab der Mitte derNeunziger Jahre fängt Kant deshalb an, lieber den Frieden vom inneren Republika-nisierungsprozess der Staaten zu erwarten als die Errichtung der republikanischenVerfassung von internationalen Friedensinstitutionen.
Summary
Kant extends the model of social contract from the individual to the internationallevel. The author‹s opinion is that, to be consistent with his transcendental philoso-phy of law, Kant should have strictly applied the principle of »domestic analogy«, astoday political scientists say. The international organization for peace should be areal »State of peoples« with a central government and a central power, in analogy tothe civil society. However, since 1795, Kant prefers the solution of the »Federationof peoples«, which warrants the autonomy and the independence of the single Sta-
02_Mori Seite 391 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
Massimo Mori · Friede und Föderalismus bei Kant392
tes. The article’s point is the following: Kant founds his refusal of the State of peop-les on its apparent logical contradiction with the concept of Law of nations, whichwould foreground a plurality of peoples; actually he cannot free himself from thetradition of Natural Law and from the dogmatic principle of absolute sovereigntyof States. Since the mid Nineties he begins to expect peace from the inward transfor-mations of States towards republican constitution instead of considering internatio-nal institutions for peace as committing republicanism.
02_Mori Seite 392 Donnerstag, 9. November 2006 1:17 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman
Türkei quo vadis?Determinanten türkischer Außenpolitik in Europa
und Asien
Die Türkei als Staat zwischen Europa, dem Nahen Osten und dem Kaukasusoder wie die türkischen Führungseliten ihr Land als eine Brücke zwischen Asienund Europa sowie den muslimischen und abendländischen Kulturen wahrnehmen,1
war und ist ein wichtiger Akteur in der internationalen Politik. In der Zeitperiodeseit dem Zerfall der Sowjetunion fanden bedeutende Änderungen in den oben ge-nannten Regionen statt. Während die ehemalig sozialistischen Staaten Osteuropasin dieser Zeitperiode versucht haben, eine gelungene Integration in die EuropäischeUnion (EU) zu verwirklichen und ihr politisches und ökonomisches System ent-sprechend den Aufnahmekriterien der EU zu transformieren, sind es nun seit derAuflösung der Sowjetunion im postsowjetischen Norden und Osten der Türkeineue, ehemals sowjetische, seit Beginn der 90er Jahren unabhängige Staaten, die inder neu entstandenen Konstellation ihre Eigenstaatlichkeit und ihre eigenen politi-schen Wege behaupten.
Die Türkei befindet sich aufgrund ihrer geographischen Lage in der Schnittstellezwischen diesen Regionen und mehr als das: sie ist Teil von ihnen. Deshalb ist sieständiger Beeinflussung durch die politischen Konstellationen in oben angesproche-nen Regionen, vor allem aber – aufgrund seines Gewichtes in der türkischen Au-ßenpolitik – durch Europa unterworfen. Die Veränderungen im regionalen Umfeldübten Einfluss auf die Außen, Innen- und Sicherheitspolitik des Landes aus, auf dieökonomische Entwicklung sowie auf die politischen Perzeptionen seiner Eliten. Esist ein Faktum, dass die Konstanten bzw. Bestimmungsfaktoren der türkischen Au-ßenpolitik, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des bipolareninternationalen Systems bestanden haben, nach dem Ende des Ost-West-Konfliktsihre Gültigkeit größtenteils verloren haben, und die Beziehungen der Türkei zu denoben erwähnten Regionen und zu ihren einzelnen Akteuren – vor allem in Europaund im postsowjetischen Osten – seit dem Ende des Kalten Kriegs neu geordnetwerden.
In dieser Abhandlung wird die türkische Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts behandelt. Herausgearbeitet und dargestellt werden Teilbereicheder türkischen Außenpolitik. Vor allem wird versucht, die grundlegende Frage zu
1 Insbesondere seit dem Amtseintritt der muslim-demokratischen AKP-Regierung wirdim außenpolitischen Kontext diese Funktion des Landes betont in Vordergrund gestellt.
03_Caman Seite 393 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?394
beantworten, nämlich ob die türkischen Entscheidungsträger mit ihrer neuen Regi-onalpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eine fundamentale Neuorien-tierung als Alternative zu ihrer traditionellen Europaorientierung zu verwirklichenbeabsichtigten und ob eine solche Chance in Wirklichkeit bestand. Ausgehend vondieser leitenden Frage wird versucht, die neue türkische Außenpolitik nach demEnde des Ost-West-Konflikts zu verorten.
Exogene Determinanten der Außenpolitik
Die neunziger Jahre könnten für die türkische Außenpolitik in vielerlei Hinsichtals eine prekäre Zeitperiode bezeichnet werden. Die Desintegration der Sowjetuni-on und die daraus folgenden Erschütterungen in der regionalen Umgebung derTürkei, die sich meistens in Form von neuen Instabilitäten, Konfliktpotenzialenund Konflikten sowie (außen)politischen und sicherheitspolitischen Unwägbarkei-ten manifestierten, beunruhigten die türkischen Entscheidungsträger und Füh-rungseliten vom Ende des Ost-West-Konflikts an zunehmend, da sie entsprechendder republikanischen Tradition an der Erhaltung des regionalen Status-quo aufGrundlage des Friedensvertrages von Lausanne2 interessiert waren, der nach demEnde des Ersten Weltkrieges nicht nur die innenpolitischen Parameter des Landes,sondern auch die außenpolitischen Reflexe und Denkweisen bestimmend beein-flusste. Das Ende des Ost-West-Konflikts brachte für das regionale Umfeld derTürkei jedoch alles andere als eine Garantie der Bewahrung des Status-quo.
Wie die Führungseliten in anderen Ländern der Region, vor allem aber in Euro-pa, waren auch die türkischen Entscheidungsträger von der unerwartet entstande-nen neuen Konstellation nach Ende des Ost-West-Konflikts überrascht. Die neueregionale Konstellation führte erstens zu Veränderungen der Rahmenbedingungender bisherigen Außenpolitik – dies impliziert vor allem die kontinuierliche Europa-politik des Landes mit dem Endziel des EU-Beitritts – und zweitens zur Gestaltungeiner neuen regional ausgerichteten Außenpolitik.
Es ist im Hinblick auf eine ganzheitliche Korrelierung und Bewertung von gro-ßer Bedeutung, die neue regionale Konstellation mit ihren Rahmenbedingungen imZusammenhang der türkischen Außenpolitik zu thematisieren. Das in dem Desinte-grationsprozess der Sowjetunion entstandene Vakuum jenseits der nordöstlichenGrenzen (türkisch-sowjetische Grenze) des Landes brachte neue exogene Einfluss-faktoren hervor, die im Prozess des Policy-Making von den türkischen Entschei-dungsträgern unbedingt mit berücksichtigt werden mussten. Dabei waren sie aller-dings überfordert, zumal das bestehende politische Vakuum alle Komponenten derinternationalen Konstellation permanent beeinflusste, d.h. es herrschte nach derDesintegration des Ostblocks intensive politische Wandlungsprozesse. Insbesonde-
2 Für die Bestimmungen des Friedensvertrages von Lausanne siehe Adnan San, Die Stel-lung der Türkei im Rahmen internationaler Verträge seit dem Ersten Weltkrieg, Göttin-gen 1963, S. 18f.
03_Caman Seite 394 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 395
re auf dem europäischen Kontinent sind neue Verhältnisse entstanden, die gewichti-ge Auswirkungen auf die politischen Entwicklungen in Westeuropa hatten. Vor al-lem realisierten die Führungseliten der EU eine neue, während des Ost-West-Konflikts undenkbar gewesene Dimension der europäischen Integration. Die EUwurde zu einem Gravitationszentrum für Osteuropa und setzte sich das ehrgeizigeund historische Ziel, ein politisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch vereinigtesEuropa zu verwirklichen, das es in der europäischen Geschichte bisher nicht gab.Seitdem befinden sich die ehemals sozialistischen osteuropäischen Staaten des War-schauer Paktes sowie die drei postsowjetischen baltischen Länder unter dem domi-nierenden Einfluss einer alternativlosen Systemtransformation und in einem Inte-grationsprozess mit der EU.
Das nach der Auflösung der Sowjetunion entstandene Vakuum löste auch imKaukasus und in Zentralasien gravierende Änderungen aus. Die Türkei wurde da-her wie die anderen Staaten in der Region tiefgreifend von diesen internationalenEreignissen beeinflusst. Alleine die Tatsache, dass sogar die gemeinsame türkisch-sowjetische Grenze durch die Desintegration der Sowjetunion verschwand und aufehemals sowjetischem Territorium drei neue Staaten entstanden, mit denen die Tür-kei nun jeweils eine Grenze hatte, zeigt das Ausmaß der Veränderung für die türki-sche Außenpolitik. Die Entstehung der neuen postsowjetischen Nationalstaaten imKaukasus und in Zentralasien war eine Entwicklung, die die türkischen Entschei-dungsträger nicht ignorieren konnten.
Die neue Konstellation, deren Folgen oben zusammengefasst wurden, brachte inihrer Anfangsphase aus der Perspektive der türkischen Außenpolitik simplifiziertausgedrückt zwei Ergebnisse von besonderer Relevanz mit sich. Zum einen verur-sachte sie einen gewissen Verlust der sicherheitspolitischen Relevanz der Türkei imHinblick auf die Interessen der westeuropäischen Staaten.3 Die Türkei rückte folg-lich in die äußerste Peripherie Europas, was die Haltung der EU-Staaten gegenüberder Türkei im Zusammenhang der türkischen Europaintegration nicht im Sinne dertürkischen Interessen beeinflusste. Zum anderen veränderte die neue Konstellationdie regionalen Konditionen und eröffnete neue außen-, kultur- und auch machtpoli-tische, aber auch außenwirtschaftliche Optionen für das Land.
Im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Folgen des Endes des Ost-West-Konf-likts waren türkische Führungseliten mit der oben erwähnten Problematik der au-ßenpolitischen Orientierung einer nun erforderlich gewordenen außenpolitischenNeugestaltungsnotwendigkeit konfrontiert, die nicht nur eine außenpolitischeNeubeurteilung der internatonalen Lage erforderte, sondern auch realistische Per-zeptionen bezüglich der neuen Konstellation verlangte.
3 Șule Kut: »The Contours of Turkish Foreign Policy in the 1990s« in: Barry Rubin, /Kemal Kirișçi, Turkey in World Politics. An Emerging Multiregional Power, Istanbul2002, S. 8. Siehe auch Kemal Kirișçi, »Uluslararası Sistemdeki Degișmeler ve Türk Dıș Politikasının Yeni Yönelimleri« in: Faruk Sönmezoglu (Hg.), Türk Dıș PolitikasınınAnalizi, Istanbul 1994, S. 393ff.
03_Caman Seite 395 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?396
Wandel der Perzeptionen
Die Beziehungen Europas zur Türkei wurden während des Kalten Krieges aus-schließlich aus geostrategischen und sicherheitspolitischen Blickwinkeln gerechtfer-tigt und begründet. Die Priorität, das westlich-freiheitliche Europa gegenüber derexpansionistischen sowjetischen Bedrohung zu schützen, bekräftigte die Positiondes südöstlichen NATO-Partners infolge seiner Funktion in der europäischen Si-cherheitsstruktur auch im Kontext der europäischen Integration.
Die Perspektive, an der europäischen Integration teilzunehmen, beinhaltete je-doch für die Türkei auch identitätsstiftende Funktionen. Die Eliten der RepublikTürkei gründeten und definierten das Land ganz im Sinne der europäischen Aufklä-rung als einen europäischen Staat. Es handelte sich bei der Europa-Orientierung umeine Entscheidung der türkischen Führungseliten und Intellektuellen. Die These dersich unter den besonderen Konditionen des Kalten Kriegs europäisierenden Türkenentspricht also nicht den historischen Tatsachen.4
Die Selbstperzeption der türkischen Eliten wurde von den europäischen Elitenvorwiegend nicht registriert. In Europa blieb die identitätsstiftende Rolle der Tür-ken als das Andere – meistens als Gegenteil des Europäerseins – erhalten, währendin der Türkei Europa als das Andere parallel zur zunehmenden Europäisierung undaußenpolitischen Europaorientierung der Türken überwiegend relativiert wurde.Die türkische Selbstperzeption gab bei der Intensivierung der Beziehungen der Tür-kei zu Europa relevante Impulse und motivierte die Entscheidungsträger des Lan-des ununterbrochen dazu, an den institutionalisierten Kooperationen in Europateilzunehmen.
Die neue Konstellation nach der Desintegration der Sowjetunion transformiertenicht nur die ehemals sozialistischen osteuropäischen Staaten, sondern auch die Per-zeptionsweise westeuropäischer Staaten. Das europäische Integrationsprojekt warnach dem Ende des Ost-West-Konflikts die Trägerin gesamteuropäischer Erwar-tungen.5 Ironischerweise entstanden erst nach der Entstehung dieser gesamteuropä-ischen Perspektive die Tendenzen in Europa, den Platz der Türkei in Europa infragezu stellen.
Chance einer neuen Regionalpolitik
Die neue Konstellation in der Region eröffnete neue außenpolitische Möglichkei-ten für die Türkei. Sie erforderte eine neue Bewertung und Beurteilung der neuenAusgangslage in der Regionalpolitik, in der nun auch endogene Determinanten, vorallem ideologischer Natur, zumindest bei den Perzeptionen türkischer Entschei-
4 Für die Einzelheiten dieser Position siehe z.B. Hans Arnold, Europa am Ende? DieAuflösung von EG und NATO, München 1993, S. 31.
5 Werner Weidenfeld, »Europa – aber wo liegt es? «, in: ders. (Hg.): Europa Handbuch,Bonn 1999, S. 19.
03_Caman Seite 396 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 397
dungsträger, Führungseliten und Intellektuellen eine Rolle zu spielen begannen. Indiesem Kontext stellte es sich heraus, dass die vorrepublikanische Vergangenheit desLandes auch im Zusammenhang mit der Haltung der Staaten in den benachbartenRegionen – z.B. auf dem Balkan, im Schwarzmeerraum, im Kaukasus und im Mitt-leren Osten – bei der Gestaltung der Regionalpolitik von nicht zu unterschätzenderBedeutung war, obwohl die offizielle Geschichtsschreibung der Republik das histo-rische und kulturelle Erbe ihres Vorgängers, des Osmanischen Imperiums, beinahevöllig ignorierte.
Das Ende des Ost-West-Konflikts beeinflusste die Perzeption der Führungselitenim Kindermannschen Sinne im Hinblick auf die Bewertung der Gegenwart und diePerzeption der Daseinslagen, auf die rückblickende Deutung geschichtlicher Ent-wicklungen sowie auf Zukunftstendenzen. Hierbei spielten das ideologische Drei-eck, der Kemalismus, der Islamismus und der Nationalismus, als endogene Deter-minanten der türkischen Außenpolitik eine einflussreiche Rolle. Einerseits bildendie Anhänger dieser Ideologien ab dem Beginn der neunziger Jahre einen Teil dergesellschaftlichen Pluralität in der politischen Landschaft des Landes und trugen indiesem Sinne zur neu entstehenden offeneren und toleranteren politischen Kulturbei. Andererseits – und noch wichtiger – scheinen die Ideologien nach dem Endedes Ost-West-Konflikts auch im außenpolitischen Kontext sowohl im Hinblick aufdie Bildung neuer Perzeptionen der türkischen Entscheidungsträger als auch dem-entsprechend im außenpolitischen Entscheidungsprozess des Landes wichtiger zusein. Die selektiv-subjektive Bestandsaufnahme der türkischen Entscheidungsträgerhängt auch mit den ideologischen Bestimmungsfaktoren zusammen.
Angesichts der gesellschaftlichen Pluralität verfügen die Ideologien in der Türkeinach dem Ende des Ost-West-Konflikts über genügend Nährboden für einen Evo-lutionsprozess. Die Transformation des Kemalismus und des Islamismus in Plural-form6 ist ein Indiz dieser positiven Entwicklung. Die Spannung zwischen den laizis-tisch orientierten Kemalisten und den das laizistische System des Landes zurelativieren beabsichtigenden Islamisten manifestierte sich als eine relevante endoge-ne Kodeterminante mit außenpolitisch nicht zu unterschätzenden Folgen. Währendder sozialdemokratisch tendierte Kemalismus – vor allem der CHP – sich in neunzi-ger Jahren nicht nur im innen- sondern auch außenpolitischen Kontext zunehmendzu einer Status-quo-Ideologie entwickelte, entfesselte sich der Islamismus der AKPzwar nicht völlig jedoch zunehmend von seinen fundamentalistischen Wurzeln. ImKemalismus als staatstragender Ideologie konkretisiert sich die früher eher marginalinterpretierbare Teilung in Staatskemalismus und alternative Kemalismen. Dennochbleibt der staatstragende Kemalismus die dominante Version dieser Ideologie undwird insbesondere vom Militär und von der Mehrheit der Bürokratie sowie von denlinksgerichteten Parteien (CHP und DSP) überwiegend konservativ interpretiert.
6 Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass es mehrere Islamismen gibt und daher dieIslamisten nicht als ein einheitlicher Block betrachtet werden sollten. Siehe hierzu PeterAntes, Der Islam als politischer Faktor, Bonn 1997, S. 92f.
03_Caman Seite 397 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?398
Der Konservativismus im an sich reformistisch und radikal-modernistisch orientier-ten Kemalismus scheint paradox zu sein, aber es ist im Kontext des Staatslaizismus-konzepts eine Tatsache, der im Endeffekt die staatliche Kontrolle der Religion vor-sieht, um deren Einfluss auf die Politik zu verhindern. In der Außenpolitik gewinntdas Gewicht des Kemalismus gerade in diesem innenpolitischen Kontext an Rele-vanz. Das Spannungsfeld zwischen den laizistischen Mächten (vor allem Militär,CHP und die Mehrheit der türkischen Bürokratie) einerseits und den islamistischenBewegungen wie der politischen Partei RP von Erbakan und der derzeit regierendenAKP von Erdo≤an andererseits veranlasste, ermöglichte, und rechtfertigte auch inden neunziger Jahren die permanente Einflussnahme des Militärs in Regierungsan-gelegenheiten. Das Paradox besteht darin, dass Staatskemalisten – vor allem das Mili-tär – das Laizismusprinzip als untrennbaren Bestandteil einer funktionierenden De-mokratie sehen und daher die Rolle des Militärs in der Politik als quasi-legitimbetrachten, da dadurch eine Garantie gegen die Islamisierung des politischen Sys-tems gewährleistet sei. Dabei begreifen sie den Laizismus als eine vom Staat ergriffe-ne Maßnahme gegen die Einflussnahme der Islamisten, und übersehen dabei den vielwichtigeren Prozesscharakter der sozialen Säkularisierung in der türkischen Gesell-schaft, die allerdings wiederum größtenteils als Verdienst des republikanischenStaatslaizismus begriffen werden soll. Der relevante Punkt in diesem Zusammen-hang ist die oben erwähnte Legitimation der Macht des Militärs. Genauso wie derethnische Separatismus im Südosten des Landes, der bis zur Mitte der 90er Jahre vonden türkischen Entscheidungsträgern und Führungseliten als eine ernsthafte sicher-heitspolitische Gefahr wahrgenommen wurde und daher die Rolle des Militärs – pa-rallel zu seiner Funktion in der Sicherheitspolitik – in den sicherheitspolitischen Fra-gen quasi rechtfertigte und legitimierte, trägt die aus Sicht der hochrangigenOffiziere systemfeindliche Tendenz der islamistischen Parteien wie RP von Erbakanund AKP von Erdo≤an zu den die Rolle des Militärs in diesem Kontext hinnehmen-den Perzeptionen der staatslaizistisch orientierten zivilen Mächten (vor allem derlinken Parteien) bei. Auch zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Organisationenund Einrichtungen im Lande – vor allem die Universitäten – betrachten den Laizis-mus als die wichtigste Säule der türkischen Demokratie und positionieren sich gegeneine islamistische Relativierung des säkularen Charakters des republikanischen poli-tischen Systems. Die Islamisten scheinen in der Tat trotz der negativen Erfahrungender Vergangenheit die Tendenz zur Förderung der Islamisierung einiger Politikfel-der, z.B. im Bereich der Bildungs- und Hochschulpolitik oder in der Geschlechter-politik, 7 nicht aufgegeben zu haben. Dennoch distanziert sich die eher muslimde-mokratisch8 und im Zusammenhang der türkischen Außenpolitik deutlich pro-europäisch orientierte AKP von Erdo≤an von der auch im außenpolitischen Sinne
7 Ein Beispiel in diesem Bereich bildet ihre negative Haltung gegenüber den staatlichenMaßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Frauen in allen Gesellschaftsberei-chen.
8 Dieser eher in Europa verwendete Begriff wird auch zunehmend in der türkischen Poli-tikterminologie, vor allem in den Tageszeitungen und anderen Medien, verwendet.
03_Caman Seite 398 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 399
islamistisch orientierten fundamentalistischen RP von Erbakan. Die Spitzenpolitikerder AKP, vor allem die zur ehemaligen zweiten Generation der islamistischen MSP-RP-Tradition gehörenden Führungseliten Erdo≤an und Gül, wollen als eine konser-vative zentralrechte Richtung in der türkischen Parteienlandschaft begriffen werden.Dies erfordert natürlich eine gewisse Transformation der Bewegung. Es lässt sich dieFrage nur in der Zukunft beantworten, ob es der AKP gelingt, sich von ihren eherfundamentalistisch orientierten Wurzeln (und Wählern) deutlicher zu distanzierenund sich zu einer muslimdemokratischen Partei zu transformieren, d.h. zu einer Par-tei, die Demokratie trotz ihrer muslimischen Wurzeln als Staatsform akzeptiert, unddie in der Parteienlandschaft des politischen Systems in der Türkei einen festen Platzhat. Islamistische Nuancen – wie bei der Thematik der Imam-Berufsschulen – fallenin der Exekutivpraxis der AKP-Regierung auf. Sie implizieren ein gewisses Kon-fliktpotenzial mit dem bestehenden säkularen politischen System des Landes unddessen Verfassung. Die AKP wird in Zukunft umso mehr politisches Gewicht erhal-ten, je mehr sie sich in das politische System des Landes integriert. Eine mit demSystem versöhnte muslim-demokratisch orientierte AKP könnte zur inneren Stabili-tät der Türkei viel beitragen. Dies würde die Position der Türkei in ihrer Rolle alsdemokratisches Beispiel für die anderen muslimischen Gesellschaften stärken.
Eine weitere außenpolitisch relevante ideologische Position stellt der Nationalis-mus als turkistische bzw. panturkistische Ideologie dar. Der Turkismus oder Pan-turkismus, der entstehungsgeschichtlich bis zum Desintegrationsprozess des Osma-nischen Imperiums zurückverfolgt werden kann, gewann nach der Entstehung derpostsowjetischen Turkrepubliken in der außenpolitischen Praxis an Bedeutung. Der(Pan)Turkismus als Gedankengut, der einerseits infolge der antikommunistischenbzw. anti-linken Tendenz seiner Anhänger – vor allem der MHP und ihrer pro-fa-schistischen bzw. rechtsextremistischen Grauen Wölfe – und aufgrund der realpoli-tischen Lage der turksprachigen Völker in der Sowjetunion während des Ost-West-Konflikts bis in die neunziger Jahre eher als eine reaktionäre und rechtsextremisti-sche politische Position bezeichnet werden kann9 und andererseits das politischeSystem nach dem Staatsstreich von 1980, insbesondere aber die Bildungspolitik,zum Teil dominierend beeinflussen konnte, wurde gleich nach der Desintegrationder Sowjetunion zu einer endogenen Determinante der türkischen Regionalpolitikim Kaukasus und in Zentralasien. Zahlreiche (pan)turkistische Entscheidungsträgerder konservativen Mitte-Rechts-Parteien (der DYP und der ANAP) übten Einflussauf die öffentliche Perzeption in der Türkei bezüglich der Turkvölker aus.(Pan)Turkistische Bezüge wie die sprachlichen, kulturellen, historischen oder religi-ösen Gemeinsamkeiten zwischen den Türken und den postsowjetischen Turkvöl-kern wurden von führenden türkischen Politikern wie Özal oder Demirel sowieauch von anderen politischen Führungseliten – unter anderen auch den linken Poli-tikern wie Ecevit – auch im Kontext der türkischen Beziehungen zu den postsowje-
9 Für die Einzelheiten vgl. Tanıl Bora, / Kemal Can, Devlet, Ocak, Dergah. 12 Eylül’den1990’lara Ülkücü Hareket, Istanbul 1994.
03_Caman Seite 399 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?400
tischen Turkrepubliken ausgesprochen. Es ist möglich, in der türkischen Kulturpo-litik im Kaukasus und in Zentralasien latente (pan)turkistische Tendenzenfestzustellen, obwohl die türkischen Entscheidungsträger dies bisher stets katego-risch verneint haben. Auch realpolitisch nicht zu verwirklichende Tendenzen, enge-re Kooperationen mit den Turkrepubliken zu realisieren, erscheinen einen latent(pan)turkistischen Charakter zu implizieren. Es muss jedoch darauf hingewiesenwerden, dass der Panturkismus infolge des osmanischen Expansionismus im ErstenWeltkrieg und dessen tragischen Folgen in der alltäglichen türkischen Politiktermi-nologie mit seinem irredentistischen und expansionistischen Charakter im Vorder-grund steht, wovon sich die republikanischen Entscheidungsträger bewusst distan-zieren. Doch wie oben dargelegt, existieren in der ideologischen Kategorie der(Pan)Turkismen zahlreiche Tätigkeitsfelder. Im Bereich der Kultur bzw. der aus-wärtigen Kulturpolitik lässt sich der (Pan)Turkismus als politische Instrumentalisie-rung der kulturellen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten und deren gezielte För-derung definieren. Die türkische Unterstützung der Einführung des lateinischenAlphabets in den Turkrepubliken, um die bestehenden Gemeinsamkeiten zwischendem Türkischen und den Turksprachen durch eine gezielte sprachliche Annäherungzu fördern, ist ein Beispiel dafür. Durch diese außenpolitische Instrumentalisierungdes (Pan)Turkismus begründeten die türkischen Entscheidungsträger die intensivenBeziehungen zu den postsowjetischen Turkrepubliken, die im Rahmen der neuenRegionalpolitik einen besonderen Platz einnahmen.
Rolle des innenpolitischen Erbes in der Außenpolitik
Die zivilen türkischen Entscheidungsträger waren im Analysezeitraum auch mitden Schwierigkeiten des innenpolitischen Erbes des Staatsstreichs von 1980 kon-frontiert. Durch die verfassungsmäßige Ermächtigung des Nationalen Sicherheits-rats (NSR) als ein quasi-exekutives Organ,10 in dem die militärischen Mitglieder ge-genüber den Regierungsmitgliedern lange Zeit zahlenmäßig überlegen und vorallem gleichberechtigt in einem Gremium saßen, ermöglichte dem Militär ein insti-tutionalisiertes Mitspracherecht. Das Militär konnte dadurch lange ein latentes Ve-toregime im Sinne von Hale anwenden.11 Dieser Zustand wurde auch in den regel-mäßigen Berichten der EU als eine Anomalie bezeichnet, weil die Macht derExekutive von der Staatsbürokratie relativiert wurde.12 Es entstand ein Spannungs-feld zwischen den Gewählten (Regierung und Parlament) und den Ernannten (Mili-tär und Staatsbürokratie).
10 George Harris, The Role of the Military in Turkey in the 1980s: Guardians or Decision-Makers? in: Metin Heper / Ahmet Evin, (Hg.), State, Democracy and the Military,New-York & Berlin 1988, S. 177-200.
11 William Hale, Turkish Military and Politics, London 1994.12 Siehe Regelmäßiger Bericht der EU-Kommission. Über die Fortschritte der Türkei auf
dem Weg zum Beitritt, (1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003)
03_Caman Seite 400 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 401
Diese Entwicklung hatte konkrete negative Folgen bezüglich der Rechtsstaatlich-keit und demokratischer Grundordnung. Dieses vom Militär dominierte Konzeptspiegelt sich vor allem beim erweiterten Begriff der Sicherheit in der politischen Pra-xis des Landes wider. Demnach wird die Außenpolitik, deren Kern nach diesemKonzept die Sicherheitspolitik bildet, überwiegend als ein überparteiisches und na-tionales Politikfeld betrachtet,13 in dem die dominante Rolle des NSR verfassungs-rechtlich vorgesehen war. Einige außenpolitisch relevante Themen wie die türkischeZypernpolitik, Politiken bezüglich der Frage des kurdischen Separatismus undinsbesondere Irak- und Armenienpolitik der Türkei gehörten lange zum Kom-petenzbereich des militärisch dominierten NSR. Natürlich bedeutete diese Entpo-litisierung der Außenpolitik und anderer Politikbereiche zweifelsohne eineoffensichtliche Einschränkung der Machtkompetenz der Regierung. Bis zu denjüngsten Reformen zur Erfüllung der EU-Beitrittskriterien dauerte diese Funktiondes NSR.
Seit Mitte der neunziger Jahre bis 2004 wurden zahlreiche Artikel der türkischenVerfassung von 1982 mitsamt ihrer Präambel revidiert und neu geschrieben. Nachden parallel zu diesen Verfassungsreformen durchgeführten demokratisierendenReformpaketen wurde vor allem der NSR weitgehend von einem Organ im Ent-scheidungszentrum zu einem beratenden Gremium ohne politische Kompetenzentransformiert. Dadurch wurde die Legitimität der dualen Struktur des türkischenEntscheidungszentrums zumindest de jure beendet und somit wurden 2004 nach ei-nem diesbezüglichen Bericht der EU-Kommission formell die EU-Kriterien vonKopenhagen erfüllt. Auch in der politischen Praxis wird seit der Neugestaltung desNSR eine Änderung des Verhältnisses zwischen der Regierung und dem Militär be-obachtet.
Es lässt sich also feststellen, dass in diesem Prozess der Einfluss des Militärs par-allel zu den demokratisierenden Reformen kontinuierlich abnimmt. Im außenpoliti-schen Zusammenhang ist diese Entwicklung insbesondere im Prozess der türki-schen Integration in die EU von großer Bedeutung, zumal das entpolitisiertePolitikfeld Außenpolitik von seinem militärisch dominierten Charakter befreit, diezivile Kontrolle in diesem Politikfeld gewährleistet und somit eines der problema-tischsten Bereiche im EU-Beitrittsprozess der Türkei weitgehend beseitigt wurde.Die Zyperngespräche im April 2004 zeigten deutlich, dass die Regierung – vor alleminfolge der Neugestaltung des NSR – in der Lage ist, sogar bei der sicherheitspoli-tisch höchst sensiblen Thematik Zypern den politischen Willen auch gegen abwei-chende Perzeptionen der Armeeführung im NSR durchzusetzen und die Verant-wortung der resultierenden politischen Entscheidungen alleine zu tragen. Daherdarf dieser Schritt in der politischen Praxis nicht unterschätzt werden. Bisherscheint auch die Armeespitze ihre neue entpolitisierte Rolle akzeptiert zu haben.
13 Gencer Özcan, »Türkiye’de Siyasal Rejim ve Dıș Politika (1983-1993)«, in: Faruk Sön-mezoglu, Türk Dıș Politikasının Analizi, Istanbul 1994, S. 293-315.
03_Caman Seite 401 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?402
Die Vorbereitung der Türkei auf den Beitritt zur EU im Rahmen der Beitritts-partnerschaft fördert nicht nur den Reformprozess zur Demokratisierung, sondernsie zwingt auch alle Führungseliten des Landes, darunter auch die militärischenFührungseliten, in der Praxis zu einem Wandel ihres politischen Verhaltens. Esbleibt abzuwarten, wie dieses neue Entscheidungszentrum, in dem das Militär überkeine legitime oder legale politische Rolle oder Einflussmöglichkeit mehr verfügt, inder politischen Praxis funktionieren wird. Die Transformation im politischen Sys-tem des Landes und vor allem in der Funktionsweise der Entscheidungsprozessebirgt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen den Zivilen und den Mili-tärs, doch angesichts des bisher verwirklichten Demokratiestandes der Türkei undder zunehmenden Einflussnahme Europas in der türkischen Innenpolitik parallelzur zunehmenden Integration der Türkei in die EU wird die Möglichkeit eines Ab-bruchs der demokratischen Ordnung in der Türkei durch eine militärische Inter-vention ziemlich unwahrscheinlich.
Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union
Die türkische Integration in die EU ist eines der aktuellen Themenbereiche dertürkischen Außenpolitik. Der gesellschaftliche Konsens in der Türkei, die EU-Mit-gliedschaft zu verwirklichen, spielt insbesondere seit dem Gipfel von Helsinki(1999), an dem die Türkei von der EU als Beitrittskandidat anerkannt wurde, in dertürkischen Innenpolitik eine zunehmende Rolle. Der Prozess der Beitrittsvorberei-tung fördert – als Instrument der EU wie bei anderen Beitrittskandidaten – den De-mokratisierungsprozess in der Türkei.
Die Beziehungen der Türkei zu Europa einerseits und die EU-Kandidatur diesesLandes andererseits kann man als Kontinuität der türkischen Außenpolitik bezeich-nen. Vor allem in der Außenpolitik der republikanischen Geschichte vom Ende desZweiten Weltkriegs bis heute wird in der Tat eine unübersehbare Europäisierungder Türkei und kontinuierliche Integrationspolitik mit den westlichen bzw. europä-ischen Kooperationsformen festgestellt. Sicherlich ist die EWG/EG/EU-Mitglied-schaft und diesbezügliche Politik der Türkei der wichtigste Bestandteil der außen-politischen Orientierung. Die EU-Orientierung der Türkei hat aus türkischerPerspektive zahlreiche Dimensionen. Die geographische Lage des Landes zwischenEuropa, dem Kaukasus, dem nordöstlichen Mittelmeer, der Schwarzmeerregionund dem Nahen Osten sowie der identitätsbezogene kulturelle Dualismus zwischenislamischen Wurzeln und moderner europäischer Identität spielen nicht nur in Be-zug auf die innenpolitischen Verhältnisse, sondern auch in den Beziehungen zwi-schen der Türkei und der EU eine relevante Rolle.
Dies hat historische Gründe: Interaktionen zwischen dem Osmanischen Reichund den anderen europäischen Mächten sowie die Französische Revolution undihre politischen sowie kulturellen Folgen beeinflussten sowohl die Führungselitenund Intellektuellen der osmanischen Gesellschaft wie auch infolge der Entstehungder Nationalismen das Schicksal des Imperiums selbst. Gesellschaftliche Bereichewie das Militärwesen (europäische Neugestaltung und Lehrprogramme), das politi-
03_Caman Seite 402 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 403
sche System (Relativierung des Absolutismus und Teilung der Macht mit dem Par-lament), das Rechtssystem (Relativierung der islamischen Gesetzgebung und Ein-führung der europäischen Gesetze), das Schulsystem (Modernisierung der Schulen)etc. wurden ab dem 18. Jahrhundert von europäischen Entwicklungen und von Eu-ropa selbst immer stärker beeinflusst.14 Dies setzte in der osmanisch-türkischen Ge-schichte zugleich eine von Oben geleitete Modernisierung in Gang, die von denführenden Gesellschaftsschichten gefördert und von der Bevölkerung überwiegendverinnerlicht wurde.
Diese tradierte reformistische und europäisierende Haltung der türkischen Füh-rungsschichten wurde von den Gründern der republikanischen Türkei ererbt. DieAnalyse der republikanischen Geschichte der Türkei lässt zweifelsohne feststellen,dass die Republik Türkei auf die ideelle Grundlage der europäischen Aufklärunggegründet wurde. Die Überreste islamischer Referenz(quellen) in der Politik, imRechtswesen – sowohl im Sinne der Gesetzgebung, als auch in der Rechtspraxis –und im öffentlichen Leben (d.h. in der nichtreligiösen Sphäre) wurden durch dieRepublikgründung auf revolutionäre Weise abgeschafft und die Rolle der Religi-on(en) durch den Staatslaizismus auf das Privatleben des Individuums beschränkt.Durch die Gründung der Republik im Jahr 1923 erfolgte eine rasche Europäisie-rung.
Außenpolitisch ist die Türkei wie ihr Vorgänger ein Teil der europäischen Staa-tenwelt. Während des Zweiten Weltkriegs agierte die Türkei trotz der Neutralitäts-politik ihrer Entscheidungsträger als ein europäischer Staat. In diesem Sinne war dieBeteiligung oder Nicht-Beteiligung der Türkei am Zweiten Weltkrieg eine europäi-sche Frage, die für die Entwicklung des Kriegs in Europa von großer Bedeutungwar. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie ebenfalls Teil der NachkriegsordnungEuropas: sie erhielt beispielsweise eine Wirtschaftshilfe im Rahmen der Truman-Doktrin (1947) und wurde von den USA und von ihren europäischen Verbündetenals Teil des (west)europäischen Staatensystems angesehen.15 Nach der Konkretisie-rung der sowjetischen Expansionspolitik gegenüber der Türkei zeigten auch die tür-kischen Entscheidungsträger ein deutliches Interesse, mit den USA und Westeuropain der Sicherheits- und Militärpolitik eng zu kooperieren. Die türkische Rolle imOst-West-Konflikt in Südosteuropa und in der nordöstlichen Mittelmeerregiontrug erheblich zur westeuropäischen Sicherheit bei und verstärkte die Selbstperzep-tion der Türken als Europäer weiter, was den intensiven Kooperationen mit Euro-päern im Bereich der Sicherheitspolitik und zunehmend auch in wirtschaftlichenund politischen Bereichen entsprach.
Da diese sicherheitspolitische Notwendigkeit der türkischen Integration in Euro-pa nicht mehr bestand, erhielt die Türkei von der EG/EU zu Beginn der 90er Jahre
14 Für die Einzelheiten siehe Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London1968.
15 Für die türkische Außenpolitik in diesem Zeitraum siehe Hüseyin Bagcı, Die türkischeAußenpolitik während der Regierungszeit Menderes von 1950 bis 1960, Bonn 1988, S.11ff.
03_Caman Seite 403 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?404
keine konkrete Beitrittsperspektive, während den ehemalig sozialistischen StaatenOsteuropas von der EU in absehbarer Zeit ein sicherer Platz in der künftigen Unionreserviert wurde. Aufgrund dieser Tatsache musste sich die Türkei nun auf Teilbe-reiche der Integration mit der EU konzentrieren, um von der europäischen Integra-tion nicht vollständig ausgeschlossen zu werden. In diesem Zusammenhang er-schien die Intensivierung der bestehenden Integration im Rahmen der EU-Zollunion auf der vertraglichen Grundlage des EWG-Türkei-Assoziationsabkom-mens von Ankara (1963) ein alternativer Weg zu sein, eine Art Sonderbeziehung zurEU zu etablieren mit der Hoffnung, durch den ökonomischen Spill-Over-Effektkünftig in weiteren Politikfeldern besondere Integrationsmöglichkeiten zu erhaltenund Beziehungen zur Union weiter zu intensivieren. 1995 wurde nach langwierigenVerhandlungen der Vertrag der Zollunion unterzeichnet, und 1996 trat die Türkeider Europäischen Zollunion bei. Im Hinblick auf die Demonstration der türkischenEU-Orientierung war der Beitritt in die EU-Zollunion – ohne jedoch an Entschei-dungsmechanismen der EU teilnehmen zu können, d.h. ohne zuvor Vollmitglied zuwerden – von weitreichender politischer Relevanz, da die Türkei im Rahmen dieserbesonderen Beziehung zur EU auf gewisse Souveränitätsrechte einseitig verzichtethat. Dadurch übernahm die Türkei als erster Staat den EU-Außenzolltarif für dritteStaaten, ohne zuvor der EU beigetreten zu sein.16
Die türkischen Entscheidungsträger und Führungseliten definierten zu dieserZeit die Aufnahme ihres Landes in den Kreis der offiziellen EU-Anwärter bzw. dieoffizielle Beitrittskandidatur als primäres außenpolitisches Ziel in der Europapoli-tik. Die Staats- und Regierungschefs der Union tendierten jedoch dazu, die Türkeinicht als Beitrittskandidat anzuerkennen und Zugeständnisse für die Entwicklungder Beziehungen in Richtung Vollmitgliedschaft zu machen, aber andererseits – wiedurch die Zollunion mit der Türkei – das »prowestliche Land« mit politischenSchritten in einer Art Sonderbeziehung an Europa zu binden, da im Hinblick aufdie europäische Sicherheitspolitik und auf seinen wachsenden konsumorientiertenBinnenmarkt ein Land wie die Türkei relevant war. Zahlreiche Regierungen in derEU – z.B. die damalige Bundesregierung und der Bundeskanzler Kohl – nahmen dieTürkei als ein Land wahr, das trotz seiner partiellen Zugehörigkeit zu Europa keinkultureller Teil Europas ist. Diese die Türkei aufgrund der Religion, Kultur undGeschichte ablehnende Position der Christdemokraten in der EU führte 1997 zu ei-ner Erklärung der Europäischen Volkspartei, dass die Türkei nicht als EU-Kandidatin Frage käme, da sie als islamisches Land über andere kulturelle Werte verfüge unddaher nicht zur europäischen Zivilisation passe.17 Diese Huntington’sche Denkwei-se dominierte die damalige EU und mündete nach dem EU-Gipfel von Luxemburgim Jahr 1997 in die bisher tiefste Krise in der Geschichte der türkisch-europäischen
16 Șefik Alp Bahadir, »Die Zollunion der Türkei mit der Europäischen Union – ein Schrittauf dem Weg zur Vollmitgliedschaft?« in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 11-12/97, 7.März 1997, S. 33-40; S. 33ff.
17 Süddeutsche Zeitung vom 22. März 1997.
03_Caman Seite 404 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 405
Beziehungen. Die Krise nach Luxemburg zeigte, dass Perzeptionsunterschiede inden türkisch-europäischen Beziehungen ein ernst zu nehmendes Konfliktpotentialbilden.
Derartige Perzeptionsunterschiede zwischen den türkischen Führungseliten undden europäischen Entscheidungsträgern existierten zwar, wie oben angesprochen,auch während des Ost-West-Konflikts, aber sie beeinflussten die sicherheitspoli-tisch definierte Lage der Türkei im westlichen Bündnis – also auch in Europa –während des Ost-West-Konflikts nicht auf bestimmende Weise. Darüber hinauswar die Türkei aus Sicht der europäischen Entscheidungsträger zum einen ange-sichts ihrer ökonomischen und politischen Lage von einem Beitritt weit entferntund zum anderen erforderten die außerordentlich wichtige Rolle des Landes imOst-West-Konflikt sowie die Rahmenbedingungen der europäischen Konstellationauf dem geteilten Kontinent nicht unbedingt eine Manifestation und Verdeutli-chung derartiger Perzeptionsunterschiede. Die europäischen Entscheidungsträgerbetrachteten die Türkei zwar aus realpolitischen Gründen immer als einen zuverläs-sigen Partner im Rahmen der blockgebundenen euro-atlantischen Sicherheitspolitikund unterstützten sie aus diesem Blickwinkel auch bei der Frage ihrer Europaorien-tierung, sie nahmen sie sogar im Zusammenhang der Erweiterung zusammen mitanderen euromediterranen Ländern wie Griechenland, Spanien oder Portugal wahr,die ähnliche ökonomische und soziopolitische Probleme hatten, aber die Europain-tegration der Türkei konnte nicht wie bei anderen euromediterranen Ländern zumBeitritt führen.
Die Türkei fand sich insbesondere bezüglich ihrer innenpolitischen Lage auf dieneue internationale Konstellation nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ziemlichunvorbereitet: das Erbe der Militärregierung zwischen 1980-1982 und die als dessenFolge verabschiedete Verfassung von 1982 verhinderten bzw. verlangsamten denDemokratisierungsprozess in der Türkei und verursachten eine ernsthafte Instabili-tät in der türkischen Innenpolitik. Von Beginn der 80er Jahre an wurde diese Pro-blematik zu einem der wesentlichen Themen in den türkisch-europäischen Bezie-hungen, das wegen seiner Relevanz zunehmend eine ausschlaggebende Rolle zuspielen begann.
Während es in den 90er Jahren den ehemals sozialistischen mittel- und osteuro-päischen Staaten gelang, ihre politischen und wirtschaftlichen Transformationspro-zesse erfolgreich abzuschließen und von der EU konkrete Beitrittsperspektiven an-geboten zu bekommen, erwiesen sich die türkischen Fortschritte vorwiegend alsungenügend. Die fehlende konkrete Beitrittsperspektive der Türkei erwies sich indiesem Zusammenhang äußerst kontraproduktiv. Die Türkei gehörte zu dieser Zeitoffensichtlich nicht zu den Prioritäten der EU-Erweiterung.
Die türkischen Entscheidungsträger und Führungseliten waren mit dem Problemkonfrontiert, dass ihr Land in Europa zunehmend an die Peripherie gerückt wurde.Die Desintegration der Sowjetunion sowie die Befreiung – und Europaorientierung– ihrer Satellitenstaaten in Osteuropa ermöglichte der EU, neue Visionen für die po-litische Gestaltung des europäischen Kontinents zu entwickeln und zum Teil zurealisieren, wobei die geographische Entfernung der Türkei von Kerneuropa sich
03_Caman Seite 405 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?406
bezüglich der türkischen Interessen weitgehend als nachteilig erwies. Die neuen Di-mensionen der europäischen Integration sahen neben der Vertiefung der wirtschaft-lichen Integration auch den zunehmenden Ausbau der politischen, außen- und si-cherheitspolitischen Komponente vor und verstärkten die Position der EU in derWeltpolitik. Von dieser neuen integrationspolitischen Gewichtung der EU dürftesich die Türkei aus Sicht der türkischen Entscheidungsträger vor allem aufgrund ih-rer intensiven ökonomischen, politischen und sicherheitspolitischen Beziehungennicht isolieren. In diesem Sinne wurde der Wertverlust des Landes in Bezug auf dieeuropäische Integration von den türkischen Entscheidungsträgern als eine äußerstnegative außenpolitische Ausgangslage und Entwicklung bewertet. Die Entschei-dung von Luxemburg (1997) wurde vom amtierenden Regierungschef Yilmaz alsDiskriminierung bezeichnet.
Die aus türkischer Sicht diskriminierende Politik der EU gegenüber der Türkeiwurde quer durch alle Gesellschaftskreise, in Hochschulen, von nichtstaatlichenOrganisationen und von allen Proeuropäern scharf kritisiert. Die Enttäuschung dertürkischen Eliten war immens. Auch in der EU löste die unerwartete Reaktion derTürkei neue Diskussionen über die EU-Türkei-Beziehungen aus und setzte einenpolitischen Denkprozess in Gang. Eine Normalisierung der Beziehungen gelangerst nach dem Beschluss der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten derUnion auf dem EU-Gipfel von Helsinki. Die dort getroffene Entscheidung, dieTürkei offiziell zum Beitrittskandidaten der EU zu erklären und ihre Kandidaturauf der Grundlage der dafür allgemein gültigen Prinzipien und Kriterien zu bewer-ten, bestätigte die klare Beitrittsperspektive der Türkei und nahm das Land in denErweiterungsprozess der EU auf. Die Entscheidung in Helsinki bestätigte die Zuge-hörigkeit der Türkei zu Europa und verdeutlichte die strategischen Interessen derEU an einer Integration der Türkei.18 In Helsinki erklärten Premierminister Ecevit(DSP) und der Außenminister Cem (DSP), die notwendigen Reformen zur Erfül-lung der EU-Beitrittskriterien von Kopenhagen energisch voranzutreiben, um dieAnpassung der Türkei an die EU-Normen zu beschleunigen. Der Reformprozessvon 1999 bis Mitte 2004 brachte praktisch eine neue Verfassung hervor, die entspre-chend den EU-Normen die Grundordnung einer europäischen Rechtsstaatlichkeiterfüllt. Ausgehend von diesen Verfassungsreformen fand in der Türkei eine politi-sche Systemtransformation statt, die die letzten undemokratischen Bestandteile derOrdnung von 1982 abschaffte. Die politischen Beitrittskriterien von Kopenhagenwurden bis dato de jure weitgehend erfüllt. Auch die EU deutete bereits 2002 aufdie Erfüllung der wesentlichen Prioritäten der Beitrittspartnerschaft hin. Aufgrunddieser positiven Entwicklungen eröffnete die EU 2005 Beitrittsverhandlungen mitder Türkei – trotz ihres betonten ergebnisoffenen Charakters – mit dem einzigenZiel: Vollmitgliedschaft.
18 Ian O. Lesser, »Turkey in a Changing Security Environment«, in: Journal of Internatio-nal Affairs, Herbst, 54/2000, S. 183-198; S. 188.
03_Caman Seite 406 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 407
Die klare Beitrittsperspektive der Türkei beschleunigte, wie oben angedeutet, dentürkischen Demokratisierungsprozess und bestätigte nochmals die stabilisierendepolitische Rolle der EU in Europa. Nicht nur im Hinblick auf die innenpolitischenVerhältnisse der Türkei, sondern auch auf die Außenpolitik des Landes wurde zwi-schen 1999-2004 der Einfluss der EU deutlich. Die türkische Haltung nach der US-amerikanischen Invasion im Irak, d.h. der Dritte Irakkrieg, die deutliche Entspan-nung und der initialisierte Dialog in den türkisch-griechischen Beziehungen undvor allem der neue außenpolitische Kurs der Türkei in der Zypernfrage sind diegreifbarsten Ergebnisse der türkischen Außenpolitik, in denen die Beeinflussungder EU am konkretesten feststellbar sind. Die Zustimmung zum Plan der UN zurWiedervereinigung Zyperns wäre für die türkischen Entscheidungsträger ohne dieklare EU-Beitrittsperspektive der Türkei undenkbar gewesen. Diese Kursänderungder Türkei reichte zwar nicht für die Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel vordem Beitritt des griechischen Teils zur EU, aber sie entspannte den Konflikt undstärkte die Positionen der EU und der UN. Von daher ist die wachsende Rolle derEU in der Konfliktkonstellation im nordöstlichen Mittelmeer als positiv zu bewer-ten. Die Entspannung in dieser Region zwischen dem EU-Mitglied Griechenland,dem neuen Mitglied der Union Zypern (de facto nur griechischer Teil) und demEU-Beitrittskandidaten Türkei demonstriert die Möglichkeiten der europäischenGASP in ihren Grenzregionen.
Die Türkeipolitik der EU birgt trotz der diesem Land angebotenen Beitrittspers-pektive einige Konfliktpotenziale. Diese hängen mit europäischen Türkei-Perzepti-onen zusammen. In Europa wird die Türkei aufgrund ihrer mehrheitlich muslimi-schen Bevölkerung nicht als ein natürlicher Europäer wahrgenommen. Zahlreicheeuropäische Politiker vertreten ihre Turkofobie im Kontext der europäischen Eini-gung ohne Bedenken.19 Einige politische Parteien und Führungseliten in Deutsch-land und Frankreich fordern energisch die Revidierung des Status der Türkei alsBeitrittskandidat und beabsichtigen, den türkischen Beitritt zu verhindern odermöglichst zu verzögern, selbst wenn die Türkei politisch und wirtschaftlich für ei-nen Beitritt bereit wäre. Die christdemokratisch-konservativ orientierten Kräfte inEuropa wollen der Türkei anstatt einer Vollmitgliedschaft eine Art Sonderbezie-hung mit der EU anbieten. Trotz der bereits begonnenen Beitrittsverhandlungensteht diese die Türkei aus der europäischen Integration ausschließende Idee nochauf der Tagesordnung und verfügt über Potenzial, die Agenda der EU bezüglich ih-rer Türkeipolitik jederzeit zu ändern.
Die angebotene Sonderbeziehung wird jedoch von den türkischen Führungseli-ten als eine höflich formulierte Ablehnung des türkischen Beitritts zur EU wahrge-nommen. Diese Position, die als Zollunion plus zusammengefasst werden kann, istzwar derzeit nicht die offizielle Türkeipolitik der EU, sie muss allerdings im Zu-sammenhang mit den möglichen Entwicklungstendenzen der türkischen Integrati-
19 Vgl. Thomas Meyer, Die Identität Europas. Der EU eine Seele?, Frankfurt am Main2004, S. 148.
03_Caman Seite 407 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?408
on in die EU mit einkalkuliert werden. Fakt ist, dass die Führungseliten aller Partei-en des Landes eine Sonderbeziehung zwischen der Türkei und der EU einheitlichkategorisch ablehnen. Diesbezüglich gibt es also landesweit einen weitgehendenKonsens. Es ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten, dass die türkischen Ent-scheidungsträger ihre politische Haltung gegenüber Alternativen der EU-Vollmit-gliedschaft ändern. Im Falle einer Revidierung der EU-Entscheidung, die Türkei alszukünftiges Mitglied zu betrachten, könnten daher ernsthafte Belastungen in denTürkei-EU-Beziehungen herbeiführen. Es wäre denkbar, dass diese Probleme auchdie bilateralen Beziehungen der Türkei zu den einzelnen EU-Staaten beeinträchti-gen könnten. Eine Revidierung des Endzieles der Beitrittsverhandlungen in der EUwürde darüber hinaus die Glaubwürdigkeit der EU nicht nur aus der Perspektiveder türkischen Perzeptionen, sondern auch in der Welt erschüttern. Ferner könntedie Ablehnung der Türkei auf der Grundlage des religiös-kulturellen Unterschiedesder Türkei das EU-Bild in der muslimischen Welt negativ beeinflussen und zusätzli-che Polarisierungen zwischen Europa – auch dem Westen allgemein – und dem Is-lam hervorrufen. Eine solche Entwicklung könnte auch die Erfolgchance eines vonder Türkei repräsentierten säkular-demokratischen politischen Systems und einer li-beral-pluralistischen Islamauffassung – was auch als Euro-Islam bezeichnet wird20 –vermindern. Auch für die türkischen Einwanderer in Europa wäre dies ein polari-sierendes Signal. Auf längere Sicht könnte ein eindeutiger Ausschluss der Türkeivon der europäischen Integration das Selbstverständnis der türkischen Bevölkerungverändern.
Regionalpolitik nach dem Ost-West-Konflikt
Die neue weltpolitische und regionale Konstellation sowie die daraus entstandenerelative Peripherisierung der Türkei aus europäischer Perspektive verursachten zuBeginn zwar einen gewissen Wertverlust der Türkei im Hinblick auf die europäi-sche Sicherheitspolitik, aber andererseits eröffneten sie für die Türkei neue Mög-lichkeiten und Chancen für die Entwicklung einer aktiven Regionalpolitik. Zahlrei-che internationale Führungspersönlichkeiten wiesen der Türkei in diesem Kontexteine aktive regionale Rolle zu. Tatsächlich entstanden in der nahen Umwelt der Tür-kei – auf dem Balkan, im Schwarzmeerraum, im östlichen Mittelmeer und im NahenOsten, aber vor allem im Kaukasus und in Zentralasien – neue wirtschaftliche sowieaußen- und kulturpolitische Kooperationsmöglichkeiten und Betätigungsfelder.Insbesondere die neuen unabhängigen postsowjetischen Staaten im Kaukasus undin Zentralasien sollen in diesem Zusammenhang als ein vordringliches Betätigungs-feld der neuen türkischen Regionalpolitik betrachtet werden.
Es soll an dieser Stelle zunächst nochmals auf die Relevanz der Gestaltung einerneuen Regionalpolitik der Türkei betont werden. Es lässt sich – wie oben bereits an-
20 Zu diesem Begriff siehe Thomas Meyer, Die Identität Europas. Der EU eine Seele?,Frankfurt am Main 2004, S. 152-154.
03_Caman Seite 408 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 409
gedeutet – vorab feststellen, dass diese neue Regionalpolitik vor allem eine Notwen-digkeit im Sinne der Anpassung der Türkei an die neue regionale Konstellation war.Dies kann folgendermaßen begründet werden: Die Desintegration der Sowjetunionwar Ausgangspunkt für diese außenpolitische Notwendigkeit. Die direkte Nach-barschaft der Türken und Russen ging durch die Desintegration der Sowjetunionnach Jahrhunderten zu Ende. In dem ehemals russisch-sowjetischen Territorium imSüdkaukasus, mit dem die Türkei eine lange Grenze hat, erlangten drei ehemals so-wjetische Unionsrepubliken ihre Souveränität und wurden am Ende des Desinteg-rationsprozesses zu unabhängigen Staaten. Auf dem Balkan nahm der russischeEinfluss parallel zu dieser Entwicklung deutlich ab. Die Region Südosteuropa gerietunter die starke Anziehung der EU. Im Schwarzmeerraum erlangten die sowjeti-schen Unionsrepubliken Ukraine und Moldawien ebenfalls ihre Unabhängigkeit. InZentralasien – einer Region, die von den benachbarten Regionen der Türkei geogra-phisch getrennt ist, zu der jedoch historische und kulturelle Verbindungen vorhan-den sind – entstanden ebenfalls neue postsowjetische Republiken. Der Irak wurdenach dem Ende des Zweiten Irakkriegs de facto geteilt und demzufolge entstand imNordirak aufgrund der Entmachtung der irakischen Autorität – eine Region, mitder die Türkei eine gemeinsame Grenze hat – ein Machtvakuum. Diese Ausgangsla-ge der türkischen Regionalpolitik könnte folgendermaßen zusammengefasst wer-den: einerseits gab es für die türkische Außenpolitik neue Betätigungsfelder mitneuen Möglichkeiten und Optionen, von denen die Türkei mittel- und langfristigprofitieren könnte. Andererseits aber wurde die türkische Außenpolitik durch dieregionale Instabilität direkt bedroht. Es war jedenfalls für die türkischen Entschei-dungsträger ein Faktum, dass die Rahmenbedingungen der türkischen Außenpolitikbis zum Ende des Ost-West-Konflikts ihre Gültigkeit voll und ganz verloren hat-ten. Sie mussten daher entsprechend den realpolitischen Rahmenbedingungen undKonditionen der neuen regionalen und weltpolitischen Konstellation eine neue re-gionale Außenpolitik gestalten. Ein außenpolitischer Anpassungsprozess musste inGang gesetzt werden. Dieser Prozess erforderte eine neue Lagebeurteilung der regi-onalen Umwelt, eine Definition der neuen Interessen entsprechend den neuen regi-onalen Rahmenbedingungen und letztendlich die Gestaltung einer neuen Regional-politik. Die Zentralasien- und Kaukasuspolitik der Türkei war ein signifikanterBestandteil der neuen türkischen Regionalpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Am Beispiel der Analyse dieser Neuorientierung können die fundamen-talen Entwicklungen sowie deren mögliche Folgen und Entwicklungstendenzen derneuen türkischen Regionalpolitik festgestellt werden.
Bei der Bewertung der türkischen Zentralasien- und Kaukasuspolitik sollen diePerzeptionen der türkischen Entscheidungsträger mit berücksichtigt werden, dadiese insbesondere in der Phase der Lagebeurteilung und der Interessensdefinitionvon entscheidender Relevanz sind. In der Türkei wurde die Auflösung der Sowjetu-nion nicht nur aufgrund des gesunkenen Gefahrenpotenzials im Hinblick auf dietürkische Sicherheitspolitik begrüßt, sondern auch infolge der Entstehung der tür-kischen Welt. Diese subjektive Perzeption der türkischen Eliten ist einerseits aufmangelndes Wissen der Mehrheit der türkischen Eliten über die turksprachigen
03_Caman Seite 409 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?410
Völker der ehemaligen Sowjetunion, andererseits auf bewusste Propagandaarbeitder (pan)turkistischen Intellektuellen zurückzuführen. Es ist zwar eine Tatsache,dass es nicht zu unterschätzende sprachliche Ähnlichkeiten zwischen den Turkspra-chen – auch mit dem Türkischen – gibt, doch ein Vergleich deutet nicht auf bloßeDialektunterschiede hin, sondern – abgesehen der türkischen und aserbaidschani-schen Sprachen – eher auf Sprachunterschiede. Die Perzeption der türkischen Ent-scheidungsträger unterschied sich in diesem Punkt deutlich von der den politischenFührern der postsowjetischen Turkrepubliken. In der Türkei wurden die turkspra-chigen Völker dieser Republiken ethnisch als zentralasiatische Türken (Orta AsyaTürkleri) wahrgenommen. Die fehlende Unterscheidung im Türkischen zwischenTürkische Sprache und Turksprache sowie Türke und Turk trugen zu diesem be-grifflichen Fehlgebrauch bei, wobei man jedoch hier auch eine ideologisch begrün-dete bewusste Ignoranz nicht völlig ausschließen darf. Die für die Türkei nach derDesintegration der Sowjetunion entstandene außenpolitische Neuorientierungs-möglichkeit wurde rasch zum Thema rhetorischer Machtprojektionskapazitäten.Das Entstehen einer Einflussregion von der Adria bis zur Chinesischen Mauer21 warder politische Ausdruck der türkischen Euphorie. Nahezu alle türkischen Entschei-dungsträger waren mehr oder weniger davon überzeugt, dass die Türkei in Eurasiendas Potential hätte, sich zu einem mächtigeren regionalen Akteur zu entwickeln. Sietendierten darüber hinaus eher dazu, die Türkei als einen »älteren Bruder« der Tur-krepubliken wahrzunehmen. Sie betonten in diesem Zusammenhang die transe-pochale Staatlichkeit der Türken als Argument für ihre Perzeption. Als weitereStärken des Landes wären vor allem sein demokratisches politisches System, seineliberale und exportorientierte Marktwirtschaft sowie vor allem seine Integration imWesten. Die türkischen Entscheidungsträger sahen für die Türkei auch ein Potenzi-al, die politischen Werte Europas durch ihre engeren Beziehungen zu den kaukasi-schen und zentralasiatischen Regionen zu verbreiten. Ausgehend von dieser Per-zeption übernahm die Türkei insbesondere in der Anfangsphase der Beziehungeneine Vermittlerrolle zwischen den Turkrepubliken und den westlichen Institutio-nen, in denen sie Mitglied ist.22 Die Türkei war der erste Staat, der die Unabhängig-keit der postsowjetischen Turkrepubliken anerkannt hat. Auch die ersten Auslands-vertretungen in diesen Republiken waren die türkischen Botschaften. DerSüdkaukasus und Zentralasien gehören darüber hinaus zu den von türkischen Poli-tikern am meisten besuchten Regionen. Die primären türkischen Interessen könnenwie folgt zusammengefasst werden:
21 Kut weist darauf hin, dass der Ausdruck Türkische Welt von Adria bis China zum ers-ten Mal in der Weltwirtschaftsforum am 1. Februar 1992 vom US-amerikanischenStaatsmann Kissinger verwendet wurde. Auch das Buch von Graham Fuller und Ian O.Lesser hat den Untertitel From the Balkans to Western China. Siehe Gün Kut, »YeniTürk Cumhuruyetleri ve Uluslararası Ortam«, in: T.C. Kültür Bakanlıgı (Hg.):Bahımsızlıhın Ìlk Yılları, Ankara 1994, S. 9-24; S. 13.
22 Bess Brown / Elisabeth Fuller, Die Türkei und die muslimischen Republiken der ehema-ligen Sowjetunion, Sankt Augustin 1994, S. 19f.
03_Caman Seite 410 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 411
1. Die Staatlichkeit und Unabhängigkeit der Turkrepubliken und der anderen post-sowjetischen Staaten der Region sollen etabliert und gefestigt werden.
2. Eine politische Plattform zur Kooperation zwischen der Türkei und den Turkre-publiken soll initialisiert werden. Die Beziehungen zu den Turkrepubliken soll-ten möglichst institutionalisiert werden, um eine gewisse Kontinuität hervorzu-bringen.
3. Die kulturellen Ähnlichkeiten – insbesondere die sprachlichen, aber auch die his-torischen, religiösen und gesellschaftlichen – sollen im Rahmen einer türkischenKulturpolitik gezielt gefördert werden und die wichtigste Basis der außenpoliti-schen Aktivitäten der Türkei bilden.
4. Die wirtschaftlichen Kooperationen mit den postsowjetischen Republiken sollenunterstützt und gefördert werden. Hierbei soll die Türkei zu einem Knoten-punkt für die aus der kaspischen Region stammenden fossilen Brennstoffe wer-den, die durch Pipelines zu türkischen Mittelmeerhäfen transportierten werdensollen.
5. Zur Lösung der Konflikte und zur Behebung der Konfliktpotentiale zwischenden postsowjetischen Nachbarstaaten soll durch bilaterale und multilaterale Ini-tiativen – vor allem ohne militärische Machtprojektion – beigetragen werden.
6. Das wichtigste Interesse der Türkei in der Kaukasus- und Turkrepublikenpolitikist – entsprechend dem generellen regionalpolitischen Interesse des Landes – eineaußenpolitische Anpassung an die Rahmenbedingungen der neuen regionalenKonstellation nach dem Ost-West-Konflikt. Diese Interessenslage bestimmte diebisherige Zentralasien- und Kaukasuspolitik der Türkei.Die ersten Kontakte zu den Turkrepubliken wurden kurz vor der Auflösung der
Sowjetunion hergestellt. Mehrere bilaterale und multilaterale Verträge zwischen derTürkei und den Turkrepubliken wurden nach der Erlangung der Unabhängigkeitdieser Staaten paraphiert.23 Die multilateralen Formen der Beziehungen zu denpostsowjetischen Turkrepubliken erwiesen sich eher als nicht effektiv und konntendie politischen und wirtschaftlichen Kooperationsmöglichkeiten nicht hinreichendkonkretisieren. Die Kooperationsformen wie die ECO oder die Turkstaatengipfelwaren hinter den Erwartungen der türkischen Entscheidungsträger zurückgeblie-ben. Einerseits fehlten der Türkei die wirtschaftlichen Kapazitäten und insbesonde-re die erforderlichen politischen und sicherheitspolitischen Strukturen. In diesemZusammenhang wäre nochmals auf die machtpolitische Lage der Russischen Föde-ration als Erbin der sowjetischen Supermacht hinzuweisen. Andererseits sind zwi-schen den Entscheidungsträgern und Führungseliten der Türkei und den turkspra-chigen Führungen einige tiefgreifende Interessensunterschiede festzustellen. DieEntscheidungsträger der Turkrepubliken zeigten keinerlei Interesse an einer supra-national orientierten und ethnisch oder religiös fundierten – und eventuell pantur-kistischen – Kooperationsform der Turkstaaten, die von den türkischen Entschei-
23 Siehe hierzu T.C. Milli E≤itim Bakanlıgı (Hg.), Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri veTürk Topluluklari Arasinda Yapilan Antlasmalar, Iliskiler ve Faliyetler, Ankara 1993.
03_Caman Seite 411 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?412
dungsträgern auf den Gipfeltreffen der turksprachigen Staaten vorgeschlagenworden war.24 Das nicht konkretisierte und eher als eine Option wahrgenommeneZiel türkischer Entscheidungsträger, mit den Turkrepubliken zusammen eine türki-sche Liga der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit zu ini-tialisieren, muss so aus türkischer Perzeption als ein Versuch gesehen werden, fürdie EU und die USA wieder an Bedeutung zu gewinnen. Nicht nur im Hinblick aufdie fehlenden finanziellen Kapazitäten, sondern auch auf machtpolitische Gleichge-wichte in der Region mussten Träume über eine supranational geprägte Kooperati-onsform zwischen der Türkei und den Turkrepubliken scheitern. Vor allem wäreein derartiges Vorgehen nicht unbedingt mit den Interessen Russlands im Einklangund würde die ohnehin dominante russische Politik des nahen Auslands provozie-ren.
Im Rahmen der initialisierten Kulturpolitik als einen wichtigen Bestandteil dertürkischen Regionalpolitik entwickelten sich intensive kulturelle Beziehungen zwi-schen der Türkei und den turksprachigen Republiken. Insbesondere die Sprach-,Bildungs- und Hochschulpolitik waren die Aktivitätsbereiche der türkischen Kul-turpolitik, in denen eine kulturelle Annäherung zu diesen Republiken stattfindenkonnte.25 In Aserbaidschan beispielsweise konnte das lateinische Alphabet aufgrundder aktiven kulturpolitischen Initiative der Türkei das von Russland durchgesetzteund bisher verwendete kyrillische Alphabet erfolgreich ablösen, was zweifelsohnezur sprachlichen Verständigung auf höherer Ebene – auch in Literatur und Wissen-schaft – zwischen der Türkei und Aserbaidschan zunehmend beitragen wird. In an-deren postsowjetischen Turkrepubliken wurde das lateinische Alphabet nurteilweise eingeführt. Auch der Einfluss der türkischen Medien – vor allem der türki-schen Fernsehkanäle und Zeitungen – könnten in diesem Zusammenhang eine zu-sätzliche Annäherung fördern. Die türkischen Gymnasien und Hochschulen in denkaukasischen und zentralasiatischen Regionen sind ebenfalls als wichtige Kompo-nenten der türkischen Kulturpolitik zu betrachten, die mittel- und längerfristig zueinem bestimmenden Faktor der kulturellen Beziehungen zwischen der Türkei undden postsowjetischen Staaten dieser Regionen werden können. Diese Schulen undUniversitäten sind elitär orientiert und bilden Kinder und Jugendliche der höherenBildungs- und Führungsschichten dieser Länder aus. Durch staatliche Stipendienermöglichte die Türkei zahlreichen Studenten aus den Turkrepubliken überdieswissenschaftliche Studien an den türkischen Universitäten. Ähnliche Studienmög-lichkeiten an den türkischen Militärakademien wurden ebenfalls angeboten. Der
24 Hierzu siehe Nursultan Nazarbayev, Yüzyılların Kav agında, Ankara 1997, S. 200f.Siehe auch Ahmet Kuru, »Uluslararasi Ortam ve Bölgesel Entegrasyon Teorileri Isi-ginda Türk Birligi Meselesi«, in: Mim Kemal Öke, (Hg.), Gecis Sürecinde Orta AsyaTürk Cumhuruyetleri, Istanbul 1999, S. 152-210; S. 185.
25 Für die Einzelheiten siehe Çaman, Türkische Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts: Außenpolitische Kontinuität und Neuorientierungen zwischen der EU-Integration und neuer Regionalpolitik, S. 292-301. Siehe auch Zakir B. Av ar, »TürkCumhuriyetleri Arasında Ìleti im«, in: Avrasya Etüdleri, 3/1 (1996), S. 101-113.
03_Caman Seite 412 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 413
Türkei gelang es dabei, die Besonderheiten ihres laizistischen politischen Systemsund ihrer Lebensweise – eine pluralistisch orientierte parlamentarische Demokratieund eine pluralistische sowie säkulare Gesellschaftsstruktur – den zukünftigen Füh-rungsschichten der Turkrepubliken nahe zu bringen. Andererseits mussten die tür-kischen Entscheidungsträger registrieren, dass der kulturelle Einfluss Russlands indiesen Jahrhunderte lang russisch dominierten Regionen fest etabliert ist und damitdas Kulturleben sowie die politische und gesellschaftliche Praxis dominiert. In die-sem Zusammenhang muss die übergeordnete Rolle der russischen Kultur und Spra-che sowohl in Zentralasien als auch im Südkaukasus insbesondere unter denFührungsschichten betont werden. Diese Tatsache mussten die türkischen Entschei-dungsträger einsehen und hinnehmen.
Ein weiteres Kooperationsfeld war der Bereich der wirtschaftlichen Beziehun-gen. Die Regionen Kaukasus und Zentralasien wurden von Anfang an sowohl vonden türkischen Führungseliten als auch von den privaten Investoren aus der Türkeials ein potenziell bedeutender Markt für die seit den 80er Jahren exportorientiertetürkische Volkswirtschaft wahrgenommen. Darüber hinaus verfügten die postsow-jetischen Staaten – vor allem Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan – überstrategisch wichtige Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas. Für die türkischen Entschei-dungsträger war es relevant, die wirtschaftliche Entwicklungspolitik und die Refor-men zur Systemtransformation in diesen Staaten zu unterstützen, um zu ihrer Sou-veränität und Unabhängigkeit beitragen zu können. Zu diesem Zweck stellte dieTürkei Kredite und humanitäre Hilfe für die Turkrepubliken zur Verfügung undleistete technische Hilfe bei der Ausbildung von Führungspersonen der Wirtschaft.Zur Modernisierung der Infrastruktur der Turkrepubliken wurden von der Türki-schen Telekom und auch aus dem Privatsektor insbesondere im Bereich der Tele-kommunikation technische Unterstützungen angeboten. Die türkischen Entschei-dungsträger waren sich von Anfang an bewusst, dass die wirtschaftlichenRessourcen der Türkei nur eine begrenzte Unterstützung im wirtschaftlichen Be-reich zulassen würden. In den Turkrepubliken bilden auf der anderen Seite diestrukturellen Wirtschaftsprobleme – z.B. ihre Abhängigkeit von der Russischen Fö-deration als Folge des sowjetischen Erbes, veraltete Technologie, fehlende Kapital-akkumulation und Know-how-Defizite – eine konkrete Barriere für die Intensivie-rung der Wirtschaftsbeziehungen. Nichtsdestotrotz sind die Investitionen destürkischen Privatsektors in Zentralasien und im Südkaukasus nicht zu unterschät-zen.
Ein strategisches Interesse der Türkei im Rahmen ihrer Zentralasien- und Kauka-suspolitik war die Durchsetzung der von der Türkei vorgezogenen Transportwegezur Vermarktung von Erdgas und Erdöl aus Zentralasien und dem Kaukasus. Die-ser Bereich ist als ein Querschnittsbereich zwischen den strategischen und wirt-schaftlichen Interessen des Landes zu betrachten. Die türkischen Entscheidungsträ-ger erwarteten vor allem vom Pipelineprojekt Baku-Ceyhan (über Georgien und dieTürkei), das von der internationalen Gemeinschaft – vor allem von den USA undder EU – unterstützt wird und aserbaidschanisches Erdöl in den Weltmarkt, vor al-lem aber nach Europa transportieren wird, sowohl wirtschaftliche als auch politi-
03_Caman Seite 413 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?414
sche und strategische Vorteile. Insbesondere im Kontext der zukünftigen Entwick-lungstendenzen der Türkei-EU-Beziehungen zeigt sich die strategische Dimensiondieses Projektes, das größtenteils vollendet wurde. Die türkische Pipelinepolitik alsein relevanter Bestandteil der neuen Regionalpolitik erwies sich in diesem Zusam-menhang als erfolgreich. Angesichts dieser Einschätzungen, Bewertungen und Fak-ten in diesem Bereich der Beziehungen kann eine vielversprechende Möglichkeit derIntensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen der Türkei insbesondere zu Aser-baidschan und Georgien, ferner längerfristig auch zu Armenien, prognostiziert wer-den. Parallel dazu ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Einfluss der EU sich imSüdkaukasus – vor allem im Falle eines türkischen EU-Beitritts – sowohl im wirt-schaftlichen als auch im politischen Sinne intensivieren wird. Dies könnte länger-fristig konflikteindämmende und stabilisierende Projektionen durch EU-Initiativenunter aktiver Teilnahme der Türkei ermöglichen.
Gerade hierin liegt ein weiteres türkisches Interesse. Sowohl Zentralasien als auchder Kaukasus sind konfliktbeladene Regionen. Die russische und sowjetischeFremdherrschaft in diesen Regionen hatte zur Folge, dass sich zahlreiche Konflikt-potentiale, die während der Sowjetzeit nur latent bestanden, nach der Desintegrati-on der Sowjetunion als Konfliktherde manifestierten und durch ihre Eskalation dieStabilität der Region untergraben. Tschetschenien (Russische Föderation), Adscha-rien (Georgien) und Berg-Karabakh (Aserbaidschan-Armenien) sind die wichtigs-ten, aber nicht die einzigen Konflikte im Transkaukasus. Zwei dieser gefährlichenKonfliktherde befinden sich in unmittelbarer Nähe der Türkei und stellen ein aku-tes Eskalations- und Instabilitätspotenzial dar. Vor allem der Konflikt zwischen denArmeniern und Aserbaidschanern um das aserbaidschanische Gebiet Berg-Kara-bakh betrifft die türkische Regionalpolitik in vielerlei Hinsicht. Das schlechte Ver-hältnis zwischen der Türkei und Armenien ist auf die tragischen Ereignisse im Ers-ten Weltkrieg und auf die daraus entstandenen unterschiedlichen Perzeptionendieser Tragödie zurückzuführen. Dies ist gewiss ein dominanter Faktor eines ge-fährlichen Ultranationalismus und türkenfeindlicher Tendenzen in der heutigenpostsowjetischen Republik Armenien. Eine weitere Problematik, die das türkisch-armenische Verhältnis im Südkaukasus erschwert, ist die Aggressionspolitik Arme-niens gegenüber seinem Nachbar Aserbaidschan. An einer friedlichen Lösung die-ses Konflikts ist die Türkei vor allem auch deshalb interessiert, damit sich endlichstabilere Verhältnisse im Südkaukasus etablieren. Die Friedensinitiativen der Türkeibrachten allerdings in der Vergangenheit keine konkreten Erfolge. Eine aktive Initi-ative seitens der EU, die eine baldige Lösung des Konflikts herbeiführen könnte, er-scheint im Moment vor allem kurzfristig nicht realistisch zu sein. Es ist jedochdurchaus möglich, dass die zunehmende Einflussnahme der EU sich zu einem stabi-lisierenden Faktor im Südkaukasus entwickeln könnte. Auch in diesem Punkt stim-men die Interessen der Türkei und der EU überein.
Die türkische Regionalpolitik hängt selbstverständlich mit dem außenpolitischenVerhalten anderer regionaler und internationaler Akteure zusammen. Die Interaktio-nen dieser Akteure einschließlich der Türkei sind weitere exogene Bestimmungsfakto-ren der türkischen Zentralasien- und Kaukasuspolitik. Die Entwicklungstendenzen
03_Caman Seite 414 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 415
der Beziehungen der Türkei zu den postsowjetischen Turkrepubliken werden von denFolgen der Interaktionen dieser regionalen Akteure der Konstellation beeinflusst. DerIran im Kaukasus sowie Pakistan und Indien in Zentralasien zeigen sich als regionaleAkteure mit geringen Einflussmöglichkeiten und Kapazitäten. China verfügt überenormes ökonomisches Potential und könnte sich in diesem Sinne insbesondere hin-sichtlich seiner Außenhandelspolitik zu einem einflussreicheren Akteur in Zentralasi-en entwickeln. Diese regionalen Akteure haben eine überwiegend multiethnische Be-völkerungsstruktur und sind so der Gefahr interethnischer Konflikte ausgesetzt. Dierepressive Nationalitätenpolitik Chinas in Ostturkistan (in Westchina) gegenüber demTurkvolk Uiguren und der uigurische Nationalismus sind die Determinanten des eth-nischen Konfliktpotenzials im chinesischen Zentralasien.26 Die chinesischen Entschei-dungsträger müssen dieses latente Konfliktpotential bei den chinesisch-zentralasiati-schen Beziehungen stets berücksichtigen, da in Zentralasien eine nicht zuunterschätzende uigurische Minderheit lebt. Auch für den Iran bildet die Aseri-Min-derheit an der iranisch-aserbaidschanischen Grenze ein ethnisches Konfliktpotentialmit denkbaren Eskalationstendenzen, die sich parallel zur wirtschaftlichen Entwick-lung und internationaler Integration Aserbaidschans zu einem wichtigen innenpoliti-schen Problem des Iran entwickeln könnte. Sowohl im Falle Chinas wie auch des Irankönnte die problematische Struktur der fehlenden pluralistischen Demokratie undRechtsstaatlichkeit Nährboden für ethnische Konfliktpotentiale sein.
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts benahm sich die Russische Föderationals ein führender und äußerst aktiver Akteur in Zentralasien und im Kaukasus. Eskann davon ausgegangen werden, dass die Russische Föderation bisher der wichtigs-te exogene Einflussfaktor auf die türkische Regionalpolitik in Zentralasien und imKaukasus war. Es könnte aus vielerlei Hinsicht von einer türkisch-russischen Rivali-tät in Zentralasien und im Kaukasus die Rede sein, deren Ursachen in den kontro-versen Perzeptionen und daraus resultierenden unterschiedlichen Interessen der bei-den regionalen Staaten zu suchen sind. Die russischen Entscheidungsträger undFührungseliten nehmen die südlichen postsowjetischen Staaten im Kaukasus und inZentralasien im Rahmen des außenpolitischen Konzepts des nahen Auslands wahrund betrachten diese Regionen als eine Art abhängige Einflusszone.27 Diese nostalgi-sche russische Sichtweise ist bis zur Kolonialpolitik des Russischen Reichs und zuder sowjetischen Fremdherrschaft in diesen Regionen zurückzuverfolgen.28 Die rus-
26 Zu diesem Thema siehe Gudrun Wacker, »Xinjiang und die VR China. Zentrifugale undzentripetale Tendenzen in Chinas Nordwestregion« in: BIOST, 3/1995.
27 Graham E. Fuller, »Russia and Central Asia: Federation or Fault Line?« in: MichaelMandelbaum, (Hg.), Central Asia and the World. Kasakhstan, Usbekistan, Tajikistan,Kyrgystan and Turkmenistan, New York 1994, S. 94-129. Siehe auch Uwe Halbach,»Zwischen ›heißem Krieg‹ und ›eingefrorenen Konflikten‹. Russlands Politik im Kau-kasus«, in: Osteuropa, 4/5, 51. Jahrgang, 2001, S. 481-494. Für die russische Außenpoli-tik in Zentralasien siehe Birgit Brauer / Beate Eschment, »Russlands Politik inZentralasien«, in: Osteuropa, 4/5, 51. Jahrgang 2001, S. 495-508.
28 Schilling, Walter: »Rückkehr des Imperialismus im Kaukasus?«, in: Internationale Poli-tik, 50/11 (1995), S. 45-50.
03_Caman Seite 415 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?416
sischen Führungseliten versuchen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dieim völkerrechtlichen Sinne zu Ende gegangene russische Herrschaft in diesen Regio-nen zumindest durch eine besonders aktive Regionalpolitik fortzuführen. Die Etab-lierung der Unabhängigkeit der ehemals sowjetischen Republiken im russischen na-hen Ausland entspricht in diesem Zusammenhang nicht unbedingt den strategischenInteressen der Russischen Föderation. Dies ist dem oben erwähnten strategischenInteresse der Türkei diametral entgegengesetzt. Die russischen Führungseliten be-trachten daher jede politische oder wirtschaftliche Kooperation der postsowjeti-schen Staaten südlich ihres Territoriums als eine negative Tendenz, die die russischeVorherrschaft und Dominanz in der Region relativieren würde. Es gelang den russi-schen Entscheidungsträgern bisher weitgehend, die Bemühungen der türkischenEntscheidungsträger zu neutralisieren, eine Plattform der Kooperation mit den Tur-krepubliken in die Tat umzusetzen. Diese mussten die von der Russischen Föderati-on durchgesetzte Lage aus realpolitischen Gründen hinnehmen. Auf der anderenSeite aber gelang es der Türkei ihre Pipelinepolitik in Zusammenarbeit mit denUSA, trotz der energischen Opposition der Russischen Föderation durchzusetzen.
Für die türkischen Entscheidungsträger erscheint es insgesamt realistischer sein,mit dem Westen, vor allem aber mit der EU neue Kooperationsfelder zu suchen, umihre Interessen besser wahrnehmen zu können. Insbesondere ihre Perzeptionen be-züglich der Etablierung der Unabhängigkeit der südkaukasischen Staaten – aberauch der zentralasiatischen Staaten – stimmen mit denen der EU sowie der USAweitgehend überein. Auch im Sinne der Stabilisierung des Südkaukasus könnendeutliche Übereinstimmungen mit den Perzeptionen der EU festgestellt werden, dadie EU neuerdings die südkaukasischen Staaten in ihre ausgeweitete Nachbar-schaftspolitik aufnahm. Auch Georgien und Aserbaidschan signalisieren ihr Inter-esse an einer Beteiligung an der EU-Integration. Die Entscheidungsträger dieserLänder wissen, dass der Beitritt der Türkei zur EU sie zu direkten Nachbarn derEU machen würde, was für sie eine positive Entwicklung im Hinblick auf ihre wirt-schaftliche und politische Stabilität wäre und zudem ihre Unabhängigkeit von derrussischen Dominanz stärken würde. Die Führungen der postsowjetischen Staatenim Südkaukasus werden diese Möglichkeit bei ihren Beziehungen zur Türkei in na-her und mittlerer Zukunft immer vordringlicherer berücksichtigen. Für die EUwird möglicherweise vor allem der Reichtum Aserbaidschans an fossilen Brennstof-fen sowie deren Transport über Georgien und die Türkei nach Europa eine zuneh-mende zentrale Rolle in ihrer Türkei- und Kaukasuspolitik spielen. Zentralasienhingegen befindet sich verglichen mit dem Südkaukasus unter viel stärkerem russi-schem Einfluss. Die geographische Entfernung Zentralasiens von der Türkei undvon Europa bildet eine große Barriere für eine Intensivierung der Beziehungen derEU zu dieser Region. Für die Türkei ist es abgesehen von ihrer erfolgreichen Kul-turpolitik und ihren wirtschaftlichen Aktivitäten in naher und mittlerer Zukunftnicht allzu wahrscheinlich, in Zentralasien und insbesondere auf dessen Märkten einKooperationsplattform mit den Turkrepubliken zu realisieren. Ihre geographischeEntfernung sowie die geringfügigen und konkurrenzunfähigen wirtschaftlichen Ka-pazitäten sind offensichtliche Nachteile der Türkei in ihrer Zentralasienpolitik.
03_Caman Seite 416 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 417
Schluss
Es wurden nach dem Ende des Ost-West-Konflikts folgende, für die Gesamtau-ßenpolitik relevante Folgen der neuen Konstellation beobachtet, die die Neugestal-tung der türkischen Außenpolitik auf bestimmende Weise mit beeinflussten. DieSichtweise und dementsprechend die Lagebeurteilung der außenpolitischen Ent-scheidungsträger und Führungseliten der Türkei mussten sich aufgrund den neuenexogenen Determinanten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ändern. Infolgeneuer Machtlagen in der regionalen und weltpolitischen Konstellation, insbesonde-re aufgrund der Desintegration der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, ent-standen für die Türkei neue, vorher nicht oder nur latent und vor allem realpolitischunbedeutend wahrgenommene Interessensfelder mit nun bedeutend gewordenenpolitischen, ökonomischen, sicherheitspolitischen und kulturellen Dimensionen. Indiesem Sinne wurden nach dem Paradigmenwechsel in der Weltpolitik neue Orien-tierungen in der türkischen Außenpolitik beobachtet. Eine aktive Balkanpolitik, dieneue Kooperationspolitik am Schwarzmeer (eine von der Türkei initialisierte Koo-peration mit den Schwarzmeer-Anrainerstaaten), eine neue Nahostpolitik (Irak-Kriege und deren Folgen im Hinblick auf die türkische Außen- und Sicherheitspoli-tik) und vor allem die Zentralasien- und Kaukasuspolitik oder anders ausgedrückt,die Turkrepublikenpolitik, gehören zu den außenpolitischen Neuorientierungen,die auch ein neues Konzept der Regionalpolitik ermöglichten. Die neue Konstellati-on hinsichtlich der sich geänderten Machtlage zwischen den an der regionalen Kon-stellation beteiligten – teilweise neu entstandenen – Akteuren brachte eine neueMachthierarchie hervor und die türkischen Entscheidungsträger mussten dies beider Gestaltung der regional gerichteten außenpolitischen Neuorientierungen desLandes mitberücksichtigen. Nach der Desintegration der Sowjetunion fand nichtnur ein Machtkollaps, sondern in der Folge vor allem auch eine Machtverlagerungstatt. Hierbei stellte sich die Russische Föderation als regionaler Akteur in den Re-gionen, in denen die Türkei in 90er Jahren außenpolitisch aktiv war – vor allem imKaukasus und in Zentralasien – im Hinblick auf ihr Machtpotenzial als Erbin derSowjetunion, d.h. als dominierender Machtfaktor, dar. Im normativen Bereich, wasEthik, Recht, Ideologie und ihre Auslegung betrifft, waren die Einflüsse der neuenKonstellation zunehmend spürbar. Das Ende des Ost-West-Konfliktes eröffnete fürdie Türkei einen Raum für eine ideologisch beeinflusste regionale Außenpolitik, diewährend des bipolaren Systems nicht vorstellbar war. In der bipolaren Weltpolitikspielte die Türkei im westlichen Bündnis eine entscheidende sicherheitspolitischeRolle, so daß eine regional ausgerichtete Außenpolitik des Landes lediglich beschei-den möglich war. Während die ideologischen Grundpositionen in den außenpoliti-schen (und auch in den innenpolitischen) Entscheidungen zunehmend als Einfluss-faktor wirkten und im außenpolitischen Zusammenhang an Relevanz gewinnenkonnten, brachten die gegensätzlichen ideologischen Positionen zwischen den Re-gierungen und staatlichen Institutionen (vor allem dem Militär) ein Spannungsfeldhervor, das im Hinblick auf den Prozess der politischen Entscheidungsfindung undvor allem auf das politische System des Landes von großer Bedeutung ist. Eine wei-
03_Caman Seite 417 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
Efe Çaman · Türkei quo vadis?418
tere Beobachtung im Zusammenhang der normativen Bindungen stellt der zuneh-mende Einfluss der Europäischen Union im Demokratisierungsprozess der Türkeigemäß den EU-Beitrittskriterien von Kopenhagen dar. Die kontinuierliche außen-politische Europaorientierung mit dem Ziel der Vollmitgliedschaft in der EU brach-te vor allem seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre die zunehmende Übernahme derpolitischen Normen der EU hervor. Die gegenseitige Beeinflussung zwischen derAußen- und Innenpolitik war im Analysezeitraum charakteristisch in den Türkei-Europa-Beziehungen. In diesem Prozess wurde die türkische Verfassung von 1982sowie andere Gesetze so reformiert, daß das politische System des Landes sich indie Richtung von Demokratisierung und EU-Anpassung bewegte, sich damit libe-ralisierte und europäisierte.
Die Rahmenbedingungen der türkischen Außenpolitik änderten sich entspre-chend den Konstellationsänderungen in der Weltpolitik in jeder Hinsicht, so dassdie türkischen Entscheidungsträger und Führungseliten mit der ernsthaften Fragekonfrontiert waren, die Außenpolitik der Türkei rasch an die neuen Rahmenbedin-gungen anzupassen und sie dementsprechend neu zu gestalten. Zu diesem Zweckversuchten sie vor allem, ein neues Konzept der Regionalpolitik parallel zu den ak-tuellen Rahmenbedingungen nach dem Ost-West-Konflikt zu entwickeln, um eineaußenpolitische Anpassung an die geänderte Situation zu schaffen. Dies wurde vonmanchen Autoren auch als eine aktive Außenpolitik bezeichnet. In diesem Zusam-menhang ist die neue türkische Regionalpolitik als eine Art präventiver Außenpoli-tik zu verstehen, die aus der Änderung des unübersichtlichen Gefüges der regiona-len Konstellation resultierte. So tendierten die türkischen Entscheidungsträgerdazu, die Entstehung und vor allem die Eskalation zwischenstaatlicher Konfliktesowie weiterer potenzieller Krisen in ihren Nachbarstaaten durch internationaleZusammenarbeit vorab oder aber zumindest rechtzeitig einzudämmen.
Eine fundamentale Neuorientierung der türkischen Außenpolitik nach dem Endedes Ost-West-Konflikts war indes nicht der Fall war, die als eine Alternative zurbisherigen pro-westlichen und pro-europäischen Außenpolitik mit dem transe-pochalen Ziel einer weitgehenden Integration mit den sicherheitspolitischen, insti-tutionelllen und wirtschaftlichen Kooperationsformen mit dem Westen betrachtetwerden könnte.
Bei der neuen Außenpolitik handelte es sich weniger um Machtpolitik oder dasAnstreben einer Machtexpansion, sondern vielmehr darum, in den neuen polyzent-rischen regionalen Konstellation anhand neuer Perzeptionen und Interessenslagenin einem kontinuierlichen Interaktionsprozess mit den anderen involvierten Akteu-ren eine neue Außenpolitik zu gestalten. Dies ist der Türkei im Analysenzeitraumgrößtenteils gelungen. Unterstrichen werden soll hierbei die Tatsache, dass die Ent-stehung einer neuen Regionalpolitik entsprechend den neuen Parametern der inter-nationalen Politik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts keine optionale Neuori-entierung, sondern eine unvermeidbare Anpassung darstellt.
03_Caman Seite 418 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Efe Çaman · Türkei quo vadis? 419
Zusammenfassung
Das Ende des Ost-West-Konflikts veränderte die Rahmenbedingungen der türki-schen Außenpolitik. Während die Türkei parallel zu ihrem Wertverlust im sicher-heitspolitischen Kontext in Europa Schwierigkeiten hatte, ihren traditionellen Eu-ropakurs mit dem Ziel der Mitgliedschaft in der EU zu legitimieren, entstanden fürdie Türkei nach der Auflösung der Sowjetunion neue Chancen im Kaukasus und inZentralasien. Dieser Artikel beabsichtigt, die türkische Außenpolitik unter diesenneuen Konditionen der internationalen Politik zu verorten. Dabei wird versucht,die Frage zu beantworten, ob es sich bei dem neuen Außenpolitikkonzept um einaußenpolitisches Potenzial als Alternative zur sich bisher als dominante Orientie-rung erwiesenen Politik mit dem Ziel des EU-Beitritts handelt, oder ob diese neueAußenpolitik anders kategorisiert werden kann.
Summary
The end of the Cold War has changed the general conditions of the turkish fo-reign policy. While Turkey had some difficulties in the post Cold War period paral-lel to its lower importance in european security context to legitimate its europeancourse with the final destination of the full membership in the EU, there were newchances in Caucasus and Central Asia after the disintegration of the Soviet Union.This article intends to locate the Turkish foreign policy under these new conditionsof the international relations. It tries to answer the question whether it concerns bythe new foreign policy concept a potential as alternative to dominating orientationwith the destination of EU membership, or whether this orientation could be cate-gorized differently as well.
03_Caman Seite 419 Donnerstag, 9. November 2006 1:46 13
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl
Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?
Demokratie in Gefahr?
Betrachtete man während der Regierungszeit Silvio Berlusconis (2001-2006) Teileder Italien-Berichterstattung in deutschen Zeitungen, bot sich auf den ersten Blickein alarmierendes Bild: Von der »Umwandlung der parlamentarischen Demokratiein einen autoritären Staat« war da zu lesen, die Gewaltenteilung werde »aufgeho-ben« und die »Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt«, das Parlament sei »willfährig« unddie »Justiz geknebelt«.1 War in Italien, EU-Gründungsmitglied, G8-Staat und Fast-Nachbar Deutschlands, wirklich die Demokratie in Gefahr oder womöglich schondemontiert? Hatte der Medienunternehmer und Regierungschef Silvio Berlusconiwirklich so viel Macht angesammelt, dass er nach Belieben Journalisten entlassenund maßgeschneiderte Gesetze zum eigenen Nutzen durchdrücken konnte? Warendie gewaltenteilenden Sicherungsmechanismen einer modernen Demokratie, dieeine solche Machtkonzentration verhindern sollten, in Italien wirkungslos? DieseFragen versucht der vorliegende Beitrag näher zu beleuchten.
Dazu wird wie folgt vorgegangen: Nach kurzen Bemerkungen zur Vorgeschichtewerden die wichtigsten Probleme, die das »Phänomen Berlusconi«2 mit sich bringtbzw. brachte, rekonstruiert. Danach wird untersucht, welche Sicherungsmechanis-men der italienischen Politik diese Probleme eindämmen. Abschließend wird derBlick auf Probleme, denen sich Italien abgesehen von Berlusconi gegenüber sieht,gerichtet.
Vorgeschichte
Wie kam es überhaupt dazu, dass ein Medienmogul zum Chef der italienischenRegierung wurde? Italien wurde nach dem 2. Weltkrieg jahrzehntelang von einemParteienkartell regiert. Im Zentrum dieses Kartells standen die Christdemokraten,die Democrazia Christiana, die zusammen mit vier weiteren kleineren Parteien inwechselnder Konstellation stets die Regierungskoalition bildeten. Die zweitgrößtePartei, die Kommunisten, wurde vor dem Hintergrund des Kalten Krieges perma-nent von der Regierung ausgeschlossen, aber im politischen Alltagsgeschäft durch-
1 Ulrich Ladurner, »Bella Berlusconia« in: Die Zeit 33/2002.2 Michael Braun, »Populismus an der Macht. Das Phänomen Berlusconi« in: Internatio-
nale Politik und Gesellschaft, 3/2003, S. 110-133.
04_Köppl Seite 420 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 421
aus eingebunden. So entstand ein stabiles System aus Dauerregierung (trotz derzahlreichen Kabinette) und Proporz, in dem sich die Akteure bequem einrichteten.
Diese im Großen und Ganzen stabile Konstellation endete Anfang der 1990er Jahreschlagartig. Der Kalte Krieg war vorbei und damit auch das Hauptargument für denAusschluss der Kommunisten, die sich ohnehin längst programmatisch umorientiertund 1991 schließlich umbenannt und gespalten hatten. Die Unzufriedenheit der Italie-ner mit ihren politischen Eliten und der Politik allgemein machte sich im Aufstieg neuerParteien Luft, allen voran der populistischen Regionalpartei Lega Nord mit ihrem Vor-sitzenden Umberto Bossi. Die Unzufriedenheit entlud sich noch stärker ab 1992, alsausgehend von Mailand ein flächendeckendes System von Korruption und illegalerParteienfinanzierung (Schlagwort: Tangentopoli) aufgedeckt wurde; im Strudel diesesSkandals gingen faktisch alle Regierungsparteien unter, die Democrazia Cristiana zerfielin zahlreiche Kleinparteien. Katalysator des Wandels im Parteiensystem war schließlichdie Wahlrechtsreform von 1993, die zwar nicht – wie beabsichtigt – die Parteienzersplit-terung behob, aber später die Bildung zweier großer Lager zur Folge hatte.3
Vor diesem Hintergrund tat sich ein großes politisches Vakuum auf, das SilvioBerlusconi die Gelegenheit für seinen Einstieg in die Politik bot. Dass er sich zu die-sem Einstieg genötigt sah, weil mit den etablierten Parteien auch seine politischeProtektion verschwunden war und er sich von einer drohenden Regierungsübernah-me durch die Ex-Kommunisten nichts Gutes für sein Wirtschaftsimperium erwarte-te, ist zwar nicht bewiesen, aber eine durchaus plausible Erklärung. Der reichsteMann Italiens stampfte seit Ende 1993 eine neue Partei aus dem Boden, die ForzaItalia (Vorwärts Italien!, Schlachtruf der italienischen Fußballnationalmannschaft).Die Partei wird streng nach Marketinggesichtspunkten konzipiert, der Wahlkampfunterstützt von Berlusconi-eigenen Marktforschungsinstituten, Werbeagenturenund Medien; das Personal rekrutiert sich weitgehend aus dem Management.4 ImApril 1994 erringt die Forza Italia aus dem Stand 21 Prozent und bildet zusammenmit den Bündnispartnern Lega Nord und Alleanza Nazionale (der Nachfolgeparteider ehemaligen Neofaschisten) die Regierung.5 Allerdings bleibt die RegierungszeitBerlusconis ein kurzes Intermezzo: Schon im Dezember kündigt die Lega Nord dieKoalition auf, weil gegen den Regierungschef wegen Bestechung ermittelt wird. Esfolgen sechseinhalb lange Jahre in der Opposition, von denen fünf Jahre eine Mitte-Links-Koalition, u.a. unter Romano Prodi, regiert. Im Mai 2001 feierte die Mitte-Rechts-Koalition allerdings einen deutlichen Wahlsieg – und seitdem war Berlusconiwieder italienischer Regierungschef, bis zur äußerst knappen Abwahl im April 2006.
3 Vgl. Reimut Zohlnhöfer, »Die Transformation des italienischen Parteiensystems in den90er Jahren« in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 1998, S. 1371-1396 und Stefan Köppl,Das politische System Italiens. Eine Einführung, Wiesbaden 2006.
4 Vgl. Jörg Seißelberg, »Berlusconis Forza Italia. Wahlerfolg einer Persönlichkeitspartei(1994) « in: Winfried Steffani / Uwe Thaysen, (Hg.), Demokratie in Europa: Zur Rolleder Parlamente, Opladen 1995, S. 204-231.
5 Bestandteil der Wahlbündnisse und der Regierungskoalition waren auch noch kleinereSplitterparteien, die hier unerwähnt bleiben.
04_Köppl Seite 421 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?422
Probleme
Berlusconi an der Macht – warum war das ein Problem? Die zahlreichen Kritikpunk-te, die diese Konstellation hervorrief, lassen sich im wesentlichen auf vier Problemfelderreduzieren: Das waren erstens der Interessenkonflikt, der sich daraus ergab, dass einerder größten Unternehmer des Landes gleichzeitig Regierungschef war; zweitens dasMedienimperium in Berlusconis Besitz, also die Verbindung von politischer Macht undMedienmacht; drittens die Probleme mit der Justiz, also gegen Berlusconi laufende Er-mittlungen und Verfahren; und viertens ein populistischer und konflikthafter Politikstil.
Interessenkonflikt
Silvio Berlusconi ist im Besitz eines kaum zu übersehenden Wirtschaftsimperiums,vom Bauunternehmen bis zum Supermarkt, über die Werbeagentur bis hin zum Fern-sehsender. Dementsprechend ist er weit mehr als ein gewöhnlicher Bürger Adressatder Politik, welche die italienische Regierung macht. Das heißt, immer dann, wenn inItalien etwas mit wirtschaftlicher Bedeutung geregelt wird – Berlusconi ist davon be-troffen. Was drohte, war Politik nicht für das Gemeinwohl, sondern in eigener Sache.
Ein Blick auf die Maßnahmen der Regierung Berlusconi erhärtet den Verdacht:Als erstes wurden die Schenkungs- und Erbschaftssteuern massiv gesenkt. Davonprofitieren in erster Linie Reiche, die ihr Vermögen sukzessive ihren Kindern über-geben wollen, was auch auf den Regierungschef zutrifft. In eine ähnliche Richtungging ein Gesetz, das eine partielle Amnestie für Steuersünder vorsah: Für einen be-grenzten Zeitraum konnten Schwarzgelder, die zum Zwecke der Steuerhinterzie-hung ins Ausland geschafft worden waren, straffrei und zu einem geringen Steuer-satz nach Italien zurückgeholt werden. Eine ähnliche Aktion gab es zwar auch inDeutschland seitens der rot-grünen Regierung, doch kann im italienischen Fall an-genommen werden, dass der Regierungschef einer der größten Profiteure war.
Ein weiterer Punkt ist das neue Mediengesetz (sog. legge Gasparri). Der italieni-sche Fernsehmarkt stellt de facto ein Duopol dar: Auf der einen Seite die staatlicheRundfunkanstalt RAI, auf der anderen Seite die Privatsender, unter denen die dreiBerlusconi-Sender ca. 90% Marktanteil haben. Spätestens seit Anfang der 1990erJahre wird, zu einem beträchtlichen Teil angeregt durch Urteile des Verfassungsge-richtshofes, eine gesetzliche Neuregelung des Fernsehmarktes diskutiert, die end-lich echten Wettbewerb zulassen sollte. Die legge Gasparri sieht allerdings so aus,dass zwar die Marktanteile, die jemand kontrollieren darf, auf 20% beschränkt wer-den, doch bezieht sich dies auf den ganzen Mediensektor, also auch Zeitungen, Ra-dio, Buchverlage etc. Im Ergebnis wird die übermächtige Stellung Berlusconis aufdem Privatfernsehmarkt also nicht angetastet – das Gesetz erlaubt ihm vielmehrnoch eine weitere Expansion auch in andere Bereichen, z.B. durch den bis dato nochverbotenen Zukauf von Tageszeitungen. Also auch hier eine Regelung, die ganz denGeschäftsinteressen des Unternehmers an der Regierungsspitze entspricht.6
6 Vgl. Matthew Hibberd, »La Rai e il governo di centro-destra: quale futuro per 50 annidi televisione pubblica?« in: Vincent Della Sala / Sergio Fabbrini, (Hg.), Politica in Ita-lia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, Bologna 2004, S. 189-206.
04_Köppl Seite 422 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 423
Eines der Wahlversprechen aus dem Wahlkampf 2001 war die Regelung des Inte-ressenkonflikts binnen 100 Tagen nach Regierungsübernahme. Rein formal wurdedieses Versprechen auch erfüllt. Doch verbietet das entsprechende Gesetz nur dieFührung von Unternehmen bei gleichzeitiger Ausübung eines Regierungsamtes,nicht deren Besitz. Da Berlusconi seine Firmen nur besitzt, aber von Vertrauten undVerwandten führen lässt, änderte sich auch hier nichts am Status quo. Nur als Präsi-dent des AC Mailand musste der Regierungschef formal zurücktreten.
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Interessenkonflikt nicht nur po-tentiell, sondern auch aktuell bestand und keineswegs wirksam geregelt war.
Medien
In modernen Demokratien stellen die Medien eine wichtige Kontrollinstanz dar,die das Handeln der Politik und ggf. Verfehlungen öffentlich macht und kritisiert.Hinzu kommt, dass die Präsenz und das Bild eines Politikers oder einer Partei inden Medien zunehmend wichtiger für den Erfolg bei Wahlen werden. Vor diesemHintergrund ist es durchaus problematisch, wenn ein politischer Akteur, sei es einePerson oder eine Partei, weite Teile der Medienlandschaft besitzt und dadurch kon-trolliert. Die Problematik verschärft sich in Italien dadurch, dass der Schwerpunktvon Berlusconis wirtschaftlichen Aktivitäten in der Fernseh-Holding Mediasetliegt. Denn die Italiener sehen sehr viel fern, andere Medien wie Zeitung oder Radiohaben vergleichsweise geringe Bedeutung.7 Damit ergibt sich für den PolitikerBerlusconi ein direkter Zugriff auf das Hauptmedium der Wähler und daraus einklarer Wettbewerbsvorteil, der auch genutzt wird. In der Tat kann festgestellt wer-den, dass insbesondere Berlusconi mit seiner Forza Italia, aber auch die verbündetenParteien, in den drei Mediaset-Sendern sehr gut wegkommen – sowohl quantitativim Sinne überproportional hoher Präsenz als auch qualitativ im Sinne weitgehendpositiv gefärbter Darstellung.8 Das parteiische Agieren der drei großen Privatsenderist und bleibt somit ein Problem für den politischen Wettbewerb, unabhängig da-von, ob ihr Besitzer sich gerade in der Opposition oder in der Regierung befindet.
Was den Aufschrei in Teilen der außeritalienischen Medien nach der Regierungs-übernahme 2001 hervorrief, war der Umstand, dass die Allianz von politischerMacht und Medienmacht nun neue Ausmaße erreichte. Denn die Regierungskoaliti-on hatte nun auch die Möglichkeit, die staatliche Rundfunkanstalt RAI zu kontrol-lieren. Zu Zeiten des alten Parteienkartells war die RAI fester Bestandteil des Pro-porzsystems gewesen und unter den Parteien aufgeteilt worden: Der größte SenderRAI 1 »gehörte« den Christdemokraten, der zweitgrößte Sender RAI 2 den Sozia-
7 Vgl. Ernst Ulrich Große / Günter Trautmann, Italien verstehen, Darmstadt 1997, S.153-198.
8 Giacomo Sani / Guido Legnante, »Quanto ha contato la comunicazione politica?« in:Gianfranco Pasquino (Hg.): Dall’ Ulivo al governo Berlusconi. Le elezioni del 13 mag-gio 2001 e il sistema politico italiano, Bologna 2002, S. 117-137. Vgl. auch die Daten desMedienforschungsinstituts Osservatorio di Pavia, die z.T. auf http://www.osservato-rio.it (Stand: 21.08.2006) zugänglich sind.
04_Köppl Seite 423 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?424
listen und der kleine Sender RAI 3 blieb den oppositionellen Kommunisten überlas-sen. Damit stand auch das staatliche Fernsehen unter starkem parteipolitischemEinfluss, was sich in dessen Programm entsprechend niederschlug.
Die Befürchtungen waren also durchaus gerechtfertigt, dass Berlusconi mit derRegierungsübernahme auch den zweiten Teil des Fernsehduopols kontrollieren unddamit seine Medienmacht noch erheblich steigern könnte. In der Tat gab es für einesolche Beeinflussung viele Beispiele: Zahlreiche unbequeme Redakteure wurdenentlassen, Posten neu besetzt und erfolgreiche, aber regierungskritische Sendungenwie z.B. die des renommierten Journalisten Enzo Biagi, eingestellt. Auch hier konn-te man also die Einflussnahme klar erkennen.9 Allerdings stellte sich diese nicht sodirekt dar, wie man auf den ersten Blick vermutete – der Regierungschef kann kei-neswegs von seinem Schreibtisch aus direkt auf die RAI zugreifen. An deren Spitzesteht ein neunköpfiger Verwaltungsrat, der größtenteils von der zuständigen Parla-mentskommission nach Proporz besetzt wird. Zwar steht damit der Parlaments-mehrheit auch die Mehrheit im Verwaltungsrat zu, doch müssen sich die Koalitions-parteien untereinander auf entsprechende Kandidaten einigen, um dies auch nutzenzu können. Dementsprechend stellte die Besetzung des obersten RAI-Gremiumsseit 2001 einen permanenten Streitgegenstand zwischen den Bündnispartnern dar,wobei vor allem die UDC darauf bedacht war, Berlusconis Einfluss nicht zu großwerden zu lassen, und in dieser Angelegenheit mehr als einmal mit der Oppositionstimmte. Ohne die turbulente Entwicklung auf diesem Feld hier en detail nachvoll-ziehen zu können, sei als Ergebnis festgehalten, dass die Konzentration der Medien-macht durchaus ein Problem darstellt, auch wenn sich der Zugriff Berlusconis aufdas Staatsfernsehen weitaus weniger einfach vollzog als gemeinhin angenommen.10
Justiz
Problematisch ist auch Berlusconis Verhältnis zur Justiz. Er steht seit langem imVisier staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und wurde schon einige Male ange-klagt, unter anderem wegen Wirtschaftsvergehen wie Bilanzfälschung, aber auchwegen Bestechung. Trotz teilweise umfangreichen belastenden Materials und er-stinstanzlichen Schuldsprüchen ist Berlusconi nach wie vor nicht rechtskräftig ver-urteilt. Manche Ermittlungen und Verfahren wurden eingestellt, Schuldsprüche inhöheren Instanzen aufgehoben, meist wegen Verjährung oder aus Mangel an Bewei-sen. Inwieweit das Belastungsmaterial dennoch die Täterschaft nahe legt, bleibt demUrteil jedes einzelnen Bürgers überlassen – zumindest sind die Vorwürfe durch dieVerfahren öffentlich geworden. Kommt man zu dem Schluss, dass Berlusconi tat-sächlich Recht und Gesetz gebrochen hat, ist es allerdings fraglich, ob eine solchePerson zur Führung der Regierung geeignet ist.
9 Vgl. Hibberd, »La Rai e il governo di centro-destra: quale futuro per 50 anni di televisi-one pubblica?« aaO. (FN 6).
10 Vgl. detailliert das entsprechende Kapitel in Köppl, Das politische System Italiens, aaO(FN 3).
04_Köppl Seite 424 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 425
Stellt dies noch eher eine Frage des politischen Geschmacks dar, kam ein Aspektdes Problems hinzu, der unabhängig von der Schuldfrage Anlass zur Sorge gab: dieRhetorik Berlusconis, der allen gegen ihn ermittelnden und urteilenden Staatsan-wälten und Richtern politische Motive unterstellt. Dies unterminiert das Vertrauenin die Neutralität der Justiz und diskreditiert damit die Justiz insgesamt. Wenn auchden teilweise scharfen Angriffen aus dem Regierungslager gemeinhin kaum Tatenfolgten, ist doch mit einem Schaden durch die rhetorische Auseinandersetzung zurechnen. Inwiefern die Justizreform der Mitte-Rechts-Regierung die Unabhängig-keit der dritten Gewalt faktisch tangieren wird, ist umstritten; ob sie jemals in derursprünglichen Fassung vom Juli 2005 wirksam werden wird, ist fraglich, da dieneue Mitte-Links-Regierung bereits eine baldige Revision angekündigt hat.
Den schwerwiegendsten Aspekt dieses Problems stellte allerdings der auch hierbestehende Interessenkonflikt dar. Es gab mehrere Versuche, durch entsprechendeGesetze Berlusconi und seine Mitarbeiter vor drohenden Schuldsprüchen zu retten;hier seien drei der wichtigsten exemplarisch genannt:• Eine Reform der Gesetzgebung zur Bilanzfälschung beinhaltete im Wesentlichen
die Reduzierung des Strafmaßes, wodurch sich auch die Verjährungsfristen ver-kürzten. Dieses Gesetz führte direkt zur sofortigen Einstellung von Verfahrengegen Berlusconi.11
• Ein Gesetz, das einem Angeklagten erlaubt, die Verlegung des Prozessortes zubeantragen, wenn er berechtigte Zweifel an der Unparteilichkeit des Richters hat– was genau der Argumentation Berlusconis gegen die Mailänder Richter ent-spricht. (Dieses Gesetz trat zwar in Kraft, doch scheiterte ein entsprechender An-trag Berlusconis vor dem Kassationsgerichtshof.)
• Schließlich wurde ein Gesetz verabschiedet, das für die fünf höchsten StaatsämterImmunität einführte.12 Diese fünf Ämter waren der Staatspräsident, die Präsiden-ten der beiden Parlamentskammern, der Vorsitzende des Verfassungsgerichtsho-fes und der Regierungschef; damit wären also sämtliche Ermittlungen und Ver-fahren gegen Berlusconi gestoppt worden. Allerdings scheiterte dieses Gesetz beieiner Überprüfung durch das Verfassungsgericht.Obwohl die Gesetzgebung in eigener Sache zum Teil scheiterte und sich zum Teil
als unnötig erwies, bleibt doch zumindest ein schaler Beigeschmack, wenn nicht so-gar eine massive Schädigung des Vertrauens in die Rechtsordnung. Allerdings istdieses Kapitel noch nicht abgeschlossen: Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermitteltweiter und bereitet neue Anklagen gegen Berlusconi vor.
11 Der Versuch, dieses Gesetz auf europäischer Ebene zu kippen, scheiterte: Der Europäi-sche Gerichtshof erklärte es für rechtens; vgl. »Niederlage für Mailänder Staatsanwälte«in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.5.2005, S. 11.
12 Die parlamentarische Immunität war 1993 im Zuge der Korruptionsskandale abge-schafft worden.
04_Köppl Seite 425 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?426
Politischer Stil
Schließlich ist Berlusconis politischer Stil anzuführen.13 Populismus, Inhaltsleereund Inszenierung sind häufige Vorwürfe, die in diesem Zusammenhang genanntwerden. In der Tat ist erkennbar, dass manche der vielen abrupten Kursänderungenwohl dem Blick auf aktuelle Umfragewerte geschuldet sind. Ebenso ist eine Scheuvor konkreten Aussagen zugunsten wohlklingender, aber unverbindlicher Be-schwörungen der Freiheit festzustellen. Auch ist frappierend, welch große Auf-merksamkeit der Regierungschef seinem Erscheinungsbild widmet; Schönheitsope-rationen wie Haartransplantation oder Facelifting sind hier nur die augenfälligstenBeispiele, die auf Kosten von politischen Inhalten ausgiebig diskutiert werden.
Problematischer als Populismus und Inszenierung, die keine italienischen Spezi-fika darstellen, ist das persönliche Politikverständnis Berlusconis. Angetreten mitdem Anspruch, Italien wie ein Unternehmen zu führen, zeigt er keinerlei Sensibili-tät für Minderheiten- oder Oppositionsrechte. Nach seinem Bild von Politik sollder Gewinner der Wahl fünf Jahre lang frei von allen Beschränkungen schalten undwalten dürfen. Dies schlägt sich nicht nur darin nieder, dass Berlusconi sich selbst,weil faktisch direkt vom Volk legitimiert, auch den Koalitionspartnern gegenüberfür unantastbar hielt, sondern auch darin, dass er sich Belästigungen von nicht ge-wählten Institutionen wie der Justiz verbat. Die dem zugrunde liegende Idee derelective dictatorship ist aber gerade nicht das Ideal, sondern vielmehr die Gefahr, diemoderne gewaltenteilende Demokratien abzuwenden versuchen.
Eine entsprechende Einstellung zeigt Berlusconi gegenüber Kritik. SachlichenAuseinandersetzungen geht er meist dadurch aus dem Weg, dass er dem Kritikerjegliche Legitimation abspricht oder ihn als Kommunisten bezeichnet. Damitknüpft er an die historisch tief verwurzelte Spaltung des Landes in eine katholischeund eine kommunistische Subkultur sowie die Zeit des Kalten Krieges an. Vor demHintergrund, dass sich die italienische Linke längst vom Kommunismus abgewandthat und eher als sozialdemokratisch zu bezeichnen ist, trifft der Vorwurf durchaus,dass Berlusconi mit seiner Rhetorik nur die größtenteils überwundene ideologischeSpaltung künstlich aufrecht erhält und unnötig das politische Klima vergiftet. Aller-dings muss der Fairness halber hinzugefügt werden, dass der Stil der politischenAuseinandersetzung in Italien traditionell recht rau ist und der Vorwurf zum Teilauch an das linke Lager zu richten ist, wenn es den Faschismusvorwurf entspre-chend in Stellung bringt.14
Dass Berlusconi als politischer Quereinsteiger allzu oft jegliche Sensibilität aufdiplomatischem Parkett vermissen lässt, zeigt sich, wenn er Italien verlässt. Die Lis-te entsprechender Ausfälle würde die Grenzen dieses Beitrags sprengen. Zwar hatdiese Stilfrage nicht unbedingt essentielle Bedeutung, lässt aber tief blicken und fügtnicht zuletzt dem Bild Italiens im Ausland beträchtlichen Schaden zu.
13 Vgl. Braun, »Populismus an der Macht« aaO. (FN 2).14 Vgl. zu diesem Punkt exemplarisch die Berichterstattung zum Wahlkampf 2006, der
von Beobachtern in puncto politischer Stil als Tiefpunkt betrachtet wurde.
04_Köppl Seite 426 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 427
Dämme
Die geschilderten Probleme sind durchaus geeignet, Besorgnis um die Demokra-tie in Italien hervorzurufen. Nun soll untersucht werden, ob Berlusconi wirklichunbeschränkt schaltete und waltete oder ob es Gegenkräfte gab, die ihm Einhaltbieten. Hier sind zu nennen: die Justiz, die Beschaffenheit der Regierungskoalition,die Institutionen des zentralen politischen Entscheidungssystems und schließlichdie italienische Gesellschaft im allgemeinen.
Justiz
Obwohl sie noch keine rechtskräftige Verurteilung erreicht hat, stellt die italieni-sche Justiz einen der wichtigsten Kontrollmechanismen dar, nicht zuletzt indem siedie Vorwürfe öffentlich macht, so dass sich jeder Bürger für sich selbst ein Urteilbilden kann. Schließlich sucht die Unabhängigkeit der italienischen Justiz weltweitihresgleichen: Sie ist völlig autonom, keinen Weisungen aus der Exekutive unter-worfen und wählt sich ihre Selbstverwaltungskörperschaften, die über Organisationund Laufbahnfragen entscheiden, zum größten Teil selbst. Wie sehr diese Unabhän-gigkeit intakt ist, zeigen die nicht erlahmenden Ermittlungen sowie die Schuldsprü-che in erster Instanz.
Außerdem gibt es im Bereich der Judikative noch zwei Institutionen, die sich vonBerlusconi nicht beeindrucken lassen: Der Kassationsgerichtshof, der seinen Antragauf Prozessverlegung abgelehnt hat, wurde schon genannt. Weit bedeutender ist derVerfassungsgerichtshof, der z.B. das Gesetz zur Einführung der Immunität für diefünf höchsten Staatsämter für nichtig erklärt hat. Aber auch weit über die Vereite-lung von Gesetzgebung in eigener Sache hinaus hat sich das Verfassungsgericht alsbeachtliches Korrektiv erwiesen. Ein Beispiel ist das so genannte Bossi-Fini-Gesetz,das eines der Vorzeigeprojekte der Mitte-Rechts-Regierung war und drastischeMaßnahmen zur Bekämpfung illegaler Einwanderung vorsah. Dieses Gesetz wurdewegen Mängeln in den Bereichen Grundrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit ge-kippt. Auch im Bereich der Medien erweist sich der Verfassungsgerichtshof als einerder wichtigsten Gegenspieler Berlusconis. Er fällte bereits mehrere Urteile zurWahrung des Medienpluralismus, die rasche gesetzgeberische Maßnahmen seitensder Mitte-Rechts-Koalition erforderten, um den Status quo zu sichern.15 Das Katz-und-Maus-Spiel von Gerichtsurteil auf der einen Seite und legislativen Gegenmaß-nahmen auf der anderen Seite ging zwar bislang zu Gunsten Berlusconis aus, sorgteallerdings dafür, dass der Druck auf das Duopol aufrechterhalten wurde und dasThema auf der politischen und öffentlichen Agenda blieb. Eine Neugestaltung derMedienwettbewerbsordnung obliegt nun der neuen Mitte-Links-Regierung.
15 Vgl. Birgid Rauen, »Medien und Politik« in: Bernd Rill (Hg.), Italien im Aufbruch –eine Zwischenbilanz, München, S. 123-134.
04_Köppl Seite 427 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?428
Koalition
Der wichtigste Hemmschuh für effizientes Regieren waren seit Gründung derRepublik stets die intern sehr heterogenen und zerstrittenen Regierungskoalitionen.Mit genau diesem Problem hatte auch der Regierungschef Berlusconi zu kämpfen.16
Das Mitte-Rechts-Bündnis Casa delle libertà (Haus der Freiheiten) besteht im We-sentlichen aus vier Parteien:17 die regionalpopulistische Lega Nord, die aus den ehe-maligen Neofaschisten hervorgegangene Alleanza Nazionale (AN), die christdemo-kratische Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) undschließlich Berlusconis eigene Partei Forza Italia. Ganz abgesehen von den Proble-men, die sich durch die reine Anzahl der Partner ergeben, ziehen sich tiefe Gräbendurch dieses Zweckbündnis,18 von denen hier nur einige exemplarisch aufgeführtseien:• AN und Lega Nord sind im politischen Spektrum klar rechts positioniert, wäh-
rend Forza Italia als catch all-Partei und vor allem die UDC als christdemokrati-sche Zentrumspartei sich an der Mitte orientieren.
• Mit UDC und AN treffen Vertreter eines starken (Wohlfahrts-)Staates auf diemarktliberalen Forza Italia und Lega Nord, denen eher ein »Nachtwächterstaat«vorschwebt.
• Während AN und UDC ihre Wählerschaft vor allem im armen Süden haben,sieht sich die Lega Nord als Anwalt des reichen Nordens, dem die teure Förde-rung des Mezzogiorno viel zu weit geht. Entsprechend treffen hier gänzlich un-terschiedliche Staatsverständnisse aufeinander: Die Lega Nord verficht vehementdie Föderalisierung Italiens; dagegen setzt die AN auf den starken Zentralstaatund die unteilbare Einheit der Nation.
• Personell bringt nicht nur der schwer kalkulierbare Umberto Bossi (trotz seinergesundheitlichen Probleme) ein instabiles Element in die Koalition. Auch die Ri-valitäten um die Führungsrolle im Mitte-Rechts-Lager (bzw. die Frage der Nach-folge Berlusconis) sorgen für Zündstoff: Der subtil, aber zielstrebig taktierendeAN-Vorsitzende, ehemalige Vize-Regierungschef und Außenminister Gianfran-co Fini gilt als Hauptanwärter, aber auch Pierferdinando Casini (UDC) ist einmöglicher Kandidat.
16 Gianfranco Pasquino, »The government, the opposition and the President of the Repu-blic under Berlusconi« in: Journal of Modern Italian Studies 2003, S. 486-491. Vgl. auchRoland Höhne, »Regieren in Italien – Wie durchsetzungsfähig ist die Regierung Berlus-coni?« in: Bernd Rill (Hg.), Italien im Aufbruch – eine Zwischenbilanz, München 2003,S. 75-88.
17 Die beiden Splitterparteien, die ebenfalls die Regierung stützen und auch am Kabinetts-tisch Platz nehmen, die neuen Sozialisten und die Republikaner, sind von geringerBedeutung und werden bei den folgenden Ausführungen nicht weiter betrachtet.
18 Die Kombination von relativer Mehrheitswahl in den Wahlkreisen und zersplittertemParteiensystem führte dazu, dass sich die Koalitionen anlässlich der Wahl aus rein takti-schen Erwägungen und nicht aufgrund programmatischer Gemeinsamkeiten bilden.Daran änderte auch die Wahlrechtsreform von 2005 nichts. Vgl. auch Ilvo Diamanti /Elisa Lello: »The Casa delle Libertà: A House of Cards?« in: Modern Italy 2005, S. 9-35.
04_Köppl Seite 428 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 429
• Strukturell bildet sich in der Mitte-Rechts-Koalition eine Konfliktlinie zwischen»alter« und »neuer« Politik ab: UDC und AN sind trotz aller Umbenennungen,Abspaltungen und Umorientierungen Parteien, deren Wurzeln noch bis vor denZweiten Weltkrieg reichen; dementsprechend wurde ihr politisches Personal völ-lig zu Zeiten der so genannten »Ersten« Republik, also vor den 1990er Jahren, so-zialisiert und pflegt den partikularistischen Politikstil des Proporzsystems. Ge-nau mit diesem Politikstil wollen Lega Nord und Forza Italia brechen; sieverstehen sich als radikale Neuerer einer »Zweiten« Republik, sind zu einem be-trächtlichen Teil politische Newcomer und sorgen mit undiplomatischem Verhal-ten für Aufruhr (vgl. oben).Durch diese Konstellation mehrerer, sich überkreuzender Konfliktlinien befand
sich die Mitte-Rechts-Regierung de facto in demselben Zustand der Dauerkrise, derschon für die früheren Kabinette kennzeichnend war: Die Lega Nord drohte mitVerlassen der Koalition, wenn nicht die große Föderalismusreform beschlossenwird; die UDC drohte mit ihrem Ausstieg, wenn nicht Bossi seine Beschimpfungender Vertreter der alten DC (»Diebe«) zurücknimmt; und die AN drohte mit demRegierungssturz, wenn nicht die Förderung des Südens intensiviert wird. Das The-ma einer Überprüfung der Zusammenarbeit und eventuell einer Kabinettsumbil-dung war damit permanent auf der politischen Agenda.
So musste z.B. im Sommer 2004 der Wirtschafts- und Finanzminister Giulio Tre-monti auf Druck der AN zurücktreten, weil der Berlusconi-Vertraute eine zu wirt-schaftsorientierte Politik vertreten hatte. Als Berlusconi das Amt selbst übernehmenwollte, schrie die UDC auf – und setzte durch, dass der Posten neu besetzt wurde.Zuvor war schon der Versuch des Regierungschefs gescheitert, das Amt des Außen-ministers in Personalunion zu übernehmen; nach einigem Widerstand mussteBerlusconi nolens volens Gianfranco Fini mit dieser staatstragenden Aufgabe be-trauen. Auch in puncto Justiz konnte sich Berlusconi auf seine Koalitionspartner al-les andere als verlassen: Als z.B. im Juli 2003 der Justizminister ein Rechtshilfeersu-chen der Mailänder Ermittler an die USA blockierte, lief die UDC Sturm und setztedie Weiterleitung des Ersuchens durch.19
Den Höhepunkt erreichten die internen Koalitionsquerelen im April 2005, alsnach einer verheerenden Niederlage des Mitte-Rechts-Bündnisses bei den Regional-wahlen AN und UDC Berlusconi zum Rücktritt zwangen. Zwar stellten sie wederdie Koalition noch Berlusconi als Regierungschef in Frage, doch konnten sie als Be-dingung für die erneute Regierungsbildung (wenn auch geringe) personelle undprogrammatische Zugeständnisse erreichen, z.B. eine verstärkte Förderung der Fa-milien und des Südens.
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Berlusconi die Zügel seiner Regie-rung keineswegs fest in der Hand hielt. Statt autonom zu entscheiden oder zu füh-ren, musste er einen Großteil seiner Energie mit Verhandeln, Überreden, Moderie-ren und Vermitteln verbringen – ganz so wie seine zahlreichen Vorgänger in diesemAmt.
19 »Bahn frei für die Rechtshilfe in Italien«, in: Neue Zürcher Zeitung vom 30.07.2003.
04_Köppl Seite 429 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?430
Institutionen
Neben Justiz und Koalitionspartnern finden sich in Italien zahlreiche weitereVorkehrungen, die einer Machtanhäufung entgegenstehen.20 Die italienische Institu-tionenordnung wurde nach der Erfahrung des Faschismus sogar bewusst mit demZiel möglichst breiter Machtdiffusion entworfen. So ist der italienische Regierungs-chef bedeutend schwächer als seine Kollegen in vergleichbaren Demokratien. Z.B.fehlt ihm als Führungsinstrument die Möglichkeit seine Minister zu entlassen, wasdazu führt, dass diese kaum in eine Kabinettsdisziplin einzubinden sind und folg-lich hochgradig unkoordiniert, z.T. sogar gegeneinander agieren. Damit wird auchdie formal vorhandene Richtlinienkompetenz des Regierungschefs wirkungslos.
Die Schwäche italienischer Regierungen lässt sich schon an ihrer bloßen Zahl ab-lesen: Das im April neu eingesetzte dritte Kabinett Berlusconi war das 60. seit 1945.In der Tat fehlt der italienischen Verfassung eine stabilisierende Bestimmung wie daskonstruktive Misstrauensvotum; auch genügt schon der Vertrauensentzug in einerder beiden Kammern, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Im Zusammen-wirken mit den Eigenheiten des Parteiensystems (z.B. Ausschluss der Kommunis-ten, jetzt die bipolare Lagerstruktur) ergibt sich so eine äußerst geringe Hemm-schwelle zum Regierungssturz, die auch an den bereits genannten Geschehnissen imApril 2005 abzulesen ist.
Damit zusammenhängend ist die strukturelle Verbindung zwischen Regierungund Parlamentsmehrheit, die an sich funktionslogisch und erforderlich für parla-mentarische Regierungssysteme ist, in Italien nur schwach ausgeprägt. Vielmehr ste-hen sich Parlament und Regierung als relativ unkoordinierte Machtzentren gegenü-ber. Nicht nur am häufigen Sturz der Regierung wird dies deutlich, sondern auch inder Gesetzgebung: Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der beschlossenen Gesetzegeht auf die Initiative der Regierung zurück, die Erfolgsaussichten der Regierungs-vorlagen sind alles andere als sicher und Abstimmungsniederlagen für die Regie-rungskoalition keine Seltenheit.21 So musste Berlusconi zwischen Juni 2001 undApril 2005 insgesamt 23 Mal die Vertrauensfrage stellen, um die eigenen Parlamen-tarier zu disziplinieren.
Auch kommt die Gesetzgebung im Allgemeinen recht schwerfällig voran. Durchdas so genannte »perfekte Zweikammersystem« (bicameralismo perfetto) müssenalle Gesetze von beiden Kammern im identischen Wortlaut verabschiedet werden;ein Schlichtungsorgan wie den Vermittlungsausschuss gibt es nicht, so dass Gesetzezuweilen mehrmals zwischen den Kammern hin- und herpendeln. Vor dem Hinter-grund der in Italien sehr schwach ausgeprägten Fraktionsdisziplin ist die Gesetzge-bung somit ein schwieriges Unterfangen mit ungewissem Ausgang, das viel Über-zeugungsarbeit verlangt.
20 Vgl. Höhne, »Regieren in Italien« aaO. (FN 16).21 So z.B. bei dem umstrittenen Mediengesetz, das erst nach mehreren Anläufen die Hür-
den im Parlament nahm. Vgl. zum Thema Regierung und Gesetzgebung exemplarischGiliberto Capano / Marco »Giuliani, »Governing Without Surviving? An Italian Para-dox: Law-Making in Italy, 1987-2001« in: Journal of Legislative Studies 2001, S. 13-36.
04_Köppl Seite 430 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 431
Ein weiteres Gegengewicht ist der Staatspräsident, der zwar institutionell rechtschwach, aber dennoch eine nicht zu unterschätzende Instanz ist.22 Sein schärfstespolitisches Instrument ist das suspensive Veto: Er kann ein verabschiedetes Gesetzzur erneuten Beratung an die Kammern zurückverweisen, wobei er sich auf verfas-sungsrechtliche, aber auch politische Gründe berufen kann. Zwar können Abgeord-netenhaus und Senat dieses Veto überwinden, indem sie das Gesetz erneut verab-schieden, doch stellt dies im Lichte der oben geschilderten schwierigenMehrheitsbildung weit mehr als eine bloße Formalität dar. Von diesem Instrumenthatte Carlo Azeglio Ciampi während der Regierungszeit Berlusconis zweimal Ge-brauch gemacht: Bei dem umstrittenen Mediengesetz, das dann ein paar Monatedarauf erneut verabschiedet wurde, und bei der Justizreform, die das suspensiveVeto ebenfalls überstand. Ein wichtiger Faktor war außerdem das sehr hohe Anse-hen, das sowohl das Amt, aber auch speziell die Person Ciampi in der Öffentlichkeitgenossen. So wirkte der Staatspräsident auch weniger formell als vielmehr informelldurch mahnende Worte, die bei aller Diplomatie zwischen den Zeilen die Adressa-ten deutlich erkennen ließen. Dass diese Appelle alles andere als wirkungslos waren,zeigten die Bemühungen Berlusconis um ein zumindest nach außen hin gutes Ver-hältnis zu Ciampi.
Schließlich ist noch das Referendum zu erwähnen. In Italien können Gesetzedurch eine Volksabstimmung abgeschafft werden, wenn sich mehr als die Hälfte derWahlberechtigten daran beteiligen. Dieses Instrument hat seit den 1970er Jahren be-trächtliche Wirkungen auf die italienische Politik entwickelt, unter anderem wurdeauf diesem Wege die Wahlrechtsreform erzwungen. Zwar zeigen die Italiener in denletzten Jahren eine gewisse Referendumsmüdigkeit, doch ist diese letzte Verteidi-gungslinie nicht zu unterschätzen. So wurden schon gegen mehrere problematischeVorhaben der Regierung Berlusconi seitens der Opposition Volksabstimmungenangedroht, z.B. gegen die erwähnte Justizreform; diese sollten sich allerdings mitdem Regierungswechsel erledigt haben. Anderen bereits beantragten Referenden,z.B. gegen das Immunitätsgesetz, kam der Verfassungsgerichtshof zuvor.23
Die zweite italienische Variante der Volksabstimmung, das Verfassungsreferen-dum, erwies sich ebenfalls als wirkungsvolle Verteidigungslinie: Eine breit angelegteVerfassungsreform der Mitte-Rechts-Regierung, die unter anderem eine Föderali-sierung Italiens und eine Stärkung des Regierungschefs beinhaltet hätte, wurde am25. und 26. Juni 2006 den Wählern zur Abstimmung vorgelegt. Kritiker hatten die-ser Reform vorgeworfen, sie stelle einen Schritt in Richtung Autoritarismus dar. In-wieweit diese Kritik zutraf, ist inzwischen hinfällig: Die Reform scheiterte eindeutigan den Urnen. 61,3% der Abstimmenden sprachen sich gegen sie aus; nicht einmaldas Mitte-Rechts-Bündnis, das die Reform ursprünglich verabschiedet hatte, unter-stützte sie geschlossen.24
22 Vgl. Pasquino, »The government, the opposition and the President of the Republicunder Berlusconi« aaO (FN 16), S. 494-495.
23 Vgl. Augusto Barbera / Andrea Morrone, La Repubblica dei referendum, Bologna 2003.24 »Verfassungsänderung in Italien offenbar gescheitert«, in: Süddeutsche Zeitung vom
27.06.2006.
04_Köppl Seite 431 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?432
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die italienische Institutionenordnung so sehrauf checks and balances setzt, dass – ganz unabhängig von Berlusconi – ihr Problemvielmehr in zu großer Machtdispersion und daraus resultierender mangelnder Steu-erungsfähigkeit liegt als in zu großer Machtkonzentration.
Gesellschaft
Schließlich sind Aspekte der italienischen Gesellschaft zu nennen, die dem »Phä-nomen Berlusconi«“ Einhalt boten. Hier ist zunächst festzuhalten, dass die Italienereine beträchtliche Skepsis dem Staat und der Politik gegenüber hegen. Diese politi-sche Kultur erschwert nicht nur ganz allgemein politische Steuerung, sondern auchManipulation. Denn die Skepsis erstreckt sich auch auf die Medien: Politischer Ein-fluss auf die Medien ist in Italien nichts außergewöhnliches, sondern der Normal-fall. Nicht nur war das staatliche Fernsehen schon seit seinen Anfängen immer par-teipolitisch geprägt (s. oben), auch die meisten Zeitungen zeigen eine so klareRichtung, dass sie jedem bekannt ist.25 Der Gedanke, von Medien sei eine vollkom-men neutrale Berichterstattung oder gar die ungefilterte objektive Wahrheit zu er-warten, ist in Italien traditionell nicht vorhanden. Dementsprechend unbeeindrucktzeigen sich auch die Italiener gegenüber Manipulationsversuchen.
Wie oben erläutert, besitzt Berlusconi großen Einfluss auf einen beträchtlichenTeil der wichtigsten Medien, den er auch nutzt. Seit 2001 kam auch noch Einflussauf die staatlichen Medien hinzu, der ebenfalls ausgeübt wurde. Berlusconi befandsich also während der letzten Legislaturperiode auf dem Zenit seiner Medienmacht.Wenn man davon ausgeht, dass Medieneinfluss sich im politischen Erfolg ummün-zen lässt, hätte Berlusconi fester im Sattel sitzen müssen denn je zuvor. Doch dasGegenteil war der Fall: Seit seiner Regierungsübernahme waren Berlusconis Popu-laritätswerte stetig im Sinken und die Mitte-Rechts-Koalition musste auf allen Ebe-nen eine Wahlschlappe nach der anderen hinnehmen. Exemplarisch genannt seienhier nur die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2004, in der die ForzaItalia im Vergleich zu 2001 ein Drittel ihrer Wähler verlor, und die schon erwähntenRegionalwahlen 2005, in denen von dreizehn Regionen elf an das oppositionelleMitte-Links-Bündnis gingen.26 Berlusconi galt als entzaubert, was sich auch an derAnzweiflung seines Führungsanspruchs und dem Regierungssturz vom April 2005niederschlug. Anders ausgedrückt: Die Medienmacht Berlusconis zeigte in Wahlennicht den geringsten Effekt, ganz Gegenteil – die Italiener schienen Berlusconisüberdrüssig zu sein. Eines der Hauptprobleme erwies sich damit als offensichtlichungefährlich – auch wenn die Aufholjagd im Wahlkampf 2006 unter anderem auchdurch den privilegierten Medienzugang zu erklären sein dürfte.27
25 Vgl. Große / Trautmann, Italien verstehen, aaO (FN 7).26 Aldo di Virgilio, »The Italian Regional Elections of April 2005: Does the Triumph of
the Union Signal the End of the Berlusconi Era?« in: South European Society & Politics2005, S. 477-490.
27 Vgl. Gian Enrico Rusconi, »Die Mediendemokratie und ihre Grenzen – am Beispiel vonBerlusconis Italien« in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 35-36/2004, S. 32-38.
04_Köppl Seite 432 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 433
Schließlich ist festzustellen, dass die überaus lebendige italienische Protestkulturauch durch Totschweigen in den Medien nicht zum Erlahmen gebracht werdenkonnte. Dies zeigen die massiven öffentlichen Proteste und Demonstrationen, dievon einer außerparlamentarischen Opposition (die so genannte Ringelreihen-Bewe-gung, girotondi) seit 2001 gegen die Regierung Berlusconi veranstaltet wurden. Ih-ren Höhepunkt erreichten sie in der Verbindung mit den Protesten gegen den Irak-Krieg, die in Italien den größten Zulauf in Europa erhielten.28 Auch die Gewerk-schaften erweisen sich als starke Akteure: In der Regierungszeit Berlusconis gab esvier Generalstreiks, die jedes Mal die Regierung zum Einlenken zwangen.29
Also gibt es auch außerhalb der genuin politischen Sphäre starke und wider-standsfähige Kräfte, die sich einer mediengestützten Manipulation oder gar ver-meintlicher Gleichschaltung effektiv entgegenstellen.
Ausblick
Die bisherigen Ausführungen konzentrierten sich auf das »Phänomen« Berlusco-ni, das außerhalb Italiens die Wahrnehmung stark prägt. Doch steht Italien auch un-abhängig von Berlusconi vor gewichtigen Problemen, die dringend einer Lösungbedürfen:
Wie vergleichbare Staaten kämpft auch Italien mit dem sozio-ökonomischenStrukturwandel. Eine gewaltige Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, geringesWirtschaftswachstum und marode Sozialversicherungssysteme belasten Staat undGesellschaft. Hier steht der schmerzliche Reformprozess noch bevor, zumal die Re-gierung Berlusconi auf diesem Feld ihre Versprechungen nicht erfüllen konnte.30
Nach wie vor stellt das fragmentierte Parteiensystem ein großes Problem für diepolitische Handlungsfähigkeit dar. Sowohl Mitte-Rechts wie Mitte-Links setzensich aus vielen Parteien mit heterogenen inhaltlichen Positionen zusammen, so dassschon für die Willensbildung innerhalb der Bündnisse erhebliche Kräfte aufgewen-det werden müssen. Die neue Regierungskoalition unter Romano Prodi scheint so-gar noch zerstrittener als die alte – zumindest was die Anzahl der Parteien und dieinhaltlichen Streitpunkte angeht.31
28 Donatella della Porta / Mario Diani, »’Contro la guerra senza se né ma’: le proteste con-tro la guerra in Iraq« in: Vincent della Sala / Salvatore Vassallo, (Hg.): Politica in Italia. Ifatti dell’anno e le interpretazioni, Bolgna 2004, S. 249-269.
29 Selbst die Arbeitgeber, die Berlusconi eigentlich freundlich gesinnt sein müssten, stellensich immer öfter – z.T. zusammen mit den Gewerkschaften – gegen ihn. So forderte derPräsident des Arbeitgeberverbandes, Luca di Montezemolo, anlässlich der Regierungs-krise im April 2005 unverblümt Neuwahlen.
30 Vgl. Helmut Drüke, »Europas Stiefel drückt und zwickt – Grundprobleme der Wirt-schaft Italiens« in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 35-36/2004, S. 18-25.
31 Vgl. Pasquino, »The government, the opposition and the President of the Republicunder Berlusconi« aaO (FN 16), S. 491-494 und Gianfranco Pasquino, »Too ManyChiefs and Not Enough Indians: The Leadership of the Centre-Left« in: Modern Italy2005, S. 95-108.
04_Köppl Seite 433 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr?434
Problematische Aspekte der politischen Kultur wie Staatsferne und Politikver-drossenheit wurden schon angesprochen. Hinzu kommt der unüberwundene Ge-gensatz zwischen Nord und Süd, auf dem der Erfolg der regionalistischen LegaNord beruht. Der wirtschaftlich rückständige Süden wird im Norden als faul undz.T. sogar ethnisch minderwertig angesehen, was separatistischen Tendenzen Vor-schub leistet.
Schlussendlich ist die italienische Verfassung dringend reformbedürftig, um diepolitische Steuerungsfähigkeit zu erhöhen. Dieses Thema befindet sich seit überzwanzig Jahren auf der politischen Agenda, doch sind bisher trotz mancher ergriffe-nen Einzelmaßnahmen alle groß angelegten Reformversuche gescheitert.32 Nachdem Fehlschlag der Verfassungsreform der Mitte-Rechts-Koalition ist es fraglich,ob solche großen Würfe überhaupt eine zielführende Strategie sind .
Nach diesen Überlegungen lässt sich das Ergebnis auf einen Punkt bringen: Itali-en sieht sich zahlreichen Problemen gegenüber – Berlusconi war eines davon, abersicherlich nicht das dringendste. Und die Abwahl der Mitte-Rechts-Regierung hattrotz des knappen Ergebnisses gezeigt, dass Italien trotz aller Medienmacht weitentfernt von einer Mediendiktatur ist.
Zusammenfassung
Die Regierung Berlusconi wurde seit 2001 von Beobachtern mit großen Sorgengesehen; sogar von einer Bedrohung der italienischen Demokratie wurde gespro-chen. Dabei wurden vor allem vier Probleme angeführt: der InteressenkonfliktBerlusconis als Unternehmer und Regierungschef; die Medienmacht aus der Verbin-dung von Berlusconis Medienimperium mit dem Einfluss auf den Staatsrundfunk;das Verhältnis zur Justiz; und schließlich der konflikthafte politische Stil. DiesenProblemen standen jedoch zahlreiche und wirksame Sicherungsmechanismen deritalienischen Politik gegenüber: die unabhängige Justiz; die widerstrebenden Koali-tionspartner, mit denen sich Berlusconi auseinandersetzen muss; die auf Machttei-lung angelegte Institutionenordnung; und schließlich die italienische Gesellschaftselbst. Es zeigte sich, dass sich die italienische Demokratie den genannten Proble-men gegenüber als resistent erwies.
Summary
Many observers considered the Berlusconi government since 2001 with deep sor-row, even as a threat to Italian democracy. Above all, four problems had to beadressed: Berlusconi’s conflict of interest as businessman and Prime Minister; hisample media power, resulting from the ownership of a big media enterprise and go-vernment influence on public broadcast; the permanent struggle with justice; and
32 Vgl. Stefan Köppl, »Vergebliches Bemühen um Veränderung: Gescheiterte Anläufe zurReform der italienischen Verfassung« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 2/2003, S.310-329.
04_Köppl Seite 434 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Stefan Köppl · Italien unter Berlusconi – eine Demokratie in Gefahr? 435
his conflictive policy-style. But there were also several checks and balances in Itali-an politics which opposed these problems: the highly independent justice; Berlusco-ni’s reluctant coalition partners; the institutional setting plainly designed for the dif-fusion of power; and last but not least Italy’s civil society. In the end, Italiandemocracy proved to be resistant to the problems mentioned above.
04_Köppl Seite 435 Donnerstag, 9. November 2006 2:14 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair
Die Interessen und Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit in Südtirol
1. Einführung
Anhand des Beispiels Südtirol wird im vorliegenden Aufsatz ein Ausschnitt ausder Westpolitik der DDR sowie die Rolle ihrer auslandsgeheimdienstlichen Aktivitä-ten im politischen System beleuchtet. Zudem wird aufgezeigt, welcher Methoden sichdas Ministerium für Staatssicherheit bediente, um außenpolitische Maßnahmen zubegleiten. In der Geschichte Südtirols gab es zwei heiße Phasen, in dem das Land süd-lich des Brenners von demonstrativen Attentaten und blutigen Anschlägen erschüt-tert wurde, zwei Phasen, die sich für die Einmischung ausländischer Geheimdienste,und überhaupt für nachrichtendienstliche Aktivitäten besonders eigneten. Das warendie sechziger gleichermaßen wie die achtziger Jahre. In diesem Fall gab es aber keineGuerilla, die die DDR zu einem Stellvertreterkrieg anheizen konnte. So stellt sich dieFrage, was der Geheimdienst des selbsterklärten ersten antifaschistischen Staates aufdeutschem Boden nur mit neonazistischen Terroristen teilte, die in den achtziger Jah-ren hinter den grausamen Anschlägen südlich des Brenners steckten. Die Antwortliegt nahe: Es handelte sich um eine rein strategisch begründete Kontaktaufnahme.Die vorliegende Analyse wird zeigen: Weder die Südtiroler noch die Italiener warendie eigentlichen Adressaten der Einmischung. Es steckte eine Strategie hinter denMaßnahmen, die letztlich auf die internationale Stärkung der DDR auf Kosten derBundesrepublik abzielte. Um aufzuzeigen, wie es überhaupt zu den heißen Phasen inSüdtirol kam, die Ost-Berlin für sich zu nutzen versuchte, sei zunächst ein histori-scher Rückblick auf das Land zwischen Brenner und Salurner Klause erlaubt.
2. Die Politische Situation des geteilten Tirols von 1919 bis 1989
Wie zahlreiche Konflikte Europas, wurzelte auch das Südtirolproblem letztlich ineinem Pariser Vorortfriedensvertrag von 1919, in diesem Fall des von Saint Ger-main, in dem das Gebiet Italien zuerkannt wurde. Es folgte recht bald eine Italieni-sierungspolitik, der das sogenannte 32-Punkte-Programm des Senators auf Lebens-zeit, Ettore Tolomei, zugrunde lag. Derselbe Tolomei hatte schon die italienischeFriedensdelegation in Paris beraten. Am 22. Juni 1939 schlossen Hitler und Musso-lini dann das Abkommen zur Umsiedlung der Südtiroler in das Deutsche Reich, diesie vor die Wahl zwischen Abschiebung aus der Heimat oder Zwangsassimilationim faschistischen Italien stellten. Südtirol stand dann von September 1943 bis Mai1945 de facto unter der Zivilverwaltung des nationalsozialistischen Deutschen Rei-
05_Koller-Seizmair Seite 436 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol437
ches im Rahmen der Operationszone Alpenvorland. Nach dem Zweiten Weltkriegschließlich, im Jahr 1946, sollte das in Paris unterzeichnete österreichisch-italieni-sche Gruber-De Gasperi-Abkommen eine Lösung der Südtirolfrage bringen.1
Die darin zugesicherte Autonomie setzte Italien faktisch nicht um. Die römischeRegierung baute Industrieanlagen und Sozialwohnungen im bäuerlichen Südtirol.2
Süditalienische Arbeiter sollten davon profitieren. Massen von ihnen kamen und lie-ßen sich für immer nieder. In den fünfziger Jahren fürchteten die Südtiroler schonwieder, zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Junge Einheimische bekamenkeine Anstellung. Die Landeshauptstadt Bozen wurde in der Zeit mehrheitlich italie-nisch. So spitzte sich die Situation zu. Nach der Zeit des Faschismus regte sich nunerneut Widerstand unter den Südtirolern. Zunächst waren es nur Parolen, an Häuser-wände geschrieben. In den Jahren 1956 und 1957 verübte die sogenannte Stieler-Gruppe erste kleine Anschläge, mit geringem Sachschaden. In der Nacht zum 30. Ja-nuar 1961 in Waidbruck im Südtiroler Eisacktal sprengten ein paar Tiroler, die sichzum Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) zusammen geschlossen hatten, ein Denkmaldes Duce Benito Mussolini aus Aluminium. Die Hinterlassenschaft aus der Zeit desitalienischen Faschismus war für die Südtiroler eine Provokation. Sie wurden ständigan die Zeit nach dem Hitler-Mussolini-Abkommen von 1939 erinnert. Der BAS ope-rierte im Untergrund in rund 30 kleinen Zellen. Initiiert wurde die Gruppe in Südti-rol von Sepp Kerschbaumer und weiteren Gefährten. Diese Männer waren vorwie-gend bäuerlich, traditionell katholisch geprägt. Von Nordtirol aus unterstützen sieKünstler und Intellektuelle, einige davon einst im Widerstand gegen Hitler. In einemwaren sie sich auf beiden Seiten des Brenners einig: Die italienische Staatsmacht sollteaufschrecken und die Weltöffentlichkeit endlich auf die Menschenrechtsverletzungenblicken. Kein Blut sollte dabei fließen. Über den Weg gab es aber Debatten: Die Süd-tiroler Gruppe um Sepp Kerschbaumer wollte die Staatsmacht mit einzelnen An-schlägen, wie Nadelstiche, zermürben. Die Nordtiroler hielten mehr vom großenSchlag.3 BAS-Mitglied Georg Klotz aus Walten im Südtiroler Passeiertal hatte an ei-nen regelrechten Guerillakampf gedacht und hielt daher engeren Kontakt zu denNordtirolern. Um die Sicherheitskräfte des italienischen Staates zu erschrecken undbloßzustellen, überfiel er Carabinieri und schoss absichtlich über ihre Köpfe hinweg.4
Die anderen Südtiroler holten in der sogenannten Feuernacht auf den 12. Juni1961 doch noch zum großen Schlag aus, als sie Dutzende Strommasten sprengten.Zum militärischen Untergrundkampf, wie sich ihn Klotz dachte, kam es nie. Nurwenige Wochen nach den Anschlägen reagierte der italienische Staat: Die Polizeinahm bis Ende Juli 1961 fast 80 Südtiroler fest, bis Ende September stieg die Zahlder Festnahmen auf fast 140.5 Unter brutaler Folter wurden sie verhört. Der Befrei-
1 Rolf Steininger, Südtirol im 20. Jahrhundert, Innsbruck 1997, S. 13-385.2 Sepp Mitterhofer, »Warum wir nicht zusehen konnten« in: ders., / Günther Obwegs
(Hg.), Es blieb kein anderer Weg, Bozen 2000, S. 35ff.3 Eva Klotz, Georg Klotz. Freiheitskämpfer für die Einheit Tirols, Wien 2002, S. 73.4 Klotz, Georg Klotz. Freiheitskämpfer für die Einheit Tirols, aaO. (FN 3), S. 106ff.5 Luis Gutmann, »Die Cura Speciale« in: Mitterhofer u.a. (Hg.), Es blieb kein anderer
Weg, aaO. (FN 2), S. 65ff.
05_Koller-Seizmair Seite 437 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol438
ungsausschuss zerfiel. Georg Klotz flüchtete nach Österreich. Aber weiterhin ex-plodierten Bomben. Neue Attentäter kamen hinzu. Echte Rechtsradikale, wie derGründer der Nationaldemokratischen Partei Österreichs, Norbert Burger, aberauch undurchsichtige Scharfmacher. Inzwischen floss Blut in Südtirol und Italien,Mörder mischten sich unter die Bombenleger. Eine Kofferbombe riss am 20. Okto-ber 1962 den Bahnarbeiter Gaspare Erzen in Verona in den Tod, zudem wurdenweitere Menschen verletzt. Ein zweiter Koffer explodierte am Bahnhof von Trient.Prompt distanzierte sich der Befreiungsausschuss für Südtirol von den grausamenAkten. Auch die Rechten bekannten sich nicht dazu. Ehemalige Südtirolaktivistenrechnen das mysteriöse Attentat einem östlichen Geheimdienst zu.6
Diese erste Phase der Spannung hielt bis zum österreichisch-italienischen Ab-kommen von Kopenhagen im Jahr 1969 an. Darin wurde ein Operationskalenderund ein Maßnahmepaket zur Verwirklichung einer Autonomie für Südtirol, das so-genannte Südtirolpaket, sowie die Rücknahme eines italienischen Veto gegen die ös-terreichischen Assoziierungsbestrebungen mit der EWG vereinbart. Es dauerte je-doch noch mehr als zwei Jahrzehnte, bis die italienische Seite ihre Zusagenverwirklichte und der Streit beigelegt werden konnte. Zwischenzeitlich, in den Jah-ren zwischen 1978 und 1982, erschütterten erneut Sprengstoffmorde das Land zwi-schen Brenner und Salurner Klause. Inzwischen waren zwei italienische Gruppenund eine deutsche Gruppe neu auf den Plan getreten: Movimento Italiano Alto Adi-ge (Mia) und Associazione Protezione Italiani (Api) sowie »Tirol«. In seinem Buch»Bomben aus zweiter Hand« vertritt der Publizist Hans Karl Peterlini die These,dass es eine Verbindung zwischen dem italienischen Südtirol-Terrorismus von Miaund dem italienischen Geheimdienst Gladio gegeben habe. Die Existenz von Gladiowurde erst 1990 öffentlich bekannt, bis dahin entzog sich der Dienst fast vollkom-men der öffentlichen Kontrolle. Im Zeitraum zwischen 1986 und 1988 verübte eineTerrorgruppe namens »Ein Tirol« blutige und sogar tödliche Attentate, die von kei-ner politischen Vereinigung in Südtirol unterstützt wurden. Der Name der Gruppetäuschte, die Bomben in jenen Jahren hatten nur vorgeblich etwas mit Freiheits-kampf zu tun. Nachweislich setzte sie sich aus Rechtsradikalen und Kriminellen zu-sammen. Und ihre Attentate erreichten genau das Gegenteil von dem angeblich er-strebten Ziel der Freiheit für Südtirol: So wurde etwa die post-faschistische ParteiMSI in Südtirol in dieser Zeit der Terrorakte dreimal stärker. Inzwischen wird dieGruppe »Ein Tirol« sogar als von italienischen Geheimdienstkreisen ferngelenktangesehen, möglicherweise mit dem Ziel, die vollständige Umsetzung des Autono-miestatuts zu behindern.7 Der Einsatz für die Selbstbestimmung geriet nun endgül-tig in Verruf.
6 Erhard Hartung, »Südtiroler Freiheitskampf – als Österreicher im Dienst der Sache« in:Mitterhofer u.a. (Hg.), Es blieb kein anderer Weg, aaO. (FN 2), S. 289.
7 Hans Karl Peterlini, »Die Achse am Brenner. Die Rolle der Geheimdienste seit den 70erJahren, Südtirol zwischen Gladio und Stasi« in: Gerald Steinacher, Im Schatten derGeheimdienste, Innsbruck 2003, S. 229ff.
05_Koller-Seizmair Seite 438 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol439
Am 11. Juni 1992 schließlich vollzog Österreich den Abschluss der Südtirolver-handlungen mit der Abgabe der Streitbeilegungserklärung vor den Vereinten Natio-nen.
In beiden Attentatsphasen, die von ganz unterschiedlicher Ausrichtung, Zielset-zung, Qualität und Effizienz waren und vor gänzlich verschiedenem Hintergrundstattfanden, könnten östliche Geheimdienste aktiv auf verschiedenen Ebenen invol-viert gewesen sein. Die folgende Untersuchung wird zeigen, dass das Ministeriumfür Staatssicherheit in den achtziger Jahren nachweislich Mitwisser von Sprengstoff-anschlägen war. Für die sechziger Jahre gibt es immerhin Indizien für Einmi-schungsversuche. Nachgewiesen ist für diesen Zeitraum, dass Ost-Berlin propagan-distisch aus dem Gewaltgeschehen Nutzen zog. In den folgenden Abschnitten wirdaber zunächst einmal die Rolle des Geheimdienstes im politischen System Ost-Ber-lins erläutert sowie grundsätzliche Ziele der Außenpolitik aufgezeigt, ohne derennähere Betrachtung begleitende Maßnahmen der Staatssicherheit nicht zu verstehensind.
3. Die Aktivitäten im politischen System: Das MfS – Schild und Schwert der Partei – Vollstrecker einer tschekistischen Außenpolitik
Die jeweiligen Minister für Staatssicherheit in der DDR bekannten sich alle zumPrimat der Partei im Staat. Der erste Minister jedoch, Wilhelm Zaisser, hatte lautStaatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht die Parteiarbeit unterschätzt und war gleichnach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 entlassen worden. Sein Nachfolger, ErnstWollweber, bezeichnete die Stasi 1954 auf dem IV. Parteitag der SED als »ein schar-fes Schwert..., mit dem unsere Partei den Feind unerbittlich schlägt«. Erich Mielke,der letzte Minister für Staatssicherheit prägte dann auf dem Kampftreffen des MfSzum 35. Jahrestag seiner Gründung 1985 den Satz: »Die Staatssicherheit wird sichjederzeit als zuverlässiger Schild und scharfes Schwert der Partei und der Arbeiter-und Bauern-Macht erweisen«.8
In Richtlinien, Dienstanweisungen und Befehlen der Stasi wurde denn auch aus-drücklich auf Parteibeschlüsse Bezug genommen. Der stellvertretende Stasi-Minis-ter Wolfgang Schwanitz sagte noch wenige Wochen vor dem Mauerfall: »Die weite-re Stärkung der Kampfkraft der Partei erfordert, dass jeder einzelne Tschekistseinen Kampfposten in und außerhalb des Dienstes bezieht.« Zur näheren Erläute-rung: Die Mitarbeiter der Minister begriffen sich selbst als Tschekisten, in Erinne-rung an die Vorläuferinstitution der sowjetischen Sicherheitsorgane, der Tscheka.Im folgenden wird von tschekistischer Außen- und Deutschlandpolitik die Redesein, da auch dieser Bereich der Ost-Berliner Politik von parteihörigen Kampfgeist
8 Karl Wilhelm Fricke, »Schild und Schwert der Partei. Das Ministerium für Staatssicher-heit – Herrschaftsinstrument der SED«, in: Aus Politik und Zeitgeschicte - Beilage zurWochenzeitung Das Parlament, Nr. 21(1992), S. 3-10. Karl Wilhelm Fricke, »Zur Geschichte der DDR-Staatssicherheit«, in: Bernd Florath, /Armin Mitter, / Stefan Wolle (Hg.), Die Ohnmacht der Allmächtigen. Geheimdiensteund politische Polizei in der modernen Gesellschaft, Berlin 1992, S. 123-137.
05_Koller-Seizmair Seite 439 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol440
bestimmt war und ihr vor allem die Erkenntnisse des enormen Sicherheitsapparatesden Entscheidungen zugrunde lagen. Schon allein die Zahlen belegen die Bedeutungder DDR-Aufklärung: Das Ministerium für Staatssicherheit in Ost-Berlin hatte91.000 Hauptamtliche und 174.000 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) im Verhältnis zu 17Millionen Einwohnern der DDR.9
Darüber hinaus ist voraus zu schicken, dass die Außenpolitik eng mit derDeutschlandpolitik verknüpft war, beide ineinander griffen, was im übrigen für dieBundesrepublik wie für die DDR gleichermaßen galt. In Westdeutschland war dasWiedervereinigungsgebot im Grundgesetz verankert, die jeweiligen Regierungenzogen unterschiedliche Konsequenzen daraus. Bis zum Grundlagenvertrag von1972 galt es in der Außenpolitik, alles zu unterlassen und zu verhindern, was dieStaatlichkeit der DDR stabilisierte.10 Bis dahin galt die Hallstein-Doktrin11 und dieDDR wartete mit Antworten auf die westdeutsche Nichtanerkennungspolitik auf:Walter Ulbricht machte die Anerkennung der vollen Souveränität des jeweils ande-ren deutschen Staates zur Voraussetzung für diplomatische Beziehungen zwischenOst-Berlin und Bonn. Im Februar 1967 erreichte er, dass die Ostblockländer sichverpflichteten, nicht eher mit der Bundesrepublik diplomatische Beziehungen auf-zunehmen, bevor nicht die Beziehung zwischen Bonn und Ost-Berlin normalisiertwar. DDR-Topjurist Friedrich Kaul formulierte darüber hinaus das Ziel, »allge-meingültig durchzusetzen, dass die DDR allein zur Repräsentanz der deutschenNation legitimiert ist, da nur die in ihr verwirklichte Ordnung die Überwindungder nazistischen Vergangenheit ermöglicht und einen gleichwie gearteten Rückfallin diese Vergangenheit verhindert.«12 Die Kaul-Theorie ging damit weiter als dieZwei-Staaten-Theorie von Nikita Chruschtschow, die die Politik der UdSSR seit ih-rer Formulierung nach der Genfer Konferenz von 1955 maßgeblich beeinflussteund den oben erwähnten Forderungen Ulbrichts zugrunde lag. Diese besagteschlicht, dass mit der Gründung zweier deutscher Staaten, der BRD und der DDR,zwei selbständige Staaten entstanden seien.
4. Die Interessen und Ziele der DDR in Südtirol -Südtirol als PräzedenzfallErster Krisenherd Westeuropas
Der Intervention östlicher Geheimdienste in der kritischen Situation Südtirols inden sechziger bis achtziger Jahren lag zunächst einmal die Absicht zugrunde, einendauerhaften Krisenherd inmitten des Westens zu schüren. In den 13 Jahren von1956 bis 1969 bereits sollte Südtirol zur ersten Unruheregion Westeuropas werden.
9 Jürgen Aretz , / Wolfgang Stock. Die vergessenen Opfer der DDR, Bergisch Gladbach1997, S. 18.
10 Rüdiger Marco Booz, Hallsteinzeit. Deutsche Außenpolitik 1955-1972, Bonn 1995, S. 11.11 Booz, Hallsteinzeit. Deutsche Außenpolitik 1955-1972, aaO. (FN 10), S. 18: »Diese
Auffassung mündet in der Formulierung, „dass die Bundesregierung auch künftig dieAufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR durch dritte Staaten, mit denensie offizielle Beziehungen unterhält, als einen unfreundlichen Akt ansehen würde.“«
12 Michael Wolffsohn, Die Deutschland-Akte. Tatsachen und Legenden, München 1995, S. 36.
05_Koller-Seizmair Seite 440 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol441
Der bewaffnete Kampf baskischer, nordirischer oder korsischer Separatisten standnoch ebenso wenig auf der politischen Tagesordnung, wie ein ideologisch motivier-ter Terrorismus, der mehrere westeuropäische Staaten, ob in Form der Roten Briga-den (BR), der Rote-Armee-Fraktion (RAF) oder der Kommunistischen Zellen(CC), erschüttern sollte. Lediglich Frankreich war durch den Algerienkonflikt imZuge der Entkolonialisierung unmittelbar mit Gewalt konfrontiert worden. Aller-dings nicht im Mutterland, sondern am südlichen Rand des Mittelmeeres. Der zyp-riotische Unabhängigkeitskampf gegen die britische Herrschaft lag geographischnoch weiter entfernt. Südtirol bildete insofern einen Präzedenzfall im freien Europaund vor allem im Einzugsgebiet der NATO. Die Warschauer Paktstaaten hatten da-gegen bereits die gescheiterten Aufstände in der DDR, Polen und Ungarn erlebt. Je-der Krisenherd destabilisierte nicht nur im Innern, sondern stellte immer auch dieGlaubwürdigkeit des Blocks auf dem internationalen Parkett in Frage. Dieser As-pekt spielte vor allem im fortgeschrittenen Kalten Krieg eine Rolle, spätestens mitder Anerkennung des Status Quo seit der Unterzeichnung der Schlussakte von Hel-sinki am 1. August 1975.
In dem Alpenland hatte sich erstmals ein Konfliktpotential westlich des EisernenVorhanges aufgestaut, das gleich mehrfach politische Implikationen in sich barg: Einethnischer Konflikt, verbunden mit der Eigendynamik eines geteilten Landes, dieeine separatistische Ausrichtung mit sich brachte und somit eine Territorialfrage imBereich der NATO aufwarf. Der Südtirolkonflikt entstand zudem genau in einemGrenzgebiet des westlichen Verteidigungsbündnisses. Darüber hinaus hatten diewestlichen Alliierten, allen voran die USA, in Italien gerade noch wenige Jahre zu-vor unter großen Anstrengungen eine kommunistische Machtübernahme verhin-dert. In Italien organisierte sich nach 1945 die stärkste und einflussreichste kommu-nistische Partei Westeuropas. Angesichts dieses Drucks galt es seitens der NATO-Partner territoriale Interessen Italiens zu berücksichtigen, wenn sie nicht potentiellepolitische Bündnispartner auf der Apenninhalbinsel befremden wollten. Zudem be-deutete ein Verbleib Südtirols bei Italien eine Vergrößerung der NATO. Angesichtsdieser Gesamtsituation war es das Interesse des Ostblocks, den Krisenherd im Landzwischen Brenner und Salurner Klause aufrecht zu erhalten und sogar zu schüren.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die örtlichen Vertreter der ka-tholischen Kirche bereits seit 1955 die Bevölkerung auf die Vorrangigkeit der Ab-wehr des Kommunismus vor der ethnischen und territorialen Frage einzuschwörenversuchte, zu einem Zeitpunkt, als ihr Wort noch Gewicht hatte. Beleg dafür ist ein-mal der Hirtenbrief von 1955 »Kommunismus ist Werk des Teufels«, der eine härte-re Gangart in der Südtirolfrage durch die nachrückende neue Führungsspitze derSVP kritisierte, sowie der Hirtenbrief von 1961 »Kommunismus will Unruheherdschaffen«, der sich gegen den Befreiungsausschuss für Südtirol, d.h. die Südtirol-At-tentäter richtete. Sie werden darin bezichtigt, kommunistisch ferngelenkt zu sein.13
13 Karl-Heinz Ritschel, Diplomatie um Südtirol - Politische Hintergründe eines europäi-schen Versagens, Stuttgart 1966, S. 386ff.
05_Koller-Seizmair Seite 441 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol442
5. Der Nazismus-Vorwurf als politische Waffe
Das erklärte Ziel der DDR-Außenpolitik war, wie oben dargelegt, den Alleinver-tretungsanspruch Ost-Berlins durchzusetzen, legitimiert durch das Diktum, nur sokönne ein Rückfall zum Nationalsozialismus verhindert werden. So war Außenpo-litik der DDR in erster Linie ein Kampf um Anerkennung, der unter anderem auchmit dem Mittel der Diskreditierung geführt wurde. Aufschlussreich ist im Zusam-menhang mit den Methoden der DDR-Außenpolitik das Buch »Auftrag: Irrefüh-rung. Wie die Stasi Politik im Westen machte« der ehemaligen Stasi-MitarbeiterGünter Bohnsack und Herbert Brehmer. Darin wird ausführlich beschrieben, wiedas MfS Desinformation als Mittel der Politik einsetzte. Als Beispiel sei an dieserStelle die Geheimdienstaktion »Nessie« nach dem Sturz des Karamanlis-Regimes inGriechenland angeführt, die in dem Buch geschildert wird: »Es sollte lanciert wer-den, dass Karamanlis-Sympathisanten versuchten, die politische Instabilität Grie-chenlands auszunutzen, um eine neue Diktatur zu errichten. Dabei arbeiteten siemit CSU-Kreisen und BND-Agenten im süddeutschen Raum zusammen.« Der un-garische Geheimdienst, unter Mithilfe der Stasi, sendete dazu fingierte Funksprü-che, in denen von angeblichen Umsturzabsichten die Rede war.14
Die DDR-Staatssicherheit inszenierte dazu gezielt rechtsextremistische Straftatenim Westen. So bewies der Historiker Michael Wolffsohn, dass die wahren Autorenso mancher antisemitischer Hetzbriefe in den sechziger Jahren im Ministerium desErich Mielke saßen. Auch hinter antisemitischen Flugblattaktionen und Haken-kreuzschmierereien steckte die Stasi.15
Ost-Berlin unterstützte im Zusammenhang mit der Südtirolfrage Rechtsextre-misten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum mit dem Ziel der Stärkung sei-ner Legitimation als erstem antifaschistischem Staat auf deutschem Boden. Zudemnahm die DDR das Land zwischen Brenner und Salurner Klause als Teil des ehema-lig nationalsozialistischen Einflussbereichs wahr, in dem es aufzuzeigen galt, dasssich nichts geändert habe. Es galt somit, die Bundesrepublik als Nazi-Zentrum in-ternational zu diskreditieren, wo man die Spinne im rechten Netzwerk propagan-distisch verortete. Der Ost-Berliner Geheimdienst hatte keine Scheu davor, mittelsseiner Agenten enge Kontakte zu rechtsextremistischen Vereinigungen, wie zurWehrsportgruppe Hoffmann zu pflegen. Das MfS konnte dann in Südtirol anrechtsterroristische, kriminelle Zirkel anknüpfen, wie etwa die Gruppe »Ein Tirol«in den achtziger Jahren.
Spätestens seit Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki am 1. August 1975spielte der Nazismus-Vorwurf im einzelnen und die Diskreditierung im allgemei-nen als politische Waffe eine größere Rolle als die paramilitärischen Destabilisie-rungsversuche. Der Grund liegt im Zusammenwirken des ersten Kapitels derSchlussakte mit dem sogenannten Korb III. Im ersten Kapitel sicherten sich die Un-terzeichnerstaaten den Status Quo zu, in Punkten wie Unverletzbarkeit der Gren-
14 Günter Bohnsack, / Herbert Brehmer, Auftrag: Irreführung. Wie die Stasi Politik imWesten machte, Hamburg 1992, S. 227.
15 Wolffsohn, Die Deutschland-Akte. Tatsachen und Legenden, aaO. (FN 12), S. 19.
05_Koller-Seizmair Seite 442 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol443
zen, Gleichberechtigung der Völker, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten.Der Osten erreichte damit ein Sicherheitsbewusstsein und wurde damit auch nochdiplomatisch aufgewertet. Korb III behandelte die Beziehungen der Gesellschaftenund Individuen der 35 Konferenzteilnehmer in Genf. Darin lag die eigentliche Zen-trifugalkraft: In der Folge bezogen sich immer mehr Bürgerrechtler im kommunis-tischen Machtbereich in ihren innenpolitischen Forderungen auf die internationalenPrinzipien von Helsinki und die Vereinbarungen der Folgekonferenzen. Sie forder-ten Zusicherungen ein, die ihre jeweilige Regierung auf internationaler Ebene gege-ben hatte und in der Folge in ihren Ländern veröffentlichen musste. Über dieseForderungen und die Verfolgung ihrer Verfechter berichteten im Westen Menschen-rechtsorganisationen. Ein schwerwiegendes Legitimationsproblem tat sich da fürden Osten auf.16 Diskreditierung wurde in der Folge verstärkt als politisches Mittelzu Bekämpfung der Bürgerrechtler eingesetzt, Fälschungen und Verleumdungenwurden zu Waffen im späten Kalten Krieg, die soweit gingen, Dissidenten geheim-dienstlich verübter Gewaltakte zu beschuldigen.17
Im Fall Südtirols überschnitt sich der falsche Nazi-Vorwurf der DDR mit dem,was die italienische Politik und Öffentlichkeit in den Aktivisten der 60er Jahregrößtenteils sahen bzw. sehen wollten und verbreiteten. Das belegen US-Akten, dieSiegfried Stuffer zum Thema aufgearbeitet hat. In einem von ihm zitierten Protokollüber ein Gespräch zwischen US-Präsident Dwight D. Eisenhower und dem italieni-schen Ministerpräsidenten Antonio Segni vom 30. September 1959 ist über die Ein-lassung des Italieners über Südtirol zu lesen: »Das Gebiet wäre Teil des italienischenTerritoriums und die Italiener gäben es nicht auf. Es ist möglich, daß die Aufruhrbe-wegung von Moskau aus gesteuert worden sei. Auf jeden Fall wären die Leute, diejetzt das größte Geschrei erheben würden, vor zwanzig Jahren Nazis gewesen. «18
6. »Pangermanismus« als Vorwurf - Parallele Interessen in Ost und West
In Italien hatte sich am 5. Dezember 1963 die erste Mitte-Links-Regierung unterMinisterpräsident Aldo Moro (Democrazia Cristiana, DC) formiert. Da trat dieDDR auf den Plan: Bereits Anfang 1964 strebte Ost-Berlin eine Normalisierung derBeziehungen zu Rom an. Die Initiative hing eng mit dem »Neuen ÖkonomischenSystem« zusammen, das zwischen 1962 und 1965 Elemente des wirtschaftlichenWettbewerbs ebenso wie eine Ausweitung der Exporte in den Westen mit sichbrachte. Außenpolitische Offensiven sollten helfen, die Verwirklichung der Außen-
16 Michaela Koller, »Der Einsatz für die Menschenrechte im KSZE-Prozess« in: LotharBossle, (Hg.), Pforten zur Freiheit – Festschrift für Alexander Böker zum 85. Geburts-tag, Paderborn 1997, S. 305-318.
17 Jürgen Wüst, Menschenrechtsarbeit im Zwielicht – Zwischen Staatssicherheit und Anti-faschismus, Bonn 1999, S. 166-197. Koller, »Der Einsatz für die Menschenrechte im KSZE-Prozess« aaO., (FN 16), S. 310.
18 Siegfried Stuffer, »The Alto Adige-Question – Der Südtirol-Konflikt aus der Sicht derUSA« in: Elisabeth Baumgartner, / Hans Mayr, / Gerhard Mumelter, (Hg.), Feuernacht- Südtirols Bombenjahre. Ein zeitgeschichtliches Lesebuch, Bozen 1995, S. 335.
05_Koller-Seizmair Seite 443 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol444
handelsinteressen zu ermöglichen.19 Ein Adressat war Italien: Dies belegt eine Vor-lage des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR für die Außenpo-litische Kommission im Zentralkomitee der SED. In der »AußenpolitischenDirektive zur weiteren Entwicklung der Beziehungen mit Italien« vom 19. Februar1964, in der detailliert eine PR-Offensive gegenüber Rom geplant wurde, heißt eswörtlich: »Ausgehend von den oben genannten Schwerpunkten in der Auslandsin-formation, insbesondere über die Notwendigkeit der Propagierung der Friedenspo-litik der DDR, und der Tatsache, dass die Entwicklung normaler Beziehungen zwi-schen der DDR und Italien günstige Auswirkungen auf eine weitere Entspannunghat, ist auf die Gefährlichkeit der Revanchepolitik des westdeutschen Imperialis-mus, insbesondere auf die Gefahren, die sich aus der Politik der atomaren Aufrüs-tung ergeben, hinzuweisen.«20
Seit 1978 gab es Begegnungen auf höchster diplomatischer Ebene zwischen Itali-en und der DDR: beginnend mit Außenministerbesuchen (Oskar Fischer 1978 inRom und Emilio Colombo, DC, 1983 in Ost-Berlin), die im Besuch von Minister-präsident Bettino Craxi (Partito Socialista Italiano, PSI) zusammen mit ColombosNachfolger Giulio Andreotti (DC) im Juni 1984 in der DDR gipfelten. Italien wardann auch der erste NATO-Staat, der den DDR-Staatsratsvorsitzenden ErichHonecker schließlich im April 1985 einlud. Italien wollte damit seinen außenpoliti-schen Spielraum innerhalb des Bündnisses erweitern, in dem es selbständig Gesprä-che über Abrüstung führte. So heißt es denn auch in dem Vermerk vom 23. April1985 über ein Gespräch zwischen DDR-Außenminister Oskar Fischer und seinemCounterpart Andreotti unter Mitwirkung von Politbüromitglied Hermann Axenüber den italienischen Außenminister: »In diesem Zusammenhang bekräftigte erausdrücklich das positive Herangehen Italiens an eine verbindliche Bekräftigung desVerzichts auf militärische Gewalt, der zugleich mit anderen vertrauensbildendenMaßnahmen kombiniert werden soll. Zum anderen sollten beide Staaten ihren Ein-fluß gegenüber der jeweiligen Führungsmacht des Bündnisses zugunsten konkreterLösungen bei den Genfer Verhandlungen geltend machen.«21 (Die Genfer Verhand-lungen begannen am 30. November 1981 und drehten sich um die in Europa statio-nierten Mittelstreckenwaffen der Supermächte.)
Italien wollte also seine außenpolitische Bedeutung ausbauen bei gleichzeitigerBeibehaltung des territorialen Status Quo.
Im September 1984 warf der damalige italienische Außenminister Giulio Andre-otti der deutschen Politik Pangermanismus vor, da sie an der Wiedervereinigung alsnationalem Ziel festhielt. Die Aufrechterhaltung der deutschen Doppelstaatlichkeitsei Voraussetzung des europäischen Gleichgewichtes. Erst nach Protesten des Aus-
19 Peter Marsh, »Foreign policy making in the German Democratic Republic: the inter-play of internal pressures and external dependence« in: Hannes Adomeit, / RobertBoardman, (Hg.), Foreign policy making in Communist Countries, Westmead/Farnbo-rough/Hants. 1979, 79ff.
20 SAPMO-BArch, DY 30 / IV 2/2 115 Bd. 5, Bl. 159f (Bestand Außenpolitische Kommis-sion).
21 SAPMO-Barch, DY 30 / IV 2/2. 035, Bd. 103, Bl. 13 (Büro Hermann Axen).
05_Koller-Seizmair Seite 444 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol445
wärtigen Amtes in Bonn bog er seine Aussage um und erklärte, nicht die deutsch-deutsche Frage gemeint zu haben, sondern die Bestrebungen zur Tiroler Landesein-heit, hinter denen sich der Pangermanismus verberge. Das Jahr 1984 stand ganz imZeichen des Gedenkens an den 175. Jahrestag des Tiroler Aufstands unter AndreasHofer gegen Napoleon, das einige Südtiroler mittels demonstrativer Akte für dieForderung nach Selbstbestimmung nutzten. Gerade ein Jahr zuvor hatte sich eineGruppe Selbstbestimmungsbefürworter aus der regierenden Südtiroler Volkspartei(SVP) herausgelöst, die noch um die Vervollkommnung der Autonomie zitternmusste. Die Paketdurchführung war bereits Ende der siebziger Jahre ins Stockengeraten, zudem schränkten Reformgesetze des Staates die Autonomie ein und dieethnischen Spannungen hatten wieder zugenommen. Die politischen Aktivitätendes Selbstbestimmungsanhänger gipfelten in den Innsbrucker Landesfestumzugvom 9. September 1984. »Der Landesfestumzug löst ein politisches Erdbeben aus:35.000 sind aufmarschiert, an der Hofburg prangt ein Transparent mit der Auf-schrift „Los von Rom“, Musikkapellen und Schützen haben das Motto „Ein Tirol“gewählt, Selbstbestimmungsfahnen sind über die Straßen gezogen.«22 So schildertHans Karl Peterlini die Ereignisse auf Tiroler Seite. Eduard Wallnöfer, Landes-hauptmann des österreichischen Bundeslandes Tirol, sagte damals im österreichi-schen Sender ORF, mit dem Festumzug könne sich »die Weltöffentlichkeit über dasUnrecht der Brennergrenze Klarheit verschaffen«.23
Auf italienischer Seite wurde die Parallele zwischen der Teilung Tirols und derDeutschlands deutlich wahrgenommen. Im Umkehrschluss ergab sich daraus wie-derum die Parallele zwischen den Interessen Italiens und der DDR über den Eiser-nen Vorhang hinweg. So lässt sich die These formulieren: Die vom mehrfachen itali-enischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti im Zusammenhang mit demdeutschen Wiedervereinigungsziel beschworene Pangermanismusgefahr konnte vonItalien wie von der DDR in Tirol exemplarisch und propagandistisch verdeutlichtund als Bestätigung der jeweils eigenen Position aufgezeigt werden. In diesem Zu-sammenhang sei noch an jüngere Beispiele erinnert: Eine Äußerung des vormaligenBundeskanzlers Helmut Kohl sowie eine Stellungnahme im selben Sinne seines Fi-nanzministers Theo Waigel zur Schaffung einer grenzüberschreitenden Europaregi-on Tirol hatte noch 1993 eine italienische Protestnote provoziert. Das lässt denSchluss zu, dass der Herd der von Italien instrumentalisierten Gefahr des Panger-manismus vor allem auch in der Bundesrepublik vermutet wurde.
Der Autor Hans Karl Peterlini liefert in seinem Buch »Bomben aus zweiterHand« Hinweise darauf, dass italienische Dienste während der Paketverhandlungenin den achtziger Jahren eine Atmosphäre der Spannung erzeugten, um jegliche For-derung nach Selbstbestimmung und Landeseinheit Tirols als rechtsextremistischoder gar rechtsterroristisch zu diskreditieren. Im Jahr 1990 deckte der venezianischeUntersuchungsrichter Felice Casson auf, dass für ein Attentat, das ursprünglich lin-ken Attentätern zugeschrieben wurde, in Wirklichkeit rechte Kreise verantwortlich
22 Hans Karl Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi: Südtirolsmissbrauchter Terrorismus, Bozen 1993, S. 72.
23 Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi, aaO. (FN 22), S. 72.
05_Koller-Seizmair Seite 445 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol446
waren. Dabei handelte es sich um das sogenannte Blutbad von Peteano bei Triest imJahr 1972, bei dem drei Carabinieri durch eine Autobombe ums Leben kamen. Cas-son ging der neuen Spur nach und stieß auf eine geheime Struktur, der im histori-schen Überblick dieses Aufsatzes bereits erwähnte Nachrichtendienst Gladio.24 DerGeheimdienst war zunächst unter Einfluss der amerikanischen CIA (Central Intel-ligence Agency) zur Abwehr der kommunistischen Gefahr Anfang der fünfzigerJahre gegründet worden. Italienische Regierungen setzten ihn jedoch nachweislichgegen innenpolitische Gegner ein. Verschiedenen Aussagen und Hinweisen zufolgesollte auch in Südtirol ein spannungsreiches Klima erzeugt werden. Ein italienischerPolizei-Oberst, Amos Spiazzi, sagte 1990 im italienischen Fernsehen RAI, dass erbereits in den sechziger Jahren zwei Carabinieri dabei erwischt habe, wie sie einenAnschlag vorbereiteten. Andere Carabinieri hätten ihm dann die beiden Gefange-nen abgenommen und am nächsten Tag sei er versetzt worden.25 Zudem schreibt derehemalige österreichische Südtirol-Aktivist Erhard Hartung: »Während der 60erJahre hatte es eine Reihe von Anschlägen gegeben, zu denen sich die Südtiroler Frei-heitskämpfer nie bekannt haben, ja, von denen sie sich distanziert hatten und nochheute distanzieren.«26 Eine parlamentarische Untersuchungskommission über denTerrorismus in Südtirol führte im Jahr 1991 den Beweis, dass italienische Geheim-dienste bereits in den 60er Jahren Einfluss auf das Gewaltgeschehen nahmen.27
Der eingangs erwähnte Südtiroler Attentäter Georg Klotz suchte nicht nur Geldund Waffen, sondern vor allem auch Mitkämpfer für seine Überfälle. So nahm erauch Christian Kerbler in seinen Kreis auf, nach eigenen Angaben freischaffenderJournalist. Die parlamentarische Untersuchungskommission des Senators MarcoBoato (Verdi) in Rom stellte drei Jahrzehnte später fest, dass der Mann ein italieni-scher Geheimagent war. Kerbler erhielt zusammen mit seinem Bruder Franz Geldaus einem eigenen Fond des italienischen Innenministeriums. Dafür lieferten dieZwei Berichte und Fotomaterial über die Attentäter-Szene. Christian Kerblerschoss im Auftrag im September 1964 in der Nacht auf Klotz und dessen Wegge-fährten Luis Amplatz, als diese heimlich über die Grenze nach Südtirol gekommenwaren. Klotz’ Kamerad war sofort tot, er selbst schleppte sich schwerverletzt überdie Berge nach Nordtirol. Bei den Gewaltakten, bei denen östliche Geheimdienstemitmischen wollten, waren italienische Agenten also nachweislich aktiv beteiligt.Interessant ist auch hierbei der propagandistische Mitnahmeeffekt: Der MailänderIllustrierten »L’Europeo« vermittelte Kerbler ein Interview mit Georg Klotz imExil und lancierte dabei die Falschbehauptung, der Befreiungsausschuss für Südtirol
24 Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi, aaO. (FN 22), S. 12.25 Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi, aaO. (FN 22), S. 22.
Siehe auch Dario N Azzellini, »Gladio in Italien«, in: Jens Mecklenburg. Gladio. Diegeheime Terrororganisation der NATO, Berlin 1997, S. 23-47.
26 Hartung, »Südtiroler Freiheitskampf – als Österreicher im Dienst der Sache« in: SeppMitterhofer u.a. (Hg.), Es blieb kein anderer Weg, aaO. (FN 2), S. 291.
27 Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della man-cata individuazione dei responsabili delle stragi. Relazione preliminare su episodi rela-tivi all’attività dei corpi militari, di polizia o di sicurezza dello stato in connessione con levicende del terrorismo in Alto Adige/ Südtirol, Rom 1991.
05_Koller-Seizmair Seite 446 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol447
habe eine »Terroristenschule« in den »bayerischen Alpen« unterhalten. Nachdemder Artikel im Februar 1964 erschienen war, waren München und Bonn entspre-chend mit Dementis beschäftigt.28
Die DDR-Interessen trafen sich in Südtirol teilweise mit italienischen Interessen.So erhoben beide, Rom und Ost-Berlin, den Vorwurf des Pangermanismus29 gegendie Bundesrepublik Deutschland. Die parallelen Interessen führten in einzelnenFällen zu einer indirekten Zusammenarbeit. So lässt sich den Stasi-Akten entneh-men, dass als Inoffizielle Mitarbeiter (IM) Doppel- bzw. Mehrfachagenten, die auchfür einen italienischen Dienst tätig waren, eingesetzt wurden. DDR-PropagandistKarl Eduard von Schnitzler behauptete bei einer internationalen Pressekonferenz1964, der Friede in Europa sei in Gefahr, da in Westdeutschland Pangermanismusund Revanchismus derart erstarkt seien, dass nicht nur zu befürchten sei, dass »dieDDR nach Vorstellung Bonner Militaristen gewaltsam befreit«, sondern auch »dasSudetenland und Südtirol heim ins Reich geholt« werde.30
7. Agenten, Operative Vorgänge und Zielpersonen
Die Pressekonferenz fand aus Anlass der Verurteilung Herbert Kühns statt. DasOberste Gericht der DDR verurteilte im Februar 1964, im selben Monat also, indem der oben erwähnte »L’Europeo«-Artikel erschien, den damals 22-jährigen Ge-legenheitsarbeiter aus Essen (Nordrhein-Westfalen) zu lebenslanger Haft.31 Nacheinem Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit kamen die Richter zu demSchluss, Kühn habe drei Sprengstoffanschläge verübt, darunter auf den Bahnhof inVerona und das Rote Rathaus in Berlin. Als Westdeutscher mit Kontakten nachSüdtirol und zu konservativen sowie rechtsextremen Kreisen, erfüllte er das idealeTäterprofil für die DDR-Propaganda. Der Wortlaut des Kühn-Urteils wurde imMärz 1964 in voller Länge in der DDR-Fachzeitschrift »Neue Justiz« veröffent-licht. Einen Monat zuvor hatte das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten(MfAA) in Ost-Berlin einen detaillierten Plan für eine neue Außenpolitik gegenü-
28 Klotz, Georg Klotz. Freiheitskämpfer für die Einheit Tirols, aaO. (FN 3), S. 169-175.29 Pangermanismus: Im späten 19. Jahrhundert im englischen und französischen Raum
entstandenes Schlagwort für das Streben nach der Sammlung deutscher Volksgruppen.Tatsächlich hatte der P. nur wenige Anhänger. Seine Argumentation war, dass die Ger-manen wegen ihrer gemeinsamen Stammeszugehörigkeit sich gegen die Bedrohung derSlawen verbünden müssten.
30 6 Hartung, »Südtiroler Freiheitskampf – als Österreicher im Dienst der Sache« in: SeppMitterhofer u.a. (Hg.), Es blieb kein anderer Weg, aaO. (FN 2), S. 290.
31 Wegen der politischen Bedeutung des Prozesses ist davon auszugehen, dass das Verfah-ren rechtsstaatlichen Maßstäben nicht gerecht wurde. Bislang konnte die Rolle Kühnsin Südtirols heißen Jahren historisch nicht geklärt werden. Auch ein Gerichtsverfahrenim Jahr 1980 in Köln wegen des Anschlags auf den Bahnhof in Verona, vier Jahre nachdem Freikauf Kühns aus der DDR-Haft, brachte kein Licht ins Dunkel. Der Bundesge-richtshof hob das diesbezügliche Urteil gegen die Mitangeklagten Kühns auf undnannte dabei 35 Revisionsgründe. Für Kühnkam die BGH-Entscheidung zu spät: Erhatte, als einziger Angeklagter nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, das erste Urteilbereits angenommen und damit dessen Rechtskraft in seinem Fall herbeigeführt.
05_Koller-Seizmair Seite 447 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol448
ber Italien erstellt, demzufolge Bonn in Rom der Revanchepolitik und des Imperia-lismus bezichtigt werden sollte. So verwundert es wenig, wenn die DDR-Richter inder Urteilsbegründung die westdeutsche Regierung für die Gewalttaten moralischmitverantwortlich machen: »Unter den in Westberlin und Westdeutschland beste-henden politischen Verhältnissen entwickelte er sich vom jugendlichen Abenteurerzu einem gefährlichen rechtsextremistischen Neofaschisten. Durch seinen Vater, ei-nen ehemaligen Amtsleiter der Nazipartei, und durch Lehrer, die ihm als ehemaligeOffiziere der faschistischen Wehrmacht unter anderem auch Geschichtsunterrichterteilten, wurde ihm ein politisches Bild vermittelt, das Kapitalismus und selbst Fa-schismus in rosigen Farben erscheinen ließ.«32
Bei der Lektüre der Stasi-Akten zu den Südtirolattentaten fällt das Interesse derDDR-Staatssicherheit und Justiz an bislang ungeklärten Gewaltakten, bis in die De-tails, auf. So werden in einem Dossier über den Befreiungsausschuss Südtirol fastausschließlich bislang unaufgeklärte oder vereitelte Anschläge aufgelistet.33 Die Lis-te beginnt mit dem Attentat vom 20. Oktober 1962 im Bahnhof von Verona. Siehängen die Tat dem Befreiungsausschuss für Südtirol an. Herbert Kühn soll auchdabei gewesen sein. In der Akte heißt es wörtlich: »Am 19. Oktober 1962 gaben dieAttentäter in der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofes in Verona einen Koffer ab.Er enthielt 10 Kilo Sprengstoff sowie einen Kunststoff-Kanister mit 10 Liter Ben-zin-Öl-Gemisch, das dazu bestimmt war, neben der Explosion noch einen Brandauszulösen. Der Zündmechanismus wurde auf etwa 3.00 Uhr nachts eingestellt. Amgleichen Tage gaben die Täter in der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofes von Tri-ent eine Reisetasche ab. Sie hatte den gleichen Inhalt mit Zeitzündermechanismus.Diese Anschläge auf den Bahnhöfen verletzten über 20 Personen zum Teil lebensge-fährlich und eine Person wurde getötet. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.«
Die DDR zog also nachweisbar propagandistischen Nutzen aus Terrorakten. Ge-nau wie die italienischen Behörden erhob sie den Vorwurf des Pangermanismus ge-gen die Aktivisten vom Befreiungsausschuss. Damit arbeitete sie letztlich auch Itali-ens Alt-Faschisten zu: Wie bereits im historischen Überblick am Anfang aufgezeigt,stärkte die Mär vom Pangermanismus die Zustimmung der italienischen Wähler zupostfaschistischen Partei MSI. Der selbsterklärte Anti-Faschismus der DDR wurdesomit aus pragmatischen Gründen ausgehöhlt.
Die meisten Akten der Hauptverwaltung Aufklärung, dem Auslandsgeheim-dienst der DDR, kamen nach der Wende in den Schredder. Damit gingen mögli-cherweise Dokumente verloren, die über die oben dargelegte Nutzung für Agit-prop-Zwecke eine Mitwisserschaft oder Mittäterschaft der Stasi in Terroraktesüdlich des Brenners belegen können. Schon lange vor Öffnung der Stasi-Akten gabes aber Hinweise auf eine mögliche Verstrickung östlicher Geheimdienste in Südti-roler Attentate. Leider blieb es bislang bei diesen Indizien. Im Jahr 1976 bereits sag-te der in den Westen übergelaufene tschechische Geheimdienstmajor Josef Frolik ineinem Interview mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen aus, einer seiner Männer
32 »Urteil des Obersten Gerichts gegen den Terroristen Kühn« in: Neue Justiz 18, Nr. 6(1964), S. 179.
33 BStU, Archiv der Zentralstelle, MfS-HA XXII, Nr. 5529/5, Bl. 1ff.
05_Koller-Seizmair Seite 448 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol449
habe 1956 im Auftrag Moskaus erste Attentate in Südtirol verübt. In der Tat hat eszu der Zeit Anschläge gegeben, deren Hintergründe und Täter nie entdeckt wurden.Nach Aussagen von Eva Klotz, der Tochter und Biographin des SüdtirolattentätersGeorg Klotz, hatte der tschechische Geheimdienst mit ihrem Vater in den 60er Jah-ren Kontakt aufgenommen. Darüber hinaus soll es ein »Angebot« der Sowjets anihn gegeben haben, seine Aktivitäten zu unterstützen, das er aus ideologischenGründen ausgeschlagen habe.34 Es war naheliegend, dass unter den östlichen Diens-ten, die in Südtirol präsent sein sollten, auch die Stasi war, fiel in diesem Fall dochdie Sprachbarriere weg.
Die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in den achtzigerJahren in Südtirol lassen sich bislang durch zwei Aktenvorgänge belegen. Aus die-sen Vorgängen ergibt sich, dass die Spitzelbehörde auch Mitwisserin von Attentatenwar. Es sind dies die Vorgänge mit Berichten des in Mannheim geborenen HerbertHegewald und des Peter Weinmann aus Bonn.35 Beide waren Mehrfachagenten undgegen beide endeten Ermittlungsverfahren deutscher Staatsanwaltschaften wegengeheimdienstlicher Tätigkeit glimpflich. Hegewald war einer der Komplizen um dieTerrorgruppe »Ein Tirol« um Karl Außerer und Karl Zwischenbrugger, die in denachtziger Jahren ihr Unwesen trieb und, wie oben ausgeführt, Rückendeckungdurch italienische Dienste erhielt und das Gegenteil von dem erreichte, das sie vor-gab zu verfolgen. Hegewald spielte da laut Peterlini die Rolle eines Agent Provoca-teur. Der dreifache Agent war zudem in der rechtsextremistischen Szene inDeutschland als V-Mann unterwegs. Nationaldemokratische Partei Deutschlands(NPD) und Wehrsportgruppe Hoffmann36, um nur zwei zu nennen, waren seineBetätigungs- und Ermittlungsfelder. Auch unter dem Vorwand, als Journalist zu re-cherchieren, gelangte der Mann an viele vertrauliche Informationen in Südtirol. Sei-ne vielschichtigen Aktivitäten brachten wieder zwei Dinge zusammen, die rechteSzene in der Bundesrepublik Deutschland und das Milieu der Selbstbestimmungs-befürworter in Südtirol. Letzteres sollte ja offenbar durch die Attentate diskreditiertwerden. Durch die Aktivitäten des deutschen Bundesbürgers konnte zudem wiederder Verdacht des Pangermanismus genährt werden. Die Generalbundesanwaltschaftin Karlsruhe hatte zwar 1993 ein Verfahren wegen des Verdachts der terroristischenBetätigung gegen ihn eingestellt, jedoch fand sich in seiner Stasiakte ein Hinweisdarauf, dass er im September oder Oktober 1988 mit Karl Außerer Sprengstofftransportiert hat. Das gab Hegewald gegenüber seinem Stasi-Führungsoffizier zu.
34 Hans Mayr, »Wir hätten auch den Klotz erfunden. Die Umtriebe der Geheimdienste inSüdtirol«, in: Baumgartner, / Mayr, / Mumelter, (Hg.), Feuernacht - Südtirols Bomben-jahre. Ein zeitgeschichtliches Lesebuch, aaO. (FN 18), S. 310.
35 BStU, Archiv der Zentralstelle, MfS AIM 868/91, Teil 1, Bd. 1 (Akte Hegewald).BStU, Archiv der Zentralstelle, MfS AIM 4691/91, Bd. 1 bis 4 (Akte Weinmann).
36 Die Gruppe wurde 1973 von Karl-Heinz Hoffmann begründet und diente ähnlichenGruppen zum Vorbild, darunter der Wehrsportgruppe Werwolf von Michael Kühnenvon der Aktionsfront Nationaler Sozialisten/ Nationale Aktivisten, als deutscher Zweigder NSDAP/AO. Die Wehrsportgruppe Hoffmann wurde 1980 verboten. Sie ist ver-antwortlich für den Mord am jüdischen Verleger Shlomo Levin und seiner Lebensge-fährtin, sowie für den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest von 1980.
05_Koller-Seizmair Seite 449 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol450
Kurz darauf, Anfang Oktober 1988, gab es dann tatsächlich eine Attentatsserie inSüdtirol. Die Stasi wusste demnach vom terroristischen Hintergrund ihres Inoffizi-ellen Mitarbeiters (IM) und nahm diesen bewusst in Kauf. Hegewalds Geständnissefielen bei der Beurteilung seiner Person durch den Stasi-Apparat nicht einmal nega-tiv ins Gewicht. Die Akte über Hegewald beginnt erst mit dem Jahr 1985. Sie ent-hält jedoch einen Hinweis darauf, dass er bereits in den sechziger Jahren Kontaktzum MfS hatte. Damals unterhielt er Beziehungen zu Südtiroler Freiheitskämpfern.Angesichts dieser Indizien stellt sich auch die Frage nach der Mitverantwortungöstlicher Geheimdienste an den Terrorwellen in den Sechzigern.
Der zweite Agent, der nachweislich in Südtirol eingesetzt war, war Peter Wein-mann, der seine Tätigkeit für mehrere Seiten später öffentlich bekannte.37 Er arbei-tete, wie Hegewald, als Journalist getarnt, verdiente seinen Unterhalt aber vor allemals Mehrfachagent, für West- und Ostdeutschland sowie für die Italiener, als Infor-mant und als Agent Provocateur. Weinmann war vielen rechtsextremistischen, aberauch konservativen Gruppierungen und Einzelpersonen bekannt, zu denen er vorallem im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz seit 1969 unter demDecknamen »Werner« Kontakt pflegte. Gegenüber der Stasi hatte er seine Arbeitfür den Verfassungsschutz sowie für die politische Polizei Italiens offengelegt. »Fastdie ganze Woche« sei er für den Kölner Inlandsgeheimdienst unterwegs, gab er ge-genüber den MfS-Mitarbeitern an. Die DDR-Staatssicherheit stellte anfangs zurEinstufung der Person Weinmanns eine Liste seiner rechten Kontakte zusammen.Darunter waren bekannte Neonazis wie Michael Kühnen und Friedhelm Busse.Letzterer war Bundesvorsitzender der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei(FAP)38, in der sich Kühnens Anhänger nach dem Verbot von dessen NSDAP/AO-Zweigs Aktionsfront Nationaler Sozialisten/ Nationale Aktivisten (ANS/ NA) ab1984 sammelten. Er unterhielt zudem Beziehungen zur Wehrsportgruppe Hoff-mann, zur Nationalistischen Front39, zur Wiking-Jugend40, der NPD und den Re-publikanern. Er besuchte Veranstaltungen der Deutschen Volksunion (DVU), dar-unter die Verleihung des Andreas-Hofer-Preises am 18. September 1988 in Passau,wo er für die italienischen Sicherheitskräfte auch Südtiroler Schützen beobachtete.Weinmann schrieb Artikel für diverse Publikationen aus dem rechten Milieu.41 Am29. März 1989 brüstete er sich sogar gegenüber der Stasi mit seinen vielfältigen ex-
37 »Peter Weinmann –Ein Spitzel für alle Fälle« in: Tiroler, Nr. 42 (1994). In dieser Doku-mentation des Tiroler ist eine Darstellung über Weinmann vollständig wiedergegeben,die dieser anlässlich seines Prozesses vor dem Staatsschutzsenat des OLG in Koblenzim Februar 1994 verteilt hatte. Der 1946 im Kreis Schwäbisch Hall geborene Weinmannwurde zu einer Haftstrafe von neun Monaten, zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt.
38 Die FAP wurde 1979 gegründet und 1995 verboten.39 Die NF wurde 1985 gegründet und 1992 verboten. Ihr Ziel liegt in der Rekrutierung
und Konditionierung von nationalistischen Führungskräften. 40 Zum Zeitpunkt ihres Verbots 1994 war die »Wiking Jugend« mit rund 400 Mitgliedern
die stärkste neonazistische Jugendorganisation. Nach dem Verbot durch das Bundesmi-nisterium des Innern finden deren Mitglieder Aufnahme in der Jugendorganisation derNPD, den Jungen Nationaldemokraten (JN).
41 Türmer-Verlag, Nation Europa, Grabert-Verlag, NPD-Verlag »Deutsche Stimme«
05_Koller-Seizmair Seite 450 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol451
tremistischen Kontakten: »So telefoniere ich ungeniert von meiner Wohnung ausmit Leuten wie Busse, Vorsatz u.s.w., wo ja sicher ist, daß von diesen und auch an-deren Leuten die Telefone permanent abgehört werden.«
Der Fleiß lohnte sich, konnte der gelernte Friseur und Bademeister mit Polizeier-fahrung durch seine vielschichtigen Kontakte doch ab 1976 mit fast täglichen Tele-fonaten noch eine weitere Einnahmequelle unter dem Decknamen »Sigmund« beider politischen Polizei Italiens, im folgenden Digos genannt, erschließen. EigenenAngaben zufolge arbeitete er auch noch für den italienischen Geheimdienst SISMI,der dem Verteidigungsministerium unterstellt war.42 Die italienischen Polizeibeam-ten interessierten sich für die Südtirolkontakte Konservativer und Rechtsextremeraus Deutschland, wozu beide Seiten observiert werden sollten. Dabei waren dieVerbindungen der DVU und der Republikaner ebenso interessant wie die Stand-punkte bayerischer Landtagsabgeordneter zur Südtirolfrage und die Person desSüdtirolattentäters aus den sechziger Jahren, Peter Kienesberger, und dessen Wohn-ort. Kienesberger hatte den Gewaltakten zwar öffentlich abgeschworen, Weinmannsollte dennoch eine Lageskizze dessen Hauses in Nürnberg anfertigen. Das war einzweifelhaftes Unterfangen, sollte Kienesberger doch um 1979/1980 gewaltsam imGeheimdienstauftrag nach Italien gebracht werden. »Tot oder lebendig« wollten ihndie SISMI-Leute, wie im Zuge der Gladio-Ermittlungen herauskam.43 Der Agentbesuchte den einstigen Südtirolaktivisten dann noch im Jahr 1988. Bei der Gelegen-heit empfahl dieser dem Besucher das Gasthaus Weinländer zur Übernachtung, umihn nicht zu sich einladen zu müssen, wie er später angab. In einem Bericht der poli-tischen Polizei Bozens, der kurze Zeit nach Weinmanns Nürnberg-Reise der Quäs-tur (Polizeipräsidium) vorlag, wurde Kienesberger bezichtigt, eine Werkstatt in sei-nem Haus zu haben, die sich »zur Herstellung von für die in der Provinz Bozenverübten und im anliegenden Polizeibericht aufgezählten Terroranschläge identi-schen Sprengkörpern eignet.« Damit wurde offenbar bewusst eine falsche Spur ge-legt, um den Verdacht zu schüren, ehemalige Südtirol-Aktivisten der sechziger Jahreseien in die Anschläge der achtziger Jahre verwickelt. In dem Report steht darüberhinaus ein entlarvender Satz: »Außerdem quartiert Peter Kienesberger seine Südti-roler Freunde, die zu ihm auf Besuch kommen, bei der Pension „Weinländer“ inNürnberg ... ein.« Der ehemalige Südtirol-Aktivist hatte nach eigener Aussage inden vorausgegangenen zehn Jahren nur Weinmann dieses Gasthaus empfohlen.44
Der Agent war, wie sich aus seiner fast 800 Seiten starken Stasi-Akte entnehmenlässt, in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre als »Rolf Römer« für das Ministeri-um für Staatssicherheit in Ost-Berlin tätig. Er hatte seine Dienste im August 1984
42 »Peter Weinmann –Ein Spitzel für alle Fälle« in: Tiroler, Nr. 42 (1994), S. 3. Angeblichsollte Weinmann im August 1984 für den SISMI SS20-Raketenbasen in der DDR orten.Angesichts des in diesem Aufsatz beschriebenen Gesprächs über Bemühungen zurAbrüstung von Mittelstreckenwaffen vom 23. April 1985 ist diese Behauptung zumin-dest plausibel.
43 »Spion aus Leidenschaft – Die unaufhaltsame Karriere des Mehrfachagenten PeterWeinmann« in: Spiegel Nr. 7 (1994), S. 40.Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi, aaO. (FN 22), S. 64.
44 Peterlini, Bomben aus zweiter Hand – zwischen Gladio und Stasi, aaO. (FN 22), S. 308.
05_Koller-Seizmair Seite 451 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol452
während einer DDR-Reise selbst angeboten. Der DDR-Geheimdienst wollte vonihm in der Folge vor allem wissen, worauf ihn die Digos, die politische Polizei inBozen, angesetzt hatte und zu welchen Ergebnissen er dabei gekommen war. Ausdem vorliegenden Aktenkonvolut erfährt der Leser denn auch reichlich über dieAktivitäten Weinmann für die westlichen Dienste. Die Stasi war demnach Zweitver-werter von vertraulichen Informationen über rechtsextreme, konservative oderanti-kommunistische Kreise in der Bundesrepublik und ihrer Kontakte nach Südti-rol. Ein wichtiges Dokument befindet sich im vierten Band. Es ist der bereits zitier-te Bericht, in dem Weinmann am 15. Dezember 1988 eine ausführliche Analyse derpolitischen Situation Südtirols abliefert, mit detaillierter Beschreibung der jeweili-gen Interessenlage. Darin zeigt er sich wieder bemüht, Verbindungen herzustellen,die für sein nachrichtendienstliches Gegenüber von Interesse sein mussten, in demer über die Kontakte der Selbstbestimmungsbefürworter Südtirols schreibt: »Undein anderer Umgang mit ausländischen Helfern zeichnet sich dadurch jetzt schonab. Waren früher Nordtiroler und bayrische Schützeneinheiten die Ansprechpart-ner, so sind es heute österreichische und deutsche Politiker. Es stellt sich also dieFrage, welche Rolle die BRD und Österreich im Südtirolkonflikt spielen, welcheOrganisationen und Einzelkräfte sich um das Südtirolproblem kümmern und wiepräsent diese in der BRD, in Österreich bzw. in Südtirol sind.«45 Weinmann hattezudem offenbar kein Problem damit, CSU-Politiker als Sympathisanten desRechtsextremismus darzustellen. So behauptete er am 19. November 1986 gegenü-ber der Stasi, der CSU-Landtagsabgeordnete Alois Glück46 habe Kontakte zumrechtsextremistischen Verleger Gert Sudholt47 einerseits und zum Andreas-Hofer-Bund andererseits unterhalten, in dem sich die deutschen Freunde des SüdtirolerSelbstbestimmungsmilieus sammelten. Daraus lässt sich ein immer wiederkehrendesMuster in der Arbeit dieses Mannes ableiten: Konservative Demokraten werden mitExtremisten in einen Zusammenhang gebracht, um Erstere zu diskreditieren. Soversuchte Weinmann auch, Südtiroler Politiker ins rechte und damit schlechte Lichtzu rücken. Ein beliebter Weg zu diesem Ziel war, schriftliche oder mündliche Äuße-rungen der Betreffenden in rechtsradikalen Publikationen wie die der NPD oderder Republikaner zu lancieren. Die Diskreditierung war eine Methode, die sich, wiebereits aufgezeigt, beiderseits des Eisernen Vorhangs bewährt hatte, in Rom undBozen genauso wie in Ost-Berlin. Davon war zum Beispiel der Landtagsabgeordne-te der Südtiroler Volkspartei, Franz Pahl, betroffen. Mitte der achtziger Jahre gab erWeinmann nichts ahnend ein Interview, das dieser dann Jahre später, ohne dessenEinverständnis eingeholt zu haben, in der Republikaner-Zeitschrift »Europa vorn«
45 BStU, Archiv der Zentralstelle, MfS AIM 4691/91,4, Bl. 266.46 Alois Glück (CSU) ist seit 1970 Mitglied des bayerischen Landtags. Von 1988 bis 2003
war er Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion und seitdem ist er Landtagspräsident.47 Im Januar 1999 wurde Sudholt vom Schöffengericht Starnberg wegen Volksverhetzung
zu vier Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 4.000 DM verurteilt. Erist Eigentümer der Verlagsgemeinschaft Berg (VGB), unter deren Dach drei rechtsextre-mistische Verlage arbeiten: Der Türmer-Verlag, der Vowinckel-Verlag und der Druffel-Verlag, die schon seit Jahren in deutschen Verfassungsschutzberichten erwähnt werden.
05_Koller-Seizmair Seite 452 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 53. Jg. 4/2006
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol453
veröffentlichte. In einem Bericht vom 15. November 1988, für das MfS in Ost-Ber-lin verfasst, fasste er dann zusammen: »Hier ist die Interessenlage ziemlich klar.Möglichst konkrete Verwirklichung der Autonomie, ein klares Ja zur Schutzmacht-funktion Österreichs, bis hin zum Zusammenschluss im föderativen Sinne mitNordtirol. In diesem Sinne agiert auch der „SVP“-Abgeordnete Dr. Franz Pahl, vondem einige bemerkenswerte Interviews bzw. auch Aufsätze zu diesem Komplexvorliegen.«48
Offenbar wähnte Weinmann trotz anderslautender Berichte die Täter der 80erJahre selbst nicht im Milieu von Selbstbestimmungsbefürwortern und sonstigenKonservativen. In einem Bericht vom 15. Dezember 1988 für die Stasi schreibt er je-denfalls: »Es spricht wirklich nicht viel dafür, dass rechtsextremistische Kräfte ausSüdtirol diese Sprengstoffanschläge verübt haben, aber auch nur eventuell Rechts-extremisten aus Österreich oder evtl. aus Deutschland. Dazu eine Erklärung: Nachjedem Sprengstoffanschlag mutmaßten rechtsextremistische italienische Kräfte unddie Polizei und der Geheimdienst, diese Spuren würden nach Innsbruck führen,ohne dabei genaue Daten anzugeben. Und interessanterweise wurden sog. Beken-nerschreiben mit der Aufschrift „Für ein Tirol“ bei den Postämtern in Innsbruckund Nürnberg aufgegeben, in einem Fall auch in München.« Weinmann neigte eherder These zu, die italienischen Dienste hätten selbst die Finger im Spiel. Trotzdemlenkte er den Verdacht auf die von der italienischen Polizei gescholtenen Kreise vonSelbstbestimmungsbefürwortern. Weinmanns eigenen Angaben zufolge hat er noch1992, als die Behörden in Deutschland bereits wegen seiner Stasi-Tätigkeit ermittel-ten, einen Auftrag von einem italienischen Geheimdienst erhalten.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DDR-Staatssicherheit vor allem auspropagandistischen Gründen in Südtirol mitmischte. Den Krisenherd anzuheizen,das war im Sinne der Freunde in Moskau. Die Bundesrepublik mit vermeintlichrechtsradikalen Gewaltakten in Zusammenhang zu bringen, das diente einem urei-genen Ziel: Die internationale Anerkennung als ersten anti-faschistischen Staat aufdeutschem Boden. Die Wahrnehmung der Westdeutschen und der Südtiroler jeweilsin Rom und Ost-Berlin prägten Informanten und Agents Provocateurs so, wie siedie jeweilige Zentrale sehen wollte. Die Stasi konnte dabei mit ihrer Propaganda aufeinen fahrenden Zug aufspringen: Die Polizei und die Presse in Italien bezeichnetenwahrheitswidrig die Mitglieder des Befreiungsausschuss als Nazis, bezichtigen siedes Pangermanismus.
Besonders deutlich zeigt sich das zumindest stillschweigende Zusammengehenüber den Eisernen Vorhang hinweg im Jahr 1964, als das Kühn-Urteil in der »Neu-en Justiz« kurz nach dem Artikel über die angebliche Terroristenschule in Bayern inder Illustrierten »L’Europeo« veröffentlicht wurde, beides wiederum in zeitlicherNähe zur MfAA-Direktive über Maßnahmen zur DDR-Öffentlichkeitsarbeit in
48 BStU, Archiv der Zentralstelle, MfS AIM 4691/91,4, Bl. 267.
05_Koller-Seizmair Seite 453 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
Michaela Koller-Seizmair · Interessen u. Aktitvitäten d. DDR-Staatssicherheit u. Südtirol454
Italien. Ab 1978 gab es eine Annäherung, an der sich auch die italienische Seite zu-nehmend interessiert zeigte und die in der Einladung aus Rom an Erich Honeckergipfelte, der ein halbes Jahr zuvor der Pangermanismus-Vorwurf Giulio Andreottisvorausgegangen war. Der Antipangermanismus war fast so etwas wie eine gemein-same ideologische Basis für die Zusammenarbeit, auch wenn äußerst rechte Elemen-te in Italien an dem Mythos mitstrickten. Die DDR schreckte aber vor keinemKooperationspartner zurück, wenn er nur dazu beitragen konnte, ihren Handlungs-spielraum zu erweitern.
Summary
It was mainly for propagandistic reasons that the Staatssicherheit of the GDR in-termingled in South Tyrol. Aggravating the crisis was in conformance with the inte-rests of the friends in Moscow. Putting the Federal Republic of Germany in thecontext of real or pretended right extreme violence served to pursue an original aim- to gain the international acknowledgement as the first anti-fascist German state.Informants and agents provocateurs formed the view on West Germans and SouthTyrolians in Rome and East Berlin in the very way the respective centre wanted tosee them. The propaganda of the Stasi could jump on a running band-waggon. Both,Italian politicians and Italian media designated the members of the Befreiungsaus-schuss as Nazis contrary to the facts and reproached them with pangermanism.
The taciturn go-together beyond the Iron Curtain becomes particularly obviousin the year 1964, when the Kühn verdict was publishd by the law magazine »NeueJustiz« shortly after the publication of the article on the pretented terrorist trainingcentre in Bavaria by the magazine »L’Europeo«. These two publications coincidetemporal with the MfAA (ministry of foreign affairs)-directive on measures concer-ning GDR public relations in Italy. From 1978 on there was a rapprochement inwhich the Italian side showed increasing interest. The latter climaxed in the invitati-on of Erich Honecker by Rome which as preceded by Giulio Andreotti’s reproachof pangermanism six months before. Antipangermanism was almost something likea common ideology on which the cooperation was based, even though elementsfrom the extreme right in Italy contributed to the creation of the myth. The GDRon the other hand did not shrink from any cooperation partner, who ever it is, ifonly the partner contributes to an enlargement of Eastberlin’s field of action.
05_Koller-Seizmair Seite 454 Donnerstag, 9. November 2006 2:33 14
ZfP 52. Jg. 2/2006
B U C H B E S P R E C H U N G E N
Bataille, Georges: Die innere Erfahrung.Die Freundschaft. Nietzsche und der Willezur Chance. Atheologische Summe I-III.(Lars Schuster) ........................................... ???
Steinvorth, Ulrich: Docklosigkeit oder zurMetaphysik der Moderne. Wie Fundamenta-listen und Philosophen auf die menschlicheFehlbarkeit reagieren.(Holger Zapf) ............................................. ???
Roy, Olivier: Der islamische Weg nach Wes-ten. Globalisierung, Entwurzelung und Ra-dikalisierung.(Armin Pfahl-Traughber) ......................... ???
Leonhard, Jörn: Liberalismus. Zur histori-schen Semantik eines europäischen Deu-tungsmusters.(Hans-Christof Kraus) .............................. ???
Massing, Otwin: Politik als Recht – Rechtals Politik. Studien zu einer Theorie der Ver-fassungsgerichtsbarkeit.(Daniel Hildebrand) ................................. ???
Janowski, Cordula Agnes: Die nationalenParlamente und ihre Europa-Gremien – Le-gitimationsgarant der EU?(Ralph Alexander Lorz) ........................... ???
Schiller, Theo / Mittendorf, Volker (Hrsg.):Direkte Demokratie. Forschung und Pers-pektiven.(Martin Sebaldt) ........................................ ???
Sachs, Jeffrey D.: Das Ende der Armut. Einökonomisches Programm für eine gerechtereWelt.(Armin Pfahl-Traughber) ......................... ???
Grothe, Ewald: Zwischen Geschichte undRecht. Deutsche Verfassungsgeschichts-schreibung 1900-1970.(Hans-Christof Kraus) .............................. ???
Wirsching, Andreas: Abschied vom Proviso-rium. Geschichte der BundesrepublikDeutschland 1982-1990. Band 6.(Helge F. Jani) ............................................ ???
Nolte, Ernst: Die Weimarer Republik. De-mokratie zwischen Lenin und Hitler.(Volker Kronenberg) ................................. ???
Kühn, Andreas: Stalins Enkel, Maos Söhne.Die Lebenswelt der K-Gruppen in der Bun-desrepublik der 70er Jahre.(Armin Pfahl-Traughber) ......................... ???
Anton, Florian / Luks, Leonid (Hrsg.):Deutschland, Rußland und das Baltikum.Beiträge zu einer Geschichte wechselvollerBeziehungen.(Holger Zapf) ............................................. ???
Kaiser, André: Mehrheitsdemokratie undInstitutionenreform. VerfassungspolitischerWandel in Australien, Großbritannien, Ka-nada und Neuseeland im Vergleich.(Martin Sebaldt) ........................................ ???
Georges BATAILLE: Die innere Erfahrung.Die Freundschaft. Nietzsche und der Willezur Chance. Atheologische Summe I-III.Übers. v. Gerd Bergfleth, Berlin 1999, 2002,2005. Verlag Matthes&Seitz, 287 S., S. 302,S. 392 S., gebunden, je 34 EUR.
In der jüngsten Vergangenheit drängt sich,stärker als in den Jahrzehnten zuvor, das Re-ligiöse wieder in den Blickpunkt der allge-meinen Aufmerksamkeit. Religiöser Funda-mentalismus christlicher, islamischer undanderer Prägung, aber auch gemäßigte reli-giöse Strömungen nehmen dabei mittel- undunmittelbar Einfluss auf das politische Ta-gesgeschäft. Die Religionen fordern ihrenerneuten Einbezug in das politische Kalkülein und verweisen als Begründung für die-sen Anspruch auf den vorgeblichen Exklu-sivzugang zu jenem Anderen, allem Sein
06_Buchbesprechungen Seite 455 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen456
Vorgängigen, das sie als Gott bezeichnen.Die Authentizität dieses Zugangs findet ihreBegründung in dem unmittelbaren mysti-schen Gotteserlebnis meist einiger wenigerPropheten und Heiligen, welches entwederin eine bereits bestehende theologische Se-mantik integriert wird und diese bestärkt,oder indem es zu ihrer Bildung anregt. Dasseine solche Semantik keineswegs in der Na-tur der Sache liegt, dass mystische Erfahrun-gen auch jenseits der althergebrachten theo-logischen Glaubenssysteme thematisiertwerden können, belegt Georges Bataille inseiner Atheologischen Summe, welche diedrei in den Jahren 1943-1945 erschienenBände Die innere Erfahrung (IE), DieFreundschaft (F) und Nietzsche und derWille zur Chance (N) umfasst. Darin verei-nigt finden sich vorwiegend Aphorismen,Essays, Fragmente, autobiografische Be-schreibungen und Tagebuchnotizen Batail-les zum weit abgesteckten Feld existenziel-ler Fragestellungen, ohne dass er doch, wieer selbst mehrfach betonte, zum Typus desExistenzialphilosophen, vergleichbar etwaSartre oder Camus, gerechnet werden kann.
Nach erstmaliger Lektüre blickt man aller-dings zunächst ein wenig ratlos auf das vorlie-gende Werk, das bei oberflächlicher Betrach-tung sehr an den Stil Friedrich Nietzscheserinnert, um den Bataille beständig kreist wieum ein geistiges Zentralgestirn: handelt essich hierbei noch um Literatur oder bereitsum Philosophie? Die aphoristischen Texte,die weite Teile der drei Bände ausfüllen, glei-chen eher zu sich selbst gesprochenen Mono-logen als geschliffenen Sinnsprüchen und zu-gespitzten Gedanken für interessierte Leser.Die stilistische Schwerfälligkeit seinerSchreibweise fällt besonders dort ins Auge,wo Bataille Zitate von Nietzsche in seinenText integriert; insbesondere der dritte Bandder Summe ist hierin reich bestückt. Batailleist sich dabei der fehlenden stilistischen Ele-ganz durchaus selbst bewusst, wenn er etwaabschließend zur Inneren Erfahrung schreibt(in einem Postskriptum von 1953): »Ich fühlemich nicht wohl bei diesem Buch. […] ichhasse seine Umständlichkeit und Dunkelheit.Ich hätte gern dasselbe in wenigen Wortengesagt.« (IE, 271)
Ein Problem bei der Lektüre stellt dieAbsage Batailles an das »Projekt« dar. Im
Grunde ist stets unklar ob überhaupt undfalls ja, welche Intention der Autor mit sei-nem Werk verfolgt. In seiner assoziativ-des-kriptiven Form gleicht es weniger einer phä-nomenologischen, wissenschaftlichen oderphilosophischen Analyse, die eine gewisseDistanz zum Betrachtungsobjekt voraus-setzt, sondern eher einer auf Unmittelbar-keit zielenden künstlerischen Darstellung.So stellt sich das Werk als Steinbruch dar, andessen Bruchkanten die geistigen und psy-chischen Tiefenprozesse Batailles zu Tagetreten. Gleichzeitig bieten sich die herausge-brochenen Fragmente als Ausgangspunktefür eigene Überlegungen an, ohne doch zustarr auf das System zu verweisen, dem sieentnommen wurden.
Zentraler Teil der Inneren Erfahrung istdas mit »Die Marter« überschriebene zweiteKapitel. Mit dem Begriff der Marter begeg-nen wir einem der Schlüsselbegriffe in Ba-tailles Werk, mit dem er unmittelbar an diePhilosophie Nietzsches anschließt und derKlage des tollen Menschen um den totenGott erneut Ausdruck verleiht. Die Marterbeschreibt die Qual des in die Freiheit ent-lassenen Menschen, der sich durch den Ab-senz Gottes auf sich selbst zurückgeworfenfindet. Allerdings geht Bataille mit seinemBegriff über Nietzsche hinaus, da er denMenschen nicht nur als an seiner Gottverlas-senheit leidend erkennt, sondern ihn derquälenden Erkenntnis zum Trotz in einemdionysisch-ekstatischen Gelächter vorfindet.Bataille hatte sich hierzu von zwei Bilderneines zu Tode gemarterten Menschen inspi-rieren lassen, die der franz. PsychologeGeorges Dumas in seinem Nouveau traitéde psychologie wiedergegeben hatte. Abge-bildet war die Marter eines Mannes währendeiner Lingchi-Hinrichtung, die bei Kapital-verbrechen in China bis ins 20. Jahrhunderthinein verhängt wurde: Dem aufrecht an ei-nen Pfahl gefesselten Delinquenten wurdenbei vollem Bewusstsein sukzessive Körper-teile abgetrennt, bis der Tod durch Enthaup-tung eintrat. Eines der Bilder zeigt den Ge-marterten, dem bereits die Brust und dieArme entnommen wurden, mit einem ver-zückt erscheinenden Lächeln und einemzum Himmel gewendeten Blick. Bedauerli-cherweise findet sich dieses Bild nicht in die-sem Buch Batailles abgedruckt (sondern
06_Buchbesprechungen Seite 456 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 457
stattdessen in Die Tränen des Eros), verdeut-licht es doch auf eindringlichste Weise, wel-chem paradoxen Begriff der Marter BatailleAusdruck zu verleihen sucht: ImmenserSchmerz und absolute Hoffnungslosigkeitführen doch nicht notwendig zur erwartba-ren Reaktion, sondern können einhergehenmit ekstatischen Zuständen der Verzückung.Wie der zu Tode Gefolterte sieht Batailleden Menschen am Ende der Moderne mitder absoluten Hoffnungslosigkeit in einernicht wieder aufzuhebenden Gottverlassen-heit gefangen. Doch statt das Requiem aeter-nam deo des tollen Menschen anzustimmen,verfällt der Verlorene ekstatischen Zustän-den, die ihn seiner existenziellen Situationentrücken. Dabei versteht es sich von selbst,dass diese Zustände, entgegen der Annah-men antiker und mittelalterlicher Mystiker,keineswegs auf ein dem Subjekt Äußerlichesverweisen. Das Außen bleibt leer, die Eksta-se verweist doch bloß auf das erlebende Sub-jekt selbst. Obwohl sich Bataille entschiedenvon der christlichen Theologie distanziert,hält er an einem ontologisch entleerten Got-tesbegriff fest, der sich durchaus sozialkri-tisch wenden lässt: »Gott scheint mir eineAntwort, die nicht weniger leer ist als die‚Natur’ des groben Materialismus. Dennochkann ich nicht die Möglichkeiten diesesGottes leugnen, die denen zuteil werden, diesich ein Bild von ihm machen: die Erfahrungexistiert für den Menschen; […]« (N, 88f)
Bataille steht diesen Betrachtungen nunkeineswegs neutral gegenüber, sondern ver-weist immer wieder auf eigene mystisch-eks-tatische Erfahrungen: »Sogleich erkannte ichGott. […] Wir machen uns gewöhnlich eineerbärmliche Idee von seiner Majestät: mirenthüllte sie sich in ihrer Unermeßlichkeit.«(N, 89) Dabei sieht er sich dem gleichen Pro-blem der Sprachlosigkeit gegenüber, wie vorihm die religiösen Mystiker: Nicht nur, dasssich die mystische Erfahrung des sprachli-chen Ausdrucks entzieht; vielmehr beschä-digt die Sprache sogar jenen besonderen in-neren Zustand. Was bleibt ist einerseits eineArt negativer Theologie im Sinne von Pseu-do Dionysius Areopagita und andererseitsdie Selbstbehauptung des Subjekts: »DerMystiker vor Gott verhielt sich als Untertan.Wer das Wesen sich selbst gegenüberstellt,verhält sich als Souverän.« (F, 58)
Wenngleich sich also die eigentliche Er-fahrung als unformulierbar erweist, könnendie Vorbedingungen und Folgerungen ausdem mystischen Erleben durchaus themati-siert werden: Während Bataille in der Inne-ren Erfahrung noch eremitisch anmutendeTugenden wie die Bestreitung des Wissens,Meditation und Askese als Wege in die Eks-tase diskutiert, wendet er in der Freund-schaft seinen Blick dem rauschhaften Erosund dem Alkoholexzess zu. Auch hier blei-ben die Situationen, auf die sich Bataille be-zieht, keineswegs theoretischer Natur: ohnesich in voyeuristischen Details zu verlierenbeschreibt er Bordellbesuche und die Teil-nahme an Orgien. In allen Fällen zielt er aufdie maximale Dezentrierung des Subjekts,das er stets an die Grenzen des Menschen-möglichen zu bringen sucht. An dieserGrenze, die nicht Gott ist, aber durchausgöttlicher Natur, steht die Verschmelzungvon unwissendem Subjekt und unerkann-tem Objekt.
Was in einer gott- und sinnentleerten Weltaus Sicht Batailles schließlich bleibt, ist dieMöglichkeit der Chance (bonne chance) unddes Missgeschicks (mauvaise chance), »derSpieleinsatz einer unaufhörlichen Infrage-stellung« (F, 111). Die Akzeptanz der Chan-ce bedeutet ein radikales Aufsspielsetzen al-les Möglichen, vor allem der Vernunft undder eigenen Person. Die entschiedene Hin-wendung zur Chance ist das Amor fati, andessen Ende doch keineswegs die Erlösung,sondern die absolute Vernichtung steht:»Denn die Chance erhebt uns nur, um unsaus größerer Höhe herabzustürzen; die ein-zige Gnade, die wir am Ende erhoffen kön-nen, ist die, daß sie uns tragisch vernichtet,anstatt uns am Stumpfsinn sterben zu las-sen.« (N, 132) Dieser erschreckenden Leereder Welt und des Lebens lässt sich lediglichdie rauschhafte Leidenschaft, die Ekstase,wie sie sich in den Zügen des Gemartertenzeigt, entgegensetzen: »Gott stellte die ein-zige Grenze dar, die sich dem menschlichenGeist widersetzte; frei von Gott, ist dieserWille unverhüllt der Leidenschaft preisgege-ben, der Welt eine Bedeutung zu verleihen,die ihn berauscht.« (F, 240)
Mit dem Willen zur Chance entlässt Ba-taille den Leser, wenn schon nicht hoff-nungsfroh, so doch mit dem Schicksal ver-
06_Buchbesprechungen Seite 457 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen458
söhnt aus der Atheologischen Summe. Auchder Krieg, der als permanente Hintergrund-folie stets durch die Anmerkungen Bataillesdurchschimmert, geht seinem Ende entge-gen; die deutsche Besatzung wird von denalliierten Truppen zurückgedrängt, der drit-te Band der Summe erscheint bereits in ei-nem befreiten Paris.
Geistesgeschichtlich stellt sich Bataillemit seiner Summe noch hinter Nietzscheund entfernt sich ein gutes Stück weiter vonDescartes und dessen Credo des »klarenund deutlichen« Formulierens: die Textewirken oft wie ein ekstatischer, teils wilder,teils ruhiger, wenig durchchoreografierterTanz, der sich oft dunkel und raunend gibt.In vielem erinnert Form und Inhalt derSumme an die surrealistischen Versuche desautomatischen Schreibens.
An einigen Stellen, so etwa im dritten Teilder Inneren Erfahrung, aber auch der imNietzsche-Band angeführten Diskussion, istdie zeitliche Zuordnung des Textes nichtohne weiteres erkennbar. Hier wären An-merkungen zur zeitlichen Verortung sicher-lich hilfreich, da sich diese aus den biblio-grafischen Kommentaren nicht immererschließen lässt.
Schließlich bleibt zu bemerken, dass sichdie Lektüre nur bei soliden philosophischenVorkenntnissen empfiehlt. Wenngleich alsunentbehrliches Werk für die Bataille-For-schung zweifelsohne von nicht zu über-schätzendem Wert, erscheint dem Rezen-senten die Atheologische Summe weder alsEinstiegslektüre in das Werk Batailles nochin die behandelte Thematik des mystischenErlebens als besonders geeignet. Wer aller-dings nach den Wurzeln der zeitgenössi-schen französischen Philosophie sucht, wirdmit diesen drei Bänden reich beschenkt.
Lars Schuster
Ulrich STEINVORTH: Docklosigkeit oder zurMetaphysik der Moderne. Wie Fundamenta-listen und Philosophen auf die menschlicheFehlbarkeit reagieren. Paderborn 2006.Mentis-Verlag, 221 S., kart., 24,80 EUR.
Eine Verteidigung des Liberalismus mit me-taphysischen Ansprüchen darf man in einer
Zeit, die gerne auch als postmetaphysischbezeichnet wird, durchaus ein Desideratnennen. Gerade die – um es gleich zu sagen:für den Verfasser gewissermaßen vorder-gründigen – »fundamentalistischen« Gegnerdieses philosophischen Liberalismus erfor-dern ja eine gewisse Sinnorientierung, wenndie Auseinandersetzung mit ihnen nichtsinnlos und eitel sein soll. Steinvorth hat daserkannt und nimmt einerseits das von We-ber als »Gehäuse der Hörigkeit« beschriebe-ne Gefühl einer von äußeren Zwängen über-schriebenen Autonomie, andererseits OttoNeuraths Bild vom Umbau des Schiffes aufhoher See als Ausgangspunkte für seineÜberlegungen.Die Verteidigung des Libera-lismus erfolgt hier gegen einen Fundamenta-lismus, den der Verfasser im Islam und derkatholischen Kirche verortet: auch politischstünden sich stets ausschließlich Docklosig-keit und Dogmatismus gegenüber. In denReligionen sieht Steinvorth die Vertreter ei-ner dogmatischen Vernunft am Werk, gegendie er die kritische Vernunft der liberalenPhilosophie, deren Tugend die Einsicht indie eigene Fehlbarkeit ist, verteidigen möch-te. Papst Johannes Paul II. dient dabei einemkleinen Vorgefecht, das der Verdeutlichungdes dogmatischen Verständnisses von Ver-nunft und Wahrheit dient. Nicht gerade mithermeneutischer Benevolenz behandeltSteinvorth hier die Aussagen des Papstes –ein Beispiel dafür ist die recht plumpeGleichsetzung dessen, was in Fides et Ratiounter Märtyrer verstanden wird, mit Selbst-mordattentätern (S. 27) –, doch gelingt esihm dabei immerhin recht schnell, seinen ei-genen Standpunkt deutlich zu machen: diemoralischen Aussagen der Religionen wer-den gegründet auf dogmatische Vernunftebenso wie auf einen Appell an die Autono-mie – gemäß dem Verfasser ein fast prome-theisches Programm, das hinter der eigentli-chen prometheischen Idee jedoch deutlichzurückbleiben muss.Eine durchweg wohl-wollendere und breitere Interpretation er-fährt Sayyid Qutb, den Steinvorth ohne vielFederlesens zum Repräsentanten des politi-schen Islam erhebt – einer Form des Funda-mentalismus, mit der der liberale Westenebenso rechnen müsse wie mit der des Ka-tholizismus. Dabei geht es Steinvorth darumzu zeigen, dass selbst ein ausgewiesener
06_Buchbesprechungen Seite 458 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 459
»Fundamentalist« wie Qutb (freilich auchder Papst) sich auf Vernunftgründe und in-dividuelle Autonomie berufen muss, um sei-ne Fundamentalismen vertreten zu können.Diese nach Steinvorth vordergründige Par-allele zum Liberalismus ist es dann auch, dieer bei Qutb sorgfältig, um nicht zu sagenmühselig und manchmal an der Grenze in-terpretatorischer Freiheit operierend, her-ausarbeitet. Erscheinen doch viele der sichso ergebenden Parallelen zwischen Funda-mentalismus und Liberalismus auf unglück-liche Weise unnötig, weil von vornhereinklar ist, dass sie sich inhaltlich doch aus-schließen (vgl. etwa S. 68). Steinvorth gehtzum Beispiel nicht darauf ein, dass QutbsPolitikbegriff mit seinem Freiheitsbegriffnicht ohne weiteres vermittelbar ist. Wenndie Gerechtigkeit der Herrschenden denGehorsam der Beherrschten verlangt (S. 64),so folgt daraus noch lange nicht, dass diegottgewollte Freiheit zur Betätigung derVernunft sich nahtlos in dieses Schema ein-fügen lässt. Gerade die islamische Traditionlehnt unter Berufung auf den Koran jedeswerktätige Vernünfteln ab und verlangtnach Gehorsam gegenüber den Herrschen-den. Steinvorth behauptet hinsichtlich derislamischen Tradition das glatte Gegenteil(S. 70) – er hat sich eben fast ausschließlichmit dem Umstürzler Qutb befasst, der hiereinen dezidierten Gegenstandpunkt ver-tritt. Der Verfasser arbeitet so immerhinheraus, wie ‚liberal‘ Qutb in Wirklichkeitist: und zwar hinsichtlich seiner gegenüberdem Staat vom Individuum ausgehendenArgumentation. Das ändert nichts daran,dass Qutb sich am Liberalismus weiterreibt, argumentativ hat er mehr mit ihm ge-mein, als einer orthodoxen islamischen Tra-dition lieb sein könnte – darum ist es durch-aus reizvoll, diese Nähe zur Moderne anseinem Beispiel nachzuvollziehen, auchwenn der Verfasser vor allem darauf abzielt,Parallelen zwischen Fundamentalismus undLiberalismus bezüglich der individuenzent-rierten Begründungsstrategie zu ziehen.Die-se ganze Auseinandersetzung spielt sich abvor dem programmatischen Hintergrundder Rehabilitation einer prometheischen Po-sition gegenüber dem, was Steinvorths Fun-damentalisten als dem Menschen unverfüg-bare Schöpfung oder Schicksal bezeichnen
würden. Die prometheische Idee bleibt auchim zweiten Teil des Buches bestimmend, woder Verfasser zunächst die kritische Ver-nunft gegenüber dogmatischer und skepti-scher Vernunft als (instrumentelle) Grund-lage eines philosophischen Liberalismusstark macht. Die Einsicht in die Fehlbarkeitempirischer Urteile wird hier zum Grundfür allgemeinverbindliche Erkenntnis, wasmit Hilfe von Poppers Falsifikationismusnachgewiesen wird. Diese kritische wird zurprometheischen Vernunft, sowie sie »derMenschheit und der individuellen Autono-mie nutzbar gemacht« wird (S. 110). Diesich dann anschließende Diskussion vonWittgensteins Privatsprachenargument zieltdarauf ab, die sprachlichen Grundlagen desErkennens als nicht-individuelle zu verste-hen: Erst die Interaktion zwischen Men-schen auf Grund einer gemeinsamen Naturlässt es zu, dass Wirklichkeit sprachlich er-schlossen wird. Dass aber die Tätigkeiten,die dem sprachlichen Weltzugang vorausge-hen, in der Moderne ihren Sinn verlierenkönnen, eröffnet für Steinvorth eine andere,noch bedrohlichere Dimension der Fehlbar-keit: die des Handelns.Dieser ist das nächsteKapitel gewidmet, in dem der Verfasser dieEvolution moralischer Intuitionen, Willens-freiheit und Autonomie erörtert. Im Gefol-ge Harts möchte Steinvorth die moralischenIntutionen vereinigen unter »der Idee einesuniversalen natürlichen, aber deswegennicht absoluten Rechts eines jeden Men-schen auf gleiche Freiheit.« (S. 139) Demwird ein ökonomisches »natürliches Rechtjedes Menschen, an der produktiven Verän-derung des Gemeineigentums teilzuneh-men« (S. 145) zur Seite gestellt – am Endeseines Buches wird er auf dieses keineswegsunproblematische Recht zurückkommen:auch eine metaphysisch fundierte Moderneist keineswegs postmaterialistisch. Nach-dem für die Willensfreiheit eine Lanze ge-brochen wurde, diskutiert der Verfasser sei-nen Autonomie-Begriff, der ja bereits beider Auseinandersetzung mit dem Funda-mentalismus neben dem der Vernunft inMittelpunkt der Überlegungen stand. Erversteht dabei Autonomie als eine eigeneArt von Handlungsfreiheit, die sich unterden Bedingungen von Konsistenz und Iden-tität des Individuums vollzieht – diese in der
06_Buchbesprechungen Seite 459 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen460
Zeit überaus fragwürdigen Kategorien wer-den hier nicht weiter problematisiert (S.170).Schließlich wird noch einmal die pro-metheische Idee in aller Deutlichkeit zurMetaphysik der Moderne erklärt: Der Sinn,die Metaphysik, die im Stande ist, den philo-sophischen Liberalismus und die von Stein-vorth postulierte prometheische Vernunftzu – man verzeihe mir das böse Wort – fun-dieren, liegt in der Annahme, dass die Exis-tenz intelligenten Leben selbst schon sinn-stiftend ist, zur Erhaltung und Steigerungauffordert – ein prometheisches Programmeben. Es wird klar ausgesprochen, dass diese»Fundierung« auch dem Wunsch geschuldetist, das Feld hier nicht den religiösen Funda-mentalismen zu überlassen (S. 187). Damitfreilich wird ein modernes Programm na-mens »plus ultra« fortgeschrieben, das aufeiner nun wohlformulierten metaphysischenGrundlage aufruht.Am Ende des Bucheswird – noch einmal – deutlich, welche Be-drohung Steinvorth am höchsten ansetzt.Mit dem Aufruf zu einer unheiligen Allianzzwischen Liberalismus und Fundamentalis-mus möchte er den Kapitalismus, der vorer-wähntes »natürliches Recht« unmoralischund menschenverachtend beschneide, in dieSchranken verweisen. Die prometheischeIdee soll als Metaphysik des philsophischenLiberalismus verhindern, dass derselbe inder Außenansicht mit einem ökonomischenNeoliberalismus in Eins fällt. Bedenklich istdie Art, wie darum der Angriff auf die TwinTowers als die Antwort auf eine solche neo-liberale Herausforderung verstanden wird:gälten die Türme »als Symbol promethei-scher Vermessenheit: sie könnten heutenoch stehen« (S. 211). Damit enthält dasBuch neben zahlreichen interessanten Über-legungen, von denen einige eine weit aus-führlichere Diskussion verdienten, auch vielMerkwürdiges. Gerade die Tendenz, Funda-mentalismus als eine obschon missglückteAntwort auf Verteilungsungerechtigkeit zubegreifen, ist angesichts des philosophischenAnspruchs unbefriedigend. Hier täte derDocklosigkeit mehr Mut zum Tiefgang gut.Manche Unklarheit ist freilich dem Um-stand geschuldet, dass diese tour de forcedurch ein halbes Dutzend brennender Pro-bleme vieles nicht ausführen kann. Stein-vorth immerhin bemüht sich gemäß seiner
eigenen wissenschaftstheoretischen und phi-losophischen Postulate um eine kohärenteBeantwortung der gestellten Fragen. Ob esihm aufzuweisen gelungen ist, dass der Tur-bokapitalismus mit der Docklosigkeit nichtszu tun hat – denn das war das Ziel des Un-ternehmens, das auch den gemeinsamenGegner von Docklosigkeit und Fundamen-talismus definiert – sei einmal dahingestellt,lesenswerte fehlbare Argumente hat er alle-mal geliefert. Gleichwohl bietet seine pro-metheische Metaphysik dem Individuumnur eine materielle, keine spirituelle Hoff-nung.
Holger Zapf
Olivier ROY: Der islamische Weg nach Wes-ten. Globalisierung, Entwurzelung und Ra-dikalisierung. Übers. v. Michael Bayer, Nor-bert Juraschitz, Ursel Schäfer. München2006. Pantheon-Verlag, 368 S., brosch., 12,90 EUR.
Angesichts der gegenwärtigen politischenEntwicklung in der arabischen Welt von ei-nem Niedergang des Islamismus zu sprechenmutet absonderlich an. Gleichwohl tun esgleich zwei Autoren, die in Frankreich alsführende Experten auf diesem Gebiet gelten:Gilles Kepel und Olivier Roy. Während dasvon Ersterem verfasste Schwarzbuch desDschihad bereits seit einiger Zeit auch indeutscher Sprache vorliegt, erschien erstweitaus später eine Übersetzung von Roysdiesbezüglicher Arbeit unter dem Titel Derislamische Weg nach Westen. Globalisierung,Entwurzelung und Radikalisierung. Der Au-tor ist Forschungsdirektor am Centre Natio-nal de la Recherche Scientifique (CNRS) undunterrichtet an der Ecole des Hautes Etudesen Sciences Sociales und an der Sciences Po inParis. Roy veröffentlichte eine Reihe vonAufsätzen und Büchern zum Islamismusund verwandten Themen, welche auch inzahlreichen Übersetzungen erschienen undihn zu einem international beachteten Exper-ten machten. In seinem Buch will er die sichverändernden Muster der Religiosität unterMuslimen im Spannungsfeld von Globalisie-rung und Individualisierung, Säkularisierungund Verwestlichung untersuchen.
06_Buchbesprechungen Seite 460 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 461
Es gliedert sich in acht Kapitel, die unter-schiedliche Schwerpunkte haben: Zunächstgeht es um die aktuelle Welle der Re-Islami-sierung, die eine Suche nach einer autono-men Position der Religion in bereits säkula-risierten Gesellschaften sei. Dem folgenAusführungen zur Privatisierung der Religi-on, den muslimischen Minderheiten in Euro-pa und dem Triumph des religiösen Indivi-dualismus. Hierbei erörtert Roy dasKonfliktverhältnis für den Islam im Westensowie bei der Verwestlichung des Islam. Ins-besondere weist er auf die Bedeutung der»Deterritorisierung« durch Migration undSäkularisierung hin, wodurch die muslimi-sche Identität ihre bisherige soziale Verwur-zelung verliere und sich in einer anderen ge-sellschaftlichen Konstellation neu bildenmüsse. Erst nach den damit verbundenenAnalysen spricht Roy den »Neofundamen-talismus« als neue Form der Radikalisierung,den individuellen Weg in den Terror und dieNeuvermessung der Weltpolitik an.
Das Besondere und Ungewöhnliche anRoys Arbeit besteht in einer spezifischenPerspektive, die von den bisherigen öffentli-chen Diskussionen zum Thema abweichtund mitunter zu Irritationen führen kann. Erunterscheidet nicht nur die Islamisten vonden Muslimen, sondern nimmt für die mitdem erstgenannten Begriff meist Gemeintennoch einmal eine besondere Unterscheidungvor. Demnach sind für ihn die Islamisten po-litische Bewegungen, denen es um die Erlan-gung von Macht zur Bildung eines wahrhaftislamischen Staates gehe. Sie beteiligen sichzu diesem Zweck auch an politischen Insti-tutionen und Prozessen. Demgegenüber leh-nen die Neofundamentalisten in Gestalt derterroristischen Gruppen solches ab, gehe esihnen doch allein um die verbindliche Aus-richtung an der Scharia. Die damit gemein-ten Dschihadisten nutzen zwar eine religiöseTerminologie, betrachten diese aber als bloßeLegitimation für ihr gewalttätiges Vorgehen.Anhänger finden sie vor allem unter Musli-men in westlichen Ländern, welche in einernicht-islamischen Gesellschaft als Minder-heiten leben und dort häufig ihre islamischeIdentität in Abgrenzung von der Mehrheits-gesellschaft entwickeln.
Bei allen antiwestlichen Grundhaltungengelten die Neofundamentalisten Roy dem-
nach als Produkt von Entwicklungen imWesten. Hierfür stehen bei ihm die Stichwor-te Globalisierung, Identitätssuche, Orientie-rungslosigkeit und Säkularität. FanatischeMinderheiten unter den Muslimen nutzendort die damit verbundenen Möglichkeiten,um junge Anhänger insbesondere in be-stimmten Moscheen für ihr terroristischesVorgehen zu rekrutieren. Die Entterritoriali-sierung des Islam durch das Leben im Wes-ten wird in diesen Kreisen durch die virtuelleGemeinschaft der Gläubigen in Geschichts-bildern oder im Internet ausgeglichen. Kurz-um, Roy deutet den »Neofundamentalis-mus« nicht als Reaktion auf eine erodierendetraditionelle Kultur, sondern als Indiz für dieEntwurzelung und Säkularisierung. Insofernlehnt er auch den kulturorientierten Ansatzab, welcher im Islam und Koran die Wurzeldes analysierten Phänomens sieht.
Roy erweist sich auch in diesem Werk alsausgezeichneter Kenner der Materie. Geradesein anderer Blick dürfte die öffentliche undwissenschaftliche Debatte beleben und diffe-renzieren. Bei seinem Bemühen, kursierendeDeutungsansätze zu kritisieren, geht er aller-dings selbst wieder zu einseitig vor. Ohne di-rekte argumentative Auseinandersetzung lässtRoy sie vorschnell fallen und beraubt damitseine eigene Interpretation eines gewissenMaßes an Ausgewogenheit - aber auch anKlarheit. Überhaupt nähert sich Roy etwas zuumständlich seiner eigentlichen Problematik,stellt er dieser doch nicht immer kontextbe-zogene Ausführungen voran. Darüber hinausargumentiert der Autor mitunter allzu frei-händig, hätte man sich hier und da doch ge-nauere Begründungen und Belege gewünscht.Gleichwohl bleibt sein Buch ein beachtens-wertes und wichtiges Werk zum Thema, al-lein schon aufgrund der Ausführungen zumWeg in den Terrorismus und dem kritischenBlick auf die Entwicklung im Westen selbst.
Armin Pfahl-Traughber
Jörn LEONHARD: Liberalismus. Zur histori-schen Semantik eines europäischen Deu-tungsmusters. Veröffentlichungen des Deut-schen Historischen Instituts London, Bd. 50.München 2001. Oldenbourg Verlag, 800 S.,gebunden, 79,80 EUR.
06_Buchbesprechungen Seite 461 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen462
Anknüpfend an ein Diktum Nietzsches, dereinmal bemerkte, nur dasjenige sei definier-bar, was keine Geschichte habe, unternimmtder Autor eine ausführliche, thematisch undmethodisch sehr weit ausgreifende Rekonst-ruktion der Entstehung und Entwicklungdes »Bewegungsbegriffs« Liberalismus, vor-nehmlich während der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts – also im zeitlichen Rahmeneiner Epoche, in der nicht nur eine ökono-mische, eine demographische, eine politi-sche, sondern eben, wie die Kenner wissen,auch eine sprachliche »Revolution« zu ver-zeichnen war, die von nicht wenigen auf-merksamen Zeitgenossen als »Sprachmenge-rei und Begriffsverwirrung« (26) empfundenworden ist. Ausgehend von der vorläufigenBestimmung, der Begriff Liberalismus be-zeichne »in klassisch-ideengeschichtlicherPerspektive eine fundamentale Traditionsli-nie Europas, ohne den die politisch-konsti-tutionelle Entstehungsgeschichte der Ge-genwart nur unvollkommen verstandenwerden kann« (28), rekonstruiert Leonhardnun die historische Semantik eben diesesBegriffs, der sich in seiner unleugbaren Vag-heit einer klaren und unzweideutigen Be-stimmung bis heute entzieht und nur ausden Zusammenhängen seiner Entstehungund Entwicklung – und zwar in den jeweilsverschiedenen ideengeschichtlich-politi-schen und besonders auch nationalen Kon-texten – heraus verstanden werden kann.
Anknüpfend zuerst an neuere Fragestel-lungen der historischen Komparatistik un-ternimmt der Autor es nun – indem erzugleich Ansätze der neueren Bürgertums-forschung wie auch der seit Kosellecksgrundlegenden Arbeiten in Deutschland be-gründeten Begriffsgeschichte aufnimmt,verfeinert und thematisch erweitert – dieGenese und die weitere Ausfaltung des Li-beralismus-Begriffs in vier europäischen po-litischen Regionen zu rekonstruieren:England, Frankreich, Deutschland und Itali-en. Gerade indem »nicht von einer retros-pektiven Dimension von Liberalismusausgegangen wird, sondern von einer histo-risch-semantischen Pluralisierung des Be-griffes in zeitlich-diachroner und zugleichkomparativer Hinsicht, wird dem histori-schen Deutungsmuster nicht a priori ein sta-tischer Rahmen von Inhalten, Werten und
Zielen unterlegt« (33). Diese methodisch-thematisch offene Fragestellung hat sich,wie bereits vorweggenommen werden darf,in jeder Hinsicht glänzend bewährt. Dennsie eröffnet den Blick auf die vielfältige,stark zerklüftete und – zuerst jedenfalls –ganz unübersichtliche Landschaft einesWortfeldes, dessen politisch bedingte se-mantische Entwicklungslinien erst nach undnach zu Tage treten.
Das von Leonhard als »Semantogenese«(73) eines historisch-politischen Begriffs be-zeichnete Verfahren kombiniert auf unge-mein ertragreiche Weise chronologische,systematische und komparativ-nationalge-schichtliche Perspektiven. Er unterscheidetinsgesamt vier Phasen der Begriffsentwick-lung: (1) die Ausgangsstufe der «präpoliti-schen Bedeutungsdimensionen« einesBegriffs, sodann (2) die »Fermentierungs-phase« in der sich vorpolitische und politi-sche Bedeutungselemente miteinandervermischen; (3) die eigentliche »Politisie-rung« eines Begriffsfeldes und (4) schließ-lich die gewissermaßen elaboriertepolitische Begriffsbestimmung, in der sichbereits im Spannungsfeld von Ideologisie-rung und Polarisierung die Ausgestaltungals Kampfbegriff im eigentlichen Sinne voll-endet (73f.). Der Untersuchungszeitraumumfasst im wesentlichen eben diejenigeEpoche, die von Koselleck als »Sattelzeit«des Übergangs von der europäischen Vor-moderne zur Moderne gekennzeichnet wor-den ist, also die Ära der Revolutionenzwischen 1776/89 und 1848/50 – gefolgt voneinem Ausblick auf die zweite Jahrhundert-hälfte.
Leonhard ermittelt vier Zeitstufen alsgrundlegende chronologische Untersu-chungseinheiten, die seine Untersuchungbestimmen: 1789 bis 1815/20, 1815/20 bis1830, 1830 bis 1835, sowie 1835 bis 1848/50.Eine besondere (und von der bisherigenForschung in dieser Form unterschätzte)Bedeutung kommt dabei vor allem dem ver-gleichsweise knappen Zeitraum zwischen1830 und 1835 zu, eben weil jene »Phase derfranzösischen Julirevolution und ihrer Re-zeption in den verschiedenen Ländern bzw.die erste Welle politisch-konstitutionellerReformen in England eine wesentliche Rol-le« (75) für die Entwicklung der Bewe-
06_Buchbesprechungen Seite 462 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 463
gungsbegriffe »Liberalismus«, »liberalism«,»liberalisme« bzw. »liberalismo« gespielthat. Sympathisch mutet es den Leser in die-sem Zusammenhang an, dass der Autornicht nur die Bedeutung und die heuristi-schen Möglichkeiten seines Ansatzes thema-tisiert, sondern durchaus auch dessen innereund äußere Begrenzungen. Und im Weite-ren bleibt zu erwähnen, dass er ebenfalls be-müht ist, stets über den Tellerrand einer rei-nen Begriffsgeschichte hinauszuschauen,indem er betont, dass seine Untersuchungnicht zuletzt »zur Erschließung der unter-schiedlichen politisch-kulturellen Definitio-nen des Bürgertums als europäischer Sozial-formation der Moderne« (85) beizutragenbeabsichtigt.
Seine anschließende Untersuchung, in de-ren Rahmen er sein sehr anspruchsvollestheoretisches Programm entfaltet, gliedertsich in insgesamt sechs große chronologi-sche Abschnitte: Hier rekonstruiert er an-schaulich die jeweilige nationalgeschichtli-che Begriffsentwicklung mit einer Fülle vonBelegen, die er am Schluss in eine verglei-chende Perspektive bringt, beginnend mitder »Inkubationszeit« des politisch-sozialenDeutungsmusters Liberalismus zwischen1789 und 1820 und endend mit einem Aus-blick auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-derts. Der Reichtum seiner Reflexionen undResultate kann hier allenfalls angedeutetwerden, ebenfalls die Fülle der überraschen-den Quellenfunde, von denen an dieser Stel-le lediglich pars pro toto die hochinteressan-te Rekonstruktion einer vergessenen,gleichwohl überaus bedeutenden politisch-begriffsanalytischen Schrift von Carl Lud-wig von Haller aus dem Jahre 1822 erwähntwerden soll (271-276).
Die eigentlichen Resultate seiner Unter-suchung sind folgende: Zuerst einmal er-weist sich der untersuchte Begriff wirklichals ein nicht nur chronologisch, sondernauch nationalgeschichtlich-territorial zu dif-ferenzierender Bewegungsbegriff, d. h. diekomparative historische Semantik von Libe-ralismus (liberalism, liberalisme, liberalis-mo) »erlaubt keine idealtypische Charakte-risierung eines gesamteuropäischenGrundbegriffes« (546); zu unterscheidensind allenfalls mehrere, semantisch genaudifferenzierbare »Liberalismen« der ver-
schiedenen Nationen. Zweitens stellt sichdie genuine Modernität des Begriffs heraus;eine Rückkehr zur traditionellen societas ci-vilis sive res publica erscheint in diesem Ho-rizont als unmöglich. Was nun die jeweili-gen nationalgeschichtlichen Entwicklungenanbetrifft, so hat man es sozusagen mit lau-ter einzelnen »Sonderwegen« zu tun (umdiesen in der deutschen neueren Geschichts-schreibung höchst umstrittenen Begriff zugebrauchen). In Frankreich entwickelte undveränderte sich der Begriff und das mit ihmverbundene politische Konzept am rasantes-ten und auch am tiefgreifendsten, wie sichanhand einer Analyse der wechselnden Be-griffsverwendung nach den jeweiligen poli-tischen Umbrüchen (1789, 1799, 1814/15,1830, 1848/51, 1870/71) nachweisen lässt. InDeutschland wiederum verlief die Entwick-lung wesentlich langsamer; hier blieb derBegriff länger seinen vorpolitisch-wertbe-hafteten Ursprüngen in der Spätaufklärungverbunden und entwickelte sich erst seitetwa 1830 zu einem genuin politischen undschließlich auch weltanschaulich stark auf-geladenen (und selbst wiederum bekämpf-ten) Bewegungsbegriff.
Ähnlich verlief die Entwicklung in Itali-en, wo sich seit der Jahrhundertmitte zuneh-mend die politisch-religiös-weltanschauli-che Polarität zwischen liberalismo undcattolicismo entfaltete und wo sich diese Di-alektik politischer Komplementärbegriffespäter immer weiter ausdifferenzierte. InGroßbritannien endlich gestaltete sich dieEntwicklung wiederum vollkommen an-ders als auf dem Kontinent – Leonhardscheut sich nicht, von einer angelsächischen„spezifische[n] Sonderentwicklung“ (554)zu sprechen. Denn hier dominierten weiter-hin die schon in der Frühmoderne ausgebil-deten »politischen Wertmuster«, die sich imtradierten Whig/Tory-Gegensatz bereits seitdem 17. Jahrhundert herausgebildet hattenund die unter den Bedingungen des frühen19. Jahrhunderts nun vergleichsweise konti-nuierlich und unspektakulär, wenngleichebenfalls keineswegs konfliktfrei in das poli-tische Gegensatzpaar liberal/conservativeüberging. Die Transformation von der letzt-lich aristokratisch geprägten Whig-Ideolo-gie des 18. Jahrhunderts zum moderat-bür-gerlichen liberalism wurde erleichtert durch
06_Buchbesprechungen Seite 463 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen464
bewusst konstruierte ideologische Traditi-onslinien einer vermeintlich genuin-freiheit-lichen englischen Verfassungsentwicklung;liberalism konnte daher umso leichter zu ei-nem neuen nationalen Wertbegriff avancie-ren, der sich sowohl traditional legitimierenwie auch mit modernen Ideen neu und zeit-gemäß definieren ließ – etwa durch JohnStuart Mill.
Der Reichtum der Ergebnisse dieser Stu-die kann im Rahmen dieser Rezension bes-tenfalls angedeutet werden, doch wenigstenszwei besondere Vorzüge sollen abschließendnoch erwähnt werden: Zum einen ist die au-ßerordentliche Fülle der herangezogenenund ausgewerteten Quellen in vier verschie-denen Sprachen (das kleingedruckte Ver-zeichnis umfasst knapp 70 Seiten) zu nen-nen, und zum anderen ebenfalls dieumfassenden, exzellenten Begriffsregister insogar fünf Sprachen (Deutsch, Englisch,Französisch, Italienisch und Latein) auf et-was mehr als 70 Seiten! Auch in formalerHinsicht lässt diese herausragende Arbeitkaum etwas zu wünschen übrig. Sie darf alsModellstudie einer modernen politischenBegriffsgeschichte aufgefasst werden, diehoffentlich bald Nachahmer finden wird,denn an historisch wichtigen und die jewei-ligen politischen Kulturen prägenden Leit-begriffen, die einer semantisch-geschichtli-chen Analyse dringend bedürften, mangeltes wahrlich nicht.
Hans-Christof Kraus
Otwin MASSING: Politik als Recht – Rechtals Politik. Studien zu einer Theorie der Ver-fassungsgerichtsbarkeit. RechtspolitologieBd. 18. Baden-Baden 2005. Nomos Verlags-gesellschaft, 276 S., gebunden, 44,- EUR.
Rechts- und Verfassungspolitologie stellt inDeutschland einen noch vergleichsweisejungen Zweig der Wissenschaft dar, wasnicht zuletzt im Untersuchungsgegenstandbegründet liegt. Politik-, Geschichts- undRechtswissenschaft führen im Gegensatz zuGroßbritannien immer noch eher ein Ne-beneinander als ein Miteinander. Immerhinzeigt nicht zuletzt der Werdegang von Mas-sing selbst, daß es kein Gegeneinander mehr
ist, lehrte der Verfasser doch lange Jahre alsPolitologe an der rechtswissenschaftlichenFakultät Hannover.
Anläßlich seiner Emeritierung hat derGelehrte nun Aufsätze aus vier Jahrzehntenzu einer Theorie der Verfassungsgerichtsbar-keit verdichtet. Er beginnt mit der Kritik ei-nes Phänomens, das sich im öffentlichenDiskurs der Bundesrepublik Deutschlandbis heute erhalten hat: Nämlich der Reduk-tion jeglicher politischer Konflikte und jeg-licher Argumentation, mag sie auch noch sooffensichtlich oder trivial sein, auf dasGrundgesetz als Argumentationsgrundlage.Der inflationäre, mittlerweile gar in den pri-vaten Alltag abgesunkene Rekurs auf dieMenschenwürde dürfte das wohl anschau-lichste Beispiel darstellen. Vor diesem »Na-bel und Tabernakel des bundesrepublikani-schen Selbstverständnisses« sinke »eineganze Zunft [...] in die Knie.« (S. 17) – eineFeststellung, die freilich lange Zeit eher aufPolitik und öffentliche Meinung als auf dieStaatsrechtslehre zutraf: Diese wartete viel-mehr relativ lange ab, ehe sie sich gegenüberder 1949 verabschiedeten Verfassung einUrteil bildete, wie jüngst Frieder GünthersForschungen erneut gezeigt haben.
Während der »Statusbericht«, den derGründungsrichter Gerhard Leibholz 1952verfaßte, das Bundesverfassungsgerichtnoch ganz auf die rein rechtsprechendeFunktion beschränkt und ihm jede politi-sche Gestaltungsfunktion abgesprochen ha-be, habe sich, wie Massing nachzeichnet,alsbald eine »Justizherrschaft« verfestigt. Invielen Fällen sei die tatsächliche oder zu-mindest vom Gericht beanspruchte Freiheit,nicht an spezielle Verfahren gebunden zusein, die für den jeweils zu entscheidendenEinzelfall geschaffen seien, ein gewichtigerMachtfaktor, weil relative formale Freiheiteben auch materiale Spielräume eröffnet (S.49).
Das Problematische an der politischenHerrschaftsfunktion, die dem Gericht fak-tisch zufällt, liegt zweifelsohne in seiner feh-lenden unmittelbaren demokratischen Legi-timation und der Konkurrenz zurLegislative: »Korrelativ zur Verfestigung derJustizherrschaft läßt sich« daher schon 1967von Massing eine »Ohnmacht der Parla-mente« feststellen (S. 64). Es bleibt jedoch
06_Buchbesprechungen Seite 464 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 465
die Frage, ob Machtgewinnung und Macht-erhalt des höchsten deutschen Gerichts sichnicht noch subtiler und längst an noch un-vertrauteren Konfliktlinien entwickeln, alsdies die gewiß scharfsinnigen und metho-disch elaborierten Analysen Massings glau-ben machen wollen. In einem bereits 1970verfaßten Aufsatz berichtet Massing von ei-ner Neigung, »das politische Risiko zuneh-mend auf Judikative Funktionsträgerüber[zu]wälz[en]« (S. 83). Gut eine Genera-tion später ist diese Pathologie des politi-schen Systems weiter vorangeschritten:Nicht wenig spricht zum Beispiel dafür, daßzumindest von den jeweiligen Bundesregie-rungen dieser Weg gar planmäßig angestrebtoder doch zumindest in Kauf genommenwird. (cf. z. B. Korte / Fröhlich, Regieren inDeutschland, 2004, S. 61). Eigenartigerwei-ser war bis vor kurzem diese Entwicklungvor allem im Bereich der Familienförderungzu beobachten, wie gerade die staatsrechtli-che Literatur kritisch hervorhebt (cf. z. B.Schmehl, Das Äquivalenzprinzip, 2004, S.209). Parlamentarische Souveränität zuwahren »gelingt am besten, wenn die Recht-sprechung an grundlegende systembildendeGestaltungsentscheidungen des Gesetzge-bers anknüpft – das setzt indes voraus, daßder Gesetzgeber Entscheidungen dieser Artauch tatsächlich trifft« (ebd. S. 21). Außer-dem ist auch eine Tendenz zu »vorauseilen-dem Gehorsam des Gesetzgebers« zu beob-achten (cf. Rudzio, Das politische Systemder Bundesrepublik Deutschland, 2003, S.326). Dieses Vorgehen ist nicht nur als sol-ches gleichermaßen ineffizient wie indiffe-rent, sondern es fügt dem in Deutschlandohnehin eher schwachen Parlamentarismusdauerhaften Schaden zu. Dies mündet nichteben selten darin, daß das Bundesverfas-sungsgericht die Autonomie des Gesetzge-bers schützend hegen muß, wie beispielwei-se am Finanzausgleichsrecht deutlich wird.Manche Verfassungsjuristen sehen eine sol-che Entwicklung, wie sie hier für das einfa-che Gesetz beschrieben wird, sich auch beider Verfassungsgebung vollziehen.
Zwar stellt eine systematische Untersu-chung des sozialen Hintergrundes sämtli-cher Richter nach wie vor ein Desiderat derForschung dar. Aber dennoch sind MassingsVersuche, im Bundesverfassungsgericht eine
Agentur der »politisch organisierten gesell-schaftlichen Macht« auszumachen (S. 91),was zur »Verfestigung« von »partikularenMachtprivilegien« führe, »m. a. W. sozial-konservierend sich auswirkt«, nicht rechtüberzeugend (S. 96). Vielmehr ist heuteweithin anerkannt, daß Demokratie sehrviel stärker antiegalisierend wirkt als anderslegitimierte Herrschaftsformen. NamhafteVerfassungsrichter, so auch der jetzige Präsi-dent, entstammen zudem nicht sozialen Ver-hältnissen, die sich als privilegiert oder garals »herrschende Klasse« apostrophieren lie-ßen – wenn es denn eine solche Klasse über-haupt noch gibt. Vielmehr scheint es sichum sachlich begründetes elitäres Exklusivi-tätsdenken intellektuell hochdifferenzierterPersönlichkeiten zu handeln, was nicht un-bedingt weniger problematisch ist, steht da-hinter doch häufig ein relativ offenartikuliertes Mißtrauen in Parlament undBürger, in Demokratie und politische Frei-heit. Diese Denken ist eher als spezifischdeutsch und antiwestlich, denn als bour-geois oder adelig zu werten. Einer der erstenGegner des in Deutschland mühsam Fußfassenden Parlamentarismus war neben denpreußischen Reaktionären bekanntlich derHegelianer Karl Marx. In der letzten Demo-kratie der Welt, in der richterliche Aufgabensogar offiziell an Adelstitel gebunden sind,nämlich in England, gilt bekanntlich dasGebot des Parlamentsabsolutismus, derauch nur eine Machtstellung, wie sie etwader US-Supreme-Court einnimmt, undenk-bar werden läßt. Eine strukturell zutreffen-de Beobachtung wird hier vom Verfasser indas theoretische Schema der für ihn prägen-den Frankfurter Schule hineingepreßt: DieWirklichkeit eines nicht standes-, sondernfunktionselitär begründeten Außerkraftset-zens parlamentarischer Herrschaft ist abernoch viel unangenehmer, denn sie einzuord-nen entzieht sich den überkommenen ideo-logischen Linien, die auch noch für dasheutige Parteiensystem konstitutiv sind.
Bemerkenswert ist die Weite, die Mas-sings Blick auf die Grundsätzlichkeit undÄtiologie dessen auszeichnet, was im Phä-nomen des Bundesverfassungsgerichtes nureines seiner Symptome aufweist: Bundes-rechnungshof und Deutsche Bundesbank,EZB und EuGH, ließe sich inzwischen hin-
06_Buchbesprechungen Seite 465 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen466
zufügen, sind weitere Symptome, die aus»einer strukturellen Schwäche des parla-mentarisch-repräsentativen Regierungssys-tems« erwachsen (S. 111). Daß dieseEntwicklung über alle ideologisch noch sounterschiedlich ausgerichteten Bundesregie-rungen hinweg noch immer weiter voran-schreitet, zeigt die Einrichtung dessogenannten »Gemeinsamen Bundesaus-schusses«, mit dem ein weiteres zunehmendbedeutenderes Entscheidungsfeld dem Par-lament entzogen wird: Die Versicherungs-leistungen im Gesundheitswesen.
Die gegenwärtige Wirklichkeit erweistsich im Lichte dieser Summe eines ganzenGelehrtenlebens als ernüchternd. Treffendbeschreibt der Hannoveraner Politikwissen-schaftler daher seine Arbeit als »Kritik, dienicht veralten will.«
Daniel Hildebrand
Cordula Agnes JANOWSKI: Die nationalenParlamente und ihre Europa-Gremien – Le-gitimationsgarant der EU? Baden-Baden2005. Nomos Verlagsgesellschaft, 278 S., ge-bunden, 49,- EUR.
Die Entwicklung der Europäischen Unionund ihrer Gemeinschaften ist in vielfacherHinsicht einzigartig und bemerkenswert.Zu ihren zahlreichen Denkwürdigkeiten ge-hört eine Beobachtung, die auf den erstenBlick ihren eigenen Traditionen ebenso wieder institutionellen Logik ins Gesicht zuschlagen scheint: die Bereitwilligkeit odervielleicht auch Gleichgültigkeit, mit der dieParlamente ihrer Mitgliedstaaten jahrzehn-telang der eigenen Entmachtung zugesehenhaben. Die Europäischen Gemeinschaftenbegannen ihre Existenz im Prinzip als reineExekutivveranstaltung: mit einer machtlo-sen »Versammlung« auf europäischer Ebe-ne und nationalen Parlamenten, die sich ent-weder aus Unkenntnis oder im Interesseeines scheinbar höheren Ziels auf eine Zaun-gastrolle beschränkten. Die Überreste diesesUrsprungs sind in der institutionellen Ar-chitektur der Europäischen Union nochheute deutlich zu erkennen.
Spätestens mit dem Vertrag vonMaastricht hat sich dieses Bild allerdings ge-
wandelt. Die zunehmende Verlagerung vonKompetenzen auf die europäische Ebene hatdas Bedürfnis nach einer direkteren Rück-kopplung der europäischen Entscheidungs-träger an die sie legitimierenden Völker we-sentlich erhöht. Als Reaktion darauf hat sichnicht nur das Europäische Parlament weit-gehende Mitentscheidungsrechte erkämp-fen können, sondern auch die nationalenParlamente sind zum großen Teil aus ihremDornröschenschlaf erwacht und versuchendie europäischen Entscheidungsprozessestärker zu beeinflussen. Speziell in Deutsch-land erscheint dies außerdem als eine verfas-sungsrechtliche Notwendigkeit. Denn inseiner Entscheidung zum Maastrichter Ver-trag hat das Bundesverfassungsgericht fest-gestellt, das Europäische Parlament sei inErmangelung wahrhaft supranationaler ge-sellschaftlicher und politischer Strukturennur begrenzt in der Lage, die demokratischeLegitimation der Europäischen Union zugewährleisten; die nationalen Parlamentemüßten daher »zuvörderst« Legitimations-garanten der EU und ihrer Maßnahmenbleiben.
Wie aber können nationale Parlamente ih-ren Einfluß in Europa besser geltend ma-chen? Dies kann in aller Regel nur über eineEinflußnahme auf die eigene Regierung undihr Abstimmungsverhalten im Ministerraterfolgen. Das parlamentarische Plenum istjedoch durchweg zu schwerfällig, um einenderartigen Einfluß effektiv ausüben zu kön-nen. Aus diesem Grund rücken die inzwi-schen von fast allen nationalen Parlamenteneingesetzten »Europa-Gremien« – typi-scherweise besondere Ausschüsse – in denMittelpunkt des Interesses. Die tatsächlicheArbeit dieser Gremien, ihre Ausstattungund ihre Wirksamkeit sowie die daraus zuziehenden Schlußfolgerungen für ihre Stel-lung als »Legitimationsgaranten« der EUsind aber erstaunlicherweise bisher kaumumfassend untersucht worden. Die Disser-tation von Janowski, 2004 an der UniversitätBonn unter der Betreuung von Gerd Lang-guth entstanden und in der Schriftenreihedes dortigen Zentrums für Europäische In-tegrationsforschung publiziert, schließt hiereine wesentliche Forschungslücke und prä-sentiert ebenso fruchtbare wie überraschen-de Erkenntnisse.
06_Buchbesprechungen Seite 466 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 467
Das gilt schon für die beiden einleitendenKapitel, in denen die Verfasserin die Pro-blemstellung erläutert und den aktuellenForschungsstand nachzeichnet. Wie es sichfür eine gute politikwissenschaftliche Re-cherche gehört – als in empirischen For-schungen wenig bewanderter Jurist ist manfür solche Datensammlungen besondersdankbar –, belegt sie im einzelnen den unge-heuren Umfang, den die europäische Recht-setzungstätigkeit mittlerweile gewonnenhat, den damit einhergehenden Kompetenz-verlust der nationalen Parlamente, der sichvor allem aus der statistisch feststellbarenVorliebe der europäischen Organe für denErlaß von Verordnungen ergibt, und dieebenfalls daraus resultierende Flut von Vor-lagen, die die nationalen Parlamente ausBrüssel erreichen (S. 46 ff.). Man bekommtso schon einen sehr guten Eindruck von derHerkulesarbeit, der sich die Europa-Gremi-en dieser Parlamente gegenübersehen.
Das Herzstück der Arbeit bildet aberzweifellos die vergleichende Betrachtung al-ler Europa-Gremien der alten 15 Mitglied-staaten, die sich in dieser Form in der Lite-ratur noch nirgends findet (S. 69 ff.).Janowski beginnt verständlicherweise mitdem EU-Ausschuß des Deutschen Bundes-tages, jedoch nicht primär wegen ihrer eige-nen Herkunft bzw. ihrem Forschungsort,sondern vor allem deswegen, weil dieserAusschuß das institutionell am besten ver-ankerte Gremium verkörpert und weil dasBeharren auf einer dualen Legitimations-struktur der Union unter vorrangiger Ein-beziehung der nationalen Parlamente – nichtzuletzt aufgrund der entsprechenden Recht-sprechung des Bundesverfassungsgerichts –eine deutsche Spezialität darstellt. Von derdeutschen Situation ausgehend werden füralle mitgliedstaatlichen Parlamente gleicher-maßen Institutionalisierung, Struktur, Ver-fahren und Rechtsinstrumente der Europa-Gremien, aber auch ihre Sitzungshäufigkeitsowie Zahl und Auswirkungen ihrer Be-schlüsse untersucht. Dabei ergeben sichhöchst interessante Aufschlüsse, die die Ver-fasserin dankenswerterweise typisierend zu-sammenfaßt: So sind die Europa-Gremienin Deutschland und Österreich zwar amstärksten rechtlich abgesichert, die größtefaktische Einflußnahme läßt sich jedoch un-
geachtet ihrer formal schwachen Stellungfür die Gremien der skandinavischen Staa-ten konstatieren – weshalb Janowski auchdafür plädiert, die Verfahrensweise des däni-schen Folketing zum Vorbild zu nehmen –,während sich die Parlamente der Benelux-Staaten bewußt zurückhalten, um dem Eu-ropäischen Parlament keine Konkurrenz zumachen, und die Parlamente der Mittel-meerländer von vornherein kaum europapo-litisches Kontrollinteresse zeigen. MitFrankreich und Großbritannien (an dessenTradition sich Irland noch anlehnt) stellenschließlich ausgerechnet die beiden nebenDeutschland größten und einflußreichstenMitgliedstaaten aufgrund ihrer speziellenverfassungsrechtlichen Situation Sonderfäl-le dar, die sich in allgemein relativ geringenEinflußmöglichkeiten der nationalen Parla-mente auf die Regierungspolitik nieder-schlagen.
Insgesamt zeichnet Janowski ein ernüch-terndes Bild. Von den 15 untersuchten nati-onalen Parlamenten verfügen überhaupt nurfünf über eine hinreichende Basis für effek-tive europapolitische Mitwirkung. Undauch diese bestehen den von ihr durchge-führten Praxistest (S. 192 ff.) nur sehr be-grenzt; so kann sie etwa für den EU-Aus-schuß des Bundestages nachweisen, daß erdie Europapolitik der Bundesregierung bis-her mit keinem seiner Beschlüsse tatsächlichbeeinflußt hat. Janowski zieht daraus einesich fast schon aufdrängende Konsequenz –die aber auch nur auf der Basis ihrer Unter-suchung möglich wird, was ein ganz we-sentliches Ergebnis ihrer Arbeit ausmacht:sie stellt das gerade in Deutschland herr-schende Dogma von der dualen Legitimati-onsbasis der Europäischen Union grund-sätzlich in Frage. Denn wenn die nationalenParlamente die ihnen zugedachte Kontroll-und Legitimationsfunktion faktisch garnicht erfüllen können, bricht die darauf auf-gebaute zweite Säule der demokratischenLegitimation der Union in sich zusammen,was zwangsläufig die Frage nach möglichenAlternativen heraufbeschwört. Janowski be-antwortet diese Frage am Schluß ihrer Ar-beit (S. 233 ff.) mit einer »präsidentiellenDemokratisierungsstrategie« und fordertdie Direktwahl des Kommissionspräsiden-ten durch die Unionsbürger. Über den prak-
06_Buchbesprechungen Seite 467 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen468
tischen Nutzen dieser Strategie mag mannun trefflich streiten; das bleibende Ver-dienst ihrer Arbeit liegt jedoch darin, dieGrenzen des derzeit gängigen dualen Legiti-mationsmodells klar aufgezeigt und damitdie Frage nach der demokratischen Legiti-mation Europas neu gestellt zu haben.
Ralph Alexander Lorz
Theo SCHILLER / Volker MITTENDORF(Hrsg.), Direkte Demokratie. Forschungund Perspektiven. Wiesbaden 2002. West-deutscher Verlag, 387 S., brosch., 34,90EUR.
Direkte Demokratie erfreut sich inDeutschland gerade seit Beginn der neunzi-ger Jahre sowohl in der politischen Praxisals auch in der politikwissenschaftlichenForschung eines boomartigen Aufmerksam-keitszuwachses. Denn obwohl bei derGrundgesetzreform 1994 die Einfügung di-rektdemokratischer Elemente in die bundes-deutsche Verfassung scheiterte, war dochauf Länder- und auf kommunaler Ebene einsystematischer, flächendeckender Ausbaudieses plebiszitären Partizipationsinstru-mentariums zu beobachten, wobei sowohlbestimmte Skandale (Barschel-Affäre) alsauch die Wiedervereinigung hierfür katalyti-sche Wirkungen entfalteten. Der bereits1998 von der neuen rot-grünen Regierungim Koalitionsvertrag angekündigte undjüngst wieder erneuerte Vorstoß zu einerentsprechenden Reform auf Bundesebenehat der Diskussion noch einmal neuen Auf-trieb verliehen.
Theo Schillers und Volker MittendorfsSammelband kommt daher zur rechten Zeit,und er ist natürlich auch Produkt dieserKonjunktur des Themas »Direkte Demo-kratie«. Nicht weniger als 22 Einzelbeiträgesind in ihm versammelt, die sich dem Ge-genstand ganz unterschiedlich nähern: Nacheinführenden Artikeln der Herausgeber undOtmar Jungs zu neuen Entwicklungen di-rekter Demokratie bzw. zum aktuellen For-schungsstand werden in vier Teilen ver-schiedene Schwerpunktbereiche bearbeitet:Abschnitt I dient der ländervergleichendenAnalyse von »Entwicklung, Formen und
Ergebnisse(n) direktdemokratischer Verfah-ren« im allgemeinen, während der zweiteTeil dem »Bürgerbegehren und Bürgerent-scheid in den Gemeinden« insbesondere inDeutschland gewidmet ist. Abschnitt III be-leuchtet dann den Themenaspekt »Mei-nungsbildung und Kommunikation in derdirekten Demokratie«. Beschlossen wirdder Band von mehrere Länder umgreifendenStudien zu den »Perspektiven direkter De-mokratie« (Abschnitt IV). Abweichend vondieser Gliederung seien einzelne Beiträgeverschiedener Abschnitte nach ihrer inhalt-lichen Affinität hier zusammengeführt undangesprochen:
Theo Schiller und Volker Mittendorf wei-sen in ihrem Einführungsbeitrag insbeson-dere auf bestehende Forschungsdesideratehin: Die fachwissenschaftliche Diskussionsei bisher zu juristenlastig geführt worden,und die fortschreitende europäische Integra-tion bringe auf supranationaler Ebene neueAnsatzmöglichkeiten plebiszitärer Partizi-pation. Im Rahmen der schon beschriebe-nen Konjunktur des Themas macht OtmarJung eine zunehmende »Überwindung« desdirektdemokratiefeindlichen »deutschenFundamentalismus« aus, der auch durchwachsende Nachweise besserer Performanzvon politischen Systemen mit direktdemo-kratischen Elementen bewirkt worden sei.Mittendorfs zweiter Beitrag verweist zudemdarauf, dass Volksabstimmungen durch ihreprimäre Sachorientierung zu einer inhaltli-chen Rationalisierung des politischen Pro-zesses beitrügen. Und Gerhard Himmel-mann bezieht in sein generelles Plädoyer fürDemokratie als »Lebensform« auch die di-rekte Demokratie ein. Die Vielfalt direktde-mokratischer Beteiligungsformen wirddurch Roland Ernes Beitrag typologisch ge-ordnet, indem er sie nach ihrem Auslö-sungsmodus ordnet: Obligatorische, d.h.von der Verfassung zwingend vorgeschrie-bene Referenden stellt er dabei von den»Regierenden« ausgelösten »Plebisziten«und ‚von unten’ initiierten Volksbegehrenund fakultativen Referenden gegenüber –eine Begriffssystematik, der die meisten üb-rigen Beiträge auch folgen.
International vergleichende Studien zuden deutschen Bundesländern, der Schweizund den US-amerikanischen Bundesstaaten
06_Buchbesprechungen Seite 468 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 469
werden von Diana Schaal und AndreasGross geliefert: Beide weisen dabei insbe-sondere auf die im Vergleich zu Deutsch-land wesentlich geringeren formalenHürden für Direktdemokratie in den US-Bundesstaaten und der Schweiz hin, was siejeweils zur konsequenten Forderung nachVerringerung dieser Hindernisse inDeutschland führt. Fallstudien zu ausländi-schen Systemen liefern Anna Capretti (Itali-en) sowie zur Schweiz Lars P. Feld undGebhard Kirchgässner sowie Claude Long-champ. Capretti verweist dabei auf die am-bivalente Wirkung abrogativer Referenden,die zwar als externe Schocks durchaus Wir-kung zeigten, aber zunehmend parteipoli-tisch instrumentalisiert und zudem durchfaktische Ignorierung ihres bloßen abrogati-ven Votums zunehmend sinnentleert wür-den. Sie plädiert daher für deren Ausbau zuinhaltlich gestaltenden konstruktiven Refe-renden. Feld und Kirchgässner können fürdie Schweiz belegen, dass direktdemokrati-sche Beteiligungsformen mit im internatio-nalen Vergleich geringerer Staatsschuld undkostengünstigerer Verwaltung einhergehen,weswegen ihrer Ansicht nach gerade der üb-liche »Finanzvorbehalt« als Ausschluss-grund für Referenden unbegründet sei.Longchamp entwickelt anhand der Schweizeinen eigenen »Dispositionsansatz«, demge-mäß »Ergebnisse von Volksabstimmun-gen… das Produkt aus der institutionellverfassten Entscheidung, Prädisposition derBürgerInnen und der Öffentlichen Mei-nung« (S. 290) sowie weiterer »Umweltfak-toren« darstellen.
Die Studien zu Deutschland lassen sichnach ihrer Bezugsebene gliedern: Für dieBundesebene finden sich sowohl farbige di-rektdemokratische Plädoyers politischerPraktiker (Klaus Hahnzog) als auch vor-sichtig befürwortende Stellungnahmen ausder Wissenschaft (Erwin K. Scheuch).Hahnzog kritisiert dabei insbesondere dengegen die Aufnahme direktdemokratischerElemente in das Grundgesetz gerichtetenStrukturkonservatismus vieler Verfassungs-richter (insb. Isensee, di Fabio), währendScheuch zwar die entscheidenden Struktur-defekte nicht hier, sondern in der unkont-rollierten Parteienherrschaft erblickt, aberdirekte Demokratie immerhin im Rahmen
eines reformierten Repräsentativsystems fürsinnvoll erachtet. Reinhard Schiffers weistzudem noch einmal auf Basis seiner ein-schlägigen Studien auf die Unhaltbarkeit derThese von der Destabilisierung Weimarsdurch direktdemokratische Verfahren hin,die nach dem Krieg mit zur rein repräsenta-tivdemokratischen Ordnung des Grundge-setzes beitrug. Umso weniger könne dies inder heutigen Diskussion als Gegenargumenttaugen.
Die direkte Demokratie auf Landesebenethematisieren die Beiträge von Frank Reh-met und Peter Neumann. Rehmet doku-mentiert dabei akribisch den Verfahrens-boom seit der Wiedervereinigung 1990 undweist dabei insbesondere auf die generell ge-ringe Erfolgsquote von Volksbegehren hin.Neumann kritisiert in seiner Untersuchungder diesbezüglichen Rechtsprechung die ge-nerelle Verschärfung der juristischen Maß-stäbe bei der Zulässigkeitsprüfung vonVolksbegehren. Die »Rechtsentwicklungseit der Wiedervereinigung« sei »insgesamtals restriktiv zu bewerten« (S. 147), was di-rektdemokratische Partizipation unzulässigbehindere.
Nicht weniger als sieben Beiträge sinddann noch den deutschen Kommunengewidmet. Roland Geitmann kritisiert hiergenerell die meist unnötig hohen Verfah-renshürden für die Zulassung von Bürgerbe-gehren und fordert, »Interpretationsspiel-räume« insbesondere durch restriktivgehandhabte Themenausschlüsse für Initia-tiven »demokratiefreundlich zu nutzen« (S.174). Andreas Paust tritt mit seiner Analysedem Eindruck entgegen, die Einführung di-rektdemokratischer Elemente führe aufkommunaler Ebene zur Erosion des Partei-ensystems: Im Gegenteil seien die Parteiendort aktiv in deren Nutzung involviert. Aufdie ergänzende Wirkung dieser Verfahrenweist auch der Beitrag von Andreas Kosthin. Empirische Studien werden zu den ost-deutschen Kommunen (Hellmuth Woll-mann), zu Nordrhein-Westfalen (Jörg Bo-gumil) sowie zu Hamburg (AndreasDressen, Karsten Vollrath) geliefert. Woll-mann weist dabei auf die im innerdeutschenVergleich überdurchschnittliche Zahl anBürgerbegehren, aber zugleich unterdurch-schnittliche Zahl an Bürgerentscheiden hin,
06_Buchbesprechungen Seite 469 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen470
was auf politisch-kulturelle (weniger politi-sche Partizipation) und organisatorischeProbleme zurückgeführt werden dürfte. Bo-gumil diagnostiziert durch die direktdemo-kratischen Beteiligungsformen generell eineFörderung von »Verhandlungsarrange-ments« und in den nordrhein-westfälischenKommunen ein »Neuarrangement zwischenwettbewerbs- und verhandlungsdemokrati-schen Formelementen« (S. 194). Dressel undVollrath dokumentieren in ihren Beiträgendie »rege direktdemokratische Praxis« (Voll-rath, S. 249) in den Hamburger Bezirken,die laut Dressel zunehmend professionellablaufe. Sie deute darauf hin, »dass alle Be-teiligten trotz aller Differenzen zu einemvernünftigen Umgang mit dem neuen In-strument gefunden haben« (S. 248).
Summa summarum: Der große Vorzugdes Bandes ist seine immense Materialfülle:Wer ihn systematisch durcharbeitet, erhältsowohl einen exzellenten Überblick überdie Fachdiskussion zum Thema als auch zurinternationalen direktdemokratischen Pra-xis, wenngleich die auf Deutschland zen-trierten Beiträge dominieren. Allerdings sei-en auch ein paar Schwächen angesprochen:Insbesondere in Teil II gibt es deutliche in-haltliche Überschneidungen zwischen denBeiträgen, die zu lästigen Redundanzen füh-ren. Auch hätte die Auswahl der Beiträgeausgewogener ausfallen können, die durch-weg auf Befürworter der Direktdemokratiebeschränkt bleibt. Gerade etwa wenn KlausHahnzog die Chance zur Polemik gegen Jo-sef Isensee u.a. erhält, wäre es nur recht undbillig, den einen oder anderen Gegner direk-ter Demokratie zu Wort kommen zu lassen– gerade dann, wenn man den Anspruch er-hebt, »Forschung und Perspektiven« direk-ter Demokratie umfassend zu dokumentie-ren. Schließlich hätte die Literaturliste nocheinmal Korrektur gelesen werden müssen:Weber 1997 (S. 197) fehlt dort als Eintrag,ebenso Holtkamp 2000a (S. 197) und Weh-ling 1989b (S. 207). Das sind jedoch insge-samt nur sekundäre Schwächen eines Sam-melbandes, der sich als Überblickswerk fürForschung und Lehre sehr gut eignet.
Martin Sebaldt
Jeffrey D. SACHS: Das Ende der Armut. Einökonomisches Programm für eine gerechtereWelt. Übers. v. Udo Rennert, ThorstenSchmidt. München 2005. Siedler-Verlag, 477S., gebunden, 24,90 EUR.
Warum gibt es in manchen Ländern Armut?Und: Wie lässt sich diese überwinden? Überbeide Fragen gibt es bereits seit Jahrzehntenin Öffentlichkeit und Wissenschaft einebreite und kontroverse Diskussion. Nunmeldet sich der bekannte US-amerikanischeEntwicklungsökonom Jeffrey D. Sachs, derals angesehener Wissenschaftler und politi-scher Berater großen Einfluss entfaltenkonnte, mit einem grundlegenden Werkzum Thema zu Wort. In Das Ende der Ar-mut. Ein ökonomisches Programm für einegerechte Welt gibt er sich in einer verglei-chenden Betrachtung als Arzt, der die The-rapie für kranke Ökonomien kennt. Sachswill darin aufzeigen, »wie die Weltwirtschaftdorthin gekommen ist, wo sie sich heute be-findet, und welche Kapazitäten unsere Ge-neration in den kommenden zwanzig Jahrenmobilisieren könnte, um die verbliebene ex-treme Armut zu beseitigen. Es geht um dieSkizzierung eines Weges zu Frieden undWohlstand, der so ist, dass wir hoffentlichbereit sein werden, ihn zu gehen« (S. 16).
Dabei wendet sich der Autor gegen einsei-tige und monokausale Modelle und Prakti-ken wie sie etwa in dem Ansatz der Welt-bank zum Ausdruck kämen: Der Abbau vonsozialen Rechten und die Etablierung funkti-onierender Märkte, die Privatisierung vonStaatseigentum und die Schaffung privatenEigentums seien entgegen deren Auffassungnicht in allen Ländern ein Allheilmittel gegenArmut und Krise. Die Dogmen der „Markti-deologen“ (S. 386) lehnt Sachs demnach ab.Statt dessen fordert er ein analytisches Vor-gehen im Sinne einer »klinischen Wirt-schaftswissenschaft« (S. 105), welche stattallgemeiner und eindimensionaler Program-me die konkrete Situation der in Not gerate-nen Länder ins Visier nimmt. Denn »so we-nig es eine einzelne, umfassende Erklärungdafür gibt, warum bestimmte Regionen derErde bis heute arm geblieben sind, so weniggibt es ein einziges Allheilmittel. Ein guterMaßnahmeplan beginnt daher mit einer dif-ferenzierten Diagnose, welche spezifischen
06_Buchbesprechungen Seite 470 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 471
Faktoren die wirtschaftlichen Verhältnisseeines Landes geformt haben« (S. 68).
Dabei bedürfe es der Berücksichtigungder folgenden Gesichtspunkte: Erstens seienWirtschaften komplizierte Systeme, derenineinandergreifende Mechanismen und ge-sellschaftliche Strukturen berücksichtigtwerden müssten. Zweitens bedürfe es einerDifferenzialdiagnose, die auf die Besonder-heiten des Landes eingehe. Drittens gelte esnicht nur das Land isoliert, sondern in sei-nem ökonomischen Kontext zur Kenntniszu nehmen. Viertens bedürfe eine gute Ent-wicklungspraxis ständig der Evaluierungund Überwachung der Maßnahmen. Undfünftens fehlten den Entwicklungsökono-men die notwendigen berufsständischenund ethischen Normen (vgl. S. 102-105).Danach nimmt Sachs in einzelnen Kapitelneine entsprechende Analyse mit einer klarenBenennung der jeweiligen Lehren für die Si-tuation in Bolivien, Indien, Polen und Russ-land vor. Aus dieser Erörterung entwickeltder Autor dem folgend die »Grundzüge ei-ner Strategie zur weltweiten Beseitigung ex-tremer Armut bis 2005« (S. 280).
Im Kern besteht diese darin, dass die In-dustriestaaten den ärmeren Ländern durcheine kräftige Aufstockung ihrer Entwick-lungshilfe unter die Arme greifen. Hierbeisollte aber nicht einfach Geld ausgeschüttet,sondern zielgerichtet verwendet werden.Zur Umsetzung bedürfe es eines inhaltlichentwickelten Finanz- und Investitions-, Ge-ber- und Rahmenplans, der die unterschied-lichen geographischen, kulturellen und poli-tischen Ausgangsbedingungen in denjeweiligen Ländern stärker berücksichtigt.Allein könnten sie sich nicht aus der »Ar-mutsfalle« (S. 302) befreien; sie bedürftender Auslandshilfe zur Einleitung der nöti-gen strukturellen Veränderungen vor Ort.Mit Rekursen auf die Ideen der Aufklärungformuliert der Autor: »Letzten Ende solltendie Globalisierungsgegner ihre überwälti-gende Einsatzbereitschaft und moralischeKraft für eine Pro-Globalisierungsbewe-gung mobilisieren, die sich vor allem um dieBedürfnisse der Ärmsten der Armen, denweltweiten Umweltschutz und die Verbrei-tung der Demokratie kümmert» (S. 432).
Sachs legt mit Das Ende der Armut einüberaus informatives und gut strukturiertes
Buch mit beeindruckendem Analysevermö-gen und großer Fachkenntnis vor, wobei essich ohne Verallgemeinerungen und Verfla-chungen auch noch gut lesen lässt. Gleich-wohl weist der Autor bei der Betrachtungder ökonomischen Situation verschiedenerLänder differenziert auf unterschiedlicheGegebenheiten in diversen Bereichen hin.Dies unterscheidet seine Arbeit von vielenanderen monokausal argumentierendenVeröffentlichungen. Überhaupt veranschau-licht Sachs auch in den historischen Teilenden großen Erkenntnisgewinn, der von sys-tematischen Vergleichen der sozialen undwirtschaftlichen Entwicklung in unter-schiedlichen Ländern ausgehen kann. Undschließlich widmet der Autor sich auch kri-tisch den von ihm »Mythen und Zauberfor-meln« (S. 375) genannten dogmatischen undideologielastigen Auffassungen, die auch dieDebatte unter Wirtschaftswissenschaftlernzu nicht unbedeutsamen Teilen prägt.
Die inhaltlichen und methodischen Ein-sichten und Grundauffassungen des Buchessind nicht neu. Sie stammen aber von einembekannten Ökonomen, der zur Bekämp-fung wirtschaftlicher Krisen Ländern wieBolivien und Russland »Schocktherapien«verordnet hatte und zumindest in Ansätzendaraus Lehren für seine entwicklungspoliti-schen Auffassungen zog. Dass er den damitverbundenen Bruch zu früheren Positionennicht deutlich genug hervorhebt und Konti-nuitäten seines Handelns suggeriert, erklärtsich wohl durch das Bedürfnis, eine »geradeLinie« in der eigenen Biographie bestehenzu lassen. Kritikwürdig wären demgegen-über andere Aspekte: Sachs argumentiert zusehr von der Geberseite her und äußert sichkaum zu den angemessenen Forderungen andie Empfängerländer. In einer solchen tradi-tionellen Perspektive erscheinen sie nur alspassive Versorgungsempfänger, sie solltenaber nach Erkenntnissen der neueren Ent-wicklungsforschung stärker eigenständigeBeiträge zur Überwindung ihrer eigenenMisere liefern.
Im Sinne einer »Hilfe zur Selbsthilfe« hät-te man sich doch einige Ausführungen mehrzu den strukturellen Voraussetzungen derEmpfängerländer zur Überwindung ihrerArmut gewünscht. Als Stichworte mögenhier die verweise auf Besitzverhältnisse und
06_Buchbesprechungen Seite 471 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen472
Bodenreform, Demokratisierung undRechtsstaatlichkeit genügen. Ebenfalls kri-tikwürdig wäre, dass Sachs interessante er-kenntnisförderliche Fragen wie »Warumeinige arme Volkswirtschaften wuchsen undandere schrumpften?« (S. 90) formuliert, siedann aber doch nicht ausführlicher und dif-ferenzierter beantwortet. Und schließlichlöste er auch eine andere Zusage nicht ein,spricht Sachs doch davon, »konkrete Maß-nahmen erwähnt« (S. 439) zu haben. Daranfehlt es leider! Die Skizzierung von konkre-ten Entwicklungsmodellen für unterschied-liche Länder hätte dem doch eigentlich aufpraktische Wirkung zielenden Buch gut an-gestanden. Gleichwohl handelt es sich umein analytisch interessantes und inhaltlichlehrreiches Buch zu einem leider immernoch und immer wieder aktuellen Thema.
Armin Pfahl-Traughber
Ewald GROTHE: Zwischen Geschichte undRecht. Deutsche Verfassungsgeschichts-schreibung 1900-1970. Ordnungssysteme.Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit,Bd. 16. München 2005. Oldenbourg Verlag,486 S., gebunden, 64,80 EUR.
Grothes Studie stellt die erste umfassendeGesamtdarstellung der modernen deutschenVerfassungsgeschichtsschreibung dar, denner beginnt mit seiner Analyse zwar, wie imTitel angegeben, um 1900, nimmt aber in ei-ner Reihe von Rückblicken ebenfalls das 19.Jahrhundert wenigstens noch mit in denBlick. Bis zum Erscheinen seiner Habilitati-onsschrift hatte man sich über diesen exzep-tionellen Zweig der Geschichtsschreibungwie der Rechtsgeschichte lediglich aus zweiknappen, wenn auch vorzüglichen Abhand-lungen von Fritz Hartung (1956) und HansBoldt (1984) informieren können. Grothehat nun im Rahmen seiner Studie erstmalsausführlich auch ungedrucktes Material ausmehr als einem Dutzend öffentlicher undprivater Archive ausgewertet und hierauseine Fülle neuer Erkenntnisse gewinnenkönnen. Hierin besteht ohne Frage der ge-wichtigste Vorzug seiner Arbeit, an derenResultate und Thesen freilich auch einigeFragezeichen angebracht werden müssen.
Der Aufbau des Bandes ist klar und ein-leuchtend, er kombiniert chronologischeund systematische Aspekte: vier großeÜberblickskapitel sind den Epochen desKaiserreichs, der Weimarer Republik, desNationalsozialismus und schließlich derJahre 1945 bis 1970 gewidmet. Seine drei –allerdings in der Darstellung nicht immerverzahnten, sondern oft schematisch neben-einanderstehenden – Analyseebenen wid-men sich erstens den handelnden Personen,genauer: den Lebenswegen und Karrierever-läufen der führenden deutschen Verfas-sungshistoriker dieses Zeitraums, zweitensden fachlichen Strukturen, womit besondersdie Lehrstühle und Studienordnungen ge-meint sind, und drittens den Produkten wis-senschaftlichen Forschens, den verfassungs-geschichtlichen Publikationen. Diepersonengeschichtlichen Abschnitte kon-zentrieren sich dabei auf die drei bedeu-tendsten deutschen Verfassungshistorikerdes 20. Jahrhunderts, zwei Historiker undeinen Juristen, die alle drei als Repräsentan-ten einer bestimmten Generation geltendürfen: Otto Hintze (1869-1940), FritzHartung (1883-1967) und Ernst Rudolf Hu-ber (1903-1990). Die mittelalterliche Verfas-sungsgeschichtsforschung und deren Prota-gonisten werden von Grothe nur insoweitberücksichtigt, als ihre Produkte Einflussauf die allgemeine Entwicklung der Verfas-sungsgeschichtsschreibung ausgeübt haben(das gilt besonders für Georg von Belowund Otto Brunner).
Unter »Verfassungsgeschichtsschrei-bung« versteht der Autor »alle diejenigenhistorischen, juristischen und politikwissen-schaftlichen Studien [...], die sich mit denpolitisch-gesellschaftlichen Strukturen derVergangenheit auseinandersetzen, indem siehistorische Fragen nach der Staatsform unddem Regierungssystem, nach politischerPartizipation und Repräsentation, nach denpolitisch-gesellschaftlichen Institutionenund Organisationen untersuchen« (S. 17).Diese fraglos etwas weit gefasste Definitionschränkt Grothe implizit jedoch dadurchein, dass er sich praktisch nur auf dasjenigebeschränkt, was mit einer sehr treffendenFormulierung knapp und präzise als »politi-sche Strukturgeschichte« (Hans Boldt) be-zeichnet werden kann. Dabei geht es Grothe
06_Buchbesprechungen Seite 472 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 473
um die Herausarbeitung einer vermeintlich»spezifisch nationalen Tradition, wie sie sichin der westeuropäisch-amerikanischen His-toriographie nicht vergleichbar findet« (S.17). Ist das aber wirklich der Fall? Schonhier ist das erste Fragezeichen fällig, dennallein ein Blick auf Großbritannien zeigt,dass dort eine sehr lebendige, von Grothefreilich kaum auch nur angedeutete Traditi-on besteht, die der deutschen – trotz allerUnterschiede im einzelnen – inhaltlich undmethodisch durchaus vergleichbar ist: vonHallam und Maitland (beide erwähnt Gro-the kurz) sowie May im 19. Jahrhundert biszu Holdsworth und Keir (Grothe nennt sienicht) im 20. Jahrhundert.
Im allgemeinen gut gelungen sind demAutor die eigentlichen Hauptteile seiner Ar-beit, die überblicksartige Rekonstruktionder Karrieren und der wissenschaftlichenWerke der drei zentralen Protagonisten.Otto Hintzes herausragende Leistung, diein der Begründung einer vergleichenden undzugleich typologisierenden modernen Ver-fassungsgeschichte besteht, wird klar her-ausgearbeitet, ebenso die Wandlungen,denen Hintzes Werk unter dem Eindruckund Einfluss der politischen Zäsuren von1918/19 und 1933 unterlag. Zu fragen bleibtallerdings, wie Grothe zu seiner Auffassunggelangt, es erscheine »zweifelhaft«, ob dasManuskript der »Allgemeinen Verfassungs-geschichte der neueren Staaten«, an demHintze während der 1920er und 1930er Jah-re gearbeitet hatte, »jemals vollständig vor-lag« (142 f.). Denn aus einem Brief Hartungsan Willy Andreas vom 22. 1. 1941 geht klarhervor, dass dieses Manuskript Hintzeslängst abgeschlossen war als er 1940 starb(diesen Briefbestand aus dem Nachlass vonAndreas hat Grothe laut Quellenverzeichnisund mehreren Fußnotenverweisen ausge-wertet).
Fritz Hartung gehört nicht zu den vonGrothe bevorzugten Autoren: er bezeich-net zwar die erste Ausgabe von dessen 1914erschienener Deutscher Verfassungsge-schichte mit Recht als Pionierleistung, kriti-siert aber implizit deren Staatszentrierungund deren Beschränkung auf eine »Perspek-tive der ‚Herrschenden’« (112), ohne freilichdabei angemessen zu berücksichtigen, dassdie Reihe, in der das Werk damals erschien
(Aloys Meisters Grundriss der Geschichts-wissenschaft), der inhaltlichen Gestaltungdes Themas sehr enge Grenzen setzte, wor-auf Hartung selbst auch immer wieder hin-gewiesen hat. Während Hintze nach 1933weitgehend verstummte und Hartung seine(noch kurz vor der NS-»Machtergreifung«überarbeitete) Anfang 1933 in 4. Auflage er-scheinende Verfassungsgeschichte bis 1945nicht mehr »aktualisierte«, obwohl ihm das,nicht nur vom Verlag, immer wieder nahe-gelegt wurde, erlebte die Disziplin als solcheeine neue Blütezeit, denn in den Rechtswis-senschaften wurde die Verfassungsgeschich-te als Teilfach mit eigener Pflichtvorlesungnunmehr fest etabliert. Darauf ist es zurück-zuführen, dass nun einige mehr oder weni-ger (zumeist weniger) gute Lehrbücherentstanden, darunter die Verfassungsge-schichten von Ernst Forsthoff und vor allemvon Hans Erich Feine – letzterer, wie Gro-the anmerkt, »mit Blick auf die verkauftenExemplare [...] vermutlich der Spitzenautorder deutschen Verfassungsgeschichtsschrei-bung im ‚Dritten Reich’« (239). Jedenfallsverstand es Feine sehr erfolgreich, die vonHartung hinterlassene, in dieser Zeitschmerzlich fühlbare Lücke rasch zu füllen.
Die Tatsache, dass (wie der Autor mit ei-ner in diesem Fall sehr treffenden Formulie-rung feststellt) »die nationalsozialistischeFührung vielfach nicht auf Konformität,sondern ‚lediglich’ auf Kompatibilität Wertlegte« (309), wirkte sich im Bereich dieserDisziplin dahingehend aus, dass gewisseKonkurrenzen und Rivalitäten entstehenkonnten. So war es möglich, dass sich ErnstRudolf Huber von den Vertretern eines ex-trem nationalsozialistischen Kurses (wieReinhard Höhn und dessen Schule) deutlichabheben konnte und mit seinen Studien zumBismarckreich oder auch zur Geschichte derdeutschen Wehrverfassung, zum Verhältnisvon »Heer und Staat in der deutschen Ge-schichte«, eigene Wege zu gehen vermochte,etwa indem er das Volk ausdrücklich in engeBeziehung zum Staat setzte und es über denStaatsbegriff zu definieren versuchte (219).Freilich setzte er sich mit dieser »etatisti-schen« Rückbindung der Volksidee scharfenAngriffen von Seiten der besonders radika-len NS-Ideologen aus. Fritz Hartung wie-derum vermochte den Verlockungen der
06_Buchbesprechungen Seite 473 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen474
vermeintlich »neuen Zeit« klar zu widerste-hen, wenn er sich auch in Einzelfragen andas NS-Regime anpasste und sich ebenfallszu mancher verbalen Konzession bereit-fand. Dennoch geht Grothe – der immerhinHartungs aufsehenerregende Kontroversemit Carl Schmitt (1935) breit referiert –ohne Frage zu weit, wenn er Hartungs Hal-tung gegenüber dem Nationalsozialismusals »im Zweifel vor allem loyal und konzes-sionsbereit« (297) charakterisiert. Den Zu-sammenstoß, den der Verfassungshistoriker1941 mit seinem obersten Vorgesetzten,Reichswissenschaftsminister Bernhard Rust,wegen der kritischen Rezension eines Bu-ches von Graf Ernst zu Reventlow (eines»alten Kämpfers« der Partei) erleben muss-te, erwähnt Grothe in diesem Zusammen-hang ebensowenig wie Hartungs öffentlich,in der Historischen Zeitschrift ausgetragenenKonflikt mit dem fanatisch nationalsozialis-tischen »Wehrwissenschaftler« PaulSchmitthenner wenige Jahre vorher.
Die Neuetablierung der Verfassungsge-schichte in den beiden Wissenschaften derJurisprudenz und der Geschichte nach demZweiten Weltkrieg wird in den letzten Ab-schnitten der Monographie behandelt, wo-bei die Bemerkungen des Autors über dieangebliche politische »Kontamination« derDisziplin (333 u. a.) doch als weit überzogenerscheinen. Denn der eigentliche langjährige»Klassiker« unter den einschlägigen Dar-stellungen, Hartungs Deutsche Verfassungs-geschichte, konnte 1950 in neuer, nunmehr5. Auflage erscheinen, ohne dass sein Autorseine frühere Wertungen und politische Ur-teile in den wesentlichen Aspekten hatte zu-rücknehmen müssen; bis 1969 erreichte dasWerk noch vier weitere Auflagen. In denMittelpunkt der Darstellung tritt nun vor al-lem Ernst Rudolf Huber, dessen »Wieder-eintritt« in die deutsche Wissenschaft vomAutor bereits früher in mehreren Aufsätzendetailliert dargestellt worden ist. Hubersgroßes und bleibendes Hauptwerk, die mo-numentale Deutsche Verfassungsgeschichteseit 1789, wird mit ihren allen Verfassungs-historikern wohlbekannten Vorzügen undNachteilen dem Leser vorgestellt und kri-tisch referiert – freilich nur überaus knapp,bedenkt man den Umfang und den Inhalts-reichtum dieses acht Bände und etwa 7000
Textseiten umfassenden Werkes. Dabei be-schränkt sich der Autor zudem allzu starkauf den biographischen Aspekt: auf diekomplizierte Entstehungsgeschichte derVerfassungsgeschichte ebenso wie auf derenFunktion im Rahmen der Bemühungen die-ses fraglos politisch schwer belastetenRechtsgelehrten um seine persönliche undwissenschaftliche Rehabilitierung nach demZweiten Weltkrieg. Hubers Aufwertung des»deutschen Konstitutionalismus« (379 ff.)als zentrales, sich zugleich gegen die be-kannte Deutung seines Lehrers CarlSchmitts von 1934 klar abgrenzendes Inter-pretament wird als Kern von Hubers vonGrothe als »konservativ« bezeichneter Neu-interpretation der deutschen Geschichte des19. Jahrhunderts betont – allerdings ohnedie neuerliche starke Aufwertung dieserThese durch die jüngste Forschung (MartinKirschs bahnbrechende Untersuchung überden »monarchischen Konstitutionalismus«in vergleichender Perspektive) zu berück-sichtigen.
Die Darstellung Grothes liefert insge-samt, das ist ausdrücklich zu betonen, eineFülle von neuen Einzelinformationen zurGenese und zur Entwicklung der verfas-sungshistorischen Teildisziplinen innerhalbder deutschen Jurisprudenz und Ge-schichtswissenschaft seit dem ausgehenden19. Jahrhundert; hierin liegt ihre Stärke undihr nicht anzuzweifelndes Verdienst. Grothehat mit enormem Fleiß Wissenschaftsge-schichte wirklich aus den Quellen geschöpftund dabei keine Anstrengung gescheut – dasverdient Respekt. Gleichwohl weist seineStudie (neben den bereits genannten) eineReihe von Mängeln auf, die ebenfalls nichtunterschlagen werden dürfen – und in einerRezension schon gar nicht:
Zuerst einmal reicht es wirklich nicht aus,bei Erwähnung der wissenschaftshistori-schen Voraussetzungen der deutschen Dis-ziplin Verfassungsgeschichte lediglichknapp auf die ältere Tradition der Reichshis-torie und der Staatenkunde bzw. »Statistik«als »Konkurrenten« hinzuweisen (31). Hier,bei der älteren »Staatsbeschreibung« des 17.und 18. Jahrhunderts, handelt es sich viel-mehr um Vorläufer im präzisen Sinne diesesBegriffs, und die meisten »staatenkundli-chen« Werke seit Hermann Conring enthal-
06_Buchbesprechungen Seite 474 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 475
ten denn auch explizit verfassungshistori-sche – wenn auch in der Sache zumeist mehrreferierende als analysierende und interpre-tierende – Abschnitte. Diese Tradition wardurchaus stärker und bedeutender als vonGrothe angenommen. – Zweitens: Kannman wirklich die These vertreten, die Reso-nanz auf die rechts- und verfassungshistori-schen Arbeiten von Rudolf von Gneist undOtto von Gierke sei gering gewesen, ja ihrWerk sei vorübergehend »in völlige Verges-senheit« (51) geraten? Diese Auffassunglässt sich ebenso wenig begründen wie eineweitere These Grothes, nach der HintzesForschungen in ihrer komparativen und ty-pologischen Ausrichtung »auf Ablehnung«(80) bei der Mehrheit der Fachkollegen ge-stoßen seien. Das entspricht zwar derSelbststilisierung einer gewissen Richtungder neueren Sozialgeschichte, die Hintzeimmer wieder gerne als einsamen Vorläuferzu vereinnahmen bestrebt ist, aber kaum derRealität: Hintzes Ergebnisse setzten sich –auch infolge des Ersten Weltkrieges undwohl ebenfalls wegen der gesundheitsbe-dingten fragmentarischen und zersplittertenProduktionstätigkeit Hintzes – vergleichs-weise langsam durch, aber von generellerAblehnung kann überhaupt keine Rede sein.Im übrigen ist die von ihm begründete ver-fassungsgeschichtliche Tradition an der Ber-liner Universität wenigstens bis 1948 (Har-tungs vorzeitiger Emeritierung) gepflegtund in Forschung und Lehre kontinuierlichweitergeführt worden; anschließend habendie an der neu gegründeten Freien Universi-tät in West-Berlin tätigen Historiker wieCarl Hinrichs sowie die Hartung-SchülerGerhard Oestreich und Richard Dietrich dieTradition Hintzes fortgeführt.
Ein weiterer Punkt: Grothes Darstellung,der Herausgeber der Zeitschrift für die ge-samte Staatswissenschaft, Georg Brodnitz,sei 1933 vom Verleger Siebeck in Tübingenwegen Erfolglosigkeit und »liberaler« Hal-tung abgelöst worden, ist durchaus unzu-treffend. Der Hintze-Schüler Brodnitz,Staatswissenschaftler an der UniversitätHalle, wurde zuerst und vor allem wegenseiner jüdischen Herkunft aus der Heraus-geberschaft verdrängt – übrigens zugunstenErnst Rudolf Hubers. Und »erfolglos« warBrodnitz (er wurde 1941 im KZ ermordet)
als Herausgeber keinesfalls gewesen; Har-tung etwa hat in der Zeitschrift während der1920er Jahre wichtige Rezensionen und Ein-zelbeiträge zur Verfassungsgeschichte publi-ziert, darunter seine Auseinandersetzungmit Carl Schmitts Verfassungslehre. Ärger-lich sind zudem scheinbare Kleinigkeiten; sowird etwa auf S. 191 Ernst von Hippel mitseinem Bruder Fritz verwechselt. – Schließ-lich: Kann man wirklich von einem »Ana-them« (393) gegen die Sozialgeschichte inder frühen Bundesrepublik sprechen unddies ausgerechnet mit der späten Publikati-on von Otto Büschs Dissertation über daspreußische Militärsystem des 18. Jahrhun-derts zu belegen versuchen? Erst seit Endeder 1950er Jahre ist bekanntlich der Publi-kationszwang für Doktorarbeiten wiedereingeführt worden, und vor allem hierauserklärt sich der späte Druck dieser Arbeit.Entgegen so mancher, bis heute gerne ge-pflegten frommen Legende waren For-schungen auf dem Gebiet der Sozialge-schichte seit den fünfziger Jahren, wie sichanhand sehr vieler Beispiele zeigen ließe,wirklich alles andere als ein Karrierehinder-nis für jüngere Historiker!
Auch Grothes Umgang mit der wissen-schaftlichen Literatur ist, vorsichtig ausge-drückt, etwas merkwürdig. Während dieStandardwerke von Ursula Wolf und Hel-mut Heiber mit wenigen Worten abgetanwerden – sie seien angeblich »zu Recht ve-hement kritisiert« (23) worden (worin dieBerechtigung dieser Kritik bestehen soll,verschweigt Grothe) –, stützt er sich selbstwiederum auf höchst umstrittene Publikati-onen, so etwa auf das Buch der Kühnl-Schü-lerin Karen Schönwalder oder auf die Dis-sertation von Ingo Haar, die heftigste Kritikund berechtigten Widerspruch etwa vonHeinrich August Winkler oder WolfgangNeugebauer auf sich gezogen hat. Die wich-tigen, nicht nur Haar korrigierenden Einzel-studien von Christian Tilitzki zu den Kö-nigsberger Historikern scheint Grothedagegen überhaupt nicht zur Kenntnis ge-nommen zu haben.
So bleibt am Ende ein insgesamt deutlichzwiespältiger Eindruck: der unleugbar gro-ßen Arbeitsleistung stehen nicht wenigeMängel gegenüber. Jedenfalls handelt es sichbei diesem Buch, so viel kann gesagt wer-
06_Buchbesprechungen Seite 475 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen476
den, keinesfalls um die abschließende Dar-stellung der Geschichte der deutschen Ver-fassungsgeschichtsschreibung zwischen1900 und 1970. Eine solche hätte nicht zu-letzt viel eingehender das Problem nicht nurder Zeitgebundenheit dieser Disziplin, son-dern vor allem auch deren von Grothe ledig-lich mit Bezug auf die NS-Zeit thematisierteFunktion als »Legitimationswissenschaft«(305) in den Blick zu nehmen. Denn hierbeihandelt es sich um ein generelles Problemder Verfassungsgeschichte, das in allen vonGrothe behandelten Epochen sichtbar wird– vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik.Das Spannungsfeld zwischen auf Wahrheitgerichteter wissenschaftlicher Erkenntnis ei-nerseits und politischer Legitimationsideo-logie mit umgehängtem pseudowissen-schaftlichem Mäntelchen andererseits istgerade bei dieser Disziplin ein höchst bri-santes Feld, das keinesfalls vernachlässigtwerden darf, sondern immer wieder neuvermessen und kritisch in den Blick genom-men werden muss.
Hans-Christof Kraus
Andreas WIRSCHING: Abschied vom Provi-sorium. Geschichte der BundesrepublikDeutschland 1982-1990. Band 6. Stuttgart2006. Deutsche Verlagsanstalt, 848 S., ge-bunden, 49,90 EUR.
Als zwischen 1981 und 1987 die ersten fünfder insgesamt auf sieben Bände angelegtenGeschichte der Bundesrepublik erschienen,waren dies großformatige Werke, die denVerlauf der Nachkriegsbundesrepubliknachzeichneten. Andreas Wirsching, Profes-sor für Neuere und Neueste Geschichte ander Universität Augsburg, hat nun den vor-erst letzten Band dieser Reihe vorgelegt.Während die ersten Bände – auf Hochglanz-papier geschrieben und reichhaltig bebildert– von dem Impetus getragen waren, die Er-folgsgeschichte der Bundesrepublik zu er-zählen, schreibt Wirsching gegen das Ver-dikt an, die achtziger Jahre hätten diesenpositiven Verlauf umstandslos fortgeschrie-ben.
Der Titel des überaus voluminösen undsehr dicht geschriebenen Werkes – Abschied
vom Provisorium – trägt eine doppelte Be-deutung. Rein formal war mit der Herstel-lung der deutschen Einheit und dem Aufge-hen der DDR in der Bundesrepublik dasvom Bonner Grundgesetz formulierte Pro-visorium an sein Ende gekommen. Anderer-seits, so der Autor in der Einleitung, hattesich der westdeutsche Teilstaat mit seinemprovisorischen Charakter arrangiert undspätestens zu Beginn der achtziger Jahrehatte die Politik jegliche Hoffnung auf eineWiedervereinigung hinter sich gelassen.
Das Buch gliedert sich in zwei chronolo-gisch und sechs thematisch orientierte Kapi-tel. Der erste Teil »Die ‚Wende’ 1982/83 unddie erste Zeit der Regierung Kohl« be-schreibt den Ablauf des Bonner Regierungs-wechsels von Oktober 1982 bis zur Bundes-tagswahl im März 1983 und der WahlHelmut Kohls zum Bundeskanzler. Ebensodas letzte Kapitel – »Deutschlandpolitik mitüberraschendem Ausgang« –, das den Wegzur deutschen Einheit nachzeichnet, folgteiner chronologischen Struktur. Die übrigenKapitel sind anhand thematischer Schwer-punkte aufgebaut (wie z.B. Wirtschaft undFinanzen, Außenpolitik, kulturelle Aspek-te). Diese überwiegend sachbezogene Kapi-telanordnung lässt allerdings bisweilen denEindruck von thematischen Einzelepisodenentstehen und steht damit einer kohärentenGesamtdarstellung im Weg.
In seinem geschichtlichen Panorama stelltWirsching die epochenbestimmenden The-men der achtziger Jahre dar. Beschriebenwerden die Auseinandersetzungen über denNATO-Doppelbeschluss, die Erprobungneuer gesellschaftlicher Protestformen inden Bereichen Umwelt und Kernkraft sowieder als konstant wirkende Hintergrundbe-strahlung andauernde Ost-West Konflikt.Insgesamt glänzt Andreas Wirsching in sei-nem Buch mit der Präsentation einer Füllevon Informationen. Im Spiegel komplexerwerdender Problemlagen wird alles erzählt– facettenreich und detailliert – und manmuss lange suchen, um eine Begebenheitdieses Jahrzehnts zu finden, die nicht sach-kundig erwähnt wird. So reichen die thema-tischen Verästelungen bis hin zurEinführung von Katalysatoren und niedri-gen Abgaswerten sowie zu den Krawallen inder Hamburger Hafenstraße. Die großen in-
06_Buchbesprechungen Seite 476 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 477
haltlichen Linien des Buches werden jedochdurch die die Politik der achtziger Jahre be-stimmenden Themen gesetzt. Auf dem Feldder Wirtschaftspolitik vollzog sich ein lang-samer Ûbergang vom keynesianischen Para-digma hin zu einer Politik, die sich an mehrWettbewerb, Privatisierung und staatlicherDeregulierung orientierte. Finanzpolitischwaren es vor allem die beiden großen Steu-erreformen der Jahre 1986 und 1988, die he-rausgehoben behandelt werden. Darüberhinaus bestand eines der zentralen sozialpo-litischen Themen in der Konsolidierung desSozialstaates, die in der Verabschiedung derRentenreform am Abend des 9. November1989 – nicht ganz ohne historische Ironie –ihren prominenten Ausdruck fand.
Wirschings politisches Gesamtpanoramaüber die erste Hälfte der christlich-liberalenRegierungszeit gibt an vielen Stellen Auf-schlüsse über die Spezifika des deutschenRegierungssystems. Deutlich wird, wie sehrdas politische System von einer Vielzahl vonVeto-Spielern beherrscht wird. Zwarschreibt der Autor keine Abhandlung einermodernen Regierungslehre, doch geht esimmer wieder um die systemeigenen institu-tionellen Handlungsrestriktionen, die nichtnur prägend für Regieren in der Bundesre-publik sind, sondern sich teilweise über dieJahre verstärkt haben. So entsteht der Ein-druck, der westdeutsche Teilstaat sei unbe-weglich, saturiert und in seinem Innernunfähig zu durchgreifenden Reformen ge-wesen.
Trotz einiger großer Reformprojekte –Absenken der Staatsverschuldung, Rück-führung der Staatsqoute, Steuerreform –sieht Wirsching einen Triumph der leichtenKurskorrekturen und der minimalen Statusquo-Veränderungen. Er hätte sich einengrößeren politischen Wurf gewünscht, aberübersieht dabei, dass es der institutionellverfasste Kern der Bundesrepublik ist – unddarin hat auch die Wiedervereinigung nichtsgeändert –, der Politik zu kleinen Schrittenund inkrementalen Anpassungen gerinnenlässt. Trotz des als »geistig-moralische Wen-de« apostrophierten Kanzlerwechsels vonSchmidt zu Kohl gab es in der Innenpolitikkeinen tiefgehenden Politikwechsel. Zwarwaren die späten achtziger Jahre durch einepositive Grundstimmung geprägt, doch der
verbreitete Optimismus hatte nur ein dün-nes Fundament. Während sich die Politiknoch ein Jahrzehnt zuvor auf die umfassen-de Steuerung gesellschaftlicher Sektorenund die Planbarkeit polititscher Prozessestützte, wurde dieser positive Fortschritts-gedanke erschüttert. Neue Technologienversprachen nicht nur Chancen, sondern ka-men auch mit neuartigen Risiken und Ge-fahren einher.
Darüber hinaus werden immer wiederpolitischer Kleinmut, fehlende Weitsicht so-wie staatliche Steuerungsschwächen in eini-gen Policy-Bereichen (wie z.B. Familie undGesundheit) identifiziert. Indem Wirschingkrisenhafte Symptome, mentale Blockadenund Versäumnisse benennt, wirft sein Buchstreckenweise einen deutlichen Schattenüber die ansonsten so erfolgüberglänztenDarstellungen der Bundesrepublik der acht-ziger Jahre, die dieses Jahrzehnt als Fort-schreibung der Erfolgsgeschichte seit 1949sehen. Obwohl am Ende das Jahrzehntdurch den historischen Glücksfall der deut-schen Einheit gekrönt wurde, wird deutlich,dass die Innenpolitik einen langen Katalogungelöster Probleme hinterlassen hat. ImSchlusskapitel widerspricht Wirsching Dar-stellungen der alten Bundesrepublik, bei de-nen sich fast zwangsläufig sämtlichehistorischen Entwicklungen in ein wohlge-ordnetes Gesamtbild fügen und »eine prä-stabilierte Harmonie« abstrahlen. Indem derAutor drei kritische Entwicklungstenden-zen identifiziert, macht er am Ende deutlich,dass sich das sozio-ökonomische Modell deralten Bundesrepublik am Abend der deut-schen Einheit durchaus in einer prekärenLage befand. Ausgehend von Prozessen desWertewandels hat sich eine beschleunigen-de Auffächerung von Lebensformen undErwerbsmustern in Gang gesetzt. Zusätz-lich wurden die Fundamente des Wohlfahrt-staates nicht nur durch seine Expansiongefährdet, sondern vor allem durch den de-mographischen Wandel und sinkendeWachstumsraten. Im Zusammentreffen die-ser drei Entwicklungslinien sieht Wirschingeinen »Epochenwechsel«, der sich in densiebziger und achtziger Jahren anbahnte undschließlich die Bundesrepublik am Ûber-gang ins vereinte Deutschland in ihrem sta-bilitätsverwöhnten Kern erschütterte.
06_Buchbesprechungen Seite 477 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen478
Insgesamt hat Andreas Wirsching ein äu-ßerst komplex angelegtes Werk über die ers-te Hälfte der Kanzlerschaft Helmut Kohlsverfasst. Das Buch – orchestriert in acht Ka-piteln – ist überaus eloquent, kenntnisreichund stilsicher geschrieben und lässt sichohne jeden Zweifel zum Standardrepertoireder jüngsten Zeitgeschichtsforschung zäh-len.
Helge F. Jani
Ernst NOLTE: Die Weimarer Republik. De-mokratie zwischen Lenin und Hitler. Mün-chen 2006. Herbig Verlag, 429 S., gebunden,29, 90 Euro.
Sei es Zufall oder nicht – fast auf den Tag ge-nau zwei Jahrzehnte nach Ausbruch des»Historikerstreits«, jener publizistischenGroßkontroverse der späten achtziger Jahre,die fälschlicherweise als Streit »um die Ein-zigartigkeit der nationalsozialistischen Ju-denvernichtung« in das öffentlicheBewusstsein der Bundesrepublik eingegan-gen ist und die doch viel eher ein politisch-kultureller Konflikt um die Freiheit derWissenschaft hinsichtlich einer multipers-pektivischen Beschäftigung mit der natio-nalsozialistischen Vergangenheit war, hatErnst Nolte ein neues Werk über Die Wei-marer Republik als einer Demokratie zwi-schen Lenin und Hitler vorgelegt.
Es war Nolte, der im Zentrum des vonJürgen Habermas angezettelten »Histori-kerstreits« stand, und der noch heute – so-zusagen als Spätfolge der damaligen Kon-troverse – vereinzelt als »trübe, javerächtliche Figur der deutschen Zeitge-schichte« (Marcel Reich-Ranicki) apostro-phiert wird. Dabei galt der Berliner Histori-ker und Philosoph seit Erscheinen seinesErstlingswerks über den Faschismus in sei-ner Epoche im Jahre 1963 als ein internatio-nal renommierter Ideologiehistoriker, dersich nicht nur bestens mit der Phänomeno-logie des Faschismus, sondern, wie seinenachfolgenden Monographien und Sammel-bände dokumentieren, nicht minder gut mitMarxismus, (Früh-)Sozialismus, Industriel-ler Revolution sowie der Geschichte desKalten Kriegs auskennt.
Nach eingehendem Studium der Ge-schichte der Russischen Revolution nahmNolte im Verlauf der achtziger Jahre einekonkretisierende Akzentverschiebung sei-ner bisherigen Forschungen insofern vor, alser seinen ideologiegeschichtlichen Ansatzstärker noch als zuvor mit den realge-schichtlichen Entwicklungsverläufen ver-knüpfte, und fortan die weltpolitischeBedeutung der bolschewistischen Machter-greifung in Russland für die nachfolgendenpolitisch-gesellschaftlichen Entwicklungen,zumal der Entstehung und Etablierung derfaschistischen Bewegungen, in das Zentrumseines Paradigmas eines ideologischen Bür-gerkriegs in Europa von 1917 bis 1945 rück-te.
»Hitler als Anti-Lenin? « – diese, wennauch rhetorisch verkürzte, Formel verbindetsich seither mit Noltes Versuch, den Natio-nalsozialismus als Radikalfaschismus eben-so wie den italienischen Normalfaschismushistorisierend im Rahmen einer historisch-genetischen bzw. interaktionistischen Tota-litarismustheorie als Folge der bolschewisti-schen Revolution in Russland zu deuten.
Nicht nur der Untertitel Demokratie zwi-schen Lenin und Hitler signalisiert, dass derAutor sich interpretativ in seinem neuenWerk treu bleibt. Bereits auf S. 10 seinesVorwortes lässt Nolte keinen Zweifel, wel-chem Phänomen der Weimarer Republik er»die größte Bedeutung« zumisst, »nämlichder radikal-pazifistischen Bewegung, die in-folge der beispiellos schrecklichen Kriegser-lebnisse eine überragende Überzeugungs-kraft gewonnen hatten, die aber mit demlängst vorhandenen Wunsch verknüpft war,mit den ‚Schuldigen’ an diesem Kriege aufradikale Weise ‚aufzuräumen’, damit endlichdas ganz Andere, nämlich die kommunisti-sche Gemeinschaft einer Welteinheit ohneKlassen und Staaten, entstehen könne«.
Nein, Ernst Nolte lässt nicht davon ob,diese »Bewegung« und jene »noch radikale-re« »Gegenbewegung« (S. 11) des National-sozialismus historisch zu relationieren – nunalso im Horizont der Weimarer Republik –,selbstredend, ohne die eine oder anderemoralisch zu relativieren. Zu Recht, denndasjenige, was Nolte im Laufe der zurück-liegenden zwei Jahrzehnte als Beiträge zu ei-ner Ideologiegeschichte der Moderne
06_Buchbesprechungen Seite 478 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 479
vorgelegt hat, vor allem seine monumentaleAbhandlung über die Historische Existenz.Zwischen Anfang und Ende der Geschichte?von 1998, vermochte seinen Interpretations-ansatz des totalitären Zeitalters nicht nurweiter zu fundieren, sondern entlarvte dieNolte-Schelte des »Historikerstreits« alsdasjenige, was sie von Anfang an war: einegeschichtspolitisch motivierte Invektive ge-gen einen streitbaren, unbequemen Geist,für den das wissenschaftliche Ethos stetsmehr war und blieb als bloßes Wortgeklin-gel im verbands- und parteipolitischenKlüngel um Einfluss und Kommissionsvor-sitze.
Noltes »apolitischer Rigorismus« (Joach-im C. Fest) reizte lange Zeit viele Kollegenund Medienvertreter, doch heute, mit wach-sendem Abstand zur geschichtspolitischenKontroverse der späten achtziger Jahre undangesichts von Noltes fortgeschrittenem Al-ter, beginnen sich Aversionen und grund-sätzliche Vorbehalte in Neugierde, wennnicht gar zaghafte Zustimmung – und sei esnur partiell – zu wandeln. Zu offenkundigist der akademische Zuspruch, den der Ge-schichtsdenker und einstige Heidegger-Schüler Nolte aus dem Ausland, zumal ausFrankreich und Italien, nicht erst seit Er-scheinen des Schwarzbuchs des Kommunis-mus erfährt, und allzu unbegründet war dieim Raum stehende Behauptung, Nolte gingees mit seinen Thesen und Theorien um dasVergehen der Vergangenheit, gar um einemoralische Entlastung Hitlers und der nati-onalsozialistischen Verbrechen.
Ernst Nolte, der die »Singularität« der na-tionalsozialistischen Untaten bereits 1963im Faschismus in seiner Epoche postulierteund auch vier Jahrzehnte später in der Wei-marer Republik daran festhält (S. 11), hatdiese Behauptung stets als infame Unterstel-lung zurückgewiesen und auf den Inhalt sei-ner Bücher verwiesen, die man jedoch,nachdem einmal der Vorwurf des histori-schen Revisionismus im Raum stand, hier-zulande oftmals gar nicht mehr glaubte lesenzu müssen. Hätte man sie gelesen und liestman das nun erschienene, so sieht man, wieunhaltbar die geschichtspolitischen Behaup-tungen und Unterstellungen sind.
Noltes nun vorgelegte Weimarer Republikverdient große Aufmerksamkeit, nicht zu-
letzt aus vier Gründen. Zum einen bietet eseinen luziden Überblick über Politik, Gesell-schaft und Kultur, über Verfassung, politi-sche Strukturen sowie zentrale Akteure; esanalysiert in chronologischer Abfolge die»Nöte der Frühzeit«, die »fragile Konsolidie-rung« sowie schlussendlich »Krise und Un-tergang« einer Republik, die, daran lässt derAutor keinen Zweifel, in ihrer Genese undvor allem in ihrem Scheitern ganz wesentlichvon den politischen Rändern her geprägt war.
Zum anderen schließt der Autor mit derBehandlung jenes bedeutsamen Zeitraumsvom Ende des Ersten Weltkriegs bis hin zurMachtübernahme Hitlers im Januar 1933eine periodische Lücke in seinem Werk, indem diese Scharnierzeit bislang keinesfallsso detailliert und systematisch beleuchtetwurde, wie dies mit dem nun vorliegendenBuch geschieht. In ihm gelingt es dem hinund wieder der Empirieferne gescholtenenGeschichtsdenker Nolte im übrigen, in dienüchterne, faktengesättigte Schilderung derGenese der Weimarer Republik Exkurseüber »die Linke«, »die Rechte« und »dieMitte« einzuflechten bzw. historisch-ideo-logiegeschichtliche »Präfigurationen« ein-zuspiegeln, ohne dass der Text in disparateTeile auseinander fällt. Im Gegenteil. DieWeimarer Republik vereint wesentliche the-matische Aspekte ganz unterschiedlicherMonographien des Autors, sowohl seinerhistorischen Tetralogie und philosophischenTrilogie, als auch seiner Historischen Exis-tenz und dient, ganz unverkennbar, zur Prä-zisierung und interpretatorischen Schär-fung zentraler Thesen hinsichtlich seinesideologischen Bürgerkriegs-Paradigmas.
So legt die Lektüre des Buches den Ein-druck nahe, mit der Weimarer Republik seiwomöglich nicht nur ein bedeutender Bau-stein, sondern vielmehr ein Schlussstein imNolteschen Gedankengebäude eingefügtworden - doch wie auch immer: Tatsache ist– und davon zeugt auch die nun vorgelegteWeimarer Republik –, dass das NoltescheWerk in seiner intellektuellen Zwingkraft,seinem Umfang, seiner historiographischenWeite und philosophischen Tiefe inDeutschland und weit darüber hinaus seines-gleichen sucht und einen solitären Rang mitgroßer Strahlkraft für sich beanspruchenkann. Dass es damit, und so auch der vorlie-
06_Buchbesprechungen Seite 479 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen480
gende »Baustein«, Einspruch von unter-schiedlicher Seite provoziert, ja zur Widerre-de auffordert, ist selbstverständlich und einerliberalen, offenen Gesellschaft wesensgemäß.
Nicht angemessen und einer offenen Ge-sellschaft im Grunde unwürdig war derUmgang mit Ernst Nolte und seinen Bü-chern, wie er in Deutschland über Jahre hin-weg praktiziert wurde. Das Erscheinen derWeimarer Republik zum zwanzigsten Jah-restag des »Historikerstreits« bietet Gele-genheit, diesen Umgang zu ändern. Mankann eine solche Änderung nicht nur Autorund Werk wünschen, sondern letztendlicheinem jeden, der mit dem Ethos der Wissen-schaft noch mehr verbindet, als die peinlicheErinnerung an einstige akademische Selbst-verständlichkeiten.
Volker Kronenberg
Andreas KÜHN: Stalins Enkel, Maos Söhne.Die Lebenswelt der K-Gruppen in der Bun-desrepublik der 70er Jahre. Frankfurt/M.2005. Campus Verlag, 358 S., brosch., 39,90EUR.
Durchaus bedeutsame Angehörige der ge-genwärtigen journalistischen, politischenund wissenschaftlichen Elite verfügen übereinen biographisch-politischen Vorlauf inden sogenannten »K-Gruppen« der 1970erJahre. Hierbei handelte es sich um maois-tisch ausgerichtete kommunistische Klein-organisationen, die zwar nur selten übermehr als 1.000 Mitglieder verfügten und beiWahlen unter 0,3 Prozent der Stimmen blie-ben. Gleichwohl verstand man sich alsAvantgarde der »revolutionären Arbeiter-klasse«, sah in den anderen GruppierungenAbweichler und Verräter gegenüber denIdealen des »wahren Sozialismus« und ent-wickelte einen ausgeprägten ideologischenDogmatismus und Fanatismus. Heute istdieses »Folgeprodukt« der 68er Bewegungfast schon vergessen. Auch in der wissen-schaftlichen Literatur fand es kaum Beach-tung, sieht man einmal von der allerdingsstark autobiographisch geprägten Arbeitvon Gerd Koenen Das Rote Jahrzehnt. Un-sere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977 (Köln 2001) ab.
Um so erfreulicher ist daher das Erschei-nen einer ersten umfangreichen Darstellungzum Thema, die der Düsseldorfer Histori-ker Andreas Kühn unter dem Titel StalinsEnkel, Maos Söhne. Die Lebenswelt der K-Gruppen in der Bundesrepublik der 70erJahre vorgelegt hat. Die Untersuchungsob-jekte bestanden aus der »KommunistischenPartei Deutschlands/Marxisten-Leninisten«(KPD/ML), der »Kommunistischen ParteiDeutschlands« (KPD) und dem »Kommu-nistischen Bund Westdeutschlands« (KBW)– den ebenfalls bedeutsamen »Kommunisti-sche Bund« (KB) behandelte Kühn nicht –für den Zeitraum von 1970 bis 1980. DieQuellenbasis lieferten autobiographisch-literarische Texte, unterschiedliche Archiv-bestände mit der Publizistik der Organisati-onen sowie Interviews mit einigen »Ehema-ligen«. Mit seiner Arbeit beabsichtigte derAutor »die Rekonstruktion der elitären Le-benswelt einer Generationskohorte, die diepolitischen Geschicke der Bundesrepublikheute mitgestaltet« (S. 19).
In neun umfangreicheren Kapiteln gehtKühn auf die unterschiedlichsten Aspekteder genannten drei politischen Gruppen ein:Zunächst widmet er sich der Gründungs-phase Ende der 1960er/Anfang der 1970erJahre und beschreibt das Innenleben bezo-gen auf Alltag, Binnenstruktur und Habitus.Dem folgend geht es um die Agitationsin-halte und –themen sowie die Ideologie undIndoktrination. Die Einstellung zu Gewalt-anwendung und die Einschätzung desLinksterrorismus sowie die Beziehungen zuanderen linksextremistischen Gruppen ste-hen danach im Zentrum des Interesses. Be-sondere Aufmerksamkeit finden auch dieöffentlichen Aktivitäten bezogen auf dieinhaltlichen Schwerpunkte Kultur- und So-zialpolitik. Nach Erörterungen zumGeschichtsbild und zur Mythenbildungschließt die Arbeit mit einer Darstellung derAuflösungstendenzen Ende der 1970er/An-fang der 1980er Jahre. In den K-Gruppensieht der Autor eine Bewegung, »die imNachklang von ‚1968’ Denkmodelle wie Li-beralismus oder Demokratie hasserfüllt ge-genüberstand« (S. 287).
Das Urteil über die Arbeit fällt ambiva-lent aus: Einerseits beeindruckt sie durchihre hohe Informationsdichte und Material-
06_Buchbesprechungen Seite 480 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 481
fülle, die inhaltlich überzeugend und gutstrukturiert aufgearbeitet und dargestelltwurde. Kühn geht selbst auf so exotisch er-scheinende Themen wie die Einstellung zuErnährung und Urlaub ein, allerdings nichtum der Füllung von Seiten willen, sondernzur Veranschaulichung eines bestimmtenpolitischen Organisationstyps. Dabei findensich auch eine Reihe von guten Beobachtun-gen und Einschätzungen, etwa wenn er dasLeben in Wohngemeinschaften »als Vehikelzur Durchsetzung sektenartiger Kontroll-mechanismen« (S. 78) oder die Einstellungzur Sexualität als Form einer »linksradikalenVerkleinbürgerlichung« (S. 85) deutet. Auchwird die »Hinwendung von emanzipatori-schen Ideen zur rigiden Kaderpolitik, vonder Libertinage zur Totschlagsrhetorik« (S.294) anschaulich und überzeugend nachge-zeichnet. Damit liefert der Autor einen be-deutenden Beitrag zur Forschung in diesemBereich.
Andererseits ist kritikwürdig, dass Kühnauf dieser Ebene stehen bleibt, keine klareFragestellung entwickelt und kein daraufbezogenes Untersuchungsraster präsentiert.Es handelt sich über weite Strecken um eineprimär beschreibend ausgerichtete Arbeit,die auch einige kleinere inhaltliche Lückenaufweist (ideologische Grundpositionen, re-volutionäres Selbstverständnis). Währenddies durchaus verzeihbar ist, kann das Feh-len einer genaueren analytischen Auseinan-dersetzung mit dem Aufkommen und Ende,dem Typus und Wesen der Gruppen bedau-ert werden. So nimmt der Autor etwa beider Darstellung der Organisationsstrukturzwar immer wieder vergleichende Betrach-tungen mit religiösen Sekten vor, belässt esaber überwiegend bei kurzen Anmerkungendazu. Nur gegen Ende der Arbeit findensich einige – allerdings viel zu kurz geratene- stärker analytisch ausgerichtete Ausfüh-rungen etwa zu »Kontinuitäten zur Subkul-tur einer geeinten Studentenbewegung«oder zum »Organisationsfetisch« aus einer»tiefempfundenen Ohnmacht« (S. 294).
Armin Pfahl-Traughber
Florian ANTON / Leonid LUKS (Hrsg.):Deutschland, Rußland und das Baltikum.Beiträge zu einer Geschichte wechselvollerBeziehungen. Festschrift zum 85. Geburts-tag von Peter Krupnikow. Köln 2005. Böh-lau Verlag, 408 S., brosch., 44,90 EUR.
Der Titel der dem Historiker Peter Krupni-kow gewidmeten Festschrift deutet es schonan: In diesem Band geht es keineswegs aus-schließlich um die zeitgeschichtlichen undpolitischen Aspekte und ihre ideenge-schichtlichen Reflexe in diesen wechselvol-len Beziehungen. Vielmehr befassen sicheinige der thematisch sehr heterogenen Bei-träge mit der Politikwissenschaft entferntenGegenständen – so z.B. der mittelalterlichenKunstgeschichte. Eine eingehendere Würdi-gung dieser Beiträge muss hier darum unter-bleiben, es versteht sich von selbst, dass sieauch dem an den politischen BeziehungenInteressierten wertvolle Einblicke gewäh-ren können, insofern sie kulturelle Hinter-gründe dieser Beziehungen wesentlicherhellen, die in unseren Breiten auch nachder Aufnahme der baltischen Staaten inNATO und Europäische Union selbst imBereich akademischer Allgemeinbildungungenügend präsent sind.
Die Beiträge sind insgesamt chronolo-gisch geordnet, was ungewöhnlich erschei-nen mag, doch wäre eine systematische Ein-ordnung bei dieser thematischen Vielfaltauch kaum zu erreichen – zumal man einerFestschrift für einen Historiker durchausauch gerne eine historische Ordnung zuge-steht. Abschließend sei hinsichtlich derStruktur des ganzen Bandes erwähnt, dassdie Autoren in erster Linie dem Baltikumund Deutschland verbunden sind, wenigerRussland. Ob dies der wissenschaftlichenObjektivität des Bandes, der durchaus derlegitimen Betonung der kulturellen und po-litischen Eigenständigkeit der baltischenStaaten gegenüber Russland verschriebenist, Abbruch tun kann, muss freilich jederfür sich selbst entscheiden.
Von Interesse für eine auch an geschichtli-chen Hintergründen interessierte Politik-wissenschaft sind vor allem die folgendenBeiträge. Trotz des nun wirklich mittelalter-lichen Themas sei zunächst der ArtikelHans-Heinrich Noltes »Die Eroberung des
06_Buchbesprechungen Seite 481 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen482
Baltikums durch deutsche Herren im 13.Jahrhundert in globalgeschichtlicher Pers-pektive« erwähnt, der gleichsam den Aus-gangspunkt für die Beziehungen in der Re-gion im Rahmen der christlichen MissionLivlands markiert und so auch für die poli-tikwissenschaftliche Beschäftigung mit derRegion wertvolles Grundlagenwissen lie-fert. Mit einem großen Sprung hinweg überdie Zeit kommen wir zu dem Artikel vonLeonid Luks, der in seinem Beitrag diedurchaus frappierenden Ähnlichkeiten inder antisemitischen Grundhaltung Heinrichvon Treitschkes und Fjodor Dostojewskiswie auch ihrer Entwicklung beleuchtet, wasnicht nur im Bezug auf das damit verbunde-ne Konzept einer »organischen nationalenEinheit« erhellend ist. Luks zeigt dabei dieverheerende Wirkung der breiten Rezeptionder antijüdischen Gedanken dieser beidenintellektuellen Autoritäten auf, wobei er inkonzentrierter Form auch die historischeFolie, d.h. die sozioökonomischen Proble-me, sowie die geschichtstheoretische Pers-pektive, also den geschichtlichen Auftrag ei-ner jeweils »auserwählten« Nation, als fürdieses Denken bestimmend zur Geltungbringt.
Politikwissenschaftlich lehrreich sindauch die beiden Aufsätze zur sowjetischenZeitgeschichte. Ludmila Thomas greift dasvon ihr schon an anderer Stelle bearbeiteteThema der politischen Biographie GeorgiTschitscherins auf und ergänzt einige As-pekte. Sie geht dabei im Wesentlichen denSpuren nach, die persönliche Dispositionenbei seiner Ausübung des Amtes als ‚Volks-kommissar des Äußeren‘ hinterlassen ha-ben. Dass er aus dem Adel stammte, wasihm seine Arbeit als Diplomat wesentlicherleichterte, dann seine Wachsamkeit gegen-über den Medien und eine damit verbunde-ne pragmatische Sensibilität für die rhetori-sche Selbstdarstellung der Sowjetunion undschließlich die persönlichen Beziehungenzum deutschen Botschafter Brockdorff-Rantzau und dem russischen DichterMichail Kusmin tragen wesentlich zur Er-klärung der Entfremdung Tschitscherinsvon der übrigen Sowjetführung bei. Auchder Aufsatz »Entkolonialisierung in der So-wjetunion. Die neuen nationalen Eliten inden sowjetischen Unionsrepubliken seit den
1950er Jahren« von Gerhard Simon knüpftan frühere Arbeiten des Autors an und zeigtnun ex post die Bedeutung auf, die nichtrus-sische Eliten für die Auflösung der Sowjetu-nion hatten. Bemerkenswert ist hier vor al-lem der Aufweis Simons, dass die jeweiligenEliten zum einen zunächst völlig systemtreugewesen waren und zum anderen erst durchBreschnews Politik der stabilen Kader ihrekulturelle und also nationale Verwurzelungverstärkt hatten, ehe sie zu treibenden Kräf-ten des Zerfalls der Sowjetunion wurden.
Die vier letzten Aufsätze beziehen sichauf die Zeit nach der Unabhängigkeit desBaltikums. Die Wiederaufnahme diplomati-scher Beziehungen zwischen Lettland undDeutschland im Jahr 1991 stellt Eckart He-rold dar. Kristina Hansen zeichnet in ihremBeitrag konzentriert die Beziehungen zwi-schen Estland und Russland im Spannungs-feld estnischer Sicherheitspolitik undrussischer Großmachtpolitik nach. AnHand des Strebens Estlands nach demNATO-Beitritt wird die Interdependenzverschiedener Felder nationaler Politik bei-der Seiten einleuchtend aufgewiesen. Eben-falls einen guten Überblick bietet PhilippKerns Auseinandersetzung mit den politi-schen Beziehungen zwischen Russland undEuropäischer Union seit dem AmtsantrittPutins und ihren gleichsam im Hintergrundwirksamen wirtschaftlichen Determinan-ten. Im letzten Aufsatz des Bandes nimmtFlorian Anton die von Hansen bereits ange-sprochene Problematik baltischer Sicher-heitspolitik im Bezug auf Lettland in einerauf die Europäische Union erweiterten Per-spektive wieder auf. Die Alternativlosigkeitder bisher erfolgten baltischen Sicherheits-und Integrationspolitik verknüpft er in ei-nem Ausblick auf die zukünftige außenpoli-tische Option Lettlands als Mittler zwischenEU und Rußland mit der Aufgabe der letti-schen Republik »ein vernünftiges Abwägenzwischen ihrer allein aus historischen Grün-den vorhandenen europäischen Identität so-wie dem erst kürzlich wiedergefundenennationalen Bewußtsein« (S. 364) zu bewerk-stelligen. Dies und die damit notwendig ein-hergehende Befreiung von der historischenLast russischer Bedrohung ist ein weiterer,wichtiger Schritt auf dem Wege der Trans-formation aller baltischen Staaten: eine Auf-
06_Buchbesprechungen Seite 482 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
ZfP 52. Jg. 3/2006
Buchbesprechungen 483
gabe, der die mit dem Thema befasstenAutoren in diesem Band bestenfalls verhal-ten optimistisch gegenüberstehen.
Abschließend gilt es festzuhalten, dass so-wohl das biographische Vorwort als auchdas eigene Kapitel »Begegnungen mit PeterKrupnikow« interessante Einblicke in dasakademische und keineswegs unpolitischeLeben des Jubilars geben, welches die wech-selvollen Beziehungen zwischen Deutsch-land, Rußland und dem Baltikum wieder-spiegelt und so als historische Konkretionum eine weitere Facette bereichert, was die-sem informativen Band einen angemessenenRahmen gibt.
Holger Zapf
André KAISER: Mehrheitsdemokratie undInstitutionenreform. VerfassungspolitischerWandel in Australien, Großbritannien, Ka-nada und Neuseeland im Vergleich. Frank-furt a.M.,/New York 2002. Campus Verlag,559 S., brosch., 59,90 EUR.
Der politikwissenschaftliche Vergleich vonInstitutionen leidet nur allzu oft unter ei-nem zentralen methodischen Manko: Er be-greift den Gegenstand als statisches, vonlange Zeit invarianten Elementen geprägtesRegelgefüge und vernachlässigt daher meistdie Frage nach dem permanenten Wandel,welchem diese Institutionengefüge unterlie-gen. Beispielhaft für diese analytische Blind-stelle sind die wegweisenden Studien ArendLijpharts, die zwar wichtige Beiträge zur ty-pologischen Unterscheidung zeitgenössi-scher Demokratien (consensus vs.majoritarian democracy) und zur Perfor-manzforschung beinhalten, gerade aber deninnersystemischen Wandel der betrachtetenDemokratien nicht genügend abbilden.
In diese Lücke stößt nun André Kaisermit seiner voluminösen Mannheimer Habi-litationsschrift zu den politischen SystemenAustraliens, Großbritanniens, Kanadas undNeuseelands. Dabei setzt er sich zwei Ziele:Zum einen geht es ihm darum, »konzeptio-nelle Bausteine für eine systematisch ver-gleichende Analyse verfassungspolitischerReformdiskussionen zu liefern« (S. 424);zum anderen um einen detaillierten empiri-
schen Vergleich der faktischen Reformpro-zesse in den vier Ländern mit dem An-spruch, Regelmäßigkeiten und Unterschiedeherauszuarbeiten und zu erklären.
Dem akteurszentrierten Institutiona-lismus verpflichtet, geht Kaiser in seinemkonzeptionellen Gebäude von der Kernan-nahme aus, dass der Institutionenwandel inden vier Systemen primär durch »struktu-rierte Eigeninteressen politischer Akteure«(S. 425) erklärt werden kann, mithin durch-weg aus dem systemischen Inneren kommtund nicht primär durch externen Struktur-wandel (gesellschaftliche, wirtschaftlicheModernisierung etc.) induziert ist. Zu dieserErkenntnis kommt er deshalb, da die vierausgewählten »Mehrheitsdemokratien« dies-bezüglich in ganz ähnliche Rahmenbedin-gungen eingebettet waren, aber trotzdemganz unterschiedliche institutionelle Refor-men durchliefen.
Empirisch ist zunächst ist festzustellen,dass die Reformschübe in den vier Staatenzu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten er-folgten: Während die entsprechenden Dis-kussionen in Australien im Grunde schonseit der Schaffung des bundesstaatlichenCommonwealth zu Beginn des 20. Jahrhun-derts permanent geführt wurden, begannensie in Großbritannien und Neuseeland erstab den siebziger bzw. achtziger Jahren desletzten Jahrhunderts eine größere Rolle zuspielen. Auch in Kanada erfolgt diese refor-morientierte Initialzündung mit dem Beginnder révolution tranquille in den Sechzigernvergleichsweise spät.
Zweitens zeigt sich, dass die Schwerpunk-te der Reformdiskussion recht unterschied-lich und zum Teil auch pfadabhängig waren,da sie sich an den spezifischen Bedingungenund Probleme der einzelnen Systeme orien-tierten, nicht an generellen demokratietheo-retischen Überlegungen: Während im bun-desstaatlichen Australien die Abschaffungder Monarchie und die Reform des Födera-lismus im Mittelpunkt standen, prägte imeinheitsstaatlichen Neuseeland die Diskussi-onen um das Wahlrecht die Szenerie. InGroßbritannien wiederum standen insbe-sondere die Reform des als undemokratischapostrophierten House of Lords und dasProjekt der Devolution im Mittelpunkt,während in föderalen Kanada nach der
06_Buchbesprechungen Seite 483 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15
Buchbesprechungen484
»Heimholung« der Verfassung 1982 vor al-lem um eine präzise Kompetenzverteilungzwischen Bund und Provinzen sowie insbe-sondere um das Verhältnis Quebecs zur Fö-deration gestritten wurde.
Drittens zeigt Kaiser, dass Dauer und Er-folg von Reformprozessen in keinem syste-matischen Zusammenhang stehen: Geradein Australien resultierten die schon sehr lan-ge währenden Reformforderungen letztlichkaum in substantiellen Änderungen des In-stitutionengefüges, da die vielfältigen »Veto-punkte« der australischen Föderalverfas-sung entsprechende Initiativen (Reform desSenats; Übergang zur Republik) regelmäßigscheitern ließen; Ähnliches gilt auch für Ka-nada, wo umfangreiche Reformen (MeechLake Accord, Charlottetown Accord) anden Vetokompetenzen der Provinzen schei-terten. Demgegenüber waren in den von»flexiblen«, weil nicht einheitlich kodifizier-ten Verfassungsordnungen geprägten Staa-ten Großbritannien und Neuseeland Refor-men im Grundsatz wesentlich einfacherdurchzusetzen.
Der Blick ins Detail zeigt aber auch hierdas Obwalten insbesondere informellerHürden, die Institutionenreformen jahr-zehntelang verschleppen halfen. So wurdensowohl Oberhausreform als auch Devoluti-on in Großbritannien seit den siebziger Jah-ren zum dauernden Gegenstand parteipoliti-scher Auseinandersetzung, da die LabourParty in ihrer langen Oppositionszeit seit1979 mehr und mehr zur Speerspitze derReformer wurde, um dieses systemkritischePotential für ihr politisches Comeback zuinstrumentalisieren. Der Strukturkonserva-tismus der Regierungen Thatcher und Majorließ derlei Wandel zuvor aber nicht zu.
Auch in Neuseeland weist Kaiser derleiinformelle Hürden nach, die sogar nochweiter reichten als im britischen Mutterland:Der informelle reformfeindliche Grundkon-sens der beiden gegnerischen Großparteienkonnte Anfang der achtziger Jahre bezüg-lich der Wahlrechtsreform erst durch exter-nen Druck erzwungen werden: So langezwei große Parteien durch regelmäßige Al-ternanz in der Regierungsverantwortungkalkulierbare Chancen auf die Gewinnungpolitischer Macht besitzen, sind Institutio-nenreformen trotz formal niedriger Ände-
rungshürden unwahrscheinlich, da sie imNutzenkalkül der entscheidenden Akteurekeine entscheidende Rolle spielen.
Kurzum: Die große Stärke von KaisersStudie, deren inhaltliche Fülle hier notwendi-gerweise nur im Ansatz vorgestellt werdenkonnte, liegt im detaillierten Nachweis per-manenten Instutionenwandels in den vierSystemen und den trotz der mehrheitsdemo-kratischen Grundlogik doch recht unter-schiedlichen Reformzielen und –erfolgen. In-soweit ist er dem selbst gesteckten Anspruch,vergleichende Institutionenforschung mehrals bisher auch als Institutionenwandelfor-schung zu betreiben, voll gerecht geworden.Schade nur, dass er seine »konzeptionellenBausteine« am Ende nicht doch zu einemsystematischen Theorieansatz weiterentwi-ckelt hat, wozu doch gute Voraussetzungenbzw. Vorbilder bestünden: Schon Arend Lij-phart hat seinen empirischen Demokratie-vergleich ja in die theoretische Folgerungmünden lassen, Konsensdemokratien seienan bestimmten Performanzkriterien gemes-sen die leistungsfähigeren Systeme. Darüberwird seither intensiv gestritten, aber das istletztlich der langfristig bleibende theoreti-sche Nutzen seiner Studien. Auch für Kaiserhätte sich eigentlich die präzise theoretischeKlärung der Frage angeboten, ob nicht un-terschiedliche Ausprägungen mehrheitsde-mokratischer Gefüge nicht systematisch dieinstitutionenreformerische Performanz vor-bestimmen. Ansätze hierzu liefern seine eige-nen theoretischen Vorarbeiten (Konzept derVetopunkte) bzw. die empirischen Detailsseiner Studie ja genügend (unterschiedlicheTerritorialstrukturen; Struktur und Wandeldes Parteiensystems; Konstanz bzw. Wandelinformellen verfassungspolitischen Grund-konsenses; Rolle externer Akteure als Kata-lysatoren etc.). Doch das theoretische Resü-mee der Studie (S. 424-425) bleibt dafür vielzu skizzenhaft. Aber vielleicht ist gerade diesein guter Anreiz, die vergleichende Instituti-onenforschung mit neuem Elan auch auf the-oretischer Ebene weiter voranzutreiben.
Martin Sebaldt
06_Buchbesprechungen Seite 484 Donnerstag, 9. November 2006 3:08 15