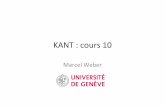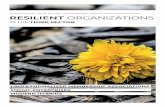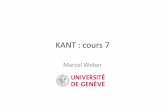Universität, Volksbildung und Moderne – die »Wiener Richtung« wissenschaftsorientierter...
Transcript of Universität, Volksbildung und Moderne – die »Wiener Richtung« wissenschaftsorientierter...
Sonderdruck aus
Katharina Kniefacz / Elisabeth Nemeth /Herbert Posch / Friedrich Stadler (Hg.)
Universität – Forschung – Lehre
Themen und Perspektiven im langen20. Jahrhundert
V& R unipress
Vienna University Press
ISBN 978-3-8471-0290-8
ISBN 978-3-8470-0290-1 (E-Book)
Inhalt
Zur Reihe
Grußwort des Rektors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grußwort der Vorsitzenden des Universitätsrats . . . . . . . . . . . . . . 13
Grußwort der Vorsitzenden des Senats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Grußwort des Ehrenvorsitzenden des International Scientific Board . . . 17
Friedrich StadlerVorwort des Reihenherausgebers zur Buchreihe . . . . . . . . . . . . . . 19
Band 1 j Universität – Forschung – Lehre
Katharina Kniefacz, Elisabeth Nemeth, Herbert Posch undFriedrich StadlerEinleitung der HerausgeberInnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Streit der Fakultäten
Elisabeth Nemeth und Friedrich StadlerDie Universität Wien im »langen 20. Jahrhundert« und das unvollendeteProjekt gesellschaftlich verankerter Vernunft – Zum »Streit derFakultäten« von Kant bis Bourdieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hans-Joachim Dahms und Friedrich StadlerDie Philosophie an der Universität Wien von 1848 bis zur Gegenwart . . 77
Irene RanzmaierDie Philosophische Fakultät um 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Wolfgang L. ReiterInstitution und Forschung: Physik im Wandel 1850 – 1900 – einekaleidoskopische Annäherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Thomas KönigAufsteigen, Verdrängen, Nachholen: Sozialwissenschaft(en) an derUniversität Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Thomas OlechowskiDie Entwicklung und Ausdifferenzierung der rechts- undstaatswissenschaftlichen Disziplinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Wissensgesellschaft j Wissenschaftsgesellschaft
Friedrich Stadler und Bastian StoppelkampDie Universität Wien im Kontext von Wissens- undWissenschaftsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Petra SvatekRaumforschung an der Universität Wien im 20. Jahrhundert.Kontinuitäten und Wandlungen einer multidisziplinären und politischorientierten Forschungsrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Johannes FeichtingerDie verletzte Autonomie. Wissenschaft und ihre Struktur in Wien 1848bis 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Christian H. StifterUniversität, Volksbildung und Moderne – die »Wiener Richtung«wissenschaftsorientierter Bildungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Katharina Kniefacz und Herbert PoschAkademische Grade und Berufsberechtigung – Das Verhältnis vonBildung und Ausbildung an der Universität Wien im »langen20. Jahrhundert« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Doris IngrischGender-Dimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Inhalt6
Karl Anton FröschlScientia digitalis. Exemplarische Skizzen zur Informatisierung derWissenschaften an der Universität Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Universität & Öffentlichkeit
Katharina Kniefacz und Herbert PoschSelbstdarstellung mit Geschichte. Traditionen, Memorial- undJubiläumskultur der Universität Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Anhang
Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
AutorInnen dieses Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Universitäre Kommission zur wissenschaftlichen Aufarbeitung derUniversitätsgeschichte im Rahmen des 650-jährigen Jubiläums (UKUG,2010 – 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Wissenschaftlicher Beirat (VertreterInnen der Fakultäten und Zentrender Universität Wien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
International Scientific Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Inhalt 7
Christian H. Stifter
Universität, Volksbildung und Moderne – die »WienerRichtung« wissenschaftsorientierter Bildungsarbeit
1. Einleitung
Die aktive Beteiligung an organisierter Volks- beziehungsweise Erwachsenen-bildung, an Weiterbildung sowie an der Popularisierung wissenschaftlichenWissens zählt keineswegs zum traditionellen Rollenverständnis und Aufgaben-feld der Universitäten1 – insbesondere in den deutschsprachigen Ländern. ImGegenteil sind Exklusivität durch Zugangsbarrieren, Hierarchie, Rituale undrelativ autonome Arbeits-, Verkehrs- und Kooperationsformen geradezu tradi-tionelle Kennzeichen jener Qualifikations- und Bildungseinrichtung, die »an derSpitze der gesellschaftlichen Bildungspyramide«2 steht.
Obwohl die soziale Exklusivität vergleichsweise spät gelockert wurde, undzwar in Folge der Hochschulreform 1975 und der damit vorangetriebenen de-mokratischen Öffnung,3 hat die Kooperation von Volksbildung und Universitätauch hierzulande eine beachtliche Tradition, deren (vorläufig erste) Hochblütevom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Erste Republik reichte.4
Ohne hier weder auf die facettenreiche und vielgestaltige ländliche Vorge-schichte noch auf die Aktivitäten und Vorläufereinrichtungen urbaner Wis-senschaftspopularisierung in Österreich näher eingehen zu können, soll im
1 Siehe dazu: Paul Natorp, Universität und Volksbildung [1913], in: Wolfgang Krüger (Hg.),Wissenschaft, Hochschule und Erwachsenenbildung, Braunschweig: Westermann 1982, 89;weiters: Paul Steinmetz, Die deutsche Volkshochschulbewegung (Probleme der Staats- undKultursoziologie, hg. v. Alfred Weber, 5), Karlsruhe: G. Braun 1929, 25.
2 Erich Schäfer, Historische Vorläufer der wissenschaftlichen Weiterbildung. Von der Universi-tätsausdehnungsbewegung bis zu den Anfängen der universitären Erwachsenenbildung in derBundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske + Budrich 1988, 9.
3 Ulrike Felt/Elisabeth Nemeth, Universität, Demokratie und Hochschulreform im Nach-kriegsösterreich. Über Möglichkeiten und Grenzen demokratischer Entscheidungs-strukturen, in: Gerhard Bisovsky/Christian Stifter (Hg.), »Wissen für Alle«. Beiträge zumStellenwert von Bildung in der Demokratie, Wien: Verband Wiener Volksbildung 1996, 48 – 49.
4 Siehe dazu: Tom Steele, Knowledge is Power! The Rise and Fall of European Popular Educa-tional Movements, 1848 – 1939, Oxford–Bern–Berlin et al. : Peter Lang 2007, 149 – 184.
Folgenden auf die vom Experimentalphysiker und Wiener VolksbildungspionierAnton Lampa als »Wiener Richtung«5 benannte wissenschaftsorientierteVolksbildung eingegangen werden.
2. Vorläufer wissenschaftsorientierter Volksbildung und derPrototyp einer ersten Volksuniversität in Wien
Angefacht vom Universalitäts- und Gleichheitspostulat der Aufklärung und denpolitischen Ideen der französischen Revolution und vorangetrieben durch In-dustrialisierung und Urbanisierung sowie den Siegeszug der Naturwissen-schaften, wurden Mitte des 19. Jahrhunderts traditionelle Bildungsbarrieren,neben den politischen Machtverhältnissen, erstmals auf breiter Basis in Fragegestellt und auf Veränderungen gedrängt. Die bekannten Schlagwörter »Wissenist Macht« und »Bildung macht frei« erinnern eindrücklich daran.
In Wien nahm die wissenschaftszentrierte Volksbildungsbewegung – nebeneinzelnen Vorläufereinrichtungen wie etwa dem »Gemeinnützigen Verein«6 –ihren Ausgangspunkt mit der Zweigstellengründung des »Allgemeinen Nie-derösterreichischen Volksbildungsvereines« 1887. Unter der Leitung desKunsthistorikers Eduard Leisching7 – erster Obmann war der Jurist, Industrielle,liberales Reichsratsmitglied und Kurator des k.k. Österreichischen Handels-museums Alexander Peez – verselbstständigte sich diese Zweigstelle knappsechs Jahre später als »Wiener Volksbildungsverein«, der die Keimzelle für dienachfolgenden »Stammhäuser« der Wiener Volkshochschulen bildete.8
Ausschlaggebend für den enormen Erfolg der unentgeltlichen Sonntagsvor-träge des Wiener Volksbildungsvereins war sicherlich der besondere Reiz, den
5 Lampa sowie auch Ludo M. Hartmann unterschieden diese sowohl von der »alten« wilhel-minischen Volksbildungstradition als auch von der intensiven, auf potenzielle gesellschaft-liche MultiplikatorInnen zugeschnittenen »neuen« Richtung der Volksbildung in der Wei-marer Zeit. Vgl. Anton Lampa, Kritisches zur Volksbildung (Volk und Geist, Schriften zurVolksbildung), Berlin: Verlag der Arbeitsgemeinschaft 1927, 29. Siehe dazu im Detail: StephanGanglbauer, »Neutrale« Volksbildung und die »wertungsfreie Wissenschaft«. Die »Sehnsuchtnach Schicksal und Tiefe« und der Richtungsstreit in der deutschsprachigen Volksbil-dungsbewegung der 20er Jahre, in: Spurensuche. Zeitschrift für Geschichte der Erwachse-nenbildung und Wissenschaftspopularisierung 10 (1999), 1 – 4, 60 – 84.
6 Siehe dazu: Christian Stifter, Staatsmann und Volksbildner. Freiherr Wilhelm von Schwarz-Senborn (1816 – 1903), in: Spurensuche 3 (1992) 4, 18 – 19.
7 Robert A. Kann/Peter Leisching (Hrsg.), Ein Leben für Kunst und Volksbildung. EduardLeisching 1858 – 1938. Erinnerungen (Fontes rerum Austriacarum. Scriptores, Abt. 1., Bd. 11),Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1978.
8 Bericht über die bisherige Thätigkeit, hg. vom Allgemeinen Nieder-Österreichischen Volks-bildungs-Verein, Zweigverein Wien und Umgebung, Wien: Selbstverlag 1889.
Christian H. Stifter294
systematischen Ausführungen von Universitätsprofessoren und -dozenten9 zueiner Vielzahl an Themen beiwohnen zu können. Die Bandbreite des breitge-fächerten Bildungsangebots, das auch »Volksconzerte« und Lesungen umfasste,reichte von »gewerblicher Buchführung«, »Fortschritt und Armuth« über»Verhütung ansteckender Krankheiten«, »Magnetismus und Elektrizität«, bis zu»volkswirtschaftlicher Bildung« oder dem »Theater der Griechen«.10
Da die ehrenamtlichen Geschäfte des jungen Vereins von jüngeren, enga-gierten und gut vernetzten Privatdozenten wie dem bereits genannten Leischingund dem Mediävisten und Theodor Mommsen-Schüler Ludo Moritz Hart-mann11 – unterstützt vom Philosophen und Privatdozenten Emil Reich12 – ge-führt wurden, lag es nahe, dass dieser »erste Brückenschlag zwischen Volks-bildung und Universität«13 bald zu einer nachhaltigen Kooperation ausgebautwurde.
Zur Finanzierung der bald eingerichteten Vortragsserien – »Cyklen« von achtEinzelvorträgen – wurden ab 1890 versuchsweise fünf Gulden pro Stunde alsbescheidene Vortragshonorare eingehoben,14 doch dem kontinuierlich anstei-genden und überraschend großen Zulauf waren die finanziellen und räumlichenRessourcen des Wiener Volksbildungsvereins langfristig nicht gewachsen.15
9 Unter der Vielzahl an Vortragenden aus dieser Frühphase finden sich z. B. Prof. Dr. WilhelmNeurath; Univ.-Prof. Dr. Eduard Reyer; Univ.-Dozent Dr. Alfred Francis Pribram; Univ.-Dozent Dr. Günther von Beck-Mannagetta; Univ.-Dozent Dr. Carl Grünberg; Univ.-Prof. Dr.Albrecht Penck; Univ.-Prof. Dr. Max Gruber oder Univ.-Dozent Dr. Robert Zuckerkandl.
10 »Theseus« – Interne Datenbankauswertung des Österreichischen Volkshochschularchivs(ÖVA) zu Vorträgen und Kursen, 1887 – 1961.
11 Zu Ludo M. Hartmann siehe insbesondere: Wilhelm Filla/Michaela Judy/Ursula Knittler-Lux(Hg.), Aufklärer und Organisator. Der Wissenschaftler, Volksbildner und Politiker LudoMoritz Hartmann (Schriftenreihe des Verbands Wiener Volksbildung 17), Wien: Picus-Verlag 1992; weiters: Günter Fellner, Ludo Moritz Hartmann und die österreichische Ge-schichtswissenschaft. Grundzüge eines paradigmatischen Konfliktes (Veröffentlichungen desLudwig Boltzmann-Instituts für Geschichte der Gesellschaftswissenschaften 15),Wien–Salzburg: Geyer-Ed. 1985.
12 Vgl. Norbert Hans Fellinger, Entwicklungsgeschichte der Wiener Volksbildung, in: NorbertKutalek/Hans Fellinger, Zur Wiener Volksbildung, Wien–München: Verlag Jugend & Volk1969, 129; Emil Reich, Grillparzer- und Ibsenforscher, war neben Leisching und Hartmanndie zentrale Gründerfigur der österreichischen Volkshochschulbewegung. Siehe dazu:Christian Stifter, Soziale Kunst und Wissenschaftliche Volksbildung. Emil Reich 1864 – 1940,in: Spurensuche 3 (1992) 3, 16 – 19.
13 Hans Altenhuber, Universitäre Volksbildung in Österreich 1895 – 1937 (Nexus. Zur Ge-schichte der Erwachsenenbildung 1), Wien: ÖBV, Pädagogischer Verlag 1995, 21.
14 Ernst Schulze, Die Volksbildungsarbeit ausländischer Universitäten [1896], in: Krüger (Hg.),Wissenschaft, Hochschule und Erwachsenenbildung, 59.
15 Dies verdeutlicht der geradezu explosionsartige Anstieg der Besucher/innenzahlen in denJahren zwischen 1887/88 und 1892/93, die sich von 6.000 auf 60.000 verzehnfachten. Siehe:Josef Luitpold Stern, Wiener Volksbildungswesen, Jena: Eugen Diederichs 1910, 16.
Universität, Volksbildung und Moderne 295
3. Akademisierung der Volksbildung – die Adaptierung derenglischen »University Extension« in Wien
Mit der seit längerem erfolgreichen englischen »University Extension«16 bot sichden reformorientierten Privatdozenten, die ihre Vorträge bis dahin ehrenamt-lich abgehalten hatten, und denen aus Eigeninteresse an einer horizontalenÖffnung der Universitäten gelegen war, ein Modell an, das auch in Wien zurorganisatorischen Erweiterung der Volksbildungsaktivitäten dienen konnte. Dievon James Stuart, einem Privatdozenten am Trinity-College, bereits 1873 an derUniversität Cambridge eingerichteten extramuralen Vorträge für externe Teil-nehmende aller sozialen Schichten, die sich über Kollegiengelder (»fees«) fi-nanzierten und nachfolgend auch von den altkonservativen UniversitätenLondon (1875) und Oxford (1877) übernommen wurden,17 waren bald auch inAustralien, den USA und Kanada en vogue,18 bevor sie auch auf dem europäi-schen Festland adaptiert wurden.19 Für Emil Reich war das ein Beweis dafür, dassdie Universitäten »in Wahrheit universitates seien […] das gemeinsame Bandfür alle jene […] die, gleichviel welchem Stand und Beruf im Leben sie ange-hörten, von dem redlichen Eifer erfüllt wären, Fühlung zu behalten mit denErgebnissen der Wissenschaft.«20
Die »volkstümliche Verbreitung« beziehungsweise »Ausdehnung« des Uni-versitätsstudiums an Orte, wo bisher noch keine Universitäten bestanden, führtein England – in Kooperation mit Gewerkschaften, industriellen Verbänden undder »Workers Educational Association« (WEA)21 – in den folgenden Jahrzehn-ten, anders als am europäischen Festland, zur Neugründung einer Reihe vonColleges und Universitäten wie beispielsweise Manchester, Liverpool, Leeds,Sheffield, Bristol, Nottingham oder Glasgow, die keine staatlichen Institutionen,sondern privatrechtlich organisierte Körperschaften waren.22
16 Vgl. Robert Peers, Adult Education. A Comparative Study (International Library of Sociologyand Social Reconstruction), London: Routledge & Kegan Paul 1958, 50 – 59; weiters: Barry J.Hake/Stuart Marriott (Eds.), Adult Education between Cultures. Encounters and Identities inEuropean Adult Aducation since 1890, Leeds: University of Leeds 1992.
17 Thomas Kelly, A History of Adult Education in Great Britain, Liverpool: Liverpool UniversityPress 1970, 222 – 230; Schulze, Volksbildungsarbeit, 58.
18 So wurden volkstümliche Universitätskurse u. a. an folgenden Universitäten eingerichtet:Philadelphia (1890), New York (1892), Melbourne (1890).
19 Etwa in Gent (1892), Brüssel (1893), Oviedo (1898), Sevilla (1899), Barcelona (1901).20 Emil Reich, Volkstümliche Universitätsbewegung (Ethisch-socialwissenschaftliche Vor-
tragskurse 5), Bern: Steiger 1897, 8 – 9.21 Siehe: Albert Mansbridge, An adventure in working-class Education. Being the story of the
workers’ educational association 1903 – 1915, London: Longmans, Green, and Co. 1920;weiters: G. Raybould, The English Universities and Adult Education, London: WEA 1951.
22 Martin Keilhacker, Das Universitäts-Ausdehnungs-Problem in Deutschland und Deutsch-Österreich, dargestellt auf Grund der bisherigen Entwicklung, Stuttgart: Silberburg 1929, 18.
Christian H. Stifter296
Obwohl der Vortragsstil und die Lehrweise dem Bedürfnis der erwachsenenHörerinnen und Hörer angepasst war, ausdrücklich »nur wirkliche Meister inihrem Fach«23 unterrichten durften, auf ein »schulmässiges Abfragen, welchesbei Erwachsenen beiden Theilen nur peinlich sein könnte«24, verzichtet wurdeund zum besseren Verständnis vor jedem Vortrag eine gedruckte Inhaltsüber-sicht (»syllabus«) ausgeteilt wurde, konnten die Teilnehmenden nicht nurschriftliche Prüfungen ablegen, sondern darüber hinaus, nach Absolvierung vonmindestens acht zusammenhängenden Vortragsreihen, die sich über drei Jahreerstreckten, auch der Universität affiliieren und schließlich ein reguläres Uni-versitätsstudium ablegen.25
In direkter Anknüpfung an das erfolgreiche und allseits gelobte Modell derenglischen University Extension26 – 1886 war die Zahl der extramuralen Stu-dierenden auf über 10.000 angestiegen27 – und mit Hinweis auf die große Be-deutung einer Ausweitung der bisherigen wissenschaftlichen Vortragszyklendes Wiener Volksbildungsvereins, insbesondere zur Milderung der »Wucht dessocialen Kampfes«, reichten die Privatdozenten der Universität Wien 1890 beiden akademischen Behörden eine Petition für die Schaffung volkstümlicher,remunerierter Universitätskurse ein. Abgesehen davon, dass der Wiener Uni-versität durch Einrichtung einer »Oberleitung eines Universitäts-Ausschusses«für »populäre Kurse« das Verdienst zukommt, »als erste auf dem Continent dasrühmliche Beispiel ihrer Schwestern in England nachgeahmt zu haben«, ging esdem akademischen Mittelbau hierbei freilich auch um »die Verbesserung dermateriellen Lage dieser jungen Gelehrten […] aus denen sich großtheils dieVortragenden des Wiener Volksbildungs-Vereins (ähnlich wie in England ausden Graduierten der Universitäten) recrutieren«28.
Nachdem dieser erste Versuch erfolglos verlief, unternahm Ludo M. Hart-mann einen neuen Anlauf, indem er am 16. Dezember 1893 dem AkademischenSenat der Universität Wien ein von 37 ordentlichen Professoren und 16 Dozentenaller Fakultäten unterzeichnetes Gesuch samt Denkschrift überreichte. Darinwurde die Einsetzung einer Kommission zur Ausarbeitung eines Statuts für dieOrganisation »volkstümlicher Lehrkurse der Universität mit besonderer Rück-
23 Robert Peers, Die Erwachsenenbildung in England, Stuttgart: Klett 1963, 78.24 Hans von Nostiz, Das Aufsteigen des Arbeiterstandes in England. Ein Beitrag zur socialen
Geschichte der Gegenwart, Jena: Fischer 1900, 193.25 Ebd., 195. Im Semester 1893/94 stieg die Zahl der extramuralen Hörerinnen und Hörer in
England dann auf 63.000 an. Siehe: Reich, Volkstümliche Universitätsbewegung, 12.26 Vgl. Christian Stifter, Knowledge, Authority and Power : The impact of university extension
on popular education in Vienna 1890 – 1910, in: Barry J. Hake/Tom Steele/Alejandro Tiana(Eds.), Masters, Missionaries and Militants. Studies of Social Movements and Popular AdultEducation 1890 – 1939, Leeds: University of Leeds 1996, 158 – 190.
27 Volksbildung in England [Feuilleton], Die Presse, 29. 8. 1890, 1.28 Ebd., 2.
Universität, Volksbildung und Moderne 297
sicht auf die Heranziehung von Privatdozenten und Assistenten als Lehrkräfte«29
vorgeschlagen; finanziert werden sollte dies durch eine jährliche Subvention desUnterrichtsministeriums in der Höhe von 6.000 Gulden. Begründet wurde dasGesuch mit dem Hinweis auf das »rege Bildungsbedürfnis« der erwachsenenBevölkerung, dem durch die beschränkten Mittel des Wiener Volksbildungs-vereins nicht adäquat Rechnung getragen werden könne; zudem sei weitausmehr zu erreichen, würde die »Alma Mater Viennensis mit ihrer Unparteilich-keit, Unabhängigkeit und ihrem wissenschaftlichen Ernste sich der Sache an-nehme[n]«.30 Schließlich, so die Denkschrift, ließe sich dadurch auch die ma-terielle Lage der Privatdozenten verbessern.
Der Vorschlag wurde im Jänner 1894 vom Akademischen Senat angenommenund ein Komitee eingesetzt, das unter Leitung des Rechtswissenschafters AntonMenger ein Statut ausarbeitete, welches nach Begutachtung des AkademischenSenats am 14. Oktober 1895 vom Unterrichtsministerium genehmigt wurde,31
nachdem zuvor Finanzminister Ernst von Plener das Vorhaben »im Interesse desallgemeinen öffentlichen Wohls […] mit Befriedigung begrüßt«32 hatte. Nach-dem ein elfköpfiger »Ausschuß für volkstümliche Universitätsvorträge der k.k.Universität Wien« unter Vorsitz von Anton Menger eingesetzt worden war, desnunmehrigen neuen Rektors der Universität Wien, der sich zeitgleich auch fürdie Nachbesetzung des vakanten Lehrstuhls für Philosophie engagierte,33 be-gann am 16. November 1895 das erste Programm der »volkstümlichen Univer-sitätsvorträge«, bei denen alle Fragen, die sich auf »die politischen, religiösenund socialen Kämpfe beziehen«34, strikt ausgeschlossen waren. Ziel der jeweilszu sechs Vorträgen zusammengefassten »Curse«, die »außerhalb des Universi-tätsgebäudes abgehalten und in das amtliche Vorlesungsverzeichnis nicht auf-genommen« wurden, war laut Paragraf 1 des Statuts die »Förderung der wis-senschaftlichen Ausbildung jener Volkskreise, welchen bisher die akademischeBildung unzugänglich war«35.
Als Auftakt zum Start der Wiener »University Extension« hielten die Uni-versitätsprofessoren Albrecht Penck, Ludwig Boltzmann, Ludwig Mitteis undMax Gruber »vor überaus zahlreichem Publikum, das zum größten Teil ausArbeitern beiderlei Geschlechts bestand«, wie die Arbeiter-Zeitung berichtete,
29 Keilhacker, Das Universitäts-Ausdehnungs-Problem, 30.30 Ebd., 31.31 Ebd.32 Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 35.33 Budget-Ausschuß, Neue Freie Presse, 27. 11. 1895, 2. Den Lehrstuhl für Philosophie mit
besonderer Berücksichtigung der Geschichte und Theorie der induktiven Wissenschaftenübernahm 1895 schließlich Ernst Mach.
34 Volksthümliche Universitäts-Curse in Wien, Die Presse, 26. 10. 1895, 9.35 Statut für die Einrichtung volkstümlicher Universitätsvorträge durch die Wiener Universität,
abgedruckt in: Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 133.
Christian H. Stifter298
einleitende Sonntagsvorträge »über verschiedene wichtige Wissenschaftsge-biete«. So sprach etwa Penck im Gemeindesaal des III. Wiener Gemeindebezirks»in plastischer Weise« unter Vorführung von Bildern »durch das elektrischbeleuchtete Skioptikon« über die »Schönheit der Erde«, Boltzmann im Ge-meindesaal des IX. Bezirks über »Wärme«, der Romanist Mitteis über »Römi-sche Geschichte« und Obersanitätsrat Gruber »in seinem Hörsaal im hygieni-schen Institut« über »Urzeugung«.36 In seinen einleitenden Worten betonteGruber, dass die Universität nun den Versuch machen wolle, »all denen, die nichtso glücklich sind, akademische Bildung genießen zu können, diese in Abend-kursen zugänglich zu machen.« Zum Zweck einer gründlicheren Vertiefungwürden auch Bücher zur Verfügung gestellt, zum Schluss der Kurse Prüfungenabgehalten und Zeugnisse erteilt. Wie Gruber resümierte, mache die Universitätsich jedoch nicht aus Eigeninteresse zur »Lehrerin für breite Kreise der Bevöl-kerung«, sondern von einem »höheren Standpunkte« aus:
»Die höchsten Güter der Kultur drohen immer d e r B e s i t z e i n e r k l e i n e nG r u p p e z u w e r d e n […], e s i s t d a h e r d a s g r ö ß t e I n t e r e s s e d e s S t a a t e s ,d i e s e K l u f t z u ü b e r b r ü c k e n u n d d i e Wi s s e n s c h a f t z u m E r b t h e i l d e sg a n z e n Vo l k e s z u m a c h e n . (Stürmischer Beifall).«37
4. Programmatik, Klientel, Didaktik und bildungspolitischeZielsetzungen der University Extension
Programmatisch war damit der Kern der spätaufklärerischen Bemühungen umeine Versöhnung der Klassen ausgesprochen, die sich von der Vergesell-schaftung von Wissenschaft und Bildung eine friedliche Lösung der sozialenFrage ebenso erhoffte wie einen volkswirtschaftlichen Benefit für das Staats-ganze. Dementsprechend hatte anlässlich der Einrichtung der University Ex-tension auch der liberale Abgeordnete Armand Freiherr von Dumreicher daraufhingewiesen, die »naturwidrige Trennung von Kopf und Arm«, die »Aus-schließung des Arbeiterstandes vom geistigen Inhalte seines eigenen Tuns« imSinne des kollektiven Nutzens für das Volkswohl aufzuheben.38
Noch deutlicher brachte der Philosoph, Präsident des Monistenbundes unddritte Obmann des Wiener Volksbildungsvereins, Friedrich Jodl39 die Annahme
36 Die volksthümlichen Universitätskurse, Arbeiter-Zeitung, 11. 11. 1895, 2.37 Ebd., 3. Sperrung im Original.38 Zitiert nach: Josef Loos, Studenten im Dienste der Volksbildung. Ein Beitrag zur Lehrer-
bildungsfrage, Linz: Selbstverlag 1909, 6.39 Friedrich Jodl folgte nach dem Tod des Historikers Alfred von Arneth als Vereinsobmann
nach. Siehe: Hans Altenhuber/Aladar Pfniß (Hg.), Bildung. Freiheit. Fortschritt. Gedankenösterreichischer Volksbildner, Wien: Verband Österreichischer Volkshochschulen 1965, 87.
Universität, Volksbildung und Moderne 299
einer direkten sozialintegrativen Wirkung von wissenschaftsorientierterVolksbildung zur Sprache, indem er postulierte, dass »jeder Klassendünkel einZeichen von Unbildung« sei, da dieser in der Unfähigkeit liege, »über sich hinausins Allgemeine zu blicken, die eigene Person und den eigenen Lebenskreis insLicht des großen Kulturzusammenhangs zu rücken«40 – ein sozialevolutionäresLeitmotiv, das Ludo M. Hartmann, seit 1898 geschäftsführender Sekretär der»University Extension«, mit seiner Vision einer »Verbrüderung« von Wissen-schaft und Arbeit teilte. Wie Hartmann in seiner 1893 verfassten Denkschrift anden akademischen Senat programmatisch formuliert hatte, sollten ab nun vonder Universität als »Brennpunkt der Wissenschaft […] Strahlen ausgehen, dieauch den exoterischen Kreis der Bevölkerung«41 erleuchten sollten.
Tatsächlich schienen die in der damaligen Gesellschaft sonst überall existie-renden sozialen Scheidewände unter den Teilnehmenden der Volksbildungs-kurse zumindest ein stückweit aufgehoben.42 Das fleißig Aufzeichnungen ma-chende Publikum – jeweils rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer – der ersteneinstündigen volkstümlichen Universitätskurse über »Bakteriologie«, »Physio-logie des Menschen«, »Grundzüge des Österreichischen Rechts« und »Darstel-lende Geometrie«, die um acht Uhr abends begannen und anschließend dieMöglichkeit zur Diskussion vorsahen, charakterisierte das Neue Wiener Journalals sozial, alters- und geschlechtermäßig »kunterbunt« zusammengesetzt : »Dasweibliche Geschlecht machte die Hälfte der Hörer aus […] wir sehen Hand-lungsgehilfen, Arbeiter, Beamte, und Kaufleute, Lehrer und Privatiers. Wir be-merken einige Grauköpfe.«43
Die zu einer sehr günstigen Gebühr von einer Krone pro Zyklus angebotenenKurse – die Vortragenden erhielten 180 Kronen pro Kurs plus Vergütung all-fälliger Reisekosten –, die außer an Universitätsinstituten44 auch an Schulen und
40 Friedrich Jodl, Was heißt Bildung? Vortrag gehalten anlässlich der Eröffnung des vomWiener Volksbildungsverein erbauten Volksbildungshauses, in: Altenhuber/Pfniß (Hg.),Freiheit – Bildung – Fortschritt, 82.
41 Rektoratsakten der Wiener Universität, 1893/94, Nr. 1119, Einreichungsdenkschrift zur Er-richtung volkstümlicher Universitätskurse, zitiert nach: Gerhardt Kapner, Die Erwachse-nenbildung um die Jahrhundertwende, dargestellt am Beispiel Wiens, Wien: Notring 1961, 9.
42 Der Anteil von Teilnehmenden mit lediglich Volksschulabschluss lag bei den ersten Kurs-Zyklen bis zum Semester 1897/98 bei 5,6 %, jener mit Bürgerschulabschluss bei 8,6 %. DerAnteil von Arbeiterinnen und Arbeitern lag bei rund 25 %, der Anteil von Frauen stieg vonanfänglich rund 27 % bis 1905/06 auf 54 %. Vgl. Statistik der Hörer der VolkstümlichenUniversitäts-Curse in den Jahren 1895/96 bis 1905/06. Österreichisches Volkshochschular-chiv (ÖVA), B-University Extension, Kt. 130/1.
43 Die Universität für das Volk, Neues Wiener Journal, 12. 11. 1895, 4.44 So standen etwa die Hörsäle des physikalischen, des anatomischen, des physiologischen, des
hygienischen, des pathologisch-chemischen Institutes ebenso zur Verfügung wie das»Zweite chemische Universitätslaboratorium«. Siehe: Keilhacker, Das Universitäts-Ausdeh-nungs-Problem, 34.
Christian H. Stifter300
anderen kommunalen Lokalitäten, in Räumlichkeiten der industriellen Be-zirkskommissionen oder jener der Gewerkschaften und Arbeiterbildungsver-eine abgehalten wurden, fanden jedenfalls rasch großen Zulauf. Allein in Wienstieg die Zahl der abgehaltenen Semesterkurse bis zur Jahrhundertwende auf 77an, mit einer Gesamtzahl an 9.500 Hörerinnen und Hörern, wobei die Dropout-Rate gering war – nahezu drei Viertel der Eingeschriebenen waren auch noch inden letzten Vorträgen der Kurse anwesend. Wie Hartmann festhielt, übertraf dieEntwicklung »sogar die anfänglichen Erfolge der University Extension in Eng-land«,45 wobei von den ab 1900 in Wien eingeführten fakultativen Abschluss-prüfungen weniger als vier % Gebrauch machten, und wenn, dann hauptsächlichim Zusammenhang beruflicher Zusatzqualifikationen in Gegenständen wieElektrotechnik, Mechanik, Physik oder Chemie.
Das Hauptinteresse der Hörerinnen und Hörer – die bald ihre Scheu vor derDiskussion überwanden und sich, »namentlich in Arbeitergegenden«, oft »sehrlebhaft«46 einbrachten – lag über viele Jahre bei den naturwissenschaftlichenund medizinischen Fächern, gefolgt von Geschichte, Rechtswissenschaften,Mathematik und Technik, Philosophie, Literatur-, Sprach- und Kunstwissen-schaften sowie Geografie und Völkerkunde.47
Bereits ein Jahr nach Einführung der volkstümlichen Universitätsvorträge inWien folgte 1896 die Universität Innsbruck diesem Beispiel, 1897 schließlichauch die Universität Graz bis es nachfolgend in rascher Folge auch in Brünn(1898), in Krakau (1899), in Budapest (1901), in Prag (1902), in Salzburg (1903)und 1905 in Czernowitz übernommen wurde.48
Neben der Organisation volkstümlicher Vorträge in einer Reihe kleinererStädte hielt die »Vereinigung österreichischer Hochschuldozenten« ab 1899 aufAnregung Hartmanns zu Fortbildungszwecken auch Ferialkurse für Mittel-schul- und bald auch für Volks- und Bürgerschullehrer ab.49 Darüber hinausübernahm die Vereinigung der Hochschuldozenten ab Oktober 1903 auch dievom Verleger Moriz Szeps drei Jahre zuvor gegründete Zeitschrift Das Wissen fürAlle,50 die das bisherige Programm fortführte und sich nun als offizielles Organder österreichischen University Extension der Aufgabe widmete, volkstümliche
45 Ludo M. Hartmann, Zur Ausgestaltung der volkstümlichen Universitätskurse, in: Zentral-blatt für Volksbildungswesen 1 (1900) 1 – 2, 17.
46 Ebd., 19.47 Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 69.48 Keilhacker, Das Universitäts-Ausdehnungs-Problem, 49 – 50.49 Ebd., 46.50 Siehe dazu im Detail : Klaus Taschwer, Das Wissen für Alle. Annäherungen an das popu-
lärwissenschaftliche Zeitschriftenwesen um 1900, in: Relation. Medien/Media – Gesellschaft/Society – Geschichte/History, Sonderdruck, hg. von der Österreichischen Akademie derWissenschaften, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997, 1 –33.
Universität, Volksbildung und Moderne 301
Hochschulvorträge in populärwissenschaftlichen Einzelaufsätzen möglichstweiten Kreisen zugänglich zu machen.51
Der große Erfolg der volkstümlichen Vorträge gründete – außer in derzweifellos großen »Wißbegierde« der breiten Bevölkerung und der geradezuexotischen Anziehungskraft, die öffentlich zugängliche Vorlesungen teilshochrangiger Gelehrter unter der Ägide der Universität wohl hatten – sicherauch in der besonderen fachlich-didaktischen Qualität jener Vorträge. Diesehätten sich, wie der Geologe, Schüler von Eduard Suess und Volksbildungs-pionier Eduard Reyer52 programmatisch forderte, von denen regulärer Univer-sitätsvorlesungen wesentlich zu unterscheiden: »Die von Fremdwörtern strot-zende Sprache des Akademikers ist ebenso verwerflich wie der hochtrabendeverwickelte Satzbau mancher liberaler Rhetoren.«53 Und Reyer weiter :
»Es begreift sich, daß mancher Universitätsprofessor, welcher alle Nachteile einesbeschränkten Spezialisten mit jenen eines schlechten Pädagogen vereint, Mißerfolgeerzielt, sobald er vor ein großes Publikum tritt. Man wird solche Kräfte übergehen undsich an jene Dozenten halten, welche als Lehrer Hervorragendes leisten.«54
Obwohl nicht wenige Universitätsangehörige der staatlich finanzierten Aus-dehnung der Universitäten ablehnend gegenüberstanden und manche das Po-pularisieren der Wissenschaften »mit Hohn und Spott lächerlich zu machen«versuchten, indem sie dies mit »Verflachung und Seichtigkeit« gleichsetzten,55
sah Hartmann in den volkstümlichen Vorträgen die größte Herausforderung fürVortragende: Generell müssten diese aus der Forschung kommen, da nur derspezialisierte Universitätslehrer – »wenn er einmal populär vorzutragen gelernthat« – in ausreichend engem Verhältnis mit seinem Gegenstand und – im bestenFall – »über dem Lehrstoff« stünde.56 Damit nicht genug, so Hartmann weiter,wäre »der beste Forscher, der beste Lehrer und der beste Redner gerade gutgenug für die ungeheuer schwierige Aufgabe, die ihm gestellt wird. DieseKombination ist nun allerdings selten genug […]«57.
51 Das Wissen für Alle. Volksthümliche Vorträge und populärwissenschaftliche Rundschau, in:Zentralblatt für Volksbildungswesen 4 (1903) 1 – 2, 14.
52 Reyer war Wegbereiter des öffentlichen Büchereiwesens in Wien und Gründer des »VereinsZentralbibliothek«, der in der Zwischenkriegszeit größten Leihbücherei. Siehe: PeterVodosek, Eduard Reyer, 1849 – 1914, Berlin: Deutscher Bibliotheksverband 1976.
53 Eduard Reyer, Handbuch des Volksbildungswesens, Stuttgart: J. G. Cotta 1896, 94.54 Ebd., 97.55 Wilhelm Rein, Volkshochschulen [1897], in: Krüger (Hg.), Wissenschaft, Hochschule und
Erwachsenenbildung, 63.56 Hartmann, Ausgestaltung, 19.57 Ludo M. Hartmann, Das Volkshochschulwesen. Seine Praxis und Entwicklung nach Erfah-
rungen im Wiener Volksbildungswesen, hg. vom Dürer-Bund (Flugschrift zur Ausdrucks-kultur 66), München u. a.: Callwey 1910, 1, abgedruckt in: Altenhuber/Pfniß (Hg.), Bildung –Freiheit – Fortschritt, 117.
Christian H. Stifter302
Um diesem in der universitären Realität freilich selten anzutreffenden Idealwenigstens ansatzweise näherzukommen, wurde ab dem Semester 1896/97jedem Vortragenden der volkstümlichen Universitätsvorträge – quasi eine früheund innovative Qualitätssicherungsmaßnahme – eine Anleitung über die »ge-eignetste Art des Unterrichts« in die Hand gegeben. Darin heißt es:
»Der Vortragende darf keine Kenntnisse in dem von ihm vorgetragenen Wissensgebietevoraussetzen und soll namentlich auch technische Ausdrücke und Fremdworte ver-meiden, bis er sie erklären konnte. Er wird gut daran tun, überall, wo es angeht, anVorgänge anzuknüpfen, die den Hörern aus der Erfahrung des täglichen Lebens be-kannt sind«58.
Darüber hinaus sollten die Vortragenden möglichst frei sprechen, da »alle Er-fahrungen beweisen, dass gelesene Vorträge die Hörer abschrecken« und sichbemühen, »die anfängliche Schüchternheit der Schüler zur überwinden, indemer ihnen leichte Fragen stellt […]. Ferner soll er [der Vortragende, Anm. d. Verf.]die Hörer anfeuern, selbst Fragen zu stellen, die sich auf schwierige Teile desGegenstandes oder auf Gegenstände beziehen, die mit dem Vortrage im Zu-sammenhang stehen« – methodisch-didaktische Hinweise, die, wie HansAltenhuber zu Recht angemerkt hat, auch heute noch für Erwachsenenbildnergelten.59
Durch strikte Orientierung auf »voraussetzungslose«, »parteilose Wissen-schaftlichkeit« und das Bemühen, selbständiges »Denken zu lehren«, sollte – soLudo M. Hartmann – jeder »Dilettantismus in der Person und in der Sache«ebenso vermieden werden wie geistige Bevormundung oder ideologische Ein-flussnahme gegenüber den prinzipiell als »gleichwertig und gleichberechtigt«anzusehenden Teilnehmenden:
»Deshalb muß von unserem volkstümlichen Unterricht alles ausgeschlossen werden,was häufig missbräuchlich noch als Wissenschaft bezeichnet wird, aber eigentlich nurdie Lehre eines bestimmten politischen, religiösen, wissenschaftlichen Glaubens ist.[…] Denn nur auf die Weise kann das ärgste Produkt, das auf geistigem Gebiete erzeugtwird, vermieden werden, die Halbbildung […] Unbildung ist entwicklungsfähig, Bil-dung ist Entwicklung, aber Halbbildung ist Starrheit, Unbeweglichkeit.«60
Herangebildet werden sollten keine Spezialisten, die »irgendein wissenschaft-liches Steckenpferd reiten gelernt haben«, sondern allgemein gebildete, selb-ständig denkende Menschen mit Freude an der Erweiterung ihres geistigenHorizonts.61
58 Keilhacker, Das Universitäts-Ausdehnungs-Problem, 37.59 Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 83.60 Ludo M. Hartmann, zitiert nach: Altenhuber/Pfniß (Hg.), Bildung – Freiheit – Fortschritt,
116.61 Reich, Volkstümliche Universitätsbewegung, 27 bzw. 28.
Universität, Volksbildung und Moderne 303
Der Nutzen und Gewinn der volkstümlichen Universitätsvorträge liege aberletztlich keineswegs nur bei den Hörerinnen und Hörern, sondern auch bei derUniversität selbst, wie Hartmann mit Hoffnung auf die als dringend notwendigerachtete Modernisierung und Demokratisierung der Universitäten hervorhob.Schließlich wäre die Wiener Universität »erst durch die Einrichtung der volks-tümlichen Universitätskurse wirklich populär geworden« und werde nun nichtmehr als eine zur Erziehung der privilegierten Klassen, »sondern als eine ge-meinsame Angelegenheit aller Volksschichten betrachtet«.62 Ja mehr noch:neben der gestiegenen »Achtung nicht nur vor der Wissenschaft im allgemeinen,sondern auch speziell vor der Forschung«63 hätten die Hochschulen durch die»Extension« einen »gewaltigen Einfluß auf das öffentliche Leben und die öf-fentliche Meinung«64 bekommen. Und im Hinblick auf die Herausforderungender universitären Lehre gebe es für junge Dozenten »keine bessere Schule klarenVortrages und klarer Anordnung, keine bessere Art, in der er zu der Erkenntnisvon der Relativität unserer wissenschaftlichen Ausdrucksweisen kommenkönnte, als die volkstümlichen Universitätskurse«65.
Anlässlich seiner Rede zum Hochschulbudget hielt auch der Reichstagsab-geordnete Prof. Dr. Stanislaus Ritter von Starzynski vor dem Abgeordnetenhaus1902 fest, dass sich die »Zugänglichmachung der Wissenschaft an breitere Be-völkerungskreise und eine gewisse Popularisierung derselben […] fast in allenUniversitätsstädten glänzend bewährt«66 hat.
Dass die volkstümlichen Universitätsvorträge im »Interesse des öffentlichenWohles« wirkten und die sozialen »Scheidewände« »wenigstens in der ge-meinsamen Liebe für Kunst und Wissenschaft« zu Fall gebracht wurden, do-kumentierte sich für Emil Reich unter anderem darin, dass die Wiener Uni-versität am 1. Mai nicht, wie andere öffentliche Gebäude, durch starke Polizei-abteilungen geschützt werden musste; im Gegenteil sei vom vorbeidefilierendenDemonstrationszug der Ruf erschallt : »Hoch die Universität! Hoch die Wissen-schaft!«67
62 Hartmann, zitiert nach: Altenhuber/Pfniß (Hg.), Bildung – Freiheit – Fortschritt, 126.63 Ebd., 127.64 Reyer, Handbuch des Volksbildungswesens, 104.65 Hartmann, zitiert nach: Altenhuber/Pfniß (Hg.), Bildung – Freiheit – Fortschritt, 127.66 Bericht über die volkstümlichen Universitätsvorträge der Wiener Universität im Studien-
jahre 1901/02, in: Zentralblatt für Volksbildungswesen 3 (21. 8. 1902) 9/10, 130.67 Reich, Volkstümliche Universitätsbewegung, 32.
Christian H. Stifter304
5. Institutioneller Output der volkstümlichenUniversitätsvorträge – die erste »Volksuniversität« Wiens
Als größter Erfolg und nachhaltigste Auswirkung der Wiener Universitätsaus-dehnung – obendrein ein europaweit singuläres Ereignis68 – kann die Gründungder ersten »Volksuniversität«, der Volkshochschule Ottakring, im Jahr 1901angesehen werden, die 1905 bereits ihr eigenes Haus bezog.
Bei den besser vorgebildeten Hörerinnen und Hörern hatten die volkstüm-lichen Universitätsvorträge derart große Resonanz gefunden, dass 38 Teilneh-mende eines volkstümlichen Philosophiekurses bei Adolf Stöhr schließlich denWunsch äußerten, eine eigenständige Organisation zu schaffen, um noch in-tensivere, vertiefende Studien zu ermöglichen.69
Als Sekretäre der University Extension nahmen Hartmann und Reich dieseAnregung auf und stellten Überlegungen an, zunächst »ein kleines Heim, etwaeinige Zimmer in den westlichen Vororten […], in dem Lehrmittel, Bücher undDemonstrationsobjekte, konzentriert werden, als Sammelpunkt für die Ler-nenden und Lehrenden«70 zu schaffen. Hier sollten sich an jedem WochentagDozenten einfinden, um auf spezielle Fragen Auskunft zu geben, Lektürehin-weise zu geben, Fortbildungskurse zu halten und auch physikalische Experi-mente durchzuführen, für die – im Sinne einer »gründlichen Bildung« – eineigenes physikalisches Kabinett projektiert wurde, da die physikalischen Kurse»nicht immer in den physikalischen Hörsälen abgehalten werden« konnten undderen »gänzlich unbrauchbare« Bestuhlung und »unzureichende Raumver-hältnisse« ohnehin Probleme verursachten.71
Dass diese Anregung zur Schaffung einer Volksuniversität, wie Hartmannmeinte, »nicht als Utopie bezeichnet«72 werden musste, zeigte sich sehr rasch.Nachdem in den Wiener Bezirken Werbevorträge abgehalten worden waren und65 namhafte Wissenschafter, Literaten, Künstler und Schauspieler einen Aufrufzur Konstituierung einer »Volksuniversität« unterschrieben hatten,73 kam es im
68 Bereits die frühen Schriften über die University Extension in Wien verwiesen darauf, dass dieUniversitätsausdehnung in Deutschland nicht Fuß fassen konnte – wohl auch wegen derablehnenden Haltung der deutschen Professorenschaft sowie der besseren Besoldung derDozenten; die Gründung einer »Volksuniversität« als direkter institutioneller Output derUniversity Extension stellt zumindest unter europäischen Ländern einen Sonderfall dar. Vgl.dazu: Schäfer, Historische Vorläufer, 22.
69 Klaus Taschwer, Wissenschaft für viele. Zur Wissenschaftsvermittlung im Rahmen der WienerVolksbildung um 1900, phil. Diss., Wien 2002, 154.
70 Hartmann, Ausgestaltung, 21.71 Anton Lampa, Über Anlage und Nutzen einer physikalischen Sammlung für die Zwecke der
volkstümlichen Universitätskurse, in: Zentralblatt für Volksbildungswesen 1 (1900) 1 – 2, 23.72 Hartmann, Ausgestaltung, 21.73 So etwa die Universitätsprofessoren Edmund Bernatzik, Adolf Stöhr, Gustav Seidler, Al-
Universität, Volksbildung und Moderne 305
Ballsaal des Ronacher am 24. Februar 1901 zur konstituierenden Gründungs-sitzung des neuen Vereins, dem die Vereinsbehörde (niederösterreichischeStatthalterei) allerdings die Führung des Namens »Volkshochschule« untersagte,sodass die Vereinsleitung den weniger revolutionär anmutenden Vereinsnamen»Volksheim« wählen musste.74 Nach Anmietung verkehrstechnisch gut gelege-ner Souterrain-Räumlichkeiten im XV. Bezirk am Urban Loritz-Platz 1 erwarbder Verein, unterstützt durch zahlreiche private Spenden, 1903 ein Grundstückin Ottakring, Ecke Koflerpark (heute Ludo Hartmann-Platz), wo bereits am5. November 1905 in Gegenwart von »Sr. Magnificenz des Herrn Rektors« dasnach den Plänen des Architekten Ludwig Faigl fertig gestellte Gebäude – derersten Abend-Volkshochschule Europas – feierlich eröffnet werden konnte.
Sowohl die räumlichen Gegebenheiten – neben Hörsälen, einem im Vergleichzur Universität modern eingerichteten physikalischen und chemischen Labor,einem experimentalpsychologischen Labor, einem naturhistorischen und mi-neralogischen Kabinett, gab es eine umfangreiche Bibliothek samt großemZeitschriftenlesesaal und gut ausgestattete Fachbibliotheken mit Handappara-ten – als auch die verwendete Begrifflichkeit (»Dozenten«, »Hörerinnen« und»Hörer«, »Experimente«, ein eigener »Gaudeamus« etc.) verweisen auf dasidealtypische Vorbild eines demokratisch organisierten, nicht-autoritären uni-versitären Lehrbetriebs, bei dem die prinzipiell als gleichrangig angesehenenTeilnehmenden ihre Interessen und Wünsche über gewählte »Hörervertrau-ensleute« einbringen konnten;75 eine Konstitution, die sich programmatischauch im Wortlaut jener Urkunde findet, die in den Grundstein des Gebäudeseingebracht wurde, worin es heißt : »Arbeiter, Bürger und Hochschullehrergründeten den Verein Volksheim als eine Stätte höherer wissenschaftlicher
brecht Penck, Ernst Mach, Eduard Reyer, Max Gruber, Eduard Suess, Eugen von Philippo-vich, Karl Toldt, Heinrich Swoboda, Richard Wallaschek, Richard von Wettstein, EmilZuckerkandl, Friedrich Jodl, die Dozenten Julius Tandler, Karl Brockhausen, Ludo M.Hartmann, Anton Lampa, Emil Reich, Walter Schiff, Wilhelm Jerusalem, Eduard Leisching,die Schriftsteller Ferdinand von Saar, »Doctor« Marie von Ebner-Eschenbach und MarieEugenie delle Gracie sowie Rosa Mayreder, Marianne Hainisch, Isidor Himmelbauer, ElseFedern oder die Reichsratsabgeordneten Julius Ofner, Engelbert Pernerstorfer, GustavMarchet und Karl Seitz, die k. u. k. Hofschauspieler Georg Reimers und Josef Lewinsky, derFabrikant Albert Schwab oder der Obmann des Arbeiter-Bildungsvereines »Apollo«, KarlZwirner. Siehe: Wilhelm Bründl, Eigenart und Entwicklung der Wiener Volkshochschulen(Schriften zur Volksbildung 1), Wien: Bundesministerium für Unterricht o. J. [1962], 110 –111.
74 Ebd.75 Christian H. Stifter, Geistige Stadterweiterung. Eine kurze Geschichte der Wiener Volks-
hochschulen 1887 – 2005, Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz – edition seidengasse o. J.[2005], 54.
Christian H. Stifter306
Ausbildung und reichen künstlerischen Genusses für die breiten Schichten deswerktätigen Volkes.«76
Neben elementaren Fächern wie Lesen, Schreiben oder Rechnen und einemweiten Spektrum kreativer, musisch-künstlerischer sowie gesundheitsbezoge-ner Kurse bildete denn auch das wissenschaftszentrierte Bildungsangebot denHauptteil und inhaltlichen Schwerpunkt des systematisch aufbauenden Veran-staltungsprogramms dieser ersten »Volksuniversität«, an dessen Spitze wis-senschaftliche Fachseminare als methodische Innovation standen – die soge-nannten »Fachgruppen«,77 die für einen bis dahin völlig unbekannten Maßstabwissenschaftsorientierter Erwachsenenbildung sorgten. Dabei handelte es sichum intensive fachliche Arbeitszusammenschlüsse von Experten und Laien, dieinteraktiv und egalitär zum Teil über viele Jahre hinweg forschten und derenErgebnisse in Einzelfällen sogar publiziert wurden.
Da die Gründung der neugeschaffenen »Volkshochschule« Ottakring wennauch nicht organisatorisch-institutionell, so doch konzeptionell und ideell indirektem Zusammenhang mit der University Extension stand, wurden gleichvon Beginn an neben geisteswissenschaftlichen insbesondere naturwissen-schaftliche Kurs-Zyklen zu Übungs- und Demonstrationszwecken am neuenStandort abgehalten.78 Immerhin hatte der akademische Senat der Universitätgestattet, dass eine Lieferung von Büchern und Apparaten für die Zwecke desVolksheims als »Sammelpunkt für das Stammpublicum der volksthümlichenUniversitätscurse« zur Verfügung gestellt wurde, um »das in den Universi-tätskursen gebotene Wissen noch zu vertiefen und zu ergänzen.«79
Abgesehen von Universitätsinstituten und Schulen wurden die volkstümli-chen Universitätskurse in den folgenden Jahren auch weiterhin in einer Vielzahlunterschiedlicher Räumlichkeiten und Lokalitäten abgehalten, die von der Ge-meinde Wien, der Südbahngesellschaft, dem Technischen Gewerbemuseumoder der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft unentgeltlich zur Verfügung ge-stellt wurden, weil die Mittel stets knapp waren.
Trotz Anhebung der staatlichen Subvention auf 17.000 Gulden im Jahr 1912,gerieten die volkstümlichen Kurse, die in den Jahren zwischen 1906 und 1910
76 Bründl, Eigenart und Entwicklung, 112.77 Siehe im Detail dazu: Wilhelm Filla, Wissenschaft für alle – ein Widerspruch? Bevölke-
rungsnaher Wissenstransfer in der Wiener Moderne. Ein historisches Volkshochschulmodell,Innsbruck–Wien–München: Studien-Verlag 2001.
78 So z. B. Fortsetzungskurse in Biologie, chemische, experimentell-psychologische oder psy-chophysikalische Übungen. Siehe: Bericht über die volksthümlichen Universitätsvorträgeder Wiener Universität im Studienjahr 1901/02, in: Zentralblatt für Volksbildungswesen 2/3(21. 8. 1902) 9/10, 138 – 139.
79 Bericht über die volksthümlichen Universitätsvorträge im Studienjahre 1900/01. Statistik fürdie Jahre 1898/99 – 1900/01, Wien: Universität Wien 1901, 13.
Universität, Volksbildung und Moderne 307
mit rund 18.000 Teilnehmenden ihren quantitativen Höhepunkt erreichten,80
unter anderem auch durch Ausweitung der Wander- und Lehrer-Ferialkurse anweiter entfernt liegende Orte wie Bielitz, Troppau, Mährisch-Ostrau oderTeschen, wiederholt in eine schwierige finanzielle Lage,81 die aber durch Pri-vatspenden immer wieder bereinigt werden konnte.
6. Veränderungen während des Ersten Weltkrieges
Neben der idealtypischen Orientierung der Bildungsarbeit an wissenschaftlicherObjektivität und »voraussetzungsloser« Rationalität war die weltanschaulich-politische »Neutralität« das zweite zentrale Prinzip der wissenschaftszentrierten»Wiener Richtung« der Volksbildung. Diese gab – im Unterschied zur Ent-wicklung in Deutschland – bis in die Erste Republik der »Schulung durch daswissenschaftliche Denken«82 den klaren Vorzug gegenüber einer deutsch-völ-kischen Gefühls- und Gemeinschaftsbildung (»Formung durch Volkheit«83) undder hier präferierten sittlich-seelischen und bodenständigen Synthese desdeutschen »Volksganzen« (Walter Hofmann). Auch wenn das 1897 nach demBerliner Vorbild ins Leben gerufene »Volksbildungshaus Wiener Urania« alsdrittes »Stammhaus« der Wiener Volkshochschulen nicht im selben Maße striktwissenschaftsorientiert agierte wie die volkstümlichen Universitätskurse oderdie Volkshochschule Ottakring, blieb der Lehrbetrieb hier, wie auch im WienerVolksbildungsverein, frei von parteipolitischer Programmatik und ideologi-scher Beeinflussung;84 ohne Zweifel war die zentral gelegene Wiener Urania, diefrüh auf die mediale Anziehungskraft von »Sensationsfilmen« und anschauli-chen Lichtbildervorträgen setzte, die von einem Massenpublikum frequentiertwurden,85 ein weitaus interessanteres Objekt für politische Überformungsver-suche.86
80 Taschwer, Wissenschaft für viele, 114.81 Bericht über die volkstümlichen Universitätsvorträge der Wiener Universität im Studienjahr
1911/12, Wien: Universität Wien 1912, 107.82 Lampa, Kritisches zur Volksbildung, 13.83 Ebd., 38 – 39.84 Dessen ungeachtet sah die Sozialdemokratie – trotz Kritik an der »Neutralität« in den
Volkshochschulen »geistige Rüstkammern« für die eigene politische Klientel. Zitiert nach:Vorwärts, 28. 10. 1910. ÖVA, Zeitungsausschnittesammlung, B-Volksheim Ottakring.
85 Siehe: Christian H. Stifter, Der Urania-Kulturfilm, die Exotik des Fremden und die Völ-kerversöhnung. Veränderungen und Kontinuitäten: vom Austrofaschismus, über den Na-tionalsozialismus zur Zweiten Republik, in: Spurensuche 13 (2002) 1 – 4, 114 – 148.
86 So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Wiener Urania zunächst zu einer Film-bühne des Austrofaschismus und nach dem »Anschluss« zum Sitz des »Gauvolksbildung-samtes« wurde. Siehe dazu: Walter Göhring, Volksbildung in Ständestaat und Ostmark.
Christian H. Stifter308
Bis zum Ersten Weltkrieg war das Hartmannsche Diktum, diese Form vonVolksbildung habe »fern aller und jeder Politik« zu stehen, wie er dies 1905anlässlich der Eröffnung der Volkshochschule Ottakring formuliert hatte,87 trotzeiner Vielzahl an politischen Angriffen, Rekatholisierungsversuchen und Sub-ventionskürzungen unter Bürgermeister Karl Lueger,88 keinen schweren pa-triotischen beziehungsweise staatspolitischen Belastungsproben ausgesetzt. Die»absolute Unparteilichkeit«, wie Hartmann dies zu einem späteren Zeitpunktformulieren sollte, richtete sich zwar primär gegen direkte politische Instru-mentalisierung der Bildungsarbeit, ließ dabei aber auch keinen Spielraum füroffenen Antisemitismus, Rassismus, Militarismus, Autoritätsgehorsam oderNationalitätenhass.89 Unter Ausklammerung der genannten Elemente steht al-lerdings außer Frage, dass das Hochhalten deutscher Kultur sowie deutsch-nationale Einstellungen auch innerhalb der Pioniergeneration der wissen-schaftsorientierten Volksbildung fest verankert waren, wenn auch zumeist, wiezum Beispiel bei Ludo M. Hartmann, auf Basis des Selbstbestimmungsrechtesder Völker noch auf dem Boden der Monarchie und in grundsätzlich liberal-republikanischer Ausprägung.90
Obwohl Hartmann sich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht an demgrassierenden Chauvinismus und der Kriegshysterie beteiligte, sondern »gegendie zügellose Kriegspropaganda schrieb« und das Ultimatum an Serbien als»verbrecherischen Leichtsinn« verurteilte,91 nahm er doch als Sekretär dervolkstümlichen Universitätsvorträge bereits in den ersten Kriegsmonaten einenKurswechsel vor, indem er das Programm an der »Vaterlandsverteidigungspo-litik« ausrichtete und dabei fallweise auch bellizistische Töne anschlug, etwawenn er in der Arbeiter-Zeitung den Krieg als Kampf »gegen Unkultur« und den»geistigen Stumpfsinn des russischen Muschiks« bezeichnete.92
Wie bei dem staatlich finanzierten Programm der University Extension nichtweiter verwunderlich, führten die »ausserordentlichen Verhältnisse desKriegsjahres« dazu, dass nun Vorträge und Kurse abgehalten wurden, »welche
Österreich 1934 – 45 (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Er-wachsenenbildung 2), Mattersburg 1985, 151 – 154. [Manuskript im ÖVA].
87 Ludo Moritz Hartmann, Der Morgen, 25. 12. 1910. ÖVA, B-Volksheim Ottakring, K 9, Ge-schichte des Volksheims in Zeitungsausschnitten, 1901 – 1912.
88 Siehe: Wilhelm Filla, Protest gegen finanzielle Pressionen. Der Kampf des Wiener Volks-bildungsvereines gegen Subventionskürzungen vor 100 Jahren, in: Spurensuche 7 (1996) 1,46 – 55.
89 Christian Stifter, Rassismus und populäre Wissenschaft. Vorläufige Anmerkungen zur Po-sition der neutralen Volksbildung, 1890 – 1930, in: Spurensuche 11 (2000) 3 – 4, 36 – 66.
90 Oliver Rathkolb, Ludo Moritz Hartmann – Sozialdemokratischer Politiker und Diplomat:Republikaner und Deutschnationaler, in: Filla/Judy/Knittler-Lux (Hg.), Aufklärer und Or-ganisator, 54.
91 Fellner, Ludo Moritz Hartmann, 265, zitiert nach: Rathkolb, Ludo Moritz Hartmann, 54.92 Ludo M. Hartmann, Die Volksbildung im Kriege, Arbeiter-Zeitung, Nr. 270, 29. 9. 1914, 6.
Universität, Volksbildung und Moderne 309
sich ihrem Inhalte und ihren Einrichtungen nach den besonderen Bedürfnissendes Kriegsjahres anzupassen suchten.«93 So lauteten die Themen der Vorträgejetzt »Die feindlichen Länder I. : Russisches Reich inkl. Sibirien, Turan, Kaukasus(mit Demonstrationen und Lichtbildern)«, »Die Wirtschaft in Kriegszeiten«,»Die Physik im Kriege (mit Demonstrationen und Experimenten)« oder »Wieverhüten wir die Invalidität unserer Kriegsverwundeten? (mit Demonstrationenund Lichtbildern)«, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diese direkte »Berücksichtigung der Kriegsgegenstände«94 veränderte sichjedoch, als die staatliche Subvention halbiert wurde und die Besucherzahlendeutlich zurückgingen und sich somit – so der offizielle Wortlaut – herausstellte,»dass es weiten Kreisen der Bevölkerung ein Bedürfnis ist, wenigstens anAbenden sich in geistige Gebiete zurückzuziehen, die von dem Kriege nichtunmittelbar berührt sind, um sich dadurch von den Spannungen und Aufre-gungen des Tages zu erholen.«95
Anders als bei den anderen der genannten Wiener Volksbildungseinrich-tungen, die keineswegs so deutlich auf nationalen »Kriegskurs« einschwenkten,blieb die Leitung der volkstümlichen Universitätskurse bis Kriegsende sichtlichdarum bemüht, sich dem »k.k. Heere in erhöhtem Maße dienstbar« zu machenund schlug dabei – so der Professor für Geografie und damalige Obmann EduardBrückner – auch »unmittelbar nützliche Kurse« zu Feld-Hygiene oder Kriegs-geografie vor sowie »Vorträge an der Front oder in der Etappe«96. Infolge desdann baldigen Kriegsendes blieb die im Juli 1918 erfolgte Zustimmung des k.k.Armeeoberkommandos in Baden, die University Extension zum Zweck derFeindpropaganda-Abwehr einzusetzen, ohne Folgen.97
7. Langsames Ende in der Ersten Republik
Knapp vor dem sich abzeichnenden Ende des Ersten Weltkrieges berief dieUniversität Wien – allem Anschein nach im weiteren Kontext der Überlegungenzur Einrichtung eines Volksbildungsamtes im Unterrichtsministerium nachKriegsende98 – eine »Volksbildungstagung« ein, die vom 1. bis 2. November 1918
93 Bericht über die volkstümlichen Universitätsvorträge der Wiener Universität im Studienjahr1914/15, Wien: Universität Wien 1915, 1.
94 Bericht über die volkstümlichen Universitätsvorträge der Wiener Universität im Studienjahr1915/16, Wien: Universität Wien 1916, 2.
95 Ebd.96 Taschwer, Wissenschaft für viele, 205.97 Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 62.98 Lorenz Mikoletzky, »Es wäre gewiß erstaunlich zu erfahren, wie viele Menschen … sich unter
dem Namen … Urania … überhaupt nichts vorstellen können«. Einer von vielen Beiträgender Wiener Urania zum gesamtösterreichischen Volksbildungswesen, in: Wilhelm Petrasch
Christian H. Stifter310
im kleinen Festsaal der Universität Wien stattfand und an der Vertreter ver-schiedener Körperschaften, Vereine und Institutionen teilnahmen. Die Zur-verfügungstellung der Lokalität verdankte sich, wie Rektor Friedrich Becke ei-gens hervorhob, keineswegs bloß einer Gefälligkeit, sondern war der »vollenAufmerksamkeit«, welche die Universität dem Volksbildungswesen »seit langerZeit« entgegenbrachte, geschuldet. Die bisherige gute Zusammenarbeit desAusschusses der volkstümlichen Universitätskurse mit den »freien« (d. h. wis-senschaftsorientierten) Volksbildungsvereinen wie dem Wiener Volksbil-dungsverein, dem Volksheim Ottakring oder dem Verein Zentralbibliothek –außer durch die »Gleichheit der Ziele« auch »vielfach durch Personalunionverbunden«99 – sollte als »bewußte Gegenwehr gegen die schmutzige Welle vonHaß, Lüge und schnöder Selbstsucht« in den Kriegsjahren neu belebt werden.Unter Führung der Wiener Universität, welcher »Unparteilichkeit, Unabhän-gigkeit und wissenschaftlicher Ernst in gleicher Weise zur Seite« stünden, sollte– so Becke – »durch planvolles Zusammenarbeiten mit allen Korporationen, diesich um Volksbildung bekümmern«, nun in losem Zusammenhang ein»Volksbildungsausschuß für den Sprengel der Wiener Universität« als neues»Zentrum« geschaffen werden, wobei an die nachfolgende Einrichtung analogerAusschüsse »an den anderen Universitäten Deutschösterreichs« gedacht war.100
Als Aufgaben dieser neu zu schaffenden universitären »Volksbildungszen-tren« wurden, neben der künftigen Supervision der lokal-regionalen volks-bildnerischen Agenden, die Zentralisierung des Volksbüchereiwesens, die»Heranbildung« qualifizierter Volksbildner – Hartmann hatte sich bereits 1908für die Einrichtung von »Volksprofessuren«101 ausgesprochen –, der Ausbau derLehrerfortbildung, die Einrichtung von Regionalversammlungen sowie dieGründung weiterer Volksbildungshäuser, auch in ländlichen Gebieten, debat-tiert. Insbesondere in Wien sollten in Kooperation mit der Stadt Wien neben denbereits erfolgreich etablierten Institutionen weitere Volksbildungshäuser er-richtet werden102 – eine Dezentralisierungsidee, die allerdings erst Mitte der
(Hg.), 100 Jahre Wiener Urania. Festschrift, Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Uraniao. J. [1997], 31 – 35.
99 Friedrich Becke, Tagung für Volksbildungswesen, Neue Freie Presse, 2. 11. 1918, 7.100 Neben Graz, Innsbruck und Salzburg bezog der Rektor der Universität Wien zu diesem
Zeitpunkt hier nur mehr Prag bzw. »Deutschböhmen« mit ein.101 Ludo Moritz Hartmann, Volksprofessuren, in: Bericht über die Verhandlungen des III.
Deutschen Volkshochschultages am 27. April 1908 in Dresden in der Technischen Hochschule(veranstaltet vom Verbande für volkstümliche Kurse von Hochschullehrern des deutschenReiches und vom Ausschusse für volkstümliche Universitätsvorträge an der Wiener Uni-versität), Leipzig: Teubner 1908, 69 – 71.
102 Als erstes Projekt eines ländlichen Bildungsheimes dachte man an die Einrichtung eines»Landvolksheimes« in Niederösterreich, und zwar in einem der nach Kriegsende freiwer-denden militärischen oder hofärarischen Gebäude. Trotz der bis ins letzte Detail ausge-arbeiteten Pläne für eine ländliche Volkshochschule in Hainburg an der Donau – die im
Universität, Volksbildung und Moderne 311
1920-er Jahre durch eigenständige Zweigstellengründungen der StammhäuserRealität wurde.
Die zentral administrierte Gliederung auf regionaler Ebene, wie dies dann im»Glöckel-Regulativ« in Form bundesstaatlicher »Orts-, Kreis- und Landvolks-bildungsräte« konzipiert wurde,103 sah für die Universitäten eine führende Rollevor, als die Landesvolksbildungsräte nach Universitätsprengeln zusammenge-setzt sein sollten – so etwa sollten Wien, Niederösterreich, Oberösterreich undSalzburg den Sprengel der Wiener Universität bilden. Aufgrund des Widerstandsder Volksbildungsvereine gegen eine bürokratische Zentralisierung sowie auf-grund föderaler politischer Gegenkräfte kamen diese Pläne allerdings nie zurAusführung.104
In den Jahren der Ersten Republik nahm die Entwicklung der volkstümlichenUniversitätsvorträge einen entgegengesetzten Verlauf zu jenem der WienerVolkshochschulen, die durch finanzielle Unterstützung des »Roten Wien« ex-pandierten und die Hochblüte ihrer weiterhin wissenschaftszentrierten Bil-dungsarbeit erlebten. Die schwierige materielle und finanzielle Situation derUniversitäten nach Kriegsende, die Kürzung der staatlichen Subvention für dieUniversity Extension, die – wenn auch nur geringfügige – Verbesserung derfinanziellen Absicherung des universitären Mittelbaus sowie der ungeheureAufwind deutschnational-antisemitischer, völkisch-autoritärer sowie schließ-lich nationalsozialistischer Kräfte an den Universitäten führten letztlich zueinem drastischen Rückgang der Teilnahmezahlen um rund 80 %.105 Obwohl bisMitte der 1920-er Jahre – anders als an der Universität selbst – weder im Pro-gramm noch unter den Vortragenden eine klare Tendenz zu deutschnational-antisemitischer Ideologie erkennbar war,106 wandte sich insbesondere die Ar-beiterschaft von den volkstümlichen Universitätsvorträgen ab, die gegenüberden hochstrebenden und bald europaweit bewunderten Wiener Volkshoch-schulen zunehmend an Bedeutung verloren.
Sommer auch als Urlaubsheim für städtische Teilnehmende der University Extensiondienen sollte –, scheiterte dieses Projekt 1923 schließlich aus finanziellen Gründen. Siehe:Thomas Dostal, Bildung im Herrgottswinkel. Zu den ideellen und pädagogischen Grund-lagen von Architektur und Raumgestaltung ländlicher Heimvolkshochschulen am Beispieldes bäuerlichen Volksbildungsheims Hubertendorf 1928 bis 1938, in: Spurensuche 20/21(2012) 1 – 4, 155.
103 Vgl. Regulativ für die Organisation des Volksbildungswesens in Deutschösterreich. Ge-nehmigt mit Erlaß vom 30. Juli 1919, Z. 16.450, in: Volksbildung. Monatsschrift für dieFörderung des Volksbildungswesens in Deutschösterreich 1 (1919) 1, 8.
104 Altenhuber, Universitäre Volksbildung, 111.105 Und zwar von immerhin 11.274 im Wintersemester 1918/19 auf lediglich 2.400 im Win-
tersemester 1928/29. Siehe: Klaus Taschwer, Ende der Aufklärung? Die Entwicklung dervolkstümlichen Universitätskurse in Wien zwischen 1918 und 1937, in: Spurensuche 10(1999) 1 – 4, 110 – 111 bzw. 117.
106 Ebd., 112 – 113.
Christian H. Stifter312
Unter der Leitung des ersten Gründungsobmanns und Mineralogen FriedrichBecke107 sowie seinem Stellvertreter Ludo M. Hartmann entwickelte sich ins-besondere die Volkshochschule Ottakring in der Zwischenkriegszeit trotz dereuropaweiten »Krise der Wissenschaft« nach den Erfahrungen des Giftgas-krieges und der Weltwirtschaftskrise zu einer veritablen »Schattenuniversität«.
In der konservativ-katholischen Presse und in antisemitischen Hetzblätternverunglimpft,108 avancierte diese auf das Ideal »voraussetzungsloser Wissen-schaftlichkeit« orientierte Volksuniversität aufgrund ihrer organisatorischenFlexibilität, ihrer demokratischen Struktur und zahlreicher inhaltlicher undmethodisch-didaktischer Innovationen sowie der im Vergleich zur Universitätbesseren Ausstattung der Labors potenziell zu einer Institution mit bil-dungspolitischer Schrittmacherfunktion und Vorreiterrolle.109 Nicht nur fandhier eine Vielzahl linker Intellektueller, Künstler und jüdischer Wissenschaf-ter, für die sich aufgrund antisemitischer Diskriminierung eine Karriere instaatlichen Bildungsinstitutionen zunehmend schwieriger gestaltete, ein al-ternatives Betätigungsfeld, sondern die Offenheit gegenüber Wissenschaft,Künsten und Fragen der Alltagspraxis schuf ein Forum für progressive päd-agogische Methoden und wissenschaftliche Ansätze, die an der Universitätjener Zeit, wenn überhaupt, dann marginal Platz fanden. Als Beispiele sei aufdie Entwicklung der Experimentalpsychologie oder auf die Individualpsycho-logie,110 auf Ansätze einer modernen Kunstsoziologie, auf den LogischenEmpirismus des Wiener Kreises,111 auf prototypische Anläufe zu einer pro-
107 Friedrich K. Becke, international geachteter Professor für Mineralogie und Petrographie,von 1911 – 1929 Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften, Vorstandsmitglied desWiener Volksbildungsvereins, übte seine ehrenamtliche Funktion als Obmann der Volks-hochschule Ottakring bis 1929 aus. Wilhelm Filla, Weltbekannter Mineraloge und Volks-bildner. Ein Kurzportrait Friedrich Beckes (1855 – 1931), in: Spurensuche 4 (1993) 1, 17 – 23.
108 Außer der Reichspost, die sogleich über das neue »Etablissement« herzog (siehe: Ein»Volksheim«, Reichspost, 7. 11. 1905, 9), waren dies u. a.: Die Deutsche Volkswehr, dieDeutsche Zeitung oder das Deutsche Volksblatt.
109 Christian Stifter, Wissen und Macht. Anmerkungen zur Rolle und Funktion der Akade-misierung der »freien« Volksbildung in Österreich um die Jahrhundertwende, in: Spu-rensuche NF 9 (1998) 1 – 2, 19.
110 Vgl. Gerhard Benetka, Psychologie in Wien. Sozial- und Theoriegeschichte des WienerPsychologischen Instituts 1922 – 1938, Wien: WUV-Universitäts-Verlag 1995; weiters: ders.,Volksbildung und »Akademische Psychologie« oder : Wie ein relativ unbedeutendes Fach»populär« zu werden versuchte, in: Mitteilungen des Vereins zur Geschichte der Volks-hochschulen 4 (1993) 3 – 4, 14 – 19.
111 Siehe dazu: Friedrich Stadler, Wissenschaft ins Volk! Popularisierungsbestrebungen imWiener Kreis und »Verein Ernst Mach« von der Jahrhundertwende bis zum Ende der ErstenRepublik, in: Helmut Konrad/Wolfgang Maderthaner (Hg.), Neuere Studien zur Arbeiter-geschichte. Zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen des Vereines für Geschichte der Arbei-terbewegung, Bd. 3: Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte (Materialien zur Arbeiter-bewegung 35/3), Wien: Europaverlag 1984, 619 – 646; weiters: Wilhelm Filla, Die Volks-
Universität, Volksbildung und Moderne 313
funden Politischen Bildung112 sowie auf einzelne, bisher völlig unbeachtetgebliebene Modelle einer experimentell-heuristischen Vermittlung modernerMathematik verwiesen.113
In den Hörsälen und Studierzimmern der Wiener Volkshochschulen kreuztensich nicht nur die Ideen, Theorien und Konzepte der Moderne, sondern desAbends oft auch die Wege von deren Urhebern – die Veranstaltungsprogrammelesen sich heute wie das geistig-kulturelle »Who is who« der Monarchie undErsten Republik.114
Durch das wissenschaftsfeindliche, auf reaktionär-vormoderne »Persön-lichkeitsprägung«115 setzende autoritäre Dollfuß-Schuschnigg-Regime sowieschließlich und final durch die rassistische Indoktrinierung der nach dem»Anschluss« dem »NS-Gauvolksbildungswerk« unterstellten Volkshochschulenwurde der Entwicklung der wissenschaftszentrierten Wiener Volksbildung so-wohl personell als auch organisatorisch ein vernichtendes Ende gesetzt.
Die Vertreibung der künstlerischen, literarischen, und wissenschaftlichenIntelligenz des Landes hatte für die Volkshochschulen schwerwiegende Folgen.Neben den ehrenamtlichen Funktionären und den Hörerinnen und Hörernhatten viele der zur Emigration gezwungenen oder in Konzentrationslagernermordeten (jüdischen) Intellektuellen, Wissenschafterinnen und Wissen-schafter, Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftstellersowie Musikerinnen und Musiker durch ihr volksbildnerisches Engagemententscheidend zur Qualität und zum intellektuellen Flair der damaligen Volks-bildungshäuser beigetragen.
hochschule Volksheim in den zwanziger Jahren zwischen Austromarxismus und WienerKreis, in: Erwachsenenbildung durch Volkshochschulen in den 20er und 30er Jahren diesesJahrhunderts, 17. Konferenz des Arbeitskreises Historische Quellen der ErwachsenenbildungDeutschland–Österreich–Schweiz. Jena, 8.–11. Oktober 1997, Bonn: Deutscher Volkshoch-schul-Verband 1998, 35 – 48.
112 Tamara Ehs, Hans Kelsen und politische Bildung im modernen Staat. Vorträge in der WienerVolksbildung. Schriften zu Kritikfähigkeit und Rationalismus (Schriftenreihe des HansKelsen-Instituts 29), Wien: Manz 2007.
113 Filla, Wissenschaft für alle, 277 – 228.114 Siehe dazu die online gestellte Kurs- und Vortragsdatenbank der Wiener Volkshochschulen
1887 – 1960 (inklusive der Programme der University Extension) auf dem Webportal desÖVA, URL: http://www.vhs.at/vhsarchiv (abgerufen am 30. 1. 2015).
115 Das Volksbildungswesen der Stadt Wien unter Bürgermeister Richard Schmitz in den Jahren1934 – 1936, Wien: Magistrat der Stadt Wien 1937, 7.
Christian H. Stifter314
8. Späte Zusammenarbeit mit veränderter Zielrichtung ab 1998
Vor dem Hintergrund der 50-Jahr-Feier der »Volkstümlichen Universitätsvor-träge«,116 die am 13. Oktober 1945 im Auditorium Maximum festlich begangenwurde und bei der Staatssekretär Ernst Fischer und Rektor Ludwig Adamovichsr. Festreden hielten, plante die Rektorenkonferenz, »möglichst viele Hoch-schullehrer« für Veranstaltungen »im Rahmen der Volksbildungsstätten« zugewinnen, um dadurch zur »Hebung des allgemeinen kulturellen Niveaus«117
beizutragen. An jeder der Wiener Universitäten sollten Listen aufliegen, in diesich alle Professoren, Dozenten und Assistenten mit Namen und Wohnadresseeintragen sollten, die zur Übernahme eines Vortrages oder einer sonstigenMitwirkung bereit seien. Diese Initiative verlief allerdings bald im Sand.
Obwohl die »Volkstümlichen Universitätsvorträge« als vereinzelte Semes-tervorlesungen für »Hörer aller Fakultäten« nominell noch viele Jahrzehnte imoffiziellen Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien aufschienen, handelte essich dabei lediglich um eine fahle Reminiszenz an eine große Tradition, von derbald niemand mehr wusste.118
Erst 1998 wurde – freilich auf Grundlage völlig veränderter gesellschafts-politischer, sozialökonomischer und medialer Bedingungen – unter dem Namen»University Meets Public« auf Initiative des Dachverbands der Wiener Volks-hochschulen eine vertraglich geregelte Kooperation mit der Universität Wien insLeben gerufen, die als Teil einer Wissenschaftsstrategie der öffentlichen Handdie »traditionsreiche Zusammenarbeit in Form einer weitreichenden Koopera-tion neu zu beleben« beabsichtigte.119 Diese Kooperation – bei der die Univer-sitäten Partner sind und nicht, wie zuvor, Träger – hat sich bis heute auf eineReihe weiterer Universitäten zu einem »Science«-Programm ausgeweitet, un-terscheidet sich allerdings von dem früheren Modell der wissenschafts-zentrierten »Wiener Volksbildung« in mehrfacher Hinsicht. So verfügt die In-itiative »über keine vergleichbare gesellschaftliche Basis«, was sich auch in dendeutlich niedrigeren Teilnahmezahlen niederschlägt. Darüber hinaus umfasstdas Programmangebot keine Kurse beziehungsweise Kursserien, sondern bei-
116 Die Wiener volkstümlichen Universitätskurse. Ansprache anlässlich der Fünfzigjahrfeierim Auditorium Maximum am 13. Oktober 1945 von Rektor Adamovich, in: AkademischeRundschau 1 (1945) 3, 8.
117 Protokoll der 17. Sitzung des Akademischen Senats der Universität Wien, 2. 10. 1945, 3.Archiv der Universität Wien (UAW), Rektoratsakten, Akademischer Senat, 455 – 1944/45.
118 Hans Altenhuber, 100 Jahre universitäre Volksbildung. Kein Jubiläum zum Feiern, wohlaber zum Erinnern, in: Spurensuche 6 (1995) 3, 7.
119 Wilhelm Filla, Volkstümliche Universitätskurse – ein historisches wie aktuelles Modell derWissenschaftsverbreitung, in: Peter Faulstich (Hg.), Öffentliche Wissenschaft. Neue Per-spektiven der Vermittlung in der wissenschaftlichen Weiterbildung, Bielefeld: transcript2006, 64.
Universität, Volksbildung und Moderne 315
nahe ausschließlich Einzelvorträge und wenige Vortragsreihen, und die Ziel-setzung liegt unter anderem in einer besseren Information von Studienan-fängerinnen und Studienanfängern.120
Ob und inwiefern die Universität Wien im 21. Jahrhundert noch einmal anihre im Vergleich zu den deutschen Universitäten weitaus progressivere Positi-on121 einer engagiert betriebenen, methodisch-ambitionierten Wissenschafts-vermittlung anschließen wird können, wird sich wohl erst zu einem späterenZeitpunkt beurteilen lassen.
120 Ebd., 65.121 Schäfer, Historische Vorläufer, 22.
Christian H. Stifter316