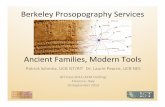St. Bödecker, Der Niedergermanische Limes und der Beginn gezielter „Militärarchäologie“ In:...
-
Upload
bodendenkmalpflege-lvr -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of St. Bödecker, Der Niedergermanische Limes und der Beginn gezielter „Militärarchäologie“ In:...
KATALOGE DES LVR-RÖMERMUSEUMS
IM ARCHÄOLOGISCHEN PARK XANTEN
Band 6
Eine Veröffentlichung des LANDSCHAFTSVERBANDES RHEINLAND
LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum
An den Grenzen des Reiches
Grabungen im Xantener Legionslager
am Vorabend des Ersten Weltkrieges
Ausstellung im LVR-RömerMuseum im Archäologischen Park Xantenvom 16. 5. 2014 bis 7. 9. 2014
AUSSTELLUNG im LVR-RömerMuseum im Archäologischen Park Xanten
Gesamtleitung
Martin Müller
Kuratoren
Maike Sieler, Ralph Trost, Kathrin Jaschke und Dirk Schmitz
Projektleitung
Charlotte Schreiter
Ausstellungsplanung und -realisierung
Petra Becker, Dirk Bütow, Norbert Damker, Janos Neumann, Dirk Sander, Mario Schiebold, Frank Termath, Jens Weinkath, Volker Wärmpf und Nicola Will
Museumspädagogisches Programm
Marianne Hilke und Kathrin Jaschke
Kommunikation, Marketing, Presse
Ingo Martell
Gestaltung weiterer Printprodukte
Sebastian Simonis Mediendesign
BEGLEITBUCH
Koordination
Dirk Schmitz und Charlotte Schreiter
Redaktion
Kathrin Jaschke, Dirk Schmitz, Maike Sieler und Ralph Trost
Fotoarbeiten
Stefan Arendt, LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Düsseldorf
Grafische Bildbearbeitung
Horst Stelter
Katalogproduktion und -gestaltung
Nünnerich-Asmus Verlag & Media
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National -bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Museums sowie des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
© 2014 Landschaftsverband Rheinland, LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum © 2014 Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz am Rhein
Printed in GermanyGedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
ISBN 978-3-943904-68-0
LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum
LVR-AMT FÜR
BODENDENKMALPFLEGE
IM RHEINLAND
„1914 – Mitten in Europa. Das Rheinland und der Erste Weltkrieg“ ist ein Projekt des LVR-Dezernats Kultur und Umwelt mit verschiedenen Partnern. Schirmherrin des Projektes ist Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
Projektidee und Konfiguration
Milena Karabaic, LVR-Dezernentin Kultur und Umwelt
Gesamtkonzeption und Projektleitung
Thomas Schleper
Wissenschaftliche Projektassistenz
Stephanie Buchholz
| 6 7 |
Inha
ltsve
rzei
chni
s
Inhaltsverzeichnis
Ute Schäfer Grußwort 8
Jürgen Wilhelm und Ulrike Lubek1914 – Mitten in Europa 9
Milena Karabaic und Thomas SchleperRömermacht mit Germanenstolz – Eine Schizophrenie der Moderne 10
Julia Obladen-Kauder und Charlotte SchreiterGrabungen im Xantener Legionslager am Vorabend ds Ersten Weltkrieges 12
Charlotte Schreiter und Dirk SchmitzAn den Grenzen des Reiches – Eine Einleitung 15
Das Lager Vetera I auf dem Fürstenberg bei Xanten und seine Erforschung
Maike SielerVetera castra. Stützpunkt Roms am Niederrhein 23
Steve BödeckerDer Niedergermanische Limes und der Beginn gezielter „Militärarchäologie“ 32
Julia Obladen-KauderWo lag Vetera I? Die Suche nach dem römischen Militärlager im Raum Xanten seit der frühen Neuzeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts 40
Nobert HanelAuf der Suche nach Vetera castra – Die römischen Militärlager auf dem Fürstenberg als Forschungsgegenstand während des zweiten Deutschen Kaiserreiches 54
Marion Brüggler mit einem Beitrag von Claudia KlagesJüngste Ausgrabungen in Vetera I – Die Nordwestecke des neronischen Lagers 64
Baoquan Song und Norbert HanelLuftbildarchäologie – Neue Perspektiven der Erforschung des Fürstenbergs 76
Archäologie und Imperium. Preußisches Militär und römische Legionen
Eva Hausteiner und Herfried MünklerDeutsche, Germanen, Römer? Wilhelminische Selbstdeutungen mit und gegen Rom 92
Ralph Trost„(…) mit lebhaftem Interesse“ – Wilhelm II., die Archäologie und Vetera 99
Zentrum und Provinz. Das Kaiserreich vor Ort
Stefan Kraus und Charlotte SchreiterXanten – Bonn – Berlin. Rheinische Funde und preußische Museumspolitik 116
Dirk Schmitz„Im übrigen geht alles recht und in altem Geleise weiter“. Organisation und Alltag der Grabung auf dem Fürstenberg zwischen 1905 und 1914 127
Imaginationen und Rekonstruktionen. Römer und Germanen im Deutschen Kaiserreich
Jürgen ObmannPopuläre Germanenbilder 164
Stefanie KlammRömer und Germanen im Schulwandbild 174
Alexandra W. BuschRekonstruktionen und Modelle römischer Militärarchitektur in wilhelminischer Zeit 182
Nach Ausbruch des Krieges
Dirk SchmitzDas Provinzialmuseum Bonn und seine Akteure während des Ersten Weltkrieges 192
Katalog 204
Anhang
Literaturliste 268
Abkürzungen 279
Personenglossar 280
Leihgeber 284
Abbildungsnachweise 286
33 |
Der
Nie
derg
erm
anisc
he L
imes
und
der
Beg
inn
gezi
elte
r „M
ilitä
rarc
häol
ogie
“
| 32
Steve Bödecker
Der Niedergermanische Limes und der Beginn gezielter
„Militärarchäologie“
In die Zeit des Deutschen Kaiserreiches (1871–1918) fällt ein grundlegender Wandel in der Erfor-schung der römischen Reichsgrenzen. Die rasant zunehmende Professionalisierung von Ausgra-bungstechniken sowie die Entwicklung wissenschaftlicher Methoden zur Analyse von Fundmateria-lien führt zum Ende des 19. Jahrhunderts zur Etablierung der Provinzialrömischen Archäologie als junge Wissenschaft in der bis dahin vor allem althistorisch geprägten Altertumskunde. Mit den großen Flächengrabungen in den Legionslagern von Neuss (1887–1900) und Haltern (1899–1914) gehen vom Rheinland und von Westfalen wesentliche Impulse für die Wissenschaftsentwick-lung aus. Mit Gründung der „Reichs-Limeskommission“ zur Erforschung des Obergermanisch-Raeti-schen Limes im Jahr 1892 wird erstmals eine reichsweite Forschungseinrichtung geschaffen, die als Ausdruck einer breiten Begeisterung für die Erforschung des römischen Militärs bis in die höchsten politischen Kreise der Wilhelminischen Zeit zu sehen ist. Dagegen bleibt eine zusammenhängende Erforschung der römischen Flussgrenze am Rhein zwischen Vinxtbach und Nordseeküste trotz be-deutender Einzelgrabungen noch lange hinaus ein „Stiefkind der Altertumswissenschaft“1.
Humanisten, Autodidakten, Altertumsvereine. Der Beginn der Limesforschungen
Mit der Entdeckung und Veröffentlichung antiker Schriftwerke, die Einblicke in die römische Ge-schichte nördlich der Alpen boten, wie der Germania und den Historien des Tacitus, beginnt auch die Erforschung der römischen Grenzen zwischen Rhein und Donau. Mit der 1598 veröffentlichten Tabula Peutingeriana, der mittelalterlichen Abschrift eines spätantiken Straßenverzeichnisses, wur-den erstmals breiten Bildungskreisen kartografische Grundlagen zur antiken Landschaftsgeschichte zugänglich. Bereits 1594 hatte Abraham Ortelius, der an der Veröffentlichung der Tabula Peutinge-riana mitgewirkt hatte, seine Kenntnisse der antiken Topografie in das von ihm herausgegebene Kartenwerk „Belgii Veteris Typus“ einfließen lassen und kombinierte sie mit geografischen Angaben aus weiteren Quellen. Dadurch wurden erstmals Forschungen zur römischen Reichsgrenze am Rhein in Gestalt einer historischen Karte vorgelegt (Abb. 9). So findet sich im Bereich der Lippemün-dung die Bezeichnung „Tricensima vel Ulpia Legio XXX“, mit der Ortelius Ortsangaben des Ammi-anus Marcellinus in seine antike Landesbeschreibung aufnimmt. In Süddeutschland begründet der
Humanist Johannes Turmair (1477–1534), genannt Aventinus, mit seiner Entdeckung des raeti-schen Limes die Limesforschung, bei der neben historischen Quellen jetzt auch Geländerelikte und Ausgrabungsergebnisse für das frühe Bild der römischen Grenze berücksichtigt werden2. Im Rheinland bleibt die Erforschung der römischen Vergangenheit durch Humanisten wie Stephan Winandus Pighius (1520–1603) oder Hermann Ewich meist auf die Sammlung bedeutender Fundstücke, vor allem Inschriftensteine zur Anlage von Lapidarien der regionalen barocken Adelsschicht beschränkt3. Dass das frühe Forschungsinteresse des lokalen Adels aber auch über Einzelfunde hinausgehen konnte, belegen die Studien des Waldgrafen Ditherich von Boennick-haußen. Dieser hatte 1614 neben einer Vermessung römischer Lagerwälle südlich seines Sitzes auf der Burg Monreberg bei Kalkar auch Überlegungen zur antiken Landschaftsgeschichte an-gestellt und den Bereich des heutigen Leybachs als ehemals römischen Rheinverlauf interpretiert. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges bedeuten hier jedoch eine spürbare Zäsur der Römer-forschung. Während in Süddeutschland 1768 mit Christian Ernst Hansselmanns Werk „Beweiß, wie weit der Römer Macht (...)“ die moderne Limesforschung begründet wird, gehen die Interes-sen des zunehmend historisch interessierten Bürgertums am Rhein nicht weit über Schatzgrabun-gen in antiken Stätten hinaus. Die Ausgrabungen im Bonner Legionslager durch den Gymnasial-oberlehrer Dr. Karl Ruckstuhl 1818/19 gelten zunächst ganz der Gewinnung von wertvollen
Abb. 9Abraham Ortelius, „Belgii Veteris Typus“. 1594.
| 34 35 |
Stev
e B
ödec
ker
Der
Nie
derg
erm
anisc
he L
imes
und
der
Beg
inn
gezi
elte
r „M
ilitä
rarc
häol
ogie
“
Fundgegenständen4. An den freigelegten Magazinbauten entzündet sich dann eine hitzig ge-führte Diskussion zwischen Bonner Gelehrten um die Funktion als Schweineställe oder Mann-schaftsbaracken. Hieraus geht die breiter angelegte Debatte um die Gestaltungsprinzipien römi-scher Militärarchitektur hervor. Die folgenden Jahrzehnte sind bestimmt von einer regelrechten Gründungswelle von Altertumsvereinen, in denen sich nun ein breites Bildungsbürgertum der Er-forschung der antiken Geschichte vor Ort verschreibt, wie der am 19. Dezember 1841 gegrün-dete „Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande“. Neben den Vertretern des Bildungsbürger-tums widmen sich vor allem auch Angehörige des Militärs den römischen Grenzverläufen, wie die älteste systematische Auflistung der römischen Lager am Rhein durch Generalmajor Friedrich Wilhelm Schmidt zeigt5. Wie auch die 1857 von dem Schuldirektor Anton Hermann Rein er-stellte Beschreibung der römischen „Stationsorte“6 handelt es sich noch um Auflistungen antiker Plätze am Rhein, ohne die Beziehung der Kastellorte untereinander und damit die Flussgrenze als Grenzsystem zu verstehen. Für den Obergermanisch-Raetischen Limes dagegen legte der Ingenieuroberst a. D. und spätere Landeskonservator von Hessen-Nassau, Karl August von Co-hausen (1812–1894), 1884 eine erste systematische Beschreibung und Analyse vor und berei-tete damit die Basis einer nun zunehmend professionalisierten Denkmalforschung7.
Universitäten, Museen, Kommissionen. Die Professionalisierung der Altertumsforschung
Neben die Intensivierung der von den Altertumsvereinen getragenen Forschungen treten verstärkt auch die Universitäten. Eine zunehmende Anzahl von Forschern des zuvor althistorisch oder auf den mediterranen Kulturkreis spezialisierten Personals wendet sich neuen archäologischen Methoden, etwa der antiquarisch-chronologischen Fundanalyse, zu. Einen prominenten Vertreter dieser neuen Richtung stellt Hans Dragendorff (1870–1941) dar, der 1894 bei Georg Loeschcke, einem Förderer der „Scherbenarchäologie“8, über Terra Sigillata promoviert wurde, deren Vorlage in den Bonner Jahrbüchern 1896 bis heute gängige Typenbezeichnungen für wesentliche Keramikleitformen liefert. Damit waren auch der Limesforschung neue Möglichkeiten der Datierung eröffnet und die „Scherben-archäologie“ fand zunehmend neue Bearbeitungsfelder, wie etwa der mit Dragendorff in engem Kontakt stehende Constantin Koenen und seine 1885 erschienene „Gefässkunde der vorrömischen, römischen und fränkischen Zeit in den Rheinlanden“. Am Beispiel der Familie Steiner aus Xanten lässt sich die Entwicklung vom Autodidakten Josef Steiner (1839–1914) zu seinem zum professionellen Archäologen ausgebildeten Sohn Paul innerhalb einer Generation festmachen9.
Zugleich mit der Herausbildung von archäologischen Fachwissenschaftlern durch die Universitä-ten beginnt mit der Gründung staatlicher Museen, wie den Provinzialmuseen Trier und Bonn im Jahr 1875, die Institutionalisierung staatlicher Stellen, denen nicht nur die Sammlung und Ordnung anti-ker Funde zukommt, sondern auch Aufgaben der Denkmalpflege und damit der Erforschung und Erhaltung antiker Fundstellen. Ein regelmäßiger Etat ermöglicht nun eine staatlich gelenkte und kontinuierliche Forschung (Beitrag Stefan Kraus und Charlotte Schreiter).
Die zunehmende Verästelung der Limesforschungen in Tätigkeiten der Vereine und Museen, de-ren Wirkungskreis zudem noch durch Landesgrenzen beschränkt war, erregte immer stärkere Wün-sche nach übergreifenden Organisationsformen. Wesentliche Triebkraft stellte hier der international renommierte Althistoriker Theodor Mommsen (1817–1903) dar. Vor allem auf seiner Initiative be-ruhte ein mit Unterstützung des Generalmajors a. D. Carl Johann von Veith (1818–1892)10 erstellter
„Organisationsplan zur Erforschung der römischen Befestigungen und Heerstraßen auf deutschen Boden“, worunter auch die Rheingrenze bis zur Rheinmündung in die Nordsee verstanden wurde11. Der Plan scheiterte jedoch am Widerspruch Süddeutschlands im Reichstag, bei dem Befürchtungen einer preußischen Bevormundung eine wesentliche Rolle spielten. Mommsens Bemühungen um die Zustimmung süddeutscher Forscherkollegen ebneten dann den Weg zur erfolgreichen Gründung der Reichs-Limeskommission (RLK) zur „Erforschung des Limes, der römischen Grenzsperre in Rätien und Obergermanien“. Die Gründung der Römisch-Germanischen Kommission sicherte ab 1902 als feste, bis heute bestehende Forschungseinrichtung auch die über das Projekt der RLK hinausge-hende dauerhafte Erforschung des Limes. Trotz der engen Kontakte Mommsens ins Rheinland – unter den Gründungsmitgliedern der RLK befand sich auch der Bonner Professor für Alte Geschichte, Heinrich Nissen – spielte die Rheingrenze Niedergermaniens vom Vinxtbach bis zur Rheinmün-dung bei diesen Überlegungen keine Rolle mehr.
Vermessungstechnik und Bodenverfärbungen. Die Verwissenschaftlichung der Ausgrabungstechnik
In die Zeit der zunehmenden Forschungs tätigkeit am Limes fällt auch die entscheidende Ent-wicklung neuer Ausgrabungstechniken. Hatte man bei den Ausgrabungen im Bonner Legions-lager 1814 noch die freigelegten und offen der Witterung ausgesetzten Mauern erst einige Jahre später eingemessen, so zeigten die Ausgrabungen von Constantin Koenen in Neuss-Grimm-linghausen von Beginn an den Willen zur ausgrabungsnahen Dokumentation. Koenen vermu-tete hier den Bereich des Legionslagers Novaesium der nachtiberischen Zeit. Nach Vorarbei-ten im Winter 1886 gelang es ihm ab 1887 in mehreren Kampagnen bis 1900, den bislang umfangreichsten Grundriss eines römischen Legionslagers zu gewinnen. Angesichts der auf viele kleine landwirtschaftliche Parzellen aufgeteilten Grabungen, die keineswegs kontinuier-lich von Feld zu Feld in dem über 26 ha großen Areal durchgeführt werden konnten, zeugen die später umgezeichneten Pläne Koenens von einer bis dahin in dieser Größenordnung nicht bekannten Genauigkeit. Auch Koenens Profilzeichnungen und der Einsatz der Fotografie verdeut-lichen die Entwicklung zur über die Grabung hinausgehend nach-prüfbaren Befunddokumentation12. Das Verfolgen der Mauerzüge mit schmalen Grabungsschnitten ent-sprach noch ganz der älteren Grabungstradition, die nur selten, meist im Falle von Räumlichkeiten, in die Fläche ausgriff (Abb. 10). Wie schnell der Autodidakt Koe-nen sich zum versierten Ausgräber wandelte, zeigen seine vor den Grabungen skizzierten Vorstellun-gen des Neusser Lagers, die durch
Abb. 10Grabungsfoto Koenenlager. Typische Technik der schmalen Grabungsschnitte entlang des Mauerverlaufes (hier mit Frau Koenen).
| 36 37 |
Stev
e B
ödec
ker
Der
Nie
derg
erm
anisc
he L
imes
und
der
Beg
inn
gezi
elte
r „M
ilitä
rarc
häol
ogie
“
Abb. 11„Erster Entwurf“ Constantin Koenens zum Legionslager „Novaesium“. Um 1880.
breite Wassergräben und mächtige Rundtürme eine noch ganz von Fantasie geleitete Vorstel-lung römischer Wehrarchitektur erkennen lassen (Abb. 11). Nur vier Jahre nach Beendigung der Ausgrabungen konnte Koenen in den Bonner Jahrbüchern den ersten Gesamtplan eines römischen Legionslagers vorlegen. Der Plan stellt einen Meilenstein der römischen Militärar-chäologie dar und bestimmt bis heute wesentlich die Kenntnis zur Organisation römischer La-gerschemata (Abb. 12).
Erkannte Koenen im Wesentlichen nur die Fundamente und Ausbruchgruben römischen Mauer-werks, so sollte die Entdeckung von Bodenverfärbungen als Reste ehemaliger Holzkonstruktionen die Ausgrabungsmethoden in eine neue Ära führen. Zunächst bei Wachtürmen am Taunus festge-stellt, konnte Carl Schuchhardt bei den Grabungen in den augusteischen Lagern in Haltern 1899–1901 die Methode zur Erkennung von Bodenverfärbungen verfeinern, welche von dort weite Ver-breitung gewann; die archäologische Erkennbarkeit des Pfostenlochs erlangte hier ihren Durchbruch (Abb. 13). Auch die Auswirkung von Licht- und Witterungsbedingungen für die Erkennbarkeit von Befun den sowie die fotografische Dokumentation mit unterschiedlichen Belichtungstechniken wurden hier entwickelt, Haltern wurde zur Archäologenschule 13. Damit war die moderne Grabungstechnik geboren. Wie schnell die neuen Erkenntnisse angewandt wurden, zeigen die Grabungen Lehners von 1905 bis 1914 in Vetera.
Mit einer am Befund orientierten Errichtung einer Holz-Erde-Mauer 1901 in Haltern beginnt eine Rekonstruktionsweise, die nun ganz der Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist. So wird die Konstruk-
Abb. 12Gesamtplan „Koenenlager“.
| 38 39 |
Stev
e B
ödec
ker
Der
Nie
derg
erm
anisc
he L
imes
und
der
Beg
inn
gezi
elte
r „M
ilitä
rarc
häol
ogie
“
tion auch bereits 1904 aufgrund neuer Er-kenntnisse abgetragen und gemäß den neuen Grabungserkenntnissen noch in situ ersetzt. Eng damit verbunden sind erste An-sätze experimenteller Archäologie. So er-richten Mainzer Pioniere mit nachgebilde-tem römischem Werkzeug 1913 auf Befehl Kaiser Wilhelms II. zwei Schanzen im Um-feld der Saalburg14.
Der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bedeutet jedoch für die vor allem durch die Limesforschung aufgenommene Dynamik der Wissenschaftsgenese der Provinzialrö-mischen Archäologie eine jähe Zäsur.
„Wir haben den Limes zusammen!“ Internationalisierung der Limesforschung nach 1945
Mit dem kriegsbedingten Ausgreifen der Städte im Rheinland auf bislang unbebaute Flächen geht eine Zunahme von Ausgra-bungstätigkeiten einher, die Harald von Pe-trikovits 1959 zusammengefasst hat und
darin die niedergermanische Reichsgrenze erstmals als „niedergermanischer Limes“ bezeichnet. Damit wird sie analog zu den bisherigen Forschungen am Obergermanisch-Raetischen Limes fortan unter systematischen Fragestellungen zur Genese und Funktion römischer Grenzen behandelt15. „Wir haben den Limes zusammen!“, titelte dazu die Kölnische Rundschau vom 7.10.1960, in der Harald von Petrikovits das „Stiefkind der Altertumswissenschaft“, den „niedergermanischen Limes“, als gleichwertiges Denkmal dem Obergermanisch-Raetischen Limes zur Seite stellte. Ausdruck die-ser systematischen Sichtweise, die nun auch den niederländischen Abschnitt einbezog, stellte der zum 10. Internationalen Limeskongress 1974 in Xanten und Nijmegen gemeinsam von niederländischen und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengetragene Begleitband „Der Niedergermanische Limes. Materialien zu seiner Geschichte“ dar16. Mit der Entscheidung der UNESCO, 2005 den Obergermanisch-Raetischen Limes in die Liste der Welter-bestätten aufzunehmen, ging zugleich die Absicht einher, zukünftig die gesamten Grenzen des Römischen Reiches in einer Welterbestätte zusammenzufassen17 und somit alle Grenzabschnitte gleichwertig als Teil eines Gesamtdenkmals zu verstehen. Mit den Vorbereitungen für ein Nominie-rungsverfahren des Niedergermanischen Limes als wichtigem Bestandteil der römischen Grenzen nördlich der Alpen wurde daher gemeinsam mit den niederländischen Partnern begonnen18.
Abb. 13Haltern, „Hofestatt“, Friedrich Koepp (l.) und Hans Dragendorf (r.). Gut zu erkennen ist das sauber gestochene Profil zu Erkennung verschiedener Verfüllungsschichten.
1 HARALD VON PETRIKOVITS in der Kölnischen Rundschau 235 vom 4.10.1960.
2 BRAUN 1984. 3 DIEDENHOFEN 2002, 39–49. 4 GECHTER 2001, 36–41. 5 SCHMIDT 1861, 65–123. 6 REIN 1857. 7 VON COHAUSEN 1884. 8 LANGLOTZ 1968. 9 J. STEINER 1901; P. STEINER 1911. 10 VON VEITHS Interessen galten auch der Rheingrenze. Seine Abhand-
lungen zur Lokalisierung von Vetera gelten als eine der frühesten auf das römische Militär spezialisierten Schriften für Niedergerma-nien: VON VEITH 1881.
11 BRAUN 1992, 12. 12 KOENEN 1904, 97–242; SEELING 1984; BÖDECKER 2011. 13 OBMANN 2000. 14 OBMANN 2000. 15 VON PETRIKOVITS 1959 b; VON PETRIKOVITS 1960, 35–36. 16 BOGAERS/RÜGER 1974. 17 BREEZE/JILEK 2008. 18 KUNOW 2010.
Anmerkungen