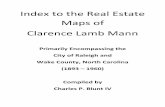So wird man(n) zum hegemonialen Mann Eine intersektionale Analyse der hegemonialen...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of So wird man(n) zum hegemonialen Mann Eine intersektionale Analyse der hegemonialen...
So wird man(n) zum hegemonialen Mann
Eine intersektionale Analyse der hegemonialen Managermännlichkeit im Wirtschaftsmagazin Bilanz
Bachelorarbeit Soziologieeingereicht bei
Dr. Charlotte Mülleram Institut für Soziologie
an der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bernam 20. August 2011
Frühlingssemester 2011
Adrian Michael DurtschiMurtenstrasse 30
3008 Bern079 223 46 17
BA Soziologie
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung........................................................................................................................... 1 2 Theorie............................................................................................................................... 6
2.1 Kapitalismus und Manager......................................................................................... 6 2.2 Patriarchat und Männlichkeit...................................................................................... 8 2.3 Zusammenspiel und Intersektionalität......................................................................10 2.4 Hegemoniale Männlichkeit....................................................................................... 12
2.4.1 (Ideal-)Typen der Männlichkeit..........................................................................13 2.4.2 Veränderung und Sozialisierung....................................................................... 15
2.5 Pierre Bourdieus Habitustheorie...............................................................................16 2.5.1 Klassenhabitus.................................................................................................. 17 2.5.2 Männlicher Habitus............................................................................................19
2.6 Synthese zur hegemonialen Managermännlichkeit.................................................21 2.6.1 Idealtyp hegemoniale Managermännlichkeit.....................................................22 2.6.2 Thesen...............................................................................................................25
3 Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik .............................................................. 26 3.1 Auswahl des Datenmaterials.................................................................................... 26 3.2 Methodenauswahl Mehrebenenanalyse...................................................................27
3.2.1 Theoretischer Hintergrund.................................................................................28 3.2.2 Funktionsweise der Mehrebenenanalyse..........................................................29 3.2.3 Anwendungsbeispiele und kritische Auseinandersetzung................................30 3.2.4 In dieser Arbeit angewandte Methode ..............................................................34
4 Ergebnisse Mehrebenenanalyse..................................................................................... 36 4.1 Hegemoniale Managermännlichkeit......................................................................... 36 4.2 Ebene Identitätskonstruktionen................................................................................ 37 4.3 Ebene symbolische Repräsentation.........................................................................39 4.4 Ebene (Sozial)-Struktur............................................................................................ 41 4.5 Wechselwirkungen zwischen den Ebenen............................................................... 43
5 Fazit..................................................................................................................................46Bibliographie........................................................................................................................ 51Selbstständigkeitserklärung................................................................................................. 57Anhang................................................................................................................................. 58
A Interview Viktor Vekselberg.......................................................................................... 58B Interview Carsten Schloter........................................................................................... 62C Interview Daniel Vasella............................................................................................... 66
Einleitung 1
1 EinleitungUnd es sind zwei Sprachen oben und untenUnd zwei Masse zu messenUnd was Menschengesicht trägtKennt sich nicht mehr. […]Die aber unten sind, werden unten gehaltenDamit die oben sind, oben bleiben.Bertold Brecht1
In der Schweiz und weltweit gibt es nach wie vor beachtliche soziale Unterschiede. Es
gibt Menschen, die aufgrund dieser Ungleichheiten verlieren und solche die davon pro-
fitieren. Diese sozialen Unterschiede nehmen entgegen anders lautender Meldungen
stetig zu. Erst kürzlich hat eine Reichtumsstudie von Ueli Mäder et al. (2010: 50-60)
aufgezeigt, dass rund 1 % der in der Schweiz wohnhaften Personen rund 59 % des ge-
samten Vermögens besitzen. Diejenigen, welche „oben“ sind, haben immer mehr und
die „unten“ immer weniger. Die Ungleichheit bezieht sich nicht nur auf die Vermögens-
verteilung. Im Jahr 2010 nahm in den 41 wichtigsten Schweizer Unternehmen die
Lohnschere in den Betrieben stark zu. Die Differenz zwischen dem Spitzenverdienst
und dem niedrigsten Verdienst betrug in diesen Unternehmen 1:43 (Unia 2011: 1f).
Oder anders ausgedrückt: Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter der niedrigsten Lohnstufe
muss ihr/sein ganzes Erwerbsleben arbeiten, um gleich viel zu verdienen wie die Best-
verdienenden in einem Jahr. Der Verteilungsbericht des SGB zeigt eine immer stärkere
Umverteilung von unten nach oben. Für die unteren Einkommen hat das real verfügba-
re Einkommen zwischen 1998 und 2008 abgenommen. Sie haben weniger Geld zum
Ausgeben. Das verfügbare Einkommen des obersten Drittels nahm im selben Zeitraum
zu (Lampart und Gallusser 2011: 19-25).
Während die Reichen vor allem Männer sind, sind bei den Armen die Frauen über-
durchschnittlich stark vertreten. So sind beispielsweise 280'000 Frauen in der Schweiz
von Tieflöhnen unter 4'000 Franken betroffen (Schärer 2011: 1). Doch auch in anderen
Bereichen sind die Frauen massiv benachteiligt. So sind in Kaderpositionen Frauen
stark untervertreten (BASS 2010: 41-44). Auch in der Politik sind die Frauen massiv in
der Minderheit (EKF 2011). Selbst bei der Hausarbeit zeigt sich klar eine Dominanz der
Männer über die Frauen (BfS 2010). Frauen haben trotz beruflicher Tätigkeit immer
noch mehrheitlich die Hauptverantwortung bei der nicht-bezahlten Reproduktionsarbeit.
Soziale Ungleichheiten lassen sich sowohl zwischen Arbeit und Kapital als auch zwi-
schen Männern und Frauen finden. Die erwähnten Fakten zeigen deutlich, wie die
beiden herrschenden Gesellschafts- respektive Herrschaftssysteme Kapitalismus und
1 Brecht, Bertolt. 1962. Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Berlin: Verlag Suhrkamp. S. 143f.
Einleitung 2
Patriarchat in der Schweiz und weltweit Ungleichheiten schaffen. Es greift zu kurz, Dis-
kriminierungen und soziale Ungleichheit einzig anhand von einigen „bösen“ Reichen
erklären zu wollen. Die ungleiche Kapitalakkumulation erklärt zwar die Zunahme des
Vermögens der Reichen, nicht aber, wieso fast alle Reichen Männer sind und die
Armen mehrheitlich Frauen. Sie erklärt ebenfalls nicht, wieso es nur eine geringe
soziale Mobilität gibt. Insbesondere die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern
darf nicht als Nebenwiderspruch von Arbeit und Kapital verstanden werden. Die beiden
Ungleichheitssysteme sind nicht voneinander getrennt. Die Herrschenden sind auch in
beiden Fälle die gleichen, eine kleine Elite von Männern, welche die anderen Men-
schen kontrolliert und von den unterschiedlichen sozialen Ungleichheiten profitiert.
Soziale Ungleichheiten haben mehrere Ursachen. Es gibt verschiedene Unter-
drückungs- oder Ungleichheitsmechanismen. Zwei der wichtigsten sind die Diskrimi-
nierung aufgrund der Klasse (classism) und des Geschlechts (sexism). Neben ihnen
existieren noch weitere Diskriminierungskategorien beispielsweise „Rasse“ oder
Körper. Diese werden jedoch in dieser Arbeit nicht weiter behandelt.
Die erwähnten Herrschaftssysteme Kapitalismus und Patriarchat schweben nicht im
leeren Raum. Sie werden getragen von den Herrschenden (z.B. ManagerInnen2,
PolitikerInnen, mächtige und unterstützende Männer), aber auch von ihren Unter-
drückten (z.B. ArbeiterInnen, Frauen im Allgemeinen). Der Kapitalismus und das Patri-
archat wirken auf diese Personengruppen ein. Die Herrschaftsformen bestimmen ihr
Handeln, aber ihr Handeln prägt wiederum auch diese Formen der Herrschaft. Dies ist
möglich, da die Herrschaftssysteme Bestandteil ihrer TrägerInnen geworden sind.
Kapitalismus und Patriarchat sind nicht nur strukturell verankert in Institutionen und der
Gesellschaft. Sie scheinen auch die Identitätskonstruktionen der TrägerInnen zu beein-
flussen. Ebenso beeinflussen sie die Ideologien und Rechtfertigungen der TrägerInnen.
Eine Analyse der TrägerInnen erlaubt so Rückschlüsse auf die Herrschaftsformen
selbst. Damit lassen sich die Unterdrückungssysteme besser verstehen. Dies liesse
sich auch auf eine Vielzahl von anderen Herrschaftsverhältnisse – also nicht nur auf
Kapitalismus und Patriarchat – anwenden. Um den Rahmen der Bachelorarbeit nicht
zu sprengen, wird diese Arbeit aber nur die beiden Herrschaftsverhältnisse Kapitalis-
mus und Patriarchat behandeln. Die Betrachtung der Herrschenden und der
Beherrschten kann erklären, wieso sich die beiden Formen immer wieder reprodu-
zieren. Es gibt nach wie vor verschiedene Lebenswelten, welche von Anfang an die
2 Diese sind meist männlich. Diese Arbeit soll geschlechtergerecht geschrieben werden. Deshalb wird immer dann, wenn alle potenziellen Geschlechtsidentitäten gemeint sind, die Schreibweise mit „Binnen-I“ verwendet werden. Ansonsten bemühe ich mich um präzise Bezeichnungen.
Einleitung 3
Rollen und die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten der Menschen bestimmen. Herr-
schende und Beherrschte lesen nicht dasselbe, essen nicht dasselbe und haben nicht
die gleichen Probleme. Ihre soziale Lage ist eine andere. Sie müssen deshalb in der
Wissenschaft als eigenständige Untersuchungsgegenstände behandelt werden.
Eine zentrale Prämisse für diese Forschung ist, dass soziale Ungleichheiten nicht
naturgegeben sind. Genauso wie die sozial konstruierte Zweigeschlechtlichkeit mit
einem „schwachen“ und einem „starken“ Geschlecht, kommen auch Reichtum und
Armut nicht aus der Natur. Sie werden vielmehr von uns Menschen konstruiert und re-
produziert. Ebenfalls sind ihre Ergebnisse, die Herrschenden und Beherrschten, sozial
konstruiert. Um zu verstehen, wie genau diese aber konstruiert und reproduziert wer-
den, müssen die Herrschenden und die Beherrschten in ihrem Verhältnis zu Kapitalis-
mus und Patriarchat analysiert werden. Denn diese prägen und bilden die Grundlagen
für ihr Wirken.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, bei der Analyse der Herrschenden und Beherrschten
einen Beitrag zu leisten. Im Folgenden sollen die Herrschenden genauer beleuchtet
werden. Ich möchte mich dem Idealtyp des Herrschenden innerhalb des Kapitalismus
und Patriarchats widmen. Genauer gesagt dem Typus des männlichen Spitzen-
managers. Dieser hat als Manager (Mann und Kapitalist) innerhalb beider Herrschafts-
verhältnisse eine dominante Rolle. An ihm orientieren sich auch die nach oben Stre-
benden und versuchen so zu werden wie dieser Typus. In dieser Arbeit soll deswegen
die Frage beantwortet werden:
Welcher Idealtyp von hegemonialer Managermännlichkeit wird in der Rubrik
„Gespräche“ im Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz (kurz: Bilanz) in Bezug auf die
Sozialstruktur, die symbolische Repräsentation, die Identitätskonstruktionen und ihre
Wechselbeziehungen untereinander reproduziert?
Dieser Untersuchungsgegenstand habe ich gewählt, weil mit ihm die Mächtigen im
Speziellen angeschaut werden können. In vielen Untersuchungen werden die
Verliererinnen und Verlierer angeschaut, die Beherrschten. Dies ist wichtig und richtig.
Genauso nötig um das gesamte System zu begreifen ist es aber, auch die andere
Seite, die Mächtigen, genauer anzuschauen. Dieser Idealtyp der Vorherrschaft, sowohl
im kapitalistischen System, wie auch zwischen den beiden Geschlechtern, wird in
dieser Arbeit hegemoniale Managermännlichkeit genannt. Der Idealtyp der hege-
monialen Managermännlichkeit kombiniert die Macht des Kapitalismus und des Patri-
archats. Diese Perspektive macht die Arbeit in ihrer Art besonders. Sie schaut nicht nur
Einleitung 4
auf einen Teil des verwobenen Herrschaftssystems von Kapitalismus und Patriarchat,
wie es beispielsweise die Reichtumsstudie von Mäder et al. (2010) weitgehend macht.
Der Typus des hegemonialen Managers soll nicht nur auf einer Ebene angeschaut
werden, sondern gleich auf drei verschiedenen: 1. Den strukturellen Verhältnissen; 2.
den symbolischen Repräsentationen, also den Rechtfertigungsstrukturen, Diskursen,
Normen und Ideologien und 3. den Identitätskonstruktionen der Akteure. Ebenso
werden die Wechselbeziehungen zwischen den drei vorgestellten Ebenen be-
rücksichtigt.
Schliesslich erlaubt die gewählte Fragestellung zu erläutern, welche hegemoniale
Managermännlichkeit in der Gesellschaft durch eine spezifisches Zeitschrift reprodu-
ziert wird. Und wie die männlichen Spitzenmanager damit als Vorbilder für andere wir-
ken, welche nach Macht, Anerkennung und sozialem Aufstieg in unserer Gesellschaft
streben. Dies alles dient dem höheren Erkenntnisinteresse, die Funktionsweise von
Patriarchat und Kapitalismus besser zu verstehen. Die vorliegende Bachelorarbeit lässt
sich damit als Forschung im Bereich der sozialen Ungleichheit, der Sozialstruktur-
analyse, der Geschlechtersoziologie und der Machtsoziologie einordnen.
In der Arbeit soll den Managern (Kapitalismus) und der Männlichkeit (Patriarchat) ein
besonderer Blick gelten, da diese Akteure (auch in vereinigter Form der männlichen
Manager) die Profiteure der beiden Systeme sind. Das Herzstück der Theorie bilden
dazu die Arbeiten von Pierre Bourdieu und Raewyn W. Connell. Connell führte das
Konzept der hegemonialen Männlichkeit ein. Ihr Konzept erlaubt es Geschlechterunter-
schiede innerhalb des kapitalistischen Systems, Ungleichheiten zwischen Männern
und das Wirken des kapitalistischen und patriarchalischen Systems zu analysieren.
Ergänzt wird Connell durch die Habitustheorie von Pierre Bourdieu. Die Habitustheorie
erlaubt es sowohl soziale Ungleichheiten innerhalb der sozialen Klassen als auch zwi-
schen den Geschlechtern zu erklären. Beide Theorien zeigen zudem auf, wie einzelne
sozial „oben“ stehende Idealtypen zum Vorbild für breite Massen der Bevölkerung
werden.
Als Methode für die Untersuchung wird die Mehrebenenanalyse von Gabriele Winker
und Nina Degele verwendet. Es ist eine relativ neue Methode in der qualitativen Sozial-
forschung, welche darauf ausgerichtet ist Mehrfachunterdrückung auf verschiedenen
Ebenen zu untersuchen. Da es sich um eine eher unbekannte Methode handelt, werde
ich die Methode innerhalb der Arbeit ausführlicher darstellen und kritisch beleuchten.
Einleitung 5
Um die vorgestellte Fragestellung beantworten zu können, gestaltet sich der Aufbau
der Arbeit folgendermassen: Zuerst kommt ein ausführliches Theoriekapitel, welches
die wichtigsten Begriffe und Konzepte erklären soll. Das Kapitel beginnt mit einer theo-
retischen Vorstellung des Kapitalismus und des Patriarchats als vorherrschende
Gesellschaftssysteme und ihren AkteurInnen. Im Anschluss folgt eine Darstellung des
Ansatzes der Intersektionalität. Danach werden die Konzepte von Connell und
Bourdieu eingehend erläutert. Das Ganze mündet schliesslich in einer selbsterar-
beitenden Synthese des Idealtypus der hegemonialen Managermännlichkeit. Diese
Theorie erlaubt es dann, die Fragestellung empirisch zu beantworten und erste Thesen
aufzustellen.
Als Datenmaterial für die empirische Analyse stehen Interviews aus der Bilanz zur Ver-
fügung, namentlich mit den Spitzenmanagern Daniel Vasella, Viktor Vekselberg und
Carsten Schloter. Im Methodenkapital wird sowohl die Methode der Mehrebenen-
analyse vorgestellt, als auch die Auswahl des Datenmaterial (Interviews) begründet.
Die Methode wird dabei theoretisch und praktisch vorgestellt und in einem Anwen-
dungsteil kritisch beleuchtet. Dem folgt ein Analysekapitel, in dem die Ergebnisse der
Mehrebenenanalyse der drei Interviews aus der Bilanz vorgestellt werden. Diese
Ergebnisse und der vorhergehende Theorieteil ermöglichen es dann am Schluss der
Bachelorarbeit, die Fragestellung zu beantworten, welche hegemoniale Managermänn-
lichkeit im Wirtschaftsmagazin Bilanz reproduziert wird.
Theorie 6
2 Theorie
2.1 Kapitalismus und ManagerDas bestimmende Herrschaftssystem im Bereich der Wirtschaft ist der Kapitalismus. In
diesem Kapitel soll der Kapitalismus, seine Funktionsweise und die ManagerInnen als
wichtige AkteurInnen des inkorporierten kapitalistischen Denkens analysiert werden.
Kapitalismus ist gemäss Max Weber die „Organisation wirtschaftlicher Interessen, die
das 'Streben nach Profit, nach immer erneutem Profit' erlaubt“ (zit. nach Swedberg
2009: 88). Als weitere Minimaldefinition für das System Kapitalismus wird in dieser
Arbeit verwendet: Ein System, welches „unbegrenzte Kapitalakkumulation durch den
Einsatz von formell friedlichen Mittel“ zum Ziel hat (Boltanski und Chiapello 2006: 39).
Innerhalb des Kapitalismus gibt es vereinfacht gesagt zwei Klassen. Auf der einen
Seite sind dies die Kapitalistinnen und Kapitalisten (Besitzende, Bourgeoisie), welche
über Produktionsmittel (Kapital, Güter, Boden) verfügen (Marx und Engels 1973: 461-
473).
Auf der anderen Seite sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, welche den Besitzenden ihre
Arbeitskraft verkaufen müssen, da sie nicht selbst über Produktionsmittel verfügen.
Durch diese Teilung entstehen soziale Ungleichheiten, die KapitalistInnen besitzen
nach Marx und Engels immer mehr und die ArbeiterInnen verarmen zunehmend. Diese
starke Teilung in Klassen wird heute in der Forschung oft negiert. Neue Modelle, wie
soziale Schichten etc., lösen dieses Klassenmuster ab (Klein 2005: 227-233). Ein-
deutig ist aber, dass es durch das System des Kapitalismus weiterhin massive soziale
Ungleichheiten gibt. Sei dies bei den Vermögen, den Einkommen oder Bodenbesitz in
der Schweiz (Mäder et al. 2010) und weltweit (Boltanski und Chiapello 2006).
Den Menschen, von ArbeiterInnen bis hin zu ManagerInnen, wohnt zur Aufrechterhal-
tung des kapitalistischen Systems ein „kapitalistischer Geist“ inne. Dieser Geist ist die
Verinnerlichung von kapitalistischen Normen, Werten und Weltanschauung. Er ermög-
licht, dass das kapitalistische System trotz Ungleichheiten ohne offene Gewalt auf-
rechterhalten bleibt. Der Geist des Kapitalismus bezeichnet auch die aktuelle Ideologie,
von welchem der Kapitalismus getragen wird (Ebd.: 42-53). Durch veränderte gesell-
schaftliche Rahmenbedienungen oder Kritik am Kapitalismus passt sich der Geist, also
die Ideologie, soweit an, dass der Kapitalismus weiterhin erhalten bleiben kann.
Nicht einig sind sich die TheoretikerInnen bei der Frage, woher die soziale Ungleichhei-
ten im Kapitalismus herrühren. Einerseits gibt es die Erklärung, dass sie von den Struk-
turen und der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe kommen. Anderseits, dass sie
Theorie 7
aufgrund von individuellem Verhalten (Rational Choice) entstehen (Klein 2005: 227-
233). Ebenfalls strittig ist, wie sich das System des Kapitalismus etablieren konnte.
Eine Theorieschule geht davon aus, dass die Strukturen entscheidend sind für die
Etablierung des Kapitalismus. So erklärt beispielsweise Marx: „Es ist nicht das
Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches
Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt“ (Marx und Engels 1973: 8-9). Zuerst gab es also
kapitalistische Strukturen, daraus resultierte dann das kapitalistische Denken. Als
heutige kapitalistische Struktur kann beispielsweise die globalisierte, kapitalistische
Wirtschaftsordnung (Osterhammel und Peterson 2006: 7f) angesehen werden. Aus
dieser folgt dann das spezifische Bewusstsein.
Eine andere theoretische Schule besagt, dass zuerst ein kapitalistisches Bewusstsein
(kapitalistischer Geist) vorhanden war und dadurch die kapitalistische Strukturen
entstanden sind (Weber 1993). In dieser Arbeit soll die Auseinandersetzung dieser
Theorieschulen nicht geklärt werden, vielmehr wird mit Bourdieu und Connell im
weiteren Teil des Theoriekapitels eine Synthese zwischen beiden Theorieschulen
verwendet.
ManagerInnen gehören zu der Gruppe der Menschen, bei welchen der Geist des Kapi-
talismus in seiner jeweils aktuellsten Prägung offensichtlich zu Tage tritt (Boltanski und
Chiapello 2006: 91-97). ManagerInnen sind Personen, welche Führungsaufgaben
wahrnehmen, sei dies im operativen Bereich (z.B. Geschäftsleitung) oder im strategi-
schen Bereich (z.B. Verwaltungsrat). ManagerInnen handeln als Verantwortliche für ihr
Unternehmen nach der kapitalistischen Logik und müssen sich in einer kapitalistischen
Wirtschaftsordnung durchschlagen. Durch ihr Handeln, wie Lohnerhöhungen oder Ent-
lassungen, können sie direkt Einfluss auf soziale Ungleichheiten nehmen. Ausserdem
werden Manager nicht nur innerhalb der Unternehmen immer einflussreicher, sondern
auch in Bereichen wie Politik und Gesellschaft (Mäder et al. 2010: 98-101). Obwohl
ManagerInnen meist nicht die Besitzer der Unternehmen sind, werden sie zu den Kapi-
talistInnen gezählt. Dies, da ihr Einfluss auf die Produktionsmittel so gross ist
(Boltanski und Chiapello 2006: 39-42).
Bei den KapitalistInnen, also ManagerInnen, Besitzenden etc., gibt es ein spezifisches
Denken, welches ihrer Klasse entspricht. Mäder et al. (2010: 308-311) haben in ihrer
Reichtumsstudie dieses Denken erforscht und kommen unter anderem zu folgenden
Ergebnissen: 1. KapitalistInnen verfügen über ein grosses Selbstvertrauen. 2. Sie sind
weltoffen und kulturell Interessiert. 3. Soziale Anliegen werden dort unterstützt, wo eine
Theorie 8
unverschuldete Not vermutet wird. 4. Der wirtschaftliche Erfolg wird vornehmlich
eigenen Fähigkeiten zugeschrieben. 5. Das Primat der Wirtschaft wird in allen Lebens-
lagen favorisiert.
Es lässt sich zusammengefasst sagen, dass der Kapitalismus das vorherrschende
Wirtschaftssystem ist, welches stark für soziale Ungleichheiten verantwortlich ist. Ein
verinnerlichter Geist des Kapitalismus trägt dazu bei, dass einige KapitalistInnen ihren
Profit immer weiter auf Kosten von anderen erhöhen können. Eine der wichtigsten
AkteurInnengruppe für den Kapitalismus sind die ManagerInnen. Sie handeln nach der
aktuellen kapitalistischen Logik und vollziehen sozusagen den Kapitalismus. Als
GewinnerInnen des Systems werden sie immer mächtiger und reicher. Bei ihnen
kommt das Denken und der Geist des Kapitalismus klar zum Vorschein.
2.2 Patriarchat und MännlichkeitIm vorherigen Teil wurde das Herrschaftssystem Kapitalismus vorgestellt und die
ManagerInnen. Ein weiteres dominantes Herrschaftssystem, welches unsere Gesell-
schaft beherrscht und Ungleichheiten erzeugt, ist das Patriarchat. Dieses Herrschafts-
system soll in diesem Unterkapitel vorgestellt werden. Ebenfalls liefert das Kapitel
einen kurzen Blick auf die Genderforschung und ihre wichtigsten Theorieschulen.
Zudem wird gezeigt, was die gängigen Zuschreibungen von Männlichkeit sind und
dass Männer die Gewinner im Patriarchat sind. Dies alles ergibt einen weiteren theo-
retischen Rahmen zur Beantwortung der Fragestellung.
Das Patriarchat ist die dominante Besetzung von Machtpostionen durch Männer in
allen sozialen Bereichen (Degele 2008: 38). Oder wie es Sylvia Walby (1990: 20) aus-
drückt: „A system of social structures and social practice in which men dominate, op-
press and exploit women.“ Dass es nach wie vor soziale Ungleichheiten aufgrund des
Geschlechtes gibt, lässt sich weltweit feststellen (Connell 2008: 145-151).
Das Patriarchat beruht auf einer dichotomen Trennung der Geschlechter in Mann und
Frau. Dem biologischen Geschlecht (sex), auf welchem die Reproduktionstätigkeiten
der Menschen beruhen, werden soziale Zuschreibungen (gender) gemacht (Connell
2008: 7-11). Zudem werden Zuschreibungen von Eigenschaften und Rollenverteilung
vorgenommen. Diese sozial konstruierten Zuschreibungen werden als naturalisiert
wahrgenommen und unreflektiert in den Naturwissenschaften wiedergegeben (Voss
2011; Honegger 1991). Diese sozialen Zuschreibungen beeinflussen die Menschen,
sowohl bei „privaten“ Tätigkeiten wie der Sexualität (Weeks 2003: 41-64), bei ihrer
Identitätskonstruktion (Breger 2009: 47-65), wie auch bei gesellschaftlichen Machtfra-
Theorie 9
gen (Connell 2008: 136-145). Da diese Geschlechterdifferenzierung als natürlich wahr-
genommen wird, werden auch die sozialen Unterschiede, die zwischen den
Geschlechtern entstehen als natürlich hingenommen. Die Unterschiede dienen der ge-
sellschaftlichen Ordnung zu einer Hierarchisierung von Mann (oben) und Frau (unten)
(Becker-Schmidt 1998).
In der Genderforschung (Geschlechterforschung) lassen sich drei Hauptrichtungen
unterscheiden: Die strukturorientierte Gesellschaftskritik fokussiert auf die Makroebene
der gesellschaftlichen Strukturen und der daraus resultierenden Unterdrückung der
Frauen. Der interaktionistische Konstruktivismus konzentriert sich auf Prozesse, wie
die Geschlechter gemacht werden (doing gender). Dabei interessiert das „wie“ stärker
als die Frage nach dem „was“ oder „warum“. Der jüngste Ansatz, der diskurstheo-
retische Dekonstruktivismus, beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Diskursen über
die Geschlechter (Degele 2008: 16-19). Aus dieser Schule ist die Queer Theorie ent-
standen. Sie befasst sich stark mit den aus den gesellschaftlich von der Norm ausge-
schlossenen wie Nicht-Heterosexuellen (Jagose 2005: 95-128) oder Geschlechtsun-
eindeutigen (Schrötter 2002: 7-14).
Luedtke und Baur (2008: 7f) bemängeln, dass in der Soziologie das Wissen über den
Forschungsgegenstand Mann sehr beschränkt sei. Zwar wird in der Forschung der
Mann als „normal“ und als Ausgangspunkt angesehen, aber oft nicht weiter wissen-
schaftlich behandelt. Die „Männerforschung“ sei aber einerseits ein wichtiger Beitrag
zur Gesellschaftsforschung und auf der anderen Seite wird damit ein „blinder Fleck“ in
der Wissenschaft aufgearbeitet (Wichert 2004: 26). Heute sei es normal über „Frau-
enthemen“ zu sprechen und zu forschen. Jedes „Frauenthema“ ist aber auch ein
„Männerthema“. Wenn Frauen ökonomisch ausgebeutet werden gibt es auf der
anderen Seite Männer die ökonomisch davon profitieren (Connell 2006: 13-15).
Der Mann und die dazugehörige Männlichkeit kann nicht abgetrennt von der Frau
respektive der Weiblichkeit gesellschaftlich konstruiert werden. Deshalb sind Zu-
schreibungen zu den Geschlechtern jeweils Gegensatzpaare. So gilt der Mann als
stark, aufrichtig, unabhängig, rein, risikofreudig und rationell. Er ist eine Führungsfigur,
promiskuitiv und macht Jagd auf Frauen für den Geschlechtsverkehr. Die Welt
„draussen“ ist sein Platz. Die Frau hingegen gilt als schwach, unterwürfig, irrational,
vorsichtig und schmutzig. Sie kann gehorchen, aber nicht führen. Sie ist dem Mann
stets treu und beim Sex das zu erlegende Wild. Das Haus, der geschlossene Raum, ist
ihr Platz. Der Mann und die Männlichkeit ist dominant, die Frau und die Weiblichkeit
untergeordnet (Wilchins 2006: 47-61; Honegger 2010: 160-172). Als Grundvoraus-
Theorie 10
setzung für Männlichkeit und Weiblichkeit gilt die Heterosexualität und die Ehe, welche
den formellen Rahmen dazu bietet (Meuser 2010: 102).
Eine Untersuchung der Männlichkeit bringt ein weitergehendes Verständnis der gesell-
schaftlichen Mechanismen der sozialen Ungleichheiten, welche das Patriarchat verur-
sacht. Die sozialen Zuschreibungen, welche in der Diskriminierung der Frauen enden,
existieren nur, wenn die Männlichkeit als Differenz dazu dient. In der neueren For-
schungen werden Sozialstrukturen als ungleichheitsgenerierendes Element oft ver-
nachlässigt. Sowohl bei der Analyse von Identitätskonstruktionen, dem Doing Gender
und den Diskursen sollten aber die sozialen Strukturen ebenfalls berücksichtigt wer-
den, um ein umfassendes Verständnis für die sozialen Ungleichheiten zu ermöglichen.
2.3 Zusammenspiel und IntersektionalitätZiel dieses Unterkapitel ist es aufzuzeigen, in welcher Beziehung die beiden Herr-
schaftssysteme Kapitalismus und Patriarchat zueinander stehen. Ob sie zwei vonein-
ander unabhängige Systeme sind oder ob sie miteinander verbunden sind. Ausserdem
soll die Theorie der Mehrfachunterdrückung, die Intersektionalität, dargestellt werden.
Hierbei interessiert ebenfalls, wie die Unterdrückungen geschehen, also auf welchen
Ebenen sie ansetzen. Die Analyse von Mehrfachunterdrückungen hilft dabei aufzu-
decken, wer innerhalb des gesellschaftlich-hierarchischen Machtgefüges „oben“ ist und
wer „unten“.
In der marxistischen Theorie und grossen Teilen der 1968er-Studierendenbewegung
wurde lange Zeit der Kapitalismus und sein Gegensatz von Kapital und Arbeit als
Hauptwiderspruch gesehen. Wenn der Kapitalismus abgeschafft werde, würde sich die
Unterdrückung der Frauen aufheben und das Patriarchat wäre beseitigt (Trumann
2002: 50; Hearn 1991: 238f). In der radikalen Frauenbewegung wurde hingegen das
Patriarchat als primärer Unterdrückungsmechanismus gesehen, welcher losgelöst vom
Kapitalismus existiert. Frauen und Männer stehen sich in diesem Verständnis wie zwei
Klassen mit unterschiedlichen Interessen gegenüber (Meuser 2010: 81).
Der dual-system-Ansatz in der Frauenforschung geht hingegen davon aus, dass die
beiden Systeme aufeinander als interdependente Systeme wirken. Kapitalismus und
Patriarchat sind damit nicht aufeinander reduzierbare Systeme (Walby 1986). In der
Männerforschung wird heute ähnlich argumentiert.
Neu ist hier die Aussage und das Forschungsinteresse, dass auch Männer z.B. Homo-
sexuelle unter dem Patriarchat leiden können, obwohl sie als Männer eigentlich
Akteure und Agenten der Unterdrückung sind (Bereswil et al. 2007: 9). Jeff Hearn
Theorie 11
(1987: 121) bringt diese Verwobenheit und Nicht-Reduzierbarkeit der beiden Systeme
auf den Punkt:
„Capitalism operates by conversion of wage labour to value and profit; patriarchy by the appropriation of the unwaged labour and energy of women to produce male power. Both are concerned with the control and accumulation of the creativity, labour and energy of women and men.“
Damit lässt sich sagen, dass Personen sowohl von den beiden Herrschaftssystemen
oder nur von einem unterdrückt werden können, oder von einem oder beiden profitie-
ren können.
Ein wichtiges theoretisches Konzept, welches sich mit der Mehrfachunterdrückung von
Personen beschäftigt, ist die Intersektionalität. Intersektionalität steht für das Zusam-
mendenken und Zusammenfallen verschiedener Formen von sozialer Ungleichheit auf
Grund von mehreren Merkmalen. Insbesondere in der Geschlechterforschung gehört
die Intersektionalität heute zu den wichtigsten Forschungszweigen (Kerner 2010: 312).
Erfunden wurde die Theorie der Intersektionalität rund um die Bewegung des Black
Feminism (Crenshaw 1997) und wurde seither weiterentwickelt.
Die Intersektionalität ist bis heute keine einheitliche Theorie. So besteht beispielsweise
keine Einigkeit, welche und wie viele Ungleichheitskategorien in der Intersektionalitäts-
forschung untersucht werden sollen (Kolar 2010: 4). Die drei gängigsten Kategorien
sind classism (Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit), sexism (Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechtes) und racism (Diskriminierung aufgrund sozial oder
politisch konstruierter „Rassen“). Andere Theoretikerinnen und Theoretiker gehen von
einer Vielzahl zusätzlicher Kategorien aus. Diese können sein: Körper, Sexualität, Alter
etc. (Winker und Degele 2010: 15-18). Judith Butler (1991: 143) gibt hierbei zu beden-
ken, dass ein Subjekt nie mit allen relevanten Kategorien beschrieben werden kann, da
ein Subjekt von einer unendlichen Anzahl von Kategorien erfasst wird. Auch bei den
Ebenen, welche untersucht werden sollen, gibt es keine Einigkeit (Kolar 2010: 3f). Es
sind zur Analyse drei Ebenen denkbar: 1. Gesellschaftliche Sozialstrukturen (Makro-
ebene); 2. Identitätsbildung wie beispielsweise in der Kategorie Geschlecht das doing
gender (Mikroebene) und/oder 3. kulturelle und symbolische Repräsentationen (Meso-
ebene) (Winker und Degele 2010: 18-20). Je nach Ansatz werden eine oder mehrere
Ebenen gewählt.
Viele Untersuchungen sehen die Ebenen als voneinander unabhängig und nicht mitein-
ander verbunden (Ebd.: 19). Dabei zeigen beispielsweise die Theorien von Pierre
Bourdieu (1987) oder Anthony Giddens (1991), dass die einzelnen Ebenen Structure
(Makro) und Agency (Mikro) aufeinander einwirken. Deshalb kann davon ausgegangen
werden, dass es zwischen den Ebenen zahlreiche Wechselwirkungen gibt. Wie diese
Theorie 12
genau verlaufen und funktionieren, ist in der Theorie nach wie vor umstritten (Kolar
2010: 4). Die Methode der Intersektionalität als Mehrebenenanalyse und die Theorie
von Winker und Degele (2010; 2007) dazu werden im Methodenkapitel ausführlicher
dargestellt und kritisch bewertet.
In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass es eine Verbindung zwischen den
beiden Herrschaftssystemen Kapitalismus und Patriarchat gibt. Sie sind miteinander
verwoben und sollten nicht einzeln betrachtet werden. Ebenfalls wurde gezeigt, dass in
der Intersektionalitätsforschung verschiedene Diskriminierungssysteme, wie classism
und sexism, als Mehrfachunterdrückung untersucht werden. Die Diskrimierungen kön-
nen sowohl auf der Makro-, der Meso- und Mikroebene erfolgen. Die Ebenen können
alle gemeinsam untersucht werden und ebenso die Wechselbeziehungen dieser
untereinander.
2.4 Hegemoniale MännlichkeitRaewyn Connell leistete mit ihrem Konzept der „hegemonialen Männlichkeit“ einen der
meist diskutierten und verwendeten Ansätze in der Männlichkeitsforschung. Der Begriff
der Hegemonie hat Connell von Antonio Gramsci entliehen. Hegemonie ist „die Fähig-
keit einer herrschenden Schicht, Klasse, ihre Dominanz über die Gesellschaft aufrecht-
zuerhalten, ohne auf direkte Formen der Repression oder Gewalt angewiesen zu sein"
(Schultze 2005: 336). Connell bearbeitet u.a. mit dem theoretischen Konzept der hege-
monialen Männlichkeit das Verhältnis zwischen Handlung und Struktur zwischen den
Geschlechtern. Das Konzept verbindet Macht und soziale Konstruktion miteinander
und zeigt, dass Geschlecht nicht nur eine persönliche Identität ist, sondern eingebettet
ist in soziale Strukturen (Meuser 2010: 100-108). Die Dominanz des Mannes wird in
dieser Analyse um eine kulturtheoretische Perspektive erweitert und hierarchische
Beziehungen unter Männern lassen sich differenzierter betrachten (Bereswil et al.
2007: 10).
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit zeigt die ungleichheitsstrukturierende
Kraft in der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft auf. Männlichkeit ist für Connell
eine soziale Praxis und muss immer als solche verstanden und untersucht werden
(Connell 2006: 92). Zuerst unterscheidet Connell in ihrer Theorie die Struktur des
sozialen Geschlechtes: Die Geschlechterverhältnisse sind in drei Strukturen organi-
siert, nämlich Machtbeziehungen, Produktionsbeziehungen und emotionalen Bindungs-
strukturen (Meuser 2010: 100). In der vorherrschenden westlichen Gesellschaftsord-
nung ist die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann, trotz einigen Ausnahmen,
Theorie 13
nach wie vor die dominante Machtbeziehung. In den Produktionsbeziehungen ist eine
klare Bevorteilung der Männer in den Bereichen Besitz und Erwerbsarbeit feststellbar.
Frauen dominieren im unbezahlten, nicht sichtbaren Teil der Arbeit. Männer sind die
Gewinner im geschlechtsbezogenen Akkumulationsprozess. In der Struktur der
emotionalen Bindungen ist ein gesellschaftlicher Zwang zur monogamen Hetero-
sexualität und männlichen Dominanz feststellbar (Connell 2006: 94-96).
Das Geschlechterverhältnis und die damit einhergehende Männlichkeit ist mit dem
Faktor Klasse und anderen verknüpft. Sie überschneiden sich und interagieren mitein-
ander. „Und entsprechend kann man auch nicht die Gestaltung von Männlichkeit der
Arbeiterklasse begreifen, wenn man neben der Geschlechtspolitik nicht auch die Klas-
senzugehörigkeit berücksichtig“ (Ebd.: 96). Somit wird klar, dass es mehr als ein
Muster von Männlichkeit gibt und von Männlichkeiten gesprochen werden muss, da es
nicht einfach einen einzigen Typus gibt (Connell 2004: 287).
Neben der Klassenzugehörigkeit ist für Connell auch die Kultur ausschlaggebend
dafür, dass es verschiedene Männlichkeiten gibt: „Wir können daher erwarten, dass es
in multikulturellen Gesellschaften multiple Definitionen und Dynamiken von Männlich-
keit gibt“ (Ebd.: 288). Die Fragen nach Klasse oder sozialen Ungleichheiten können
nicht ohne den Rückgriff auf das soziale Geschlecht beantwortet werden. „Die
Beziehungen zwischen den Geschlechtern sind ein wesentlicher Bestandteil der sozia-
len Strukturen, und Geschlechterpolitik ist einer der Hauptfaktoren unseres kollektiven
Schicksals“ (Connell 2006: 97). Damit ist begründet, wieso ein Mann aus der obereren
Klasse eine andere Männlichkeit hat, als ein Mann aus der Arbeiterklasse. Ihre Männ-
lichkeiten werden aufgrund der unterschiedlichen sozialen Strukturen, welcher sie
unterliegen, anders konstruiert und gelebt. „Vielfalt gibt es auch innerhalb eines gege-
benen Settings. Innerhalb einer Schule oder eines Arbeitsplatzes oder einer ethnischen
Gruppe wird es verschiedene Arten […]“ der Männlichkeit geben (Connell 2004:
288).Weiter zeigt Connell auf, dass es unter den verschiedenen Formen von
Männlichkeit ein hierarchisches Verhältnis gibt. Nicht nur die Frauen sind gewissen
Formen von Männlichkeiten untergeordnet, auch unter den Männern lässt sich eine
Dominanz erkennen (Meuser 2010: 103).
2.4.1 (Ideal-)Typen der Männlichkeit
Innerhalb der untersuchten Situationen und sozialen Beziehungen lässt sich eine hege-
moniale Männlichkeit herauskristallisieren. Diese Männlichkeit ist die anerkannteste
und begehrteste Form der Männlichkeit. Sie steht in der hierarchischen Ordnung zu
oberst (Connell 2004: 288). „Zu jeder Zeit wird eine Form von Männlichkeit im Gegen-
Theorie 14
satz zu den anderen kulturell hervorgehoben“ (Connell 2006: 98). Hegemoniale Männ-
lichkeit ist dabei nicht als eine feste Charaktereigenschaft zu verstehen. Sie gilt als
kulturelles Ideal, als ein Orientierungsmuster, welches dem gesellschaftlich gewollten
Männlichkeitsstruktur zu Grunde liegt (Meuser 2010: 101).
„Hegemoniale Männlichkeit kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentane akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet“ (Connell 2006: 98).
Hegemoniale Männlichkeit ist weder die am meisten verbreitetste Form von Männlich-
keit, noch müssen alle mächtigen Männer ihr unterliegen, noch ist sie die komfor-
tabelste (Connell 2004: 233). Ihre Hegemonie kann die hegemoniale Männlichkeit nur
entfalten, wenn es eine kollektive oder individuelle Entsprechung zwischen dem
kulturellen Ideal der hegemonialen Männlichkeit und der institutionellen Macht gibt. Die
hegemoniale Männlichkeit lässt sich deshalb insbesondere bei den Führungseliten von
Wirtschaft (z.B. Managern), Militär und Politik feststellen (Connell 2006: 98).
Neben der hegemonialen Männlichkeit gibt es eine Vielzahl von weiteren Männlichkei-
ten in einer Gesellschaft. Connell unterscheidet zunächst zwei weitere Männlichkeits-
typen: die autorisierte Männlichkeit und die marginalisierte Männlichkeit. Die autori-
sierte Männlichkeit orientiert sich an der hegemonialen Männlichkeit und wird gesell-
schaftlich anerkannt. Marginalisierte Männlichkeiten hingegen sind Männlichkeiten von
Männern, die beispielsweise aufgrund ihrer ethnischen, sexuellen oder ihrer Klassen-
zugehörigkeit weniger anerkannt sind und von der hegemonialen Männlichkeit ausge-
schlossen werden. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse haben sie beispiels-
weise keinen Zugang zu den mächtigen Männerbünden (Studentenverbindungen,
Lions Club etc.), die nötig sind um die hegemoniale Männlichkeit zu erlernen oder
wenigstens als autorisiert zu wirken (Meuser 2010: 104f).
Die gesellschaftliche Zuteilung autorisiert/ marginalisiert entsteht durch die gesell-
schaftliche Interaktion des sozialen Geschlechtes mit anderen Strukturen wie Klasse
oder „Rasse“. Deshalb gelten beispielsweise Ausländer oder einfache Arbeiter als
marginalisiert und besitzen keine autorisierte Männlichkeit (Connell 2006: 101f).
Die erwähnten Typen von Männlichkeiten lassen sich noch weiter unterscheiden. Wer
zum Beispiel als weisser Hochschulprofessor über eine autorisierte Männlichkeit ver-
fügt, besitzt nicht zwingend eine hegemoniale Männlichkeit. Nur wenige Männer
erreichen das Ideal der vollen hegemonialen Männlichkeit. Sie dient als Orientierungs-
muster und wird von den meisten Männern gestützt, da es die wirksamste Form zur
Aufrechterhaltung des vorherrschenden Patriarchats ist (Meuser 2010: 104f).
Diese Männer lassen sich als Komplizen der hegemonialen Männlichkeit definieren.
Theorie 15
Sie profitieren von der patriarchalen Dividende, dem allgemeinen Vorteil, welchen Män-
nern aus der Unterdrückung der Frauen erwächst. Männer, welche eine Komplizen-
schaft mit der hegemonialen Männlichkeit eingehen, gehorchen den wichtigsten Grund-
regeln der vorherrschenden hegemonialen Männlichkeit. Diese Männer sind in der
Regel heterosexuell, bringen einen Familienlohn nach Hause und akzeptieren die
hegemonialen Männlichkeit als herrschende Form. Trotzdem entspricht ihre Männlich-
keit nicht dem Ideal und sie stehen somit im Widerspruch zum Ideal (Connell 2006:
100f). Sowohl autorisierte als auch marginalisierte Männlichkeiten können eine Kompli-
zenschaft eingehen.
Ein weiterer Typus ist die untergeordnete Männlichkeit. Ihr gehören Männer an, welche
gegen die Grundzüge der hegemonialen Männlichkeit verstossen. Dies sind beispiels-
weise homosexuelle Männer. Sie Verstossen gegen den Grundsatz der Heterosexuali-
tät und deshalb wird ihnen negatives und „weibliches“ Verhalten zugeschrieben (Ebd.:
99f).
2.4.2 Veränderung und Sozialisierung
Da die Männlichkeiten soziale Konstrukte sind und auch die hegemoniale Männlichkeit
ein Produkt der vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen ist, ändern sich diese
im Laufe der Zeit. Zu unterschiedlichen Zeiten hatten unterschiedliche Gruppen die
Macht, ihre Männlichkeitsvorstellungen als hegemonial durchzusetzen. Diese Durch-
setzung gelang indem sie die Männlichkeit im jeweiligen institutionellen und politischen
Rahmen festschreiben liessen. In Deutschland dominierte früher das Militär und mili-
tärische Männlichkeitsideale entsprachen der hegemonialen Männlichkeit. Seit Ende
des 2. Weltkrieges gelten insbesondere Führungskräfte aus der Wirtschaft als hegemo-
nial und tragen ihr Männlichkeitsbild in die Gesellschaft (Luedtke und Baur 2008: 11).
Dieses von einer Gruppe vorgelebte Männerbild wird in der Kultur kollektiv konstruiert
und in Institutionen aufrechterhalten und weitergegeben (Connell 2004: 289). Knaben
erlernen die Regeln der Männlichkeit während ihrer Sozialisation (Luedtke und Baur
2008: 10). Der Prozess der Konstruktion und Inszenierung der jeweiligen Männlichkei-
ten findet beispielsweise in Face-to-Face-Interaktionen in den Klassenräumen oder
Schulhöfen statt (Connell 2004: 11). Besonders homosoziale Räume (hier rein männ-
liche wie Militär, Sportvereine etc.) und Wettkämpfe dienen zum Erlernen der hegemo-
nialen Männlichkeit und dem Kennenlernen der Spielregeln der Männlichkeit (Meuser
2010: 104). Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Erlernen respektive Aufrechterhalten
der hegemonialen Männlichkeit bieten die Medien, wie zum Beispiel die Zeitungen und
Magazine (Wichert 2004: 46-48).
Theorie 16
Connell liefert mit ihrem Konzept der hegemonialen Männlichkeit ein Analysemuster,
welches die Geschlechter gemeinsam mit anderen sozialen Strukturen wie der Klasse
analysieren kann. Das Konzept vermag sowohl die Dominanz und Unterordnungsver-
hältnisse zwischen Männern und Frauen als auch unter Männern zu erklären. Dennoch
ist es keine fertige Theorie. Es fehlen Spezifizierungen was z.B. neben der Hetero-
sexualität weitere wichtige Grundregeln der vorherrschenden hegemonialen Männlich-
keit sind und was sie alles beinhaltet. Die Feststellung, dass sich die anderen Männern
aber jeweils an der hegemonialen Männlichkeit orientieren und dass sie während der
Sozialisierung und in den Institutionen aufrechterhalten und vermittelt wird, gibt einen
wichtigen Analyserahmen. Zudem ist die Theorie gut kombinierbar mit anderen
Theorien wie Bourdieus Habitustheorie.
2.5 Pierre Bourdieus HabitustheorieBourdieu versuchte in seinen Theorien und Forschungen den Graben zwischen struk-
turalistischen und individuellen Handlungstheorien zu überbrücken. Er wandte sich
damit einerseits gegen Theorien, welche individuelle Handlungen der Menschen auf-
grund von ökonomischen Erklärungen wie dem rational-choice-Ansatz erklären wollen
(Fuchs-Heinritz und König 2005: 113).
Anderseits argumentiert er gegen rein strukturalistische Ansätze wie die Claude Lévi-
Strauss' oder Karl Marx', welche menschliches Handeln rein an Hand von sozialen
Strukturen, Regeln und Sitten erklären (Ebd.: 114). Bourdieus Theorie erlaubt damit bei
sozialen Ungleichheiten sowohl die Mikro- als auch die Makroebenen zu betrachten.
Die sozialen Ungleichheiten, ihre Reproduktion und die Herrschaftsverhältnisse
gehörten zu den wichtigsten Erkenntnisinteressen Bourdieus.
Ausgangspunkt für Bourdieus Forschungen war dabei immer die soziale Praxis der
Menschen. Er wollte die Logik der Praxis beschreiben und nicht einfach die Praxis der
Logik (Bohn und Hahn 2003: 255). Das Ergebnis seiner Forschung war die Habitus-
theorie, welche er ausführlich in seiner Forschung „Die feinen Unterschiede“ erläuterte.
Der Habitus ist „Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Reprä-
sentationen“ (Bourdieu 1976: 165). Der Habitus „gewährleistet die aktive Präsenz
früheren Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmung-,
Denk- und Handlungsschemata niederschlagen“ (Bourdieu 1999: 101). Damit stellt der
Habitus für jede passende Situation ein Set von Wahrnehmungsschemata (Wahrneh-
mung der sozialen Welt), Denkschemata (Interpretationsmöglichkeiten von Wahrge-
nommenem) und Handlungsschemata (Reaktionsmöglichkeiten auf die wahrgenom-
Theorie 17
menen und interpretierten Ereignissen) bereit (Fuchs-Heinritz und König 2005: 114).
Der Habitus ist immer an seine bestehende Soziallage gebunden und damit klassenab-
hängig (Bourdieu 1987: 79).
Durch das unterschiedliche Set an Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata,
welches der Habitus einer Person zur Verfügung stellt, haben Menschen aus unter-
schiedlichen sozialen Lagen beispielsweise einen anderen Geschmack. Eine Mahlzeit,
ein Bild oder ein Sofa werden unterschiedlich wahrgenommen, interpretiert, bewertet
und führen zu anderen Handlungen. Der Geschmack ist also nicht naturgegeben, son-
dern korreliert mit der sozialen Lage und dem dazugehörigen Habitus (Fuchs-Heinritz
und König 2005: 125). Dies hängt damit zusammen, wie der Habitus entsteht.
Bourdieu argumentiert, dass der Habitus „einverleibt“ wird (Ebd.: 134). Dieser Prozess
beginnt bereits in der Kindheit. In Gesellschaften ohne pädagogischem System (z.B.
öffentliche Schulen) erfolgt die Einverleibung durch die soziale Praxis selbst und dem
vertraut werden mit den Habitus der Menschen in der Umgebung. Ein Beispiel dafür
sind Höflichkeitsregeln, Körperhaltungen etc., welche Kinder übernehmen. Sie geben
gleichzeitig Aufschluss über Machtverhältnisse, Politik, Ethik etc. aus dem Umfeld des
Kindes (Bourdieu 1987: 190f). Damit wird die starke Rolle ungleicher Sozialstrukturen
in der Gesellschaft (z.B. Bildung, Herkunft, Wirtschaft) auf die Herausbildung von sub-
jektiven Denk- und Handlungsmustern des Habitus klar ersichtlich.
Der individuelle Habitus eines Menschen (z.B. Geschmack, Sprache, Konsumverhal-
ten) sind damit unbewusste Verinnerlichungen strukturell vorgegebener, klassen- und
geschlechtsspezifischer Grenzen. Der Habitus repräsentiert diese Bedingungen und
generiert dadurch Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Ein Habitus formt
sich zusammengefasst durch die Verinnerlichung der äusseren gesellschaftlichen
(materiellen und kulturellen) Bedingungen, welche geprägt sind durch die spezifische
Stellung, das Geschlecht und die soziale Klasse des Akteurs (Ebd.: 138).
2.5.1 Klassenhabitus
Die Lage der sozialen Akteure verordnet Bourdieu im „sozialen Feld“. Der Habitus ist
die subjektive Struktur jedes Individuums, während das soziale Feld die objektiven,
äusseren Strukturen sind. Die sozialen Felder sind strukturierte Räume, in denen die
Praxis zur Geltung kommt. Diese Strukturen sind vom Willen und Bewusstsein der
AkteurInnen relativ unabhängig. Abgrenzungsmöglichkeiten der Felder untereinander
bietet die unterschiedliche Akkumulation von mehreren unterschiedlichen Kapitalsorten
(Bourdieu 1987: S. 170-194).
Theorie 18
Gemäss Bourdieu (Bourdieu 1987; Fuchs-Heinritz und König 2005: 157-170) ist das
wichtigste Kapital das ökonomische Kapital. Als ökonomisches Kapital versteht er
sämtlichen materiellen Besitz und Verfügbarkeit über diesen, welcher in Geld umge-
wandelt werden kann.
Das kulturelle Kapital tritt in drei Formen in Erscheinung. In der objektiven Form
besteht kulturelles Kapital als Bücher, Kunstwerken, technische Instrumente etc. Das
inkorporierte Kulturkapital besteht aus kulturellen Fähigkeiten, Kenntnissen, Wissen
etc. Institutionalisiertes Kapital besteht aus Bildungstiteln und Abschlüssen.
Als dritte Kapitelform tritt das soziale Kapital auf. Es besteht aus den Möglichkeiten,
andere um Hilfe, Rat oder Informationen zu bitten, sowie die Chance durch Gruppen-
zugehörigkeit diese durchzusetzen.
Als letztes Kapital nennt er das symbolische Kapital. Das symbolische Kapital besteht
aus den Chancen, soziale Anerkennung und soziales Prestige zu gewinnen. Das
symbolische Kapital tritt in der Regel mit anderen Kapitalsorten gemeinsam auf und
macht diese bedeutsam.
Die sozialen Felder alleine reichen aber nicht, um die Stellung der AkteurInnen inner-
halb einer hierarchischen Gruppenordnung zu erklären. Dafür führt Bourdieu den
sozialen Raum ein, welcher die Einordnung der AkteurInnen erlaubt. Die Stellung der
AkteurInnen im sozialen Raum ist von der Akkumulation von Kapitalien abhängig
(Bourdieu 1987: 727-755). In einem zweidimensionalen Raum (ökonomisch und kul-
turellen) lassen sich damit folgende Klassen und Klassenfraktionen bilden: Die herr-
schende Klasse mit der Fraktion der herrschenden Herrschenden (z.B. ManagerInnen),
welche viel ökonomisches, aber wenig kulturelles Kapital besitzen und den
beherrschten Herrschenden (z.B. BildungsbürgerInnen), welche viel kulturelles, aber
wenig ökonomisches Kapital besitzen. Die Klasse der Kleinbürgerlichen, welche von
einem oder beiden Kapitalen ein wenig besitzen. Sowie die Klasse der Beherrschten,
welche wenig von beiden Kapitalsorten besitzen (Fuchs-Heinritz und König 2005: 55).
Die Herrschenden entwickeln Reproduktionsstrategien um für sich und ihre Familien
die Anhäufung von Kapital zu sichern und ihre Machtstellung zu behalten. Menschen
der beherrschten Klasse und besonders die Kleinbürgerlichen versuchen ihrerseits den
Aufstieg (Bourdieu 1987: 210). Dies geschieht einerseits in dem sie versuchen Kapital
zu erwerben. Dieses Kapital wird wiederum von den Herrschenden geschützt.
Andererseits orientieren sich die unteren Klassen an der höheren Klassen, z.B. den
ManagerInnen, und versuchen neben der angestrebten Kapitalakkumulation, auch
Theorie 19
ihren Habitus an den der Herrschenden anzupassen. Die ManagerInnen versuchen
gleichzeitig dies abzuwehren indem sie ihren Habitus respektive ihr Verhalten von den
anderen abgrenzen, auch wenn sich dies nur in feinen Unterschieden niederschlägt
(Ebd.: 210-269).
Gleichzeitig können sich die Herrschenden auf symbolische Gewalt verlassen, welche
ihrem Habitus innewohnt. Symbolische Gewalt ist das Potenzial Bedeutungen und An-
erkennung durchzusetzen. Diese Bedeutungen und Anerkennungen werden als natür-
liche Grenze wahrgenommen. Die Herrschenden können sich darauf verlassen, dass
die Beherrschten eine in ihrem Habitus angelegte Bereitschaft haben den Herrschen-
den zu folgen. Dies wird den Beherrschten beim Herausbilden des Habitus beigebracht
z.B. im Schulsystem (Fuchs-Heinritz und König 2005: 207f). ArbeiterInnen werden also
einem Manager folgen, da sie habituell dazu angelernt wurden. Um besser gestellt zu
werden, wollen Beherrschte nicht das System der Unterdrückung und ihre Reprä-
sentantInnen (z.B. ManagerInnen) wegjagen, sondern sie versuchen selbst innerhalb
des bestehenden System aufzusteigen.
2.5.2 Männlicher Habitus
Oft nutzt Bourdieu in Darstellungen und Analysen nur die Sphäre der Klasse. Bourdieu
kann aber mit seinen Theorien nicht nur die sozialen Unterschiede aufgrund der Klasse
erklären. In verschiedenen Teilargumenten werden andere Dimensionen von sozialer
Ungleichheit (Geschlecht, Alter, Ethnie) hinzugenommen (Fuchs-Heinritz und König
2005: 58).
Auf die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten ging Bourdieu (2005) insbesondere in
seinem Werk Die männliche Herrschaft ein. Er ging davon aus, dass der Habitus
sowohl klassen- wie auch geschlechtsspezifisch wirkt. Das Geschlecht ist in der
Gesellschaft immer an einen spezifischen Habitus gebunden. Dieser Habitus generiert
gewisse Praxen und verhindert andere. Im Habitus ist das Geschlecht verankert (opus
operatum), indem es ein Geschlecht ausführt (modus operandi) und reproduziert sich
im Handeln der Person (Meuser 2010: 116f). Der Habitus ordnet also nicht nur die
Klassenzugehörigkeit und das entsprechende Verhalten, sondern tut dies auch bei den
Geschlechtern. Dadurch lässt sich auch erklären, wieso zum Beispiel Frauen in der
Oberschicht anders handeln und behandelt werden als Männer. Bourdieu vereinigt
folglich mit seinem Konzept die beiden Systeme Kapitalismus und Patriarchat.
Bourdieu begründet die Herrschaft der Männer wie folgt: Die Institution der männlichen
Herrschaft hat sich seit Jahrtausenden in die „Objektivität der sozialen Strukturen und
Theorie 20
in die Subjektivität der mentalen Strukturen eingeschrieben“ (Bourdieu 1997: 153). Die
Geschlechterunterschiede werden naturalisiert. Es werden zwei Systeme naturalisier-
ter sozialer Unterschiede festgeschrieben und im Habitus inkorporiert. Frauen überneh-
men ein durch die männliche Sicht vermitteltes Selbstbild und „verleihen damit einer
Identität, die ihnen gesellschaftlich aufgezwungen worden ist, den Anschein, in Natur
fundiert zu sein“ (Bourdieu 2005: 43-62). Die negativen Vorurteile wirken dabei als self-
fulfilling prophecies (Bourdieu 1997: 163f).
Die männliche Herrschaft ist dabei eine symbolische Herrschaft. Durch symbolische
Macht werden die Unterdrückten (Frauen in den Geschlechterperspektive) dazu
gebracht die Machtbeziehung zu inkorporieren und diese für legitim zu befinden. Auch
die binären Denkschemata und Wahrnehmungskategorien (gut/schlecht, gross/klein,
etc.) werden von den Beherrschten übernommen und auch für die Selbstbewertung
verwendet (Bourdieu 1997: 165f). Das gleiche Schema der Herrschaft funktioniert auch
bei der Klassenstruktur.
Analog zum klassenspezifischen Habitus funktioniert dessen Reproduktion und damit
der Fortbestand der Herrschaftsverhältnisse stark mit der Sozialisierung der Individuen
und dem Ausschluss aus gewissen Sphären. Gerade im Bereich der Ökonomie ist
vieles so organisiert, dass Männer einen einfacheren Zugang haben als Frauen. Häufig
erhalten Frauen gar nie die Möglichkeit dieselben Dinge für ihren Habitus zu lernen wie
Männer. Damit gelingt es den Männern ihre Vorherrschaft über die Frauen zu sichern
und auf der anderen Seite ihren abgrenzenden Habitus analog der Der Feinen Unter-
schiede im Klassenhabitus zu erzeugen (Bourdieu 2005: 167-184).
Der männliche Habitus wird im Besonderen in homosozialen Räumen verinnerlicht und
erlernt: „konstruiert und vollendet wird der Habitus nur in Verbindung mit dem den Män-
nern vorbehaltenen Raum, in dem sich, unter Männern, die ernsten Spiele des Wettbe-
werbes abspielen.“ Beispiele dafür sind Militär, Netzwerke, Management etc. (Bourdieu
1997: 167). Männlichkeit ist für Bourdieu ein relationaler Begriff, der von und für die
Männer konstruiert ist und gegen die Weiblichkeit besteht (Bourdieu 2005: 96). Inner-
halb von homosozialen Räumen finden auch die Wettbewerbe der Männer unterein-
ander statt. Dieser Wettbewerb zwischen „Partner-Gegnern“ ergibt für die Männer nicht
nur Hierarchien untereinander, sondern ist gleichzeitig ein weiteres Mittel der Inkor-
porierung des männlichen Habitus (Ebd.: 83).
Der Prozess, welcher zur Entstehung des männlichen Habitus führt und die Strategie
der Reproduktion desselben, zeigt zwei wichtige Dinge auf: Erstens werden dadurch
Theorie 21
Frauen konsequent von der Macht weggehalten, da die Männlichkeit und damit die
Herrschaft innerhalb von homosozialen Räumen als Abgrenzung gegen sie konstruiert
wird. Zweitens besitzen Männer untereinander ebenfalls unterschiedliche männliche
Habitus. Ein Manager kann nicht den gleichen männlichen Habitus haben wie ein
Arbeiter, da die beiden ihren männlichen Habitus genauso wie den Klassenhabitus an
anderen Orten inkorporieren. Dies ist bedingt durch die unterschiedlich verlaufende
Sozialisierung und den Reproduktionsstrategien der Herrschenden. Wer also nach
„oben“ will (z.B. Kleinbürgerliche), wird versuchen sowohl seinen Klassenhabitus als
auch den Geschlechterhabitus denen der herrschenden Herrschenden Männern anzu-
passen, um den Aufstieg zu schaffen. Damit erlaubt Bourdieus Theorie eine Verbin-
dung von verschiedenen Ungleichheitskategorien und die Betrachtung ihrer Gewinner.
Sie bietet nicht bloss eine Analysemöglichkeit für die Klassen oder das Geschlecht.
2.6 Synthese zur hegemonialen ManagermännlichkeitHier sollen nun die vorgestellten Theorien zu einer Synthese vereinigt werden. Diese
Synthese wird als hegemoniale Managermännlichkeit bezeichnet. Um diese zu erstel-
len, werden die Theorie der hegemonialen Männlichkeit von Connell und Bourdieus
Habitustheorie miteinander kombiniert. Ebenfalls soll aufgezeigt werden, auf welchen
Ebenen im Bereich Klasse und Geschlecht diese hegemoniale Managermännlichkeit
erfasst werden kann. Schliesslich kommen in diesem Kapitel noch weitere Forschungs-
ergebnisse und Literatur hinzu, um die Theorie der hegemonialen Managermännlich-
keit abzuschliessen und so den theoretischen Hintergrund für die Beantwortung der
Fragestellung zu liefern.
Sowohl in der deutsch- als auch in der englischsprachigen Forschung gibt es zahl-
reiche Versuche Connells und Bourdieus Ansätze weiterzuentwickeln (Schölper 2008:
17-19). Insbesondere die Kombination der beiden Ansätze wird im deutschsprachigen
Raum immer beliebter. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass beide
Ansätze miteinander kombinierbar sind und gemeinsam ein schärferes Analysever-
fahren geben als einzeln (Brandes 2004: 1-6). Michael Meuser (2010: 123f), einer der
wichtigsten Männerforschern im deutschsprachigen Raum, welcher die beiden Ansätze
miteinander verbindet, führt auch aus: „hegemoniale Männlichkeit ist der Kern des
männlichen Habitus ist das Erzeugungsprinzip eines vom Habitus bestimmten ‘doing
gender’ bzw. ‘doing masculinity’“. Diese Verknüpfung der Ansätze Connells und
Bourdieus bilden die theoretische Grundlage der hegemonialen Managermännlichkeit.
Theorie 22
Wie aufgezeigt wurde, gibt es in der Welt und in der Schweiz nach wie vor grosse
soziale Ungleichheiten. Die beiden Herrschaftssysteme Kapitalismus und Patriarchat
erzeugen diese Ungleichheiten und beide Systeme sind miteinander verwoben. Der
Kapitalismus bringt durch seine Klassenstruktur ein Oben und Unten hervor. Ganz
oben in der Hierarchie sind gemäss Bourdieu die herrschenden Herrschenden, zu
denen u.a. die Manager gehören. Diese haben ihren spezifischen Habitus. Diese
Manager sind einerseits Gewinner des Kapitalismus, anderseits auch Träger desselben
zur Aufrechterhaltung des Systems. Die Manager haben ausserdem einen männlichen
Geschlechtshabitus, der hierarchisch über dem weiblichen steht.
Die allgemeinen Gewinner im Patriarchat sind die Männer, die Unterdrückten die Frau-
en. Aber auch unter den Männern und ihren Männlichkeiten gibt es Hierarchien. Die
wichtigste und höchste Männlichkeitsform ist die hegemoniale Männlichkeit. An ihren
Leitwerten orientieren sich die anderen Männlichkeiten und an ihr wird Normalität
gemessen. Die hegemoniale Männlichkeit findet sich in unserer Zeit insbesondere bei
den Wirtschaftsführern, im Militär oder im Spitzensport. Nur ein kleiner Anteil der Män-
nern gehört dieser Männlichkeit an. Die neuen mächtigen Wirtschaftsführer, die Mana-
ger, entsprechen heutzutage meistens der hegemonialen Männlichkeit.
2.6.1 Idealtyp hegemoniale Managermännlichkeit
Die mächtigen und erfolgreichen Manager verkörpern einerseits die vorherrschende
hegemoniale Männlichkeit der Gesellschaft. Auf der anderen Seite verfügen sie über
einen spezifischen Klassen- und Geschlechterhabitus. Beides benötigen sie um in der
kapitalistisch-patriarchalen Welt die Führungsrolle einzunehmen. Dieser Typ des
mächtigen männlichen Managers, einer der „Obersten“ in der gesellschaftlichen Hierar-
chie soll als hegemonialer Managermann gelten. Dieser besitzt, basierend auf der
hegemonialen Männlichkeit einen spezifischen Klassen- und Geschlechterhabitus.
Dieser spezifischer Habitus wird in dieser Arbeit als hegemoniale Managermännlichkeit
bezeichnet. Diese hegemoniale Managermännlichkeit ist als Idealtypus zu verstehen.
Manager mit dieser hegemonialen Managermännlichkeit versuchen, analog zu den
Theorien von Bourdieu und Connell, ihren Status zu sichern und verfolgen Strategien
des Machterhalts. Sie grenzen sich von hierarchisch unter ihnen stehenden Personen
ab. Eine Art der Abgrenzung sind die feinen Unterschiede. Die Manager stehen im
Dienst der kapitalistischen und der patriarchalen Strukturen, von welchen sie profitieren
und denen sie ihren Rang in der gesellschaftlichen Ordnung verdanken. Eine
Sicherung dieser beiden Herrschaftssysteme gibt ihnen gleichzeitig ihre Vorherrschaft
und ihren Erfolg.
Theorie 23
Auf der anderen Seite orientieren sich andere Männer, Frauen und allgemein Personen
aus tieferen Klassen an ihnen. Sie versuchen so zu werden, wie die hegemoniale
Managermännlichkeit der Manager es ihnen vorgibt. Diese Orientierung erfolgt analog
der Kleinbürgerlichen bei Bourdieu, welche sich am Habitus der herrschenden Herr-
schenden orientieren. Je mehr eine Person ihren Habitus dem der hegemonialen
Managermännlichkeit angleicht, desto höher wird die gesellschaftliche Anerkennung
dieser Person. Auf der anderen Seite werden die Personengruppen noch stärker unter-
drückt, welche dem Ideal dieses Typus nicht entsprechen oder entsprechen wollen.
Doch wie entsteht diese hegemoniale Managermännlichkeit? Sie muss analog zum
Habitus und zur Männlichkeit durch Sozialisierung gelernt werden. In dieser Phase
treten auch verschiedene Abgrenzungsstrategien der Mächtigen auf. So sieht Meuser
(2010) insbesondere das Erlernen des Geschlechterhabitus und der Männlichkeit in
homosozialen Räumen als wichtig für die Entstehung der Männlichkeit respektive der
hegemonialen Männlichkeit. Wichtig hierbei ist der Ausschluss von einigen Personen
aus diesen homosozialen Räumen, was zur Aneignung von anderen Männlichkeiten
führt. Männer aus der herrschenden Klasse treffen sich in anderen homosozialen
Räumen als Männer aus der Arbeiterklasse.
Ein weiterer wichtiger Ort der Sozialisierung ist die Schule respektive die ganze
Bildung. Manager gehen oft in exklusive Schulen oder Internate. Ein anderer Ort der
Sozialisation ist das persönliche Umfeld und das Elternhaus. Was bisher in Untersu-
chungen zu Männlichkeit oder Kapitalismus oft zu kurz kommt, ist die Mediensoziali-
sierung. Via Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Internet) werden die Men-
schen ebenfalls sozialisiert und die Mediensozialisierungsforschung wird immer wichti-
ger (Veith 2010: 56-59). Dies kann beispielsweise über Fachliteratur für Manager
geschehen oder über „Frauenzeitschriften“ für Hausfrauen.
Auf die Frage wie sich die hegemoniale Managermännlichkeit zusammensetzt, kann
die Theorie der Intersektionalität weiterhelfen. Die Intersektionalitätsforschung hat bei-
spielsweise gezeigt, dass Personen gleichzeitig aufgrund ihrer Klasse und ihres
Geschlechtes unterdrückt werden oder unterdrücken. Diese Mechanismen setzen auf
mehreren Ebenen an und lassen sich auf den Idealtyp der hegemonialen Manager-
männlichkeit übertragen. Als Ebenen lassen sich sowohl die Makro- (Strukturen), die
Meso- (symbolische Repräsentationen), als auch die Mikroebene (Identitätskonstruktio-
nen) anschauen. Ebenfalls gibt es verschiedenartige Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Ebenen.
Theorie 24
Abgeleitet aus den bisherigen Forschungen lässt sich über die hegemoniale Manager-
männlichkeit sagen, dass sie sich folgendermassen zusammensetzt: Bei der Sozial-
struktur sollten sich starke Bezüge auf Bildung, Netzwerke, Ehe, die Wirtschaftsord-
nung und die Globalisierung finden lassen. Innerhalb der symbolischen Repräsentation
ist beim Bereich der Klasse ein starkes meritokratisches Denken zu erwarten und ein
Bezug zum aktuellen kapitalistischen Geist.
Bei der Rechtfertigung der Männlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass die
Geschlechterverhältnisse als natürlich angesehen werden. Schliesslich ist bei den
Identitätskonstruktionen zu erwarten, dass im Bereich Klasse ein grosses Selbst-
vertrauen feststellbar ist, Risikofreudigkeit, Wettbewerbsdenken, das Denken erfolg-
reich zu sein und das Bewusstsein zu einer höheren Klasse zu gehören. Im Bereich
des Geschlechtes ist eine starke Konstruktion über die Heterosexualität zu erwarten,
Bezüge zu Stärke, Unabhängigkeit und rationellem Denken.
Die hegemoniale Managermännlichkeit ist wandelbar, genauso wie die hegemoniale
Männlichkeit wandelbar ist. Sie passt sich der jeweiligen Zeit, respektive der mit ihr ver-
bunden Sozialstruktur, an. So konnte beispielsweise Ralf Lange (1999: 12) feststellen,
dass bei den Managern eine Hegemonie individualistischer, konkurrenz- und
aufstiegsorientierter Haltungen im strategischen Management existiert und dies eine
Änderung gegenüber früher ist. Diese Anpassungen waren nötig um die
Vormachtstellung beizubehalten und so auf Kritik und neue Gegebenheiten zu
reagieren.
In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass die männlichen Manager zu den Gewinnern
der weltweiten sozialen Ungleichheiten gehören. Diese verfügen über eine spezifische
hegemoniale Managermännlichkeit. Diese ist ein spezifischer Klassen- und
Geschlechterhabitus, in dessen Kern die hegemoniale Männlichkeit ist. Die hegemo-
niale Managermännlichkeit besteht aus gesellschaftlichen Sozialstrukturen, symboli-
schen Repräsentationen und Identitätskonstruktionen. Damit wurde ein Analyserahmen
geschaffen, welcher es erlaubt die hegemoniale Managermännlichkeit zu erforschen
und Thesen aufzustellen.
Theorie 25
2.6.2 ThesenAufgrund der vorliegenden Theorie lassen sich folgende Thesen zur gesuchten hege-
monialen Managermännlichkeit zusammenfassen:
1. Unter den mächtigen männlichen Managern gibt es eine vorherrschende hege-
moniale Managermännlichkeit. Diese findet sich bei den mächtigen männlichen
Manager zumindest teilweise in ihren Identitätskonstruktion, symbolischen Re-
präsentation und Bezügen zur (Sozial)-Struktur sowie den Wechselwirkungen
unter den drei genannten Ebenen.
2. Auf der Ebene Identitätskonstruktion basiert die Konstruktion mindestens auf
Heteronormativität, Risiko, Eigenverantwortung, Leistung und einem starken
Klassenbewusstsein.
3. Auf der Ebene symbolische Repräsentationen lässt sich ein starker Bezug zum
kapitalistischen Geist, dem meritokratischen Prinzip und den Naturalisierungen
der Geschlechterverhältnisse feststellen.
4. Auf der Ebene Sozialstrukturen lässt sich bei männlichen Managern eine klare
Verbindung zu kapitalistischen Wirtschaftsordnung, Märkten, Globalisierung,
Ehe und Bildung feststellen.
5. Sowohl zwischen den Kategorien (Kapitalismus und Patriarchat), als auch zwi-
schen den untersuchten Ebenen sind Wechselwirkungen zu erwarten.
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 26
3 Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik Ziel des Kapitels ist es aufzuzeigen, welches Datenmaterial mit welcher empirischen
Methode untersucht werden soll, um die Fragestellung zu beantworten. Dazu wird im
ersten Teil kurz dargelegt, wieso die Interviews der Rubrik „Gespräche“ des
Schweizerischen Wirtschaftsmagazin Bilanz geeignet sind für eine Analyse der hege-
moniale Managermännlichkeit. Ebenso wird erklärt, warum die drei Interviews (Daniel
Vasella (Lüchinger und Pfenniger 2005: 100-103.), Viktor Vekselberg (Barmettler 2010:
74-77) und Carsten Schloter (Kowalski 2010: 44-47)) als definitives Datenmaterial zur
Analyse gewählt wurden.
Der grössere Teil des Kapitels ist dann der Methode „Mehrebenenanalyse“ gewidmet,
mit welcher die Interviews analysiert werden sollen. Da es sich hierbei um eine neue
und nicht sehr bekannte Methode handelt, wird sie hier ausführlich erläutert: Ihr
theoretische Hintergrund wird vorgestellt, die Methode wird detailliert beschrieben und
anhand von Anwendungsbeispiele kritisch beleuchtet. Daraus resultiert eine für diese
Arbeit angepasste Mehrebenenanalyse, welche im nächsten Kapitel zur Analyse der
Interviews angewandt wird.
3.1 Auswahl des DatenmaterialsTexte können als Protokolle der sozialen Praxis verwendet werden und mit dem richti-
gen methodischen Vorgehen aufgeschlüsselt werden (Oevermann 2002: 3f). Das
Schweizerische Wirtschaftsmagazin Bilanz eignet sich ausgezeichnet um die gestellte
Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten. Die Bilanz ist spezialisiert auf Manager,
Reiche und Unternehmen. Sie verfügt über gute Kontakte zu den Managern und eine
gut ausgebaute Redaktion, insbesondere für die Jahresausgabe der 300 Reichsten der
Schweiz (Mäder et al. 2010: 141-143). Die Bilanz richtet sich speziell an Leader und
Topleader der Wirtschaft und ist in dieser Gruppe das meistgelesene Magazin der
Schweiz (WEMF 2010). Zudem lesen insgesamt über 200'000 Menschen die Bilanz
(WEMF 2011). Die Bilanz gehört dem AxelSpringer Verlag, welcher bekannt ist für
seine konservative Weltanschauung, Bekenntnissen zur freien Marktwirtschaft und der
Verlag wird von FeministInnen als Männerpresse bezeichnet (Trumann 2002). Die
hegemoniale Managermännlichkeit, welche in der Bilanz reproduziert wird, richtet sich
einerseits an die Leader und Topleader und andererseits an ein zusätzlich grosses
Publikum. Weiter basieren die Interviews auf guten Kontakten der Redaktion zu den
Managern und die Bilanz wird von einem Verlag herausgegeben, welcher Kapitalismus
und Patriarchat unterstützt. Deshalb eignet sich die Bilanz zur Beantwortung der
Fragestellung dieser Arbeit.
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 27
Die drei A4 Seiten langen Interviews in der Rubrik „Gespräche“ scheinen geeignet, um
alle in der Forschungsfrage aufgestellten Ebenen (Sozialstrukturen, symbolische Re-
präsentationen, Identitätskonstruktionen) zu untersuchen. In jeder Ausgabe wird eine
wichtige und/oder mächtige Persönlichkeit in dieser Rubrik ausführlich zu aktuellen
Themen interviewt, samt Porträtfoto und kleinem Lebenslauf in einer Infobox. Was bei
anderen Forschungsfragen Probleme bereiten könnte (Gläser und Laudel 2009: 38-
43), nämlich dass die Interviews von JournalistInnen geführt wurden und redaktionell
überarbeitet wurden, könnte hier zum Glücksfall werden. Die unbewusst verwurzelte
hegemoniale Managermännlichkeit wird dadurch eher noch stärker betont. Dies, da die
hegemoniale Managermännlichkeit sowohl für die Redaktion als auch für die Interview-
ten den Normalfall darstellen. Deshalb wird wohl darauf geachtet, dass die Personen
sich in diesem Rahmen bewegen.
Die Auswahl der Interviews fand nach den Grundsätzen des Samplings nach dem
Grundsatz von vorab definierten Kriterien statt (Przyborksi und Wohlrab-Sahr 2009:
178-180). Die Interviews mussten als Grundkriterium mit Männern geführt worden sein,
welche führende und einflussreiche Manager sind. Diese sollten in unterschiedlichen,
grossen Unternehmen tätig sein. Ebenso sollten die Interviews in einem grösseren zeit-
lichen Abstand zueinander publiziert worden sein. Das erste Interview, welches nach
diesen Kriterien ausgewählt wurde, mit dem Novartis Chief Executive Officer (CEO)
und Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella ist aus dem Jahr 2005 (Lüchinger und
Pfenniger 2005: 100-103). Als Gegensatz zum bekannten Chef des privaten Pharma-
unternehmens Novartis wurde das Interview des Swisscom CEO Carsten Schloter
(Kowalski 2010: 44-47) von 2010 gewählt. Die Swisscom gehört mehrheitlich dem
schweizerischen Staat. Schliesslich kam als Drittes das Interview mit dem in der
Schweiz lebenden Oligarchen Viktor Vekselberg (Barmettler 2010: 74-77) hinzu. Diese
drei Interviews entsprechen den vorher gesetzten Kriterien und sprengen den Rahmen
einer Bachelorarbeit nicht.
3.2 Methodenauswahl MehrebenenanalyseAls Methode zur Analyse der drei Interviews in der Bilanz soll eine angepasste Variante
der Mehrebenenanalyse von Winker und Degele (2010; 2007) zur Anwendung kom-
men. Da zur Beantwortung der Fragestellung und Analyse der Interviews ein methodo-
logischer Ansatz sinnvoll ist, der nicht bloss fallrekonstruierend wirkt, kommen nur
Methoden der qualitativen Sozialforschung in Frage. Die Mehrebenenanalyse empfiehlt
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 28
sich hier, da sie darauf ausgerichtet ist mehrfache soziale Ungleichheiten, Intersektio-
nalität, zu analysieren. Sie tut dies auf den drei in dieser Arbeit behandelten Ebenen
und ihren Wechselwirkungen (Winker und Degele 2007). Zuerst soll jetzt die Methode
in ihrer „Reinform“ in Theorie und Praxis vorgestellt werden und schliesslich anhand
von Anwendungsbeispielen kritisch beleuchtet werden, um dann die angepasste
Variante auszuarbeiten.
3.2.1 Theoretischer Hintergrund
Hier soll nun noch ausführlicher auf den theoretischen Hintergrund der intersektionalen
Mehrebenenanalyse von Winker und Degele (2010) eingegangen werden. Die beiden
Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass Diskriminierungen auf drei Ebenen
(Sozialstruktur, Repräsentation und Identität) geschehen können (2007: 3f). Da damit
alle Ebenen zur Ungleichheit beitragen, müssten auch alle Ebenen in der Forschung
berücksichtigt werden. Ebenso zeigen sie auf, dass es Wechselwirkungen zwischen
den einzelnen Ebenen und den Ungleichheitskategorien gibt.
Die Ebene Sozialstruktur befasst sich mit den bestimmenden Herrschaftsverhältnissen
und deren Verankerung in der Sozialstruktur der Gesellschaft (Winker und Degele
2010: 28-53). Es lassen sich vier Strukturkategorien bilden, mit welchen die Herr-
schaftsverhältnisse konstruiert werden. Diese sind Klasse, Geschlecht, „Rasse“ und
Körper.
„Diese Differenzierungen verteilen die verschiedenen Arbeitstätigkeiten ebenso wie die vorhandenen ge-sellschaftlichen Ressourcen ungleich auf verschiedene Personengruppen. Mit diesen Kategorien lassen sich damit verbundene Ausbeutungs- und Diskriminierungsstrukturen – Klassismus, Sexismus/Hetero-normativität, Rassismus und Bodismus – aufzeigen und rekonstruieren“ (Winker und Degele 2007: 6).
In der Struktur Geschlecht befindet sich ebenfalls die sexuelle Orientierung (Winker
und Degele 2010: 44-46). Die bisher noch unbeachtete Kategorie Körper diversifiziert
die Stellung im Produktionsprozess, vor allem den Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt.
„ArbeitnehmerInnen müssen beweglich, belastbar, permanent lernbereit und -willig
sein“, ansonsten werden sie ausgeschlossen (Winker und Degele 2007: 8).
Eine weitere Ebene ist die der symbolischen Repräsentationen. „Symbolische Reprä-
sentationen wirken sowohl als Ideologien und Normen der Rechtfertigung für Ungleich-
heiten wie auch als Sicherheitsfiktion struktur- wie auch identitätsbildend“ (Ebd.: 2007:
10). Die Repräsentationen entsprechen in der Regel den aktuellen Diskursen (Butler
1991) über die Kategorien. Eine Orientierung an den Strukturkategorien – Klasse,
Geschlecht,„Rasse“, Körper – wird zum Herausarbeiten der Repräsentationen empfoh-
len, auch wenn die Anzahl der Repräsentationen nicht im vornherein feststehen soll
(Winker und Degele 2010: 54-58).
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 29
Bei der Identitätskonstruktion ist es notwenig von einer offenen Anzahl von Kategorien
auszugehen. Individuen bilden zur Ab- und Ausgrenzung von anderen und zur Vermin-
derung der Unsicherheit ihrer sozialen Position verschiedenartige Differenzkategorien
(Ebd.: 59-62).
„In der Auseinandersetzung mit dem Alltag von erwerbslosen Personen haben wir folgende Kategorien entwickelt, die sie zur Identitätskonstruktion verwenden: Arbeit, Einkommen/Vermögen, Bildung, Soziale Herkunft/Familie/Soziale Netze, Geschlechtszuordnung, sexuelle Orientierung, nationalstaatliche Zuge-hörigkeit, Ethnizität, Region, Religion/Weltanschauung, Alter, körperliche Verfasstheit/Gesundheit, Attraktivität“ (Winker und Degele 2007: 5).
Gemäss Winker und Degele (2010) kann davon ausgegangen werden, dass die
einzelnen Ebenen voneinander abhängig sind und starke Wechselwirkungen zu erwar-
ten sind. Deshalb können nicht nur die Ebenen einzeln angeschaut werden, sondern
müssen auch die Ebenen und Kategorien in ihrer Beziehung zueinander untersucht
werden. Winker und Degele unterscheiden sechs mögliche Verbindungen zwischen
Identität (I), Struktur (S) und Repräsentation (R): I→R, R→I, S→R, R→S, S→I und
I→S. Dass Verbindungen untereinander, beispielsweise zwischen Identität und Struktur
bestehen, zeige unter anderem schon Bourdieu (1987).
3.2.2 Funktionsweise der Mehrebenenanalyse
Nach diesem theoretischen Blick auf die Methode, wird nun die Funktionsweise der
Mehrebenenanalyse dargestellt:
„Um nun die Konstruktion der dargestellten Differenzkategorien empirisch zu analysieren, bedarf es [… eines] den Status Quo nicht lediglich reproduzierenden methodologischen Herangehen. Dazu schlagen wir ein praxeologisches statt reduktionistisches Vorgehen vor“ (Winker und Degele 2007: 11).
Als Datenmaterial lassen sich für die Mehrebenenanalyse beispielsweise Interviews
verwenden, aber auch weiter Protokolle sozialer Praxis (Winker und Degele 2010: 79f).
Winker und Degele fassen die Funktionsweise ihrer Methode in „Acht Schritte zur inter-
sektionalen Analyse“ zusammen (Ebd.: 79-97). Die ersten vier Schritte erfolgen nach-
einander bei den einzelnen Interviews.
1. Schritt: Die Identitätskonstruktionen in den Interviews sollen herausgesucht
und beschrieben werden. Diese Identitätskonstruktionen treten in der Regel als
Differenzierungskategorien wie Arm/Reich, Bildung, Mann/Frau etc. auf.
2. Schritt: Nun müssen die symbolischen Repräsentationen in den einzelnen
Interviews identifiziert werden. Es sollen damit alle Werte, Normen, Ideologien
und Rechtfertigungen erfasst werden, welche die Personen erwähnen oder sich
darauf abstützen.
3. Schritt: Bezüge zu (Sozial)-Strukturen entlang den vier Kategorien Klasse,
Geschlecht, Rasse und Körper sollen gefunden und beschrieben werden. Die
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 30
Bezüge ergeben sich aus Äusserungen zu Gesetzen, Regelungen, Ämtern,
Wirtschaftsordnungen, Bildungseinrichtungen etc.
4. Schritt: Wechselwirkungen zwischen den drei gefunden Ebenen finden. Als
Vorgehen wird vorgeschlagen, die Differenzierungskategorien der Identität nach
wichtigen Kategorien aufzuteilen. Wenn diese dann ebenfalls auf der Ebenen
Struktur und/oder Repräsentation vorhanden sind, können diese als wichtig
angesehen werden und erste Wechselwirkungen beschrieben werden.
Nach diesen vier Schritten mit den einzelnen Interviews werden bei den Schritten fünf
bis acht alle Interviews der Untersuchung einbezogen.
5. Schritt: Die Identitätskonstruktionen der einzelnen Personen sollen mit-
einander verglichen und geclustert werden. Damit sollen neue Erkenntnisse
gewonnen werden und Unterschiede sowie Ähnlichkeiten gefunden werden.
6. Schritt: Die erwähnten Herrschaftsverhältnisse sollen im Vergleich analysiert
werden. Dazu werden die gefundenen Strukturen für ein besseres Verständnis
mit Kontextdaten ergänzt und dann ebenfalls geclustert.
7. Schritt: Dann folgt eine Analyse der benannten Repräsentationen im Gesamt-
überblick. Dazu können ebenfalls weitere Kontextdaten zum Verständnis der
genannten Repräsentationen hinzugezogen werden.
8. Schritt: Zum Schluss sollen nun die Wechselwirkungen in der Gesamtschau
herausgearbeitet werden. Hier soll mit der Strukturebene und den vier Katego-
rien begonnen werden und schrittweise sämtliche mögliche Verbindungen zu
den anderen Ebenen angeschaut werden. Die Wechselwirkungen werden dabei
dokumentiert.
Je nach Forschung und Datenmaterial können die einzelnen Schritte länger oder kür-
zer ausfallen oder einzelne Analyseschritte in anderen Reihenfolgen statt finden.
3.2.3 Anwendungsbeispiele und kritische Auseinandersetzung
Ziel dieses Abschnittes ist es nun, die vorgestellte Methode der Mehrebenenanalyse
kritisch zu beleuchten und ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Dazu dienen als
Grundlage die beiden vorher erarbeiteten Teile über die Methode (Theoretischer Hin-
tergrund und Anwendung). Hinzu kommen Beispiele aus einer Studie über das
Erwerbsleben von Winker und Degele (2010; 2007) und aus einer Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung zu „Homophobie, Rassismus und Sexismus im Fußball“ von Degele und
Janz (2011). Diese Studien und Ergebnisse sollen genauer analysiert werden und als
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 31
Anwendungsbeispiele dienen. Damit sollten sowohl die Stärken, als auch die
Schwächen der Methode zum Vorschein kommen.
Eine erste klare Stärke der Methode zeigt sich in der Fussballstudie (Ebd.). Die
Methode kann vielseitig eingesetzt werden. Für die Fussballstudie wurden Fuss-
ballerinnen und Fussballer aus verschiedenen Klubs interviewt. Das Forschungs-
interesse für die Studie beinhaltet Diskriminierungen aufgrund von sexueller Orien-
tierung, Geschlecht und Herkunft. Obwohl damit einige Diskriminierungskategorien
ausgelassen wurden, funktioniert die Methode trotzdem. Es zeigt sich in der Fussball-
studie auch, dass nicht nur mit biographischen Interviews (Winker und Degele 2007;
Degele und Janz 2011) gearbeitet werden kann, sondern auch mit fallzentrierten Inter-
views und Sekundäranalysen. Trotz der eingeschränkten Fragestellung über die Diskri-
minierungsformen und der nicht-biographischen Interviews kommen Degele und Janz
auf verwertbare und nachvollziehbare Ergebnisse.
Eine weitere Stärke der Methode zeigt sich am offenen Herangehen bei den Identitäts-
konstruktionen am Anfang der Analysen. So ergibt sich bei einem Interview mit einer
sozial benachteiligten Person eine Vielzahl von Differenzkategorien (Winker und
Degele 2010: 108f). Viele der Identitätskonstruktionen waren vorher nicht herleitbar
und mit den gefundenen Differenzkategorien ebnen sich neue Wege zu zusätzlichen
Erkenntnissen. Das Zusammenfassen in wichtige Identitätskategorien erlaubt danach
das weitere Analysieren und gibt einen guten Überblick.
Im zweiten und dritten Schritt der Analyse zeigt sich dann, dass sich bei den Aussagen
der untersuchten Personen ebenfalls Bezüge zur Repräsentation- und Strukturebene
finden lassen (Winker und Degele 2007: 12). Die Aussagen sind nicht so klar
ersichtlich wie bei den Identitätskonstruktionen. Bezüge lassen sich beispielsweise
finden, wenn für etwas ein Rechtfertigungsgrund angeführt wird oder auf etwas
Strukturelles verwiesen wird, welches von aussen auf die Menschen einwirkt. Dies sind
beispielsweise Sozialarbeiter oder Gesetze in diesem Beispiel. Die Strukturen lassen
sich nach den Kategorien Klasse, Geschlecht, „Rasse“ und Körper ordnen. Bei der
Repräsentation ist dies auch möglich, doch gibt es dort teilweise nicht oder mehrfach
zurechenbare Ergebnisse.
Beim vierten Schritt, den Wechselwirkungen, zeigt sich, dass bei den wichtigsten
Identitätskonstruktionen in der Regel Wechselwirkungen zu den beiden anderen
Ebenen gefunden werden können. So kann bei einer alkoholabhängigen Arbeitslosen
Alleinkämpferin ein starker Bezug zur Meritokratie herausgearbeitet werden, mit der sie
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 32
ihre Armut erklärt. Ebenso ergeben sich Verweise zur Sozialarbeiterin, welche gemäss
Winker und Degele (2010: 110) im kapitalistischen Sinn handelt und in die strukturellen
Herrschaftsverhältnisse eingebettet ist.
Beim Vergleichen der Interviews und dem Clustern von diesen ergibt sich sehr schnell
eine Typenbildung und damit verwertbare Resultate (Ebd.: 121-140). Diese Typologien
lassen sich in der weiteren Analyse verwerten.
Eine weitere Stärke offenbart sich in den beiden nächsten Schritten. Der
Zusammenzug der bisher einzeln untersuchten Interviews führt ebenfalls zu einer
Typisierung bei der Repräsentationen und den Strukturen. Damit lassen sich auch
diese beiden Ebenen zufriedenstellend analysieren. Weil nun zum besseren
Verständnis dieser beiden Ebenen zusätzliches Material hinzugezogen wird,
erschliessen sich dadurch zusätzliche Erkenntnisse. Als zusätzliches Material führen
Winker und Degele (2007: 13f) auf: statistisches Datenmaterial, Gesetze, Zeitungs-
berichte bei der Struktur und bei der Repräsentationsebene alles, was Diskurse
aufzeigt wie Medien etc. Schliesslich offenbart sich bei der Betrachtung der einzelnen
ausgearbeiteten Ebenen diverse Wechselwirkungen.
Eine letzte klare Stärke zeigt sich bei den Ergebnissen. Es gelingt mit der Methode,
Fragestellungen im Bereich der Mehrfachunterdrückung systematisch zu beantworten.
Die Methode hat aber nicht nur Stärken, sondern sie kann auch einige Schwächen mit
sich bringen. So ist beispielsweise vieles davon abhängig, wie gut es im ersten Schritt
gelingt Identitätskonstruktionen zu finden. Eine Schwäche kann sich daraus ergeben,
wenn die untersuchten Personen nur wenige Bemerkungen zu Identitätskonstruktionen
machen. Hier zeigt sich, dass das am besten geeignetste Datenmaterial selbst
geführte Interviews sind, welche offen und biographisch geführt wurden. Bei anderen
Datenquellen, wo es wenig oder gar keine direkten Bezüge zur Identität gibt, kann der
ganze Forschungsprozess ins Stocken geraten.
Bei der Repräsentations- und Strukturebene wird in den Studien von Winker und
Degele mit vielen indirekten Bezügen gearbeitet. Oft werden deshalb über
Bemerkungen der interviewten Personen diese Bezüge gefunden oder dank den
vorher herausgearbeiteten Identitätskonstruktionen. Ein Schweigen oder das nicht
Erwähnen von Repräsentationen oder Strukturen in den Interviews heisst aber nicht,
dass diese Repräsentationen oder Strukturen nicht auf die Personen einwirken. Wenn
es aber keine Bezüge in den Interviews gibt, werden diese auch nicht weiterverfolgt. Es
gibt aber diverse Gründe, wieso die Personen diese Ebenen im Interview vielleicht
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 33
nicht erwähnen. Beispielsweise könnten sie sich dieser beiden Ebenen oder ihrer
Ausprägung nicht bewusst sein, da sie als normal hingenommen werden. Ebenfalls ist
denkbar, dass diese beide Ebenen falsch wiedergegeben werden, da die Interviewten
bei den Diskursen beispielsweise das wiederholen, was sie gelernt haben. Damit kann
die Methode Gefahr laufen, schlussendlich doch nur reproduzierend zu wirken und
nicht auf neue Ergebnisse zu kommen.
Bei der Hinzunahme von zusätzlichem Material bei den Arbeitsschritten sechs und
sieben zeigt sich ein nächstes mögliches Problem der Mehrebenenanalyse. Es ist zu
begrüssen, dass zum Verständnis der einzelnen nicht so stark sichtbaren Ebenen
zusätzliches Material hinzugezogen werden kann. Welches Material denn aber wann
sinnvoll ist, wird von den Autorinnen nicht schlüssig beantwortet. Es werden keine
Empfehlungen abgegeben, was, wann und wie viel zusätzliches Material sinnvoll ist.
Ebenfalls wird keine Methode angegeben, mit der das zusätzliche Material, welches im
Bereich Repräsentation und Strukturen herangezogen wird, überhaupt analysiert wer-
den soll. Dabei sind je nach Methode der Untersuchung unterschiedliche Ergebnisse
zu erwarten. Eine qualitative Inhaltsanalyse einer Fernsehsendung ergibt andere
Ergebnisse als eine quantitative Inhaltsanalyse der selben Sendung.
Im Bereich der Strukturen kann sich dabei eine weitere Schwäche ergeben: Es wird
empfohlen auf statistisches Material, Gesetze etc. auszuweichen. Diese sind aber
selbst ein Ergebnis der kapitalistisch-patriarchalischen Welt und ihr wahrer Sinn ist oft
verschleiert. Grundsätzlich ist es ein Problem, dass nicht versucht wird diese
versteckten Sinnstrukturen zu erkennen, wie dies beispielsweise bei der Objektiven
Hermeneutik der Fall ist (Oevermann 2002: 1-5). Und es stellt sich die Frage, ob dies
mit der gewählten Methode überhaupt möglich ist.
Es zeigt sich, dass die Methode klare Stärken und Schwächen hat. Zu den klaren Stär-
ken gehören also das systematische Vorgehen, die Möglichkeit Mehrfachunter-
drückung zu untersuchen und die Offenheit der Methode. Zu den Schwächen gehört
sicherlich die Abhängigkeit von Identitätskonstruktionen gleich zu Beginn der Analyse.
Eine weitere methodische Schwäche ist die Schwierigkeit, gesellschaftliche Strukturen
richtig zu erfassen und nicht bloss in den Interview Gesagtes zu reproduzieren. Ver-
steckte Sinnstrukturen können so verborgen bleiben. Ebenso fehlen genaue Angaben
zum in den späteren Analyseschritten hinzugezogenem Material und dessen
Auswertung.
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 34
3.2.4 In dieser Arbeit angewandte Methode
Nun soll kurz dargestellt werden, wieso die Methode der Intersektionalität als Mehrebe-
nenanalyse sich für diese Forschung besser eignet als andere qualitative Methoden.
Danach wird aufgezeigt, in welcher angepassten Form die Mehrebenenanalyse für die
Interviews von Daniel Vasella, Carsten Schloter und Viktor Vekselberg in dieser Arbeit
angewandt wird.
Eine Diskursanalyse würde sehr gut zum vorhandenen Datenmaterial passen und die
Diskurse auf der Repräsentationsebene wohl am Besten aufdecken (Kerchner und
Schneider 2006: 9-13). Da aber die beiden anderen Ebenen damit zu kurz kämen, fällt
diese Methode weg. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2007: 24-41) bietet
zwar den Vorteil, dass sie explizit Inhalte aus Artikeln analysieren kann und mehrfach
erprobt ist. Dennoch läuft sie Gefahr reproduzierende Ergebnisse zu liefern, da sie
vorab geschlossene Kategorien verwendet (Gläser und Laudel 2009: 204-209). Gegen
die Objektive Hermeneutik (OH) spricht, dass das Datenmaterial aus von der Redak-
tion und den Interviewten überarbeiteten Zeitschrifteninterviews besteht. Die OH
benötigt aber reale, unveränderte Protokolle der sozialen Praxis um gute Ergebnisse
zu erzielen (Oevermann 2002: 3-5). Die Artikel sind dafür zu stark bearbeitet. Schliess-
lich fällt die Grounded Theory ebenfalls weg, da sie zu stark Theorie geleitet ist, auf
Theoriebildung ausgelegt ist und mit Beobachtungsprotokollen als Daten die besten
Ergebnisse liefert (Przyborksi und Wohlrab-Sahr 2009: 184-215).
Die Mehrebenenanalyse bietet den Vorteil, dass sie auf die Überschneidungen von
sozialen Ungleichheiten auf mehreren Ebenen zugeschnitten ist. Die Methode ist
anpassbar an die Forschungsfragen und hat sich schon in abgewandelter Form
bewährt (Degele und Janz 2011). Die Schwäche, dass Strukturen und Repräsentatio-
nen schwer erkennbar sind, ist aufgrund des Datenmaterials hier wohl weniger ein Pro-
blem. Da sich die Zeitschrift Bilanz speziell mit Wirtschaftsfragen befasst und sich unter
anderem an Manager richtet, sind starke Bezüge im Bereich Struktur und Repräsenta-
tionen zu erwarten. Dies dürfte vor allem die Kategorie Kapitalismus betreffen. Da
Kapitalismus und Patriarchat gemäss der Theorie miteinander verwoben sind, müssen
sich auch Bezüge zum Patriarchat finden lassen. Durch das Bewusstsein der Schwä-
chen der Methode, sollten sich im Forschungsprozess einige der Fehler minimieren
oder gar vermeiden lassen.
Die Interviews werden mit folgender angepassten Methode der Mehrebenenanalyse
ausgewertet: Die drei Interviews (Vasella, Schloter und Vekselberg) werden zuerst ein-
zeln analysiert. Dabei wird mit der Identitätskonstruktion begonnen und die Anzahl
Methoden-, Datenauswahl und Methodenkritik 35
sowie die Ausprägung der Differenzkategorien werden dabei offen gehalten. Als
Nächstes werden Bezüge zur (Sozial)-Struktur gesucht. Bei den Herrschaftsverhältnis-
sen, werden aufgrund der Forschungsfrage und des beschränkten Umfangs nur Klasse
und Geschlecht berücksichtigt. Für die gleichen Kategorien werden dann symbolische
Repräsentationen in den Interviews gesucht. Als nächster Analyseschritt folgt das
Herausarbeiten von Wechselwirkungen innerhalb der einzelnen Interviews.
Ab diesem Schritt werden alle Interviews und deren bisherigen Resultate
berücksichtigt. Es folgt ein Zusammenzug der Identitätskonstruktionen und eine
Typenbildung unter den vorgefundenen Identitätskonstruktionen der drei Interviews. Als
Nächstes werden die Strukturen und Repräsentationen, welche bei allen drei
Interviews vorkommen, herausgearbeitet. Um deren Kontext besser zu verstehen,
können wenn nötig weitere Texte hinzugezogen werden. Schliesslich soll dann die
Wechselwirkungen zwischen den drei Ebenen in alle Richtungen untersucht werden.
Hierbei sollen auch Wechselwirkungen als relevant betrachtet werden, welche nicht in
alle drei Richtungen gehen. Diese Analyseart sollte es ermöglichen die Fragestellung
nach der hegemonialen Managermännlichkeit zu beantworten.
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 36
4 Ergebnisse MehrebenenanalyseDie Darstellung der Ergebnisse der Mehrebenenanalyse der Interviews mit Daniel
Vasella, Viktor Vekselberg und Carsten Schloter erfolgt entlang der im Theorieteil auf-
gestellten Thesen. Die Thesen sollen dabei nicht überprüft werden. Sie dienen lediglich
als Orientierungsmuster. Zuerst wird ein allgemeiner Überblick über die gesamte Unter-
suchung gegeben. Dabei wird beantwortet, ob sich eine hegemoniale Managermänn-
lichkeit als Ergebnis der Mehrebenenanalyse finden lässt. Zudem wird auf einige
Schwierigkeiten im Forschungsprozess hingewiesen. Bei den Ebenen werden die-
jenigen Ergebnisse beschrieben, welche bei allen untersuchten Interviews zu finden
waren und eine Relevanz für die Forschungsfrage haben und somit zur hegemonialen
Managermännlichkeit gehören. Zuerst werden die Identitätskonstruktionen der hege-
monialen Managermännlichkeit beschrieben. Danach werden die symbolischen Reprä-
sentationen anhand der Interviews aufgezeigt und durch die Ergebnisse nach Zuhilfe-
nahme von zusätzlicher Literatur beschrieben. Darauf folgt eine Auflistung der gefun-
den Bezüge zur (Sozial)-Struktur und deren Einordnung zu den Herrschaftsverhält-
nisse nach der Analyse von zusätzlicher Literatur. Am Schluss werden einige wichtige
Wechselwirkungen zwischen den Ebenen dargestellt.
4.1 Hegemoniale ManagermännlichkeitDie Interviews mit den männlichen Spitzenmanagern – Daniel Vasella, Carsten
Schloter und Viktor Vekselberg – wurden nach der angepassten Mehrebenenanalyse
analysiert. Bei allen drei Interviewten ist eine hegemoniale Managermännlichkeit deut-
lich sichtbar. Sowohl in den Identitätskonstruktionen, den symbolischen Repräsentatio-
nen als auch bei den (Sozial-)Strukturen und den Wechselwirkungen untereinander
wird eine gemeinsame hegemoniale Managermännlichkeit in den Interviews des Wirt-
schaftsmagazins Bilanz reproduziert.
Bei der Analyse der Interviews zeigten sich jedoch einige Schwierigkeiten. So wurden
mit der Methode der Mehrebenenanalyse vergleichsweise wenig Bezüge zu Identitäts-
konstruktionen gefunden. Da diese eine der Grundlagen für die weitere Analyseschritte
ist kann dies sehr schnell den ganzen Forschungsprozess blockieren. Dank vielen
Bezügen in den Interviews zu den sozialen Repräsentationen konnte dies aber kom-
pensiert werden.
Schwer war auch das Auffinden von Bezügen zur (Sozial)-Struktur. Das lässt sich mit
der Art der Interviews erklären, da der Fokus der Interviews auf der Wirtschaft und den
Unternehmen und nicht auf der persönlichen Identität liegt. Dies führte zu einem
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 37
anderen Problem. Es liessen sich nur schwer Bezüge zur Kategorie Geschlecht
respektive Patriarchat finden. Ebenso erlaubte es die Methode nur in geringem Masse,
nicht offensichtliche Bezüge und Sinnstrukturen zu finden.
Trotz der Probleme konnte eine klare, wenn wohl auch nicht umfassende, hegemoniale
Managermännlichkeit in der Analyse festgestellt werden. Diese wird in den Interviews
reproduziert. Die Ergebnisse werden in den einzelnen Unterkapiteln Ebene Identitäts-
konstruktionen (Analyseschritt eins und fünf), Ebene Repräsentationen (Analyseschritt
zwei und sieben), Ebene Sozialstruktur (Analyseschritt drei und sechs) und Wechsel-
wirkungen (Analyseschritt vier und acht) zusammengefasst und damit der Typus der
hegemonialen Managermännlichkeit vorgestellt.
4.2 Ebene IdentitätskonstruktionenIn sämtlichen Interviews zeigt sich, dass die drei Manager sich stark über ihre Firma
identifizieren. Sie sprechen stets von „wir“ (als Unternehmen) und versuchen das Team
als Ganzes in den Vordergrund zu stellen. Bei Vasella wird stets von „wir“ Novartis, bei
Schloter von „wir“ Swisscom und bei Vekselberg von „wir“ Renova gesprochen. Sie
machen die Ausgrenzung entlang „wir“ (unsere Firma) gegen die Konkurrenz.
Sämtliche drei Manager sind sich ihres Status bewusst. Sie wissen, dass sie besser
gestellt sind und zu einer Eliteschicht gehören und über Macht verfügen. Und sie bilden
ihre Identität auch danach. So argumentiert beispielsweise Carsten Schloter: „Aber
wenn ich als Gutgestellter Neid empfinden würde gegen einen noch Besser gestellten,
wäre das traurig“ (Kowalski 2010: 47).
Viktor Vekselberg lässt sich in der Infobox neben dem Interview als Oligarchen und
Grossinvestor darstellen und korrigiert zu Beginn des Interviews: „Aber die Zahl der
Mitarbeiter unserer Investitionen liegt weltweit bei etwas über 200 000“ (Barmettler
2010: 74).
Die Konstruktion als mächtiger Manager lässt sich auch bei Daniel Vasella aufzeigen.
Obwohl er gerne über „wir“ spricht im Interview, spricht er beispielsweise von sich
selbst und seinen Entscheidungen, wenn es um Personalentlassungen geht und um
Faktoren für den Erfolg der Fusion (Lüchinger und Pfenniger 2005: 100).
Sie konstruieren ihre Identität entlang den Linien gesetzestreuer Manager, sozialer
Manager, teamorientierter Manager als klare Abgrenzung von Managern, die rein aus
persönlicher Gier gehandelt und sich gar falsch oder verbrecherisch verhalten haben.
Vasella bringt es dabei auf den Punkt, wieso Manager heute teilweise einen schlechten
Ruf haben und grenzt sich von den fehlbaren Managern ab:
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 38
„Das ist teilweise selbst verschuldet, da sich zu viele Manager falsch oder nicht gesetzestreu verhalten haben. Mangelnde Transparenz bis hin zu Zahlenmanipulation […]. Und schliesslich kam hinzu, dass viele Manager trotz Misserfolg gut bezahlt wurden.“
Als Gegenstück erwähnt er Novartis und damit sein Geschäft, mit welchem er sich
identifiziert: „Bei Novartis wollen wir aus Prinzip gegen innen und aussen transparent
sein“ (Ebd.: 102). Auch Vekselberg und Schloter lassen durchblicken, dass sie sich als
gute Manager sehen, die das Wohl der Allgemeinheit im Auge haben.
Es zeigt sich bei allen dreien ebenfalls eine neoliberale politische Identität. Sie spre-
chen sich gegen Regulationen und für einen schwachen Staat aus. Besonders scheint
im Interview mit Vasella das neoliberale Credo für einen schwachen Staat und eine
deregulierte Wirtschaft durch.
Alle drei untersuchten Manager zeigen in ihren Interviews, dass sie sich als erfolg-
reiche Manager und als „Macher“ begreifen, die das Heft in die Hand nehmen,
Probleme lösen und damit dann den bereits betonten Erfolg haben. So wurde Veksel-
berg beispielsweise gefragt, ob es denn nicht gefährlich sei in Russland Geschäfte zu
machen. Er antwortet klar: „Ich weiss, wie man in Russland erfolgreich geschäftet“
(Barmettler 2010: 77). Und zeigt damit seine Überzeugung, ein erfolgreicher Manager
zu sein. Auf die Frage nach einem Auslandsgeschäft der Swisscom, welches in Verruf
gekommen ist und nach möglichen Schäden, antwortet Carsten Schloter sofort mit
einem Erfolg statt einer Selbstkritik: „Im März haben wir im Grosskundenbereich 73
Prozent aller Ausschreibungen am Markt gewonnen, so viel wie nie zuvor“ (Kowalski
2010: 46). Es wird nicht über eigenes Versagen gesprochen, sondern nur über ihre
Erfolge und was sie erreicht haben.
Die drei Manager geben sich wettbewerbsfreudig und bereit Risiken einzugehen. Sie
sind auch dazu in der Lage schnell und dynamisch zu handeln. So analysiert Veksel-
berg zum Beispiel, dass Sulzer viel zu langsam ins Auslandsgeschäft einsteigt und
eine zu konservative und risikolose Strategie fährt. Er meint dazu: „Ja, ich bin ein
anderes Tempo gewohnt“ (Barmettler 2010: 77). Schloter zeigt den Wettbewerbs-
charakter auch durch seine Teilnahme an der „Patrouille des Glaciers“, einem der
härtesten Bergläufen der Welt.
Sie sehen sich selbst als Kosmopoliten, die auf der ganzen Welt zu Hause sind.
Vasella erzählt von Vorträgen bei den Young Leaders in New York, Vekselberg pendelt
zwischen der Schweiz und Russland und Schloter arbeitet drei Tage pro Woche in
Italien für ein Swisscom Auslandsgeschäft. Ebenso zeigen sich alle vorurteilsfrei
gegenüber anderen Staaten und Nationalitäten und betonen die Wichtigkeit der inter-
nationalen Tätigkeiten ihrer Firmen und befürworten Multikulturalismus in ihren Teams.
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 39
Die drei Manager verweisen in ihren Interviews auf ihre Kinder. So zeigt sich Vasella
als guter Vater der seinen Kindern die Arbeit zu erklären versucht und Vekselberg
wollte gar fast seinen Auslandsfirmensitz in die Nähe der Colleges seiner Kinder in den
USA verlegen. Bei Carsten Schloter sind sie zumindest in der Infobox erwähnt. Dies
zeigt, dass ihre Identität auch über Vaterschaft, sorgendes Elternteil und die Hetero-
sexualität konstruiert wird.
Damit lassen sich folgende Identitätskonstruktionen als vorherrschender Typus der drei
Manager aus den drei untersuchten Interviews bilden, nämlich den des wir-bezogenen,
teamorientierten, klassenbewussten, besser gestellten, gesetzestreuen, sozialen, wohl-
standsschaffenden, risikobereiten, wettbewerbsorientierten, kosmopolitischen, an-
packenden (Macher), erfolgreichen, heterosexuellen, kinderhabenden Managermann.
4.3 Ebene symbolische RepräsentationAlle Manager betonen jeweils, dass ihr geschäftliches Handeln nur zum Wohle und
Erfolg des Konzerns sei und auch dem Wohl der Angestellten und der ganzen Gesell-
schaft diene. Vekselberg begründet seine Investments in Schweizer Firmen:
„Es geht nicht um Portfolio-Umschichtungen, sondern um Synergien. Die Investitionen in Russland und Europa sind komplementär. Durch einen grossen Solarauftrag konnten wir zum Beispiel sowohl OC Oerlikon als auch ein Projekt in Russland stärken“ (Barmettler 2010: 76).
Regulierungen werden abgelehnt, die Firmen sollen so weit wie möglich frei handeln
können und die Märkte gestärkt werden. Dies führe zu zusätzlichen Vorteilen für alle.
Schloter meinte zum Eingreifen der Wettbewerbskommission gegen eine Fusion der
Swisscom Konkurrenten:
„Es ist traurig, dass man zum Schluss kommt: Wir schwächen jetzt mal alle Marktteilnehmer in gleichem Masse, dann kommt es schon gut. Stattdessen sollte sichergestellt werden, dass in diesen Markt noch mehr investiert wird und noch mehr Dynamik entsteht“ (Kowalski 2010: 46).
Selbst bei Problemen wie der zunehmenden Lohnschere in einigen Unternehmen sol-
len vor einer staatlichen Regulierung zuerst Firmen eigene Lösungen gesucht werden
(Ebd.: 47).
Oft wird die Alternativlosigkeit von wirtschaftlichen Entscheiden dargestellt und es wird
begründet, dass es gar nicht anders geht. So begründet Vasella beispielsweise, dass
es bei Problemen der Konkurrenzfähigkeit oder bei schlechten Ergebnissen nur eine
Möglichkeit gibt: „Dann ist der Personalabbau keine Option, sondern eine Notwendig-
keit“ (Lüchinger und Pfenniger 2005: 102). Sie alle betonen die Nachhaltigkeit ihres
Handelns und dass nicht nur die Quantität wichtig sei, sondern auch die Qualität der
Arbeit und Investments. Damit begründen sie ihr Bild als „gute“ Manager und wehren
sich gegen den Diskurs der „Abzocker“, welcher die Manager in Verruf brachte.
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 40
Schliesslich wird oft auf die eigene positive Leistung oder die Leistung des Unterneh-
mens während ihrer Führerschaft verwiesen, um ihr Handeln und ihre Identität zu
rechtfertigen. Vasella verweist in seinem Interview beispielsweise auf den von ihm und
seiner Führungscrew erzielten hohen Marktanteil und die positive langfristige Perfor-
mance von Novartis (Ebd.: 103). Schloter weist auf den „positiven Wertbeitrag für die
Swisscom-Aktionäre“ durch seine Fastweb Geschäfte hin und zeigt sich selbst in kriti-
sierten Geschäften als erfolgreicher Manager (Kowalski 2010: 46). Vekselberg macht
auf seine 200 000 Mitarbeiter aufmerksam, welche er mit seinen erfolgreichen Investi-
tionen beschäftigt, und auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der russischen Regie-
rung (Barmettler 2010: 74f).
Um diese symbolischen Repräsentationen zu verstehen, ist der Zuzug weiterer Mate-
rialien erforderlich. Für die folgenden Abschnitte wurde Literatur aus dem Theorieteil
verwendet (Boltanski und Chiapello 2006; Degele 2008). Mit dieser Literatur wird
schnell klar, dass es sich dabei um bekannte Werte, Ideologien und Rechtfertigungen
handelt: Die gemachten Aussagen der Spitzenmanager entsprechen dem aktuellen
Zustand des kapitalistischen Geistes. Dieser Geist passt sich je nach struktureller
Grundlage oder Kritik am Kapitalismus an, um dem Kapitalismus die nötige Rechtfer-
tigung zu geben.
Eine klassische Rechtfertigungsstrategie ist es, die kapitalistische Akkumulationslogik
als naturgegeben anzunehmen. Der Markt und die kapitalistische Handlungslogik
bringt gemäss diesem Geist immer die besten Lösungen hervor. Regulierungen sind
dabei nur störend. Durch das kapitalistische System wird für alle das beste Ergebnis
produziert und es nützt allen, der Gesellschaft und den Arbeitnehmenden in den Betrie-
ben. Der kapitalistische Geist nimmt aktuelle Kritiken auf und passt sich an. Deshalb
grenzen sich die Manager von gesetzesbrecherischen und habgierigen Managern ab.
Denn deren Verhalten ist in die Kritik gekommen und somit die Rechtfertigung des
kapitalistischen Systems. Deswegen stellen sie sich als sozial und nachhaltig dar im
Gegensatz zu den in Verruf gekommenen Managern. Das letzte Element des kapitalis-
tischen Geistes, welches hier ebenfalls beobachtet werden kann, ist die Meritokratie.
Ungleichheiten und Erfolge werden durch die eigenen Leistungen gerechtfertigt. Der
Status der Manager kann somit gerechtfertigt werden, aber auch die Geschäfte der
Firma.
Keine direkten Aussagen auf der Repräsentationsebene lassen sich zur Familie oder
den Geschlechterrollen finden. Nur Bezüge zu Freundschaften und Netzwerken sind
auffindbar. Diese seien wichtig, um die Kultur und die Beziehungsnetzwerke in anderen
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 41
Ländern zu begreifen und so wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das Fehlen von Aussa-
gen auf der Repräsentationsebene zu Frauen, Kindern und Geschlechterrollen kann
aber ebenfalls als oft beobachtete natürliche Legitimation verstanden werden. Da das
Kinderhaben, die Heterosexualität und die Ehefrauen als normal gelten, kann die Ver-
mutung gemacht werden, dass diese als natürlich angenommen werden. Deshalb
könnten auch das Fehlen von Aussagen damit erklärt werden.
4.4 Ebene (Sozial)-StrukturEine der stärksten Strukturen, auf die sich die Interviewten beziehen, ist die Globali-
sierung oder besser gesagt die globalisierte Wirtschaftsordnung. Dies zeigt sich in den
Interviews einerseits durch die zahlreichen Verweise auf Märkte und Konkurrenz aus-
serhalb der Schweiz. Anderseits durch die Mobilität, welche sie selbst in ihrem Leben
erfahren. Ebenfalls sollen die Unternehmen der Globalisierung angepasst werden, wie
beispielsweise Vekselberg ausführt: „Ich will eine internationale Kultur bei Renova
schaffen, will Erfahrungen, Standards, Know-how und Managementideen aus verschie-
denen Ländern zusammenbringen“ (Barmettler 2010: 77).
Nahe bei der Globalisierung stehen die Verweise zur Marktwirtschaft und dem damit
verbunden starken Konkurrenzdruck. Die Marktwirtschaft wird als Grundsystem der
Ordnung innerhalb der Wirtschaft angesehen. Neu dabei ist, dass dieses System glo-
bal einen hegemonialen Status innehat. Daraus und aus der Logik der Marktwirtschaft
entsteht für die Unternehmen ein starker Konkurrenzdruck in dem sie sich behaupten
müssen. Als Beispiel dient die Entwicklung in der Pharmabranche, welche Vasella
anführt: „In der Vergangenheit ist pro Jahr ein grosses Unternehmen durch Fusion oder
Übernahme verschwunden. Der Konsolidierungsprozess hängt mit dem Druck […]
zusammen“ (Lüchinger und Pfenniger 2005: 103). Dies zeigt, wie hart der inter-
nationale Konkurrenzkampf ist und unter welchem Druck die Manager stehen. Als spe-
zifische Form der Wirtschaft respektive von Märkten werden der Aktienmarkt und die
Investitionen erwähnt. Auf diese beziehen sich die Manager mehrfach. Der Aktienmarkt
dient dabei als Indikator, wie gut es dem Unternehmen geht und wie der Manager gear-
beitet hat. Die Investitionen dienen dabei als wichtige Indikatoren für das Wohl der
Unternehmen und der gesamten Wirtschaft. Carsten Schloter meint zum Erfolg der
Liberalisierung der Telekommunikationsbranche: „Es gibt zwei Kriterien, an denen man
den Erfolg […] messen kann: die Preise für die Endkunden und das Investitionsvolu-
men pro Einwohner. [… Hier] gehört die Schweiz zu den Ländern mit den weltweit
höchsten Investitionen pro Kopf“ (Kowalski 2010: 44).Der Erfolg der Liberalisierung
wird anhand der getätigten Investitionen gemessen, da diese gemäss der kapitalis-
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 42
tischen Lehre positiv für die Branche und das Unternehmen sind.
Diverse Bezüge zur Struktur finden sich anhand von erwähnten Gesetzen und staat-
lichen Regulierungen. Die Manager orientieren sich bei ihren Handlungen und den
unternehmerischen Tätigkeiten an den bestehenden Gesetzen, die den erlaubten
Rahmen ihrer Tätigkeit vorgeben. Dass die Gesetze den Handlungsrahmen für die
Manager setzen, zeigt beispielsweise die Aussage von Vekselberg: „Wir folgen immer
und überall den Gerichtsentscheiden“ (Barmettler 2010: 76). Dies zeigt, dass die
Manager selbst wenn sie in Konflikt mit Gesetzen gekommen sind, alles dafür geben in
der Öffentlichkeit als gesetzestreue Bürger dazustehen und sich dafür an den
Gesetzen und Urteilen orientieren.
Bei allen Interviews, respektive den Infoboxen finden sich Bezüge zu Bildung. Alle drei
Manager haben eine Ausbildung an einer Universität absolviert.
Sämtliche Manager verweisen auf die Bedeutung von bestehenden Netzwerken
und/oder Freundschaften. Für Vekselberg sind beispielsweise die Freundschaften zu
russischen Spitzenpolitkern wichtig und die fehlenden Netzwerke in der Schweiz ein
Problem. Schloter begründet das lange Festhalten an einem Mitarbeiter, der in Italien
in den Medien des Betruges beschuldigt wurde: „Es war uns wichtig, sein Netzwerk
nicht zu verlieren. (Kowalski 2010: 44). Sämtliche erwähnte Netzwerke und alle
Freundschaften sind zwischen Männer. Eine Kombination zwischen Netzwerk und
Familie zeigt sich bei Vasella in der Infobox: „Vasella ist verheiratet mit der Nichte des
langjährigen Sandoz Lenkers“ (Lüchinger und Pfenniger 2005: 100). Der Name des
Onkels wird danach erwähnt, auf sie wird jedoch nicht weiter eingegangen.
Die aufgezeigten Strukturen lassen sich mit der Zuhilfenahme von zusätzlicher Litera-
tur (Osterhammel und Peterson 2006; Mankiw 2004; Meuser 2010) aus der Theorie in
die Herrschaftssysteme Kapitalismus und Patriarchat einordnen. Die Globalisierung
beschreibt den Prozess, in dem sich Kapitalismus und Wirtschaftstätigkeit entwickeln
und ihnen einen immer stärkeren globalen Rahmen gibt. Unter Globalisierung ist zu-
dem der Vorgang der weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftliche Verflechtung
und Verdichtung zu verstehen (Osterhammel und Peterson 2006: 7-9). Die freie Markt-
wirtschaft und der daraus resultierende Konkurrenzdruck sind inzwischen globale Wirk-
lichkeit und nehmen stets zu. Zum System des globalen Kapitalismus gehören die
Aktienmärkte, welche den angenommen Wert eines Unternehmens wiedergeben soll-
ten. Gleichzeitig findet ein internationaler Kampf um Investitionen statt, in welchem sich
die Unternehmen behaupten müssen. Das Ganze dient dem höheren Ziel, weiteres
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 43
Kapital akkumulieren zu können. Die einzigen Beschränkungen bilden nach wie vor
staatliche Regulierungen, welche sich in Gesetzen niederschlagen. Diese halten den
Kapitalismus in Schranken. Die inzwischen verflochtene globale kapitalistische
Wirtschaftsstruktur gibt den Managern vor, in welchem Umfeld sie ihr Unternehmen
führen müssen und was sie erwartet. Nur wer sich in dieser Struktur behauptet, kann
nach „oben“ kommen und Erfolg haben.
Auch beim Herrschaftssystem Patriarchat lassen sich weitere Strukturen einordnen.
Die Netzwerke und Freundschaften dienen als homosoziale Räume, in denen wichtige
Entscheide gefällt werden. Durch ihre Homogenität helfen sie bei der Sicherstellung
des Status Quo, da nur Insider von ihnen profitieren können. Die „normale“ Kleinfamilie
und Heterosexualität sind die vorherrschenden Formen, in denen sich die Männlichkeit
bewegt. Sie sind Voraussetzung um anerkannt zu werden und in die homosozialen
Räume zu kommen, welche wiederum in der kapitalistischen Sphäre zu Erfolg führen.
4.5 Wechselwirkungen zwischen den EbenenIm Folgenden sollen nun einige der wichtigsten Wechselwirkungen zwischen den
Ergebnissen der einzelnen Ebenen Identität, Repräsentationen und Struktur dargestellt
werden. Dies ist der letzte nötige Schritt um die hegemoniale Managermännlichkeit
aufzuzeigen, welche in der Bilanz reproduziert wird.
Ein erster Blick gilt den Wechselwirkungen zwischen Struktur und Identität. Die risiko-
und wettbewerbsorientierte Identität der Manager ist in deutlicher Wechselwirkung mit
dem globalen Wettbewerb und dem Konkurrenzdruck, in denen sie sich mit ihren
Unternehmen befinden. Nur ein Manager, welcher weiss wie der Wettbewerb läuft und
genügend Risiko eingeht, kann dort mit seinem Unternehmen überleben. Das Kosmo-
politische scheint stark mit der Globalisierung in einer gegenseitigen Wirkung zu
stehen. Ein Firmenchef kann heute in einem transnationalen Unternehmen nicht als
rein lokal verwurzelter und lokal agierender Manager handeln, da er auf diese Weise
untergehen würde. Das Gleiche zeigt sich beim Bild des „Machers“. Es ist ein harter
globaler Kampf und nur die Starken, die „Macher“ können sich in so einem Kampf
durchsetzen. Ebenfalls lässt sich sagen, dass sich die Gesetzestreue direkt auf die
aktuelle Gesetzgebung bezieht. Auch lassen sich Wechselwirkungen zwischen Identi-
tätskonstruktionen wie Elternteil und Heterosexualität und den patriarchalen Strukturen
feststellen. Die heterosexuelle Partnerschaft mit Kindern bildet strukturell den Normal-
fall. An diesem Bild orientieren sich die Identitätskonstruktionen der Manager. Diese
Identität ist nötig um in exklusive homosoziale Räume respektive Netzwerke zu
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 44
kommen. Dies stärkt die Geschlechtsidentität und die Erfolgsaussichten der Manager.
Ein sehr vielseitiges Bild von Wechselwirkungen lassen sich bei den Ebenen Identität
und Repräsentationen finden. Hier wird auf die Beziehung der Geschlechtsidentität und
den vermuteten natürlichen Legitimation dieser eingegangen. Da diese Identität der
Norm und vorherrschenden Werten entspricht und als natürlich angenommen wird, ist
es für die Manager auch klar, dass sie Kinder haben müssen und dies nicht ausführlich
begründen. Ebenso zeigt sich dies in der Nichterwähnung ihrer Frauen, da es für sie
normal zu sein scheint eine Frau zu haben. Spannend ist die Übernahme der eigentlich
ursprünglich „weiblichen“ Identitätskonstruktion des Teamplayers. Alle Manager beto-
nen einer zu sein. Diese Identität korreliert mit der Repräsentationsebene, mit dem
neuen Geist des Kapitalismus. Es kann angenommen werden, dass diese aufgrund
von Kritiken erfolgte. Daraufhin hat sich der kapitalistische Geist angepasst und ein
neues Idealbild für Manager geschafft: Das des Teamorientierten-Managers.
Das gleiche Zusammenspiel lässt sich bei der Identität der Gesetzestreue beobachten.
Diese ist ebenfalls ein Ergebnis der Kritik am Kapitalismus und deswegen gehört die
Gesetzestreue neu zur Identität der Manager. Eine weitere klare Wechselwirkung findet
sich zwischen dem Identitätstypus des erfolgreichen Managers und der Meritokratie.
Erfolg und Leistung gehören zu den wichtigsten Rechtfertigungen auf der Repräsenta-
tionsebene um Ungleichheiten zu erklären. Ein Manager kann sich nicht als gutgestellt
sehen, ohne dies mit seiner Leistung zu rechtfertigen. Ebenso verhält es sich mit dem
Typus des sozialen, des wohlstandsbringenden Managers. Diese Identitätskonstruktion
korreliert mit der als natürlich empfundenen Überlegenheit und Wohlstandsverspre-
chen des Marktes. Es gilt als Naturgesetz, dass die kapitalistische Produktionsweise
Wohlstand für alle bringt. Da die Manager diese Repräsentation haben, sehen sie sich
selbst als sozial und wohlstandsbringend oder suchen sich diese Rechtfertigung um ihr
Handeln und ihren eigenen Typus zu legitimieren.
Schliesslich zeigen sich ebenfalls zwischen den Ebenen Struktur und Repräsentation
Wechselwirkungen. In der Sozialstruktur zeigt sich, dass Männer grossmehrheitlich
heterosexuell leben, verheiratet sind und Kinder haben. Dass sich dies so entwickelt
hat, hängt mit der empfundenen Natürlichkeit dieser Norm zusammen, welche die Re-
präsentationen aufzeigen. Diese Korrelation zeigt sich auch bei den drei untersuchten
Managern. Auch im Bereich Kapital lassen sich zwischen den beiden Ebenen Wechsel-
wirkungen beobachten. Der zunehmend globale kapitalistische Markt entspricht dem
Ideal, welches der aktuelle kapitalistische Geist vorgibt. Es wird von einem Primat der
Wirtschaft ausgegangen und dem Grundsatz, dass der Markt die Probleme besser
Ergebnisse Mehrebenenanalyse 45
lösen kann als der Staat. Dadurch wird einerseits die wirtschaftliche Globalisierung
beflügelt und anderseits dient das Primat der Wirtschaft als Rechtfertigungsgrund. Es
zeigt sich ebenfalls eine Wechselwirkung zwischen den staatlichen Regulationen und
dem kapitalistischen Geist. Wenn die Kritik am Kapitalismus, respektive an den
Managern zu stark wird, wie es beispielsweise bei der Lohndebatte der Fall ist, können
die Gesetze angepasst werden. Dies zeigt zum Beispiel die Reaktion von Carsten
Schloter. Er fordert, falls es keine zusätzliche Selbstregulierung der Wirtschaft in der
Lohnfrage gibt, staatliche Gesetze zu Regulierung des Problems. Dies, da soziale
Ungleichheiten auf die Dauer gefährlich werden können (Kowalski 2010: 47). Da der
Diskurs aber noch nicht so weit ist, fordert er zuerst eine wirtschaftliche Selbst-
regulation, wie es der aktuelle kapitalistische Geist vorgibt.
Es kann also festgestellt werden, dass es zwischen allen Ebenen und den Kategorien
(Kapitalismus oder Patriarchat) Wechselwirkungen gibt.
Fazit 46
5 FazitNach der Analyse der aktuellen Theorien und der Untersuchung der drei Interviews aus
der Zeitschrift Bilanz lässt sich eindeutig feststellen, dass es eine hegemoniale
Managermännlichkeit gibt, welche bei den mächtigen Managern zum Vorschein tritt.
Der hegemoniale Managermann ist als ein Idealtypus von Mensch zu verstehen, der in
der heutigen durch Kapitalismus und Patriarchat geprägten Welt zu den Gewinnern, zu
den Mächtigen gehört. Die untersuchten Manager stellen beim „Oben-“ und „Unten“-
Gegensatz der sozialen Ungleichheit das „Oben“ dar. Diese männlichen, mächtigen
Manager verfügen nach Pierre Bourdieu über einen spezifischen Klassen- und
Geschlechterhabitus, welcher sie prägt und ihr Handeln beeinflusst. Im Kern dieses
Habitus steht die hegemoniale Männlichkeit, welche Raewyn Connell als theoretisches
Konzept eingeführt wurde. Dieser spezifische Habitus der mächtigen Männer lässt sich
als hegemoniale Managermännlichkeit bezeichnen. Bei den Managern vereint sich der
Typus des herrschenden Herrschenden in der Klassenstruktur von Bourdieu und die
hegemonialen Männlichkeit nach Connell. Die hegemoniale Managermännlichkeit
besteht aus Identitätskonstruktionen, symbolischen Repräsentationen und gesellschaft-
lichen (Sozial)-Strukturen, welche untereinander in Wechselwirkungen stehen. An
dieser hegemonialen Managermännlichkeit orientieren sich die anderen Personen und
versuchen durch das Erreichen einer solchen hegemonialen Managermännlichkeit den
sozialen Aufstieg zu schaffen. Diese hegemoniale Managermännlichkeit wird in den
Medien reproduziert. Benachteiligte und Aufstiegsinteressierte erhalten so eine Art An-
leitung um den sozialen Aufstieg zu schaffen.
Mit einer angepassten Variante der Mehrebenenanalyse wurden drei Interviews mit
Daniel Vasella, Viktor Vekselberg und Carsten Schloter aus der Wirtschaftszeitung
Bilanz analysiert. Mit dieser Analyse und der betrachteten Theorie lässt sich die
Forschungsfrage: Welcher Idealtypus von hegemonialer Managermännlichkeit wird in
der Rubrik „Gespräche“ im Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz in Bezug auf die
Sozialstruktur, die symbolische Repräsentation, die Identitätskonstruktion und ihre
Wechselbeziehungen untereinander reproduziert, nun beantworten:
Bei der Ebene Identitätskonstruktion findet sich ein gemeinsamer Typus des wir-bezo-
genen, teamorientierten, klassenbewussten, besser gestellten, gesetzestreuen,
sozialen, wohlstandsschaffenden, risikobereiten, wettbewerbsorientierten, kosmopoli-
tischen, anpackenden (Macher), erfolgreichen, heterosexuellen, kinderhabenden
Managermannes.
Fazit 47
Bei der Ebene symbolische Repräsentation finden sich klare Bezüge zum aktuellen
kapitalistischen Geist. Dieser besteht aus mehreren Elementen. Das meritokratische
Denken ist als Rechtfertigung stark vertreten. Es gilt weiter als Naturgesetz, dass die
kapitalistische freie Wirtschaftsordnung Wohlstand für alle bringt. Ebenfalls werden die
sozialen Unterschiede als normal und natürlich wahrgenommen. Zudem gehört zur auf-
genommenen Kapitalismuskritik eine klare Ablehnung von gesetzesbrecherischen und
gierigen Praktiken von einzelnen Managern, für welche der persönliche Reichtum wich-
tiger war als das Wohl der Firma und der Gesellschaft. Es besteht die starke Vermu-
tung, dass, neben dem kapitalistischen Geist, auch die geltende Geschlechterordnung
und die Heterosexualität als natürlich angenommen werden.
Bei der Ebene (Sozial-)Struktur finden sich im Herrschaftssystem Kapitalismus starke
Bezüge zum globalen freien Markt. Der Konkurrenzdruck wird immer stärker, die
Aktienmärkte und Investitionen bestimmen über das Wohlergehen der Firmen. Nur die
starken Unternehmen überleben im globalen Wettbewerb. Gesetze bilden einen
regulatorischen Rahmen, an denen sich die Manager halten müssen. Zudem sind die
Netzwerke und Kontakte entscheidend um auf den Märkten Erfolg zu haben. Beim
Herrschaftssystem Patriarchat finden sich starke Bezüge zur heterosexuellen Ehe und
zu Elternschaft. Diese sind auch in der Statistik die häufigste Form des Zusammenle-
bens. Zudem zeigt sich vereinzelt die Bedeutung von männlichen Netzwerken und
homosozialen Räumen.
Es lassen sich zwischen allen Ebenen Wechselwirkungen beobachten. So beeinflusst
der globale Markt beispielsweise die kosmopolitische Identität der Manager oder der
Konkurrenzdruck ihre Wettbewerbsorientierung und Risikobereitschaft. Zwischen den
Ebenen Repräsentation und Identität zeigt sich, dass verschiedene Identitätskonstruk-
tionen wie Gesetzestreue mit der Ausprägung des kapitalistischen Geistes aufgrund
der aktuellen Kritik am Kapitalismus in Wechselwirkung stehen. Ebenfalls zeigen sich
Wechselwirkungen zwischen Repräsentation und Struktur. So gilt Ehe und Hetero-
sexualität als natürlich. Sie ist die meist gelebte Form des Zusammenlebens. Es gibt
ebenfalls Wechselwirkungen zwischen den Kategorien Kapitalismus und Patriarchat.
So gilt die Risikobereitschaft als männliche Zuschreibung, gehört bei den Ergebnissen
hier aber eher zur kapitalistischen Ausprägungen.
Es ist somit gelungen einen Idealtyp der hegemonialen Managermännlichkeit zu be-
schreiben. Im Folgenden möchte ich mich kritisch mit den erzielten Resultaten und der
Arbeit auseinandersetzten. Die Resultate, wie die hegemoniale Managermännlichkeit
aussieht, entsprechen mehr oder weniger den aus der Theorie erwarteten Resultaten.
Fazit 48
Sie zeigen eine Verknüpfung zwischen Kapitalismus und Patriarchat und dem
gebildeten Idealtypus der hegemonialen Managermännlichkeit. Die Ergebnisse zeigen,
was als „normal“ in der Gesellschaft gilt und wie die Mächtigen „ticken“. Es war auch zu
erwarten, dass ein Idealtyp gefunden wird, welcher gesellschaftlich „zu oberst“ ist und
an dem sich alle anderen orientieren.
Das Fehlen einiger von der Theorie erwarteten Resultate bedarf zusätzlicher Erklä-
rung. So ist der Bezug zu Ausbildung, Netzwerken und den homosozialen Räumen, wo
die hegemoniale Managermännlichkeit gebildet wird, recht gering ausgefallen. Dies
erstaunt, da erwartet wurde, dass diese in den Interviews respektive in der hegemonia-
len Managermännlichkeit stärker auftreten würden. So wurde die Bildung bei der
Ebene Struktur nur im geringen Ausmass vorgefunden und es gab von ihr aus keine
eindeutige Wechselwirkung mit anderen Ebenen.
Ausserdem waren auch die Befunde, welche eindeutig im Bereich Männlichkeit, also
Gender, zuzuordnen sind, weit unter den Erwartungen. Dies führt generell zu einer
Schwächung der Resultate, da angenommen wird, dass die hegemoniale Männlichkeit
den Kern des spezifischen Habitus ausmacht. Dafür waren die Ergebnisse, welche die
Seite Kapital betreffen, umso stärker und erlauben hier, eine recht umfassende Darstel-
lung. Zudem konnte bei der Auswertung nicht stark in die Tiefe gegangen werden. Die
untersuchten Aussagen wurden „nur“ mit zusätzlicher Literatur analysiert. Damit blei-
ben allfällig verdeckte Sinnstrukturen im Verborgenen und es besteht die Gefahr einer
zu schnellen reinen Fallwiedergabe statt dem Aufdecken von Neuem.
Die Ergebnisse sollten ausserdem nicht generalisiert werden. Dafür ist die Zahl der
analysierten Interviews zu klein und es fehlen als Vergleich andere (Ideal)-Typen von
Männern und Frauen. Es wurden drei Interviews in einer Zeitschrift analysiert, die
gefundene hegemoniale Managermännlichkeit entspricht also dem vorgefunden Typus
dieser drei Manager in dieser Zeitschrift. Dank der Ausstrahlungskraft der Bilanz und
der Bedeutung der drei Manager kann aber von einer gewissen Breitenwirkung der re-
produzierten hegemonialen Managermännlichkeit ausgegangen werden. Die Resultate
sind zudem eine Momentaufnahme. Ob sich die hegemoniale Managermännlichkeit im
Wandel befindet oder ob die Finanzkrise Einfluss hatte, lässt sich nicht sagen.
Viele der aufgedeckten Schwächen der Resultate hängen direkt mit dem Aufbau der
Arbeit zusammen. Da es sich bei der untersuchten Bilanz um ein Wirtschaftsmagazin
handelt, musste von vornherein angenommen werden, dass die Seite Kapitalismus in
der Analyse zu mehr Resultaten führen würde. Dies wäre beispielsweise in einem
Fazit 49
Interview über Familie in der Schweizer Illustrierten wohl anders ausgefallen. Zumal
verkleinerte die redaktionelle Überarbeitung der Interviews und die Ausrichtung der
Zeitschrift Bilanz die Chance auf abweichende Resultate von vornherein. Zudem bieten
je drei A4 Seiten Interviewtext aus einem Wirtschaftsmagazin nicht eine Fülle an aus-
wertbarem Datenmaterial. Die Mehrebenenanalyse bot aber eine gut strukturierte
methodische Anleitung. Mit der Methode konnten die Interviews Schritt für Schritt unter-
sucht werden, um damit die Zusammenhänge zwischen Kapitalismus und Patriarchat
aufzudecken. Die geringe Anzahl von Interviews und ihre Auswahl lässt sich ebenfalls
kritisieren, da zusätzliche Interviews mehr Informationen gegeben hätte.
Nun soll aufgezeigt werden wie die Forschung einerseits verbessert werden könnte
und wo anderseits weiter geforscht werden sollte. Ein erster spannender Schritt wäre
sicherlich, die Anzahl der untersuchten Manager auszuweiten. Je mehr Manager und je
verschiedener diese sind, desto eher würden sich Aussagen zu einer generellen hege-
monialen Managermännlichkeit machen lassen. Zudem wäre der Blick auf andere
Gruppen wie zum Beispiel ArbeiterInnen, KleinbürgerInnen und MigrantInnen inter-
essant. Eine Untersuchung ihrer Klassen- und Geschlechterhabitus, unter Berücksichti-
gung der gesellschaftlich vorherrschenden hegemoniale Männlichkeit, würde eine Viel-
zahl von weiteren Idealtypen ergeben und das Ausarbeiten eines Leittypus wie der
hegemonialen Managermännlichkeit vereinfachen. Ausserdem wäre eine zeitlich ver-
schobene Betrachtung interessant. Mit Untersuchungen von mächtigen Managern und
anderen einflussreichen Personen über eine längere Zeitspanne könnte die Wandlung
der hegemonialen Managermännlichkeit dargestellt werden. Könnte man damit aufzei-
gen, was zu welcher Zeit als „normal“ galt und was als „abnormal“. Auch würde eine
solche Untersuchung zeigen, welche Personengruppen zu welcher Zeit von den sozia-
len Ungleichheiten profitierten.
Neben der Ausweitung oder Änderung der untersuchten Personen, gilt dasselbe auch
für das Datenmaterial. So liessen sich beispielsweise andere Zeitschriften, TV--
Beiträge, Radiointerviews etc. analysieren um an mehr Informationen zu kommen.
Ebenso könnte so erforscht werden, ob es gesellschaftlich eine hegemoniale Manager-
männlichkeit gibt, welche überall reproduziert wird. Eine eigene Erhebung von Daten,
beispielsweise durch biographische Interviews würde zudem zu zusätzlichem, unbear-
beitetem Material führen und es erlauben den Fokus der Interviews direkt auf die For-
schungsfragen zu legen.
Ebenfalls könnte mit den Auswertungsmethoden variiert werden. Ausser der hier ver-
wendeten Mehrebenenanalyse wäre beispielsweise zusätzliche Erkenntnisse durch die
Fazit 50
Objektive Hermeneutik zu gewinnen; insbesondere um damit verdeckte Sinnstrukturen
aufzudecken. Gerade bei der Ebene Repräsentationen wäre auch eine Diskursanalyse
sehr aufschlussreich, da sie für diese Ebene erschaffen wurde. Es könnten zudem in
die intersektionalen Untersuchungen noch weitere Ungleichheitskategorien betrachtet
werden. Mindestens die Kategorie „Rasse“ empfiehlt sich, doch sind auch weitere wie
Körper, Alter, Weltanschauung etc. denkbar.
Im Bereich der Theorie könnte sowohl der Habitus, als auch die hegemoniale
Managermännlichkeit umfassender hergeleitet und weitere Ausprägungen beschrieben
werden. Zudem könnten zusätzliche Forschungsergebnisse hinzugezogen werden.
Auch könnte der Bereich Kapitalismus in der Theorie weiter ausgebaut werden. Viele
Theorien und Texte in dieser Arbeit stammen aus der Geschlechterforschung. Zudem
könnte der Theorieteil um weitere Theorien der Inter- oder Transdependenzen ergänzt
werden.
Eine weitere spannende Forschung würde sich durch einen Wechsel der Fragestellung
ergeben. So könnte das Forschungsinteresse von „was“ die hegemoniale Manager-
männlichkeit ist zu andern Bereichen hin verlagert werden. Wünschenswert sind Unter-
suchungen zu „wie und wo“ diese hegemoniale Managermännlichkeit konstruiert wird
und zu „warum“ sie existiert. Schliesslich könnte die Forschungsfrage: „Wie sich die
hegemoniale Managermännlichkeit ändern oder abschaffen lässt“, untersucht werden.
Mit diesen weitergehenden Forschungsfragen, zusätzlichem Datenmaterial, diversen
Theorien und Methoden liesse sich dann das Grundinteresse am Zusammenspiel von
Kapitalismus und Patriarchat bei sozialen Ungleichheiten weiter verstehen.
Bibliographie 51
BibliographieBarmettler, Stefan. 2010. „Das Gespräch mit Viktor Vekselberg. Mit Merz hat es nicht
geklappt.“ In Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz Nr. 12 vom 18. Juni 2011,
S. 74 – 77.
BASS, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien. 2010. Analyse der Löhne von
Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2008. Bern: BASS.
Becker-Schmidt, Regina. 1998. Trennung, Verknüpfung, Vermittlung: zum feminis-
tischen Umgang mit Dichotomien. S. 84-125. In Kurskorrekturen. Feminismus
zwischen Kritischer Theorie und Postmoderne, herausgegeben von Axeli-Knapp,
G. Frankfurt am Main und New York: Campus Verlag.
Bereswil, Mechthild, Meuser Michael, und Scholz Sylka. 2007. Männlichkeit als Gegen-
stand der Geschlechterforschung. S. 7-21. In Dimension der Kategorie
Geschlecht: Der Fall Männlichkeit, herausgegeben von M. Bereswil, M. Meuser
und S. Scholz. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.
BfS, Bundesamt für Statistik. 2010. Hauptverantwortung für die Hausarbeit in Paar-
haushalten. 2007. Neuchâtel: BfS.
Bohn, Cornelia und Hahn Alois. 2003. Pierre Bourdieu (1930-2002). S. 252-271. In
Klassiker der Soziologie 2. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu, herausgege-
ben von D. Kaesler. München: Verlag C.H. Beck.
Bourdieu, Pierre. 2005. Die männliche Herrschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag.
Bourdieu, Pierre. 1999. Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag.
Bourdieu, Pierre. 1997. Die männliche Herrschaft. S. 153-217. In Ein alltägliches Spiel.
Geschlechterkonstruktionen in der sozialen Praxis, herausgegeben von I. Dölling
und B. Krais. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Bourdieu, Pierre. 1987. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteils-
kraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.
Bourdieu, Pierre. 1976. Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologische Grund-
lage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Boltanski, Luc und Chiapello Eve. 2006. Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz:
UVK Verlagsgesellschaft mbH.
Bibliographie 52
Brandes, Holger. 2004. Hegemoniale Männlichkeit und männlicher Habitus. Thesen zu
Connell und Bourdieu. 3. AIM-Gender Konferenz, 24.-26.6.2004. Stuttgart.
Breger, Claudia. 2009. Identität. S. 47-65. In Gender@Wissen. Ein Handbuch der
Gender Theorien, herausgegeben von C. Braun und I. Stephan. Köln etc.: Böhlau
Verlag.
Butler, Judith. 1991. Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Connell, Raewyn. 2008. Gender. Cambridge: Polity Press.
Connell, Raewyn. 2006. Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkei-
ten. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Connell, Raewyn. 2004. „Ich warf Bälle wie ein Mädchen“. Schwierigkeiten mit dem
männlichen Körper. S. 281-308. In Reflexive Körper? Zur Modernisierung von
Sexualität und Reproduktion, herausgegeben von I. Lenz, L. Mense und C.
Ullrich. Opladen: Verlag Leske und Budrich.
Crenshaw, Kimberle. 1997. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist
Politics. S. 23-51. In Feminist Legal Theories, herausgegeben von Maschke, K.J.
New York: Garland Pub.
Degele, Nina und Carloine Janz. 2011. Hetero, weiß und männlich? Fußball ist viel
mehr. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Homophobie, Rassismus und
Sexismus im Fußball. Webdokument.
<http://www.fes.de/aktuell/documents2011/110608_Hetero.pdf> (zuletzt geöffnet
am 15. Juni 2011).
Degele, Nina. 2008. Gender / Queer Studies. Paderborn: Verlag Wilhelm Fink.
EKF, Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. 2011. 1. Politik / Politische
Partizipation. Bern: EKF.
Fuchs-Heinritz, Werner und König Alexandra. 2005. Pierre Bourdieu. Eine Einführung.
Stuttgart: UTB Verlag.
Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Idenity. Self and Society in the Late
Modern Age. Stanford: Stanford University Press.
Gläser, Jochen und Laudel Grit. 2009. Experteninterviews und qualitative Inhalts-
analyse. Als Instrument rekonstruierender Untersuchungen. Lehrbuch.
Wiesbaden: VS Verlag.
Bibliographie 53
Hearn, Jeffrey. 1991. Gender. Biology, Nature, and capitalism. S. 222 – 245. In The
Cambridge Companion to Marx, herausgegeben von T. Cerver. New York:
Cambridge University Press.
Hearn, Jeffrey. 1987. The Gender of Oppression. Men, Masculinity, and the Critique of
Marxism. Brigthon: Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf.
Honegger, Claudia. 2010. Die Männerwelt der Banken. Prestigedarwinismus im
Haifischbecken. S. 160-172. In Strukturierte Verantwortungslosigkeit. Berichte
aus der Bankenwelt, herausgegeben von C. Honegger, S. Neckel und C. Magnin.
Berlin: Suhrkamp Verlag.
Honegger, Claudia. 1991. Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom
Menschen und das Weib. 1750-1850. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Jagose, Annamarie. 2005. Queer Theory. Eine Einführung. Berlin: Querverlag.
Kerchner, Birgitte und Schneider Silke. 2006. „Endlich Ordnung in der Werkzeugkiste“.
Zum Potenzial der Foucaultschen Diskursanalysen für die Politikwissenschaft.
Einleitung. S. 9-32. In Foucault. Diskursanalyse der Politik. Eine Einführung,
herausgegeben von B. Kerchner und S. Schneider. Wiesbaden: VS Verlag.
Kerner, Ina. 2010. Intersektionalität. PERIPHERIE 30 (118/119): 312-314.
Klein, Thomas. 2005. Sozialstrukturanalyse. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Kolar, Regula. 2010. „Intersektionalität. Eine unverzichtbare Perspektive?“. In
genderstudies, Nr. 17 vom Herbst 2010: 3-5.
Kowalski, Marc. 2010. „Das Gespräch Carsten Schloter. Doch – ‚Ich würde es wieder
tun.‘“ In Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz, Nr. 9 vom 07. Mai 2010, S.
44-47.
Lampart, Daniel und Gallusser David, 2011. SGB-Verteilungsbericht. Webdokument.
<http://www.verteilungsbericht.ch/wp-
content/uploads/2011/04/77_Verteilungsbericht.pdf> (zuletzt geöffnet am: 15.
Juni 2011).
Lange, Ralf. 1999. Männlichkeit(en) – Macht – Management – Zur sozialen
Konstruktion von hegemonialer Männlichkeit im Management von
Organisationen. Webdokument. <www.hbshessen.de/archivseite/pol/-
GDLange.pdf> (zuletzt geöffnet am: 15. Juni 2011).
Bibliographie 54
Lüchinger, René und Silvia Pfenniger. 2005. „Das Gespräch Daniel Vasella. ‚Der Staat
ginge daran Bankrott.‘“ In Das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz, Nr. 3 vom
23. Februar 2005, S. 100-103.
Luedtke, Jens und Baur Nina. 2008. Konstruktionsbereiche von Männlichkeit. Zum
Stand der Männerforschung. S. 7-30. In Die soziale Konstruktion von Männlich-
keit. Hegemoniale und marginalisierte Männlichkeiten in Deutschland, herausge-
geben von J. Luedtke und N. Baur. Opladen etc.: Verlag Barbara Budrich.
Mäder, Ueli, Aratnam Ganga Jay und Schilliger Sarah. 2010. Wie die Reichen denken
und lenken. Zürich: Rotpunkt Verlag.
Mankiw, Gregory. 2004. Principles of Economics. Mason: Thomson South-Wester.
Marx, Karl und Engel Friedrich. 1973. Manifest der kommunistischen Partei. S. 461-
474. In Marx Engels Werke 4, herausgegeben vom Institut für Marxismus und
Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz Verlag.
Marx, Karl und Engel Friedrich. 1973. Zur Kritik der Politischen Ökonomie. S. 7-160. In
Marx Engels Werke 13, herausgegeben vom Institut für Marxismus und
Leninismus beim ZK der SED. Berlin: Dietz Verlag.
Mayring, Philipp. 2007. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Forschung.
Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Meuser, Michael. 2010. Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und
kulturelle Deutungsmuster. Wiesbaden: VS Verlag.
Osterhammel, Jürgen und Petersson Niels. 2007. Geschichte der Globalisierung.
Dimensionen. Prozesse. Epochen. München: Verlag C.H. Beck.
Oevermann, Ulrich. 2002. Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der
objektiven Hermeneutik – Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialfor-
schung. Webdokument. <http://www.ihsk.de/publikationen/Ulrich_Oevermann-
Manifest_der_objektiv_hermeneutischen_Sozialforschung.pdf> (zuletzt geöffnet
am: 15. Juni 2011).
Przyborksi, Agnes und Wohlrab-Sahr Monika. 2009. Qualitative Sozialforschung. Ein
Arbeitsbuch. München: Oldenbourg Verlag.
Schärer, Corinne. 2011. Schluss mit der Lohndiskriminierung – Mindestlohn jetzt.
Webdokument. <http://www.sgb.ch/uploaded/Texte/110308_Corinne
%20Schärer_milohn.pdf> (zuletzt geöffnet am: 15. Juni 2011).
Bibliographie 55
Schölper, Dag. 2008. Männer- und Männlichkeitsforschung. Ein Überblick.
Webdokument. <http://web.fu-
berlin.de/gpo/pdf/dag_schoelper/dag_schoelper.pdf> (zuletzt geöffnet am 15.
Juni 2011).
Schrötter, Susanne. 2002. FeMale. Über Grenzläufe zwischen den Geschlechtern.
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Schultze, Rainer-Olaf 2005. Hegemonie. S. 336-337 in Lexikon der Politikwissen-
schaft. Bd. I: A-M, herausgegeben von D. Nohlen. München: Verlag C. H. Beck.
Swedberg, Richard. 2009. Grundlagen der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS
Verlag.
Trumann, Andrea. 2002. Feministische Theorie. Frauenbewegung und weibliche
Subjektbildung im Spätkapitalismus. Stuttgart: Schmetterling Verlag.
Unia, Gewerkschaft Unia. 2011. Lohnscherenstudie 2010. Bern: Unia.
Veith, Hermann. 2008. Sozialisation. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Voss, Heinz-Jürgen. 2011. Geschlecht. Wider die Natürlichkeit. Stuttgart: Schmetterling
Verlag.
Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy. Oxford: B. Blackwell.
Walby, Sylvia. 1986. Patriarchy at work. Patriarchal and Capitalist Relations in
Employment. Cambridge: Polity Press.
Weber, Max. 1993. Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus.
Bodenheim: Athenäum Hain Hanstein Verlag.
Weeks, Jeffrey. 2003. Sexuality. London: Routledge Press.
WEMF, AG für Medienforschung. 2011. Mach Basic 2010. Zürich: WEMF.
WEMF, AG für Werbemedienforschung. 2010. MA Leader 2009. Zürich: WEMF.
Wichert, Frank. 2004. Der VorBildliche Mann. Die Konstituierung moderner Männlich-
keit durch hegemoniale Print-Medien. Münster: UNRAST Verlag.
Wilchins, Riki. 2006. Gender Theory. Eine Einführung. Berlin: Queerverlag.
Winker, Gabriele und Degele Nina. 2010. Intersektionalität. Zur Analyse sozialer
Ungleichheit. Bielefeld: Transcript Verlag.
Winker, Gabriele und Degele Nina. 2007. Intersektionalität als Mehrebenenanalyse.
Bibliographie 56
Webdokument. <http://www.tu-
harburg.de/agentec/winker/pdf/Intersektionalitaet_Mehrebenen.pdf> (zuletzt
geöffnet am: 15. Juni 2011).
Selbstständigkeitserklärung 57
Selbstständigkeitserklärung
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig verfasst
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle
Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen
wurden, habe ich in jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich
gemacht. Das Gleiche gilt auch für eventuell beigegebene Zeichnungen und
Darstellungen. Mir ist bekannt, dass ich anderenfalls ein Plagiat begangen habe, dass
dieses mit der Note 1 bestraft wird und dass ich vom Dekan einen Verweis erhalte.
Bern, 20. August 2011 Adrian Michael Durtschi